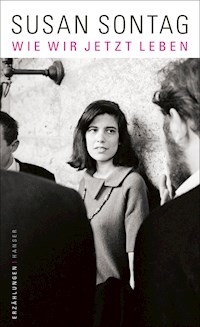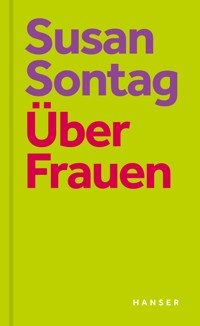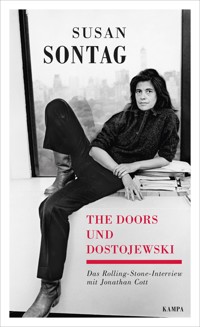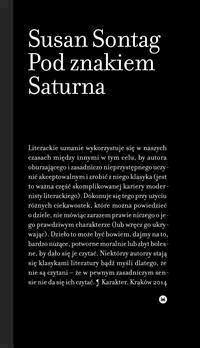Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
„Mein Leben ist mein Kapital, das Kapital meiner Imagination“, sagte Susan Sontag einmal. Ihre Tagebücher sind Spiegel dieses Selbstverständnisses, das bei ihr auch immer an die Politik geknüpft war. Zentral sind ihr Aufenthalt in Hanoi und ihr Engagement in den USA gegen den Vietnamkrieg, ihre Begegnung mit Mary McCarthy und Reisen nach China, Marokko und Israel. In den Jahren 1964 bis 1980, die geprägt sind von ihrer Auseinandersetzung mit der Kunst von John Cage, Marcel Duchamp, Jasper John und vor allem Joseph Brodsky, entstehen auch Sontags bedeutendste Bücher. In diesen Tagebüchern legt eine der außergewöhnlichsten Intellektuellen des 20. Jahrhunderts das intime Zeugnis ihrer Reifejahre ab. Die Übersetzung wurde von der Brougier-Seisser-Cleve-Werhahn-Stiftung gefördert: www.bscw-stiftung.de.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Susan Sontag
Ich schreibe, um herauszufinden,
was ich denke
Tagebücher 1964–1980
Aus dem Amerikanischen
von Kathrin Razum
Carl Hanser Verlag
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel As consciousness is harnessed to flesh. Diaries 1964–1980 bei Farrar, Straus & Giroux in New York.
Die Übersetzung wurde mit einem Stipendium des Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Der Verlag dankt der Brougier-Seisser-Cleve-Werhahn-Stiftung für die großzügige Förderung der Übersetzung sowie für Anregung und Finanzierung der Registererstellung.
www.bscw-stiftung.de
ISBN 978-3-446-24452-8
© The Estate of Susan Sontag 2012
© für das Vorwort David Rieff 2012
Alle Rechte der deutschen Ausgabe
© Carl Hanser Verlag München 2013
Satz: Satz für Satz. Barbara Reischmann, Leutkirch
Schutzumschlag: Peter-Andreas Hassiepen, München, unter Verwendung einer Fotografie © Jerry Bauer
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Inhalt
Vorwort von David Rieff
Ich schreibe, um herauszufinden, was ich denke
Tagebücher 1964–1980
Register
Vorwort
In den frühen 1990er Jahren spielte meine Mutter flüchtig mit dem Gedanken, eine Autobiographie zu schreiben. Da sie es bis dahin weitgehend vermieden hatte, direkt über sich selbst zu schreiben, überraschte mich das. »Hauptsächlich über mich selbst zu schreiben«, hatte sie einmal in einem Interview mit der Boston Review gesagt, »scheint mir ein ziemlich umständlicher Weg zu den Themen zu sein, über die ich schreiben möchte … Ich war noch nie der Ansicht, dass meine Neigungen oder meine Geschicke Vorbildcharakter haben.«
Meine Mutter sagte das 1975, als sie sich gerade einer aggressiven Chemotherapie unterzog, von der die Ärzte hofften – auch wenn sie nicht wirklich daran glaubten, wie mir damals einer von ihnen sagte –, dass sie ihr zu einer langen Remission, wenn nicht gar zur Heilung des metastatischen Brustkrebses im fortgeschrittenen Stadium verhelfen würde, der im Jahr zuvor diagnostiziert worden war (es war die Zeit, als man den Angehörigen von Patienten mehr sagte als den Patienten selbst). Es war typisch für meine Mutter, dass sie, als sie wieder schreiben konnte, jene Reihe von Essays für die New York Times Book Review verfasste, die später unter dem Titel Über Fotografie in Buchform erscheinen sollte. Nicht nur in diesem Werk ist sie in einem autobiographischen Sinne mehr oder weniger abwesend. Auch in Krankheit als Metapher spielt sie als Person kaum eine Rolle, einem Buch, das sie ganz gewiss nicht geschrieben hätte, wenn sie nicht am eigenen Leibe die Stigmatisierung erlebt hätte, die damals mit einer Krebserkrankung einherging, und die noch heute, wenn auch in abgeschwächter Form, existiert, zumeist als Selbststigmatisierung.
Ich weiß nur von drei Fällen, in denen sie als Schriftstellerin unverhohlen autobiographisch schrieb. Der erste ist ihre Erzählung »Projekt einer Reise nach China«, die 1973 kurz vor ihrer ersten Chinareise veröffentlicht wurde. Über weite Strecken ist dieser Text eine Meditation über ihre Kindheit und ihren Vater, einen Geschäftsmann, der den größten Teil seines bedauerlich kurzen Erwachsenenlebens in China verbrachte und dort starb, als meine Mutter (die ihre Eltern nie in die britische Konzession im heutigen Tianjin begleitete, sondern in New York von Verwandten und ihrem Kindermädchen versorgt wurde) vier Jahre alt war. Der zweite Fall ist die Erzählung »Ohne Reiseführung«, die zuerst 1977 in The New Yorker erschien. Und als drittes wäre der 1987 ebenfalls im New Yorker erschienene Text »Wallfahrt« zu nennen. Es handelt sich um eine Erinnerung an den Besuch, den sie 1947 als Jugendliche dem damals im Exil in Pacific Palisades lebenden Thomas Mann abstattete. Allerdings ist »Wallfahrt« in erster Linie eine Übung in Bewunderung für den Schriftsteller, den meine Mutter als Jugendliche verehrte wie keinen anderen; das Selbstporträt nimmt typischerweise einen verschwindend geringen Raum ein. Es sei, so schreibt sie, eine Begegnung gewesen zwischen »einem verlegenen, begeisterten, literaturtrunkenen Kind und einem Gott im Exil«. Und schließlich sind da noch die autobiographischen Passagen am Ende des 1992 erschienenen dritten Romans meiner Mutter, Der Liebhaber des Vulkans, in denen sie sehr direkt und in einer Weise, die sich von all ihren sonstigen Veröffentlichungen oder auch Interviews unterscheidet, darüber spricht, wie es ist, eine Frau zu sein, sowie ein paar flüchtige Kindheitserinnerungen in ihrem letzten, 2000 erschienenen Roman In Amerika.
»Mein Leben ist mein Kapital, das Kapital meiner Vorstellungskraft«, erklärte sie in besagtem Boston Review-Interview und fügte hinzu, sie »kolonisiere« es gern. Dieses »Kapital« war ein merkwürdiges, ungewöhnliches Bild für meine Mutter, die an finanziellen Dingen nicht das geringste Interesse hatte und in privaten Gesprächen, soweit ich mich erinnere, nie eine monetäre Metapher gebraucht hat. Doch zugleich scheint es mir eine absolut treffende Beschreibung ihrer Auffassung vom Schrifstellerdasein zu sein. Nicht zuletzt deshalb erstaunte es mich so, dass sie auch nur erwog, eine Autobiographie zu schreiben, denn für sie hätte das bedeutet – um im Bild zu bleiben –, nicht von den Früchten, dem Ertrag ihres Kapitals zu leben, sondern es direkt anzuzapfen: der Gipfel der Unvernunft, sei das betreffende Kapital nun tatsächlich Geld oder der Stoff für Romane, Kurzgeschichten und Essays.
Letztlich wurde dann nichts aus der Idee. Meine Mutter schrieb Der Liebhaber des Vulkans und wurde damit in ihrer eigenen Wahrnehmung endlich wieder zur Romanautorin, was selbst zu den Zeiten, als sie ihre besten Essays schrieb, immer ihr eigentliches Ziel gewesen war. Der Erfolg des Romans stärkte ihr Selbstbewusstsein, das, wie sie selbst einräumte, erschüttert worden war, als ihr 1967 erschienener zweiter Roman Todesstation ein sehr gemischtes Echo fand, was sie damals bitter enttäuschte. Auf das Erscheinen von Der Liebhaber des Vulkans folgte dann ihr langanhaltendes Engagement für Bosnien und das belagerte Sarajevo, das sich zu einer wahren Leidenschaft entwickelte. Danach wandte sie sich wieder der Belletristik zu, ohne dass von Memoiren noch einmal die Rede gewesen wäre – zumindest soweit ich weiß.
In meinen kühneren Momenten denke ich manchmal, dass die Tagebücher meiner Mutter – drei Bände, von denen dieser der zweite ist – nicht nur die Autobiographie darstellen, die sie letztlich nie schrieb (hätte sie es getan, wäre es wohl, so stelle ich mir vor, ein literarischer, episodenhafter Text geworden, ähnlich John Updikes Selbst-Bewusstsein, einem Buch, das sie sehr bewunderte), sondern auch den großen autobiographischen Roman, den zu schreiben sie nie interessiert hatte. Wollte man diesen Gedanken anhand der üblichen Kategorien weiterentwickeln, wäre der erste Band, Wiedergeboren, der Bildungsroman – ihr Buddenbrooks, um Manns großes Werk anzuführen, oder, auf einer niedrigeren literarischen Ebene, ihr Martin Eden, ein Roman von Jack London, den meine Mutter in ihrer Jugend gelesen hatte und von dem sie bis an ihr Lebensende in den wärmsten Tönen sprach. Der vorliegende Band, den ich – nach einem der Einträge – Ich schreibe, um herauszufinden, was ich denke genannt habe, wäre dann der Roman der tatkräftigen, erfolgreichen Erwachsenen. Über den dritten und letzten Band möchte ich mich vorerst nicht äußern.
Das Problem an dieser Lesart ist, dass meine Mutter, wie sie selbst stolz und leidenschaftlich bekundete, zeit ihres Lebens eine Lernende war. Natürlich war die sehr junge Susan Sontag in Wiedergeboren ganz bewusst damit beschäftigt, sich selbst als die Person, die sie sein wollte, zu erschaffen oder vielmehr neu zu erschaffen, eine Person fernab der Welt, in der sie geboren und aufgewachsen war. Dass und wie sie das südliche Arizona und das Los Angeles ihrer Kindheit verließ, um an die University of Chicago, nach Paris und New York zu gehen und Erfüllung zu finden (jedoch kein Glück, was etwas völlig anderes ist und, fürchte ich, kein Quell war, aus dem meine Mutter je ausgiebig schöpfen durfte), spielt im vorliegenden Band keine Rolle. Doch auch ihr großer Erfolg als Schriftstellerin, den meine Mutter hier dokumentiert, die Gesellschaft von Schriftstellern, Künstlern und Intellektuellen jeglicher Couleur – von Lionel Trilling und Paul Bowles über Jasper Johns und Joseph Brodsky bis hin zu Peter Brook und György Konrád – und die Möglichkeit, an praktisch jeden beliebigen Ort reisen zu können, was ihr größter Kindheitstraum gewesen war, das alles änderte nichts daran, dass sie sich als Lernende begriff. Wenn überhaupt, bekräftigte es sie darin eher noch.
Einer der beeindruckendsten Aspekte an den Tagebüchern dieser Jahre ist für mich die Art und Weise, wie sich meine Mutter zwischen verschiedenen Welten hin und her bewegt. Zum Teil hängt das mit ihrer grundlegenden Ambivalenz zusammen und mit gewissen Widersprüchen in ihrem Denken, die dieses jedoch keineswegs herabmindern, sondern im Gegenteil interessanter machen und letztlich dazu führen, dass es sich der Interpretation – nun ja, entzieht, könnte man wohl sagen. Ein noch wichtigerer Punkt ist, dass meine Mutter, die Dummköpfe bekanntlich nur schwer ertrug (und ihre Definition von »Dummkopf« war, gelinde gesagt, sehr umfassend), gegenüber Menschen, die sie aufrichtig bewunderte, nicht als Lehrerin auftrat, wie sie es so oft und gern tat, sondern zur Schülerin wurde. Die stärksten Momente in Ich schreibe, um herauszufinden, was ich denke sind für mich daher jene, in denen sich meine Mutter in Bewunderung übt – was sie gegenüber vielen Menschen tut, am eindrücklichsten aber wohl, auf jeweils eigene Weise, gegenüber Jasper Johns und Joseph Brodsky. Diese Passagen zu lesen hilft, jene Essays meiner Mutter besser zu verstehen, die in erster Linie Hommagen sind – ich denke da besonders an die Texte über Walter Benjamin, Roland Barthes und Elias Canetti.
In meinen Augen kann man diesen Band mit Fug und Recht auch als politischen Bildungsroman betrachten – eben in dem Sinne, dass hier jemand zur Reife gelangt. Im vorderen Teil des Buches ist meine Mutter zugleich zornig und erschüttert über die Torheit des Vietnamkriegs, gegen den sie als prominente Aktivistin zu Felde zog. Ich glaube, einige der Dinge, die sie während ihrer Besuche in dem damals unter amerikanischem Bombardement stehenden Hanoi sagte, hätten im Rückblick auch ihr selbst Unbehagen bereitet. Ich habe sie trotzdem ohne Zögern hier aufgenommen, wie auch viele andere Einträge zu den verschiedensten Themen, die mir entweder ihretwegen zu schaffen machen oder mich selbst schmerzen. Was Vietnam betrifft, möchte ich nur hinzufügen, dass die Kriegsgreuel, die sie so unglaublich wütend machten, keineswegs persönliche Hirngespinste waren. Meine Mutter mag unklug gewesen sein, aber der Krieg war zweifellos die Ungeheuerlichkeit, für die sie ihn damals hielt.
Von ihrem Widerstand gegen den Krieg distanzierte sich meine Mutter nie. Was sie jedoch irgendwann bereute und wovon sie sich im Gegensatz zu vielen ihrer Kolleginnen und Kollegen (ich nenne hier keine Namen, aber kritische Leser werden wissen, welche amerikanischen Schriftsteller ihrer Generation ich meine) sehr wohl distanzierte, das war der Glaube an das emanzipatorische Potenzial des Kommunismus, nicht nur in der sowjetischen, chinesischen oder kubanischen Ausprägung, sondern als System schlechthin. Ich kann nicht mit Gewissheit sagen, ob sie sich umbesonnen hätte, wäre da nicht ihre sehr innige Beziehung zu Joseph Brodsky gewesen – vielleicht die einzige Gefühlsbeziehung auf Augenhöhe, die sie in ihrem Leben hatte. Brodskys Bedeutung für meine Mutter – in ästhetischer, politischer und menschlicher Hinsicht – kann gar nicht hoch genug veranschlagt werden, ungeachtet ihrer beider Entfremdung gegen Ende seines Lebens. Als meine Mutter am vorletzten Tag ihres Lebens – die Schlagzeilen wurden von Nachrichten über die asiatischen Tsunamis beherrscht – auf ihrem Sterbebett im New Yorker Memorial Hospital um Luft und um ihr Leben rang, sprach sie nur von zwei Menschen: von Joseph Brodsky und von ihrer Mutter. Sie machte, um Byron zu paraphrasieren, ihr Herz zum Tribunal.
Ihr Herz wurde oft gebrochen, und über weite Strecken geht es in diesem Band um gescheiterte Liebesbeziehungen. Das vermittelt insofern ein falsches Bild von meiner Mutter, als sie umso ausgiebiger Tagebuch zu schreiben pflegte, je unglücklicher sie war, am wenigsten wiederum, wenn es ihr gutging. Doch auch wenn das Verhältnis nicht ganz stimmt, war die Tatsache, dass sie kein Glück in der Liebe erlebte, meines Erachtens genauso sehr Teil ihrer Persönlichkeit wie die tiefe Erfüllung, die sie im Schreiben fand, und die Leidenschaft, mit der sie, wenn sie gerade nicht schrieb, ihr Leben als ewig Lernende anging, als eine Art ideale Leserin bedeutender Literatur, ideale Liebhaberin bedeutender Kunst, ideale Betrachterin beziehungsweise Hörerin bedeutender Theaterstücke, Filme und Musik. Und so bewegen sich die Tagebücher, gemäß ihrer Persönlichkeit und ihrem Leben, von Verlust zu Gelehrsamkeit und wieder zu Verlust. Dass es nicht das Leben war, das ich ihr gewünscht hätte, steht hier nicht zur Diskussion.
Meine editorische Arbeit an diesem Band der Tagebücher meiner Mutter hat enorm davon profitiert, dass Robert Walsh sich großzügigerweise bereit erklärt hat, die letzte Fassung des Manuskripts durchzusehen – er hat zahlreiche Fehler und Lakunen entdeckt.
Die Verantwortung für verbleibende Fehler liegt natürlich ganz allein bei mir.
David Rieff
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!