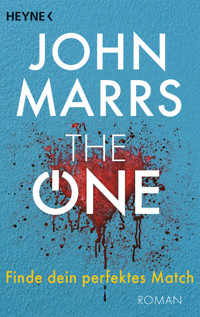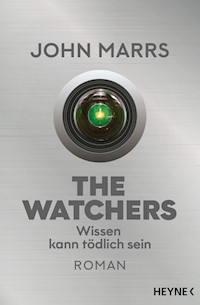13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Verheiratete Menschen sind glücklicher, gesünder und produktiver. Um den Bürgern des Vereinten Königreiches den Hafen der Ehe schmackhaft zu machen, erlässt die Regierung ein Gesetz, das Verheirateten Privilegien verschafft: bessere Schulen für die Kinder, bessere Kredite, bessere Gehälter, Häuser in besseren Wohngegenden. Alles, was man für das schöne Leben tun muss, ist einen Smart-Marriage-Vertrag zu unterschreiben. Doch was bedeutet es, wenn man seine Beziehung einem Algorithmus anvertraut? Ein Witwer versucht verzweifelt, den Tod seiner Frau zu vertuschen, weil er nicht zwangsverheiratet werden will. Eine Hausfrau und Mutter macht Karriere als Vloggerin, bringt dabei aber ihre Familie an den Rand des Ruins. Ein Serienmörder wird zum Paartherapeuten, und ein queeres Paar gerät wegen seiner smarten Ehe in tödliche Gefahr …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch
Wie geht es weiter, wenn man sein perfektes Match gefunden hat? Klar, mit der perfekten Ehe! Verheiratete Paare sind glücklicher, gesünder und produktiver. Das ergab eine Studie britischer Wissenschaftler. Deshalb ermutigt die Regierung ihre Bürger, einen Smart-Marriage-Vertrag zu unterschreiben. Alles, was die Paare für die damit einhergehenden Privilegien tun müssen, ist, jeden Aspekt ihres Privatlebens überwachen zu lassen. Wer sich zu häufig streitet, wird geschieden und landet im sozialen Abseits.
So versucht ein Witwer verzweifelt, den Tod seiner Frau zu vertuschen, weil er weder zwangsverheiratet werden noch aus seinem Haus ausziehen will, das er sich als alleinstehender Mann nicht leisten kann. Eine Hausfrau und Mutter macht Karriere als Vloggerin, bringt dabei aber ihre Familie an den Rand des Ruins. Eine junge Frau wird in den Selbstmord getrieben. Und ein Paartherapeut verliebt sich in seinen Patienten – mit tödlichen Folgen …
Der Autor
John Marrs arbeitete über zwanzig Jahre als freischaffender Journalist für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften. Mit seinem Roman THEONE und dessen Serienadaption auf Netflix gelang ihm der internationale Durchbruch. Der Autor lebt und arbeitet in London.
John Marrs
TheMarriageAct
Bis der Tod euch scheidet
Roman
Aus dem Englischen übersetztvon Felix Mayer
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der Originalausgabe
THE MARRIAGE ACT
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 08/2023
Redaktion: Joern Rauser
Copyright © 2023 by John Marrs
Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabeund der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat GbR, München,unter Verwendung mehrerer Motive von Shutterstock
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-30274-0V001
www.diezukunft.de
Für Ada Lovelace
(1815–1852)
Audite (lat.): ich höre, ich höre zu, ich verstehe.
Erster Teil
Jem Jones
Transkript eines Live-Videos der britischen Videobloggerin und Influencerin JEMJONES, das in zahlreichen sozialen Medien ausgestrahlt wurde.
ANMERKUNGDERTRANSKRIPTORIN: Als die Aufnahme beginnt, sieht Miss Jones nicht in die Kamera. Sie hat nur wenig Make-up aufgetragen, die dunklen Ansätze ihrer blonden Haare sind deutlich zu sehen, und sie hat das Haar flüchtig zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie trägt einen schwarzen Strickpullover und eine silberne Halskette mit einem Anhänger, der den heiligen Christophorus zeigt. Sie wirkt angespannt und aufgewühlt. Miss Jones sitzt im Loungebereich eines Wohnhauses. Hinter ihr stehen zwei große Sofas, an der Wand hängen Bilder, die tropische Strände zeigen. Die Fensterläden sind geschlossen. Sie ist allein. Nach dem Beginn der Aufnahme dauert es achtunddreißig Sekunden, bis sie in die Kamera blickt und zu sprechen anfängt.
»In den letzten Jahren habe ich unzählige von diesen Videoblogs aufgenommen, aber dieser hier ist der erste, bei dem ich nicht weiß, wie ich anfangen soll.«
(Miss Jones schüttelt den Kopf und atmet hörbar tief durch.)
»Ich glaube, ich sollte mich erst mal entschuldigen. In den letzten Monaten habe ich nicht besonders viel von mir hören lassen. Aber nach meinem letzten Post – oder dem ›Desaströsen Dienstag‹, wie meine Kritiker gesagt haben – habe ich es für besser gehalten, mich erst mal zurückzuziehen und mir Zeit für mich selbst zu nehmen. Aber dieses Live-Video wird kein Comeback. Im Gegenteil. Es wird ein Abschied.
Ich bin einfach völlig durch, Leute. Ich hab einfach nicht mehr die Kraft, das hier noch länger zu machen. Wie soll ich denn glücklich sein, wenn sich alle nur noch über mich lustig machen und mich auslachen? Durch diese permanente, gnadenlose negative Aufmerksamkeit und den ganzen Stress hab ich eine posttraumatische Belastungsstörung bekommen, und Schlafstörungen und Angstzustände. Ich kann nicht mehr. Ich bin einfach erschöpft.«
(Miss Jones reibt sich mit den Händen über das Gesicht. Ihre Fingernägel sind angekaut, der weiße Nagellack ist aufgeplatzt.)
»Als ich vor sechs Jahren mit dem Videobloggen angefangen habe, hatte ich ganz harmlose Absichten. Ich wollte einfach nur ein kurzes Video machen, das sich vielleicht ein paar Leute ansehen würden und in dem ich über all das sprechen könnte, was mich als Frau mit Mitte zwanzig beschäftigt hat. Ich dachte, wenn sich das hundert Leute anschauen, die mich nicht kennen, dann wäre das schon ein Riesenerfolg.
Aber dann sind meine Videos plötzlich viral gegangen. Ich glaube, ich werde nie kapieren, warum. Aus hundert Abonnenten wurden zweihundert, dann tausend, und nach einem Jahr waren es eine Million. (Miss Jones lächelt zum ersten Mal kurz.) All diese Leute haben mir zugesehen und sich angehört, wie ich rumgeschwafelt habe: wo man Lippenstift in genau dem und dem Farbton bekommt, wie ich ihnen mein erstes Tattoo gezeigt habe, oder wenn ich mal wieder einen entsetzlichen Kater hatte, nachdem ich am Abend zuvor mit den Mädels um die Häuser gezogen war … Mein Gott, damals war das Leben einfach nur ein großer Spaß und völlig easy. Ich meine das ernst; damals hab ich ein paar von den tollsten Dingen überhaupt erlebt, und ich hab das alles mit euch geteilt. Und durch euer Feedback wurde das alles noch wertvoller. Die Nachrichten, die Tags, die dämlichen Emojis und die liebevollen Worte … das hat mir wahnsinnig viel bedeutet. Die meisten von euch habe ich nie kennengelernt, aber es hat sich angefühlt, als wärt ihr alle meine Freundinnen. Ihr habt mein Glück geteilt, wenn ich frisch verliebt war, und wenn’s dann wieder vorbei war, hab ich mich an euren Schultern ausgeheult. Das war eine Gemeinschaft, die mir wahnsinnig viel Kraft und Unterstützung gegeben hat. Ihr habt mir wirklich das Gefühl gegeben, dass ich geliebt werde.«
(Miss Jones schließt die Augen.)
»Ich hätte wissen müssen, dass das nicht ewig so weitergehen kann. Alles Schöne ist irgendwann vorbei. Und das alles ist nur passiert, weil ich mir erlaubt habe, eine eigene Meinung zu haben. Ich mag die Vorstellung, sich zu etwas zu verpflichten, und ich finde es toll, verliebt zu sein. Da hat es nahegelegen, dass ich öffentlich für das Gesetz über die Unantastbarkeit der Ehe geworben habe. Aber dann haben sich die Aktivisten, die gegen das Gesetz sind, auf mich eingeschossen. Da fing das mit dem Hass an. Selbst in unserer angeblich so aufgeklärten Zeit machen die Leute einen Sport daraus, eine Frau, die für etwas eintritt, mundtot zu machen, während ein Mann, der dasselbe sagt, in Ruhe gelassen wird.
Diejenigen unter euch, die mir schon länger folgen, wissen es: Wenn jemand behauptet, dass ich irgendetwas nicht kann, oder mir sagt, was ich denken soll, dann führt das erst recht dazu, dass ich mein Ding mache. Und als mich die Regierung dann gefragt hat, ob ich das Gesicht der Werbekampagne für das neue Ehegesetz werden will und seine Vorteile überall bekannt machen will, da hab ich natürlich Ja gesagt.
Der Widerstand, der mir zuvor entgegengeschlagen war, war schon heftig gewesen, aber im Vergleich zu dem, was dann kam, war das Kindergarten. Ich wurde sozusagen das Aushängeschild der Cancel Culture. Jeden Tag habe ich Tausende Mails und Nachrichten bekommen, in denen mich die Leute als selbstsüchtiges, bösartiges Miststück beschimpft haben, und dass sie mich am liebsten tot sehen würden, und auch meine Familie. Meine Posts in den sozialen Medien wurden mit Hasskommentaren überschüttet. Auch meine Sponsoren wurden angegriffen und davor gewarnt, weiter mit mir zusammenzuarbeiten, weil sie sonst als Nächste auf der Abschussliste stünden. Anfangs konnte ich damit noch umgehen, mit den Todesdrohungen, den gefakten Videos, den Memes, den Schmierereien an meinem Haus und auch mit den Ziegelsteinen, die durch die Fenster geflogen sind. Aber als sie dann meine Hunde vergiftet haben, hat mir das den Rest gegeben. England hat sich von mir abgewendet, also habe ich mich von England abgewendet.«
(Miss Jones holt unter ihrem Monitor sieben Tablettenboxen aus Plastik hervor und hält sie in die Kamera. Es ist nicht zu erkennen, von welcher Apotheke sie stammen. Sie schiebt den rechten Ärmel ihres Pullovers hoch. Auf ihrem Oberarm sind zwei transparente Pflaster zu sehen. Ihr Unterarm weist vernarbte Stellen sowie frische Wunden auf. Dazu sagt sie nichts.)
»Die Pflaster geben über einen längeren Zeitraum hinweg Antidepressiva ab. Unter den Tabletten sind welche, die mir beim Einschlafen helfen, und andere, die mich wach halten. Ich nehme Pillen, damit ich meine Gedanken ordnen kann, Pillen, damit ich nicht zu viel denke, Pillen, damit ich Appetit bekomme, und Pillen, die verhindern, dass ich mich leer fühle. Ich habe sogar welche, die mich klar denken lassen, damit ich nicht vergesse, die anderen zu nehmen.
Aber alle Pillen und Tabletten haben eines gemeinsam: Sie erinnern mich daran, in welchem Maß mein Leben aus den Fugen geraten ist. Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal in irgendeiner Hinsicht zuversichtlich war. Jedes Mal, wenn ich mich traue, in die sozialen Medien zu schauen, schlägt mir nichts als Hass entgegen, und auch wenn das alles nur von anonymen Tastaturkriegern stammt, verletzt es mich trotzdem wahnsinnig. Und diese Angriffe nehmen kein Ende, tagein, tagaus geht das so. Früher habe ich im Internet Zuflucht gefunden, heute empfinde ich es als ein Gefängnis. Aber jetzt mach ich doch wieder weiter, obwohl ich weiß, dass es mich zerstört. Ich bin süchtig danach und habe einfach keine Ahnung, wie ich damit aufhören soll. Ich fühle mich beschissen, kriege Depressionen und fühle mich wie der letzte Dreck, aber ich kann einfach nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören …«
(Miss Jones’ Unterlippe zittert. Sie zögert.)
»Ich wünschte, ich könnte wieder die Jem Jones sein, die ich war, bevor ich mit den Videoblogs angefangen habe. Manche von euch werden jetzt sagen, dass das doch problemlos möglich ist. Aber ich weiß nicht, wie ich wieder die Frau von früher werden soll. Es ist einfach zu viel passiert, und ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wer ich bin oder was ich eigentlich bin. Manchmal bin ich mir selbst so fremd, dass ich glaube, ich bin gar nicht mehr wirklich.«
(Miss Jones hält inne und weint. Sie vergräbt das Gesicht in den Händen, nimmt dann ein Taschentuch und tupft sich die Augen trocken.)
»Tut mir leid, Leute, aber in diesem Zustand bin ich zu nichts mehr nutze, und deshalb verabschiede ich mich jetzt. Wenn welche von denen zuschauen, die mir das Leben zur Hölle gemacht haben: Herzlichen Glückwunsch, ihr habt gewonnen. Ich gebe auf, ich strecke die Waffen. Was ich jetzt auch machen würde, es wäre auf jeden Fall falsch. Danke an alle, die mir ihre Liebe gegeben haben, und es tut mir leid, dass ich euch alle so bitter enttäuschen muss. Ich habe völlig die Kontrolle verloren … Also ist es besser, wenn ich verschwinde, aus der virtuellen Welt und auch aus der realen Welt.«
(Miss Jones lächelt entschuldigend in die Kamera und greift nach etwas, das außerhalb des Bildausschnitts liegt. Dann hält sie eine graue Pistole in der linken Hand. Sie führt sie langsam an die Schläfe, drückt ab und kippt aus dem Bild. Das Video läuft noch rund siebzehn Minuten weiter, bis ihr Leichnam gefunden wird.)
1
Roxi
Ungläubig starrte Roxi auf das YouTube-Video, das auf ihrem Tablet lief. »Wie zum Teufel kommt die an so was ran?«
Eine junge Frau ging mit dynamischen Schritten einen weißen Sandstrand auf den Malediven entlang und gestikulierte so begeistert wie eine Moderatorin im Kinderfernsehen, während sie ihren Zuschauern von den hohen Temperaturen und den Naturschönheiten dieses tropischen Paradieses vorschwärmte.
»Wenn du weiter so rumfuchtelst, hebst du gleich ab«, murmelte Roxi, als die Kamera herauszoomte und ein Luxusresort ins Bild kam.
Autumn Taylor war braun gebrannt, ihre Haut strahlte geradezu, ihre Frisur war makellos, und obwohl sie behauptete, gerade eben erst aufgestanden zu sein, war ihr Make-up perfekt. In der einen Hand hielt sie eine Tube Sonnencreme und in der anderen eine Flasche Wasser. Beide Markennamen waren in die Kamera gerichtet.
Roxi drückte auf »Pause«, nahm ihr Handy, öffnete die Notiz-App und diktierte: »Sonnenbrille: Prada. Bikini: Harper Beckham. Sonnencreme: Nivea. Mineralwasser: Acqua Panna. Titten: Sponsor unbekannt.«
Sie überflog die anderen Videos, die auf dem Kanal der Videobloggerin mit dem Titel Autumn’s Endless Summer angezeigt wurden. Es waren zweiundvierzig Videos, die an den verschiedensten Orten der Welt gedreht worden waren: auf Bali, in Indien, auf den Fidschi-Inseln, den Seychellen, auf Musha Cay und auf Bora Bora. Autumns jüngster Clip, den sie erst gestern gepostet hatte, war jetzt schon über eine Million Mal angeklickt worden. Dass sie unter den weltweit wichtigsten Influencern zu den Top Ten gehörte, ärgerte Roxi jedes Mal, wenn sie darüber nachdachte. Und das tat sie ziemlich häufig.
Was Autumn präsentierte, war eine ganz andere Welt als die in den Videos, die Roxi an diesem Vormittag im wolkenverhangenen New Northampton zusammengeschnitten hatte. Gestern war sie durch die Verkaufsräume eines Möbeldiscounters gewandert und hatte die Sonderangebote der Woche vorgestellt. Dabei hatte sie darauf geachtet, die Wörter und Floskeln zu verwenden, die das Wörterbuch jeder Influencerin bildeten – »Hallo zusammen«, »Community«, »Seid ihr bereit?«, »Partner«, »Challenge« und »Schnäppchen« –, und hatte alles mit einer Begeisterung vorgetragen, als hätte sie über Airbnb in Frankreich eine Unterkunft gebucht und dann unverhofft die Schlüssel für das Schloss von Versailles bekommen.
Das Material war mit dem Handy aufgenommen worden, und die Beleuchtung hatte ein tragbares LED-Ringlicht geliefert. Geholfen hatten Roxi dabei, wenn auch widerwillig, ihre Kinder Darcy und Josh. Das Ergebnis war von Autumns High-End-Produktionen so weit entfernt wie die Sonne vom Mond. Und selbst die ausgefeilteste Bearbeitung konnte die wütende Miene nicht beseitigen, die ihre Tochter Darcy gezeigt hatte, als sie sie für einen Augenblick vor die Kamera gezerrt hatte. Darcy hätte lieber in der Hölle geschmort, als eine Filiale von Costland zu betreten.
»Ich kapier einfach nicht, warum du diese Videos machst«, hatte Darcy gequengelt, und es hatte sich angefühlt, als hätte sich in Roxis Ohren eine Mücke verfangen. »Die guckt doch kein Mensch.«
»Wie wär’s mal mit ein bisschen positivem Feedback?«, hatte Roxi erwidert. »Wenn irgendeine PR-Abteilung auf einen meiner Hashtags aufmerksam wird, kann sich schlagartig alles ändern.«
»Dafür bist du viel zu alt.«
»Jem Jones ist nicht viel jünger als ich.«
»Ja, sie ist ein Dinosaurier, aber wenigstens einer, für den sich die Leute interessieren.«
»Ich habe in den sozialen Medien insgesamt zwölftausend Follower.«
»So wenig?«, hatte Darcy lachend erwidert. »Da hat ja selbst dieser schielende Hund mehr, der mit dem Fellimplantat auf dem Rücken, der aussieht wie Prinz Louis. Mit diesen Videoblogs wirst du nie berühmt. Das ist doch nur peinlich.«
»Weißt du, was wirklich peinlich ist?«, hatte Roxi erwidert. »Wenn du morgen ohne Handy in die Schule gehst, weil deine Mutter es dir abgenommen hat, weil du nicht gehorcht hast. Und jetzt sei ein braves Mädchen, halt den Mund und richte die Kamera auf mich, wenn ich es dir sage.«
»Ich hasse dich«, hatte Darcy gemurmelt.
»Das beruht auf Gegenseitigkeit, meine Liebe.«
Das stimmte so nicht, aber Roxi musste zugeben, dass ihr Leben von heute auf morgen in Stücke gefallen war, als ihre Welt auf einmal von Kindern bevölkert wurde. Sie war noch immer damit beschäftigt, sie wieder zusammenzusetzen. Und insgeheim warf sie das ihren Kindern vor.
Als sie jetzt Autumns Video sah, musste sie sich eingestehen, dass es ihrem eigenen Clip trotz aller Bemühungen an Begeisterung für das Thema fehlte. Daran konnten auch kein warmer Farbfilter, keine Hintergrundmusik und kein Heer von positiven Emojis etwas ändern. Die Taylors dieser virtuellen Welt bekamen geschmackvoll verpackte Haute-Couture-Mode, Schmuck, Luxusreisen und Parfüm geschenkt. Die Roxis dagegen erhielten weniger glamouröse Produkte, wie etwa Espadrilles, Slipeinlagen oder wiederwendbare Holzboxen für den Audite, den auf künstlicher Intelligenz basierenden digitalen Assistenten, den jedes Paar, das eine Smart-Ehe eingegangen war, zu Hause installieren musste. Dennoch blieb Roxi stets durch und durch professionell und hielt sich vor Augen, dass auch Jem Jones irgendwann einmal klein angefangen hatte.
Heute aber war ihr Autumns neues Video zu viel. Kurz entschlossen löschte sie es. Nie wieder würde sie solche Clips anschauen.
Dass Roxi sich aufs Videobloggen verlegt hatte, war zum Teil Darcys Schuld. Es hatte vor zwölf Jahren begonnen; Darcy war ein schwieriges Kind gewesen, sie hatte unter Koliken, Reflux und Ekzemen gelitten und nur selten durchgeschlafen. Roxi hatte sich so manche Nacht damit um die Ohren geschlagen, im Internet nach Rat zu suchen. Und zu so ziemlich allen Beschwerden, unter denen ein Baby leiden konnte, gab es Videos oder Videoblogs. Aber von den Influencerinnen sah kaum eine so aus wie Roxi. Diese Frauen waren keine übernächtigten Mütter in zerrissenen Jogginghosen und fadenscheinigen Pullovern, die ihre Rundungen verbargen. Sie banden sich die Haare nicht hastig mit einem Haargummi zusammen oder gingen ohne Make-up vor die Tür. Vielmehr waren sie makellos herausgeputzte Familiengöttinnen, die ein perfektes, durch Filter beschönigtes Leben präsentierten. Roxi hatte ihre Kanäle abonniert, ihre Websites ihren Favoriten hinzugefügt, hatte sie mit ihren Fotos und Videos stellvertretend für sich selbst ihr Leben leben lassen, hatte bei ihren Signierstunden angestanden und für sie gestimmt, wenn sie im Fernsehen an Realityshows teilnahmen. Sie wurden Freundinnen, die Roxi bloß noch nicht kennengelernt hatte.
Doch im Lauf der Zeit war die Faszination dem Neid gewichen. Warum musste sie jeden Tag in ihren jahrealten Jeans mit Gummizug die Kinder zur Schule bringen und bei der Rückkehr nach Hause in Bergen von Schmutzwäsche versinken, während diese Frauen um die Welt jetteten, in exquisiten Restaurants aßen und die angesagtesten Kleidungsstücke trugen? Nach dem Chaos und der Unordnung ihrer jungen Jahre hatte Roxi mit zwei Kindern und einem Ehemann zu so etwas wie Normalität gefunden. Doch das genügte ihr nicht. Sie brauchte noch etwas anderes. Sie brauchte mehr.
Die Lösung kam so unerwartet, als hätte Gott sie ihr persönlich ausgehändigt. Sie würde selbst mit dem Videobloggen anfangen.
»Das musst du unbedingt machen, Schätzchen«, hatte ihre beste Freundin Phoebe zu ihr gesagt. »Wenn diese Mädels das können, kannst du das erst recht. Du hast da garantiert ein Händchen dafür. Du bist klug und witzig und kannst die Leute überzeugen. Du könntest einem Veganer Fleisch verkaufen.«
Roxi hatte so gut wie alles zum Thema ihres Blogs gemacht. In manchen Wochen sprach sie über günstige Modemarken, in anderen gab sie Ratschläge, wie man seiner Beziehung neuen Schwung verleiht. Sie bloggte über alles, von Sex bis Shopping, von Kosmetik bis Kindererziehung. Aber sehr zu ihrem Frust stieg die Anzahl ihrer Follower nur langsam, und die Firmen, auf die sie es abgesehen hatte, meldeten sich nicht bei ihr.
Sie wandte sich wieder Autumn und ihren Followern zu. Die meisten davon gehörten zu dem lukrativen Segment junger Frauen zwischen vierzehn und dreißig mit hohem verfügbarem Einkommen. Plötzlich fiel ihr Blick auf eines der Profilbilder. Es war Darcy. Roxi hatte gar nicht gewusst, dass ihre Tochter einen Instagram-Account hatte. Sie überflog ihre Posts. Die meisten davon waren Videos, in denen sie und ihre Freundinnen in die Kamera blickten und einen Schmollmund zogen oder Tanznummern vorführten. Als sie Darcys Profil schon wieder verlassen wollte, fiel ihr Blick auf die Zahl ihrer Follower. Es waren knapp zwölftausend, und das nur in einem einzigen sozialen Netzwerk. Noch immer verblüfft, ging sie zurück zur Website von Autumn Taylor.
»Wenn man dich so sieht, könnte man glatt meinen, du stehst auf sie«, war hinter ihr eine Stimme zu hören.
»Mein Gott, Owen, hast du mich erschreckt!« Roxi war hochgefahren und atmete jetzt tief aus, als ihr Mann sie auf die Wange küsste und ihr über die Schulter sah. Seine Sporttasche und seinen Hockeyschläger hatte er neben der Tür abgelegt.
»Wie geht’s der entzückenden Autumn denn heute? Ich sehe sie so oft bei uns, dass ich schon fast das Gefühl habe, sie gehört zur Familie.«
»Letzte Woche hat sie dreißigtausend neue Follower dazugewonnen. In einer Woche. Wie schafft sie das? Kannst du mir das mal erklären?«
Owen zuckte mit den Schultern. »Vielleicht, weil die Leute sie sympathisch finden? Sie ist witzig, sie begeistert die Menschen, sie ist jung und sie ist hübsch.«
Roxi sah ihn gereizt an. »Ist es das, was du im Internet sehen willst: junge hübsche Mädels?«
»Achtung.« Owen deutete auf den Audite, der an der Wand hing. Roxi sah zu dem kleinen, schwarzen, zylinderförmigen Gerät hinüber, das ihren Blick zu erwidern schien. Seitdem sie ihre Ehe zu einer Smart-Ehe upgegraded hatten, nahm es jeden Tag zu einem zufälligen Zeitpunkt zehn Minuten ihrer Gespräche auf und wies sie auf Probleme in ihrer Beziehung hin, die es darin entdeckte. Roxi schlug einen anderen Ton an. »Was Autumn macht, kann doch jeder Idiot. Ich will den Leuten helfen; sie dagegen produziert sich vor aller Welt und tut dabei immer so bescheiden.«
»Ich glaube, du machst dir etwas vor, wenn du denkst, du machst diese Videoblogs nur aus reiner Menschenliebe. Im Grunde willst du genau das, was Autumn hat. Und du beneidest sie, weil sie das besser hinkriegt als du.«
»Danke, Owen, das ist genau das, was ich jetzt brauche.«
»Du weißt doch, dass Influencer ein Verfallsdatum haben. Egal, was du tust, dein Alter ist dir dabei keine große Hilfe.«
»Also würde ich mehr Anfragen bekommen, wenn ich jünger wäre? Willst du das damit sagen?«
Owen schüttelte den Kopf. »Für mich bist du immer noch die Schönste«, sagte er und ging hinaus. Als er weg war, suchte Roxi im Internet nach Rabattcodes für Straffungen der Gesichtshaut, bis sie von einem News-Alert unterbrochen wurde, der auf dem Bildschirm aufpoppte. Über der Meldung prangte das Bild von Jem Jones.
2
Jeffrey
Jeffrey nahm sich eine Flasche Clear Cola aus dem Kühlschrank, öffnete sie und setzte sich an den Esszimmertisch. Erst nachdem er einen großen Schluck genommen hatte, wurde ihm klar, wie durstig er gewesen war. Er hoffte, damit die Elektrolyte zu ersetzen, die er durch die körperliche Anstrengung am Nachmittag verloren hatte.
Ein Gähnen entfuhr ihm, so rasch, dass er gerade noch den Mund öffnen konnte. Der lange, aufreibende Tag forderte seinen Tribut, aber bevor er zu Ende ging, hatte Jeffrey noch etwas zu erledigen. Er wartete darauf, dass das Pflaster auf seinem Arm die Kopfschmerzen linderte, und nahm sich vor, künftig mehr zu trinken. Als er einen säuerlichen Geruch wahrnahm, roch er kurz an seinen Achseln, die jedoch nicht der Ursprung des Geruchs waren. Vielmehr kam er von seinen Händen und Armen.
Plötzlich war im ersten Stock ein dumpfer Schlag zu hören. Jeffrey schob das Tablet zur Seite und ging vorsichtig nach oben, um nachzusehen.
Sein Koffer, der im Schlafzimmer stand, war umgefallen. Er richtete ihn wieder auf. Als ihm der säuerliche Geruch erneut in die Nase stieg, zog er sich aus und ging in die begehbare Dusche. Er trank weiter seine Cola, während das heiße Wasser auf ihn herabregnete, sein fahles braunes Haar glättete, über seine stoppeligen Wangen rann und ihm auf seine breiten Schultern und die Brust tropfte.
Aus einem Spender drückte er etwas Flüssigseife und wusch sich die rostfarbenen Flecken von den Handflächen. Dann pulte er den Schmutz unter seinen Fingernägeln hervor und rieb die Streifen von seinen Unterarmen und Handgelenken ab. Das Wasser in der Duschwanne nahm eine trübe Färbung an.
Weil er selbst keine saubere Kleidung hatte, stöberte er in Harrys begehbarem Kleiderschrank und zog alles heraus, was ihm ins Auge fiel. Mit seinen eins fünfundneunzig überragte Harry ihn haushoch – Jeffrey brachte es nur auf knapp eins achtzig. Sie hatten zwar denselben Taillenumfang, aber er würde die Hosenbeine der Jeans hinaufkrempeln müssen, um sie tragen zu können. Jeffrey war von Haus aus muskulöser als Harry, weshalb die Pullover und die T-Shirts, die er gleich in seinen Koffer stopfen würde, ein bisschen eng anliegen würden. Aber fürs Erste würde es gehen.
Bevor er mit seinem Koffer wieder ins Esszimmer hinunterging, warf Jeffrey noch einmal einen Blick ins Bad und auf die frei stehende Badewanne in der Mitte des Raumes. Er spielte kurz mit dem Gedanken, den Stöpsel zu ziehen, entschied sich aber dagegen.
Als er wieder am Tisch saß, verschränkte er die Finger und drehte die Handflächen nach außen, bis es knackte. Dann wischte er über den Bildschirm, um das Tablet zu entsperren. Die Personalabteilung hatte ihm immer wieder gesagt, er solle aus Sicherheitsgründen den Fingerabdrucksensor oder den optischen Scanner aktivieren, aber bis jetzt war er noch nicht dazu gekommen. Außerdem ließ er das Gerät so gut wie nie aus den Augen. Das Risiko, dass es je in falsche Hände geriet, war minimal.
In seinem Posteingang befanden sich sieben ungelesene Nachrichten, von denen keine einzige als dringend markiert war. Er würde sie später beantworten. Sein Finger schwebte kurze Zeit über dem Icon einer App auf dem Startbildschirm, bis er sie schließlich öffnete. Er musste drei verschiedene Passwörter eingeben, bevor sich das Display mit Worten und Bildern füllte. Er konnte das Material nach verschiedenen Kriterien ordnen: nach dem Zufallsprinzip, nach den jüngst Hinzugekommenen, nach Bildern, nach Wohnort, nach Alter oder nach Dauer.
Mit der zufälligen Auswahl konnte Jeffrey nichts anfangen. Er hatte es einmal ausprobiert, und es hatte ihn unbeschreiblich viel Mühe gekostet, während der ganzen veranschlagten Zeit bei der Sache zu bleiben. Er identifizierte eine mögliche Verbindung lieber erst anhand der Fotos, bevor er sich in die persönlichen Daten vertiefte. Dazu gehörten biografische Angaben, Informationen zu den finanziellen Verhältnissen und den Aktivitäten in den sozialen Medien. Die Liste war heute noch nicht aktualisiert worden, und das kam ihm ganz gelegen, denn nach seinen letzten Klienten brauchte er etwas Zeit, um runterzukommen. Tanya und Harry hatten ihn ordentlich Kraft gekostet. Also loggte er sich aus.
Als Beziehungsbegleiter war es Jeffreys Aufgabe, Paare, deren Ehe nach Ansicht ihres Audite in der Krise steckte, aus nächster Nähe zu monitoren, und das bis zu zwei Monate lang. Er musste die Knoten in dem Band auflösen, das die Betroffenen miteinander verband. Erst wenn das geschafft war, konnte er beurteilen, ob die KI richtiggelegen hatte. Dann entschied er, ob die Ehe fortbestehen sollte oder ob das Paar einem Familiengericht vorgeführt wurde, das über die gemeinsame Zukunft der Eheleute bestimmte. Dabei folgten die Richter oft den Empfehlungen der Beziehungsbegleiter, denn diese waren die Augen und Ohren, die die eheliche Beziehung in all ihrer Komplexität aus erster Hand miterlebt hatten.
Jeffrey sah auf seine Uhr. Die Nacht zog herauf, und es war Zeit, Doncaster Lebewohl zu sagen. Plötzlich pingte die Uhr und zeigte ihm an, dass er eine neue Nachricht erhalten hatte. Er konnte seine Neugier nicht unterdrücken und las sie. Die Liste der Paare, die einen Beziehungsbegleiter brauchten, war um drei Einträge erweitert worden.
Er zögerte kurz, rief aber dann erneut die App auf. Er überflog die Fotos, und dabei fiel ihm ein bestimmtes Paar ins Auge. Als er sah, dass die beiden in New Northampton lebten, wollte er sie schon kurzerhand aussortieren. Diese Stadt hatte er sein ganzes Erwachsenenleben lang gemieden.
Doch etwas an den Fotos, was er nicht genau hätte benennen können, weckte seine Neugier. Und während er ihre Profile durchlas, entstanden schon die ersten Fäden einer Verbindung.
Jeffrey brachte den Koffer und das Tablet in sein Auto, ging zurück zum Haus und bereitete alles vor. Er deaktivierte die Rauchmelder, verstreute in allen Räumen Feueranzünder und übergoss Polstermöbel, Vorhänge und Teppiche mit Terpentinersatz, den er in einem Regal in der Garage gefunden hatte.
Als die Flammen alles verschlangen, was sie auf ihrem Weg fanden, war Jeffrey schon unterwegs und bereitete sich auf das erste Treffen mit seinen nächsten Klienten vor.
3
Corrine
»Kannst du mich hören?«, fragte Corrine und versuchte, sich ihre Angst nicht anmerken zu lassen. »Wenn du mich hören kannst – bitte schlaf nicht ein, okay?«
Sie blickte in den Rückspiegel und sah dort den Körper, der auf der Rückbank des Autos lag. Nichts wünschte sie sich mehr als eine Reaktion, und wenn es nur ein Stöhnen gewesen wäre. »Bleib bei mir«, fuhr sie fort. »Sag mir, dass du mich hören kannst.« Keine Antwort.
Sie hielt das Lenkrad fest umklammert, und die Lichter des Armaturenbretts erhellten ihre aschfahlen Fingerknöchel. Sie war froh, dass sie ihr Auto nicht auf eine selbstfahrende Version upgegraded hatte. Anders als jetzt hätte sie sich dann an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten müssen.
Als sie einen Bezirk von Old Northampton erreichte, den zu betreten sie schon seit Jahren keinen Grund mehr gehabt hatte, flog ihr Blick zwischen Wegweisern und Schilderbrücken hin und her, während sie versuchte, sich zu orientieren. Weil sie nicht wusste, wo die Notaufnahme war, nahm sie das Navi zu Hilfe. Die Rettungsstelle war jetzt in dem ehemaligen Einkaufszentrum von Weston Favell untergebracht.
»Gleich sind wir da«, sagte sie zu ihrem Mitfahrer. »Halt durch.«
Sie hielt den Atem an und trat aufs Gas, überfuhr eine Reihe roter Ampeln und sauste nur knapp an dem Anhänger eines Sattelschleppers vorbei. Sie hoffte, dass an den Ampelmasten keine Überwachungskameras angebracht waren, aber hier im alten Teil der Stadt war das eher unwahrscheinlich. »Los, mach schon«, murmelte sie, wie um das Auto anzutreiben, und fluchte, als sie an einer belebten Kreuzung stehen bleiben musste.
»Hey, Mercedes – Sichtschutz aktivieren und Licht einschalten«, befahl sie, woraufhin das Innere des Wagens von außen nicht mehr einzusehen war. Sie drehte sich um und warf einen Blick auf den bewusstlosen Teenager hinter ihr. Das eine Bein lag ausgestreckt auf der Rückbank, das andere hing in den Fußraum hinab. Die Arme lagen neben dem Körper, der Kopf war nach rechts gedreht. Der Junge atmete flach, was Corrine zumindest ein bisschen Erleichterung verschaffte.
Seine schwarze Hose war an einem Knie aufgerissen, und um seinen Hals lag eine aufgeknöpfte Fliege. Auf seinem zerknitterten weißen Hemd bemerkte Corrine eine Blutspur. Sie fragte sich, ob das Blut von ihm stammte. Auf dem Beifahrersitz lagen die aufzeichnungsfähigen Geräte, die sie ihm abgenommen hatte, darunter sein Handy und seine Smart Watch. Er war ein dürrer Bursche, was es ihr leichter gemacht hatte, ihn durch das Foyer und in den Aufzug zu schleifen. Sie konnte nur hoffen, dass die anderen die Aufnahmen davon, wie sie ihn durch die Tiefgarage geschleppt hatte, gelöscht hatten, bevor die Polizei eingetroffen war.
Die Ampel war mittlerweile auf Grün gesprungen, und das Hupen eines Wagens hinter ihr ließ sie aufschrecken. Sie schaltete die Innenbeleuchtung aus und fuhr mit quietschenden Reifen los. Wenige Minuten später erreichte sie die Notaufnahme.
Als sie vor der Schranke des Parkplatzes stand, kamen ihr Bedenken. Möglicherweise wurde hier ihr Kennzeichen erfasst, und die Parkgebühren würden automatisch über ihre Kreditkarte abgebucht, die mit dem Auto verknüpft war. Sie durfte hier auf keinen Fall irgendwelche Spuren hinterlassen. Also parkte sie auf der Straße, öffnete die hintere Tür, packte den Jungen zum zweiten Mal an diesem Abend unter den Armen und zog ihn mit aller Kraft über den Asphalt.
Brennender Schmerz schoss ihr durch die Muskeln, und sie verzerrte das Gesicht so heftig, dass ihre ohnehin schon geschwollenen Lippen aufrissen und wieder zu bluten anfingen. Nach einer Weile erreichte sie einen Weg auf dem Gelände des Krankenhauses, wo sie den Jungen eigentlich erst liegen lassen wollte. Dort würde man ihn finden. Doch dann entschied sie, dass die Stelle zu weit vom Eingang entfernt war. Möglicherweise würde es zu lange dauern, bis man ihn entdeckte. Das hatte er nicht verdient, zumal er an diesem Abend so viel riskiert hatte.
Aus dem Handschuhfach des Autos nahm sie ein Halstuch und band es sich vor das Gesicht. Dann schleifte sie den Jungen weiter in Richtung des hell erleuchteten Gebäudes. Der Schweiß lief ihr über die Stirn und wurde von dem Stoff aufgesaugt, der ihr Gesicht verhüllte. Corrine spürte jedes einzelne ihrer fünfundfünfzig Jahre. Schließlich erreichte sie einen Flügel des Gebäudes und lehnte den Jungen dort mit dem Oberkörper aufrecht an eine Wand. »Es tut mir so leid«, flüsterte sie. Dann hastete sie davon.
Als sie wieder im Auto saß, riss sie sich das Tuch herunter, drehte die Klimaanlage auf und nahm ein paar gierige Schlucke aus einer Wasserflasche. Ihre Gedanken schossen kreuz und quer durcheinander. Sie sah wieder in den Rückspiegel, diesmal, um ihre Lippen in Augenschein zu nehmen. Hoffentlich würde die Schwellung über Nacht zurückgehen. Sie konnte von Glück sagen, denn bei einem so heftigen Schlag hätte sie locker auch ein paar Zähne einbüßen können. Und das wäre weitaus schwieriger zu erklären gewesen.
Sie ließ den Motor an und fuhr los, zu einem Ziel, das bereits im Navi einprogrammiert war. Mittels Sprachbefehl wies sie das Auto an, sämtliche Fahrten der letzten vierundzwanzig Stunden aus dem Speicher zu löschen, ebenso wie die belastenden Textnachrichten auf ihrem Handy, obwohl diese über einen Proxyserver versendet worden waren, der eine Zurückverfolgung unmöglich machte. Die Geräte des Jungen würde sie jemandem aushändigen, von dem sie wusste, dass er sie sicher verwahren konnte.
»Hey, Mercedes – Radio ein«, sagte sie laut. Die letzten Takte eines Songs erklangen, und dann ertönte das Piepen, das die Nachrichten um ein Uhr morgens ankündigte.
»Zunächst die Übersicht«, sagte die Sprecherin. »Die Influencerin Jem Jones wurde heute tot aufgefunden; Todesursache ist offenbar Selbstmord. Bildungsministerin Eleanor Harrison befindet sich nach dem Überfall in ihrer Wohnung nach wie vor in einem kritischen Zustand.«
Corrine atmete tief durch. Jetzt ist es so weit, dachte sie. Jetzt ändert sich alles.
So wie die Stadt, in der sie lebte, würde auch ihr Leben künftig in zwei Hälften geteilt sein: die Zeit vor dem Angriff auf Harrison, für den sie verantwortlich war, und die Zeit danach.
4
Arthur
Arthurs Kniegelenke und seine Wirbelsäule knackten wie trockene Zweige, als er sich bückte, um eine Handvoll Vergissmeinnicht zu pflücken.
Die zierlichen blauen Blumen wuchsen nun schon seit vierzig Jahren am Rand des Gartens, solange wie Arthur und June in ihrem Haus in Old Northampton wohnten. Jedes Jahr grub er ein paar von ihnen aus, setzte sie in Blumentöpfe und stellte sie auf dem Gehweg vor dem Haus auf einen aufgebockten Tisch, sodass die Nachbarn sie sich mitnehmen konnten. Als Bargeld noch offizielles Zahlungsmittel gewesen war, hatte er eine alte Eiscremeschachtel danebengestellt und die Einnahmen der Feuerwehrstiftung gespendet. Mittlerweile konnte man nur noch bezahlen, indem man eine Plastikkarte, ein Handy oder eine Uhr vor irgendetwas hielt, und das machte das Sammeln von Geld zu aufwendig. Also konnten sich die Nachbarn die Blumen umsonst mitnehmen.
Arthur ging den mit Mosaikpflaster bedeckten Weg zurück und durch die Hintertür ins Haus. Er stellte die Blumen in ein kleines, mit Wasser gefülltes Marmeladenglas und dieses auf ein Tablett, auf dem bereits ein Teller stand, auf dem zwei Scheiben Toastbrot lagen, die mit Konfitüre bestrichen waren. Schließlich stellte er noch eine Kanne mit dampfendem Tee dazu sowie zwei Tassen. Dann trug er das Ganze vorsichtig in den ersten Stock und ins Schlafzimmer.
»Frühstück im Bett«, sagte er und stellte das Tablett zwischen sich und seine Frau.
June roch an den Vergissmeinnicht. »Warum denn die Blumen?«, fragte sie leicht überrascht. »Die bringst du mir doch nur, wenn ich …« Sie hielt inne. »Oh Gott. Sag nicht, dass ich meinen eigenen Geburtstag vergessen habe …«
»Ich glaube, in unserem Alter sind Geburtstage nicht mehr so wichtig«, erwiderte Arthur. »Ich habe bei siebzig aufgehört zu zählen.«
»Entschuldige«, sagte June und senkte den Kopf. Arthur nahm ihre Hand, um sie zu beruhigen.
»Das macht doch nichts«, fuhr er fort und tätschelte ihr die Hand. »Das ist ja nicht das Ende der Welt.«
»Es ist furchtbar, wenn mir die Sachen nicht mehr einfallen. Es fühlt sich an, als würde ich jeden Tag ein Stück mehr von mir verlieren.«
Arthur sagte ihr nicht, dass auch er bemerkt hatte, wie ihre geistigen Fähigkeiten allmählich nachließen. Außerdem saß sie oft lange Zeit einfach nur schweigend und mit glasigen Augen da.
»Aber dafür hast du ja mich. Ich erinnere dich an alles.« Er tippte sich an die Stirn. »Hier oben sind so viele Erinnerungen gespeichert, das reicht für uns beide bis ans Lebensende.«
»Wie lange sind wir jetzt schon verheiratet?«, fragte June.
»Neunundvierzig Jahre.«
»Dann haben wir nächstes Jahr goldene Hochzeit?« Arthur nickte. »Glaubst du, ich bin dann noch da, damit wir das gemeinsam feiern können?«
»Sag so was nicht. Natürlich bist du dann noch da.«
Junes Gesicht hellte sich auf. »Wir sollten ein Fest geben! Im kleinen Rahmen. Vielleicht reservieren wir einen Raum im Charles Bradlaugh. Wir könnten Tom bitten, uns ein schönes Buffet herzurichten.«
»Ja, das ist eine großartige Idee.«
Jetzt war nicht der richtige Zeitpunkt, June daran zu erinnern, dass Tom das Pub vor über zehn Jahren verkauft hatte und es seitdem geschlossen war. Eines der zahlreichen Opfer in der geteilten Stadt. Außerdem würde sie ihren Vorschlag ohnehin bald wieder vergessen.
»Wir könnten auch ein letztes Mal mit dem Wohnmobil auf große Fahrt gehen«, fuhr June fort. »Das wäre doch bestimmt ein Riesenspaß.«
»Das klingt wunderbar. Möchtest du etwas Toast?«
»Iss du ihn, ich habe keinen Hunger.«
»Aber du musst doch bei Kräften bleiben.«
June verdrehte die Augen, als wolle sie ihm zeigen, dass er sie nervte. Arthur hob die Hände, als ergebe er sich.
»Schaltest du bitte die Nachrichten ein?«, bat ihn June. »Ich habe keine Ahnung, was derzeit in der Welt so vor sich geht.«
»Fernseher an«, sagte Arthur laut. »BBC News.«
Auf dem Bildschirm waren Aufnahmen einer jungen Frau zu sehen, die ihm irgendwie bekannt vorkam.
»Das ist doch diese junge Frau, die gesagt hat, dass wir noch mal heiraten sollen«, sagte June. »Jem Jones. Ist ihr etwas zugestoßen?«
»Ich glaube, sie ist ums Leben gekommen.« Arthur kniff die Augen zusammen, konnte aber ohne seine Brille den Newsticker am unteren Bildschirmrand nicht lesen. Immer wieder hatte er den Rat seines Optikers ausgeschlagen, sich die Augen lasern zu lassen, was für ihn als Smart-Privatpatienten kostenlos gewesen wäre.
Sein Medi-Armband leuchtete auf. Er drückte einen Button, und eine Stimme las vor, was auf dem Display stand.
»Eine Ehe besteht aus zwei Menschen, die beide ihre eigene Persönlichkeit, ihre Meinungen und ihre Macken haben«, lautete die Nachricht. »Um ein Paar zu werden, muss man seine Individualität nicht aufgeben.«
Arthur schüttelte den Kopf. Dreimal täglich ereilten ihn diese ungebetenen elektronischen Ratschläge, doch er achtete peinlich genau darauf, sie nicht zu ignorieren. Wenn man es versäumte, den grünen Button mit der Aufschrift »Gelesen« zu drücken, wurde die Nachricht bis spät in die Nacht alle fünfzehn Minuten gut hörbar wiederholt.
»Sieht aus, als hätte sie sich das Leben genommen«, sagte June mit Blick auf den Fernseher. »Die Ärmste. Wie furchtbar. Wie schlimm muss das sein, wenn man so entsetzlich unglücklich ist, dass man keinen anderen Ausweg mehr sieht.«
Arthur wusste nur zu gut, wie das war. Er selbst hatte mehrfach mit dem Gedanken gespielt. Allerdings hatte er seiner Frau kein Wort davon erzählt.
June bemerkte, dass er auf ihre Worte nicht reagierte. »Du musst mir versprechen, dass du, wenn es schlimmer wird, nur noch an die schönen Zeiten denkst, die wir miteinander hatten, und nicht an die letzten Monate«, sagte sie.
»Müssen wir ausgerechnet jetzt darüber sprechen?«
»Ich will einfach sicher sein, dass du auch ohne mich zurechtkommst, Artie.«
»Das werde ich«, antwortete er und tätschelte ihr wieder die Hand. »Versprochen. Aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen, weil du nämlich bei mir bleiben wirst. Wir beide, du und ich, zusammen bis zum Schluss.«
Und für einen kurzen Augenblick stellte er sich vor, es wäre wirklich so.
5
Anthony
Anthony lehnte sich zurück und neigte den Kopf so weit, wie es ging, nach links und rechts. Auch seine Arme und Beine fühlten sich steif an, also ließ er die Schultern kreisen, zehn Mal nach vorn und zehn Mal nach hinten. Dann zog er an jedem einzelnen seiner Finger und ließ die Knöchel knacken. Er hätte nicht sagen können, wie lange er vornübergebeugt an dem Schreibtisch in seinem Arbeitszimmer gesessen hatte, aber wenn sein Körper jetzt so steif geworden war, musste es ziemlich lange gewesen sein. Er rieb sich die brennenden Augen und setzte seine Smart Glasses auf. Durch die Vergrößerung konnte er jetzt auf den sechs Bildschirmen, die vor ihm an der Wand hingen, jedes Pixel erkennen, wodurch er sich fühlte, als sei er Teil eines Computerspiels.
Gebannt verfolgte er Jem Jones’ mittlerweile schon berüchtigten letzten Clip, den sie am Vortag gepostet hatte, spielte ihn wieder und wieder ab. Seine Aufmerksamkeit galt dabei nicht dem, was sie in ihrer Verzweiflung sagte – den Ton hatte er ausgeschaltet –, sondern ihrer Mikromimik. Die Art, wie sie einen Mundwinkel nach oben zog, wie sie ein Augenlid hob oder die Nase rümpfte, sagte genauso viel aus wie ihre Worte.
Als er zu der Stelle kam, an der sie sich die Pistole an den Kopf setzte und abdrückte, spulte er zurück und sah sich das Video ein weiteres Mal an, diesmal mit einem Viertel der Geschwindigkeit. Als sie die Waffe erneut zur Hand nahm, tippte er auf die Maus, die auf die Schreibtischplatte projiziert war, und betrachtete eingehend jedes einzelne Bild des Clips. Die Wucht, mit der die Kugel in Jems rechte Schläfe eindrang, schleuderte ihren Kopf und ihren Körper nach links. Dann fiel sie zu Boden und verschwand aus dem Bild. Ihre Kamera war so programmiert, dass sie sich auf das nächstliegende Objekt richtete, das sich bewegte, und jetzt war das nur noch das Blut, das aus der tödlichen Wunde in Jems Kopf floss. Schließlich war der gesamte Bildschirm von dem aufgerissenen Fleisch an der Austrittswunde erfüllt. Als Jems Herz kurz darauf zu pumpen aufhörte, stoppte die Blutung, und der ganze Raum war so reglos wie ihr Puls. Ihr Tod war zugleich ein Segen und völlig sinnlos, dachte Anthony.
Bei einem der früheren Durchgänge hatte Anthony die Zeit danach gemessen: Es dauerte sechzehn Minuten und fünfzig Sekunden, dann waren vier Pieptöne zu hören, ein elektronisches Türschloss ging auf, und jemand betrat den Raum. Die Kamera schwenkte auf eine Frau im mittleren Alter, die eine pink-weiße Montur trug und einen Korb dabeihatte. Es war Jems Putzfrau. Als sie die Leiche entdeckte, schrie sie auf, und als sie sich selbst im Monitor sah, schaltete sie panisch die Kamera aus. Den Newstickern zufolge waren bei den Notrufnummern Tausende Anrufe von Leuten eingegangen, die entsetzt live mit angesehen hatten, wie Jem sich umgebracht hatte. Eine Angabe konnte jedoch keiner der Anrufer machen: wo Jem Jones sich befand.
Anthony dagegen wusste genau, wo sie war.
Weil er wissen wollte, wie die Öffentlichkeit reagierte, ließ er seit Jems Selbstmord ein spezielles Programm laufen, das jede Erwähnung davon in den sozialen Medien und bei Online-Nachrichtendiensten registrierte. Nach nur wenigen Stunden war sie weltweit das Top-Thema. Ihr Tod hatte die zweitgrößte Welle an Tweets aller Zeiten zur Folge; nur der Hackerangriff auf autonome Fahrzeuge in Großbritannien ein paar Jahre zuvor hatte noch mehr gehabt. Aus den meisten Kommentaren sprach Mitgefühl. Und wo waren deine Anhänger, als du sie gebraucht hast?, dachte Anthony.
Jem war landesweit der größte und einflussreichste Star in den sozialen Medien gewesen. Anthony ließ ihren Aufstieg und ihren Fall noch einmal Revue passieren. Schon in ihren allerersten Tagen hatte sie sich durch ihren natürlichen Charme und ihren zurückhaltenden Humor von der Masse der anderen Influencerinnen abgehoben, die alle gleich aussahen und sich vergebens Hoffnungen machten. Die Zahl ihrer Follower war stetig gewachsen, und damit war auch Jems Interesse daran gewachsen, nicht immer nur über sich selbst zu sprechen. Doch als sie sich für das Gesetz über die Unantastbarkeit der Ehe einsetzte, hatte das zu ihrem Ruin geführt. Das war vorherzusehen gewesen. Letztlich stürzte die britische Öffentlichkeit alles wieder vom Sockel, was sie zuvor hochgejubelt hatte. Das war nun einmal der Lauf der Dinge.
Ein Blinken auf dem Monitor zeigte an, dass jemand vor der verschlossenen Tür des Zimmers stand. Eine kleine Kamera identifizierte die Person als Anthonys Sohn. »System herunterfahren«, sagte er laut, und die Bildschirme erloschen. Mit der Fernbedienung öffnete er die Tür.
»Hi, Daddy«, sagte Matthew übermütig und lebhaft gestikulierend. Er hatte Anthonys bronzenen Teint, aber die bernsteinfarbenen Augen seiner Mutter. Jedes Mal, wenn Anthony ihn betrachtete, wurde ihm klar, wie schnell er heranwuchs und wie wenig er selbst davon mitbekam.
»Was führt dich zu mir?«, fragte Anthony lächelnd.
»Onkel Marley und Tante Ally sind da.«
»Okay. Ich bin in einer Minute bei euch. Ich muss erst noch duschen.«
»Nein! Mum hat gesagt, ich soll dich persönlich mitnehmen.«
Sie kennt mich einfach zu gut, dachte Anthony. Wenn man ihn sich selbst überließ, konnte eine »Anthony-Minute«, wie Jada zu sagen pflegte, bis zu einer Stunde dauern. »Also gut«, sagte er und nahm die Hand, die Matthew ihm hinhielt.
Matthew zog ihn hinter sich her ins Haupthaus, durchs Esszimmer und durch eine offene Glastür und schließlich in den Innenhof. Dort rankten sich die dicken Stämme alter Weinreben um die hölzernen Pfähle und Balken einer Pergola, in deren Schatten sich die Familie um einen Tisch versammelt hatte.
»Schau mal einer an – wen haben wir denn da? Und noch dazu fast pünktlich«, spöttelte Anthonys Schwager Marley. Er hatte die nackten Beine von sich gestreckt und die Hände hinter dem Kopf verschränkt. »Wie nett von dir, dass du dich zu uns gesellst.«
Anthony verdrehte im Scherz die Augen, als wolle er zeigen, dass er das nicht zum ersten Mal hörte.
»Arbeitet er immer am Sonntag?«, fragte Jadas Schwester Ally, die jetzt hinter Anthony auftauchte. Sie küssten sich auf die Wangen, und Ally stellte die beiden Tabletts mit Essen, die sie gebracht hatte, auf den Tisch.
Jada nickte, was ihre Korkenzieherlocken zum Schaukeln brachte. »Aber ich hab ihn immerhin so weit, dass er zumindest einen Tag in der Woche freimacht«, sagte sie und stellte eine große Glasschüssel mit Salat auf den Tisch.
»Na, das ist ja schon mal ein Fortschritt«, bemerkte Ally.
»Ja, aber fairerweise muss ich sagen, dass er mich schon bei unserem ersten Date gewarnt und mir gesagt hat, dass er ein Workaholic ist. Ich wusste also, worauf ich mich einlasse.« Sie drückte ihrem Mann die Schulter, worauf er ihr die Hand küsste. »Also, sollen wir loslegen? Das kommt alles aus Anthonys Heimat: die besten Meeresschnecken von Saint Lucia, grüne Feigen und Salzfisch, gebackene Bananen und Brotfrucht. Aber lasst noch Platz für die Nachspeise.«
»Mir scheint, ich hab die falsche Schwester geheiratet«, sagte Marley. Mit einem raschen Blick auf seine Smart Watch schob er hinterher: »Das war natürlich nur ein Scherz.«
Anthony sah zu Matthew, der mit seinem Handy spielte. »Du kennst doch die Regeln. Leg das bitte weg.« Widerwillig legte Matthew das Telefon zur Seite.
»Wie läuft’s im Job, Anthony?«, fragte Ally und nahm sich Salat.
»Na ja, du weißt ja. So wie immer.«
»Eigentlich weiß ich nichts darüber.«
»Aber du weißt, dass ich nicht darüber sprechen darf«, sagte Anthony mit einem Lächeln.
»Und wann schaltest du mal einen Gang runter und genießt das Leben?«
»Hat dir das meine Frau eingeflüstert?«
»Jada hat damit nichts zu tun. Ich sag nur, was ich sehe.«
»Das ist wohl wahr«, warf Marley ein. »Das kann ich aus Erfahrung bestätigen.«
Jetzt war es Ally, die erst einen Blick auf ihre Uhr und dann auf ihren Mann warf. Er zuckte kurz zusammen und formte stumm mit den Lippen: »Entschuldigung«, als ihm wieder einfiel, dass sein tragbarer Audite ihre Gespräche jederzeit aufnehmen und analysieren konnte. »Ohne mich wärst du doch aufgeschmissen«, sagte sie in einem betont melodischen Singsang.
»Aber so was von.«
»Mit achtunddreißig setze ich mich zur Ruhe«, sagte Anthony mit einem Grinsen. »In nur drei Jahren mailen wir euch aus unserem Haus am Strand von Saint Lucia Ansichtskarten nach New Northampton. Also, wenn wir dazu kommen, vor lauter Fischen, Tauchen am Riff und Wanderungen durch den Regenwald.«
»Ja, ja, wir haben’s kapiert, Mister Geldsack«, sagte Ally. »Aber vergiss nicht: Geld allein macht nicht glücklich.«
»Aber es verschafft einem Möglichkeiten.«
»Was glaubst du – wie reich war Jem Jones?«, fragte Ally plötzlich. Bei der Erwähnung dieses Namens zog sich Anthonys Magen zusammen. »Sie hatte immer eine Menge Sponsoren, also muss sie doch auf einem Haufen Geld gesessen haben. Sie konnte sich alles kaufen. Außer Glück.«
»Im Grunde weiß man doch nie, wie ein Mensch tickt«, sagte Marley und schluckte einen Bissen Hühnchen hinunter. »Habt ihr ihr letztes Video gesehen?«
Jada und Ally nickten, während Anthony den Kopf schüttelte.
»Wie das denn?«, fragte Ally. »Dem konnte man doch gar nicht entkommen.«
»Sein Arbeitszimmer ist hermetisch abgeriegelt«, sagte Jada. »Da kommt nichts rein oder raus. Da drin würde er nicht mal merken, wenn ein Komet einschlägt.«
»Aber du weißt, wer Jem Jones war?«
»So ungefähr«, antwortete Anthony. »Ich habe sie nicht besonders aufmerksam verfolgt.«
»Mir tut es leid für sie«, sagte Ally. »Dass sie sich entschieden hat, ihrem Leben auf diese Art ein Ende zu setzen, zeigt doch deutlich, dass sie nicht mehr klar denken konnte.«
»Glaubst du, wir sollten dieses Gespräch führen, wenn dein siebenjähriger Neffe mit am Tisch sitzt?«, fragte Marley. Aber Matthew war so in sein Handy versunken, dass er nichts mitbekommen hatte. Jada nahm es ihm aus der Hand, ohne ihn vorher zu bitten.
»Niemand hat sie dazu gezwungen, ihr Leben vor einer Kamera zu verbringen«, sagte Anthony.
»Man darf sich denen, die einen mit Hass überziehen, nicht geschlagen geben«, meinte Jada.
»Aber Jem hat genau das getan – indem sie sich umgebracht hat.«
»Sollen wir das unserem Sohn beibringen? Dass er diejenigen gewinnen lässt, die ihn schikanieren?«
»Natürlich nicht«, entgegnete Anthony. »Aber wir werden ihm auch nicht beibringen, dass er in einer Situation verharren soll, die ihn unglücklich macht. Jem hätte sich aus den sozialen Medien verabschieden und in eine Klinik oder so etwas Ähnliches gehen sollen, und dann ihr Leben wieder auf die Reihe kriegen und irgendwo anonym ihren Reichtum genießen. Stattdessen ist sie so gestorben, wie sie gelebt hat – zur Unterhaltung der Leute.«
»Da hast du aber ziemlich viel zu sagen über jemanden, von dem du kaum etwas weißt«, warf Marley ein.
»Wie wär’s, wenn du uns noch eine Flasche Wein holst?«, sagte Jada.
Anthony wandte sich an seine Frau und tippte sich an eine imaginäre Kappe. »Ich kenne meinen Rang, M’lady«, entgegnete er und ging ins Haus.
Plötzlich spürte er an seinem Handgelenk ein lang anhaltendes Pulsieren. Die Absender, die ihn mit codierten Vibrationen über seine Smart Watch kontaktierten, funkten ihn nur an, wenn es einen triftigen Grund gab. Er dechiffrierte die Nachricht Buchstabe für Buchstabe, Wort für Wort, bis sich ein Satz ergab.
»Sie haben es also getan?«, lautete die Nachricht. »Sie haben Jem Jones umgebracht.«
Anthony blickte auf die Uhr, dachte kurz nach und sprach dann seine Antwort.
»Ja.«
6
Jeffrey
Während sein Auto sich selbst neben dem Grünstreifen vor dem Haus in New Northampton parkte, überprüfte Jeffrey im Rückspiegel sein Äußeres. Er hatte sich die Zähne erst kürzlich bleichen lassen, war frisch rasiert und hatte seine Augenbrauen mit einer Nagelschere gebändigt. Er leckte sich die Fingerspitzen ab und drückte ein Haarbüschel auf seinem Kopf herunter, das schnurgerade nach oben wuchs, egal, welches Pflegeprodukt er hineinschmierte. Der erste Eindruck war immer der wichtigste.
Während der Fahrt hierher hatte sein Magen fast durchgehend gerumpelt wie ein Wäschetrockner. Sechzehn Jahre lang hatte er es vermieden, diese Stadt zu betreten. Aus gutem Grund. Hier hatte alles geendet und alles begonnen.
Auf den Fotografien wirkte das Paar, das in diesem modernen Haus wohnte – in einer Erweiterung der Stadt, die Jeffrey nicht kannte –, auf fast schon einschüchternde Weise gut aussehend. Ganz anders als er selbst, wie er nur zu gut wusste. Er war weder attraktiv noch unattraktiv, und er hatte sich oft gefragt, ob die Natur nicht ganz bei der Sache gewesen war, als sie ihn geschaffen hatte. Erst als er ins Teenageralter gekommen war und um sein rechtes Auge herum eine Narbe geprangt hatte, erinnerten sich die Leute an ihn. Aber nachdem eine Operation die Narbe fast zum Verschwinden gebracht hatte, war auch er wieder verschwunden. Doch zumindest hatte er die kräftige Statur seines Vaters und seines Großvaters geerbt, und dazu ihre schiere körperliche Kraft. Letzteres hatte sich mehr als einmal als nützlich erwiesen.
Er sah auf die Uhr. Es war so weit – er musste wieder in die Rolle des Beziehungsbegleiters schlüpfen. Vor vier Jahren hatte er sich für die Ausbildung beworben und war genommen worden, als einer der jüngsten Bewerber. Nach einem neunmonatigen, von der Regierung finanzierten Intensivkurs hatte er die Prüfung mit links bestanden. Während der Probezeit hatte er unter der Supervision eines erfahrenen Trainers einen echten Fall übernommen und ein Paar betreut und anschließend begonnen, allein zu arbeiten. Er hatte nie wieder in das Zwielicht zurückgeblickt, das am Rand der Gesellschaft herrschte, und war auch nie dorthin zurückgekehrt.
Jeffrey nahm das Anwesen, in dem er die kommenden Wochen verbringen sollte, näher in Augenschein. Wie in fünf anderen Städten des Landes hatte die Regierung auch hier in Northampton Milliarden in Renovierungsarbeiten, Abbrucharbeiten, Neubauten und Aufwertung investiert und einen eigenen Stadtteil errichtet, der Menschen vorbehalten war, die nach dem Gesetz über die Unantastbarkeit der Ehe lebten. Das Haus, vor dem Jeffrey stand, war eines der kleineren Häuser, in denen frisch vermählte Paare ihre Ehe begannen. Und Jeffreys Aufgabe war es zu entscheiden, ob dies auch das Haus war, in dem die Ehe des ihm anvertrauten Paares zu Ende ging.
7
Roxi
In Roxis Gedanken keimte eine Idee.
Sie saß im Schneidersitz auf ihrem Bett, lehnte sich an zwei dicke Kissen, die am Kopfteil aufgestellt waren, und sah aufmerksam auf den Fernseher. In sämtlichen Magazinsendungen und auf allen Nachrichtenkanälen wurde ausschließlich über den Selbstmord von Jem Jones gesprochen. Und Roxi war davon genauso gebannt wie der Rest des Landes. Auf Sky News erklärten die Moderatoren seit vierundzwanzig Stunden am laufenden Band, wie die sozialen Medien Jem zum Star gemacht, sie dann aber letztlich auch zerstört hatten. Beim Zappen durch die Kanäle stieß Roxi auch auf Sender aus dem Ausland, wo man zuvor noch nie etwas von Jem Jones gehört hatte und jetzt darüber berichtete, wie die britische Öffentlichkeit die einflussreichste Influencerin des Landes in den Tod getrieben hatte.
Mehr als die Gegenwart interessierte Roxi jedoch die Vergangenheit. Heute Morgen hatte sie auf Jems YouTube-Kanal ihre Videoblogs der Reihe nach angesehen, ab dem ersten Clip, den sie vor sechs Jahren gepostet hatte. Jem war in die sozialen Medien eingestiegen, als wieder einmal eine Pandemie geherrscht hatte und weltweit ein Lockdown auf den anderen gefolgt war, weshalb die Leute viel Zeit hatten, um Videos zu gucken. Damals war sie ein neues Gesicht gewesen, eine Frau Mitte zwanzig, die Videos hochlud, die grell ausgeleuchtet waren, bei denen das Bild wackelte und die Tonqualität zu wünschen übrig ließ. Drehorte und Ausstattung waren nicht übermäßig schick, Jem hatte ihre Auftritte vorher kaum eingeübt, und auch ihr Äußeres war nichts Besonderes, ebenso wie die Themen, über die sie sprach. Aber Roxi hatte ausreichend viele Videos von ihren Konkurrentinnen studiert, um zu erkennen, dass an diesen Clips irgendetwas anders war.
Jem war durch und durch liebenswert und authentisch. Aus ihrem Auftreten sprach stilles Selbstvertrauen, sie verströmte Glaubwürdigkeit und eine ansteckende, pragmatische Begeisterung. Ob sie ein Produkt bewarb oder ihre Gefühle beschrieb – man glaubte ihr einfach. Roxi hatte sich vieles notiert, von Jems Kleidung und ihrem Make-up bis zu ihren immer neuen Frisuren und den Orten, an denen sie drehte – meistens in ihrem Haus oder ihrem Garten. Sie hatte eine Liste mit den Worten und Ausdrücken erstellt, die Jem am häufigsten benutzte, und Übersichten angefertigt, in die sie Jems Lieblingsthemen eintrug, einschließlich Angaben dazu, wie oft und wie lange sie jeweils darüber sprach, wie viele Likes die Beiträge bekommen hatten und wie häufig sie geteilt worden waren.
Mit der Zeit, so stellte Roxi fest, gewährte Jem ihren Abonnenten immer mehr Einblicke in ihr Leben hinter der Kamera. Sie erwähnte Dates (gute und schlechte Erfahrungen), Beziehungen (auch hier gute und schlechte Erfahrungen) und gebrochene Herzen – das waren immer schlechte Erfahrungen. Sie lächelte und lachte, vergoss Tränen und rappelte sich wieder auf.
Und dann, nachdem zehn Jahre lang spezielle Stadtteile errichtet und ganze Regionen wiederbelebt worden waren, stand das viel diskutierte Gesetz über die Unantastbarkeit der Ehe kurz vor der Einführung.
»Ich kann es kaum erwarten«, sagte Jem in einem der Videos, die Roxi studiert hatte. »Beziehungen können scheitern. Das ist nun mal so. Auch wenn man durch Match Your DNA seinen Herzallerliebsten gefunden hat, ist das keine Garantie für ein Happy End.«
Etliche Jahre zuvor hatten sich die Möglichkeiten der Suche nach dem richtigen Partner radikal verändert, nachdem Wissenschaftler entdeckt hatten, dass jeder Mensch ein Gen besitzt, das er mit genau einem anderen Menschen auf der Welt teilt. Ein simpler Abstrich der Mundschleimhaut genügte, um den Menschen zu finden, in den man sich garantiert verlieben würde, unabhängig von Alter, ethnischer Abstammung, sexueller Orientierung, Religion oder Wohnort. Die Firma Match Your DNA brachte die Paare zusammen, sobald beide den Test gemacht hatten. Allerdings war nicht allen das Happy End vergönnt, das sie sich erhofft hatten.
»Manche Probleme sind so groß, dass Liebe allein sie nicht lösen kann«, fuhr Jem fort. »Dann braucht man Hilfe von außen. Ist es schlimm, wenn man diese Hilfe nicht durch menschliche, sondern durch künstliche Intelligenz bekommt? Nein, ganz im Gegenteil; die KI kann den Dingen wahrscheinlich sogar besser auf den Grund gehen als Menschen, und sie kann anhand unserer Daten auch sehr viel genauer erkennen, was wir nicht zueinander sagen. In der Medizin stellt die KI heutzutage die Hälfte aller Diagnosen. Wir vertrauen ihr unser Leben an – warum dann nicht auch unsere Herzen? Eine Smart-Ehe ist da wirklich das beste Mittel.«
Im Vorfeld der nächsten Parlamentswahlen wurde Jem dann das Gesicht einer landesweiten Kampagne, die für die Smart-Ehe warb. Sie trat im Fernsehen auf, im Radio, in den sozialen Netzwerken und in Werbeaktionen, die mithilfe von virtuellen Assistenten durchgeführt wurden. Als die Regierung für eine vierte Amtszeit gewählt wurde und das Gesetz problemlos das Parlament und das Oberhaus passierte, wurde Jem sogar die Stimme des Audite. Doch jetzt war sie, wie Roxi festgestellt hatte, über Nacht durch eine männliche Stimme ersetzt worden.
In den drei Jahren, in denen das neue Ehegesetz nun in Kraft war, hatte die Anzahl seiner Gegner im ganzen Land beträchtlich zugenommen. Alleinstehende, Verwitwete, Geschiedene und Paare, die ihre Ehe auf keinen Fall upgraden wollten, beschwerten sich, dass sie diskriminiert würden. Ein Großteil ihrer Gehässigkeit richtete sich gegen Jem, das öffentliche Gesicht des Gesetzes, und nicht gegen diejenigen hinter den Kulissen, die unsichtbar blieben. Gruppen bildeten sich, die Jems Arbeit gezielt störten, ihre Privatanschrift und ihre Telefonnummer veröffentlichten und sie mit dem Tod bedrohten. Nachdem sie monatelang beschimpft worden war, verschwand das Funkeln, das Millionen Menschen verzaubert hatte, nach und nach aus ihren Augen. In ihren späteren Videos sprach sie über psychische Probleme und berichtete davon, dass wegen des Drucks, der auf ihr lastete, ihre letzte Beziehung in die Brüche gegangen war. In ihrem vorletzten Clip weinte sie hemmungslos und schrie in die Kamera, als sie davon erzählte, wie sie ihre beiden Hunde vergiftet im Garten gefunden hatte. Zu viel sei zu viel, sagte sie, und dass sie die sozialen Medien verlassen würde.
Jems letzter Videoblog war der einzige, den Roxi nicht bis zum Ende ansehen konnte. Als Jem nach der Pistole griff, drückte sie auf »Stop«.
»Neun Stunden und siebenundvierzig Minuten«, sagte Owen, als er ins Schlafzimmer kam. »So lange sitzt du schon hier und surfst im Internet.«
»Echt?«, fragte Roxi überrascht. Sie rieb sich die ermüdeten Augen, und Owen ließ den Blick über die offenen Kekspackungen und die Getränkedosen schweifen, die auf dem Nachtschränkchen lagen.
»Laut Familien-Bildschirmzeitmesser und der Bewegungs-App warst du den ganzen Tag nur hier und im Badezimmer«, fuhr Owen fort und zog seine Arbeitsklamotten aus. »Und jetzt ist es fast halb sieben.«
»Spionierst du mir nach?«
»Und nach der Tüte vom Lieferdienst zu urteilen, die auf der Kücheninsel steht, haben sich Darcy und Josh mal wieder was bestellt, oder?«
Die Kinder hatte Roxi ganz vergessen. Sie hatte gehört, wie sie aus der Schule gekommen waren, war aber viel zu vertieft in Jems Welt gewesen, um in ihre eigene zurückzukehren. Sie nahm das Band aus ihrem langen blonden Bob und drückte ihre Haare zusammen.
»Ich mach mir Sorgen um dich, Rox«, fuhr Owen fort. »Es ist nicht normal, so viel Zeit im Internet zu verbringen.«
»Ich muss dir was Wichtiges sagen«, verkündete Roxi. »Ich weiß jetzt, wie ich meinen Videoblog weiter pushen und mir als Influencerin einen Namen machen kann.«
»Klar«, sagte Owen mit einem Lächeln, das nur auf seinen Lippen zu sehen war, nicht jedoch in seinen Augen. »Natürlich geht es um deinen Videoblog. Worum auch sonst?«
»Ich werde die neue Jem Jones. Durch ihren Tod ist eine Marktlücke entstanden, und wenn ich fix bin und mich geschickt anstelle, kann ich diese Lücke füllen.«
»Und wie genau willst du das machen?«