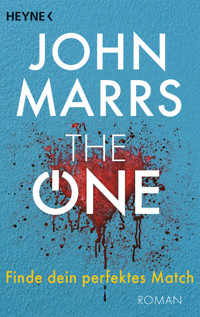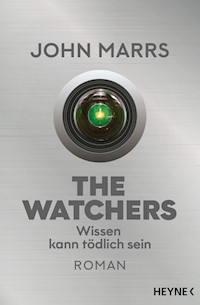
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im digitalen Zeitalter sind Informationen wertvoller als Gold. Doch Computer können gehackt und Files gestohlen werden. Nach einem massiven Cyberangriff fürchtet die britische Regierung um ihre Staatsgeheimnisse und entwickelt einen ebenso riskanten wie genialen Plan: die brisantesten Informationen werden offline genommen, in einen genetischen Code umgewandelt und fünf Zivilisten implantiert. Dafür bekommen diese so genannten Wächter die Chance auf ein neues Leben, eine neue Identität und finanzielle Unabhängigkeit. Auf keinen Fall aber dürfen sie Kontakt zueinander aufnehmen, denn gemeinsam kennen sie jede noch so schmutzige Parteiaffäre, die Wahrheit über Lady Di's Tod und die intimsten Geheimnisse der Queen. Doch jeder der Wächter verfolgt eine eigene Agenda, und schon bald entwickelt das Regierungsprojekt eine Dynamik, in der niemand mehr weiß, wem er eigentlich noch trauen kann ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Auf den ersten Blick haben Restaurantbesitzerin Flick, Dauersingle Charlie, Ingenieurin Sinéad und der alleinerziehende Vater Bruno nichts gemeinsam – außer, dass sie alle in einer tiefen Lebenskrise stecken: Flick muss einen tragischen Verlust verkraften, Charlie ist einsam, nachdem alle seine Freunde Familien gegründet haben, Sinéad wird von ihrem Ehemann drangsaliert und Bruno wurde von seiner Frau betrogen. Sie alle klicken eines schönen Abends auf einen Link, der sie zu einem schwierigen Rätsel führt. Wer das Rätsel löst, der bekommt die Chance auf ein neues Leben, so verspricht es die Social-Media-Anzeige. Keiner der vier ahnt, dass dieser Link sie direkt in ein geheimes Regierungsprogramm katapultiert. Ausgestattet mit einer neuen Identität, beginnen sie fernab von ihren Heimatstädten ein völlig neues Leben im Wohlstand – das einzige, das sie dafür tun müssen, ist, die Staatsgeheimnisse Großbritanniens mit ihrem Leben zu schützen. Doch einer von ihnen ist ein Verräter, und schon bald beginnt eine mörderische Jagd auf die Wächter …
Der Autor
John Marrs arbeitete über zwanzig Jahre als freischaffender Journalist für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften. Mit seinem Roman The One gelang ihm in England der Durchbruch, die Netflix-Adaption von The One ist international ein riesiger Erfolg. Der Autor lebt und arbeitet in London.
Mehr über John Marrs und seine Romane erfahren Sie auf:
diezukunft.de
JOHN MARRS
THEWATCHERS
Wissen kann tödlich sein
Roman
Aus dem Englischen übersetztvon Felix Mayer
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der Originalausgabe
THE MINDERS
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 09/2021
Redaktion: Joern Rauser
Copyright © 2020 by John Marrs
Copyright © 2021 der deutschsprachigen Ausgabeund der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat GbR, München,unter Verwendung eines Motivs von Shutterstock
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-27349-1V001
www.diezukunft.de
»Wenn es um etwas wirklich Wichtiges geht, schreiben Sie es auf und verschicken Sie es ganz altmodisch mit der Post. Denn glauben Sie mir: Kein Computer ist sicher.«
– Donald Trump
»Wenn du ein Geheimnis bewahren willst, musst du es auch vor dir selbst verbergen.«
– George Orwell
PROLOG
Während er das schwach erleuchtete Treppenhaus hinaufstieg, kniff er sich in die Nase und verzog das Gesicht.
Die muffigen Büroräume, die Lee Dalgleish gleich betreten würde, lagen im Zentrum Londons in der Nähe der Themse, nur einen Steinwurf von der ehemaligen Battersea Power Station entfernt. Die drückende Hitze machte den fauligen Gestank von stehendem Wasser und von Feuchtigkeit, die die Mauern hinaufkroch, noch unerträglicher als sonst.
Zwei leere Tische und ein Stuhl mit gebrochener Lehne waren die einzigen Möbelstücke in diesem Teil des Gebäudes, abgesehen von einer Leiste mit Telefondosen, die über den Boden verlief, und zwei kaputten Monitoren, die schief an einer Wand hingen. Ein ungeübtes Auge hätte keine Hinweise darauf gefunden, was sich in den Räumen dieses Hauses verbarg.
»Der größte Teil der wirklich wichtigen Regierungsarbeit wird nicht hinter den Mauern von Westminster oder Downing Street erledigt«, hatte Dalgleish mehrere Monate zuvor am Tag seiner Einweisung erfahren. »Sondern an Orten wie diesem. Sich in aller Öffentlichkeit verstecken – das ist die Devise.«
Er gab seine Umhängetasche aus Segeltuch, sein Handy, sein Portemonnaie, sein Tablet und seine Jacke einem der Security-Mitarbeiter und ging durch den Ganzkörperscanner. Wie die vier Wachleute am Eingang des Gebäudes waren auch diese drei hier bewaffnet.
Noch immer hatte er ein mulmiges Gefühl, wenn er gescannt wurde. Dafür gab es eigentlich keinen Grund, denn er musste diese Prozedur vor jeder Schicht über sich ergehen lassen und hatte außerdem nichts getan, was den zahllosen Regeln widersprochen hätte, denen er unterworfen war. Dabei fühlte er sich so, wie wenn er am Flughafen Heathrow zum Ticketschalter ging oder den Ausgang nahm, über dem NICHTSZUVERZOLLEN stand: wie jemand, den eine schwere Schuld bedrückt. Er öffnete den Mund, ein elektronischer Abstrich-Sensor fuhr über seine Zunge, und kurz darauf blinkte ein grünes Licht.
»Alles in Ordnung«, sagte die Wachfrau, ohne eine Miene zu verziehen. Sie musste hier neu sein, jedenfalls konnte sich Dalgleish nicht an sie erinnern. Ihre sanften Gesichtszüge, ihre großen blauen Augen und ihre langen Wimpern bildeten einen krassen Gegensatz zu ihrem muskulösen Körper, der sich unter dem weißen Hemd und der kugelsicheren Weste abzeichnete.
»Danke«, murmelte er und wandte den Blick hastig ab, als er bemerkte, dass er ihr etwas zu lange in die Augen gesehen hatte. Starke Frauen, ob körperlich oder intellektuell, ängstigten und erregten ihn in gleichem Maße.
Er streckte die Arme aus, drückte die Fingerkuppen auf einen Bildschirm und sagte ein paar Worte, während die biometrischen Systeme seine Augen abtasteten und seine Stimme analysierten. Kurz darauf öffnete sich vor ihm die letzte der Metalltüren, die er passieren musste.
Die Erderwärmung – die neuerdings Erderhitzung genannt wurde – sorgte für einen weiteren heißen und stickigen Märzmorgen, der Dalgleish in eine gereizte Stimmung versetzte. In der Nacht hatte er die Fenster seiner Wohnung im zweiten Stock offen gelassen, doch anscheinend hatte der Nachtclub im Nebenhaus seine Soundanlage aufpoliert, denn das Wummern der elektronischen Beats hatte den ganzen Abend alle anderen Geräusche überlagert. Nachdem er sich Kügelchen aus Toilettenpapier in die Ohren gestopft hatte, war er irgendwann eingeschlafen, hatte dann jedoch am Morgen das Wecksignal seines Handys überhört. Jedes Mal, wenn er den Besuch im Fitnessstudio ausfallen ließ – was nur selten passierte –, kam ihm wieder der übergewichtige und von den anderen gemobbte Teenager in den Sinn, der er früher gewesen war, und eine leichte Angst befiel ihn. Er beruhigte sich mit dem Gedanken, dass ein einzelner ausgefallener Workout nicht gleich wieder den Lee Dalgleish von damals aus ihm machen würde. Und doch nahm er sich vor, nach der Arbeit, egal, wie spät es dann schon war, noch zum Spinning zu gehen, um das am Morgen Versäumte nachzuholen.
Auf dem Weg zu dem Unisex-Umkleideraum ließ er die Schultern kreisen, um die aufkommende Anspannung zu lösen. Unter den aufmerksamen Blicken eines weiteren Wachmanns zog er sich aus und legte seine Kleidung in einen Metallcontainer. Erst danach erhielt er seine Uniform für den heutigen Tag, alles neue Stücke, die noch nie zuvor getragen worden waren. Sie bestanden aus einem unbestimmbaren Material und besaßen weder Taschen noch Säume, in denen man etwas hinein oder hinaus hätte schmuggeln können. Weder Unterwäsche noch Socken waren erlaubt, nur die einheitliche Kluft aus T-Shirt, Hose und Sandalen.
Nachdem er sich umgezogen hatte, betrat er ein fensterloses Großraumbüro und ging dort zu seinem Arbeitsplatz. In dem Raum befanden sich etwa vierzig Menschen, die alle Ohrhörer oder VR-Brillen trugen und Tablets in der Hand hielten oder darauf herumtippten. An die Wände wurden Dutzende Monitorbilder projiziert, von denen jedes einen anderen Ort zeigte, keines aber Gebäude oder Menschen, sondern ausnahmslos Straßen, Autobahnbrücken, Wasserflächen und Himmel.
Dalgleish tippte einem Mann, der in einem Sessel saß und auf ein Monitorbild starrte, auf die Schulter. »Hey, Lee«, sagte der Mann und gähnte. »Ist es schon so weit?«
Dalgleish nickte. »Allerdings. Hab ich was verpasst?«
»Nein, alles wie immer«, antwortete Irvine. »Keine Umleitungen, die Batterien sind noch bei rund achtzig Prozent, und der Reifendruck ist konstant.«
»Und wo geht’s heute hin?«
»In gut einer Stunde sollten wir die M90 und die Queensferry Crossing Bridge erreicht haben. Dann geht’s rauf nach Perth und Dundee, danach durch Schottland zurück Richtung Süden. Wenn deine Schicht vorbei ist, müssten wir irgendwo in der Gegend von Newcastle sein.«
Irvine stand auf, zog sich den Ohrhörer heraus, nahm die Smart Glasses ab und warf beides in einen Schredder für Elektrogeräte, der unter dem Schreibtisch stand. »Bis morgen«, sagte er und tippte sich an einen imaginären Hut.
Dalgleish setzte sich und tippte einen siebenstelligen Code in das Nummernfeld einer Security-Box aus Aluminium, die er am Eingang mitgenommen hatte. Der Deckel der Box sprang auf, und Dalgleish holte unbenutzte Smart Glasses und einen neuen Ohrhörer heraus. Dann nahm er einen Proteinriegel aus seiner Schublade und machte es sich bequem.
Das Bild, das er für den Rest des Tages betrachten würde, war dasselbe, das er bis jetzt an jedem Tag betrachtet hatte, seitdem er diesen Job machte: das leere Führerhaus eines autonomen Sattelschleppers. Eine Anzeige in einer Ecke des Bildes verriet, dass das Fahrzeug seit sechsundsiebzig Tagen ununterbrochen unterwegs war. Seine Batterien bezogen ihren Strom durch kabellose Übertragung aus Drahtspulen, die unter dem Asphalt lagen, und die Reifen gaben wie sich häutende Reptilien ihren Belag ab, sodass regelmäßig ein neuer zum Vorschein kam. Der Lastwagen fuhr konstant mit fünfundfünfzig Meilen pro Stunde, legte seine Route selbstständig fest und berechnete die Fahrtzeiten. Dalgleishs Aufgabe bestand darin, das Fahrzeug auf mögliche Bedrohungen hin zu überwachen.
Während er den Riegel aß, überflog er die Statusberichte, die die Zentralkonsole im Führerhaus an seinen Computer geschickt hatte und die bestätigten, was Irvine gesagt hatte. Dann überprüfte er die Außenseiten des Fahrzeugs sowie die nähere Umgebung, indem er die Bilder einer Vielzahl von Kameras aufrief, die an den Seiten, am Heck und am Unterboden angebracht waren. Der einzige Ort, für den er keine Sicherheitsfreigabe hatte, war der Frachtraum des Anhängers.
Für andere Verkehrsteilnehmer sah dieser Sattelschlepper so aus, wie jeder andere auf Großbritanniens Straßen, ein fahrerloser Lastwagen ohne Aufschrift, wie es sie zu Tausenden gab. Der einzige Unterschied bestand in der Fracht, die er geladen hatte. Sie war von größerer Bedeutung, als irgendjemand sich je hätte vorstellen können. Nur wenige Leute, unter ihnen Dalgleish, hatten eine ungefähre Vorstellung davon, was sich in diesem Laderaum befand. Und noch weniger Leute kannten die genauen Einzelheiten. Er hatte unzählige Verschwiegenheitserklärungen und Dokumente mit Bezug auf das Gesetz zur Wahrung von Staatsgeheimnissen unterschreiben müssen, in denen er sich verpflichtet hatte, niemandem von den Inhalten seiner Tätigkeit zu erzählen.
Ab und zu ließ er den Blick über seine Kollegen schweifen, die über den Raum verteilt an ihren Arbeitsplätzen saßen. Die meisten hatten eine ähnliche Aufgabe wie er und beobachteten jeweils einen Lastwagen. Zwei von ihnen verfolgten ein solargetriebenes Flugzeug, und ein kleines Team behielt gemeinsam das Deck eines Frachtschiffes im Blick. Es hatte Container geladen und kreuzte in einer Endlosschleife durch die Nordsee, wobei es seinen Kurs immer wieder änderte, um Stürmen und Luftdruckschwankungen auszuweichen.
Mit dem rechten Auge nahm Dalgleish wieder seinen eigenen Lastwagen ins Visier, und mit dem anderen verfolgte er die aktuellen Nachrichten, die über eines der Gläser seiner Smart Glasses liefen. Er hatte ein paar Wochen gebraucht, um diese Form des Multitasking in aller Stille einzuüben, doch noch immer taten ihm am Ende jeder Schicht die Augen weh. Tag für Tag dasselbe Bild zu betrachten, war – wie er einmal zu Irvine gesagt hatte – einfach »sterbenslangweilig«. Und insgeheim fragte er sich, wie lange er es noch aushalten würde, bevor er darum bat, von dieser Überwachungseinheit weg auf eine andere Stelle versetzt zu werden, die ihn mehr herausforderte.
Eine Stunde war vergangen, und Dalgleish nahm gerade sein drittes Sudoku in Angriff, als ihm auf dem Monitor etwas auffiel. Irgendetwas war an dem Lastwagen vorübergeflogen. Jetzt war es schon wieder verschwunden, und vermutlich war es auch nur ein großer Raubvogel gewesen, weshalb er sich fast nicht die Mühe machen wollte, die Aufnahme zurückzuspulen. Doch er war verpflichtet, auch der kleinsten Kleinigkeit nachzugehen.
Er nahm die Brille ab und sah sich die Stelle noch einmal in Zeitlupe an, um die Details besser zu erkennen. Das Ding war kein Vogel gewesen, sondern eine Drohne. Am Himmel über Großbritannien flogen ständig Drohnen herum, und auch an Lees Lastwagen waren schon öfter welche vorübergezogen. Doch nachdem er sich diese hier durch ein Dutzend verschiedener Kameras angesehen hatte, musste er feststellen, dass sie hartnäckiger als andere war. Es schien, als verfolge sie den Lastwagen und lasse ihn nicht aus dem Blick. Lees Magen verkrampfte sich. Bei dem, was er da sah, war ihm unwohl.
Er sah sich nach Dominique um, seiner Teamleiterin, die in ihrem Büro in einer Ecke des Raumes an ihrem Schreibtisch saß. Unruhig ging er zu ihr hinüber und klopfte an die Tür.
»Dom«, sagte er, »tut mir leid, wenn ich dich störe, aber ich habe da möglicherweise einen Vorfall für Alarmstufe Gelb.«
Sie klappte ihren Laptop zu. »Wieso, was ist denn los?«
Als sie zu seinem Arbeitsplatz kamen und auf den Monitor blickten, waren durch die Kameras in der Frontscheibe zwei weitere Drohnen zu sehen. Die Kameras am Heck und an den Seiten zeigten, dass noch zahlreiche weitere das Fahrzeug umschwirrten.
Dominique tippte auf ihren Ohrhörer, sagte ein paar Worte, und kurz darauf standen ihre drei Vorgesetzten neben ihr. Dalgleish kannte die drei – zwei Männer und eine Frau – vom Sehen, er hatte manchmal mitbekommen, wie sie in anderen Büroräumen des Gebäudes verschwanden, hatte aber nie ein Wort mit ihnen gewechselt. Er fühlte sich unwohl, als sie sich jetzt hinter ihm versammelten.
»Hat sonst noch jemand was Auffälliges?«, fragte Dominique durch den Raum. Die Antwort war ein vielstimmiges Nein.
»Ach du Scheiße, was ist das denn?«, stieß Lee hervor. Er war so perplex, dass er vergessen hatte, wer neben ihm stand.
Die Kamera im Führerhaus zeigte, wie sich ein Schatten über das Fahrzeug senkte. Lee schaltete auf ein anderes Gerät um, das auf dem Dach montiert war, und drehte die Linse nach oben. Jetzt war die Unterseite eines Hubschraubers zu sehen, darüber die kreisenden Rotorblätter.
»Das ist ein Angriff«, sagte einer von Dominiques Vorgesetzten, als sich drei Gestalten auf das Dach des Lasters abseilten. Dann verzog sich der Schatten, der Hubschrauber stieg auf und verschwand in der Ferne. »Sie wissen, was wir transportieren.«
»Woher wissen die das?«, fragte Dalgleish, aber niemand ging darauf ein. »Was soll ich jetzt tun?«, fragte er weiter.
»Nichts, bis ich Ihnen weitere Anweisungen gebe.«
Auf einmal herrschte im ganzen Raum Stille. Einer der Eindringlinge zog einen zylinderförmigen Gegenstand aus seinem Rucksack und befestigte ihn auf dem Dach des Anhängers. Alle bewegten sich, als befänden sie sich auf dem Mond. Dalgleish vermutete, dass sie Schuhe mit Magnetsohlen trugen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren.
»Sie wollen ihn gar nicht entführen!«, rief Dominique. »Sie wollen ihn während der Fahrt ausräumen!« Im nächsten Moment stieg eine Rauchwolke auf, und im Dach klaffte ein Loch, so groß wie ein Gullydeckel.
»Welche Straße ist das?«, fragte ein anderer der namenlosen Vorgesetzten.
»Das Fahrzeug befindet sich auf der M90 und fährt gleich auf die Queensferry Crossing Bridge. Bald erreicht es den ersten der drei Pylonen«, sagte Dalgleish.
»Verkehrslage?«
Er überflog die Bilder der Kameras zur automatischen Kennzeichenerfassung. »Mäßiges Verkehrsaufkommen, keine Verzögerungen.«
»Kollateralschaden?«
Dominique sah auf ihr Tablet. »Gering, wenn wir sofort handeln.«
Dalgleish roch eine Mischung aus Schweiß und Aftershave, als sich der Mann über den Schreibtisch beugte und hastig auf der Tastatur herumtippte. Auf dem Bildschirm öffnete sich ein neues Fenster und darin ein Feld, in das er einen langen Code eingab. Dann drückte er eine Fingerkuppe an den Bildschirm, und auf der Oberfläche des Schreibtisches erschien die Projektion eines Schaltknopfs. Er wandte sich an Dominique.
»Sind wir uns einig?«, fragte er. Dominique sah auf den Bildschirm, wo der erste Angreifer durch das Loch im Dach verschwand.
»Ja«, sagte sie. »Alarmstufe Rot.«
Als die dritte Gestalt im Inneren des Frachtraums verschwunden war, drückte er den Knopf.
Aus dem Loch im Dach schossen Flammen und Rauch, und dann driftete der Lastwagen nach links. Er beschleunigte, hielt sich aber weiter auf der Fahrbahn, bis er den ersten Stützpfeiler passiert hatte, durchbrach danach mit achtundsiebzig Meilen pro Stunde den Sicherheitszaun aus Metall und stürzte über den Rand der Brücke. Zweihundert Meter weiter flussabwärts versank er in den Tiefen des Forth.
ERSTER TEIL
**VERSCHLUSSSACHE**
TOP SECRET: NUR BRITEN ZUR KENNTNIS, GEHEIMHALTUNGSSTUFE »A«
DIESES DOKUMENT IST EIGENTUM DER REGIERUNG IHRER MAJESTÄT
PROTOKOLL DER ASSESSMENT-SITZUNG 11.6 DES GEMEINSAMEN KOMITEES FÜR CYBERSPIONAGE UND GEHEIMDIENST
»EIN ALTERNATIVER ANSATZ ZUR SPEICHERUNG VERTRAULICHER DOKUMENTE«
**Hinweis: Der folgende Text gibt das Protokoll der o. g. Sitzung wieder. Um Sicherheitsrisiken zu vermeiden, wurden einige Abschnitte sowie die Namen einiger Teilnehmer unkenntlich gemacht.**
ORT:
,
TEILNEHMER (MITGLIEDER):
Edward Karczewski, Leiter Operative Abwicklung,
Dr. Sadie Mann, Leiterin Psychiatrische Begutachtung
Dr. M. J. Porter, Abteilungsleiterin Neurowissenschaft
, Verteidigungsministerium (VM); Militärisches Forschungszentrum Porton Down
, Geheimdienst, Abt. MI5
William Harris, Minister für geheimdienstliche Angelegenheiten
TEILNEHMER (NICHTMITGLIEDER):
Premierministerin Diane Cline
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
EDWARD KARCZEWSKI: Weil die Premierministerin an unseren bisherigen Sitzungen nicht teilgenommen hat, würde ich gerne zu Beginn kurz den aktuellen Stand der Dinge zusammenfassen.
PREMIERMINISTERIN: Danke, Edward, aber zuvor würde ich noch gern fürs Protokoll festhalten, dass ich ausgesprochen ungehalten darüber bin, dass ich erst vor vierundzwanzig Stunden von der Existenz dieses Programms erfahren habe. Bis dahin hat man es mir absichtlich verheimlicht. Daher werde ich eine interne Untersuchung auf den Weg bringen, die herausfinden soll, wie das möglich war.
EDWARD KARCZEWSKI: Dabei können Sie auf unsere volle Unterstützung zählen. Ich hoffe jedoch, dass Sie nach diesem Meeting verstehen, weshalb ein solches Programm unter Verschluss gehalten wurde. Also, um es kurz zusammenzufassen: Vor zweieinhalb Jahren hat eine cyberkriminelle Organisation, die als das Hackerkollektiv bekannt geworden ist, unser Netzwerk autonomer Fahrzeuge, das damals stark expandierte, unterwandert und Tausende Fahrzeuge umprogrammiert und dadurch massenhaft Unfälle verursacht. Dieser heimtückische terroristische Akt forderte 5120 Todesopfer und Verletzte. Seit der Corona–Pandemie 2020 hat kein Ereignis auf britischem Boden mehr Menschenleben gekostet. Das Kollektiv bezeichnete den Angriff als einen Akt von »moralischem Hacktivismus« und behauptete, es hätte die moralische Verpflichtung, die Welt darauf aufmerksam zu machen, dass die damalige Regierung auf gesetzeswidrige Weise darauf Einfluss genommen hatte, wie autonome Fahrzeuge bei Unfällen Entscheidungen über Leben und Tod treffen. Entgegen den Behauptungen der Verantwortlichen hatten diese Entscheidungen nicht zum Ziel, möglichst viele Menschenleben zu retten, vielmehr wurden sie anhand sozialer und ökonomischer Faktoren getroffen. Je höher der ermittelte Wert einer Person für unsere Gesellschaft war, desto höher waren auch ihre Überlebenschancen.
WILLIAM HARRIS: Ich darf bei dieser Gelegenheit klarstellen, dass die Schuld nicht bei der gesamten Regierung lag, sondern nur bei einzelnen Mitgliedern. wurden alle zur Rechenschaft gezogen, mit Ausnahme des verstorbenen Abgeordneten Jack Larson.
PREMIERMINISTERIN: Seine Ermordung durch das Hackerkollektiv mag bedauerlich gewesen sein, kam aber nicht gänzlich unerwartet, wenn man bedenkt, dass er an den Manipulationen maßgeblich beteiligt war. Doch kein Mensch hat es verdient, bei einem Attentat mit einer Autobombe hingerichtet zu werden, das weltweit live gestreamt wird.
EDWARD KARCZEWSKI: In der Tat. Rückblickend betrachtet, war der Angriff auf die Fahrzeuge allerdings nur die Spitze des Eisbergs. Vor Kurzem hat das Kollektiv eine neue Angriffswelle gestartet und mithilfe von Schadsoftware die IT-Systeme einzelner Staaten gehackt. Albanien und die Türkei hat es als Erste getroffen. Die Hacker sind in die 5G-Mobilfunknetze eingedrungen, haben die Hardware der Behörden funktionsunfähig gemacht und so einen allgemeinen Stillstand verursacht – bei Datenüberwachungszentren, Verkehrsampeln, Rettungsdiensten und Bezahlsystemen für Einzelhandel und Industrie. Darüber hinaus haben sie Überspannungen in den intelligenten Stromnetzen verursacht, was zu landesweiten Blackouts führte, sowie Satelliten vom Kurs abgebracht und in der Erdatmosphäre verglühen lassen. Erst nachdem die beiden Länder jeweils Dutzende Millionen Bitcoins Lösegeld gezahlt hatten, konnten sie den Betrieb wieder normalisieren und beschädigte Daten rekonstruieren. Aber das Ausmaß dieser Angriffe war geradezu lächerlich im Vergleich zu dem, was das Kollektiv mit Estland und Rumänien vorhatte. Diese beiden Länder mussten erleben, wie die Hacker vertrauliche Informationen in ihren Besitz brachten: über Verwahrungsorte von Waffen, Depots der Zentralbanken etc. Und das Kollektiv drohte damit, diese Staatsgeheimnisse preiszugeben, sollten die Länder nicht auf die Lösegeldforderungen eingehen.
PREMIERMINISTERIN: Wie sind sie an diese Informationen gekommen?
, MI5: Die betroffenen Länder hatten ihre sensiblen Daten in Datenzentren und Bunkern gespeichert, die physisch durch strengste Sicherheitsvorkehrungen geschützt sind, so wie unsere. Diese Speicherorte sind jedoch an ihren geografischen Standort gebunden, weshalb die Angreifer sie irgendwann ausfindig machen konnten. Dem Kollektiv gelang es, die Verschlüsselungscodes zu knacken und in die biometrischen Systeme, Sperranlagen und Videoüberwachungssysteme einzudringen, und zwar jeweils durch die Online-Kühlsysteme, die weniger stark gesichert waren. Und als sie einmal drin waren, konnten sie sämtliche vertraulichen Informationen abgreifen.
PREMIERMINISTERIN: Wie ist derzeit die Lage in den beiden Ländern?
, VM: Satellitenaufnahmen von heute Morgen zeigen, dass sich der Norden Estlands schon unter russischer Kontrolle befindet, und Erkenntnisse des Geheimdienstes lassen darauf schließen, dass sich der Süden auch bald ergeben wird. Rumänien ist den Forderungen in voller Höhe nachgekommen, weil man dort ohne Codes für die Aktivierung von Waffen einer Invasion machtlos gegenübergestanden hätte. Jetzt sind Grenzschutz und Sicherheitssysteme zwar wieder intakt, aber der Staat ist bankrott. Heute Morgen wurde Saudi-Arabien angegriffen. Vermutlich wird sich das Ganze zu einer globalen Pandemie ausweiten.
PREMIERMINISTERIN: In welchem Ausmaß ist das Vereinigte Königreich bedroht?
, MI5: Ernsthaft. Das ist eine Stufe vor Unmittelbar.
WILLIAM HARRIS: Wir haben Milliarden investiert, um dieses Land zu schützen, sowohl physisch als auch vor Hackerangriffen. Soll das heißen, dass das alles umsonst war?
, MI5: Nein, aber das Risiko nimmt deutlich zu. Alle verfügbaren Programmierer, sowohl interne als auch externe, kämpfen mit allen Mitteln dafür, dass unsere Server uneinnehmbar bleiben. Aber wir stehen auf verlorenem Posten, Frau Premierministerin. Die Angreifer verfügen über Quantentechnologie, weshalb ihre Computer Zehntausende Millionen Mal schneller sind als die meisten von unseren. Dadurch haben sie leichtes Spiel, wenn sie unsere Verschlüsselungscodes knacken wollen. Die Technologien, mit denen wir uns schützen, entwickeln sich nicht so schnell wie diejenigen, mit denen wir angegriffen werden. Wir laufen vor einem Maschinengewehr davon, dessen Magazin unerschöpflich ist. Irgendwann erwischt es uns.
PREMIERMINISTERIN: Wollen Sie damit sagen, dass die anderthalb Millionen Männer und Frauen, die in zwei Weltkriegen für unsere Freiheit gekämpft und dabei ihr Leben gelassen haben, umsonst gestorben sind? Denn in meinen Ohren klingt das, als wollte uns jetzt, hundert Jahre später, ein unsichtbarer, nicht zu greifender Feind all dessen berauben, was uns groß gemacht hat.
EDWARD KARCZEWSKI: Das wird ihm nicht gelingen, wenn es keine Informationen gibt, die er stehlen kann.
PREMIERMINISTERIN: Was soll das heißen?
EDWARD KARCZEWSKI: Vor sechs Monaten wurde beschlossen, die Nationalarchive, sowohl das historische als auch das aktuelle, offline zu schalten.
PREMIERMINISTERIN: Wer hat das beschlossen?
EDWARD KARCZEWSKI: Diese Maßnahme gehörte zu einem Projekt, das begonnen wurde, noch bevor Sie Ihr Amt angetreten haben. Der letzte Schritt dieses Projekts bestand darin, alle sensiblen Informationen vom Netz zu nehmen und auf die Straße zu verfrachten. Sämtliche Informationen, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollen, wurden ausgedruckt und in sieben Sattelschlepper, ein Flugzeug und ein Frachtschiff verladen, die ununterbrochen über unsere Straßen fahren beziehungsweise im Luftraum kreisen und im Meer kreuzen. Das ist mehrere Monate lang gut gegangen. Bis gestern, als einer der Lastwagen zu Schaden kam und wir das Programm abbrechen mussten.
PREMIERMINISTERIN: Welche Arten von Informationen sind da auf Reisen gewesen?
EDWARD KARCZEWSKI: Solche Daten, die wir nicht täglich brauchen, und solche, die unveränderlich sind. Vor der Einführung von Computern wurden sie an geheimen Orten aufbewahrt, die über ganz London verteilt waren. Dann wurden sie elektronisch in Datenzentren gespeichert, die sich überall im Land befanden und mit Festplatten und Prozessoren vollgestopft waren. Und dort befinden sie sich auch jetzt wieder, seitdem die Lastwagen von den Straßen abgezogen wurden. Diese Standorte sind zwar so gut geschützt wie Militäranlagen und nach höchsten kalifornischen Normen erdbebensicher, aber die Hacker werden trotzdem irgendwann eindringen. Und aus diesem Grund plädiere ich für einen neuen Ansatz, um unsere Daten offline zu sichern.
PREMIERMINISTERIN: Wieder mit Lastwagen? Ich bin wirklich fassungslos, dass ein so aberwitziges Vorhaben jemals genehmigt wurde!
EDWARD KARCZEWSKI: Nein, diesmal nicht mit Lastwagen. Das sollte auch nur eine vorübergehende Maßnahme sein. Sie hat uns die Zeit zur Entwicklung eines alternativen Verfahrens verschafft, das vertrauliche Informationen sicher speichert und es Außenstehenden unmöglich macht, sie aufzufinden. Dieses Verfahren möchte ich Ihnen jetzt vorstellen, und ich bitte Sie, nicht voreilig zu urteilen. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit nun bitte auf den Bildschirm an der Wand lenken wollen.
** EDWARD KARCZEWSKI schaltet mit einer elektronischen Tastatur einen Bildschirm ein. **
PREMIERMINISTERIN: Was soll denn dieses Durcheinander von Figuren, Buchstaben und Zahlen, die da über den Bildschirm jagen?
EDWARD KARCZEWSKI: Damit finden wir die Menschen, die wir brauchen, um unser Land zu schützen.
1
Flick, London
»Ach nee!«, rief Flick empört. »Das glaubt ihr doch selbst nicht, dass ihr so viel dafür kriegt.«
Sie schüttelte den Kopf, als der Schätzpreis von 445000 Pfund auf dem Bildschirm erschien. Das junge Paar, das den baufälligen Bungalow renoviert hatte, war hellauf begeistert. Nicht so Flick. Sie sah tagsüber regelmäßig fern und war daher mittlerweile Expertin in allen Fragen rund um Immobilien.
Sie fischte eine Zigarette aus der Packung auf dem Couchtisch und zündete sie mit einem Wegwerffeuerzeug an. Das Geräusch der Flamme und der Zigarette, die knisternd zum Leben erwachte, ließ sie leicht zusammenzucken. Dann nahm sie einen langen, tiefen Zug, bis ihr der heiße Rauch in der Kehle brannte. Weil Zigaretten mittlerweile astronomisch teuer waren, hatte sie sich vorgenommen, täglich nur eine Handvoll zu rauchen. Doch jetzt war es erst später Vormittag, und das war schon ihre vierte.
Zu ihrer Überraschung teilte sich plötzlich der Fernsehbildschirm, und die eine Hälfte zeigte den Bereich vor ihrer Haustür. Obwohl die Person, die dort stand, den Kopf gesenkt hielt, erkannte die Gesichtserkennungssoftware darin Flicks Bruder Theo. Flick nahm einen weiteren langen Zug und beschloss, ihn zu ignorieren. Er drückte noch zweimal auf die Klingel und rief dann durch den Briefkasten:
»Ich weiß, dass du da bist. Ich kann den Rauch riechen, der unter der Tür durchzieht.«
Flick verdrehte die Augen. Sie hatte keine Lust, sich heute von Theo oder irgendeinem anderen Mitglied ihrer Familie stören zu lassen. Heute nicht und auch sonst nicht. Aber es hatte keinen Sinn, so zu tun, als sei sie nicht zu Hause. Sie war immer zu Hause. Sie rollte die Spitze der Zigarette an der Innenseite des Aschenbechers entlang, um den Rest für später aufzuheben, nahm eine Dose Raumspray und versprühte etwas von dem Duft im Zimmer. Dann schob sie drei Querriegel zur Seite, öffnete zwei Schlösser und tippte einen Code in einen Nummernblock. Als die Tür offen war, musterte sie der jüngste ihrer vier Brüder von oben bis unten.
»Du siehst echt scheiße aus«, blaffte er.
»Du hast dir einen Bart wachsen lassen«, entgegnete Flick. »Siehst aus wie Grandad.«
»Den hatte ich schon, als wir uns das letzte Mal gesehen haben.«
Flick zuckte mit den Schultern.
»Damals, als du deinen faulen Arsch das letzte Mal hochgekriegt und dir die Mühe gemacht hast, uns zu besuchen.«
»Wenn du mir mal wieder liebevoll die Leviten lesen willst – das kannst du dir sparen …«
»Nein, das ist nur eine nett gemeinte Dosis Realität.«
Der Streifen Tageslicht, der durch einen Spalt zwischen den zugezogenen Vorhängen fiel, erhellte einen feinen, rauchigen Schleier. Theo betrat die Wohnung, riss die Vorhänge auf, strich mit den Fingern über den Couchtisch und hinterließ dabei drei helle Streifen in der Staubschicht, in denen die Maserung des Holzes zu sehen war. Auch ohne diese Geste wusste Flick, dass er sie insgeheim tadelte, wegen des dreckigen Geschirrs, wegen der schmutzigen Wäsche, die in einem Haufen auf dem Küchenboden lag, wegen der zwei berstenden Mülltüten, des Kartons mit den leeren Weinflaschen und des überquellenden Aschenbechers. Sie konnte es ihm nicht verübeln, dass er sie für all das kritisierte.
Wie für viele ihrer Schwächen gab sie auch für dieses Chaos jemand anderem die Schuld. Ihm. Erst nach einer Weile, nachdem sie zum ersten Mal Bilder von seiner Wohnung gesehen hatte, die im Netz hochgeladen worden waren, hatte sie sich gefragt, wie sie mit so einem Ordnungsfimmel klargekommen wäre. Vielleicht hatte er bei sich zu Hause so penibel darauf geachtet, dass alles aufgeräumt war, weil der Rest seines Lebens ein entsetzliches Durcheinander gewesen war. Ein Teil von ihr musste eingestehen, dass sie von Glück sagen konnte, sein wahres Wesen nicht kennengelernt zu haben. Ein anderer, kleinerer Teil hielt weiter an der Vorstellung fest, dass es ihr vielleicht gelungen wäre, ihn zu ändern.
»Ich hab im Restaurant angerufen«, fuhr Theo fort. »An dein Handy gehst du ja nicht, und auf Nachrichten reagierst du auch nicht.« Flick antwortete nicht. Sie ahnte, was jetzt kam. »Ich hab nicht schlecht gestaunt, als sie mir gesagt haben, dass du einen Restaurantleiter eingestellt hast, der sich um alles kümmert, weil du aus persönlichen Gründen eine Auszeit nehmen wolltest. Vor einem Jahr.«
Flick zuckte mit den Schultern. »Ich bin einfach eine Zeit lang nicht da. Was macht das schon?«
»Was sind das für persönliche Gründe?«
»Es heißt ja nicht umsonst ›persönlich‹. Ich bin nicht die Einzige, die sich mal eine Auszeit nimmt.«
»Aber du hast eine Auszeit von deinem ganzen Leben genommen. Du hängst ihm noch immer nach, stimmt’s?«
»Wem?«, fragte sie zurück, aber sie wussten beide, wen Theo gemeint hatte.
»Das kann so nicht weitergehen, Felicity. Nur weil es mit ihm nicht geklappt hat, heißt das nicht, dass es nicht noch mit einem anderen klappen kann.«
»Er war mein Match«, entgegnete Flick.
»Aber vielleicht waren eure Testergebnisse manipuliert. Das ist doch Tausenden von Paaren passiert.«
»Das Ergebnis ist erst nach den Manipulationen gekommen«, sagte Flick entschieden. Theo hakte nicht weiter nach.
Sie konnte sich noch genau daran erinnern, wie sie eine E-Mail mit der Nachricht bekommen hatte, dass Match Your DNA ihren Partner gefunden hatte. Einige Jahre zuvor hatten Wissenschaftler festgestellt, dass jeder Mensch ein Gen besaß, das er mit genau einem anderen Menschen auf der Welt teilte. Dieser andere konnte buchstäblich jeder sein, unabhängig von Geschlecht, Religion, Alter oder Wohnort, und er war derjenige, der für einen selbst aufgrund der DNA-Verbindung bestimmt war. Ein Seelenverwandter. Innerhalb weniger Jahre war dieses Verfahren zur beliebtesten Methode der Partnerfindung geworden, und 1,7 Milliarden Menschen hatten eine Speichelprobe abgegeben und sich mit ihrer DNA registriert.
Etliche Monate nach einer Sicherheitspanne, bei der Tausende Paare fälschlicherweise gematcht worden waren, hatte Flick die E-Mail mit der Bestätigung erhalten, doch sie hatte ihr Match nicht mehr kennenlernen können. Er war ermordet worden.
Während sie noch versucht hatte, damit klarzukommen, hatte sie erfahren, wer er gewesen war. Seitdem fühlte sie sich wie ausgehöhlt.
Theo machte sich im Wohnzimmer zu schaffen, räumte herumliegende Zeitschriften auf, warf leere Chipstüten und Bonbonpapiere in den Müll und sammelte weggeworfene Kleidungsstücke ein. »Ich möchte dir helfen, Flick«, sagte er. »Wir machen uns Sorgen um dich, ich und Mum und Dad und alle anderen. Nicht mal bei dem sechzigsten Jahrestag unserer Großeltern hast du dich blicken lassen.«
Flick lachte höhnisch. »Ja, genau das hätte ich gebraucht! Einen ganzen Abend unter Leuten, die mich daran erinnern, dass ich niemanden habe, der mich so sehr liebt, dass er auch in sechzig Jahren noch bei mir ist.«
Theo murmelte etwas und stopfte Kleidungsstücke in die Waschmaschine. »Nein, lass das!«, protestierte Flick. »Die müssen nach Farben getrennt werden.«
»Schon klar. Weil die Wäsche nach Farben zu trennen jetzt das Wichtigste in diesem Saustall ist.«
»Ich hab gesagt, du sollst das lassen«, schnauzte sie ihn an, aber Theo ließ sich nicht beirren und zog die Schublade der Maschine heraus.
»Wo ist das Waschmittel?«
»Ich sag’s dir nochmal, Theo: Finger weg von meinen Sachen.«
Als Theo die Küchenschränke durchwühlte, hielt Flick es nicht mehr aus. Obwohl sie kleiner und schmächtiger war als ihr Bruder, drehte sie ihm einen Arm auf den Rücken, sodass er sich nach vorn krümmte, und schob ihn zur Tür.
»Verdammt noch mal!«, schrie Theo. »Ich will dir doch nur helfen!«
»Aber ich hab dich nicht um deine Hilfe gebeten, und ich will sie auch nicht«, blaffte sie zurück, öffnete die Tür und ließ ihn erst wieder los, als er draußen stand.
»Ich sag dir das als Bruder und als Freund«, erwiderte er und schüttelte seinen Arm aus. »Auch wenn er dein Match war, er ist es sicher nicht wert, dass du für ihn dein Leben wegwirfst.«
Flick wischte sich mit dem Ärmel ihres Pullovers die Augen trocken und schloss, so traurig lächelnd wie noch nie, die Tür.
Zurück im Wohnzimmer, ließ sie sich aufs Sofa fallen. Alles, was Theo gesagt hatte, traf zu, nur nicht, dass sie sich vielleicht noch einmal verlieben könnte. Das war ausgeschlossen. Die eine Gelegenheit, die sich ihr geboten hatte, war ihr wieder entrissen worden. Sie hätte alles dafür gegeben, in die Zeit zurückzukehren, in der sie jeden Morgen aufgewacht war und sich gefragt hatte, ob wohl heute die E-Mail mit der Mitteilung kommen würde, dass ihr Match gefunden war. Damals hatte sie noch hoffen können. Doch damit war es jetzt vorbei.
Flick klopfte die Reste des verbrannten Tabaks ab, zündete die Zigarette erneut an und schaltete den Fernseher auf einen Nachrichtenkanal. »Die Ausstellung eines anonymen Künstlers verursacht schon vor der für heute Abend geplanten Eröffnung kontroverse Diskussionen«, verkündete der Sprecher. »Die Installation nimmt Bezug auf eine Mordserie, bei der vor drei Jahren in London neunundzwanzig Frauen einem Serienmörder zum Opfer gefallen waren und die zu einer der größten Fahndungen in der Geschichte des Landes geführt hatte.«
»Fernseher Pause«, rief Flick. Ihr Herz raste. Sie brauchte einen Moment, um sich innerlich zu wappnen. Das Treiben des Mörders, der die Hauptstadt heimgesucht und dort wahllos Frauen ermordet hatte, bevor dann alles mit einem Schlag vorbei gewesen war, hatte die Öffentlichkeit monatelang in Atem gehalten.
»Fernseher weiter«, sagte sie, und das Bild des Nachrichtenkanals schaltete vom Studio in eine Galerie, in der Gemälde aller neunundzwanzig Leichen hingen. Manche waren blutüberströmt und boten einen grausigen Anblick. Flick drehte sich der Magen um.
»Nach Aussage des Künstlers, dessen Identität nicht bekannt ist, haben die Porträts nicht die Absicht, aus der Mordserie Kapital zu schlagen, sondern dienen dem Gedenken an die Opfer. Die Angehörigen der Opfer widersprechen dem jedoch und kritisieren die Ausstellung aufs Schärfste. Ihrer Ansicht nach sind die Bilder ›geschmacklos‹, und sie fordern, dass die Ausstellung untersagt wird.«
»Fernseher aus«, sagte Flick, und es wurde still im Raum. Sie ging zu der Tür, die auf den schmalen Balkon führte, und öffnete sie. Tagelang war sie nicht aus dem Haus gegangen, und als jetzt die frische Luft über ihre Haut strich, nahm ihr das fast den Atem.
Sie wollte diesen schrecklichen Abschnitt ihres Lebens einfach nur vergessen. Aber das war leichter gesagt als getan. Erst in der Nacht zuvor war ihr Opfer Nummer dreizehn im Traum erschienen, Kelly, die junge Bedienung mit dem Nasenpiercing, die Flick einen Monat vor ihrem Tod in ihrem Restaurant eingestellt hatte.
Erst mehrere Monate nach dem Mord an Kelly hatte Flick Kennedy erfahren, dass es sich bei dem Mann, der aufgrund ihrer gemeinsamen DNA unweigerlich die Liebe ihres Lebens war, um den Serienmörder Christopher Bailey gehandelt hatte.
2
Charlie, Portsmouth
In der einen Hand ein Bier, in der anderen ein paar Tüten Grünkohlchips und Nüsse, ging Charlie durch den Garten des Pubs. Vorsichtig, um nichts zu verschütten, schob er sich durch die ständig anwachsende Menge bis zu dem Holztisch mit zwei Bänken, auf dem in der Mitte ein »Reserviert«-Schild stand.
Weil England heute im Rahmen der Qualifikation für die Fußballweltmeisterschaft gegen den Erzrivalen Deutschland spielte, war im Garten hinter dem Lokal deutlich mehr los als an einem normalen Wochentag. Bei dem Spiel ging es um alles; wenn England jetzt verlor, wären sie bei dem Turnier im nächsten Jahr nicht dabei. Charlie kannte den Pub bestens. Seitdem sie in Kneipen gehen durften, waren er und seine Freunde zu allen wichtigen Spielen ins Wig & Pen gekommen, und heute Abend sollte diese Tradition fortgesetzt werden.
Charlie setzte sich, nahm einen Schluck Bier und sah auf die Uhr. Noch eine Viertelstunde bis zum Anstoß. Sein Blick wanderte zu der riesigen Videowand hinüber. Berühmte Fußballexperten gaben ihre Prognosen ab, waren aber im Stimmengewirr der Gäste kaum zu verstehen.
»Ist da noch frei?«, fragte jemand schroff. Vor Charlie stand ein sichtlich genervter Mann, umgeben von einer Gruppe von Freunden. Charlie errötete, als er ihre Blicke auf sich spürte.
»Nein, leider nicht«, sagte er leise und wie zur Entschuldigung. Der Mann sah ihn an, als wolle er einen Streit anfangen, schien es sich dann aber anders zu überlegen, murmelte etwas Unverständliches und wandte sich ab.
Insgeheim gab Charlie zu, dass er genauso verärgert gewesen wäre, wenn er hätte stehen müssen, während jemand anders sieben leere Plätze für sich beanspruchte. Obwohl er den Tisch schon vor Wochen gegen eine Gebühr reserviert hatte, war ihm das jetzt unangenehm.
Der heutige Abend bedeutete Charlie mehr, als irgendjemand in dem Pub ahnen konnte. Es war jetzt zweieinhalb Jahre her, dass die sieben Freunde zuletzt zusammen gewesen waren. Er dachte an die Hochzeit von Terry Stelfox zurück und daran, dass sie den Anfang vom Ende einer Freundschaft markiert hatte, die seit dem Kindergarten bestanden hatte. Wenn das Studium an verschiedenen Universitäten sie nicht hatte trennen können, so hatte Charlie in seiner Naivität geglaubt, dann würde nichts und niemand auf der Welt sie trennen können. Aber er hatte die Rechnung ohne Match Your DNA gemacht. Nach und nach fand jeder seiner Freunde die Frau – einer von ihnen den Mann –, die die Biologie für sie bestimmt hatte. Nur Charlie nicht. Sein Match hatte sich bis jetzt noch nicht gezeigt. Nie hätte er geglaubt, dass er sich mit Mitte zwanzig so einsam fühlen würde.
Er sah wieder auf die Videowand. Noch vier Minuten bis zum Anstoß. Er hatte die Snacks verputzt und kaute jetzt an den Fingernägeln. Weil er dabei zu viel abbiss, spürte er ab und zu ein Pulsieren in den Fingerkuppen. Er zog ein angstlösendes transdermales Pflaster aus der Tasche, kaum größer als eine Erbse, und klebte es sich auf den Unterarm.
Um sich abzulenken, bis das Mittel in seinen Körper drang und sein Gehirn erreichte, steckte er sich einen Ohrhörer ein und hörte die Nachrichten auf seinem Handy ab.
Die erste kam von Travis. »Sorry, Alter, ich schaff’s heute nicht. Die Zwillinge führen sich schon den ganzen Tag unmöglich auf, und Lisa ist völlig am Ende und hat sich hingelegt. Mach’s gut, bis bald.«
Die nächste war von Stelfox. »Ist das heute? Oh verdammt! Tut mir echt leid, Charlie, aber wir sind heute bei den Schwiegereltern zum Essen eingeladen.« Die Entschuldigungen der anderen fielen alle ähnlich aus.
Als der ganze Garten beim Einlauf der englischen Mannschaft aufjohlte und lauthals God Save the King mitsang, blieb Charlie sitzen. Die Teams brachten sich in Stellung, und mit einem Pfiff gab der Schiedsrichter die Partie frei. Doch schon nach wenigen Minuten wusste Charlie, dass es ihm keine Freude machen würde, das Spiel allein anzuschauen. Er trank sein Bier aus und machte sich auf den Weg zum Ausgang.
»Ist da jetzt frei? Hast wohl keine Kumpels mehr, oder was?«, höhnte der Mann, der ihn vorhin angesprochen hatte. Charlie fühlte sich gedemütigt und wollte schon kontern, aber die leeren Bänke sprachen eine eindeutige Sprache. Der Typ hatte es brutal und exakt auf den Punkt gebracht.
Als er auf der Straße stand, bestellte Charlie über eine App bei seinem Lieblingschinesen wahllos irgendein Gericht zur Lieferung. Dann sperrte er sein Fahrradschloss auf und radelte die fünfzehn Minuten nach Hause. Als er dort ankam, war die Drohne, die ihm die Single-Portion vor die Tür geliefert hatte, schon wieder auf dem Weg zurück ins Restaurant.
In der Küche nahm er die Deckel von den Aluschalen und stellte sie auf den Tisch, ohne das Essen auf Tellern anzurichten. Dann lockerte er den Gürtel um ein paar Löcher. Seit sie sonntagvormittags nicht mehr gemeinsam kickten, hatte er langsam, aber beständig zugenommen. Er vermisste das Zusammensein mit seinen Freunden, wenn sie samstagabends um die Häuser gezogen, am nächsten Morgen in aller Frühe mit einem höllischen Kater aufgewacht waren, eine Partie gespielt und sich dann im Pub einen Sonntagsbraten gegönnt hatten. Diese Stunden hatten ihm das Gefühl gegeben, Teil einer Gruppe zu sein.
Während er aß, kam ihm wieder ein Gespräch in den Sinn, das ihm klargemacht hatte, dass sich die Beziehungen in ihrem Freundeskreis allmählich verschoben. Stelfox war herausgerutscht, dass sich einige der Jungs mit ihren Frauen oder Freundinnen regelmäßig zum Abendessen oder zu Spieletreffen mit den Kindern verabredeten. Charlie wurde dazu nicht eingeladen, weil die anderen der Meinung waren, »Familienkram« sei nicht so seins. Er hatte genickt und geschwiegen. Nach nichts sehnte er sich mehr als nach »Familienkram«.
Heute Abend kehrte dieses Gefühl des Ausgeschlossenseins mit voller Wucht zurück. Charlie fragte sich, was wohl geschehen wäre, wenn er sich absichtlich aus der Gruppe zurückgezogen und sich einfach nicht mehr bei den anderen gemeldet hätte. Wie lange hätte es gedauert, bis ihnen aufgefallen wäre, dass sie ihn schon seit einer Weile nicht mehr gesehen hatten? Tage, Wochen, Monate? Oder wäre die Erinnerung an ihn allmählich verblasst, bis sie ihn ganz vergessen hätten?
Nichts wünschte er sich sehnlicher, als dass er genau das getan hätte, anstatt sich jetzt verzweifelt an früheren Zeiten festzuhalten, wie gerade eben, als er im Pub zwei Jahre alte Nachrichten abgehört hatte. Seine Freunde würden sich nie wieder mit ihm treffen, ganz einfach, weil er durch sein Verhalten alles kaputt gemacht hatte. Er klebte sich noch ein Anti-Angst-Pflaster auf den Arm und dann noch eines.
Er nahm sein Tablet zur Hand und surfte durch Seiten und Foren, die sich mit Verschwörungstheorien beschäftigten und die er schon seit Längerem intensiv verfolgte. Früher hatte er keiner dieser abstrusen Theorien Glauben geschenkt, die sich um UFOs, die Ermordung von Staatschefs oder nicht mehr auffindbare Massenvernichtungswaffen drehten. Er hatte das alles für Hirngespinste von Spinnern gehalten, die nichts Besseres zu tun hatten, als abwegige Theorien zu formulieren und sie dann mit fadenscheinigen Argumenten zu untermauern.
Doch als er sich einmal, auf der Suche nach einer Erklärung für die Ereignisse, die sein Leben verändert hatten, näher darin vertieft hatte, war ihm klar geworden, dass er dasselbe Ziel wie diese »Spinner« hatte. Sie alle suchten nach der Wahrheit, und zwar in einer Welt, in der das Eigentliche Tag für Tag unter einer Flut von Falschinformationen und Irreführungen begraben wurde. Schon bald warf er mehrmals täglich einen Blick auf die Websites und setzte die Erzählungen, die er dort vorfand, anhand eigener Ansichten fort.
Er weigerte sich, die amtliche Darstellung der Ereignisse anzuerkennen, und gab sich auch nicht damit zufrieden, dass die anschließenden Untersuchungen unter Verschluss gehalten wurden. Die Schuldgefühle wegen der Rolle, die er selbst dabei gespielt hatte, schlangen sich wie wilder Efeu immer weiter um sein Inneres und drohten, ihn zu ersticken. Daher die pausenlose Angst, die Entfremdung von seiner Familie und die dunkle Wolke, die ständig über ihm schwebte.
Gerade als er eines der einschlägigen Foren aufrufen wollte, fiel sein Blick auf eine Anzeige.
Klicken Sie hier, um ein neues Leben zu beginnen. Weniger als ein Prozent der britischen Bevölkerung kann dieses Puzzle lösen. Schaffen Sie es auch?
In dem scheinbaren Durcheinander aus Buchstaben, Schattierungen und Schemen erkannte er auf Anhieb eine Form und einzelne Wörter. Vielleicht lag es an den Grundkenntnissen im Programmieren, die er besaß, oder an seiner Zahlen-Raum-Synästhesie, dass sich in seiner Vorstellung Ziffern zu Strukturen zusammenfügten. »Das kann doch unmöglich so leicht sein«, murmelte er, machte sich aber dennoch an die Arbeit und schob mit den Fingerspitzen einzelne Figuren und Elemente auf dem Bildschirm hin und her, bis das Gefüge einen Sinn ergab.
Dank des Puzzles sah er wenigstens für kurze Zeit nicht mehr die Gesichter der Menschen vor sich, für deren Tod er mitverantwortlich war.
3
Sinéad, Bristol
»Das willst du heute Abend anziehen?«, fragte Daniel. Sinéad erschrak, als sie seine Stimme hörte. Sie war ganz in Gedanken versunken gewesen, während sie eine zweite Reihe künstlicher Wimpern über die erste geklebt hatte, und hatte nicht gesehen, wie Daniels Bild im Schlafzimmerspiegel aufgetaucht war.
»Ja«, antwortete sie und strich eine kurze Falte im Ärmel ihres gelben Kleides glatt. »Warum?«
Ihr Ehemann stand in der Tür. Er trug ein tailliertes Dinnerjacket, ein weißes Hemd und eine schwarze Fliege, und die Spitzen seiner polierten Oxford-Schuhe glänzten. Er war noch immer so attraktiv wie damals, als sie das Foto in seinem Online-Profil zum ersten Mal gesehen hatte. Allein sein Anblick verursachte ihr ein Kribbeln auf der Haut.
»Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass du das lilafarbene trägst«, sagte Daniel. Er klang enttäuscht.
»Haben wir das?«
Sinéad hatte Tage damit zugebracht, für die Feier von Daniels Firma – einer Agentur für digitale Medien – ein passendes Kleid auszuwählen, und sich schließlich für eines entschieden, von dem sie glaubte, dass es ihnen beiden gefiel. Als sie ihre Kleidung noch gekauft hatte, ohne dafür jeweils Daniels Zustimmung einzuholen, wäre dieses Kleid niemals in ihrem Online-Einkaufskorb gelandet. Es reichte ihr fast bis zu den Knöcheln, und die Ärmel bedeckten ihre Handgelenke, wodurch sie sich unförmig fühlte und ohne jeden Schick. Aber als Daniel ihr das Kleid geschenkt hatte, war er so begeistert gewesen, dass sie ihn nicht hatte verärgern wollen, indem sie ihm gestand, dass es ihr nicht gefiel.
»Findest du nicht, dass das gelbe hier besser zu einer Osterparty passt?«, fragte Sinéad.
»Als du es gekauft hast, hätte es vielleicht gepasst. Jetzt nicht mehr.«
Sie drehte sich zu ihm um. »Warum?«
»Na ja, es ist ein bisschen … also …«
»Also was?«
»Treib mich nicht in die Enge, Schatz. Das ist unfair.«
»Sag schon.«
Daniel seufzte. »Es … liegt ein bisschen eng an. An den falschen Stellen.«
»Findest du, dass ich zugenommen habe?«
»Nein, nein, ganz und gar nicht. Aber ich kenne dich. Du wirst dich heute Abend bestimmt mit den anderen Ehefrauen und Partnerinnen vergleichen.«
»Du denkst, ich habe mich gehen lassen«, sagte sie leise.
Daniel verdrehte die Augen. »Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich meine nur … ich weiß auch nicht … Wie oft warst du in letzter Zeit im Fitnessstudio? Ich habe ein Jahres-Abo für dich abgeschlossen und im Voraus Stunden bei einem Personal Trainer gebucht, aber du bist nur zweimal dort gewesen.«
»Lässt du mich etwa beschatten?«
»Ich habe Miguel in der Umkleide getroffen, und er hat gesagt, nach der zweiten Stunde habe er nichts mehr von dir gehört.«
»Ich hatte eben viel zu tun.«
»Und warum hast du mich dann gebeten, ihn zu engagieren?«
»Ich … ich habe dich gar nicht darum gebeten«, brachte Sinéad hervor. »Du hast gesagt, mir würde Krafttraining guttun.«
»Nein, du hast mich gefragt, ob du nicht etwas tun solltest, um deine Muskeln zu straffen. Und warum solltest du mich etwas zu deinem Äußeren fragen, wenn du nicht wollen würdest, dass ich dir mit deinen Gewichtsproblemen helfe? Du weißt, dass ich dir bei allem helfen kann. Ich würde alles für dich tun. Und wenn du mir sagst, dass du dich unattraktiv fühlst, dann kann ich natürlich zwischen den Zeilen lesen und helfe dir.« Er schüttelte den Kopf. »Manchmal macht es mir Sorgen, wenn du dich so falsch an unsere Gespräche erinnerst.«
Sinéad konnte sich tatsächlich nicht daran erinnern, gesagt zu haben, sie würde sich unattraktiv fühlen. Aber Daniel hatte recht damit, dass er ihr bei allem helfen konnte. Er löste ihre Probleme, auch solche, von denen sie gar nichts wusste.
»Also, zieh lieber etwas an, das dir besser steht, zum Beispiel das lila Kleid. Soll ich dir auch gleich den passenden Schmuck aussuchen?«
»Einverstanden«, antwortete Sinéad. Sie fühlte sich geschlagen. Sie betrachtete sich im Spiegel. Vielleicht hatte Daniel recht. Wie er ihr schon oft gesagt hatte, gab es an ihr immer noch etwas zu verbessern, und er wollte aus tiefstem Herzen immer nur ihr Bestes.
Während sie überprüfte, ob die künstlichen Augenbrauen richtig saßen, küsste er sie auf den Hals. Ich kann von Glück sagen, dass ich ihn habe, dachte sie. Nach dem, was passiert ist, hätten mich die meisten anderen Männer wohl verlassen.
Doch etwas anderes schnürte ihr ganz leicht die Kehle zu. Es war kaum zu spüren, aber es war da.
Von den frei liegenden Deckenbalken der umgebauten Scheune hingen weiße Lichterketten herab, eine Wand war mit einem Teppich aus weißen Rosen bedeckt, und auf den runden Tischen standen meterhohe Blumenvasen.
Als ein Heer von Servicekräften zeitgleich an jeden der zwei Dutzend Tische, die um die Tanzfläche herum gruppiert waren, das Dessert brachte, warf Sinéad einen Blick auf den in bunten Farben schillernden Teller, der ihr gereicht wurde, sah dann zu Daniel und lehnte höflich ab. Die ersten vier Gänge waren köstlich gewesen, und hätte Daniel nicht neben ihr gesessen, hätte sie jeden einzelnen bis zum letzten Bissen genossen. So aber hatte sie jedes Mal ein Drittel übrig gelassen, für den Fall, dass Daniel die Kalorien mitzählte.
Während der Fahrt von ihrer Wohnung zu dem Landhotel hatte sie kaum ein Wort gesagt. Erst als Daniel darauf zu sprechen gekommen war, hatte sie sich ausgemalt, wie bezaubernd die Partnerinnen seiner Kollegen aussehen würden. Vor einiger Zeit hatte er, nach einer ähnlichen Veranstaltung, beiläufig angemerkt, dass sie doch einmal Hautfüller verwenden solle, da ihr Gesicht, das früher so ausdrucksstark gewesen sei, jetzt nur noch müde wirke. Er hatte auch die Termine in der Praxis für sie vereinbart.
Auf jedem Tisch lag ein elektronisches Gerät, mit dem die Gäste aus einer endlosen Songliste Stücke auswählen konnten, die das automatisierte DJ-System dann spielte. Joanna, die Frau eines von Daniels Kollegen, die Sinéad schon ein paar Mal getroffen hatte und die heute neben ihr saß, reichte ihr das kleine Gerät.
»Kann ich dir helfen?«, fragte Daniel.
»Warum?«, erwiderte Sinéad. Sein Blick schien zu sagen: Du weißt ganz genau, warum. »Ich wollte gerade etwas von Ed Sheeran suchen«, sagte sie. »Den habe ich während des Studiums rauf und runter gehört.«
»Wirklich?«, fragte Daniel amüsiert. »Ich glaube, du bist die Einzige hier, die den noch hören will.«
»Damals war er einer der ganz Großen«, warf Joanna ein.
»Du musst entschuldigen«, sagte Daniel Verständnis heischend. »Meine Frau hat kein besonders gutes Gespür für die Stimmung in einem Raum.« Sinéad schlug die Augen nieder, wie ein Hund, der gescholten wird. »Sie hört nur Musik, deren Verfallsdatum längst abgelaufen ist. Und wer will schon etwas haben, dessen Verfallsdatum abgelaufen ist?«
Er legte ihr den Arm um die Schultern, zog sie an sich und umarmte sie. Sinéad konnte die gitarrenlastige Musik, die er am liebsten hörte, meist nicht leiden, aber er besaß ein schier unerschöpfliches Wissen über Musik und daher, so versicherte er ihr immer wieder, einen besseren Geschmack. Doch seine Musik brachte dunkle Farben mit sich, und von solchen war Sinéad früher oft genug umhüllt gewesen.
Mehrmals hatte sie ihm zu erklären versucht, was sie sah, wenn sie Musik hörte, und wie einzelne Töne vor ihrem geistigen Auge als bestimmte Farben erschienen. Sie hatte ihm erklärt, dass das so ähnlich war, wie wenn er einen vertrauten Song hörte, der ihn an ein bestimmtes Ereignis in seinem Leben erinnerte. »Früher hätten sie dich in eine Anstalt gesteckt, wenn du so etwas erzählt hättest«, hatte er barsch geantwortet. Sinéad hatte es dann nie wieder erwähnt.
»Wie kommt ihr mit eurer Wohnung voran?«, fragte Joanna. »Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, wart ihr gerade dabei, sie zu renovieren.«
»Wir machen da nur ein paar Schönheitsreparaturen. Streichen, Tapezieren, solche Sachen.« Während sie das sagte, stand Sinéad ein bestimmtes Zimmer vor Augen. Eines, das zu betreten ihr unmöglich war, unabhängig von seiner Ausstattung.
»Ich tue nichts lieber, als umzuziehen und von vorn anzufangen«, sagte Joanna. »Tim macht das wahnsinnig, aber ich bin nie so glücklich, wie wenn ich eine Wohnung oder ein Haus komplett neu gestalte.«
»Bei uns entscheidet Daniel über die Einrichtung. Er weiß immer ganz genau, was er will.«
»Ach ja?« Joanna kräuselte die Oberlippe, als stoße ihr etwas buchstäblich sauer auf. Diese Mimik und Joannas Tonfall überraschten Sinéad. Alle, die Daniel kannten, schienen ihn zu bewundern und waren von seinem Enthusiasmus und seiner Tatkraft fasziniert. Er besaß die Gabe, andere Menschen von seinen Ansichten zu überzeugen. Unter anderem dieses Talent hatte ihn am Anfang ihrer gemeinsamen Zeit so attraktiv für Sinéad gemacht. Es gab kaum jemanden, der Daniel nicht mochte.
Als einer der Kellner in ihre Nähe kam, winkte Daniel ihn an den Tisch.
»Für mich bitte einen Rum Cola. Joanna?«
»Ich nehme ein Glas Rotwein.«
»Einen Gin Tonic, bitte«, sagte Sinéad.
»Glaubst du nicht, du solltest jetzt nichts mehr trinken?«
»Das ist mein Song«, sagte Joanna, als die ersten Takte eines Liedes von Amy Winehouse erklangen. »Kannst du dich noch an sie erinnern?« Sinéad nickte; ihre verstorbene Mutter hatte Amy geliebt. »Dann komm«, sagte Joanna. »Kleines Revival unserer Jugend.« Sie nahm Sinéad beim Arm, und als sie aufstanden, sah Sinéad aus den Augenwinkeln zu Daniel hinüber. Seine missbilligende Miene verdarb ihr die Freude an dem schönen Moment. Beim Tanzen fühlte sie sich gehemmt, bei jedem Schritt, bei jedem Schwung mit den Armen. Noch bevor der Song zu Ende war, ging sie zu Daniel zurück, der sie jedoch ignorierte und in Richtung Toiletten verschwand. Als Joanna ebenfalls an den Tisch zurückkam, fasste sie Sinéad erneut am Arm.
»Diesen Mist musst du dir nicht bieten lassen«, sagte sie bissig.
»Was meinst du?«
»Du weißt genau, was ich meine. Du bist nicht die Idiotin, als die er dich andauernd hinstellt. Tut mir leid, wenn ich übergriffig bin, aber ich kann da einfach nicht länger zuschauen und den Mund halten. Jedes Mal, wenn ich euch bei solchen Veranstaltungen sehe, verhält er sich auf diese bevormundende Art. Das kotzt mich an, ehrlich. Er putzt dich bei jeder Gelegenheit vor allen Leuten runter. Früher bist du eine warmherzige und selbstsichere Frau gewesen, und heute denkst du über jedes Wort nach, das du sagst, damit dir ja nichts rausrutscht, was deinem Mann missfallen könnte. Er schikaniert dich, und wenn er neben dir sitzt, bist du nicht du selbst. Aber du willst mehr, das seh ich dir doch an. Du weißt nur nicht, wie du es dir holen sollst. Du bist so viel mehr als das, was er zulässt.«
Sinéad setzte schon dazu an, sich und ihren Mann zu verteidigen, Joanna zu erklären, dass sie nicht wusste, wie Daniel wirklich war, und ihr davon zu erzählen, wie er im schlimmsten Moment ihres Lebens zu ihr gestanden hatte. Sie verdankte ihm alles. Zugegeben, manchmal drückte er sich etwas schroff aus, aber das war einfach seine Art. Er meinte es nicht so. Er wollte nur ihr Bestes. Aber zum ersten Mal, seitdem sie zusammen waren, gelang es ihr nicht, ihn zu verteidigen.
»Auf dich wartet ein Leben ohne deinen Ehemann«, fügte Joanna hinzu. »Und du solltest es dir holen, denn glaub mir, wenn du das nicht tust, zermahlt er dich zu Staub. Es ist nicht zu spät, nochmal von vorn anzufangen.«
4
Emilia
Emilia zuckte am ganzen Körper, als hätte ihr jemand einen elektrisierten spitzen Gegenstand in den Schädel gestoßen. Ihre Augenhöhlen pochten, sie drückte den Rücken durch, warf den Kopf zur Seite und wollte schreien. Aber ihre Kehle war so rau, dass kein Laut hinausdrang.
Sie versuchte, die Arme zu heben, um sich gegen den unbekannten Angreifer zu schützen, aber weil ihr die Kraft fehlte, fielen sie wieder schlaff neben ihren Körper. Mit den Fingern ertastete sie etwas, das sich wie Bettwäsche anfühlte. Sie zog die Augenlider hoch. Ihre Augen waren staubtrocken, und das grelle Licht blendete sie und ließ sie alles verschwommen sehen. Erst nachdem sie sie mehrmals hintereinander rasch geöffnet und wieder geschlossen hatte, sammelte sich darin etwas Feuchtigkeit.
Als sich der Raum um sie herum immer deutlicher abzeichnete, erkannte Emilia, dass sie allein war. Der unerträgliche Schmerz, der sie durchfahren hatte, war ihr nicht von außen zugefügt worden. Weil ihre Arme geschwächt waren, brauchte sie mehrere Anläufe, bis es ihr gelang, die Hände an die Stelle ihres Kopfes zu führen, wo sie den Schlag gespürt hatte. An ihrem Kopf war nichts angebracht, keine Kabel, keine Schläuche. Hatte sie sich den Stromstoß nur eingebildet? Aber er hatte sich so echt angefühlt.
Plötzlich verspürte sie den Drang, sich aufzurichten. Sie drückte sich Zentimeter für Zentimeter nach oben, was in ihren kraftlosen Handgelenken ein stechendes Kribbeln auslöste. Als sie fast aufrecht saß, ballte sie die Hände zu Fäusten und löste sie wieder, um den Blutfluss anzuregen und ein Gefühl in den Händen zu bekommen. Mit zitternden Fingern griff sie nach der durchsichtigen Flasche, die auf dem Nachttisch stand. Sie führte sie an die Nase, roch daran und trank von dem Wasser, bis sie ihren Durst gelöscht hatte und anstatt eines Krächzens wieder menschliche Laute aus ihrer Kehle kamen.
Während sie den Blick über die fremde Umgebung schweifen ließ, dachte sie fieberhaft nach. Wo zum Teufel bin ich? Wie bin ich hierhergekommen? Was ist das hier für ein Ort? Weiß ich überhaupt, wie ich heiße? »Emilia«, sagte sie mit rauer Stimme.
Als ihr klar wurde, dass ihr Name das Einzige war, was sie mit Sicherheit über sich selbst wusste, durchfuhr sie eine ungekannte, allumfassende Angst.
Sie hielt eine Hand unter das Bett. Dort war ausreichend Platz, wo sie sich bei Bedarf verstecken konnte. Mit einem Mal wollte sie nach etwas suchen, das sie als Waffe und zur Verteidigung verwenden konnte. Warum fühle ich mich bedroht? Sie wusste es nicht. Nur ihre Intuition sagte ihr, dass sie in Schwierigkeiten steckte.
Der Raum sah wie ein Zimmer in einer Privatklinik aus, allerdings ohne die Ausstattung, die Emilia an einem solchen Ort erwartet hätte. So fehlten etwa Stühle für Besucher. Auf einem Tisch in einer Ecke stand, mit dem Bildschirm zur Wand, ein vereinzelter Monitor. Unter ihrer Kleidung – einem grauen Kapuzenpulli und einer Jogginghose – klebten überall auf ihren Armen, Beinen und dem Oberkörper transparente Pflaster. Sie tastete ihren Körper nach Wunden ab, nach Verbänden oder Schnitten, die auf eine Laparoskopie hingedeutet hätten, fand jedoch nichts. Also hatte man sie keinem Eingriff unterzogen.
Habe ich im Koma gelegen? Dutzende mögliche Erklärungen schossen ihr durch den Sinn, doch nur eines wusste sie mit Sicherheit: Irgendetwas an diesem Ort stellte eine Bedrohung für sie dar, weshalb sie ihn so schnell wie möglich verlassen musste. Doch als sie versuchte, sich daran zu erinnern, wo sie wohnte, fiel es ihr nicht ein. Ebenso wenig wollte ihr in den Sinn kommen, wie ihre Wohnung aussah, mit wem sie sie teilte oder was sie beruflich machte, wer ihre Familie und Freunde waren und welche Hobbys sie hatte. Diese Leere ängstigte sie noch mehr als der Raum, in dem sie sich befand.
Sie überschlug, dass es bis zur Tür etwa zwölf Schritte waren. Langsam hob sie die Beine über die Bettkante und stellte die bloßen Füße auf den gefliesten Boden. Plötzlich hörte sie ein Flüstern. Sie sah sich um, doch außer ihr war eindeutig niemand im Raum. Sie musste es sich eingebildet haben.
Als sie mit der Ferse gegen etwas stieß, sah sie hinunter. Vor dem Bett stand ein Paar schwarzer Turnschuhe. Sie nahm sie in die Hand. Die Sohlen hatten ihre Farbe verloren, also waren sie schon öfter getragen worden. Wozu braucht eine Komapatientin Schuhe? Sie schlüpfte hinein. Sie hatten ihre Größe, und Emilia stellte fest, dass sie, wenn auch noch unsicher, gehen konnte. Sie ging zu dem Tisch mit dem Monitor. Vielleicht war dort mehr über ihre Lage zu erfahren.
Es gab keine Tastatur, doch indem sie ein paar Icons auf dem Bildschirm berührte, brachte sie ihn zum Laufen. Er zeigte in einer Liveaufnahme das leere Bett. Instinktiv wusste Emilia, wie sie ihn bedienen musste, und nachdem sie ein paar weitere Schaltflächen gedrückt hatte, erschien eine Zeitachse. Sie spulte zurück, bis kurz vor dem Moment, als sie aufgewacht war. Sie sah sich selbst, wie sie auf dem Bett lag, Augen und Mund weit aufgerissen, regungslos, wie ein Zombie. Emilia schauderte. Was ist mit mir passiert, und wer hat mich beobachtet?
Sie spulte rund zwölf Stunden zurück, bis die Aufnahmen zeigten, wie ihr zwei Männer in weißen Pfleger-Uniformen beim Aufstehen halfen. Sie sah sich dabei zu, wie sie, gestützt von den beiden Männern, wie eine Schlafwandlerin zur Tür schlurfte. Sie betrachtete ihr Gesicht, die ausdruckslose Miene, die leeren Augen. Als die beiden sie nach einer Weile zurückbrachten, setzten sie sie aufs Bett, und der eine der beiden fütterte sie mit einer Mahlzeit aus einer Plastikschüssel, während der andere die zerknüllte Bettdecke glatt strich. Dann legten sie sie ins Bett und verließen den Raum. Ihre Gesichtszüge waren so apathisch wie zuvor.
Emilia tippte weiter auf den Icons herum, bis sich der Bildschirm in vier Fenster teilte, von denen jedes eine Person zeigte. Die zwei Männer und zwei Frauen saßen jeweils in einem karg eingerichteten Raum auf einem Stuhl neben einem Schreibtisch und wussten offenbar nicht, dass sie gefilmt wurden.