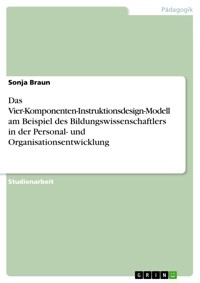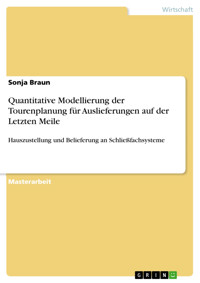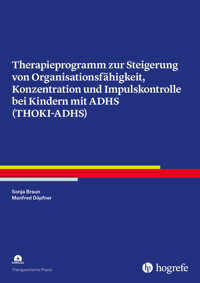
Therapieprogramm zur Steigerung von Organisationsfähigkeit, Konzentration und Impulskontrolle bei Kindern mit ADHS (THOKI-ADHS) E-Book
Sonja Braun
42,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Organisationsfähigkeit, Konzentration und Impulskontrolle sind wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Schwierigkeiten in diesen Bereichen lassen sich regelmäßig bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) feststellen. THOKI-ADHS ist das erste deutschsprachige Therapieprogramm, mit dem Defizite in den organisatorischen Fähigkeiten gezielt behandelt werden können. Das Therapiemanual gibt zunächst einen Überblick über die Symptomatik, Pathogenese und den Verlauf von ADHS und referiert den aktuellen Stand zu wirksamen Behandlungsansätzen. Ausführlich wird anschließend das therapeutische Vorgehen in den 13 Modulen beschrieben. THOKI-ADHS ist für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren konzipiert und vor allem für den Einsatz im Einzelsetting gedacht. Ziel von THOKI-ADHS ist es, die konkreten Schwierigkeiten von Kindern hinsichtlich Organisationsfähigkeit, Konzentration und Impulskontrolle im Familienalltag, in der Schule und im Freizeitbereich zu identifizieren, anhand von simulierten Situationen im Rahmen der Therapiesitzungen zu modifizieren und danach den Transfer in den Alltag zu unterstützen. Neben den kindzentrierten Interventionen kommt auch der Integration von Eltern und anderen Bezugspersonen in die Behandlung eine wichtige Rolle zu. Zudem wird im Manual erläutert, wie eine mögliche Durchführung im Gruppensetting aufgebaut sein kann und wie ergänzend digitale Technologien zum Einsatz kommen können. Zahlreiche Arbeitsmaterialien für die Arbeit mit den Kindern sowie zwei Fragebögen zur Erfassung von Funktionseinschränkungen in relevanten Alltagssituationen können nach erfolgter Registrierung von der Hogrefe Website heruntergeladen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Sonja Braun
Manfred Döpfner
Therapieprogramm zur Steigerung von Organisationsfähigkeit, Konzentration und Impulskontrolle bei Kindern mit ADHS (THOKI-ADHS)
Dr. Dipl.-Psych. Sonja Braun, geb. 1986. 2005 – 2010 Studium der Psychologie in Bremen. 2011 – 2015 Ausbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (VT) am AKiP Köln. 2011 – 2012 Wissenschaftliche Hilfskraft an der Uniklinik Köln. 2012 – 2014 Therapeutin am Institut Köln der Christoph-Dornier-Stiftung. 2018 Promotion an der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln. 2011 – 2024 Psychologin in der Ambulanz für Kinder- und Jugendpsychiatrie der St. Augustinus Gruppe in Neuss. Seit 2024 tätig in eigener Praxis.
Univ.-Prof. (em) Dr. Manfred Döpfner, Dipl.-Psych., geb. 1955. 1989 – 2021 leitender Psychologe an der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jungendalters an der Uniklinik Köln. 1999 – 2021 Universitätsprofessor für Psychotherapie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der medizinischen Fakultät der Universität zu Köln. 1999 – 2021 Leiter des Ausbildungsinstituts für Kinder- und Jungendpsychotherapie an der Uniklinik Köln (AKiP).
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Icons: © stock.adobe.com / North
Satz: Sina-Franziska Mollenhauer, Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
Format: EPUB
1. Auflage 2024
© 2024 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-2899-4; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-2899-5)
ISBN 978-3-8017-2899-1
https://doi.org/10.1026/02899-000
Nutzungsbedingungen:
Durch den Erwerb erhalten Sie ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernt werden.
Das E-Book darf anderen Personen nicht – auch nicht auszugsweise – zugänglich gemacht werden, insbesondere sind Weiterleitung, Verleih und Vermietung nicht gestattet.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
|5|Vorwort
Organisationsfähigkeit, Konzentration und Impulskontrolle sind wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, und Schwierigkeiten in diesem Bereich lassen sich regelmäßig bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) feststellen. Auffälligkeiten kommen jedoch auch bei Kindern vor, die nicht das Vollbild einer ADHS zeigen oder andere psychische Auffälligkeiten haben. In der Behandlung von Kindern mit ADHS haben sich elternzentrierte und schulzentrierte Interventionen besonders bewährt. Doch auch den kindzentrierten Interventionen kommt eine nicht zu vernachlässigende Bedeutung zu, vor allem bei älteren Kindern und auch bei Kindern, bei denen eltern- und schulzentrierte Interventionen nicht hinreichend hilfreich sind. Jahrzehntelang dominierten bei den kindzentrierten Interventionen Konzentrationstrainings oder Selbstinstruktionstrainings und in neuerer Zeit auch computerbasierte neuropsychologische Trainings oder Neurofeedback. All diese Verfahren haben sich in einer Vielzahl von Studien als nicht hinreichend wirkungsvoll erwiesen, vor allem, was die Veränderungen von Symptomen im Alltag angeht (Cortese et al., 2015; Fabiano et al., 2009; Faraone et al., 2021). Einer der wesentlichen Gründe für diese geringen Effekte liegt vermutlich darin, dass die trainierten Fähigkeiten in diesen Interventionen nicht mit den Anforderungen im Alltag übereinstimmen. Vor allem nach der Jahrhundertwende wurden im angloamerikanischen Sprachraum sogenannte Origanizational Skills Trainings entwickelt, die stärker als die bisherigen Interventionen die Auffälligkeiten im Alltag fokussieren und an deren Verminderung
arbeiten. Das vorliegende Therapieprogramm zur Steigerung von Organisationsfähigkeit, Konzentration und Impulskontrolle bei Kindern mit ADHS (THOKI-ADHS) knüpft an diese Tradition an und hat zum Ziel, die konkreten Probleme und Schwierigkeiten von Kindern hinsichtlich Organisationsfähigkeit, Konzentration und Impulskontrolle im Alltag in der Familie, der Schule und im Freizeitbereich zu identifizieren und in Therapiesitzungen anhand von simulierten Situationen zu modifizieren und danach den Transfer in den Alltag zu unterstützen. Obwohl diese Interventionen die Arbeit mit dem Kind in den Mittelpunkt stellen, kommt auch beim THOKI-ADHS der Integration von Eltern und anderen Bezugspersonen eine wichtige Rolle zu.
Die Arbeit am THOKI-ADHS hat sich am Ausbildungsinstitut für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (AKiP) über viele Jahre erstreckt. Die klinische Erfahrung mit diesem Therapieprogramm in der therapeutischen Arbeit mit den Kindern und ihren Familien sowie die empirische Untersuchung der Effekte des Programms in einer ersten Pilotstudie war uns sehr wichtig. Wir hoffen, mit THOKI-ADHS eine wichtige Komponente in der Behandlung von Kindern mit Problemen in der Organisationsfähigkeit, der Konzentration und der Impulskontrolle entwickelt zu haben und danken vor allem den Kindern und ihren Eltern, die uns dabei geholfen haben, sowie allen Kolleginnen und Kollegen, die uns in dieser Arbeit unterstützt haben
Minden und Köln, im Juni 2024
Sonja Braun und Manfred Döpfner
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1 Theoretischer Hintergrund
1.1 Störung der Organisationsfähigkeit
1.2 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen
1.2.1 Symptomatik
1.2.2 Pathogenese und Verlauf
1.2.3 Diagnostik
1.3 Behandlungsansätze und ihre Wirksamkeit
1.3.1 Verhaltensorientierte Elterntrainings
1.3.2 Interventionen in Kindertagesstätten und in der Schule
1.3.3 Patientenzentrierte kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen
1.3.4 Multimodale (Verhaltens-)Therapie
1.4 Kombination von THOKI-ADHS mit anderen Therapieprogrammen
Kapitel 2 Das Therapieprogramm THOKI-ADHS
2.1 Kurzbeschreibung des Programms
2.1.1 Zielgruppe
2.1.2 Setting
2.1.3 Inhalte
2.1.4 Voraussetzungen für die Anwendung
2.2 Diagnostik
2.2.1 Situationsfragebogen ADHS (SIT-ADHS)
2.2.2 Individuelle Problemliste
2.3 Therapieansatz
2.3.1 Therapieprinzipien und -methoden
2.3.2 Simulation von Situationen
2.3.3 Einbindung von Bezugspersonen
2.4 Voraussetzungen für eine erfolgreiche Therapie
2.4.1 Tragfähige therapeutische Beziehung
2.4.2 Ziele und Motivation
2.4.3 Ruhe und Struktur in der Therapiesitzung
2.4.4 Familieninteraktion im Blick behalten
2.4.5 Hilfestellungen und Anforderungen modulieren
2.4.6 Regelmäßige Durchführung
2.5 Ergänzende therapeutische Methoden
2.5.1 Wirkungsvolle Aufforderungen stellen
2.5.2 Verstärkersysteme
2.5.2.1 Token-Entzugssysteme
2.5.2.2 Token-Sammelsysteme
2.5.3 Einsatz digitaler Technologien
Kapitel 3 Durchführung der Module des THOKI-ADHS
3.1 Modul 1: Einstiegsmodul
3.2 Modul 2: Morgenroutine
3.3 Modul 3: Esstisch
3.4 Modul 4: Abendroutine
3.5 Modul 5: Schultasche
3.6 Modul 6: Hausaufgaben
3.7 Modul 7: Arbeiten im Klassenraum
3.8 Modul 8: Klassenarbeiten
3.9 Modul 9: Ärger in Spielsituationen
3.10 Modul 10: Aufräumen
3.11 Modul 11: Freizeit
3.12 Modul 12: Warten und Übergänge
3.13 Modul 13: Individuelle Situation
Kapitel 4 Wirksamkeit von THOKI-ADHS
Kapitel 5 Fallbeispiele
5.1 Sebastian
5.1.1 Vorstellungsanlass und Anamnese
5.1.2 Untersuchungsbefunde
5.1.3 Verhaltensanalyse
5.1.4 Diagnose nach ICD-10
5.1.5 Behandlungsverlauf
5.2 Max
5.2.1 Vorstellungsanlass und Anamnese
5.2.2 Untersuchungsbefunde
5.2.3 Verhaltensanalyse
5.2.4 Diagnose nach ICD-10
5.2.5 Behandlungsverlauf
Kapitel 6 Klinische Erfahrungen mit dem THOKI-ADHS
Literatur
Anhang
Situationsfragebogen ADHS – Eltern (SIT-ADHS-Eltern)
Situationsfragebogen ADHS – Lehrkraft (SIT-ADHS-Lehrkraft)
Hinweise zu den Online-Materialien
|9|Kapitel 1Theoretischer Hintergrund
1.1 Störung der Organisationsfähigkeit
Vielfach treten bei Kindern und Jugendlichen Schwierigkeiten mit organisatorischen Anforderungen auf. Es gilt, Materialien, Handlungen und Zeit zu organisieren. Insbesondere Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) weisen vermehrt Defizite in diesen organisatorischen Fähigkeiten auf (Abikoff & Gallagher, 2009; Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013). Wahrscheinlich tragen die Kernsymptome der ADHS zur Ausprägung solcher Organisationsdefizite bei. Jedoch sind auch Kinder und Jugendliche ohne ADHS oder Kinder mit subklinischen Ausprägungen von ADHS betroffen (Gallagher, Abikoff & Spira, 2014). Auch die Verbindung zu Defiziten der allgemeinen exekutiven Funktionen, wie der strategischen Handlungsplanung, der Entscheidung für Prioritäten, dem Koordinieren und Sequenzieren von Handlungen und dem Arbeitsgedächtnis, werden gezogen (Reck, Hund & Landau, 2010; Sonuga-Barke, Bitsakou & Thompson, 2010).
Organisatorische Fähigkeiten umfassen Zeitmanagement, Organisation und Planung. Diese Fähigkeiten werden unter anderem benötigt, um schulische Anforderungen und damit verbundene Aufgaben, die zu Hause erledigt werden müssen, zu erfüllen (Gallagher et al., 2014). Aber auch Freizeitaktivitäten und der Familienalltag stellen Anforderungen an organisatorische Fähigkeiten. Somit kann nicht nur das schulische, sondern auch das soziale Funktionsniveau durch Defizite der organisatorischen Fähigkeiten stark beeinträchtigt werden (Boyer, Geurts, Prins & Van der Oord, 2015).
Beispiele für schulische Organisationsschwierigkeiten sind:
Verlegen, Vergessen, Verlieren von Schulmaterialien,
unordentliche/unübersichtliche Schultasche und Schulmaterialien,
fehlendes Aufschreiben und Nichtwissen von Hausaufgaben, Abgabeterminen und Klassenarbeitsterminen,
verspätete Abgabe von Aufgaben und Projekten und die damit verbundene Fehlplanung von Lern- und Arbeitszeiten.
Beispiele für allgemeine und häusliche Organisationsschwierigkeiten sind:
Vergessen von gemeinsamen Terminen,
Schwierigkeiten bei der Koordination von Freizeitverabredungen,
fehlender Wochenüberblick für häusliche Aufgaben und Freizeitmöglichkeiten.
Vielfach haben Studien gezeigt, dass Kinder mit ADHS schlechtere Schulnoten und eine höhere Schulabbrecherquote als ihre Klassenkamerad*innen aufweisen (DuPaul & Stoner, 2014; Frazier, Youngstrom, Glutting & Watkins, 2007). Da es vermehrt Hinweise gibt, dass die schlechteren Schulleistungen eng im Zusammenhang mit mangelnden Organisationsfähigkeiten stehen, führte dies zur gezielten Entwicklung von Trainings organisatorischer Fähigkeiten (Langberg, Epstein et al., 2011). Außerdem entwickeln Kinder mit ADHS und Organisationsdefiziten eine negative Leistungserwartung sowie mangelndes Schulengagement und ihnen droht infolge Schulversagen (Barkley, Fischer, Smallish & Fletcher, 2006; Bernardi et al., 2012). Zudem konnte gezeigt werden, dass Organisationsprobleme auch Auswirkungen auf die Leistungen von gut begabten Schüler*innen mit ADHS haben, da beispielsweise Aufgaben verlegt werden oder Arbeitsmaterialien im Unterricht erst verspätet hervorgeholt werden und dadurch wertvolle Arbeitszeit verlorengeht (Assouline & Whiteman, 2011; Clemons, 2008). Im häuslichen Umfeld führen Organisationsdefizite nicht nur bei der Bearbeitung der Hausaufgaben zu vermehrten Konflikten innerhalb |10|der Familie (Abikoff & Gallagher, 2009; DuPaul, 2006). Auch Boyer et al. (2015) betonen, dass Kinder- und Jugendliche mit ADHS Planungsschwierigkeiten haben, die nicht nur ihr schulisches, sondern auch ihr soziales Funktionsniveau stark beeinträchtigen.
Auch wenn die Organisationsdefizite wahrscheinlich mit der Kernsymptomatik der ADHS zusammenhängen, konnte gezeigt werden, dass eine Normalisierung dieser Defizite unter einer medikamentösen Therapie der ADHS nicht erreicht werden kann. Zudem persistieren schlechtere Schulleistungen auch unter ADHS-Medikation (Abikoff et al., 2009; Langberg, Molina et al., 2011). Organisationsdefizite tendieren dazu, bis ins Jugendalter zu persistieren (Barkley & Fischer, 2011). Auch die Arbeitsproduktivität von Erwachsenen sowie deren Partnerschaften scheinen sie zu beeinflussen (Doshi et al., 2012; Solanto et al., 2010). Aufgrund der Vielfältigkeit, dem Hang zur Chronizität und der fehlenden Normalisierung unter bekannten Behandlungsmethoden bei ADHS scheinen die Erforschung und der Einsatz von gezielten Trainings organisatorischer Fähigkeiten sehr bedeutsam.
Interventionen zur Verbesserung der Organisation werden meist in Kombination mit anderen Interventionen durchgeführt und erforscht. In diesen multimodalen Programmen konnten bereits Hinweise auf eine Verbesserung der organisatorischen Fähigkeiten und den allgemeinen Schulleistungen gefunden werden (Abikoff et al., 2013; Evans, Langberg, Raggi, Allen & Buvinger, 2005). Das hier vorliegende Therapieprogramm zur Steigerung von Organisationsfähigkeit, Konzentration und Impulskontrolle bei Kindern mit ADHS (THOKI-ADHS) stellt das erste deutschsprachige Therapieprogramm da, welches die organisatorischen Fähigkeiten fokussiert und das auf seine Wirksamkeit hin untersucht wurde (Braun, 2018; vgl. Kap. 4).
1.2 Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen
1.2.1 Symptomatik
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) oder Hyperkinetische Störungen (HKS) beschreiben ein breites Spektrum an hyperaktiven, impulsiven und unaufmerksamen Verhaltensweisen, die häufig gemeinsam auftreten. Hyperaktivität ist durch eine nicht altersgerechte, desorganisierte, mangelhaft regulierte und überschießende motorische Aktivität oder ausgeprägte Ruhelosigkeit charakterisiert, die besonders in Situationen auftritt, die relative Ruhe und Ausdauer verlangen (z. B. Unterricht). Impulsivität zeigt sich in plötzlichem und unbedachtem Handeln oder auch in der vermeintlichen Unfähigkeit, abzuwarten und Bedürfnisse aufzuschieben. Der Begriff der kognitiven Impulsivität beschreibt die Tendenz, ersten Handlungsimpulsen zu folgen und eine Tätigkeit zu beginnen, bevor sie hinreichend durchdacht worden ist. Unaufmerksamkeit tritt vor allem bei Beschäftigungen auf, die eine geistige Anstrengung erfordern oder als besonders langweilig und ermüdend erlebt werden. Meist sind diese Störungen bei fremdbestimmten Tätigkeiten (z. B. Hausaufgaben) stärker ausgeprägt als bei selbstbestimmten Beschäftigungen (z. B. Spiel). In der Regel sind sowohl die selektive Aufmerksamkeit, d. h. die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auf aufgabenrelevante Reize zu fokussieren und irrelevante Reize zu ignorieren, als auch die Daueraufmerksamkeit beeinträchtigt (vgl. Döpfner & Banaschewski, 2022; Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013).
Hyperaktivität, Impulsivität und Unaufmerksamkeit können in den verschiedenen Lebensbereichen unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Die Symptome treten typischerweise stärker in solchen Situationen auf, in denen von den Kindern oder Jugendlichen eine längere Aufmerksamkeitsspanne und Ausdauer verlangt wird, wie im Unterricht, bei den Hausaufgaben oder auch beim Essen. Wenn sich das Kind oder der*die Jugendliche in einer neuen Umgebung befindet, wenn es nur mit einem Gegenüber konfrontiert ist oder wenn es sich einer Lieblingsaktivität widmet, dann können Anzeichen der Symptomatik in sehr geringem Maße oder gar nicht auftreten, selbst dann, wenn diese Tätigkeit in vermehrtem Maße Aufmerksamkeit erfordert (z. B. beim Computerspiel; Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013). Für eine Diagnose müssen sich Beeinträchtigungen durch diese Symptome in zwei oder mehreren Lebensbereichen (z. B. Schule, Familie) manifestieren, und es müssen deutliche Hinweise auf klinisch bedeutsame Beeinträchtigungen in sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsbereichen vorhanden sein. Die ICD-10 (World Health Organization, 2015, 2016) unterscheidet im Wesentlichen zwischen einer Störung von Aktivität und Aufmerksamkeit (F90.0), bei der Hyperaktivität, Impulsivität und Unaufmerksamkeit vorliegen, und der Hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens (F90.1), bei der zusätzlich die Diagnosekriterien für eine Störung des Sozialverhaltens erfüllt sind. Das DSM-5 (American Psychiatric Association/Falkai et al., 2018) unterscheidet dagegen drei Erscheinungsbilder. Beim ge|11|mischten Erscheinungsbild sind sowohl die Symptome von Unaufmerksamkeit, also auch von Hyperaktivität/Impulsivität, ausgeprägt; beim vorwiegend unaufmerksamen Erscheinungsbild imponiert vor allem die Unaufmerksamkeit, während Hyperaktivität/Impulsivität nicht oder nicht hinreichend stark ausgeprägt ist; beim vorwiegend hyperaktiv-impulsiven Erscheinungsbild liegen dagegen vor allem Symptome von Hyperaktivität/Impulsivität vor, während die Unaufmerksamkeit nicht oder nicht hinreichend stark ausgeprägt ist. Die ICD-11 (World Health Organization, 2023) übernimmt sowohl die Bezeichnung der ADHS als auch die Binnendifferenzierung von DSM-5 weitgehend.
ADHS geht mit vielfältigen psychosozialen Funktionsbeeinträchtigungen und einer deutlich reduzierten gesundheitsbezogenen subjektiven Lebensqualität einher (Danckaerts et al., 2010). Betroffene erreichen durchschnittlich schlechtere Schulleistungen, niedrigere Bildungsabschlüsse und einen geringeren sozioökonomischen Status (Wirth et al., 2022). Die Beziehungen zu Eltern, Geschwistern und Gleichaltrigen und Partner*innen sind häufig belastet; das Risiko für delinquentes Verhalten ist erhöht und das Selbstwerterleben häufig beeinträchtigt (Faraone et al., 2021).
1.2.2 Pathogenese und Verlauf
Die pathogenetischen Mechanismen der ADHS sind bislang noch unzureichend geklärt. Allerdings stützen Studienergebnisse die Vermutung, dass ADHS in den meisten Fällen multifaktoriell bedingt ist. Genetische Faktoren und frühe Umweltrisiken, die komplex interagieren und die strukturelle und funktionelle Hirnentwicklung beeinflussen, spielen jedoch eine wesentliche Rolle und bedingen eine hohe ätiologische Heterogenität. Sehr wahrscheinlich ist kein einzelner Faktor notwendig oder hinreichend, um ADHS zu verursachen; vielmehr wird die Vulnerabilität für ADHS in der Regel multifaktoriell durch das Zusammenwirken multipler Risikofaktoren bedingt. Bei einigen Patient*innen scheinen allerdings seltene genetische Varianten oder extreme Umweltrisiken einen besonders starken Einfluss zu haben (Döpfner & Banaschewski, 2022; Faraone et al., 2021).
Längsschnittstudien zeigen eine kontinuierliche Abnahme der Kernsymptomatik über die Lebensspanne, auch in Deutschland (Döpfner, Ise et al., 2014; Döpfner et al., 2020; Döpfner, Mandler et al., 2021). Ab dem Jugendalter vermindert sich in vielen Fällen die motorische Unruhe und kann sich oft auf ein unangenehm wahrgenommenes inneres Gefühl von Ruhelosigkeit beschränken, während Schwierigkeiten in Form von Unaufmerksamkeit, mangelndem Planungsvermögen und Impulsivität dagegen häufig persistieren. Allerdings persistiert die Symptomatik bei etwa 3 % über das Kindes- und Jugendalter hinweg auf hohem Niveau (Döpfner et al., 2015). Im Erwachsenenalter erfüllen noch etwa 40 % der im Kindesalter Auffälligen die diagnostischen Kriterien, ca. 65 % zeigen weiterhin beeinträchtigende Symptome und bis zu 90 % haben funktionelle Einschränkungen (Faraone et al., 2021).
1.2.3 Diagnostik
Die diagnostischen Maßnahmen bei ADHS folgen dem Konzept der multiaxialen Diagnostik und umfassen eine multimodale Verhaltens- und Psychodiagnostik, eine Diagnostik familiärer und somatischer Bedingungen (einschließlich körperlicher Untersuchung) sowie bei Bedarf auch eine Entwicklungs-, Intelligenz-, Leistungs- und neuropsychologische Diagnostik (Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013; Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie [DGKJP] et al., 2018).
Die klinische Exploration von Patient*in, Eltern und bei Bedarf auch anderer Bezugspersonen (z. B. Erziehende, Lehrkräfte, Ausbildende) ist die Grundlage der Diagnostik. Sie umfasst die Exploration der ADHS-Symptomatik des Kindes oder des*der Jugendlichen, der komorbiden Störungen, der störungsspezifischen und der allgemeinen Entwicklungsgeschichte des Kindes oder des*der Jugendlichen, einschließlich der medizinischen Anamnese. Für die klinische Exploration und die klinische Beurteilung stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung, wie das Explorationsschema für Hyperkinetische und Oppositionelle Verhaltensstörungen (ES-HOV; Döpfner, Schürmann & Frölich, 2019) und die Diagnose-Checkliste Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (DCL-ADHS), die Bestandteil des Diagnostik-Systems für Psychische Störungen nach ICD-10 und DSM-5 für Kinder- und Jugendliche – III (DISYPS-III; Döpfner & Görtz-Dorten, 2019) ist. Alternativ kann der Interview-Leitfaden für Externale Störungen (ILF-EXTERNAL), der Bestandteil einer Sammlung von Interview-Leitfäden zum DISYPS-III ist (Görtz-Dorten et al., 2022), für ein strukturiertes Interview zur Erfassung der Diagnosekriterien für ADHS nach DSM-5 genutzt werden.
Im Rahmen der multimodalen Verhaltens- und Psychodiagnostik sollten auch Fragebogen-Verfahren eingesetzt werden, die das Urteil der Eltern und Lehrkraft sowie das Selbsturteil des*der Patient*in erhe|12|ben können (DGKJP et al., 2018). Dazu zählen der Fremdbeurteilungsbogen und der Selbstbeurteilungsbogen für Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (FBB-ADHS und SBB-ADHS) aus dem Diagnostik-System DISYPS-III (Döpfner & Görtz-Dorten, 2019). Da ein erheblicher Anteil der Kinder und Jugendlichen mit diesem Störungsbild weitere Auffälligkeiten zeigt, empfiehlt es sich im Rahmen einer multimodalen Diagnostik auch Fragebogenverfahren anzuwenden, die ein breites Spektrum psychischer Störungen erheben, beispielsweise den DCL-Screeningbogen aus dem DISYPS-III oder die von Achenbach entwickelten Fragebogenverfahren (Döpfner, Plück & Kinnen, 2014). Eine ausführliche Darstellung der einzelnen diagnostischen Verfahren sind dem Band Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) (Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013), dem Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten (THOP; Döpfner, Schürmann & Frölich, 2019) und dem Band zu Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen aus dem Kinder-Diagnostik-System (KIDS) zu entnehmen (Döpfner, Lehmkuhl & Steinhausen, 2006; Döpfner, Görtz-Dorten & Steinhausen, in Vorb.).
1.3 Behandlungsansätze und ihre Wirksamkeit
In der Regel ist eine multimodale Therapie indiziert, die eine Verminderung der ADHS-Symptomatik, der komorbiden Symptomatik und der resultierenden Einschränkungen des psychosozialen Funktionsniveaus zum Ziel hat. Diese Therapie wird in individualisierter Form im Einzel- oder im Gruppensetting auf der Grundlage einer ausführlichen Psychoedukation des Kindes und der Bezugspersonen durchgeführt. Je nach Indikation kann die Therapie hauptsächlich familienzentrierte behaviorale Therapie, psychosoziale behaviorale Interventionen im weiteren Umfeld (z. B. Kindertagesstätte, Schule), kognitiv-behaviorale Therapie des Kindes und Pharmakotherapie umfassen (Döpfner & Banaschewski, 2022). Entsprechend der S3-Leitlinie „Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) im Kindes- Jugend und Erwachsenenalter“ (DGKJP et al., 2018) sollen dabei folgende Indikationen beachtet werden:
Grundsätzlich soll eine umfassende Psychoedukation angeboten werden, bei der sowohl Patient*in als auch die relevanten Bezugspersonen (z. B. Eltern, Lehrkraft) über ADHS aufgeklärt werden, ein individuelles Störungskonzept mit den Beteiligten entwickelt wird und Behandlungsmöglichkeiten dargestellt werden mit dem Ziel, eine partizipative Entscheidungsfindung zu ermöglichen.
Bei Kindern vor dem Alter von 6 Jahren soll primär psychosozial mit psychotherapeutischen Methoden interveniert werden.
Bei ADHS von einem leichten Schweregrad soll primär psychosozial (einschließlich psychotherapeutisch) interveniert werden. In Einzelfällen kann bei behandlungsbedürftiger residualer ADHS-Symptomatik ergänzend eine Pharmakotherapie angeboten werden.
Bei mittelgradiger ADHS-Symptomatik soll in Abhängigkeit von den konkreten Bedingungen des Kindes, seines Umfelds, seiner Präferenzen und seiner relevanten Bezugspersonen sowie den Behandlungsressourcen nach einer umfassenden Psychoedukation entweder eine intensivierte psychosoziale (einschließlich intensivierter psychotherapeutischer) Intervention oder eine pharmakologische Behandlung oder eine Kombination angeboten werden.
Bei stark ausgeprägter ADHS-Symptomatik soll primär eine Pharmakotherapie nach einer intensiven Psychoedukation angeboten werden. In die Pharmakotherapie kann eine parallele intensive psychosoziale (einschließlich psychotherapeutische) Intervention integriert werden. In Abhängigkeit von dem Verlauf der Pharmakotherapie sollen bei residualer behandlungsbedürftiger ADHS-Symptomatik psychosoziale (einschließlich psychotherapeutische) Interventionen angeboten werden.
Zusätzlich können psychotherapeutische oder pharmakotherapeutische Interventionen zur Behandlung komorbider Störungen (z. B. aggressiver Verhaltensstörungen oder depressiver Störungen) notwendig sein.
Nach der Leitlinie sind also familien- und umfeldzentrierte verhaltenstherapeutische Interventionen bei Kindern bis zum Alter von 6 Jahren und bei Kindern und Jugendlichen ab dem Alter von 6 Jahren mit einer minder schweren ADHS-Symptomatik die Methode der Wahl. Bei moderater ADHS-Symptomatik werden diese Interventionen als Behandlungsoption zu Pharmakotherapie und bei starker Symptomatik als Ergänzung zu Pharmakotherapie empfohlen. Da die ADHS-Symptomatik in der Regel sowohl in der Familie als auch im Kindergarten bzw. in der Schule auftritt, werden sowohl Elterntrainings und familienzentrierte Interventionen als auch Trainings für Erziehende und Lehrkräfte sowie kindergarten-/schulzentrierte Interventionen empfohlen.
|13|1.3.1 Verhaltensorientierte Elterntrainings
Verhaltensorientierte Elterntrainings wurden international meist im Gruppenformat evaluiert (Döpfner & Banaschewski, 2022). Sie erfüllen aufgrund der empirischen Studien die Kriterien für eine gut etablierte Behandlung (Evans et al., 2016). Metaanalysen konnten positive Effekte mit kleinen bis moderaten Effektstärken bezüglich der Reduktion von ADHS-Symptomen belegen (z. B. Charach et al., 2013; Fabiano et al., 2009; Daley et al., 2018). Hinsichtlich der Reduktion von komorbiden Symptomen konnten Effekte auf oppositionelles und aggressives Verhalten sowie auf emotionale Probleme in mehreren Analysen belegt werden (Charach et al., 2013; Fabiano et al., 2009; Corcoran & Dattalo, 2006). Mehrere Metaanalysen weisen auch Veränderungen im Erziehungsverhalten der Eltern nach, welche die vermuteten Hauptwirkmechanismen von Elterntrainings darstellen – meist eine Reduktion von übermäßiger Strenge und inkonsequentem Erziehungsverhalten sowie eine Zunahme von positivem Erziehungsverhalten (z. B. Charach et al., 2013; Hanisch et al., 2014). Obwohl Elterntrainings überwiegend im Gruppenformat evaluiert wurden, haben sie sich auch im Einzelformat als wirkungsvoll erwiesen (Van den Hoofdakker et al., 2007; Döpfner et al., 2014), und Effekte konnten bei der Durchführung im häuslichen Umfeld (Thompson et al., 2009) oder auf einer Eltern-Kind-Station (Ise et al., 2015) belegt werden. Außerdem haben sich auch angeleitete Selbsthilfe-Interventionen für Eltern als wirkungsvoll erwiesen (z. B. Dose et al., 2017; Döpfner, Liebermann-Jordanidis et al., 2021), die über Selbsthilfebücher (z. B. Döpfner, Dose et al., 2021; Döpfner, Plück et al., 2021; Döpfner, Eichelberger et al., 2021; Döpfner, Wolff Metternich-Kaizman et al., 2022) oder über das Internet (ADHS-Elterntrainer; Döpfner & Schürmann, 2017) durchgeführt wurden. Die Stabilität der Effekte von Elterntrainings über den Zeitraum von mehreren Monaten bis zu mehreren Jahren teilweise in Kombination mit anderen verhaltenstherapeutischen Interventionen wurde in der Mehrzahl der Studien belegt (Molina et al., 2009; Döpfner et al., 2015, 2020; Döpfner, Mandler et al., 2021; Sibley et al., 2016), wobei Metaanalysen auch eine gewisse Verminderung der Therapieeffekte über die Zeit belegen (Lee et al., 2012).
1.3.2 Interventionen in Kindertagesstätten und in der Schule
Die Interventionen in Kindertagesstätten und in der Schule sind hinsichtlich ihrer Hauptkomponenten weitgehend vergleichbar mit denen von Elterntrainings. Zusätzlich zu den Interventionen, die auf das einzelne Kind oder Jugendlichen zielen, können jedoch auch Interventionen auf Klassen- oder Schulebene (z. B. Sitzordnung, Regeln für die gesamte Klasse oder Schule) durchgeführt werden. Übersichtsarbeiten und Metaanalysen belegen die Wirksamkeit von Interventionen im Klassenzimmer (DuPaul et al., 2012; Evans et al., 2016). Die Mehrzahl der Studien kann Effekte sowohl auf das Verhalten im Klassenzimmer als auch hinsichtlich der sozialen Anpassung belegen. Effekte auf die schulischen Leistungen sind jedoch weniger eindeutig. Im deutschen Sprachraum konnten Döpfner, Plück und Mitarbeitende (2021) für das Erziehertraining im Rahmen des Präventionsprogramms für Expansives Problemverhalten (PEP) Effekte auf das externale Problemverhalten, einschließlich der ADHS-Symptome im Kindergarten, nachweisen. Mikami et al. (2012) belegen Effekte von Interventionen zur Verbesserung der Integration der Kinder mit ADHS in der Schulklasse. Häufig wurden schulbasierte Interventionen auch im Rahmen von multimodalen kognitiv-behavioralen Interventionen eingesetzt, die patienten-, eltern- und schulzentrierte Verfahren kombinieren (s. u.).
1.3.3 Patientenzentrierte kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen
Die S3-Leitlinie (DGKJP et al., 2018) empfiehlt patientenzentrierte kognitiv-verhaltenstherapeutische Interventionen sehr zurückhaltend als Ergänzung zu den familien- und umfeldzentrierten Verfahren, weil die Evidenzbasis dieser Methoden insgesamt noch relativ gering ist (Döpfner & Banaschewski, 2022). Die Wirksamkeit von klassischen Konzentrations- und Selbstinstruktionstrainings konnte in internationalen Studien nicht überzeugend nachgewiesen werden (vgl. Pelham & Fabiano, 2008). Computergestützte neuropsychologische Trainings zur Verbesserung einzelner neuropsychologscher Fähigkeiten, wie z. B. des Kurzzeitgedächtnisses, können zwar die entsprechende neuropsychologische Funktion verbessern, sie haben sich jedoch zur Verminderung von |14|ADHS-Symptomen im Alltag nicht bewährt (Cortese et al., 2015). Für das Vorschulalter empfiehlt die S3-Leitlinie (DGKJP et al., 2018) kindzentrierte Interventionen zur Verbesserung von Spiel- und Beschäftigungsintensität und -ausdauer oder zur Einübung von Handlungsabläufen im Alltag als ergänzende Maßnahme; sie werden jedoch als in der Regel nicht allein ausreichend eingeschätzt. Ein evidenzbasierter Ansatz ist das Spieltraining im Rahmen des Therapieprogramms THOP (Döpfner, Schürmann & Frölich, 2019).
Mehrere Untersuchungen zur Wirksamkeit von Selbstmanagementmethoden, einschließlich der Verfahren zur Verbesserung der Organisationsfähigkeit, belegen die Wirksamkeit solcher Methoden (Übersicht: Chan et al., 2016) bei Kindern (Abikoff et al., 2013) und bei Jugendlichen mit ADHS – teilweise in Verbindung mit umfassenderen Interventionen (z. B. Langberg et al., 2012, 2016). So konnten Abikoff et al. (2013) die Wirksamkeit des Organizational Skills Training for Children with ADHD (OST), ein primär kindzentriertes, alltagsnahes Training (20 Sitzungen) der organisatorischer Fähigkeiten für Kinder mit ADHS, belegen. Die Kinder übten dabei Strategien ein und nutzen Hilfsmittel zur Organisation von Schulmaterialien und zur Planung von schulischen Aufgaben. Auch Langberg und Kolleg*innen konnten durch ihre Homework, Organization, and Planning Skills Intervention (HOPS) signifikante Verbesserungen der Organisation von Aktivitäten und der Anfertigung der Hausaufgaben sowie im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant bessere Schulnoten erzielen (Langberg, Epstein, Becker, Girio-Herrera & Vaughn, 2012). Insgesamt zeigen sich somit vielversprechende Ergebnisse, insbesondere auf die Verbesserung der Organisationsfähigkeit (vgl. Kap. 1.1).
1.3.4 Multimodale (Verhaltens-)Therapie
Aufgrund der vielfältigen Lebens- und Funktionsbereiche, die bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS beeinträchtigt sind, verwundert es nicht, dass mit einem isolierten Behandlungsansatz häufig nicht die gewünschten Effekte erzielt werden können, sondern dass für die Behandlung oft mehrere Therapieformen miteinander kombiniert werden müssen. So lassen sich patienten-, familien- sowie kindergarten- und schulzentrierte kognitiv-behaviorale Interventionen in Form einer multimodalen Verhaltenstherapie miteinander kombinieren, die bei einer Kombination mit Pharmakotherapie als multimodale Therapie bezeichnet wird (Döpfner & Banaschewski, 2022). Die deutsche Leitlinie (DGKJP et al., 2018) und auch die europäische Leitlinien (Taylor et al., 2004) empfehlen generell eine multimodale Verhaltenstherapie (zumindest Psychoedukation und familien- und umfeldzentrierte Interventionen, ggf. ergänzt durch patientenzentrierte Interventionen) und auch die Kombination mit Pharmakotherapie – zumindest in der Kombination von Psychoedukation und Pharmakotherapie, ggf. ergänzt durch familien- sowie umfeld- und patientenzentrierte kognitiv-behaviorale Interventionen.
Zusätzliche Effekte der Kombination von Verhaltens- und Pharmakotherapie über die medikamentöse Therapie hinaus wurden in einigen, jedoch nicht in allen Studien nachgewiesen (Pelham et al., 2016; Van den Hoofdakker et al., 2007; Dose et al., 2017; MTA-Cooperative-Group, 1999). Die Langzeitverläufe nach adaptiver multimodaler Therapie aus der Kölner Adaptiven Multimodalen Therapiestudie (KAMT; Döpfner et al., 2004) zeigen ebenfalls 1½ Jahre nach Therapieende (Döpfner et al., 2021) eine weitgehende Stabilisierung der Therapieeffekte im Urteil der Eltern und Lehrkraft sowohl bei Kindern, die pharmakologisch weiterbehandelt wurden, als auch bei Kindern, die ausschließlich Verhaltenstherapie erhalten hatten. In einer weiteren Nachuntersuchung, 8 und 18 Jahre nach Behandlungsende, zeichnete sich sowohl hinsichtlich der weiteren Verminderung der Verhaltensauffälligkeiten als auch hinsichtlich globaler Maße der schulischen und der beruflichen Karriere und der Delinquenzrate ein überwiegend positives Bild ab (Döpfner et al., 2020; Döpfner, Mandler et al., 2021). In einem weiteren multimodalen Verhaltenstherapieprogramm (Challenging Horizons) wurden schulbasierte Interventionen für Kinder und Jugendliche der weiterführenden Schulen mit patienten- und elternzentrierten Interventionen kombiniert. Dabei wurden bedeutsame Verbesserungen auf dem sozialen, schulischen und familiären Funktionsniveau nachgewiesen (z. B. Evans et al., 2011, 2016).
Im deutschen Sprachraum liegen vor allem von der Kölner Arbeitsgruppe entwickelte und evaluierte multimodale Therapieprogramme vor. Nach den Kriterien der deutschen S3-Leitlinie (DGKJP et al., 2018) werden das für Vorschulkinder entwickelte Präventionsprogramm für Expansives Problemverhalten (PEP; Plück et al., 2006) und das für Vorschul- und Schulkinder entwickelte Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten (THOP; Döpfner, Schürmann & Frölich, 2019; Döpfner, Kinnen & Halder, 2016) als wirkungsvoll beurteilt. Das Therapieprogramm THOP kombiniert familien- und umfeldzentrierte verhaltenstherapeutische Interventionen und integriert auch |15|kindzentrierte Therapieansätze. Es wurde im deutschen Sprachraum in mehreren Studien auch von unabhängigen Forschergruppen intensiv untersucht (vgl. Döpfner, Schürmann & Frölich, 2019). Im Rahmen einer Studie zur adaptiven multimodalen Therapie von Kindern mit hyperkinetischen Störungen konnten im Verlauf der verhaltenstherapeutischen Interventionen Verhaltensauffälligkeiten in der Familie und in der Schule deutlich reduziert werden (Döpfner et al., 2004). Diese Effekte stabilisieren sich weitgehend in den folgenden Jahren (Döpfner et al., 2015, 2020; Döpfner, Mandler et al., 2021). Auch bei Kindern mit ADHS, deren Mütter ebenfalls an ADHS leiden, ließen sich im Verlauf des THOP deutliche Verminderungen der ADHS-Symptome in einer multizentrischen Studie nachweisen (Jans et al., 2015; Hautmann et al., 2018). Das modular aufgebaute schulbasierte Coaching bei Kindern mit expansivem Problemverhalten (SCEP; Hanisch et al., 2018) umfasst eine Gruppenschulung und ein Einzelcoaching von Lehrpersonal mit dem Ziel, expansives Problemverhalten (einschließlich ADHS-Symptomen) von Schulkindern zu vermindern. Eine Eigenkontrollgruppenstudie belegt die Wirksamkeit bei der Verminderung von Unaufmerksamkeit und oppositionellem Verhalten im Unterricht (Hanisch et al., 2020).
Von den im deutschen Sprachraum vorliegenden Therapieprogrammen mit primär patientenzentrierten Interventionen erreichen nach den Kriterien der deutschen Leitlinie (DGKJP et al., 2018) drei Therapieprogramme eine moderate empirische Evidenz: das Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern (Lauth & Schlottke, 2009), das Lerntraining LeJA für Jugendliche (Linderkamp et al., 2011) und das Modul Leistungsprobleme (SELBST-Leistungsprobleme; Walter & Döpfner, 2009) aus dem Therapieprogramm für Jugendliche mit Selbstwert-, Leistungs- und Beziehungsstörungen (SELBST; Walter et al., 2007). Das vorliegende THOKI-Programm lag bei Publikation der S3-Leitlinie noch nicht vor. Es würde jedoch auch die Kriterien für eine moderate empirische Evidenz erfüllen (vgl. Kap. 4).
1.4 Kombination von THOKI-ADHS mit anderen Therapieprogrammen
THOKI-ADHS lässt sich auch gut in Kombination mit anderen Interventionen, z. B. mit primär elternzentrierten oder schulzentrierten Interventionen für Kinder mit ADHS, anwenden:
Das Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten (THOP; Döpfner, Schürmann & Frölich, 2019) integriert elternzentrierte, kindzentrierte und pädagogenzentrierte Interventionen zur Behandlung von Kindern mit ADHS und mit oppositionellen Verhaltensstörungen. Der Schwerpunkt des THOP liegt auf elternzentrierten Interventionen, und kindzentrierte Verfahren stehen nur in einzelnen Modulen im Zentrum. Das THOKI-ADHS basiert auf dem THOP und entwickelt vor allem die kindzentrierten Verfahren weiter. Daher lassen sich beide Therapieprogramme auch gut miteinander verbinden. THOP ist primär für die Einzeltherapie von Kindern mit ADHS einschließlich deren Eltern und anderer Bezugspersonen entwickelt worden. Das Programm kann aber auch im Gruppenformat eingesetzt werden. Dafür wurde ein eigenes Manual für Gruppenleiter entwickelt, das durch eine PowerPoint-Präsentation unterstützt wird (Döpfner, Kinnen & Halder, 2016), sowie ein Arbeitsbuch für Eltern (Kinnen et al., 2016). Zudem wurden mehrere Selbsthilfeinterventionen entwickelt.
Das Elternbuch Wackelpeter & Trotzkopf (Döpfner & Schürmann, 2023) informiert Eltern über das Störungsbild und die Behandlungsansätze, gibt konkrete Hilfen in einem Elternleitfaden und zeigt deren Umsetzung in Anwendungsbeispielen. Für Eltern und pädagogische Fachkräfte von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren und von Schulkindern im Alter von 6 bis 12 Jahren sind Arbeitsbücher (Den Alltag meistern mit ADHS) entwickelt worden, die den entsprechenden Bezugspersonen in konkreten Schritten helfen, den Alltag mit diesen Kindern und Jugendlichen besser zu meistern (Döpfner, Dose et al., 2021; Döpfner, Plück et al., 2021; Döpfner, Eichelberger et al., 2021; Döpfner, Wolff Metternich-Kaizman et al., 2022). Die Bezugspersonen können mithilfe dieser Bücher eigenständig Interventionen erarbeiten, die zur Verminderung der Verhaltensprobleme im jeweiligen Lebensumfeld beitragen können.
Das Schulbasierte Coaching bei Kindern mit expansivem Problemverhalten (SCEP; Hanisch et al., 2018) ist ein Programm für Lehrkräfte von Schulkindern im Alter von 6 bis 12 Jahren, die ADHS oder oppositionelle Verhaltensauffälligkeiten zeigen. THOKI-ADHS versucht ebenfalls, problematisches Verhalten in der Schule primär über kindzentrierte Interventionen zu modifizieren und lässt sich daher gut mit SCEP kombinieren. Außerdem können die vom THOP abgeleiteten Selbsthilfebücher für Pädagogen (Döpfner, Plück et al., 2021; Döpfner, Eichelberger et al., 2021) eingesetzt werden.
|16|Zudem ist THOKI-ADHS auch mit Interventionen für Kinder mit aggressiven Verhaltensproblemen anwendbar, die ebenfalls häufig durch Schwierigkeiten in der Organisation, Konzentration und Impulskontrolle auffallen.
Das Therapieprogramm für Kinder mit aggressivem Verhalten (THAV; Görtz-Dorten & Döpfner, 2019) ist vor allem zur Behandlung von Kindern mit gleichaltrigenbezogener Aggression entwickelt worden und konzentriert sich auf kindzentrierte Interventionen, wobei auch elternzentrierte Interventionen in dem Programm enthalten sind. Mangelnde Impulskontrolle, die sich auch auf die emotionale Ebene beziehen kann, wird sowohl im THOKI-ADHS als auch im
THAV angesprochen. Ergänzend zum THAV kann auch eine Kombination mit dem Sozialen computerunterstützten Training für Kinder mit aggressivem Verhalten (ScouT; Görtz-Dorten & Döpfner, 2016) erwogen werden, das mittels Computerunterstützung die Bearbeitung von gleichaltrigenbezogenen Konflikten erleichtert.
Zusätzlich lassen sich digitale Technologien mit THOKI-ADHS kombinieren, wie sie in der App-unterstützten Therapiearbeit für Kinder (AUTHARK; Görtz-Dorten & Döpfner, 2020) oder auch im kostenlos nutzbaren ADHS-Elterntrainer (Döpfner & Schürmann, 2017) eingesetzt werden (vgl. Kap. 2.5.3).
|17|Kapitel 2Das Therapieprogramm THOKI-ADHS
2.1 Kurzbeschreibung des Programms
Dem Therapieprogramm zur Steigerung von Organisationsfähigkeit, Konzentration und Impulskontrolle bei Kindern mit ADHS (THOKI-ADHS) liegen zwei zentrale Behandlungsprinzipien zugrunde. THOKI-ADHS soll primär kindzentriert sowie alltagsnah und situationsspezifisch in unterschiedlichen Bereichen Schwierigkeiten und Funktionseinschränkungen behandeln. Es ist auch mit nur minimaler Unterstützung des Umfelds durchführbar, bezieht Bezugspersonen jedoch in verschiedenen Bausteinen soweit wie möglich ein. Das THOKI-ADHS ist als Baustein einer multimodalen Therapie anwendbar (vgl. Kap. 2.4). Zur Entwicklung des THOKI-ADHS wurden die kindzentrierten Behandlungsbausteine aus dem THOP (Döpfner, Schürmann & Frölich, 2019) und weitere Interventionen auf verhaltenstherapeutischer, ergotherapeutischer und neuropsychologischer Grundlage herangezogen. Die Merkmale des THOKI-ADHS sind in folgendem Kasten zusammengefasst.
Merkmale des THOKI-ADHS
Zwei zentrale Behandlungsprinzipien:
primär kindzentriert
alltagsnah und situationsspezifisch
Einsatzbereich: Kinder (6 bis 12 Jahre) mit ADHS sowie Kinder mit Störungen der Organisationsfähigkeit, Konzentration und Impulskontrolle
Modulsystem: 1 Einstiegsmodul, 12 Module für konkrete Problemsituationen
Setting: ambulante Einzeltherapie, einzelne Module im Gruppensetting möglich
Ansatz: kindzentriert mit Anleitung von Bezugspersonen
Generalisierung: Simulation realer und relevanter Alltagssituationen, Therapieaufgaben
2.1.1 Zielgruppe
Das THOKI-ADHS wurde für den Einsatz bei Kindern mit ADHS sowie für Kinder mit Störungen der Organisationsfähigkeit, Konzentration und Impulskontrolle entwickelt, bei denen die Kriterien für eine ADHS-Diagnose nicht voll erfüllt sind. Es ist für alle Subtypen der ADHS anwendbar und berücksichtigt unterschiedliche Symptome und Funktionsdefizite. Zudem berücksichtigt es die Möglichkeit einer bestehenden komorbiden Diagnose einer Störung des Sozialverhaltens. Das THOKI-ADHS ist für den Altersbereich von 6 bis 12 Jahren konzipiert. Es ist somit im Grundschulalter einsetzbar und schließt den Übergang zur weiterführenden Schule ein.
2.1.2 Setting
Das THOKI-ADHS wurde als Einzeltherapieprogramm für das ambulante Setting entwickelt. Die Sitzungen können aber ebenso im teilstationären und stationären Setting durchgeführt werden. Die Durchführung ist mit ca. 24 Sitzungen, mit einer Sitzungsfrequenz von mindestens einer 50-minütigen Therapiesitzung pro Woche, geplant. Der Einsatz einzelner Module ist ebenfalls im Gruppensetting möglich. Bezugspersonen werden in unterschiedlichen Bausteinen innerhalb der kindzentrierten Sitzungen angeleitet. THOKI-ADHS lässt sich auch gut in Kombination mit anderen Interventionen, z. B. mit primär elternzentrierten oder schulzentrierten Interventionen für Kinder mit ADHS, wie dem THOP (Döpfner, Schürmann & Frölich, 2019) oder dem Schulbasierten Coaching bei Kindern mit expansivem Problemverhalten (SCEP; Hanisch et al., 2018), und auch mit Interventionen für Kinder mit aggressiven Verhaltensproblemen, wie dem Therapieprogramm für Kinder mit aggressivem Verhalten (THAV, Görtz-Dorten & Döpfner, 2019) oder dem Sozialen computerunterstützten Training für Kinder |18|mit aggressivem Verhalten (ScouT; Görtz-Dorten & Döpfner, 2016) kombinieren (vgl. Kap. 1.4). Zudem ist bei Kindern mit ADHS eine Kombination mit Pharmakotherapie möglich.
Tabelle 1: Module des THOKI-ADHS
Modul
Problembereich
1: Einstiegsmodul
–
2: Morgenroutine
familiäre Routinen
3: Esstisch
4: Abendroutine
5: Schultasche
Schule
6: Hausaufgaben
7: Arbeiten im Klassenraum
8: Klassenarbeiten
9: Ärger in Spielsituationen
spezielle Situationen
10: Aufräumen (Zimmeraufräumen, Ordnung halten)
11: Freizeit (Gruppenaktivitäten, Medien, Alleinspielzeit)
12: Warten und Übergänge
13: Individuelle Situation
2.1.3 Inhalte
Das THOKI-ADHS ist ein Modulsystem mit einem Einstiegsmodul und 12 weiteren Modulen zur Behandlung von Problemverhaltensweisen in konkreten alltäglichen Situationen. Es umfasst Problembereiche aus dem häuslichen sowie schulischen Umfeld und nimmt die organisatorischen Fähigkeiten als wichtigen Behandlungsaspekt auf. Es beinhaltet kindgerechte Formen des Selbstmanagements, der Selbstinstruktion und anderer kognitiver Interventionen sowie der körperlichen und kognitiven Fokussierung. Es kann flexibel und individuell auf die konkreten Probleme des Kindes angepasst werden, wobei die Generalisierung von Bewältigungsverhalten, das in der Therapiesituation erarbeitet und eingeübt wurde, besonders fokussiert wird. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Module. Das Einstiegsmodul (Modul 1) wird immer durchgeführt. Die spezifischen Module können gezielt ausgewählt werden entsprechend den Problemsituationen, die im Rahmen der THOKI-Diagnostik (vgl. Kap. 2.2) identifiziert wurden.
2.1.4 Voraussetzungen für die Anwendung
Entwickelt wurde das THOKI-ADHS zur Anwendung im Rahmen von psychotherapeutischen Sitzungen. Eine Vielzahl der Module ist jedoch auch im Rahmen von Ergotherapie mit Fachkräften denkbar, die sich auf den Bereich ADHS spezialisiert haben. Diese müssen jedoch eine fundierte Ausbildung in der Verhaltenstherapie von Kindern mit ADHS haben. Ein spezifisches Training in der Anwendung von THOKI-ADHS ist für diese Gruppe besonders empfehlenswert.
2.2 Diagnostik
Die für das THOKI-ADHS spezifische Diagnostik erfolgt auf der Grundlage einer umfassenden diagnostischen Abklärung der ADHS-Symptomatik und komorbider Störungen auf der Basis der klinischen Exploration einschließlich Überprüfung der diagnostischen Kriterien mit dem Explorationsschema für Hyperkinetische und Oppositionelle Verhaltensstörungen (ES-HOV; Döpfner, Schürmann & Frölich, 2019) und der Diagnose-Checkliste Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (DCL-ADHS; |19|Döpfner & Görtz-Dorten, 2019) oder dem Interview-Leitfaden für Externale Störungen (ILF-EXTERNAL; Görtz-Dorten et al., 2022). Zusätzlich beantworten Eltern den störungsübergreifenden Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (CBCL/6 – 18R; Döpfner, Plück & Kinnen, 2014) und als störungsspezifischen Fragebogen den Fremdbeurteilungsbogen für Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (FBB-ADHS) aus dem Diagnostik-System DISYPS-III (Döpfner & Görtz-Dorten, 2019). Mit Zustimmung der Eltern beurteilen Lehrkräfte den Lehrerfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (TRF/6 – 18R; Döpfner, Plück & Kinnen, 2014) und ebenfalls den FBB-ADHS. Ab dem Alter von 11 Jahren können Kinder und Jugendliche den störungsübergreifenden Fragebogen für Jugendliche (YSR/11 – 18R; Döpfner, Plück & Kinnen, 2014) und den Selbstbeurteilungsbogen für Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (SBB-ADHS) aus dem DISYPS-III (Döpfner & Görtz-Dorten, 2019) bearbeiten. Durch die Selbsturteilsverfahren kann beurteilt werden, in welchem Umfang das Kind oder der*die Jugendliche die ADHS-Symptome selbst wahrnimmt und welche anderen Probleme aus seiner Sicht vorhanden sind. Eine ausführliche Darstellung der einzelnen diagnostischen Verfahren sind der Publikation Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) (Döpfner, Frölich & Lehmkuhl, 2013), dem Therapieprogramm THOP (Döpfner, Schürmann & Frölich, 2019) und dem Band zu Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen aus dem Kinder-Diagnostik-System (KIDS) zu entnehmen (Döpfner, Lehmkuhl & Steinhausen, 2006; Döpfner, Görtz-Dorten & Steinhausen, in Vorb.).
Spezifisch für die Durchführung des THOKI-ADHS ist die Identifikation der individuellen Probleme, die Gegenstand der Intervention sein sollen. Dabei werden der Situationsfragebogen SIT-ADHS (vgl. Kap. 2.2.1) und die individuelle Problemliste (vgl. Kap. 2.2.2) eingesetzt. Anhand dieser Informationen und einer ausführlichen Exploration der spezifischen Probleme werden anschließend die für den Patienten relevanten Interventionsmodule ausgewählt. Diese beiden Instrumente werden im Folgenden ausführlicher dargestellt.
2.2.1 Situationsfragebogen ADHS (SIT-ADHS)
Der Situationsfragebogen SIT-ADHS dient der Therapieplanung und konkreten Auswahl der Interventionsmodule sowie der Verlaufsmessung. Er wurde im Rahmen des THOKI-ADHS entwickelt. Ausgewählte Alltagssituationen werden detailliert abgebildet, um Schwierigkeiten zu identifizieren und Veränderungen genau darzustellen. Durch den Einsatz als Verlaufsmessinstrument lässt sich eine Veränderung des Funktionsniveaus als wichtiges Erfolgsmaß der ADHS-Therapie bestimmen (siehe auch Fabiano, Schatz & Pelham, 2014).
Der SIT-ADHS fokussiert die konkreten Funktionseinschränkungen in relevanten Alltagssituationen für Schulkinder. Die abgefragten Situationen wurden dabei spezifisch für Kinder mit ADHS ausgewählt, und es werden unterschiedliche mögliche Schwierigkeiten, die in der jeweiligen Situation auftreten können, erfragt. Es geht im SIT darum, unabhängig von übergeordneten Störungen der exekutiven Funktionen oder der Organisationsfähigkeiten, die konkreten Funktionseinschränkungen in alltagsrelevanten Situationen zu erfassen, um damit insbesondere die Therapieplanung zu verbessern und die Module des THOKI-ADHS zielgenau einsetzen zu können. Zudem soll eine Veränderungsmessung vor und nach der Durchführung des THOKI-ADHS ermöglicht werden. Der SIT-ADHS liegt in einer Version für Eltern und in einer Version für Lehrkräfte vor. Die Eltern sowie die Lehrkraft beurteilen auf einer vierstufigen Skala (1 = trifft nicht zu, 2 = trifft teilweise zu, 3 = trifft oft zu, 4 = trifft immer zu), wie zutreffend die jeweilige Aussage ist. Die Elternversion des SIT-ADHS (SIT-ADHS-Eltern) umfasst 67 Items, und es werden zehn Situationsbereiche erfasst, aus denen ein Gesamtwert (67 Items) gebildet werden kann. Es werden die Situationsbereiche Morgenritual (6 Items), Essen (10 Items), Warten und Übergänge (8 Items), Hausaufgaben (11 Items), Schultasche (4 Items), Ordnung (6 Items), Freizeitaktivitäten zu Hause (8 Items), Abendritual (5 Items), Öffentlichkeit (7 Items) und Autofahrt (2 Items) abgefragt. In ersten Analysen zeigt der SIT-ADHS-Eltern in der Gesamtskala mit Cronbachs-Alpha= 0.94 eine exzellente interne Konsistenz. Die einzelnen Skalen zeigen akzeptable bis exzellente interne Konsistenzen. Die meisten Items weisen eine Trennschärfe rit > 0.30 auf und sind somit ausreichend trennscharf (Braun, 2018).
Die Version des SIT-ADHS für Lehrkräfte (SIT-ADHS-Lehrkraft) umfasst 24 Items und es werden vier Situationsbereiche erfasst, aus denen ebenfalls ein Gesamtwert (24 Items) gebildet werden kann. Im SIT-ADHS-Lehrkraft werden die Situationsbereiche Arbeiten im Klassenzimmer (12 Items) Warten und Übergänge (6 Items), Hausaufgaben (3 Items) und Schultasche (3 Items) erhoben. In ersten Analysen zeigt der SIT-ADHS-Lehrkraft in der Gesamtskala mit Cronbachs-Alpha = 0.88 eine sehr gute interne Konsistenz. Die Skalen Arbeiten im Klassenzimmer sowie Warten und |20|Übergänge zeigen ebenfalls sehr gute interne Konsistenzen. Die Skalen Hausaufgaben und Schultasche zeigten hingegen schwache interne Konsistenzen und müssen weiter überprüft werden (Braun, 2018).
Den SIT-ADHS-Eltern sowie den SIT-ADHS-Lehrkraft finden Sie im Anhang sowie bei den Online-Materialien zu diesem Band.
2.2.2 Individuelle Problemliste
Die individuelle Problemliste basiert auf der Problemliste: Verhaltensprobleme des Kindes, welche in ursprünglicher Version von Döpfner und Mitarbeitenden aus dem Jahr 1997 aus dem THOP (Döpfner, Schürmann & Frölich, 1997) stammt, und in weiteren Auflagen leicht modifiziert wurde (Döpfner, Schürmann & Frölich, 2007, 2019). Die Problemliste ermöglicht die Überprüfung individueller Problemsituationen des Kindes und stellt ein ökonomisches Instrument dar, welches variabel einsetzbar ist. Sie eignet sich nicht nur zum Einsatz in der Forschung, sondern auch in der klinischen Routineversorgung. Inhalte therapierelevanter Problembereiche werden deutlich (Frölich & Döpfner, 1997). Gemeinsam mit den Eltern werden bis zu vier Verhaltensprobleme möglichst konkret und voneinander abgrenzbar formuliert und in die Problemliste eingetragen. Anschließend beurteilen die Eltern auf einer Skala von 0 bis 5, wie häufig jedes Problemverhalten in der vergangenen Woche aufgetreten ist (0 = nie, 1 = einmal, 2 = zwei- bis dreimal, 3 = täglich, 4 = mehrmals täglich, 5 = ständig). Nachfolgend beurteilen sie auf einer neunstufigen Skala (0 = kein Problem, 9 = es hätte nicht schlimmer sein können), wie belastend jedes einzelne Problem in der vergangenen Woche war (Döpfner et al., 2019). Zusammenfassend können die Häufigkeit der einzelnen Probleme und deren Summe und die Problemstärke der einzelnen Probleme und ihre Summe ermittelt werden (Döpfner et al., 2019). Im Rahmen des THOKI-ADHS wird die individuelle Problemliste zur Therapieplanung und zur Überprüfung des Therapieverlaufs eingesetzt. Die Individuelle Problemliste finden Sie bei den Online-Materialien zu diesem Band. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel einer individuellen Problemliste.
Abbildung 1: Beispiel für eine individuelle Problemliste
|21|2.3 Therapieansatz
2.3.1 Therapieprinzipien und -methoden
Das THOKI-ADHS folgt den beiden zentralen Behandlungsprinzipien
primär kindzentriert, wobei Eltern und andere Bezugspersonen, wenn nötig, eingebunden werden, sowie
alltagsnah und situationsspezifisch zu arbeiten.
Weiterhin liegt ein besonderer Fokus auf der Generalisierung von Bewältigungsverhalten, welches im THOKI-ADHS erworben wird. Hierzu werden innerhalb der Therapiesitzungen reale und relevante Alltagssituationen simuliert und ihre Bewältigung eingeübt sowie diese durch wöchentliche Therapieaufgaben, häufig unter Einbeziehung der Eltern und anderer Bezugspersonen, in realen Alltagssituationen trainiert. Mit den Kindern wird in der Therapie daran gearbeitet, konkrete problematische Alltagssituationen zu identifizieren und ihr Verhalten in diesen zu modifizieren. Sie werden unter anderem dazu angeleitet, die eigene Körperwahrnehmung zu verbessern, Selbstregulationsstrategien anzuwenden, Selbstinstruktionsstrategien einzusetzen, eigene Handlungen besser zu planen, Materialien und Zeit besser zu organisieren, sich unter Ablenkung zu konzentrieren, Bedürfnisse aufzuschieben und mit Belohnungssystemen umzugehen.
Im Einstiegsmodul (Modul 1) werden die Rahmenbedingungen eingeführt, vor allem die Struktur einer Therapiesitzung, und es werden ein Verstärkersystem in der Sitzung und die grundlegenden THOKI-Techniken eingeführt sowie Hilfsmittel zur Körperwahrnehmung, Selbstregulation und Selbstinstruktion (vgl. Kap. 3.1).
In den Modulen zu den konkreten Problemsituationen (Kap. 3.2 bis 3.12) werden aufeinander aufbauend unterschiedliche Therapiemethoden in den individuell für das Kind ausgewählten Alltagssituation angewendet. Abbildung 2 gibt einen Überblick über den Aufbau der Therapiemethoden.
Abbildung 2: Therapiemethoden des THOKI-ADHS
Beim Stimulusmanagement werden die ausgewählte Situation und das Verhalten in dieser Situation gemeinsam mit dem Kind und ggf. der Bezugsperson genau erfasst und analysiert. Dazu werden die Ergebnisse der diagnostischen Sitzungen verwendet und weiter vertieft. Tabelle 2 zeigt beispielsweise, wie diese einzelnen Situationen und das Verhalten in diesen Situationen konkret beschrieben werden. Auf Grundlage dessen versucht der*die Therapeut*in, äußere Einflüsse in Form von Stimulusmanagement zu optimieren und die Situation ggf. neu zu strukturieren. In diesen Schritt werden soweit möglich auch die Bezugspersonen eingebunden.
Beim Selbstmanagement werden die THOKI-Techniken zur verbesserten Körperwahrnehmung, der Selbstregulation und Selbstinstruktion in der jeweiligen Situation angewendet. Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Hilfsmittel, die zum Selbstmanagement verwendet werden.
Unter möglichst alltagsnahen Bedingungen (Simulationen) wird dann im Fertigkeitentraining die Situation im Therapiesetting durchgeführt. Für jedes Modul wurden Vorschläge entwickelt, wie diese möglichst |22|alltagsnah in die Therapiesituation transportiert werden können und wie der Schwierigkeitsgrad zum Trainieren variiert werden kann. Tabelle 4 zeigt einige Beispiele. Zudem stehen für die einzelnen Module weitere Arbeitsmaterialien und Vorschläge zur Verbesserung der Strukturierung und Organisation zur Verfügung.
Kontingenzmanagement wird sowohl in der Therapiestunde, bei den Therapieaufgaben sowie zum besseren Alltagstransfer im Training zu Hause eingesetzt. Hierfür stehen mit den Token-Sammelsystemen und dem Token-Entzug verschiedene Verstärkersysteme zur Verfügung (vgl. Kap. 2.5.2), die für die jeweilige Situation passend eingesetzt werden können.
Tabelle 2: Beispiele für die konkrete Beschreibung von Problemsituationen
Situation
Beschreibung
Morgenroutine
Kind benötigt sehr viel Zeit zum Aufstehen, Kind muss beim Anziehen oft zum Weitermachen animiert werden, Kind putzt sich nicht ausreichend die Zähne, Kleidung liegt für das Kind schwer zugänglich, Zahnbürste hat keinen festen Platz im Bad
Hausaufgaben
Ort, an dem Hausaufgaben gemacht werden wechselt, Zeitpunkt für die Hausaufgaben ist nicht fest, Kind braucht sehr lange für die Hausaufgaben, es gibt keine Informationen, welche Aufgaben zu erledigen sind