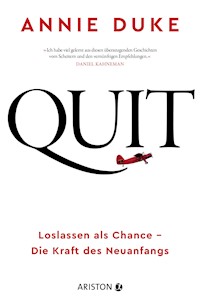18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Die Weltklasse-Pokerspielerin Annie Duke zeigt, wie Sie sich mit Unsicherheiten anfreunden und dadurch bessere Entscheidungen treffen können. Manchmal entscheidet der Zufall, manchmal Geschicklichkeit – das gilt nicht nur für den Erfolg beim Pokern, sondern auch im Leben: Die besten Entscheidungen führen nicht immer zum besten Ergebnis, denn es gibt immer ein Element des Glücks, dass man nicht kontrollieren, und Informationen, die man nicht wissen kann. Möchte man also langfristig erfolgreich sein, so muss man auf Wahrscheinlichkeiten wetten, um so die Lage besser einordnen zu können und voreilige Schlüsse zu vermeiden – sprich: in Wetten denken. Annie Duke, die ehemalige Gewinnerin des World Series of Poker zeigt anhand von Beispielen aus Politik, Wirtschaft, Poker und Sport, wie man mit jeder Unsicherheit umgehen lernt und in der Folge selbstbewusster und gelassener bessere Entscheidungen treffen kann, um dann seine Karten optimal auszuspielen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Ähnliche
Annie Duke
THINKING IN BETS
WIE MAN IMMER DIE RICHTIGE KARTE SPIELT
Annie Duke
THINKING IN BETS
WIE MAN IMMER DIE RICHTIGE KARTE SPIELT
Kluge Entscheidungen treffen, selbst wenn man nicht alle Fakten kennt
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
1. Auflage 2023
© 2023 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Türkenstraße 89
D-80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
© der Originalausgabe 2018 by Annie Duke
Die englische Originalausgabe erschien 2018 bei Portfolio, einem Imprint der Penguin Publishing Group, einer Abteilung von Penguin Random House LLC unter dem Titel Thinking in bets.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Bärbel Knill
Redaktion: Marijke Leege-Topp
Umschlaggestaltung: Pamela Machleidt
Umschlagabbildung: Zaharius/Shutterstock
Satz: abavo GmbH, Buchloe
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-86881-916-8
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96267-476-2
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96267-477-9
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Für Lila und Henry Gleitman, großzügig in Herz und Geist
Inhalt
Einführung │ Warum dies kein Buch über Poker ist
Kapitel 1 │ Das Leben ist ein Pokerspiel, kein Schachspiel
Kapitel 2 │ Wollen wir wetten?
Kapitel 3 │ Wetten, um zu lernen: zukünftige Ergebnisse zuordnen
Kapitel 4 │ Das Buddy-Prinzip
Kapitel 5 │ Uneinigkeit gewinnt
Kapitel 6 │ Das Abenteuer der mentalen Zeitreise
Danksagung
Über die Autorin
Anmerkungen
Literaturhinweise und Empfehlungen
Einführung
Warum dies kein Buch über Poker ist
Im Alter von 26 Jahren dachte ich, meine Zukunft würde sich bereits abzeichnen. Ich war auf dem Campus einer berühmten Privatschule in New Hampshire aufgewachsen, wo mein Vater den Lehrstuhl für Englisch innehatte. Gerade hatte ich an der Columbia University meinen Abschluss in Englisch und Psychologie gemacht. Mein Grundstudium hatte ich an der University of Pennsylvania absolviert, wo ich ein Forschungsstipendium von der National Science Foundation bekommen hatte, in dessen Rahmen ich den Master machen und meine Doktorarbeit in kognitiver Psychologie fertigstellen würde.
Doch kurz vor der Fertigstellung meiner Dissertation wurde ich krank. Ich nahm mir eine Auszeit, verließ die Penn, heiratete und zog in eine Kleinstadt in Montana. Natürlich wurde mein Experiment des Erwachsenseins am anderen Ende des Landes nicht durch das Stipendium von der NSF finanziert und so brauchte ich Geld. Mein Bruder Howard, zu jener Zeit Profi-Pokerspieler, der es damals schon ins Finale der World Series of Poker geschafft hatte, schlug vor, dass ich mich einmal in den Pokerturnieren in Billings probieren sollte. Dieser Vorschlag war nicht so aus der Luft gegriffen, wie er sich vielleicht anhört. Ich komme aus einer Familie, in der Wettkampf und Spiele gepflegt wurden, und Howard hatte mich schon einige Male zu Ferienaufenthalten mit nach Las Vegas genommen, die ich mir mit meinem Stipendium nicht leisten konnte. Ich hatte zugesehen, wie er spielte, und auch selbst ein paar Spiele mit geringem Einsatz mitgemacht.
Ich hatte mich sofort ins Pokern verliebt. Aber mich lockten nicht die bunten Lichter von Las Vegas, sondern die Spannung beim Spielen und das Herausfordern meiner Fähigkeiten im Keller einer Bar in Billings namens Crystal Lounge. Ich hatte viel zu lernen, aber das wollte ich auch unbedingt. Mein Plan war es, während dieser Unterbrechung des Studiums etwas Geld zu verdienen, auf dem akademischen Weg zu bleiben und Poker als Hobby weiter zu betreiben.
Aus meiner vorübergehenden Unterbrechung wurde eine 22-jährige Karriere als Profi-Pokerspielerin. Als ich mich 2012 vom Spielen zurückzog, hatte ich ein Goldarmband der World Series of Poker gewonnen, das WSOP Tournament of Champions sowie die NBC National Heads-Up Championship und mehr als vier Millionen Dollar mit Pokerturnieren verdient. Howard gewann in der Zwischenzeit zwei Armbänder der World Series, einige Titel in der Hall of Fame Poker Classic, zwei World-Poker-Tour-Wettkämpfe und über 6,4 Millionen Dollar Preisgeld aus Turnieren.
Wenn ich jetzt sage, dass ich vom akademischen Weg abgekommen bin, mag das wie Understatement klingen. Aber mir wurde ziemlich schnell klar, dass ich die akademische Welt nicht so wirklich verlassen hatte, sondern nur in eine andere Art Labor gewechselt war, um zu untersuchen, wie Menschen lernen und Entscheidungen treffen. Eine Pokerhand dauert etwa zwei Minuten. Im Verlauf dieser Hand musste ich bis zu 20 Entscheidungen treffen. Und jede Hand endet mit einem konkreten Ergebnis: Ich gewinne oder verliere Geld. Das Ergebnis jeder Hand liefert sofortiges Feedback darüber, wie sich Ihre Entscheidung auszahlt. Aber es ist ein kniffliges Feedback, denn gewinnen oder verlieren sind nur vage Anhaltspunkte für die Qualität der Entscheidungen. Man kann auch Glück haben und gewinnen oder Pech haben und verlieren. Also ist es schwierig, dieses Feedback zu verwenden, um daraus etwas zu lernen.
Die Aussicht, dass mir an einem Pokertisch ein paar grauhaarige Rancher in Montana systematisch das Geld aus der Tasche ziehen würden, zwang mich dazu, entweder praktische Lösungen für dieses Problem zu finden oder pleitezugehen. Ich hatte schon früh in meiner Laufbahn das Glück gehabt, einige Ausnahme-Pokerspieler kennenzulernen und von ihnen zu lernen, wie sie nicht nur mit Glück oder Nichtwissen umgingen, sondern auch, wie lernen und Entscheidungen zu treffen zusammenhängen.
Im Lauf der Zeit brachten mir diese Weltklasse-Pokerspieler bei, was ein Einsatz in Wahrheit ist: eine Entscheidung über eine unsichere Zukunft. Die Tatsache, dass ich Entscheidungen wie Einsätze betrachten konnte, machte es mir möglich, in unsicheren Situationen die Gelegenheit zu erkennen, etwas zu lernen. Wenn ich Entscheidungen wie Einsätze behandelte, so entdeckte ich, half mir das, die üblichen Entscheidungsfehler zu vermeiden, von den Ergebnissen auf rationalere Weise zu lernen und die Emotionen so weit wie möglich aus dem Prozess herauszuhalten.
Weil mein Freund und super erfolgreicher Pokerspieler Erik Seidel im Jahr 2002 die Einladung, einen Vortrag zu halten, abgesagt hatte, bat mich ein Hedgefonds-Manager, vor einer Gruppe von Tradern zu sprechen und ihnen ein paar Pokertipps zu geben, die sich auch im Wertpapierhandel anwenden ließen. Seitdem halte ich Vorträge vor Berufsgruppen vieler Branchen und spreche dabei über meine eigene Herangehensweise, die ich durchs Pokern gelernt und kontinuierlich verbessert habe, und helfe anderen dabei, sie auf Entscheidungen in den Finanzmärkten, in der Strategieplanung, im Bereich Human Resources, im Rechtswesen und als Unternehmer anzuwenden.
Die gute Nachricht ist, dass es praktische Wege und Strategien gibt, mit denen wir die Fallen umgehen können, die zwischen der Entscheidung liegen, die wir gerne treffen würden, und der Umsetzung dieser Entscheidungen. Das Versprechen dieses Buches ist, dass das Denken in Einsätzen uns dazu bringt, in allen Lebensbereichen bessere Entscheidungen zu treffen. Wir können besser werden im Unterscheiden von Ergebnisqualität und Entscheidungsqualität, wir entdecken, wie wirkungsvoll es ist, zu sagen: »Ich bin mir nicht sicher«, wir lernen Strategien, um die Zukunft zu entwerfen und bei Entscheidungen weniger reaktiv zu sein. Wir lernen, Gruppen aus weiteren Wahrheitssuchenden zu bilden und aufrechtzuerhalten, um unsere Entscheidungsprozesse zu verbessern, und wir lernen, unser vergangenes und zukünftiges Ich zu nutzen, um weniger emotionale Entscheidungen zu treffen.
Ich bin heute durch das Denken in Einsätzen keine stets rationale, emotionsfreie Entscheiderin geworden. Ich habe viele Fehler gemacht (und mache sie immer noch). Fehler, Emotionen, verlieren – all das ist unvermeidlich, weil wir Menschen sind. Der Ansatz des Denkens in Einsätzen hat mich in Richtung Objektivität, Genauigkeit und Offenheit des Geistes vorangebracht. Dieses Vorankommen verstärkt sich mit der Zeit und sorgt dann für bedeutende Veränderungen in unserem Leben.
Dies ist also kein Buch über Pokerstrategie oder Glücksspiel. Es geht darin aber um Dinge, die ich aus dem Poker über das Lernen und das Treffen von Entscheidungen mitgenommen habe. Die praktischen Lösungen, die ich in jenen verrauchten Pokerzimmern gelernt habe, stellten sich als ziemlich gute Strategien für jeden heraus, der in Zukunft bessere Entscheidungen treffen möchte.
Das Denken in Einsätzen beginnt mit der Erkenntnis, dass es genau zwei Dinge gibt, die bestimmen, wie sich unser Leben gestaltet: die Qualität unserer Entscheidungen und Glück. Beim Denken in Einsätzen geht es darum zu lernen, den Unterschied zwischen beiden zu erkennen.
Kapitel 1
Das Leben ist ein Pokerspiel, kein Schachspiel
Pete Carroll und die Montag-Morgen-Quarterbacks
Eine der umstrittensten Entscheidungen in der Geschichte des Super Bowl fand in den letzten Sekunden des Super Bowl XLIX 2015 statt. Es waren noch 20 Sekunden Spielzeit. Die Seattle Seahawks lagen vier Punkte im Rückstand und hatten den Ball im Second Down einen Yard vor der Endzone der New England Patriots. Jeder erwartete, dass der Coach der Seahawks, Pete Carroll, mit seinem Playcall die Übergabe des Balls an Seattles Runningback Marshawn Lynch ansagen würde. Warum sollte man einen solchen Playcall auch nicht erwarten? Es war eine Short-yardage-Situation und Lynch war einer der besten Runningbacks der NFL.
Stattdessen lautete Carrolls Playcall für Quarterback Russell Wilson, einen Pass zu spielen. New England fing den Ball ab und gewann den Super Bowl Sekunden später. Die Schlagzeilen am nächsten Tag waren brutal:
USA Today: »Was um alles in der Welt dachte sich Seattle beim miesesten Playcall in der Geschichte der NFL?«
Washington Post: »›Schlechtester Playcall in der Geschichte des Super Bowl‹ wird das Ansehen der Seahawks und der Patriots für immer verändern«
FoxSports.com: »Blödester Call in der Geschichte des Super Bowl könnte der Anfang vom Ende der Seattle Seahawks sein«
Seattle Times: »Seahawks unterliegen wegen des schlechtesten Calls in der Geschichte des Super Bowl«
Der New Yorker: »Der furchtbare Fehler eines Coaches im Super Bowl«
Auch wenn die Sache von fast jedem Experten als jenseits jeder Debatte betrachtet wurde, argumentierten einige wenige Außenseiter-Stimmen, dass die Spielentscheidung vernünftig gewesen sei, wenn nicht sogar brillant. Benjamin Morris’ Analyse auf FiveThirtyEight.com und die von Brian Burke auf Slate.com argumentierten überzeugend, dass die Entscheidung für einen Pass vollkommen vertretbar war, wenn man das Zeitmanagement und die Situation des Spielendes berücksichtigte. Sie wiesen auch darauf hin, dass ein Abfangen des Balls ein extrem unwahrscheinliches Ergebnis war. (Von 66 Pässen eines Gegners an der Ein-Yard-Linie während der Saison waren null abgefangen worden. In den vorhergehenden 15 Saisonen lag die Abfangrate in einer solchen Situation bei etwa zwei Prozent.)
Jene Stimmen, die dagegenhielten, konnten gegen die Lawine der Kritik, die über Pete Carroll hinwegrollte, nicht das Geringste ausrichten. Aber ob man sich nun der umstrittenen Analyse anschließt oder nicht, die meisten wollten Carroll nicht zugestehen, dass er das Ganze durchdacht oder für seinen Call zumindest irgendeine Begründung gehabt hatte. Hier stellt sich nun die Frage: Warum waren so viele Menschen so fest davon überzeugt, dass Pete Carroll es so falsch gemacht hatte?
Wir können es mit fünf Wörtern zusammenfassen: Das Spiel hat nicht funktioniert.
Stellen Sie sich für einen Moment vor, dass Wilson durch den Pass einen spielentscheidenden Touchdown gelandet hätte. Die Schlagzeilen hätten sich gewandelt in: »Brillanter Call« oder »Seahawks gewinnen Super Bowl mit Überraschungsspiel« oder »Carroll trickst Belichick aus«. Oder stellen Sie sich vor, der Pass wäre danebengegangen und die Seahawks hätten in einem dritten oder vierten Running Play gepunktet (oder auch nicht). Die Schlagzeilen hätten von diesen anderen Spielzügen gehandelt. Was Pete Carroll in der zweiten Chance für einen Call gemacht hätte, wäre ignoriert worden.
Carroll hatte Pech. Er hatte die Kontrolle über die Qualität der Playcall-Entscheidung, aber nicht darüber, wie das Ganze ausging. Und weil er eben kein günstiges Ergebnis bekam, musste er den Kopf dafür hinhalten. Er machte einen Playcall, der große Chancen hatte, in einem spielentscheidenden Touchdown zu enden oder in einem unvollendeten Pass (was den Seahawks zwei weitere Spielchancen ermöglicht hätte, um den Ball an Marshawn Lynch zu übergeben). Er hatte eine Entscheidung von guter Qualität getroffen, die ein schlechtes Ergebnis erzielte.
Pete Carroll war ein Opfer unserer Neigung, die Qualität einer Entscheidung mit der Qualität ihres Ergebnisses gleichzusetzen. Pokerspieler haben dafür ein Wort: Resulting. Als ich begann, Poker zu spielen, warnten mich erfahrenere Spieler vor den Gefahren des Resultings und rieten mir der Versuchung zu widerstehen, meine Strategie zu ändern, nur weil ein paar Hände kurzfristig nicht funktioniert hatten.
Pete Carroll verstand, dass seine Kritiker sich des Resultings schuldig gemacht hatten. Vier Tage nach dem Super Bowl trat er in der Today-Show auf und räumte ein: »Es war das schlechteste Ergebnis eines Playcalls, das es jemals gab.« Er fügte aber hinzu: »Der Call wäre großartig gewesen, wenn wir es gepackt hätten. Dann wäre er einfach in Ordnung gewesen und niemand hätte sich überhaupt darüber Gedanken gemacht.«
Warum sind wir so schlecht darin, Glück und Fähigkeiten auseinanderzuhalten? Warum fühlen wir uns so unwohl mit dem Wissen, dass Ergebnisse jenseits unserer Kontrolle liegen können? Warum schaffen wir eine so starke Verbindung zwischen Ergebnissen und der Qualität der Entscheidungen, die diesen vorangehen? Wie können wir verhindern, dass wir in die Falle des Montag-Morgen-Quarterbacks1) tappen, ob es nun darum geht, die Entscheidung eines anderen zu analysieren oder darum, Entscheidungen in unserem eigenen Leben zu treffen und im Nachhinein zu bewerten?
Die Gefahren des Resultings
Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und denken Sie an Ihre beste Entscheidung im letzten Jahr. Jetzt nehmen Sie sich einen Moment Zeit und denken Sie an Ihre schlechteste Entscheidung.
Ich möchte wetten, dass Ihre beste Entscheidung einem guten Ergebnis vorausging und die schlechteste einem schlechten Ergebnis.
Das ist eine sichere Wette für mich, denn Resulting ist etwas, was wir andauernd tun. Montag-Morgen-Quarterbacks sind ein leichtes Ziel, genau wie Autoren und Blogger, die einem Massenpublikum Sofort-Analysen liefern. Aber – wie ich aus eigener Erfahrung im Poker weiß – ist Resulting ein Routine-Denkmuster, das uns alle durcheinanderbringt. Wenn wir einen zu engen Zusammenhang zwischen Ergebnis und Qualität der Entscheidung sehen, beeinträchtigt das unsere Entscheidungen jeden Tag, und das hat potenziell weitreichende, katastrophale Folgen.
Wenn ich Führungskräfte berate, beginne ich manchmal mit dieser Übung. Ich bitte die Mitglieder der Gruppe, für unser erstes Treffen eine kurze Beschreibung ihrer besten und ihrer schlechtesten Entscheidung im vorangegangenen Jahr vorzubereiten. Hierbei kommt es darauf an, dass er oder sie nicht seine oder ihre besten oder schlechtesten Ergebnisse heraussucht, sondern die besten oder schlechtesten Entscheidungen.
In einem Beratungsmeeting mit einer Gruppe aus CEOs und Unternehmenseigentümern hatte ein Mitglied der Gruppe als seine schlechteste Entscheidung herausgesucht, dass er den Präsidenten seines Unternehmens gefeuert hatte. Er erklärte: »Die Suche nach einem Ersatz war furchtbar. Wir hatten zwei verschiedene Leute auf dem Job. Die Verkaufszahlen sinken. Dem Unternehmen geht es nicht gut. Wir hatten keine Bewerber, die sich als so gut herausstellten wie er.«
Das hört sich nach einem desaströsen Ergebnis an, aber ich war neugierig nachzuhaken, warum der CEO glaubte, die Entscheidung, seinen Präsidenten zu feuern, sei so schlecht gewesen (abgesehen davon, dass es danach nicht gut gelaufen war).
Er erklärte den Entscheidungsprozess und die Grundlage der Schlussfolgerung, den Präsidenten zu feuern. »Wir sahen uns unsere direkten Wettbewerber und vergleichbare Unternehmen an und kamen zu dem Schluss, dass unsere Leistungen nicht auf dem Niveau der anderen lagen. Wir dachten, wir könnten mehr leisten und auf deren Niveau aufsteigen. Wir nahmen an, dass es wohl ein Führungsproblem war.«
Ich fragte, ob bei dem Prozess auch mit dem Präsidenten zusammengearbeitet worden sei, um seine Qualifikationslücken zu verstehen und was er hätte besser machen können. Das Unternehmen hatte tatsächlich mit ihm zusammengearbeitet, um seine Qualifikationslücken zu finden. Der CEO stellte einen Führungscoach ein, der mit ihm an seinen Führungsfähigkeiten arbeitete, die sich als hauptsächliche Schwäche herausgestellt hatten.
Nachdem das Führungscoaching keine bessere Leistung brachte, zog das Unternehmen in Betracht, die Verantwortung des Präsidenten aufzuteilen, sodass er sich auf seine Stärken konzentrieren und andere Verantwortungsbereiche an eine andere Führungsperson abgeben konnte. Sie verwarfen diese Idee jedoch, weil sie zu dem Schluss kamen, dass die Moral des Präsidenten darunter leiden würde und die Mitarbeiter dies wahrscheinlich als Misstrauensvotum empfinden würden. Zudem hätte es zusätzlichen finanziellen Druck für die Firma bedeutet, eine Position aufzusplitten, von der man glaubte, dass sie von einer Person erfüllt werden konnte.
Schließlich lieferte der CEO noch ein paar Hintergrundinformationen über die Erfahrung des Unternehmens mit externen Mitarbeitern auf Führungsniveau und seine Sicht über aktuell verfügbare Talente. Es hörte sich an, als hätte der CEO eine vernünftige Grundlage für seine Annahme, dass er jemand Besseren finden würde.
Ich fragte in die versammelte Gruppe: »Wer findet, dass dies eine schlechte Entscheidung war?« Es war nicht überraschend, dass jeder der Meinung war, das Unternehmen habe einen vernünftigen Prozess durchlaufen und eine Entscheidung getroffen, die angesichts dessen, was man zu der Zeit wusste, vernünftig war.
Es hörte sich an wie ein schlechtes Ergebnis, keine schlechte Entscheidung. Der mangelhafte Zusammenhang zwischen Ergebnissen und Entscheidungsqualität brachte den CEO aus der Fassung und beeinflusste die folgenden Unternehmensentscheidungen negativ. Der CEO hatte die Entscheidung als Fehler empfunden, weil es danach nicht funktionierte. Er bereute die Entscheidung und das quälte ihn offensichtlich sehr. Er legte sehr deutlich dar, dass er hätte wissen müssen, dass die Entscheidung, den Präsidenten zu feuern, sich als schlecht herausstellen würde. Sein Entscheidungsverhalten war von da an von der Überzeugung geprägt, dass er einen Fehler gemacht hatte. Dabei unterlag er nicht nur dem Resulting, sondern auch dessen Begleiter, dem Rückschaufehler. Der Rückschaufehler ist die Tendenz, ein Ergebnis, nachdem es bekannt ist, als unvermeidlich zu betrachten. Wenn wir sagen: »Ich hätte wissen müssen, dass das passieren wird«, oder »Ich hätte das kommen sehen sollen«, unterliegen wir dem Rückschaufehler.
Solche Überzeugungen kommen von einer übermäßig engen Verknüpfung zwischen Ergebnis und Entscheidung. Genau wie die Armee der Kritiker von Pete Carrolls Entscheidung, im letzten Spiel des Super Bowl einen Pass spielen zu lassen, hatte sich der CEO schuldig gemacht, Resulting zu betreiben, seine eigene sorgfältige Analyse und die seines Unternehmens zu ignorieren und sich allein auf das schlechte Ergebnis zu fokussieren. Die Entscheidung führte zu keinem guten Ergebnis, aber er betrachtete das Ergebnis als unvermeidliche Konsequenz anstatt einer möglichen Konsequenz.
In der Übung, die ich durchführe, bei der man seine beste und seine schlechteste Entscheidung heraussucht, gibt es anscheinend nie jemanden, der eine schlechte Entscheidung angibt, die durch Glück zu einem guten Ergebnis geführt hat, oder eine gut durchdachte Entscheidung, die nicht aufgegangen ist. Wir verknüpfen Ergebnisse mit Entscheidungen, auch wenn es leicht ist, unbestreitbare Beispiele aufzuführen, in denen Entscheidung und Ergebnis nicht so perfekt korrelieren. Kein nüchterner Mensch glaubt, dass es eine gute Entscheidung ist oder für eine gute Fahrfähigkeit spricht, wenn man sicher nach Hause kommt, nachdem man betrunken Auto gefahren ist. Dass jemand seine zukünftigen Entscheidungen auf diesem reinen Glücksergebnis aufbaut, wäre gefährlich und kommt wohl niemals vor (außer man denkt sich das aus, während man betrunken ist und sich offensichtlich selbst betrügt).
Doch genau das passierte dem CEO. Er veränderte sein Verhalten aufgrund der Qualität des Ergebnisses, nicht aufgrund der Qualität des Entscheidungsprozesses. Er beschloss, dass er besser fahre, wenn er betrunken sei.
Schnell reagieren oder sterben – Rationalität ist nichts für unser Gehirn
Die Irrationalität der Kritiker von Pete Carroll und des CEOs sollte niemanden überraschen, der mit Verhaltensökonomie vertraut ist. Dank der Arbeit vieler brillanter Psychologen, Ökonomen, Hirnforscher und Neurowissenschaftler gibt es zahlreiche ausgezeichnete Bücher, die erklären, warum Menschen bei Entscheidungen mit bestimmten Formen der Irrationalität geschlagen sind. (Wenn Sie noch keine Bücher dieser Art kennen, finden Sie eine Auswahl in der Liste der weiterführenden Literatur.) Hier nun eine kurze Zusammenfassung.
Zunächst einmal hat sich unser Gehirn dazu entwickelt, Sicherheit und Ordnung zu schaffen. Wir fühlen uns nicht wohl bei dem Gedanken, dass Glück und Pech eine bedeutende Rolle in unserem Leben spielen. Wir erkennen an, dass es Glück und Pech gibt, aber wir lehnen den Gedanken ab, dass sich die Dinge trotz unserer bestmöglichen Bemühungen nicht so entwickeln, wie wir das wollen. Wir haben ein besseres Gefühl dabei, uns die Welt als einen ordentlichen Ort vorzustellen, an dem keine Willkür herrscht und die Dinge vollkommen vorhersehbar sind. Wir haben uns evolutionär dahin entwickelt, die Welt so zu sehen. Ordnung ins Chaos zu bringen war notwendig für unser Überleben.
Wenn unsere Vorfahren in der Savanne ein Rascheln hörten und ein Löwe hervorsprang, konnte es bei späteren Gelegenheiten ihr Leben retten, wenn sie eine Verknüpfung zwischen Rascheln und Löwe herstellten. Vorhersehbare Verknüpfungen zu finden ist buchstäblich eine Strategie, mit der unsere Spezies überlebt hat. Der Wissenschaftsautor, Historiker und Skeptiker Michael Shermer erklärt in The Believing Brain, warum wir in unserer Entwicklungsgeschichte (und Frühgeschichte) immer nach Verknüpfungen gesucht haben, auch wenn sie zweifelhaft oder falsch waren. Die fälschliche Interpretation eines Raschelns als vom Wind verursacht, während es tatsächlich ein sich anschleichender Löwe ist, wird als Fehler erster Art oder falsch-positiv bezeichnet. Die Konsequenzen eines solchen Fehlers waren sehr viel weniger gravierend als die eines Fehlers zweiter Art oder falsch-negativ. Ein Falsch-negativ hätte fatal sein können: Die Annahme, jedes Rascheln wäre der Wind, hätte dazu geführt, dass unsere Vorfahren gefressen worden wären, und es würde uns gar nicht geben.
Das Streben nach Sicherheit hat uns in all der Zeit geholfen zu überleben, aber es kann unsere Entscheidungen in einer Welt voller Unsicherheit auch dominieren. Wenn wir vom Ergebnis ausgehend zurückblicken, um herauszufinden, warum alles so passiert ist, laufen wir Gefahr, in einige Fallen zu tappen, wie zum Beispiel dort einen Kausalzusammenhang herzustellen, wo es nur eine Korrelation gibt, oder sich nur die passenden Daten herauszusuchen, um dasjenige Narrativ zu bestätigen, das wir bevorzugen. Wir hämmern eine Menge Würfel in runde Löcher, um die Illusion einer engen Verknüpfung zwischen Ergebnis und Entscheidung aufrechtzuerhalten.
Beim Treffen von Entscheidungen konkurrieren verschiedene Hirnfunktionen miteinander. Der Nobelpreisträger und Psychologieprofessor Daniel Kahneman machte in seinem Bestseller von 2011 Thinking, Fast and Slow die Begriffe »System 1« und »System 2« bekannt. Er beschrieb System 1 als »Schnelles Denken«. System 1 ist das, was uns bremsen lässt, wenn uns jemand auf der Straße vors Auto springt. Es umfasst Reflex, Instinkt, Intuition, Impulse und automatische Informationsverarbeitung. System 2, das »Langsame Denken«, ist das, mit dem wir entscheiden, uns konzentrieren und geistige Energie aufwenden. Kahneman erklärt, dass System 1 und System 2 in der Lage sind, sich die Aufgaben aufzuteilen und zu bestimmen, wie wir entscheiden, aber auch, dass sie zu Störungen führen, wenn sie miteinander im Konflikt sind.
Ich persönlich bevorzuge die Begriffe »reflexives Denken« und »abwägendes Denken«, die der Psychologe Gary Marcus verwendet. In seinem Buch von 2008, Kluge: The Haphazard Evolution of the Human Mind, schrieb er: »Unser Denken kann in zwei Ströme unterteilt werden, einen, der schnell, automatisch und weitgehend unbewusst abläuft, und einen, der langsam, abwägend und bewertend ist.« Das erste, »das reflexive System, scheint seine Aufgabe schnell und automatisch zu verrichten, mit oder ohne bewusste Wahrnehmung«. Das zweite System, »das abwägende System … wägt ab, betrachtet, kaut die Fakten durch«.
Der Unterschied zwischen den Systemen ist mehr als nur die Bezeichnungen. Die automatische Informationsverarbeitung kommt aus den evolutionär älteren Teilen des Gehirns, dazu gehören das Kleinhirn, die Basalganglien und die Amygdala. Unser abwägendes Denken findet im präfrontalen Cortex statt.
Colin Camerer, Professor für Verhaltensökonomie am California Institute of Technology (Caltech) und führender Vortragsredner und Forscher an der Schnittstelle zwischen Spieltheorie und Neurowissenschaften, erklärte mir, wie verrückt es sei, zu glauben, wir könnten unser abwägendes Denken dazu bringen, unsere Entscheidungen mehr zu beeinflussen. »Wir haben diese dünne Schicht des präfrontalen Cortex, die nur für uns gemacht ist und oben auf diesem großen tierischen Gehirn aufliegt. Diese dünne Schicht dazu zu bringen, noch mehr zu regeln, ist unrealistisch.« Der präfrontale Cortex kontrolliert nicht die meisten unserer täglichen Entscheidungen. Wir können einfach nicht mehr aus dieser einzigartigen, dünnen Schicht herausholen. »Er ist sowieso schon überlastet«, erklärte er mir.
Das sind die Teile unseres Gehirns, die wir nun einmal haben, und daran wird sich in absehbarer Zeit auch nichts ändern.2) Rationale Entscheidungen zu treffen ist nicht nur eine Sache der Willenskraft oder des absichtlichen Treffens von mehr Entscheidungen im Prozess des abwägenden Denkens. Unsere Kapazitäten im abwägenden Denken sind bereits ausgelastet. Wir haben nicht die Möglichkeit, wenn wir ein Problem erkennen, einfach die Arbeit auf einen anderen Teil des Gehirns zu verlagern, wie wenn man sich beim Heben von Kisten den Rücken gezerrt hat und das Gewicht auf die Beinmuskeln verlagert.
Abwägendes wie reflexives Denken sind beide für unser Überleben und Vorankommen notwendig. Die großen Entscheidungen darüber, was wir erreichen wollen, nehmen das abwägende System in Anspruch. Die meisten Entscheidungen, die wir auf dem Weg zu diesen Zielen treffen, stammen jedoch vom reflexiven Denken. Die abkürzenden Verknüpfungen, die in das automatische Informationsverarbeitungssystem eingebaut sind, haben verhindert, dass wir in der Savanne herumstanden und über den Ursprung eines potenziell bedrohlichen Geräusches debattierten, während die Quelle dieses Geräusches uns im nächsten Moment verschlang. Diese Abkürzungen haben uns am Leben erhalten, indem sie routinemäßig die Tausenden Entscheidungen trafen, die uns unser tägliches Leben erst ermöglichen.
Wir brauchen diese Abkürzungen, aber sie haben ihren Preis. Viele falsche Schritte beim Entscheiden kommen von dem Druck auf das reflexive System, seine Aufgabe schnell und automatisch zu erledigen. Niemand steht morgens auf und sagt sich: Ich will verschlossen und abweisend zu anderen sein. Aber was passiert, wenn wir auf eine Arbeit konzentriert sind und ein Kollege kommt mit seinen Flausen im Kopf daher? Unser Gehirn setzt schon Körpersprache und kurze Antworten ein, um ihn loszuwerden, ohne gegen die Konventionen der Höflichkeit zu verstoßen. Wir tun das nicht bewusst; wir tun es einfach. Aber vielleicht hätte der Kollege eine nützliche Information für uns? Wir haben ihn ausgeblendet, abgekürzt und sind darauf eingestellt, alles zu vernachlässigen, was wir wahrnehmen, wenn es von dem abweicht, was wir bereits wissen.
Die meisten unserer täglichen Handlungen kommen aus der automatischen Informationsverarbeitung. Wir haben Gewohnheiten und Standardverhaltensweisen, die wir nur selten wahrnehmen, vom Greifen eines Stifts bis zum Ausweichen, um einen Autounfall zu vermeiden. Die Herausforderung ist nicht, die Arbeitsweise unseres Gehirns zu verändern, sondern herauszufinden, wie wir innerhalb der Beschränkungen des Gehirns, die wir nun einmal haben, handeln können. Sich unseres eigenen irrationalen Verhaltens bewusst zu sein und es verändern zu wollen, ist nicht genug, genauso wie durch das Wissen, dass man eine optische Illusion vor sich hat, diese Illusion nicht verschwindet. Daniel Kahneman hat die berühmte Müller-Lyer-Illusion als Beispiel aufgeführt, um dies zu veranschaulichen.
Welche dieser drei Linien ist am längsten? Unser Gehirn sendet uns das Signal, dass die zweite Linie am längsten ist, aber man kann anhand der senkrechten Linien sehen, dass sie alle gleich lang sind.
Wir können die Linien nachmessen, um zu bestätigen, dass sie alle gleich lang sind, aber die Illusion verschwindet dadurch nicht.
Doch wir haben die Möglichkeit, Hilfsmittel hinzuzuziehen wie etwa ein Lineal und wir können lernen, wann wir es anwenden müssen, um zu überprüfen, wie unser Gehirn die Dinge verarbeitet, die wir sehen. Es hat sich herausgestellt, dass Poker eine hervorragende Plattform ist, um praktische Strategien zu finden, damit unsere Entscheidungen besser mit unseren Zielen übereinstimmen. Das Verständnis dafür, wie Pokerspieler denken, kann uns helfen, mit den Entscheidungsproblemen umzugehen, die uns am Arbeitsplatz plagen, im Finanzleben oder in Beziehungen – selbst bei der Entscheidung, ob es ein brillanter Spielzug ist, einen Pass zu spielen, oder nicht.
»Time!« – du hast noch 70 Sekunden
Unser Ziel ist es, unser reflexives Denken dahin zu bringen, nach dem besten Wissen unseres abwägenden Denkens zu handeln. Pokerspieler müssen die wissenschaftlichen Hintergründe gar nicht kennen, um zu verstehen, wie schwer es ist, die beiden Systeme in Einklang zu bringen. Pokerspieler müssen zahlreiche Entscheidungen mit bedeutenden finanziellen Konsequenzen in einem eng gesteckten zeitlichen Rahmen treffen, und zwar so, dass ihr reflexives Denken mit ihren Langzeitzielen übereinstimmt. Das macht den Pokertisch zu einem einzigartigen Labor, um den Prozess der Entscheidungsfindung zu studieren.
Jede Pokerhand erfordert mindestens eine Entscheidung (die Startkarten zusammenzufalten und abzulegen: zu passen – oder zu spielen) und manche Pokerhand kann bis zu 20 Entscheidungen erforderlich machen. Während eines Pokerspiels in einem Pokerraum im Casino bekommen die Spieler etwa 30 Hände pro Stunde. Eine durchschnittliche Pokerhand dauert etwa zwei Minuten, inklusive der Zeit, die der Dealer braucht, um die Karten einzusammeln, zu mischen und an die Spieler auszuteilen. Poker-Sessions dauern normalerweise mehrere Stunden, mit vielen Entscheidungen bei jeder Hand. Das bedeutet, ein Pokerspieler muss pro Session Hunderte Entscheidungen treffen, und sie finden sämtlich in halsbrecherischer Geschwindigkeit statt.
Die Etikette und die Regeln des Spiels fordern von den Spielern, das Spiel nicht durch Nachdenken zu verlangsamen, selbst wenn eine Entscheidung enorme finanzielle Konsequenzen nach sich zieht. Wenn ein Spieler besonders lange braucht, kann ein anderer Spieler »Time!« rufen. Dann werden dem nachdenkenden Spieler ganze 70 Sekunden eingeräumt, um sich zu entscheiden. Das ist im Poker eine Ewigkeit.
Jede Hand (und daher auch jede Entscheidung) hat unmittelbare finanzielle Konsequenzen. In einem Turnier oder einem Spiel mit hohem Einsatz kann jede Entscheidung mehr wert sein als ein durchschnittliches Einfamilienhaus und die Spieler müssen diese Entscheidungen schneller treffen, als wir uns im Restaurant entscheiden, was wir bestellen. Selbst bei Spielen mit geringerem Einsatz steht bei jeder Entscheidung das meiste oder alles Geld, das ein Spieler auf dem Tisch hat, potenziell auf dem Spiel. Deshalb müssen Pokerspieler eine Geschicklichkeit für Ad-hoc-Entscheidungen entwickeln, sonst überleben sie in dem Beruf nicht. Das heißt, sie müssen einen Weg finden, ihre Ziele (die sie sich im Vorfeld gesteckt haben) innerhalb der geforderten Geschwindigkeit am Spieltisch umzusetzen. Wer vom Poker leben will, muss zwischen dem abwägenden und dem reflexiven System hin- und herschalten können. Die besten Spieler müssen einen Weg finden, eigentlich unlösbare Konflikte Einklang zu bringen.
Außerdem müssen Pokerspieler nach dem Spiel aus dem wilden Durcheinander aus Entscheidungen und Ergebnissen lernen, indem sie Glück von Fähigkeit sowie das Signal vom Lärm unterscheiden und sich vor dem Resulting in Acht nehmen. Das ist die einzige Möglichkeit, sich zu verbessern, besonders wenn dieselben Situationen unter Druck und in variierter Form immer wieder auftreten.
Die Kunst der Umsetzung ist für den Erfolg im Poker noch wichtiger als angeborenes Talent. Alles Talent der Welt wird nichts ausrichten, wenn ein Spieler die Umsetzung nicht beherrscht, nämlich häufig vorkommende Entscheidungsfallen zu umgehen, aus Ergebnissen auf rationale Weise zu lernen und Emotionen so weit wie möglich aus dem Prozess herauszuhalten. Spieler mit ehrfurchterweckendem Talent räumen an ihren besten Abenden ab, aber gehen an den vielen anderen Abenden pleite, wenn sie sich dieser Herausforderung nicht gestellt haben. Pokerspieler, die sich lange halten, haben viele verschiedene Talente, aber was ihnen gemeinsam ist, ist die Fähigkeit zur Umsetzung innerhalb dieses Rahmens.
Wir alle haben damit zu kämpfen, unsere Ziele zu erreichen. Pokerspieler kämpfen denselben Kampf, nur mit zusätzlichen Schwierigkeiten wie Zeitdruck, offener und direkter Unsicherheit und unmittelbaren finanziellen Konsequenzen. Das macht das Pokerspiel zu einem großartigen Ort, um innovative Herangehensweisen zu finden, diese Probleme zu überwinden. Und der Nutzen von Poker, um den Prozess der Entscheidungsfindung besser zu verstehen, ist in der akademischen Welt längst anerkannt.
Dr. Strangelove
Für einen Wissenschaftler ist es schwierig, populär zu werden. Es überrascht also nicht, dass den meisten der Name John von Neumann kein Begriff ist.
Das ist schade, denn von Neumann ist einer meiner Helden, und er sollte es auch für jeden sein, der sich darum bemüht, bessere Entscheidungen zu treffen. Sein Beitrag zur Wissenschaft des Entscheidens war immens und dennoch war er nur eine Fußnote im kurzen Leben eines der größten Geister in der Geschichte des wissenschaftlichen Denkens. (Und, was kein Zufall ist, er war Pokerspieler.)
Nach 22 Jahren, in denen er zu praktisch jedem Bereich der Mathematik etwas beigetragen hatte, tat er in den letzten zehn Jahren seines Lebens Folgendes: Er spielte eine Schlüsselrolle im Manhattan Project, war Pionier in der Physik hinter der Wasserstoffbombe, entwickelte die ersten Computer, fand am Ende des Zweiten Weltkriegs einen optimalen Weg, Bomber zu lenken und Ziele anzuvisieren, und schuf das Konzept vom Gleichgewicht des Schreckens (Mutually Assured Destruction, MAD), das führende geopolitische Überlebensprinzip während des Kalten Krieges. Selbst nach seiner Krebsdiagnose 1955 im Alter von 52 Jahren diente er in der ersten zivilen Behörde zur Aufsicht über die Atomforschung und -entwicklung, nahm an Meetings teil, solange er körperlich dazu in der Lage war, wenn auch unter großen Schmerzen und im Rollstuhl.
Trotz all dem, was er in der Wissenschaft geleistet hat, ist von Neumanns Vermächtnis in der allgemeinen Wahrnehmung eines, das wie die Vorlage für eine Titelfigur in Stanley Kubricks apokalyptischer Komödie Dr. Strangelove wirkt: ein Genie mit heftigem Akzent, verkrüppelt und an den Rollstuhl gefesselt, dessen Strategie vom Gleichgewicht des Schreckens schiefgeht, sobald ein verrückter General nur einen einzigen Bomber auf eine nicht autorisierte Mission schickt, die das automatische Abfeuern sämtlicher amerikanischer und sowjetischer Nuklearwaffen in Gang setzt.
Zusätzlich zu all dem, was er erreicht hat, ist John von Neumann auch der Vater der Spieltheorie. Nachdem er seine Anstellung beim Manhattan Project aufgegeben hatte, arbeitete er mit Oskar Morgenstern zusammen, um 1944 Theory of Games and Economic Behavior (deutsch: Spieltheorie und wirtschaftliches Verhalten) zu veröffentlichen. Auf der Liste der »100 einflussreichsten Bücher des Jahrhunderts« der Boston Public Library steht auch Theory of Games. William Poundstone, Autor eines vielgelesenen Buches über Spieltheorie, Prisoner’s Dilemma (deutsch: Gefangenendilemma. Das Buch von Poundstone ist nicht ins Deutsche übersetzt worden; Anm. d. Übers.), nannte es »eines der einflussreichsten und am wenigsten gelesenen Bücher des 20. Jahrhunderts«. In der Einführung zur Jubiläumsausgabe zum 60. Jahrestag wird darauf hingewiesen, dass das Buch sofort als Klassiker erkannt wurde. Anfängliche Kritiken in den prestigeträchtigsten akademischen Zeitschriften überhäuften es mit Lob, wie »eine der großen wissenschaftlichen Errungenschaften der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts« oder »zehn weitere solche Bücher, und der Fortschritt der Wirtschaft ist gesichert«.
Die Spieltheorie hat die Wirtschaftswissenschaften revolutioniert, was von mindestens elf Nobelpreisträgern der Wirtschaftswissenschaften bewiesen wurde, darunter auch John Nash (ein Schüler von Neumanns), dessen Lebensgeschichte in dem Oscar-gekrönten Film A Beautiful Mind erzählt wird. Die Spieltheorie findet auch außerhalb der Wirtschaftswissenschaften breite Anwendung und ist für die Verhaltensforschung (in Psychologie wie Soziologie) ebenso wie für die Politikwissenschaften, die Biomedizinforschung, im Geschäftsleben und in zahlreichen anderen Bereichen von Bedeutung.
Die Spieltheorie wurde von dem Wirtschaftswissenschaftler Roger Myerson (einer der Nobelpreisträger für die Spieltheorie) kurz und prägnant definiert als »die Untersuchung von mathematischen Konflikt- und Kooperationsmodellen zwischen intelligenten, rationalen Entscheidern«. Die Spieltheorie ist die heutige Basis für das Studium eines Großteils unseres Entscheidungsprozesses, wenn es um die Herausforderung sich verändernder Bedingungen, um versteckte Informationen oder um Glück geht, und wenn mehrere Menschen in eine Entscheidung involviert sind. Hört sich das für Sie bekannt an?
Zum Glück brauchen Sie nicht mehr als das über die Spieltheorie zu wissen, um zu verstehen, wie wichtig sie ist. Und was für dieses Buch zählt, ist, dass John von Neumann die Spieltheorie anhand einer auf das Wesentliche reduzierten Version des Pokerspiels veranschaulicht hat.
Poker versus Schach
In der Dokumentationsserie The Ascent of Man erzählt der Wissenschaftler Jacob Bronowski, wie von Neumann ihm die Spieltheorie während einer Taxifahrt in London umriss. Boronowski war ein leidenschaftlicher Schachspieler und bat ihn, es ihm noch näher zu erklären. »Sie meinen also Spieltheorie wie beim Schach?«
Boronowski zitierte von Neumanns Antwort: »›Nein, nein‹, sagte er. ›Schach ist ja kein Spiel. Schach ist eine genau definierte Form der Berechnung. Man kann die Antworten vielleicht nicht ausarbeiten, aber in der Theorie muss es in jeder Position eine Lösung geben, eine richtige Vorgehensweise. Also, echte Spiele‹, sagte er, ›sind überhaupt nicht so. Das echte Leben ist ja auch nicht so. Das echte Leben besteht aus Bluffs, kleinen Täuschungsmanövern, daraus, sich selbst zu fragen, was der andere denkt, was ich wohl tun will. Und darum geht es beim Spiel in meiner Theorie.‹«
Die Entscheidungen, die wir im Leben treffen – im Geschäftsleben, im Umgang mit Geld, Gesundheit und Lebensstil, in der Erziehung unserer Kinder und in Beziehungen – passen gut in von Neumanns Definition von »echten Spielen«. Dazu gehören Unsicherheit, Risiko und zeitweilige Enttäuschungen, was im Poker vorherrschende Elemente sind. Ärger gibt es immer dann, wenn wir Lebensentscheidungen angehen, als wären sie Schach-Entscheidungen.
Beim Schach gibt es keine verborgenen Informationen und nur sehr wenig Glück. Alle Figuren sind für beide Spieler zu sehen. Die Figuren können nicht willkürlich erscheinen, vom Brett verschwinden oder durch Zufall von einer Position zur anderen bewegt werden. Es kommt nicht vor, dass jemand würfelt und Ihr Läufer vom Brett genommen wird, wenn der Wurf für Sie schlecht ausfällt. Wenn Sie bei einem Schachspiel verlieren, ist der Grund zwangsläufig, dass es bessere Züge gegeben hätte, die Sie nicht gemacht oder nicht gesehen haben. Sie könnten theoretisch im Spiel zurückgehen und herausfinden, wo genau Sie Fehler gemacht haben. Wenn ein Schachspieler mehr als nur etwas besser ist als der andere, ist es fast unvermeidlich, dass der bessere Spieler gewinnt (wenn er Weiß hat) oder zumindest ein Remis spielt (wenn er Schwarz hat). In den seltenen Fällen, in denen ein niedriger eingestufter Schachmeister einen Garry Kasparow, Bobby Fischer oder Magnus Carlsen schlägt, liegt es daran, dass der höherrangige Spieler erkennbare, objektive Fehler gemacht hat, die dem anderen Spieler Vorteile verschafft haben.
Schach ist bei aller strategischen Komplexität kein gutes Modell für die Entscheidungsfindung im Leben, da bei den meisten unserer Entscheidungen verborgene Informationen im Spiel sind und Glück eine viel größere Rolle spielt. Das schafft eine Herausforderung, die beim Schach nicht existiert: Man muss den relativen Beitrag der Entscheidungen, die wir treffen, von dem Glück oder Pech unterscheiden, das bestimmt, wie die Dinge am Ende ausgehen.
Poker dagegen ist ein Spiel der unvollständigen Informationen. Es ist ein Spiel, bei dem Entscheidungen in einer bestimmten Zeit unter unbekannten Voraussetzungen getroffen werden müssen. (Nicht zufällig ist das nahe an der Definition der Spieltheorie.) Wertvolle Informationen bleiben verborgen. Es gibt auch in jedem Ergebnis einen Glücksanteil. Sie könnten an jedem Punkt die bestmögliche Entscheidung treffen und doch die Hand verlieren, weil Sie nicht wissen, welche neuen Karten ausgeteilt und aufgedeckt werden. Wenn das Spiel einmal vorbei ist und Sie versuchen, aus den Ergebnissen etwas zu lernen, ist es schwierig, die Qualität Ihrer Entscheidungen vom Einfluss des Glücks zu unterscheiden.
Im Schach korrelieren die Ergebnisse stärker mit der Qualität der Entscheidungen. Im Poker ist es viel leichter, Glück zu haben und zu gewinnen oder Pech zu haben und zu verlieren. Wenn das Leben wie Schach wäre, würde man fast jedes Mal, wenn man über eine rote Ampel fährt, einen Unfall bauen (oder zumindest eine Strafe aufgebrummt bekommen). Wenn das Leben wie Schach wäre, würden die Seahawks jedes Mal den Super Bowl gewinnen, wenn Pete Carroll dieses Passspiel ausruft.
Aber das Leben ist eher wie Poker. Es könnte die klügste, vorsichtigste Entscheidung sein, den Präsidenten zu feuern, und dennoch fliegt einem danach alles um die Ohren. Man könnte eine rote Ampel überfahren und sicher über die Kreuzung gelangen – oder sämtliche Verkehrsregeln und -zeichen beachten und dann doch in einen Unfall verwickelt werden. Sie könnten jemandem die Pokerregeln in fünf Minuten erklären, ihn an einen Tisch mit einem Weltklasse-Spieler setzen, eine Hand austeilen (oder mehrere) und der Novize könnte den Champion schlagen. Das könnte im Schach nie passieren.
Unvollständige Informationen sind nicht nur für Entscheidungen ein Problem, die in Sekundenbruchteilen getroffen werden, sondern auch für das Lernen aus vergangenen Entscheidungen. Stellen Sie sich meine Schwierigkeiten als Pokerspielerin vor, wenn ich versuche, herauszufinden, ob ich eine Hand korrekt gespielt habe, wenn die Karten meiner Gegner nie aufgedeckt werden. Wenn die Hand endet, nachdem ich gesetzt habe, und meine Gegner passen, ist alles, was ich weiß, dass ich die Chips gewonnen habe. Habe ich schlecht gespielt und nur Glück gehabt? Oder habe ich gut gespielt?
Wenn wir uns in einem Spiel verbessern wollen – ebenso wie in jedem Bereich unseres Lebens –, müssen wir aus den Ergebnissen unserer Entscheidungen lernen. Die Qualität unseres Lebens ist die Summe der Entscheidungsqualität plus Glück. Im Schach ist der Einfluss des Glücks eingeschränkt, also ist es leichter, die Ergebnisse als Zeichen für gute Qualität zu lesen. Das verbindet Schachspieler mehr mit der Rationalität. Machen Sie einen Fehler, weist Sie das Spiel Ihres Gegners darauf hin oder Sie können es danach analysieren. Es gibt dort immer eine theoretisch richtige Antwort. Wenn Sie verlieren, gibt es nur einen geringen Spielraum für irgendeine andere Erklärung als Ihre eigene unterlegene Entscheidungsqualität. Einen Schachspieler wird man fast nie sagen hören: »Ich bin in diesem Spiel ausgenommen worden!« oder »Ich habe perfekt gespielt, aber ich hatte ein paar fürchterliche Breaks.« (Gehen Sie einmal bei einem Poker-Turnier ins Foyer und Sie werden das oft hören.)
Das ist Schach, aber das Leben sieht nicht so aus. Es sieht eher wie Poker aus, wo wir durch die vielen Unbekannten den Raum haben, uns zu täuschen und die Daten falsch zu interpretieren. Poker gibt uns den Spielraum, Fehler zu machen, die wir nie bemerken werden, weil wir die Hand sowieso gewinnen und also gar nicht nach ihnen suchen, oder den Spielraum, alles richtig zu machen, dennoch zu verlieren und das Ergebnis als Beweis zu nehmen, dass wir einen Fehler gemacht haben. Resulting – also aufgrund einer geringen Anzahl von Ergebnissen darauf zu schließen, ob unsere Entscheidung gut oder schlecht war, ist eine ziemlich vernünftige Lernstrategie im Schach. Aber nicht im Poker – und auch nicht im Leben.
Von Neumann und Morgenstern haben verstanden, dass die Welt die objektive Wahrheit nicht einfach offenbart. Deshalb haben sie die Spieltheorie auf dem Pokerspiel aufgebaut. Bessere Entscheidungen zu treffen, fängt damit an, Folgendes zu verstehen: Nichtwissen kann eine Menge Unheil anrichten.
Ein tödlicher Wettkampf des Geistes
In einer der bekanntesten Szenen in dem Film Die Braut des Prinzen holt der grausame Pirat Roberts (der liebestrunkene Westley) den Räuber Vizzini ein, das Genie, das die Prinzessin Buttercup gekidnappt hat. Nachdem er Fezzik, den Riesen in einem Wettkampf der Kraft geschlagen und den Schwertkämpfer Indigo Montoya im Duell besiegt hat, schlägt der grausame Pirat Roberts vor, dass Vizzini und er einen Wettkampf des Geistes ausfechten, was eine großartige Demonstration dafür ist, wie gefährlich es sein kann, anhand von unvollständigen Informationen Entscheidungen zu treffen. Der Pirat holt ein Päckchen tödliches Jokane-Pulver heraus und schüttet den Inhalt in einen von zwei Kelchen mit Wein, wobei er die beiden Kelche vor dessen Blick verbirgt. Dann stellt er einen Kelch vor sich selbst und den anderen vor Vizzini. Wenn Vizzini sich einen Kelch aussucht, würden beide trinken »und dabei herausfinden, wer recht hat und wer tot ist«.
»Aber das ist doch so einfach«, höhnt Vizzini. »Ich muss nur die Antwort von dem ableiten, was ich über Euch weiß. Gehört Ihr zu dem Typ Mann, der das Gift in seinen eigenen Kelch schüttet oder in den seines Feindes?« Er liefert dann eine verwirrende Reihe von Gründen, aus denen das Gift in dem einen Kelch nicht sein kann – oder sein muss – und dann in dem anderen. Sein Wortschwall handelt von Klugheit, Vorwegnahme, dem Ursprung des Jokane-Pulvers (das kriminelle Land Australien), Mangel an Vertrauenswürdigkeit, der Vorwegnahme dieses Mangels an Vertrauenswürdigkeit und Annahmen über die Duellierfähigkeiten Westleys, der den Riesen und den Schwertkämpfer besiegt hat.
Während Vizzini all dies erklärt, lenkt er plötzlich Westleys Aufmerksamkeit ab, vertauscht die Kelche und erklärt, dass nun jeder von dem Kelch vor sich trinken solle. Vizzini hält kurz inne und als er Westley von seinem eigenen Kelch trinken sieht, trinkt er zuversichtlich aus dem anderen.
Vizzini brüllt vor Lachen. »Ihr seid reingefallen und habt einen klassischen Fehler begangen. Der berühmteste ist, ›Lass dich niemals auf einen Landkrieg in Asien ein‹. Aber beinah genauso bekannt ist dieser Fehler: ›Lass dich nie auf einen Kampf mit einem Sizilianer ein, wenn es um Leben und Tod geht.‹«
Mitten im Lachen fällt Vizzini um und ist tot. Buttercup sagt: »Wenn ich daran denke, dass eigentlich Euer Becher vergiftet war …«
Westley erklärt ihr: »Sie waren beide vergiftet. Ich habe mir in den letzten zwei Jahren eine Immunität gegen Jokane-Pulver aufgebaut.«
Genau wie wir alle kannte Vizzini nicht alle Fakten. Er betrachtete sich selbst als Genie ohnegleichen: »Lasst es mich so sagen: Habt Ihr jemals von Plato, Aristoteles und Sokrates gehört? Das waren Idioten.« Aber genau wie wir anderen unterschätzte er den Umfang und die Wirkung dessen, was er nicht wusste.
Nehmen wir an, jemand sagt: »Ich habe eine Münze geworfen und sie ist viermal hintereinander auf Kopf gelandet. Wie wahrscheinlich ist das?«
Das hört sich erst einmal so an, als wäre die Antwort ziemlich einfach. Wenn wir die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass bei vier aufeinanderfolgenden Würfen mit einer 50-50-Chance jedes Mal Kopf kommt, können wir bestimmen, dass das in 6,25 Prozent der Fälle eintritt (.50 × .50 × .50 × .50).
Das bedeutet aber, dass wir denselben Fehler machen wie Vizzini. Das Problem ist, dass wir zu dieser Antwort kamen, ohne irgendetwas über die Münze oder die Person zu wissen, die sie wirft. Hat die Münze zwei Seiten oder drei oder vier? Wenn sie zwei Seiten hat, ist es eine Münze mit zwei Köpfen? Selbst wenn die Münze zwei verschiedene Seiten hat (Kopf und Zahl), ist das Gewicht der Münze so verlagert, dass sie öfter auf Kopf landet als auf Zahl? Ist der Werfer ein Zauberkünstler, der beeinflussen kann, wie die Münze landet? Diese Informationen sind alle nicht vollständig und doch haben wir die Frage beantwortet, als hätten wir die Münze untersucht und wüssten alles darüber. Wir haben nie in Betracht gezogen, dass beide Kelche vergiftet sein könnten. (»Nicht vorstellbar« hätte Vizzini es genannt, wäre er in der Lage gewesen, seinen eigenen Tod zu kommentieren.)
Wenn nun diese Person die Münze 10 000-mal werfen und uns damit eine ausreichend große Vergleichsmenge liefern würde, könnten wir mit einiger Sicherheit herausfinden, ob die Münze in Ordnung ist. Vier Würfe sind einfach nicht genug, um viel über die Münze sagen zu können.
Wir machen denselben Fehler, wenn wir anhand der Ergebnisse in unserem Leben nach Lektionen suchen. Unser Leben ist zu kurz, um genügend Daten aus unseren Erfahrungen zu sammeln, aufgrund derer wir über die Qualität unserer Entscheidungen urteilen könnten. Wenn wir ein Haus bauen, es ein bisschen herrichten und drei Jahre später für 50 Prozent mehr verkaufen, als wir bezahlt haben, heißt das dann, dass wir ein Händchen dafür haben, Immobilien zu kaufen und zu verkaufen, oder dafür, Häuser herzurichten? Beides wäre möglich, aber es könnte auch heißen, dass es auf dem Markt einen riesigen Aufschwung gab und der Kauf von fast jedem Haus ebenso viel Geld eingebracht hätte. Oder vielleicht hätte es zum selben (oder sogar zu einem noch größeren) Gewinn geführt, dieses Haus zu kaufen, aber gar nicht herzurichten. Eine Menge zunächst erfolgreicher Hausverkäufer mussten sich dieser Möglichkeit zwischen 2007 und 2009 stellen.
Wenn Ihnen also jemand die Frage mit der Münze stellt, die viermal geworfen wurde, gibt es eine korrekte Antwort: »Ich bin mir nicht sicher.«
»Ich bin mir nicht sicher«: Wie man Nichtwissen zum eigenen Vorteil nutzt
Ähnlich wie wir Probleme mit dem Resulting und dem Rückschaufehler haben, wenn wir Entscheidungen einzig nach ihrem Ergebnis bewerten, haben wir das Problem der gespiegelten Abbildung, wenn wir zukünftige Entscheidungen treffen. Wir haben bei jeder Entscheidung nur einen Versuch – einen Münzwurf – und das übt großen Druck auf uns aus, uns sicher zu sein, bevor wir handeln, eine Sicherheit, die zwangsläufig verborgene Informationen und Glück nicht berücksichtigen wird.
Der berühmte Romancier und Drehbuchautor William Goldman (der die Drehbücher zu Die Braut des Prinzen, Misery und Zwei Banditen schrieb), erinnerte sich an seine Erfahrungen mit Schauspielern wie Robert Redford, Steve McQueen, Dustin Hoffman und Paul Newman auf dem Höhepunkt ihrer erfolgreichen Karrieren. Was bedeutete es, ein Filmstar zu sein? Er zitierte einen Schauspieler, der ihm die Art Charakter beschrieb, den er spielen wollte: »Ich will nicht der Mann sein, der lernt. Ich will der Mann sein, der weiß.«
Wir sagen nicht gerne »Ich weiß es nicht« oder »Ich bin mir nicht sicher«. Wir betrachten diese Äußerungen als vage, nicht hilfreich oder sogar ausweichend. Aber auf dem Weg zu einem besseren Entscheider ist es ganz wesentlich, sich mit dem Satz »Ich bin mir nicht sicher« anzufreunden. Wir müssen Frieden schließen mit dem Nicht-Wissen.
Es ist schwer, den Satz »Ich bin mir nicht sicher« anzunehmen. In der Schule bringt man uns bei, dass es schlecht ist, »Ich weiß es nicht« zu sagen. In der Schule etwas nicht zu wissen, gilt als Lernversagen. Wenn man in einer Prüfung »Ich weiß es nicht« als Antwort schreibt, wird die Antwort als Fehler angestrichen.
Zuzugeben, dass wir etwas nicht wissen, hat ein unverdient schlechtes Image. Natürlich wollen wir die Wissensaneignung fördern, aber der erste Schritt ist, zu verstehen, was wir nicht wissen. In seinem Buch Ignorance: How it Drives Science setzt sich der Neurowissenschaftler Stuart Firestein dafür ein, die Grenzen unseres eigenen Wissens anzuerkennen. (Einen Einblick in das Buch bekommen Sie, wenn Sie seinen TED-Talk The Pursuit of Ignorance ansehen.) Im Buch und im Talk weist Firestein darauf hin, dass in der Wissenschaft der Satz »Ich weiß es nicht« kein Scheitern bedeutet, sondern ein notwendiger Schritt in Richtung Erkenntnis ist. Er unterstützt dies mit einem großartigen Zitat des Physikers James Clerk Maxwell: »Das gründliche Bewusstsein des Nichtwissens ist der Auftakt zu jedem echten Fortschritt in der Wissenschaft.« Ich würde hinzufügen, dass dies auch die Voraussetzung für jede großartige Entscheidung ist, die je gefällt wurde.
Was eine Entscheidung großartig macht, ist nicht, dass sie zu einem großartigen Ergebnis führt. Eine großartige Entscheidung ist das Ergebnis eines guten Prozesses und zu diesem Prozess muss der Versuch gehören, unseren eigenen Wissensstand genau darzustellen. Dieser Wissensstand wiederum ist irgendeine Variante von »Ich bin mir nicht sicher«.
»Ich bin mir nicht sicher« bedeutet nicht, dass es keine objektive Wahrheit gibt. Firesteins Argument ist vielmehr, dass das Anerkennen des Nichtwissens der erste Schritt in Richtung unseres Ziels ist, nämlich näher an die objektive Wahrheit heranzukommen. Dazu müssen wir aufhören, die Sätze »Ich weiß es nicht« und »Ich bin mir nicht sicher« als etwas Obszönes zu betrachten.