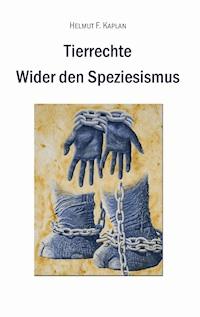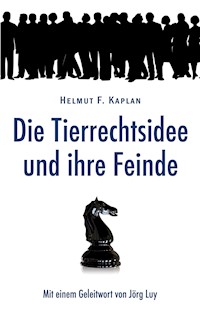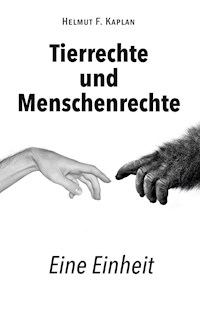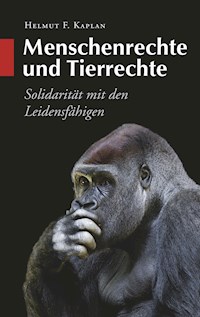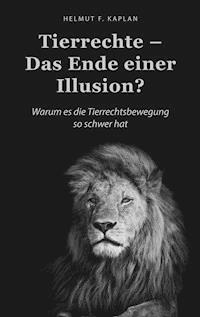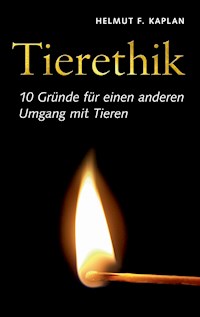
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
„Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“ Zu dieser Erkenntnis gelangte Albert Schweitzer in der Folge eines Offenbarungserlebnisses, das er 1915 am Ogowefluß in Gabun hatte. An diese Worte mußte ich an einem viel weniger exotischen Ort denken – im Salzburger „Bräustübl“: Eine Biene war in meinen Bierkrug gefallen und fast ertrunken. Ich rettete sie mit einem Blatt, setzte sie auf die sonnenbeschienene Gartenmauer und beobachtete, wie sie sich langsam erholte. Die einfache Erkenntnis „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will“ gilt im Urwald wie im Biergarten. Einfache Regeln reichen meist, um uns zu sagen, was wir sollen. Je komplexer ethische Theorien hingegen sind, desto ergiebiger ist auch die „Hintertürensuche“ - nach Ausreden dafür, alles beim Alten belassen zu können. Anstatt wie in der Ethik üblich immer weiter zu „theoretisieren“, wird daher hier der umgekehrte Weg beschritten: Aus der vorhandenen Tierethik werden zehn einfache Gründe für einen anderen Umgang mit Tieren herausdestilliert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort zur zweiten Auflage
Vorwort zur ersten Auflage
Einleitung
Praxis
1. Wünsche schaffen Pflichten
2. Niemandem schaden
3. Autonomie schafft Rechte
4. Pflicht zu helfen
5. Möglichst viel Gutes tun
6. Tatsachen ernst nehmen
7. Utilitarismus für Tiere – Kantianismus für Menschen
8. Trumpfkarte für Besserbehandlung von Menschen hat keine Grundlage
9. Gleichheitsprinzip
10. Goldene Regel
Theorie
1. Wünsche schaffen Pflichten
3. Autonomie schafft Rechte
6. Tatsachen ernst nehmen
7. Utilitarismus für Tiere – Kantianismus für Menschen
9. Gleichheitsprinzip
10. Goldene Regel
Literatur
Anhang: Menschen abholen, wo sie sind
Über den Autor
Vorwort zur zweiten Auflage
Der Vegetarismus sei nun endlich mitten in der Gesellschaft angekommen – so war es in den letzten Jahren vielerorts zu lesen. Später Ähnliches über Veganismus, Tierrechte und Tierethik. Wer sich die Vegetarismus-Debatte allerdings näher ansieht, wird die Diagnose, daß sich im Hinblick auf Tiere nun alles rasant zum Besseren entwickle, mit Skepsis betrachten: Das Ergebnis der Vegetarismus-Debatte war nämlich nicht kein Fleisch, sondern weniger Fleisch (Stichworte: „bio“, „öko“, „Sonntagsbraten“). Und auch das nur theoretisch, denn erstens wird nach wie vor gleich viel Fleisch gegessen und zweitens ist dieses Fleisch nach wie vor alles andere als „bio“. Aufmerksame Beobachter ahnen, wie eine allfällige größere Tierethik-Debatte ausgehen könnte: mit dem Breittreten diverser (vermeintlicher) „Hintertüren“, die „beweisen“, daß es mit dem bisherigen Umgang mit Tieren grundsätzlich „schon seine Richtigkeit habe“.
An dieser Stelle sei auf ein ebenso erstaunliches wie vielsagendes Phänomen verwiesen: Wenn wir unseren Umgang mit (bestimmten) Menschen „ethisch unter die Lupe nehmen“, steht außer Frage, daß es darum geht, diese künftig besser oder gerechter zu behandeln. Wenn wir aber unseren Umgang mit Tieren „ethisch unter die Lupe nehmen“, ist häufig mit Händen zu greifen, daß es vor allem darum geht, diese (grundsätzlich) gleich wie bisher behandeln zu können.
Womit wir wieder bei den „Hintertüren“ wären. Je komplexer ethische Theorien sind, desto ergiebiger ist auch die „Hintertürensuche“. (Weshalb es für die Fleischindustrie eine lohnende Investition wäre, Ethikkongresse zu sponsern!) Im folgenden soll daher der umgekehrte Weg beschritten werden: Nicht (wie in der akademischen Ethik üblich und auch notwendig!) immer mehr Aspekten und Verästelungen nachzugehen, also immer weiter zu „theoretisieren“. Sondern aus der vorhandenen Tierethik einfache, leicht nachvollziehbare Gründe für einen anderen Umgang mit Tieren herauszudestillieren. Wer in dieser „Fixierung aufs Einfache“ eine Voreingenommenheit zugunsten der Tiere vermutet, sei daran erinnert, daß unsere moralischen Regeln für den Umgang mit Menschen immer von solch einfacher Natur sind.
Salzburg, im Mai 2014
Helmut F. Kaplan
Vorwort zur ersten Auflage
Fast alle bisherigen Bücher zur Tierethik sind entweder tendenziell esoterisch / spirituell / religiös oder aber andererseits ausgesprochen akademisch-wissenschaftlich. Beides verhindert den notwendigen und wünschenswerten gesellschaftspolitischen Brückenschlag zu brisanten Themen wie Tierversuche, artgerechte Tierhaltung, Welthunger, Umweltzerstörung oder Klimawandel. Während bei Tierversuchen und Tierhaltung wenigstens der prinzipielle Bezug zur Tierethik offenkundig ist, ist dies bei den Themen Welthunger, Umweltzerstörung und Klimawandel keineswegs der Fall. Dennoch ist der Bezug zur Tierethik auch hier gegeben: Fleischkonsum, also Tiertötung, zählt zu den wichtigsten Ursachen für Welthunger, Umweltzerstörung und Klimawandel!
Dieses Buch macht auch einige der wichtigsten Begriffe und Konzepte, die seit vielen Jahren von der Tierrechtsphilosophie in den allgemeinen universitären Bereich einsickern (v. a. in Philosophie, Ethik, Biologie, Bioethik und Rechtsphilosophie) und dort intensiv diskutiert werden, für eine breite interessierte Öffentlichkeit verständlich. Zwei Beispiele: der Personbegriff, der in der Tierversuchs-, Euthanasie- und Abtreibungsdebatte eine wichtige Rolle spielt, und die prinzipielle moralische Gleichsetzung von Rassismus, Sexismus und Speziesismus, die die Tierrechtsbewegung in einen historischen und weltanschaulichen Bezug setzt zu Sklavenbefreiung, Bürgerrechtsbewegung und Frauenemanzipation.
Professor Heinrich Ganthaler danke ich für sehr fruchtbare Gespräche über ethische Grund- und Spezialfragen. Carolin Gschwilm für ihre unermüdliche fachliche und persönliche Hilfe und Unterstützung.
Salzburg, im August 2009
Helmut F. Kaplan
Einleitung
„Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“ Zu dieser Erkenntnis gelangte Albert Schweitzer in der Folge eines Offenbarungserlebnisses, das er 1915 am Ogowefluß in Gabun hatte. (Gräßer, 2006, S. 19 ff., Schweitzer, o. J., S. 168 ff.) An diese Worte mußte ich kürzlich an einem viel weniger exotischen Ort denken – im Salzburger „Bräustübl“: Eine Biene war in meinen Bierkrug gefallen und fast ertrunken. Ich rettete sie mit einem Blatt, setzte sie auf die sonnenbeschienene Gartenmauer und beobachtete, wie sie sich langsam erholte, sich zu putzen begann und allmählich wieder zu Kräften kam.
Die einfache Erkenntnis „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will“ gilt im Urwald wie im Biergarten. Und wenn wir uns in keiner Konfliktsituation befinden (was die Regel ist), ist dies sogar ein hinreichender Leitsatz für moralisches Handeln. Einfache Regeln reichen meistens aus, um uns zu sagen, was wir tun sollen.
„Tiere sind meine Freunde … und meine Freunde esse ich nicht“ (George Bernard Shaw, zit. n. Parham, 1981, S. 55) ist eine andere einfache und einleuchtende Aussage bzw. Regel. Darum soll es in diesem Buch gehen: um praktikable Grundsätze für moralisches Handeln. „Ethik ist praktisch, oder sie ist nicht wirklich ethisch“, schreibt Peter Singer (1996b, S. 194).
In den vergangenen drei Jahrzehnten entstand eine umfangreiche Literatur zur Tierethik, also zum moralisch angemessenen Umgang mit Tieren. Unsere moralische Verantwortung gegenüber Tieren ist mittlerweile philosophisch besser begründet als unsere moralische Verantwortung gegenüber Menschen. Das hat einen einfachen Grund: Daß wir moralische Pflichten gegenüber Menschen haben, wird im Grunde von niemandem bestritten und muß daher auch nicht lange begründet werden. Daß wir aber auch moralische Pflichten gegenüber Tieren haben, mußte gegen immense weltanschauliche und psychologische Widerstände erarbeitet und bewiesen werden. Entsprechend umfassend und vielschichtig fielen die Begründungen aus.
Und das hat auch einen erheblichen Nachteil: Komplexe Theorien beeinflussen die tägliche Praxis nur sehr begrenzt. Dieses Theorie-Praxis-Gefälle soll im folgenden wenigstens für einen Teil der Tierethik beseitigt werden: Im Praxis-Teil werden einfache, einleuchtende moralische Konzepte ohne „Theorieballast“ dargestellt. In den entsprechenden Theorie-Abschnitten werden dann ergänzende Fakten, Argumente und Quellen quasi nachgereicht (wobei es nicht zu allen Praxis-Abschnitten auch einen Theorie-Abschnitt gibt). Der Praxis-Teil bildet aber ein in sich abgeschlossenes Ganzes und kann auch ohne den Theorie-Teil gelesen werden.
Praxis
1. Wünsche schaffen Pflichten
Was macht etwas zu einem moralisch bedeutsamen Etwas, zu etwas, das wir unter moralischen Gesichtspunkten betrachten und behandeln sollten? Das ist eine furchteinflößend fundamentale Frage, vor allem eine Frage mit so weitreichenden Folgen, daß man sich scheut, sie zu beantworten. Besser gesagt: scheuen sollte, sie zu beantworten. Denn das Problem ist gerade, daß diese Frage allzuhäufig allzuschnell und allzuleichtfertig beantwortet wird.
Immerhin: Eine erste sinnvolle und ziemlich sichere Klärung in bezug auf diese Frage erscheint durchaus möglich – indem wir uns quasi von den Rändern her an diese Frage annähern: Steine, Elektrogeräte, Autos und dergleichen verdienen keine moralische Berücksichtigung, gesunde erwachsene Menschen verdienen die größtmögliche moralische Berücksichtigung.
Das ist freilich nur eine erste Annäherung. Offen bleibt beispielsweise, wie es sich mit besonders kranken oder besonders alten oder besonders jungen Menschen verhält – die wir, etwa im medizinischen Bereich und hier insbesondere im Konfliktfall, oft anders behandeln als gesunde Erwachsene. Und offen bleibt ebenfalls, wie es sich mit Tieren verhält – die objektiv, je nach Art, recht unterschiedliche Eigenschaften haben und bei denen wir auch bei gleichen objektiven Eigenschaften die moralisch merkwürdige Unterscheidung zwischen Haus- und Nutztieren treffen.
Als nächste Orientierung kann uns, denke ich, folgende Feststellung von Norm Phelps (2007, S. XVIII) dienen:
Die große Trennlinie verläuft nicht zwischen menschlich und nicht-menschlich, sondern zwischen empfindungsfähig und nicht-empfindungsfähig. Warum? Weil es, wie Peter Singer (1994, S. 351) erfrischend plausibel argumentiert, sehr wohl sinnvoll ist zu fragen, was eine Beutelratte fühlt, wenn sie ertrinkt, aber keinen vergleichbaren Sinn ergibt zu fragen, was ein Baum fühlt, wenn er abstirbt. Empfindungsfähige Wesen haben Bedürfnisse und Wünsche; zumindest und zuerst den Wunsch, unangenehme Erlebnisse zu vermeiden und angenehme Erlebnisse zu haben. Wo finden wir, fragt Singer, Wert außer in den Interessen empfindungsfähiger Wesen als Wertquelle? Was ist gut oder schlecht für nicht empfindungsfähige Wesen?
In der Tat: Wesen, die eine „Innenseite“ haben (Rowlands, 2002, S. 24), d. h. ihr Leben als gut oder schlecht erfahren – und sich natürlich wünschen, ein möglichst gutes Leben zu führen –, unterscheiden sich von allen anderen Dingen im Universum auf moralisch höchst bedeutsame Weise. Zu dieser Kategorie zu gehören, ist ungleich wichtiger als alle Abstufungen innerhalb dieser Kategorie.
Wesen mit Wünschen sind aber nicht nur die Quelle moralischer Werte, sondern auch die Quelle moralischer Pflichten. William James (zit. n. Frankena, 1972, S. 65) formuliert es so: „Nimm irgendein noch so geringfügiges Verlangen irgendeines noch so schwachen Geschöpfes. Sollte es nicht allein um seiner selbst willen befriedigt werden?“ Quasi die Kehrseite dieser moralischen Medaille formuliert James Rachels (2006, S. 170 f.), wenn er fordert, keinem Wesen Schaden zuzufügen. Wenn eine Handlung einem Wesen schaden würde, so sei das ein Grund, sie zu unterlassen.
Wenn es überhaupt moralische Pflichten gibt, dann haben sie in wünschenden Wesen ihre Grundlage, in Wesen also, für die es solche Umstände gibt, die sie erleben wollen, und solche, die sie vermeiden wollen. Wesen mit Wünschen sind die Grundlage der Moral. Und je mehr die Wünsche von Wesen den Wünschen von Menschen ähneln, desto mehr ähneln die Pflichten gegenüber diesen Wesen den Pflichten gegenüber Menschen.
Vor allem aufgrund der evolutionären Kontinuität kann man davon ausgehen, daß tendenziell alle Säugetiere selbstbewußte Lebewesen sind, d. h. solche, denen bewußt ist, daß sie im Laufe der Zeit und an verschiedenen Orten dieselben Individuen sind. Solche Lebewesen erinnern sich an Vergangenes und haben Wünsche in bezug auf die Zukunft. Wenn wir ein solches Wesen töten, durchkreuzen wir seine Wünsche in bezug auf seine Zukunft.
Aber auch nicht selbstbewußte Tiere sind leidensfähig und haben ein immenses Interesse, nicht zu leiden. Unser üblicher Umgang mit Tieren erzeugt aber in aller Regel sehr großes Leiden – sowohl beim Töten als auch während des gesamten Lebens der Tiere.
Mittlerweile ist klar, daß auch Tiere, denen man lange Zeit die Leidensfähigkeit abgesprochen hatte, sehr wohl schmerzempfindlich sind. Das gilt etwa für Fische. Einiges spricht dafür, daß selbst Tiere wie Würmer und Insekten, die wir bei jeder Gelegenheit gedankenlos verletzen und töten, schmerzfähig sind. Wer moralisch verantwortlich handeln will, muß wohl Leidensfähigkeit annehmen, wo Leidensfähigkeit nicht ausgeschlossen werden kann.
2. Niemandem schaden
In den 1970er Jahren wurde von Philosophen das Konzept des moralischen Status („moral standing“) eingeführt, um verschiedene (neue) Fragestellungen bzw. Themen, wie etwa Umgang mit Tieren und Umwelt, Euthanasie und Abtreibung methodisch in den Griff zu bekommen. (Rachels, 2006, S. 164; vgl. auch Röcklinsberg, 2001, Tiuschka, 1998) Bei Theorien über den moralischen Status (MS) geht es um die Beantwortung der Frage, wem gegenüber wir direkte moralische Pflichten haben.
Vorbild für das MS-Konzept war der rechtliche Bereich, wo „legal standing“ bedeutet, das Recht zu haben, seine Forderungen bei Gericht geltend zu machen. Analog dazu bedeutet MS zu haben, auf moralischer Ebene legitime Ansprüche haben zu können. Mit anderen Worten, MS zu haben, bedeutet, daß seine Interessen gute moralische Gründe darstellen, auf eine bestimmte Weise behandelt zu werden. Folgende MS-Konzepte wurden herausgearbeitet (Rachels, 2006, S. 164–166):
Das bloße Mensch-Sein beinhaltet bereits MS. Dieses Konzept hat den Vorteil, niemanden – jedenfalls keinen Menschen – zu diskriminieren und entspricht dem Geist der (amerikanischen) Bürgerrechtsbewegung. Diese hatte ja verkündet, daß die Angehörigen aller Rassen gleiche Rechte hätten – schlicht, weil sie Menschen seien.
Ein etwas ausgereifteres Konzept kombiniert MS mit Merkmalen wie Selbstbewußtsein, Autonomie und Rationalität. Aufgrund solcher Merkmale komme Menschen voller MS zu. Dieser Ansatz hat eine lange Tradition. So verschafft nach Aristoteles die Rationalität dem Menschen einen Sonderplatz unter allen Wesen. Und nach Kant können nur selbstbewußte Wesen direkte Nutznießer von Verpflichtungen sein.
Einem anderen Ansatz zufolge fallen MS und Moralfähigkeit zusammen: MS besitzt, wer fähig zu moralischem Urteilen und Handeln ist. Dieses Konzept ist für Anhänger der Vertragstheorie besonders attraktiv, für die moralische Verpflichtungen aus Vereinbarungen zwischen Personen resultieren, von denen angenommen werden kann, daß sie ihre Zusagen auch einhalten.
MS-Konzepte, die mit Merkmalen wie Selbstbewußtsein, Autonomie und Moralfähigkeit operieren, sehen sich freilich mit einem prinzipiellen Problem konfrontiert: Sie errichten eine Hürde, die so hoch ist, daß sie problemlos nur von normalen erwachsenen Menschen überwunden werden kann. Andererseits empfinden auch Tiere Schmerzen und es scheint falsch zu sein, sie zu foltern. Deshalb plädieren viele Philosophen für ein bescheideneres MS-Kriterium: MS komme Wesen zu, die leidensfähig sind.
Gemeinsam ist diesen MS-Konzepten nun folgendes (ebenda, S. 166 f.): Die Beantwortung der Frage, wie ein Individuum behandelt werden soll, wird davon abhängig gemacht, ob es sich für einen generellen Status, eben den MS, qualifiziert, der seinerseits vom Besitz bestimmter Merkmale abhängig gemacht wird. Es läuft also immer darauf hinaus, daß eine Beziehung hergestellt wird zwischen der angemessenen Behandlung eines Individuums und bestimmten Fakten in bezug auf dieses Individuum (z. B. ob es selbstbewußt, rational oder leidensfähig ist).
Und genau hier liegt das Problem. Um es zu erkennen, wollen wir zuerst Fälle aus jenem Bereich betrachten, wo unsere Intuitionen am sichersten sind: bei normalen erwachsenen Menschen: