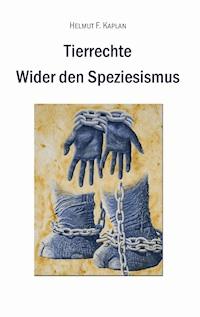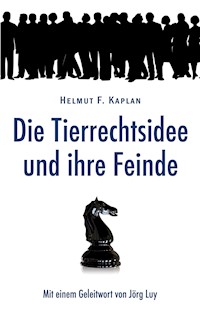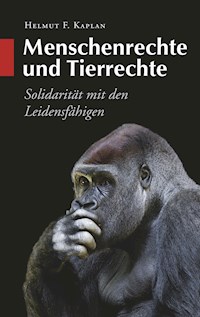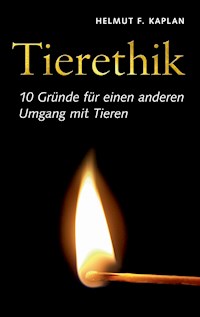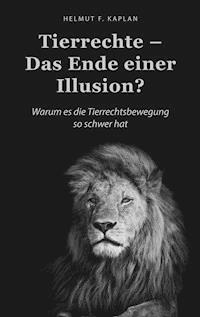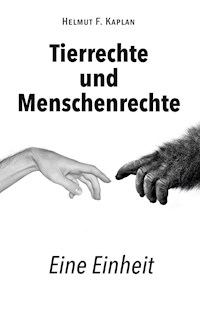
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Tierrechte wurden auch am Beginn der Tierrechtsbewegung in den 1970er und 1980er Jahren von der Mehrheit der Menschen abgelehnt. Wer aber etwas ablehnt, hat wenigstens eine Ahnung davon, was er ablehnt. Der grundsätzliche Unterschied zwischen der traditionellen Tierschutz-Haltung und der neuen Tierrechts-Forderung war bekannt: humane Nutzung der Tiere für menschliche Zwecke versus eigenständige, individuelle Tierrechte analog Menschenrechten. Dieses Grundwissen ist aber längst verlorengegangen. Wenn es heute um das Wohl von Tieren geht, ist vom Tierwohl die Rede - und vor allem vom alles dominierenden Bio. In der Fleisch-, Milch- und Eierwerbung sind idyllische Bio-Bilder mit sanften Hügeln und saftigen Wiesen buchstäblich flächendeckend. Der Begriff Tierrechte wird entweder gar nicht mehr verstanden oder für eine exotische Absurdität gehalten oder mit einschlägigen Gesetzen verwechselt. Ziel dieses Buches ist die (Wieder-)Sensibilisierung für die Tierrechtsidee: Tiere haben, wie Menschen, vielfältige Interessen und, wie Menschen, einen Anspruch, ein Recht, ein Leben entsprechend diesen Interessen zu führen, Tiere haben, wie Menschen, eigenständige, individuelle Rechte. Wir brauchen für den Umgang mit Tieren keine neue Moral. Wir müssen lediglich aufhören, Tiere willkürlich aus der vorhandenen Moral auszuschließen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Für Uli
Inhalt
Einleitung
1. Begründung und Darstellung der Tierrechtsphilosophie
Tierrechte
Wir brauchen keine neue Moral
Tiere haben Rechte
Tierrecht und Tierschutz
Die Schuld der Kirche am Elend der Tiere
Müssen Behinderte vor Tierrechtlern Angst haben?
Befreiung der Tiere
2. Veranschaulichung der Tierrechtsidee
Tierrechte und Fische
Terror in New York – und überall
Schädlinge
„Die Menschen kommen zuerst!“
Die Tierschutz-Lüge
„Sie lieben die Tiere ja mehr als die Menschen!“
Empathie und Ethik
Was wir von Reinhold Messner lernen können
Nobelpreisträger für Tierrechte
Unangepasst, mutig und frech – und tierfeindlich!
Roh oder reif?
Sind Veganer friedlicher?
Tierbefreiungen: Eine historische Perspektive
Wie können Tierrechte verwirklicht werden?
Wie radikal muß die Tierrechtsbewegung sein?
Über Ärzte, Arbeitsplätze und Tierrechte
Zwischen Steinzeit und Zukunft
„Wir sind doch alle Menschen!“
Terror gegen Tiere
Leitkultur Steinzeit?
Einmal Steinzeit, immer Steinzeit?
Wilde im Wohnzimmer
Sind Fleischesser Mörder?
Der Lack ist ab
Vegan
Sind Tierversuche ethisch zu rechtfertigen?
Tierversuche – Absolute Unmoral
Jagdterror
Tierrechte, Klima und Gerechtigkeit
Tierrechte und die „Gewaltfrage“
„Solange es so viele leidende Menschen gibt …“
„Mir sind die Tiere lieber als die Menschen!“
Apartheid perfektioniert und globalisiert
Tierrechte – Nur nicht fanatisch!
Tierrechte: Winzige Wiedergutmachung
Ethische Weltformel als moralischer Kompaß
Tierrechte und Ethische Weltformel
Heiligkeit des Lebens
Verehrt und verteufelt
Tierrechte, Evolution und Christentum
Tiere, Ethik und Egoismus
Tierrechte, „Haustiere“ und „Nutztiere“
Konsequenz führt zu Tierrechten
Menschenrechte für Tiere
Menschlicher Fundamentalismus und universelle Tierrechte
Planet des Leidens
Entscheidung
„Alles wird wieder gut!“
Anachronismus Tiere essen
Der Mensch kam nicht als Mensch auf die Welt
Sollen wir Tieren Rechte verleihen?
Befreiung, Ethik und Egoismus
Literaturverzeichnis
Der Autor und seine Werke
„Wir brauchen für den Umgang
mit Tieren keine neue Moral.
Wir müssen lediglich aufhören,
Tiere willkürlich aus der vorhandenen
Moral auszuschließen.“
Einleitung
Es gibt so etwas wie eine menschenrechtliche Weltanschauung. Dazu gehört etwa, daß jeder Mensch Anspruch auf ein faires Verfahren vor Gericht hat, daß auch Kinder Rechte haben, daß Menschen ihre Sexualität selbstbestimmt ausleben können, daß es ein Recht auf ein Altern in Würde gibt und in Europa wohl auch, daß die Todesstrafe nicht menschenrechtskonform ist. Von dieser menschenrechtlichen Weltanschauung mag es unterschiedliche Versionen, Varianten, Einfärbungen geben, etwa „linke“, liberale oder konservative. Und in bezug auf Einzelfragen wird es Auffassungsunterschiede geben, etwa, ob die „Ehe für alle“ eine übertriebene Forderung oder die „Tötung auf Verlangen“ eine legitime Forderung ist. Aber wenn konkrete menschenrechtliche Fragen aufgeworfen oder neue Forderungen erhoben werden, weiß doch jeder grundsätzlich, worum es geht, weil jeder quasi über ein basales menschenrechtliches Grundverständnis bzw. Koordinatensystem verfügt.
Das war, wenigstens ansatzweise, am Beginn der Tierrechtsbewegung auch im Hinblick auf die tierrechtliche Weltanschauung der Fall. 1989 hielt Peter Singer, der als Begründer der Tierrechtsphilosophie und -bewegung gilt, an der Universität Salzburg zwei Vorträge, die ich einleitete bzw. moderierte. Mein Buch „Philosophie des Vegetarismus: kritische Würdigung und Weiterführung von Peter Singers Ansatz“ (Kaplan, 1988) war vermutlich die erste deutschsprachige Arbeit zum Thema Tierrechte. Mein rororo-Taschenbuch „Leichenschmaus: Ethische Gründe für eine vegetarische Ernährung“ (Kaplan, 1993) trug wesentlich zur Verbreitung der im angelsächsischen Raum entstandenen Tierrechtsphilosophie im deutschen Sprachraum bei und wurde breit diskutiert. Tierrechte waren sowohl in den Printmedien als auch im Fernsehen ein wichtiges Thema.
Natürlich wurden Tierrechte auch damals mehrheitlich abgelehnt. Aber wer etwas ablehnt, hat wenigstens ansatzweise eine Ahnung davon, was er ablehnt. Der grundsätzliche Unterschied zwischen der traditionellen Tierschutz-Haltung und der neuen Tierrechts-Forderung war bekannt: „humane“ Nutzung der Tiere für menschliche Zwecke versus eigenständige, individuelle Rechte der Tiere. Dieses „Grundwissen“ ist inzwischen weitgehend verlorengegangen. Wenn es heute um das Wohl von Tieren geht, sind an die Stelle von Tierrechten längst das (mit diversen „Gütesiegeln“ versehene) „Tierwohl“, v. a. aber das alles dominierende „Bio“ getreten. Insbesondere in der Fleisch-, Milch- und Eierwerbung sind idyllische Bio-Bilder mit sanften Hügeln und saftigen Wiesen buchstäblich flächendeckend. Der Begriff „Tierrechte“ wird entweder gar nicht mehr verstanden, für eine exotische Absurdität gehalten oder mit einschlägigen Tierschutzgesetzen oder -bestimmungen verwechselt.
Wie kam es zur heute vorherrschenden Bio-Weltanschauung im allgemeinen und zur Vergötzung von Biofleisch im besonderen? Paradoxerweise auch durch eine „Vegetarismus-Debatte“: Im Zuge der intensiven öffentlichen Diskussion der Bücher „Tiere essen“ von Jonathan Safran Foer (2010) und „Anständig essen“ von Karen Duve (2011) hat sich ein breiter gesellschaftlicher Konsens nicht in Richtung „Kein Fleisch!“, sondern in Richtung „Weniger Fleisch!“ etabliert: Wir seien, so die Lesart dieses neuen „aufgeklärten“ Bewußtseins, bisher mit dem Thema Fleisch wohl etwas zu sorglos umgegangen, nun gelte es – frei nach dem Motto „Wir haben verstanden“ –, offener, sensibler und verantwortungsvoller zu handeln.
Was kaum jemand bemerkte: Diese neue „Weniger Fleisch!“-Philosophie erwies sich als Glücksfall für die Fleischindustrie! Warum? Rinderwahn, Vogelgrippe, Schweinepest, Klimadiskussion, Dioxinskandal – solche Ereignisse, Debatten und Skandale konnten dem Fleischkonsum trotz aller immer wieder aufflammenden „Weniger Fleisch!“-Appelle nie wirklich etwas anhaben: Die Konsumenten wichen vorübergehend auf andere, „unbelastete“ Tiere aus, Forscher veränderten das Futter von Rindern, um deren Methanausstoß zu verringern usw. – und nach kurzer Zeit war ohnehin wieder alles vergessen. Faktische Diskussionen dieser Art, in denen es um menschliche Gesundheit und Ökologie ging, schadeten der Fleischindustrie nie nachhaltig.
Ebensowenig pseudoethische Diskussionen, bei denen es angeblich um „Weniger Fleisch!“ um der Tiere willen ging. Solchen Forderungen fehlt nämlich jegliche moralische Glaubwürdigkeit und politische Kraft. Das sieht man sofort, wenn man sie auf Menschen umlegt: Wer, anstatt zu sagen, Foltern und Vergewaltigen sind falsch, fordert, daß weniger gefoltert und vergewaltigt werden sollte, hat keine plausible Botschaft. (Martin Luther King träumte ja auch nicht von der Aufhebung der Rassentrennung jeden Montag oder jeden Donnerstag!) Deshalb erheben Menschenrechtler auch nie Forderungen wie „Weniger foltern!“ oder „Weniger vergewaltigen!“, weil Foltern und Vergewaltigen eben immer falsch sind!
Auf einer anderen Ebene, und damit kommen wir zum springenden Punkt, nützt „Weniger Fleisch!“ der Fleischindustrie sogar! Denn „Weniger Fleisch!“ ist de facto ein ausgezeichnetes Vehikel, um mehr Fleisch zu verkaufen – weil „Weniger Fleisch!“ ein optimaler Aufhänger für Werbe-Elemente ist, die das Fleisch-Image verbessern: „bewußter essen“, „besser essen“, „ökologisch“, „biologisch“. Zusammenhängend liest sich diese neue Bio-Weltanschauung dann etwa so: Wir müssen als Konsumenten kritischer sein, bewußter essen, weniger, aber dafür besseres Fleisch essen, den Tieren Respekt erweisen – das nützt unserer Gesundheit und schont die Umwelt!
Bemerkenswerterweise ging die Einbettung des Fleischessens in die positiv besetzte Bio-Weltanschauung einher mit einer Entmoralisierung des Fleischessens selbst, und zwar dergestalt, daß die Frage, ob Fleischessen im Hinblick auf die Tiere ethisch zu rechtfertigen ist, kaum mehr gestellt wird – und auch kaum mehr verstanden würde. Schließlich geht es den Tieren sowieso super: bio, öko, Respekt, intakte Natur! Folgerichtig ist das Töten der Tiere – im Gegensatz zur früheren Tierrechte-Diskussion! – im Rahmen der Bio-Weltanschauung kein Thema mehr. Wichtig ist nur, daß die Tiere „vorher ein schönes Leben hatten“. Und das ist – siehe Bio-Werbung – ja der Fall!
Ein paar konkrete Beispiele für diese Entmoralisierung des Fleischessens (und gleichzeitig des Vegetarismus bzw. Veganismus):
In einer großen Verlagswerbung für das Buch von Karen Duve wurde der „radikale Verzicht auf die Moralkeule“ gelobt. Der Einwand, daß Menschenrechtler
immer
mit der „Moralkeule“ operieren, würde mittlerweile mental wohl automatisch unter „Verrücktes“ verbucht.
„Man muß kein Vegetarier sein, um fleischloses Essen zu genießen“, lautet eine vermeintlich liberale Devise. Soll heißen: Nicht so verbissen, liebe Leute, es geht doch auch total undogmatisch – Hauptsache, es schmeckt!
„Ich bin kein Vegetarier. Aber ich liebe Veggie.“ Mit diesem Slogan warb „Spar“ für seine vegetarische Produktlinie. Man erweitert das Sortiment um das vegetarische Segment bei gleichzeitiger „ethischer Kastrierung“ des Vegetarismus. So werden neue Kunden gewonnen, ohne alte zu verunsichern.
Bezeichnend auch die Strategie, das Nicht-Fleischessen unter Lustfeindlichkeit zu subsumieren: „Die Trias aus Nichtrauchen, Nichttrinken und Nichtfleischessen repräsentiert am deutlichsten jene Abstinenzmentalität, die sich wachsender gesellschaftlicher Zustimmung erfreut“, heißt es in einem „Zeit“-Artikel zum Thema „Verbotene Leidenschaften“.
Beliebt und wirksam: die Heimat- bzw. Kindheitsmasche, etwa so: Der Duft vom warmen Leberkäse weckt Erinnerungen an eine längst vergangene Zeit …
Die tierethisch wohl brutalste Entmoralisierung des Fleisch- bzw. Tiere-Essens: Wenn Begriffe wie „ethisch“, „moralisch“ oder „gutes Gewissen“ auftauchen, sind sie meist (nur) im Sinne von
gesundheitlich
oder
ökologisch
unbedenklich gemeint!
Die verheerendste Erscheinungsform der Entmoralisierung des Fleischessens ist das Opportunisten-Credo „Essen ist Privatsache!“, idealtypsch vertreten von Grünen-Politikern: Wir wollen niemandem etwas vorschreiben, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden! „Essen ist Privatsache“ ist so ziemlich das Gegenteil des Tierrechts-Slogans „Fleischesser sind Mörder!“.
Die für mich schockierendste Manifestation der Entmoralisierung des Fleischessens ist jene, bei der das Fleischessen als Ausdruck widerständigen Individualismus oder gar politischen Revoluzzertums begriffen wird. Im folgenden ein schauerliches Beispiel: Die französische Schauspielerin Fanny Ardant (2019, S. 129 f.) erklärt im „Spiegel“-Interview:
„Ich hasse die Idee, sich extensiv um den eigenen Körper zu kümmern. Ich hasse auch diese Dialoge, die man neuerdings führt: Huch, du isst Fleisch. Huch, du trinkst Wein. Auf keinen Fall Gluten essen. Das ist doch fürchterlich. Ich mag die Gainsbourgs dieser Welt, Leute, die gefährlich leben. Und deshalb esse ich Fleisch und trinke Wein und Bier.“
Auf die Frage, warum sie so aggressiv auf den Versuch, gesund zu leben, reagiere: „Weil ich diese neue Gesellschaftsordnung, die sich da abzeichnet, nicht mag. Es wird vorgegeben, was man machen, essen, tun sollte.“ Schließlich:
„Diese ganze Political Correctness geht mir total auf die Nerven. ( … ) Je puritanischer eine Gesellschaft sich verhält, desto gefährlicher wird es. Es gibt keine politischen Dogmen mehr, aber stattdessen breitet sich unterschwellig etwas anderes aus – eine neue Definition dessen, was gut und was schlecht ist. Ich mache da nicht mit.“
Das Entscheidende an der Bio-Weltanschauung, hier vielleicht besser: an der Bio-Wahrnehmung, ist, daß sie kaum etwas mit der Wirklichkeit zu tun hat, ihr Realitätsgehalt tendiert gegen Null. Wie falsch und verlogen diese Weltsicht ist, läßt sich anhand von zwei Punkten drastisch veranschaulichen: Erstens suggeriert die Werbung mit ihren typischen Bio-Bildern, daß praktisch alle Tiere unter Bio-Bedingungen leben. (Daß eine Bio-Schlachtung nicht nur begrifflicher Unsinn ist, sondern auch „Bio-Tiere“ de facto „normal“ geschlachtet werden, sei nur nebenbei erwähnt.) Der gefühlte Bio-Faktor beträgt also hundert Prozent. Zweitens: Der reale Bio-Anteil an der Fleischproduktion liegt unter zwei Prozent. Hinzu kommt, daß selbst die Bio-Richtlinien mit den Bio-Bildern praktisch nichts zu tun haben.
Daß die Produzenten und Konsumenten der Tierprodukte die Bio-Lüge vehement fördern und verbreiten, liegt auf der Hand: die ersteren profitieren finanziell, die letzteren „moralisch“ – in Form eines guten Gewissens. Wirklich skandalös ist, daß Politik und Gerichte diese Lügen wider besseres Wissen einfach „durchwinken“. Bedenkt man, daß Tierschutz seit 2002 in Deutschland Staatsziel ist, aber dennoch immer Mittel und Wege – und seien sie noch so krumm oder noch so konstruiert - gefunden werden, um jede denkbare Quälerei und Gemeinheit gegenüber Tieren rechtlich irgendwie abzusichern, verwundert auch das natürlich nicht wirklich.
Die Bio-Weltanschauung beinhaltet eine tragische Pointe, die mir schon vor längerer Zeit aufgefallen war, mir aber erst beim Lesen von Romain Leicks (2019) Besprechung einer Biografie der Frankfurter Schule (nämlich Stuart Jeffries´ „Grand Hotel Abgrund“) wirklich klar wurde. Darin schreibt Leick (S. 118):
„In der Frankfurter Schule breitete sich ein neuer, pessimistischer Marxismus aus, weil die Voraussetzung für eine neue Gesellschaft, die Zunahme an Bewusstsein der Arbeiterklasse, unter den veränderten Bedingungen der Moderne gar nicht mehr möglich war.“
Inzwischen wurde die Bio-Weltanschauung und -Folklore noch massiv „upgegradet“ bzw. universalisiert: Neben dem ehedem moralisch potentiell problematischen Fleisch (jetzt: „Biofleisch“) wurden zwei weitere imagemäßige Sorgenkinder auf die Ebene moralischer Unbedenklichkeit gehoben: Jagd und Pelz. In den Anfangsjahren der Tierrechtsbewegung standen Jagd und Pelz in der öffentlichen Meinung schon knapp vor dem moralischen Aus. Beide erholten sich vom schlechten Image zwar überraschend gut, blieben aber dennoch moralische Abstiegskandidaten. Mit einer erweiterten bzw. integrierten Bio-Philosophie lassen sich nun alle drei Bereiche – Fleisch, Jagd, Pelz – argumentativ elegant und v. a. „nachhaltig“ auf moralisch sicheres Gelände retten: Fleisch von Tieren, die ein glückliches Leben hatten? Da ist Fleisch von Tieren, die bis zu ihrem Tod in der freien Natur lebten, schlicht die Ideallösung! Und was heißt vor diesem Hintergrund schon „Jagd“? „Tötung in gewohnter Umgebung“ trifft die Sache viel besser! Und daß das automatisch anfallende Beiprodukt Pelz auch genutzt wird – alles andere wäre ein ökologischer Frevel!
Daß vor diesem Hintergrund eigenständige, individuelle Rechte von Tieren, Tierrechte analog Menschenrechten, als exotische Absurdität erscheinen, verwundert wenig. Ziel dieses Buches ist die (Wieder-)Sensibilisierung für die Tierrechtsidee: Tiere haben, wie Menschen, vielfältige Interessen und, wie Menschen, einen Anspruch, ein Recht, ein Leben gemäß diesen Interessen zu führen. Den philosophischen Zusammenhang zwischen Tierrechten und Menschenrechten habe ich in meinem Buch „Menschenrechte und Tierrechte“ (Kaplan, 2019) ausführlich und systematisch beschrieben.
Die folgenden, z. T. älteren Texte haben unterschiedliche thematische Aufhänger, sind in sich abgeschlossen und können daher unabhängig von einander gelesen werden. Der mit der Bio-Weltanschauung einhergehenden Entmoralisierung des Fleischessens und Verharmlosung unseres Umgangs mit Tieren wird gelegentlich auch stilistisch pointiert Rechnung getragen, etwa durch die Frage „Sind Fleischesser Mörder?“ Der Begriff „Rassismus“ gilt seit kurzem als sachlich und politisch nicht mehr angemessen. Er wurde in den Texten belassen, weil die Tierrechtsphilosophie mit diesem Begriff formuliert wurde und weil sich für den Begriff „rassistisch“ noch kein angemessener und verständlicher Ersatz etabliert hat. Teilweise inhaltliche Überschneidungen in den Texten betreffen meist den Tierrechtsbegriff selbst und ermöglichen so unterschiedliche perspektivische Annäherungen an die Tierrechtsidee.
1. Begründung und Darstellung der Tierrechtsphilosophie
Tierrechte
Neben der traditionellen Tierschutzbewegung gibt es seit den 1970er Jahren auch eine neue Tierrechtsbewegung. Während sich Tierschützer de facto mit der „Humanisierung” der Ausbeutung von Tieren begnügen, plädieren Tierrechtler für eine Beendigung der Ausbeutung, indem wir auch Tieren eigenständige, exekutierbare Rechte verleihen. Zu Recht: Eine „Humanisierung” etwa der Schlachtung ist in Wirklichkeit genauso ein Unding wie eine „Humanisierung” von Sklaverei oder Folter oder die Zulassung von „sanfter” Vergewaltigung.
Diejenigen, die Tierrechte befürworten, betonen die Ähnlichkeiten zwischen Menschen und Tieren. Diejenigen, die Tieren keine eigenen Rechte zugestehen möchten, verweisen auf die vielen Unterschiede zwischen Menschen und Tieren.
So groß und zahlreich diese Unterschiede – je nach Perspektive und Abstraktionsniveau – aber auch immer sein mögen, moralisch entscheidend ist einzig und allein diese Gemeinsamkeit zwischen Menschen und Tieren: Tiere sind wie wir leidensfähige Wesen, die nichts so scheuen, wie leiden zu müssen. Was auch immer Menschen können mögen, wozu Tiere nicht imstande sind – warum um alles in der Welt sollen wir sie deshalb quälen dürfen!
Warum soll man Wesen lebenslang einsperren dürfen, weil sie keine mathematischen Gleichungen lösen können? Warum soll man mit ihnen grausame Experimente machen dürfen, weil sie keine Sinfonien komponieren können? Und warum soll man sie umbringen und aufessen dürfen, weil sie keine Liebesgedichte schreiben können?
Tiere sind wie wir leidensfähige Wesen und haben ein immenses Interesse, nicht zu leiden. Deshalb haben sie wie wir das Recht, von Leiden verschont zu werden.
Wir brauchen keine neue Moral
Fortschritt