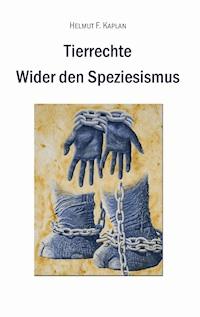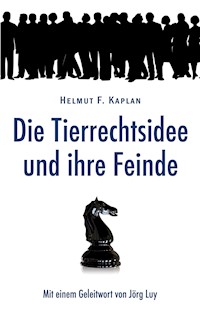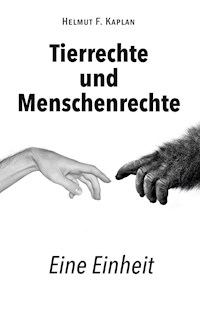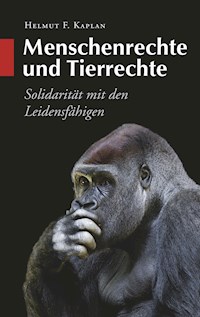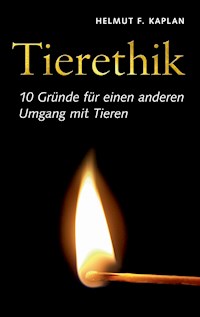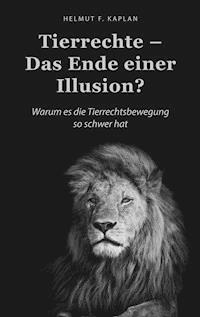
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Einst gehörte die antispeziesistische Tierrechtsbewegung zu den großen Reformbewegungen. Während aber etwa die antisexistische Frauenrechtsbewegung phänomenale Fortschritte feiert, hat der politische Stellenwert der Tierrechtsbewegung ständig abgenommen. Damit dürfen wir uns nicht abfinden, denn Tierrechte sind der mögliche Hebel für die Überwindung des allgegenwärtigen Speziesismus, der willkürlichen Diskriminierung aufgrund der Spezies. Anstatt Tierrechte fallenzulassen oder obskuren Sektierern zu überlassen, sollten die Gründe, warum es die Tierrechtsbewegung so schwer hat, analysiert werden - um auf dieser Basis einen neuen Anlauf nehmen zu können. Haben erst einmal die absurden Sprüche über kleinbäuerliche Strukturen, bio, öko, artgerecht, bewusst essen, regional genießen, Respekt vor Tieren usw. die Wahrheit vollends verdeckt - dann ist es zu spät.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 73
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Tierrechte
Problem Mensch
Problem Natur
Problem Speziesismus
Texte zum Problem Mensch
Texte zum Problem Speziesismus
Literatur
Über den Autor
Vorwort
Zur unglücklichen Entwicklung der Tierrechtsbewegung hatte ich jahrelang Notizen und Unterlagen gesammelt. Die längste Zeit lief es auf einen resignierenden Abgesang auf Tierrechte hinaus: Das sind die Gründe, warum sich Tierrechte einfach nicht so entwickeln und durchsetzen wie etwa Schwulen- oder Frauenrechte. Im Zuge der Ausarbeitung der Notizen und Unterlagen wandelten sich sukzessive Perspektive und Zielsetzung in Richtung: Tierrechte dürfen nicht fallengelassen werden, Tierrechte dürfen nicht aufgegeben werden – genauer: Wir dürfen Tierrechte nicht aufgeben! Der Grund für diesen Wandel ist wohl die moralische Erkenntnis, daß es zwar legitim sein kann, sich selbst oder seine eigene Sache aufzugeben, nicht aber, quasi stellvertretend, andere oder deren Interessen.
Allerdings sollte nicht übersehen werden, daß diese Hinwendung zum Handeln – „Packen wir´s an, laßt uns Tierrechte verwirklichen!“ – die Gefahr in sich birgt, Dramatik und Ernst der Lage zu verkennen. (Daher die Mottos zur Ermahnung!) Wir sollten Tierrechte zwar nicht aufgeben, sondern uns weiterhin um ihre Verwirklichung bemühen, aber wir müssen uns dabei bewußt sein, daß wir uns in einer sehr schwierigen, ernsten Situation befinden. Keine Lehren aus der bisherigen Abwärtsentwicklung von Tierrechten zu ziehen, wäre verheerend, ein „Weiter so!“ tödlich.
Am gefährlichsten ist die Entwicklung, die sich seit Jahren abzeichnet und immer mehr durchsetzt: die Botschaft und das Bewußtsein: Im großen und ganzen befinden wir uns auf dem richtigen Weg, alles geht in eine gute Richtung! Haben erst einmal die absurden Sprüche über „kleinbäuerliche Strukturen“, „bio“, „öko“, „artgerecht“, „bewußt essen“, „regional genießen“,„Respekt vor Tieren“ usw. die Wahrheit vollends verdeckt – dann ist es zu spät. Und die Wahrheit ist, daß heute mehr Tiere denn je zuvor ohne jegliche Rechte, die diesen Namen verdienen, in ihren Foltergefängnissen auf ihr grauenvolles Ende warten.
Salzburg, im März 2017 Helmut F. Kaplan
Darüber, ob Gott tot sei, läßt sich lange streiten, der Teufel ist es nicht.
André Glucksmann
„Die Hölle ist leer, alle Teufel sind hier!“
William Shakespeare
Einleitung
Den Beginn der Tierrechtsbewegung könnte man mit dem Erscheinen von Peter Singers Buch „Animal Liberation“ im Jahre 1975 datieren (deutsch zuerst 1982: „Befreiung der Tiere“). Meine erste Arbeit zu diesem Themenbereich, „Philosophie des Vegetarismus: kritische Würdigung und Weiterführung von Peter Singers Ansatz“, erschien 1988; seitdem publiziere ich zu tierethischen und tierrechtsphilosophischen Themen.
Einst gehörte die antispeziesistische Tierrechtsbewegung neben der ökologischen, der antirassistischen und der antisexistischen Bewegung (Frauenemanzipation) zu den großen Reformbewegungen. Seit vielen Jahren hat der politische Stellenwert der Tierrechtsbewegung aber, zumindest im deutschsprachigen Raum, ständig abgenommen – und ist mittlerweile bei Null angelangt. Von den großen Organisationen, die eine vegetarische oder vegane Lebensweise propagieren, werden Tierrechte nicht mehr oder nur mehr nachrangig thematisiert (Ausnahme: Peta). In der Öffentlichkeit wird mit Tierrechten nichts oder Falsches assoziiert: die Tierschutzgesetze. Willkommener Nebeneffekt für die Fleisch-, Milch-, Eierindustrie: Tierrechte werden als weitgehend realisiert oder zumindest als auf dem besten Weg zur Realisierung wahrgenommen. Tierrechtlerische Kleingruppen bieten auch keine positive Perspektive, da sie nicht nur Teil, sondern wesentlich Ursache der Misere sind: Ihre paranoiden Ausgrenzungen und panischen Meinungs-, Rede- und Denkverbote haben die einst relevante Tierrechtsbewegung zukzessive in die politische Bedeutungslosigkeit katapultiert.
Damit dürfen wir uns aber nicht abfinden, weil Tierrechte (siehe Kaplan, 2016) der mögliche Hebel für die Überwindung des allgegenwärtigen Speziesismus, der willkürlichen Diskriminierung aufgrund der Spezies, sind! Anstatt Tierrechte fallenzulassen oder herabzustufen oder obskuren Sektierern zu überlassen, sollen vielmehr die Gründe, warum es die Tierrechtsbewegung so schwer hat, analysiert werden, um auf nüchterner, realistischer und rationaler Basis einen neuen Anlauf nehmen zu können.
Im folgenden wird zuerst dargelegt, was unter Tierrechten sinnvollerweise verstanden werden kann (1.). Danach werden die Hindernisse, die einer erfolgreichen Tierrechtsbewegung und der Verwirklichung von Tierrechten entgegenstehen, erläutert: die Probleme Mensch (2.), Natur (3.) und Speziesismus (4.). Schließlich soll eine kleine Auswahl aus jenen Texten, die ich die Tierrechtsbewegung begleitend, beobachtend und analysierend verfaßt habe, das Problem Mensch (5.) und das Problem Speziesismus (6.) weiter veranschaulichen und vertiefen.
1. Tierrechte
Die folgende Charakterisierung von Tierrechten basiert auf Peter Singers Gleichheitsprinzip (Singer, 2008, 2013) sowie der kritischen Auseinandersetzung mit früheren Tierrechtskonzepten. (Kaplan, 2016) Nun behauptet natürlich kein vernünftiger Mensch, daß Menschen und Tiere in einem faktischen Sinne gleich wären. Menschen und Tiere haben – wie auch die Menschen untereinander – unterschiedliche Interessen. Deshalb wäre es auch völlig verfehlt, Menschen und Tiere gleich zu behandeln, denn unterschiedliche Interessen rechtfertigen und erfordern eine unterschiedliche Behandlung. So brauchen etwa Hunde und Katzen im Unterschied zu Menschen keine Religionsfreiheit und kein Wahlrecht – weil sie damit nichts anfangen könnten. So wie Männer im Unterschied zu Frauen keinen Schwangerschaftsurlaub brauchen – weil sie nicht schwanger werden können.
Was das Gleichheitsprinzip fordert, ist schlicht dies: wo Menschen und Tiere gleiche bzw. ähnliche Interessen haben, da sollen wir diese gleichen bzw. ähnlichen Interessen auch gleich berücksichtigen:
Weil alle Menschen ein Interesse an angemessener Nahrung und Unterkunft haben, sollen wir dieses Interesse auch bei allen Menschen gleich berücksichtigen – und dürfen nicht willkürliche Diskriminierungen aufgrund von Rasse oder Geschlecht vornehmen. Also kein
Rassismus
und
Sexismus
.
Und weil sowohl Menschen als auch Tiere ein immenses Interesse haben, nicht zu leiden, sollen wir dieses Interesse bei Menschen und Tieren auch gleich berücksichtigen – und dürfen nicht willkürliche Diskriminierungen aufgrund der Spezies vornehmen. Also kein
Speziesismus
.
Die Tierrechtsbewegung ist nichts anderes als die konsequente und notwendige Fortsetzung der Menschenrechtsbewegung, etwa der Befreiung der Sklaven, der (amerikanischen) Bürgerrechtsbewegung oder der Emanzipation der Frauen. Immer ging und geht es darum, moralische Diskriminierungen aufgrund moralisch belangloser Merkmale zu erkennen und zu überwinden:
Wir haben erkannt, daß die Hautfarbe belanglos ist.
Wir haben erkannt, daß die Geschlechtszugehörigkeit belanglos ist.
Wir sollten erkennen, daß auch die Speziesgehörigkeit moralisch belanglos ist:
Warum sollte man jemanden quälen dürfen, weil er zu einer anderen Spezies gehört? Gleicher Schmerz ist gleich schlecht, egal ob er von Weißen, Schwarzen, Männern, Frauen oder Tieren erlebt wird. Die Ausbeutung und Diskriminierung aufgrund der Spezies ist genauso falsch wie Rassismus und Sexismus.
Wir sagten: Gleiche bzw. ähnliche Interessen von Menschen und Tieren sollen gleich berücksichtigt werden. Anders formuliert: Tiere haben das Recht, daß ihre Interessen gleich berücksichtigt werden wie vergleichbare menschliche Interessen. Tierrechte sind dann die Summe der Ansprüche, die sich aus dieser gleichen Berücksichtigung ergeben. Der entscheidende Satz, der diesen Tierrechtsbegriff charakterisiert, lautet also:
Tiere haben das Recht, daß ihre Interessen gleich berücksichtigt werden wie vergleichbare menschliche Interessen.
Drei Beispiele mögen dies konkret veranschaulichen:
Ich schlage ein Kind und ein Pferd jeweils so, daß es dem Kind und dem Pferd den gleichen Schmerz verursacht. (Dafür muß ich natürlich das Pferd entsprechend stärker schlagen.) Wenn ich das verursachte gleiche Schmerzerlebnis dem Kind nicht zumuten würde, darf ich es auch dem Pferd nicht zumuten. Das Pferd hat das Recht, nicht auf diese Weise behandelt zu werden.
Ich sperre einen Menschen und ein Tier jeweils auf eine Weise ein, die beiden das gleiche Leiden aufgrund von Enge und Eingesperrtsein verursacht. (Dafür muß ich mich natürlich über die Lebensgewohnheiten und Bedürfnisse des betroffenen Tieres kundig machen, um ein ähnliches Leidensniveau zu gewährleisten.) Wenn ich das verursachte Leiden aufgrund von Enge dem Menschen nicht zumuten würde, darf ich es auch dem Tier nicht zumuten. Das Tier hat das Recht, nicht auf diese Weise behandelt zu werden.
Ich versetzte einen Menschen und ein Tier jeweils in eine Situation, die beiden das gleiche Ausmaß an Angst verursacht. (Dafür muß ich mich natürlich über die Lebensgewohnheiten und Bedürfnisse des betroffenen Tieres kundig machen, um ein ähnliches Leidensniveau zu gewährleisten.) Wenn ich die verursachte Angst dem Menschen nicht zumuten würde, darf ich sie auch dem Tier nicht zumuten. Das Tier hat das Recht, nicht auf diese Weise behandelt zu werden.
Zum Einwand, dieses Konzept sei nicht praktikabel, weil wir einfach zuwenig über das tierliche Erleben wüßten und es daher auch nicht hinreichend mit unserem Erleben vergleichen könnten: Millionen von (psychologischen) Tierversuchen beruhen exakt auf dieser Vergleichbarkeit! Die Herstellung der Ähnlichkeit zwischen menschlicher und tierlicher Situation ist ihre Voraussetzung und Grundlage, weil ihr Zweck darin besteht, anhand des tierlichen Erlebens und Verhaltens Methoden oder Medikamente für Menschen zu entwickeln, die bei den in Frage stehenden Problemen, etwa Ängsten oder Schmerzen, optimal helfen. Es ist daher heuchlerisch, verlogen und falsch, diesem Tierrechtkonzept mangelnde Praxistauglichkeit vorzuwerfen, weil man, leider, leider, tierliches und menschliches Erleben halt so schlecht vergleichen könne. Unser möglicher Zugang zum tierlichen Erleben ist (auch unabhängig von der Praxis der Tierversuche) empirisch wie theoretisch erwiesen und wohl dokumentiert. Ein Überblick über die diesbezüglichen Methoden und Disziplinen findet sich in Kaplan, 2016, S. 63 ff.