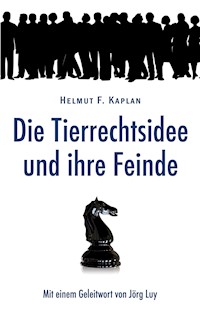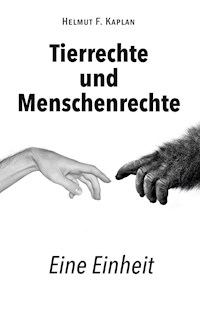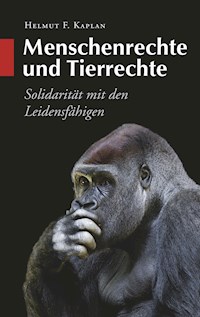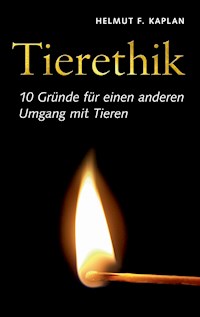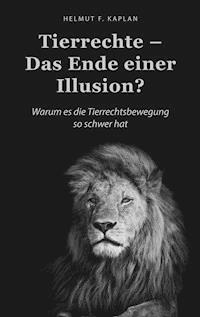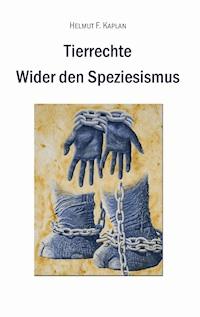
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
So wie wir erkannt haben, dass Hautfarbe und Geschlecht für die Gewährung grundlegender Rechte belanglos sind, so sollten wir auch erkennen, dass die Spezies hierfür belanglos ist: Warum sollte man jemanden ausbeuten und quälen dürfen, weil er zu einer anderen Art gehört? Gleicher Schmerz ist gleich schlecht, egal ob er von Weißen, Schwarzen, Männern, Frauen, Kindern oder Tieren erlebt wird. Die Ausbeutung und Diskriminierung aufgrund der Spezies, der Speziesismus, ist genauso falsch wie Rassismus und Sexismus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Einleitung
1. Faktische Voraussetzungen
1.1 Objektive Ähnlichkeit zwischen Menschen und Tieren
1.1.1 Bewußtsein
1.1.2 Schmerz
1.1.3 Leiden
1.1.4 Intelligenz
1.1.5 Sozialleben
1.1.6 Moral
1.1.7 Selbstbewußtsein
1.2 Subjektive Ähnlichkeit zwischen Menschen und Tieren
1.2.1 Analogie
1.2.2 Ethologie
1.2.3 Kognitive Ethologie
1.2.4 Theorie des Geistes
1.2.5 Empathie
1.2.6 Sprache
2. Ethische Forderungen
2.1 Beachtung des Gleichheitsgrundsatzes
2.2 Verwirklichung und Fortführung des Great-Ape-Projekts
3. Globale Konzepte
3.1 Vorbemerkung zum Tierrechtsbegriff
3.2 Peter Singer
3.2.1 Darstellung
3.2.1.1 Gleichheitsprinzip
3.2.1.2 Leidensfähigkeit
3.2.1.3 Rassismus, Sexismus, Speziesismus
3.2.2 Kritik
3.2.2.1 Notwendige Präzisierungen
3.2.2.1.1 Unterschiedliche Anwendungsbedingungen
3.2.2.1.2 Quantitative Interpretation
3.2.2.2 Utilitarismus
3.3 Tom Regan
3.3.1 Darstellung
3.3.1.1 Psychische Komplexität
3.3.1.2 Wohlergehen
3.3.1.3 Tod
3.3.1.4 Indirekte Pflichten
3.3.1.5 Direkte Pflichten
3.3.1.6 Inhärenter Wert und Rechte
3.3.1.7 Lösung von Konflikten
3.3.1.8 Vegetarismus
3.3.2 Kritik
3.4 Gary L. Francione
3.4.1 Darstellung
3.4.2 Kritik
3.5 Sue Donaldson und Will Kymlicka
3.5.1 Darstellung
3.5.2 Kritik
3.6 Ziel und Strukturmerkmale von Tierrechtskonzepten
3.7 Optimierter einfacher Tierrechtsbegriff: Recht auf gleiche Interessenberücksichtigung
3.8 Bemerkungen zu einem Tierrechtsbegriff auf kantischer Grundlage
4. Exkurs
4.1 Stellenwert des Leidens
4.2 Die Rolle von Fakten beim ethischen Werten
4.2.1 Was folgt moralisch aus der „Natürlichkeit“ einer Sache?
4.2.2 Welche Bedeutung haben Fakten für die moralische Bewertung von Tieren?
5. Speziesistische Schande
5.1 Begriffliche Bestimmung
5.2 Speziesistisches Dilemma („marginal cases“)
5.3 Historische Einordnung
5.4 Notwendige Überwindung
5.5 Fundamentale Illustration
5.6 Speziesistische Wahrnehmungsstörungen
5.7 Speziesistische Denkstörungen
Literatur
Über den Autor
Vorwort
Nach langer Selbstzerfleischung befindet sich die Tierrechtsbewegung in einer schweren Krise. Aber kaum jemand bemerkt es. Die versprengten Einzelkämpfer nicht, die sich im Besitz der alleinseligmachenden Wahrheit wähnen. Und die Öffentlichkeit nicht, weil sie durch die medialen Vegan- und Bio-Märchen ruhiggestellt ist.
Während das Foltern und Morden in Versuchslabors, Tierfabriken und Schlachthäusern unvermindert weitergeht. (Würde ich anstatt „Foltern“ und „Morden“ „Quälen“ und „Töten“ schreiben, würde die moralische Gleichsetzung von Rassismus, Sexismus und Speziesismus, für die argumentiert wird, durch sprachliche Differenzierung konterkariert.)
Die Tierrechtsphilosophie floriert hingegen, noch nie gab es so viele so ausgefeilte Tierrechtskonzepte. Die philosophischen Grundlagen für eine politische Befreiung der Tiere nach dem Vorbild antirassistischer und antisexistischer Bewegungen existieren also. Aber die atomisierte Tierrechtsbewegung müßte endlich ihre Kräfte konzentrieren, bündeln statt ausgrenzen!
Salzburg, im Februar 2016
Helmut F. Kaplan
Einleitung
Wenn von Tierrechten die Rede ist und nicht gerade auf ein bestimmtes theoretisches Konzept Bezug genommen wird, so sind damit wie bei Rechten von Menschen einfach gewisse Ansprüche gemeint: Ansprüche auf eine bestimmte Behandlung. Dabei richten sich diese Rechte im einzelnen nach den Interessen und Bedürfnissen der Betroffenen. Was für die einen extrem wichtig ist, kann für andere völlig belanglos sein.
So haben und brauchen etwa Kinder aus naheliegenden Gründen keinen Anspruch auf einen Platz im Altenheim. Und Männer benötigen im Unterschied zu Frauen kein Recht auf Schwangerschaftsurlaub, weil sie nicht schwanger werden können. Ebensowenig brauchen Hunde im Unterschied zu Menschen ein Recht auf Religionsfreiheit, weil sie keine Religion kennen. Der Zweck von Rechten ist stets der gleiche: den Rechtsträgern ein soweit als möglich angemessenes, das heißt ihren Interessen und Bedürfnissen entsprechendes Leben zu gewährleisten.
lm deutschsprachigen Raum hat sich als Bezeichnung für die Bewegung, die auch Tieren solche Rechte zugestehen will, der Name „Tierrechtsbewegung“ durchgesetzt. Deshalb werden auch wir im folgenden von der Philosophie der Tierrechtsbewegung sprechen. Durchaus geläufig ist aber auch die Bezeichnung „Tierbefreiungsbewegung“.
Damit wird Bezug genommen auf vorangegangene Befreiungsbewegungen, wie etwa die Befreiung der Sklaven oder die Emanzipation der Frauen. Die Tierbefreiungsbewegung ist in der Tat die logische Fortsetzung dieser Befreiungsbewegungen: So wie wir erkannt haben, daß die Hautfarbe für die Gewährung grundlegender Rechte belanglos ist und daß die Geschlechtszugehörigkeit dafür belanglos ist, so erkennen immer mehr Menschen, daß auch die Spezieszugehörigkeit diesbezüglich belanglos ist: Warum soll man jemanden ausbeuten und quälen dürfen, weil er zu einer anderen Spezies gehört? Rassismus, Sexismus und Speziesismus befinden sich logisch und ethisch auf der gleichen Ebene. Speziesismus steht für das ganze menschliche Unrecht gegenüber Tieren. Und der historisch-politische Stellenwert, das revolutionäre Potential von Tierrechten liegt darin, daß sie der mögliche Katalysator für die Überwindung des Speziesismus sind.
Während sich der traditionelle Tierschutz mit der „Reformierung“ oder „Humanisierung“ der Ausbeutung von Tieren begnügt, fordert die Tierrechtsbewegung bzw. die Tierbefreiungsbewegung die Beendigung der Ausbeutung. Eine „Humanisierung“ etwa der Schlachtung ist schließlich bei Lichte besehen, ein ebensolches Unding wie eine „Humanisierung“ von Sklaverei oder Folter oder die Zulassung von „sanfter Vergewaltigung“. Verbrechen kann man nicht „humanisieren“, man muß sie verbieten.
Tierrechte und Tierbefreiung sind zwei Seiten einer Medaille: Tiere müssen von der menschlichen Tyrannei befreit werden und jene Rechte erlangen, die ihnen ein tiergerechtes, ein tierwürdiges Leben ermöglichen. Wir werden im folgenden aber, wie gesagt, beim Terminus „Tierrechtsbewegung“ bleiben.
Den Beginn dieser Bewegung kann man im Grunde genau angeben: Es ist das Jahr 1975. Damals erschien das Buch „Animal Liberation“ von Peter Singer (deutsch zuerst 1982: „Befreiung der Tiere“). Wenngleich es natürlich auch hier wie bei allen historischen Bewegungen Vorläufer gab, so kann man dieses Buch aufgrund seiner immensen praktischen wie theoretischen Wirkung dennoch als Beginn, als lnitialzündung der Tierrechtsbewegung ansehen.
Das Neue an der Tierrechtsbewegung ist vor allem ihr rationaler Charakter. Alle vorangegangenen Initiativen zur Verbesserung des Loses der Tiere – der gesamte traditionelle Tierschutz – hatten stets, zumindest auch, religiöse, ideologische oder esoterische Wurzeln. Das hatte einen wichtigen Nebeneffekt mit verheerenden Folgen: Alle Thesen, Diskussionen und Forderungen wiesen einen erheblichen Glaubensanteil auf und waren daher entsprechend angreifbar. Vor allem aber:
Lehren und Einstellungen, die mit einem bestimmten Glauben verknüpft sind, sind in ihrer Wirksamkeit auf diejenigen beschränkt, die diesen Glauben teilen. Wer etwa, um ein Beispiel zu nennen, den Vegetarismus mit dem Glauben an die Seelenwanderung begründet, kann nur diejenigen überzeugen, die an die Seelenwanderung glauben.
Der Beginn der Tierrechtsbewegung markiert eine historische Wende: Seitdem gibt es eine ausdrücklich rationale Auseinandersetzung mit dem moralischen Status von Tieren. Damit werden Widersprüche zwischen verschiedenen Positionen rational diskutierbar und rational lösbar. Damit ist es vorbei mit der bisherigen Zwei-Klassen-Ethik: Vor der Tierrechtsbewegung war es keine Frage, daß der Mensch und nur der Mensch Gegenstand der Ethik ist. Daneben gab es bestenfalls so etwas wie eine Neben- oder Unterethik, die sich auch mit Tieren befaßte. Dank der Tierrechtsbewegung gibt es immer mehr ethische Ansätze, die sich mit dem richtigen Umgang mit Menschen und Tieren befassen.
Tierrechte sind heute Gegenstand philosophischer Vorlesungen und Seminare auf Universitäten in der ganzen Welt. Wichtigste Funktion der Philosophie der Tierrechtsbewegung ist aber nicht, neue Theorien zu schaffen, sondern vielmehr, den Blick für das Offensichtliche zu schärfen: für das, was wir sehen würden, wenn wir nicht durch vorangegangene Philosophien, Theorien und Religionen heillos verwirrt und verdorben worden wären. Ziel der Tierrechtsphilosophie ist nicht, Neues zu schaffen, sondern Naheliegendes wieder erkennbar und fühlbar zu machen: die Ähnlichkeit, Einheit und Verbundenheit von Menschen und Tieren.
Das heißt andererseits nicht, daß wir schwierigen philosophischen Fragen aus dem Weg gehen wollen. Und solchen werden wir begegnen. Denn die Tierethik ist ein Teil der Gesamtethik, und in der Ethik geht es nun einmal um zum Teil schwierige Fragen und die Versuche, sie zu lösen.
1. Faktische Voraussetzungen
1.1 Objektive Ähnlichkeit zwischen Menschen und Tieren
1.1.1 Bewußtsein
Wenn man Hunde oder Katzen aus dem Fenster wirft oder mit Hammer und Messer traktiert, so gleichen sie in ihren Reaktionen eher Menschen als Steinen oder Fernsehgeräten: Es macht ihnen etwas aus, sie spüren etwas, sie leiden. Vor die Wahl gestellt, würden sie sich mit Sicherheit dafür entscheiden, nicht aus dem Fenster geworfen oder mit Hammer und Messer traktiert zu werden. Denn Tiere sind im Gegensatz zu Steinen und Fernsehgeräten fühlende, wollende Wesen mit bewußten Erlebnissen.
Freilich käme es keinem normalen Menschen je in den Sinn, dies ernsthaft zu bezweifeln. Erstaunlicherweise gibt es aber noch immer einige Wissenschaftler und Philosophen, die glauben, ihre Seriosität und Objektivität damit beweisen zu müssen, daß sie orakeln: Strenggenommen, mit letzter Sicherheit können wir nicht wissen, ob und was Tiere erleben. Über diese zurückhaltenden Zeitgenossen hatte Konrad Lorenz (1980, S. 251, 254) eine ausgeprägte Meinung:
„Die Tatsache, daß unsere Mitmenschen so etwas Ähnliches sind, und Ähnliches empfinden, wie wir selbst, ist evident in genau dem gleichen Sinne, wie mathematische Axiome es sind. Wir sind nicht imstande, nicht an sie zu glauben. Karl Bühler, der meines Wissens als erster auf diesen Tatbestand hingewiesen hat, sprach von ‚Du-Evidenz‘.
Mit derselben axiomatischen Sicherheit, mit der wir in unseren Mitmenschen das Vorhandensein einer Seele, das heißt der Fähigkeit zum subjektiven Erleben, voraussetzen, tun wir das auch bei höheren Tieren. Ein Mensch, der ein höheres Säugetier, etwa einen Hund oder einen Affen, wirklich genau kennt und nicht davon überzeugt wird, daß dieses Wesen ähnliches erlebt wie er selbst, ist psychisch abnorm und gehört in die psychiatrische Klinik, da eine Schwäche der Du-Evidenz ihn zu einem gemeingefährlichen Monstrum macht.“
Ähnlich, wenn auch weniger drastisch äußern sich viele Autoren über die Selbstverständlichkeit tierlichen Bewußtseins, unter anderem David Hume (siehe Griffin, 1985, S. 11), Robert Spaemann (1984, S. 71), Adolf Portmann (1987, S. 112, 116), Phil Maggitti (1990, S. 24 ff.), Bernard Rollin (1989), Volker Arzt und lmmanuel Birmelin (1993) sowie Daisie und Michael Radner (1989).
Auch Charles Darwin (1966, S. 84) zeigt wenig Verständnis für Zögerer und Zauderer in bezug auf das Vorhandensein tierlichen Bewußtseins: „Die Tatsache, daß die Tiere durch dieselben Gemütsbewegungen erregt werden wie wir, ist so sicher, daß es überflüssig ist, den Leser durch zu viele Einzelheiten zu ermüden.“
1.1.2 Schmerz
Schmerzen sind wohl jene bewußten Erlebnisse, von denen es am offenkundigsten ist, daß sie auch Tiere haben. Und zwar aus mindestens zwei Gründen: Erstens läßt das Verhalten von Tieren in Situationen, die uns Schmerzen verursachen, keinen vernünftigen Zweifel darüber zu, daß auch sie Schmerz empfinden. Zweitens ist Schmerz eine biologische Notwendigkeit: „Kein höheres Lebewesen ohne Schmerz – aber ohne Schmerz auch kein höheres Leben: Der Schmerz ist es, der als ‚Warner‘ uns schützt vor Gefahren für Leib und Leben“ (Frey, 1978, S. 7; Vgl. Serjeant, 1970, S. 56–62).
Dabei ist wichtig festzustellen, daß Tiere Schmerz auch keineswegs prinzipiell schwächer empfinden als Menschen. Eher das Gegenteil ist der Fall: Aufgrund ihrer zum Teil viel empfindlicheren Sinnesorgane leiden Tiere unter entsprechenden Beeinträchtigungen oft sogar stärker als Menschen. Hier seien etwa Schweine erwähnt: Diese völlig zu Unrecht als schmutzig verschrieenen Tiere sind von Haus aus sehr sauber und haben auch einen entsprechend feinen Geruchssinn, der dem eines Jagdhundes gleichzusetzen ist. Deshalb leiden diese Tiere schrecklich unter dem fürchterlichen Gestank, dem sie in Tierfabriken lebenslang hilflos ausgeliefert sind. Außerdem sind Schweine extrem intelligent und haben ein reiches Gefühlsleben. (Vgl. Zahlen und Fakten…, 1993, S. 109, Kremsmayer, 1990, S. 118, Bittermann / Plank, 1990, S. 100–102, Comstock, 1992, S. 122 f., Schweine!, 1996, S. 14 ff., Zu schlau für die Wurst, 2012.)
Um sich einen Begriff von den „Supersinnen der Tiere“ zu machen, empfiehlt sich das gleichnamige Buch von John Downer (1990). Es vermittelt beeindruckende Einblicke in die phantastische Wahrnehmungswelt der Tiere, deren Sinnesleistungen das menschliche Wahrnehmungsvermögen geradezu armselig erscheinen lassen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie absurd die Annahme, daß Tiere Schmerzen prinzipiell schwächer empfänden, ist. (Vgl. Serjeant, 1970, S. 99 f.)
An dieser Stelle muß auch mit dem Vorurteil aufgeräumt werden, daß Fische nicht leidensfähig seien. (Vgl. Apel, 1990, S. 27) Immer mehr Forscher betonen die Leidensfähigkeit von Fischen. So etwa Culum Brown, Professor an der Macquarie University (Australien), der auch darauf verweist, daß Fische ähnliche geistige Fähigkeiten („mental complexity“) wie die meisten anderen Wirbeltiere haben. (Fish have feelings too…, 2014). Donald Broom, Professor in Cambridge (England), hält es sogar für möglich, daß Fische aufgrund ihrer weniger komplexen Gehirne mehr leiden, weil sie nicht so effektiv mit Schmerz umgehen können wie Tiere mit komplexeren Gehirnen (Bekoff, 2008, S. 43). Die Gedankenlosigkeit und Brutalität, mit der wir diese Tiere täglich millionenfach quälen und töten, gehört zum Grauenhaftesten überhaupt. (Siehe auch Jackson, 1993, S. 4 ff., Dunayer, 1992, S. 12 ff., Arras, 1991, 1996, S. 10 f.)
Das gilt übrigens auch für Hummer (sowie für andere Krebstiere, mit denen ähnlich rücksichtslos verfahren wird). Die Tierrechtsorganisation „People for the Ethical Treatment of Animals“ (PETA) verweist gleich auf eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Studien, die die Leidensfähigkeit von Hummern belegen (PETA, 2013). Diese hochempfindlichen Wesen werden monatelang (bis zu zwei Jahre lang!) lebendig „zwischengelagert“, wobei sie die ganze Zeit bewegungsunfähig und mit zusammengebundenen Scheren verbringen müssen. Schließlich werden sie lebendig in kochendes Wasser geworfen. Nur so kommt es zur schönen roten Färbung, die sich am Buffet so gut macht. Der Todeskampf im kochenden Wasser dauert nicht Sekunden, sondern Minuten. Und um sich das lästige Deckelzuhalten zu ersparen – der Hummer versucht in panischer Angst und äußerstem Schmerz mit allen Mitteln, dem Kochtopf zu entkommen –, hat man sich einen praktischen Trick einfallen lassen: die Tiere werden an einem Brett festgebunden. (Initiative gegen Tierversuche…, 1989, S. 16, Hummer – der Renner…, 1995, S. 14 f., Delikatessen zum Vergessen, 1995, S. 17, Die Hummer-lndustrie, 1995, S. 4, Jagd auf Leben…, 1996, S. 17, Berger, 1996, S. 7, Beidl, 1996/1997, S. 19)
1.1.3 Leiden
Tiere erleben nicht nur physischen Schmerz, sondern auch psychisches Leiden: Angst, Trauer, Verzweiflung, Trennungsschmerz, Kummer, Hoffnungslosigkeit, Furcht, Zorn usw. (Vgl. Bilz, 1974, V, 28, Serjeant, 1970, S. 100, Cena, 1978, Rachels, 1991, S. 133) Wenn man bedenkt, daß die evolutionäre Kontinuität (dazu gleich mehr) naheliegenderweise nicht nur eine physische, sondern auch eine psychische Seite hat, ist dies auch nicht weiter verwunderlich. (Vgl. Wolf, 1992, S. 11, Ryder, 1989, S. 330 f., 1992b, S. 171 f.)
Wie beim Schmerz muß auch hier darauf hingewiesen werden, daß Tiere unter vergleichbaren Situationen unter Umständen sogar mehr leiden als Menschen. Dies vor allem aufgrund ihrer geringeren lnformations-, Kommunikations- und Reflexionsmöglichkeiten. (Vgl. Masson / Mc-Carthy, 1996, S. 312 f., 318 f.) Zwei Beispiele:
Ein Mensch, der im Krankenhaus operiert werden soll, weiß, zumindest grundsätzlich und ungefähr, warum und wie dies geschehen soll. Vor allem weiß er, daß es zu seinem Vorteil geschieht, daß jetzige vorübergehende Unannehmlichkeiten notwendig sind, damit es ihm später wieder besser geht. Einem Tier, das gefangen wird, um einer Heilbehandlung zugeführt zu werden (zugegebenermaßen ein seltener Fall: Meist werden Tiere für ganz andere Zwecke eingefangen!), kann man diese Zusammenhänge nicht erklären. Es erlebt die gleichen Todesängste wie ein Tier, das gefangen wird, um getötet zu werden. (Vgl. Singer, 1994, S. 88 f., Höffe, 1984, S. 85 f., zit. n. Teutsch, 1987, S. 264)
Zweites Beispiel: Ein eingesperrter Mensch kann die Zeit, wo er wieder frei sein wird, vorwegnehmen und daraus Trost schöpfen. Bei einem eingesperrten Tier ist hingegen sein gesamter geistiger Horizont vom gegenwärtigen Gefangensein ausgefüllt. (Vgl. Rollin, 1981, S. 33)
Den Zusammenhang zwischen verminderter Denkkapazität und erhöhter Leidensintensität kennt im übrigen jeder aus eigener Erfahrung: ln „schlaflosen Nächten“ wälzen wir oft „unlösbare Probleme“, die wir später im Wachzustand und Vollbesitz unserer geistigen Kräfte mühelos bewältigen können. Hier besteht eine interessante Parallele zur psychoanalytischen Neurosentheorie: Konflikte, die wir als Kinder wegen Unbewältigbarkeit verdrängen mußten, können wir als Erwachsene aufgrund unseres höheren lnformationsstandes und erweiterten Denkvermögens zulassen und lösen.
Nicht vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch die menschliche Fähigkeit, Leiden durch Sinngebung erträglicher zu machen. Auf diesen Umstand weist insbesondere Robert Spaemann hin: „Gerade, weil Tiere ihr Leiden nicht in die höhere Identität eines bewußten Lebenszusammenhangs integrieren (…) können, sind sie dem Leiden ausgeliefert. Sie sind sozusagen im Schmerz nur Schmerz.“ (1984, S. 78) „Auf dem Weg in die Gaskammern Psalmen singen – das kann kein Tier. Es ist der dumpfen Angst sprachlos ausgeliefert, und seine Angst ist fast immer Todesangst.“ (1979, zit. n. Teutsch, 1987, S. 264)
Nun, wie angekündigt, ein paar Bemerkungen zur evolutionären Kontinuität – die für alle Darstellungen und Erwägungen im Hinblick auf Ähnlichkeiten zwischen Menschen und Tieren von großer Bedeutung ist. Evolutionäre Kontinuität besagt, daß die Unterschiede zwischen Spezies eher gradueller denn grundsätzlicher Natur sind. (Bekoff, 2008, S. 14) Diese Kontinuität bezieht sich nicht nur auf die anatomischen Strukturen (von Herzen, Nieren, Zähnen usw.), sondern auch auf geistige und emotionale Fähigkeiten. Mit anderen Worten: Die Wurzeln unserer eigenen Intelligenz und Emotionen finden wir in anderen Tieren. „Die Ähnlichkeiten und Kontraste verschiedener Arten sind Nuancen oder Schattierungen von Grau, keine Schwarz-Weiß-Unterschiede.“ (Ebenda, S. 55; vgl. Wild, 2013, S. 33 ff., 54) Marc Bekoff (2001, S. 54) veranschaulicht die evolutionäre Kontinuität mit folgendem Vergleich: Auch die Unterschiede zwischen einem Rolls Royce und einem Ford sind gradueller, nicht prinzipieller Natur, denn beide sind Autos.
1.1.4 Intelligenz
Es ist nicht ganz einfach, kurz und plausibel darzulegen, daß Tiere über eine so komplexe Eigenschaft wie Intelligenz verfügen. Praktische Beispiele eignen sich hierzu meines Erachtens besser als theoretische Ausführungen. Daher möchte ich gleich mit der Schilderung einiger einschlägiger „Fälle“ beginnen. Der erste mag als Beleg für tierliche Intelligenz verzichtbar erscheinen. Ich bringe es aber dennoch nicht übers Herz, ihn den Leserinnen und Lesern vorzuenthalten. Erstens wird er von niemand geringerem als Charles Darwin (1966, S. 84) berichtet, zweitens finde ich ihn einfach köstlich:
„Am Kap der Guten Hoffnung hatte ein Offizier einen Pavian häufig geneckt. Als das Tier ihn nun eines Sonntags zur Parade ankommen sah, goß es Wasser in eine Vertiefung im Boden, bereitete schnell einen schmutzigen Schlamm und warf ihn zum Ergötzen vieler Zuschauer geschickt auf den vorübergehenden Offizier. Noch lange Zeit danach freute sich der Affe mit höhnischem Grinsen, wenn ihm sein Opfer wieder zu Gesicht kam.“
Vitus Dröscher (1987a, S. 99 f.) berichtet folgendes:
„Einen richtigen Lausejungenstreich leistete sich ein kanadisches Biberkind. Allmorgendlich zur gleichen Zeit wurde es mitsamt seinen Eltern, Anverwandten und älteren Geschwistern von einer Farmersfrau gefüttert. Da der vierbeinige Lümmel den anderen immer die besten Leckerbissen wegschnappen wollte, erschien er stets als erster an der Futterstelle.
Eines Tages aber hatte er die Zeit verbummelt, und als er aus dem Wasser sprang, drängten sich schon alle erwachsenen und größeren Biber um den Trog. Da lief der Kleine zum Fluß zurück und klatschte mit dem breiten Ruderschwanz dreimal hastig auf das Wasser. Das ist in der Bibersprache das Alarmsignal für höchste Gefahr. Wie der Blitz waren alle anderen Biber von der Bildfläche verschwunden, und der Frechdachs hatte das Futter für sich allein. (…)
Überlegen wir einmal, was zu dieser ‚Leistung‘ des kleinen Bibers alles gehört: Einmal mußte er das Alarm- und Schrecksignal geben, ohne tatsächlich einen Schreck vor einem Raubtier bekommen zu haben. Er mußte sich also aus den Fesseln reinen lnstinktverhaltens befreien und sein Handeln mit einer Absicht verbinden. Das gelang nur durch einen Akt der Selbstbetrachtung, der Reflexion: Er mußte wissen, wie seine Taten auf andere wirken, um sie hinters Licht zu führen.“
Über einen Rhesusaffen im New Yorker Bronx Zoo berichtet Dröscher (ebenda, S. 100 f.):
„Eines Tages war der gewitzte Kerl vom großen Affenfelsen verschwunden, und es dauerte einige Tage, bis man ihn in einem Park gefunden und wieder eingefangen hatte. Die Umzäunung, der Wassergraben und überhaupt alles wurde überprüft. Nirgends war eine Fluchtmöglichkeit zu entdecken. Aber am nächsten Morgen war der Ausreißer wieder weg.
Erneut übte sich ein Polizeiaufgebot im Tierfang. Und dann legte sich ein Wärter auf die Lauer, um dem Affen auf die Schliche zu kommen. ln früher Morgendämmerung sah er endlich, wie das Tier aus einem Versteck eine Banane holte. Diese milde Besuchergabe hatte er extra für seinen Ausbruchplan zurückbehalten. Er lief damit zu dem breiten Wassergraben, der an das Elchgehege grenzt, und schwenkte die Banane gut sichtbar hin und her – genauso wie ein Wissenschaftler, der mit einer hinterlistigen Futterbelohnung ein Versuchstier zu irgendeiner Tätigkeit bewegen will.
Tatsächlich schwamm einer der großen Elche zu dem-Rhesusaffen heran. Schnell steckte ihm der ebenso schlaue wie wasserscheue Kerl die Banane ins Maul, als Fahrkarte sozusagen, sprang auf den breiten Rücken und ließ sich mit diesem, Fährschiff‘ ins Nachbargehege übersetzen. Von hier aus war die Flucht dann nur noch ein Affenkinderspiel.“
Schließlich noch eine Geschichte von Pavianen (ebenda, S. 101 f.):
„lm Freigehege eines Zoos schwang sich das stärkste Männchen zum Sultan auf und verbot allen anderen Männchen intimen Umgang mit seinen ‚Damen‘. Ja, er duldete nicht einmal den kleinsten Flirt. Doch konnte der Gefürchtete nicht immer und überall aufpassen. Hielt er einmal irgendwo im Schatten eines Felsens ein Schläfchen, konnte es schon geschehen, daß die Damen fremdgingen, ja sie legten es geradezu darauf an. Eine Haremsdame, die von ihrem Sultan längere Zeit vernachlässigt worden war, fing bei solch günstiger Gelegenheit unter Zurschaustellen all ihrer Reize ganz unverhohlen an, einen Junggesellen kirre zu machen.
ln just diesem Augenblick erschien der Sultan wieder, und nun geschah das Unglaubliche: Als sei sie von einem Mörder bedroht, schrie die Seitenspringerin auf, riß sich los, gab dem eben noch Umworbenen eine Ohrfeige, floh laut jammernd in die Arme des verblüfften Sultans und ‚beschwerte‘ sich bei ihm, indem sie mit wütenden Gurgellauten böse zu dem von ihr Verführten hinüberschaute und mit den Armen auf die Erde trommelte. Und sie erreichte ihr Ziel: Der Sultan, der bei unerlaubten lntimitäten für gewöhnlich nur das Weib bestrafte, glaubte diese abgefeimte Lüge. Erst vermöbelte er den schuldlosen Junggesellen ganz gehörig, und dann überhäufte er die ‚Leidgeprüfte‘ mit Zärtlichkeiten.“
Vorangehende Beispiele von Vitus Dröscher habe ich auch in meinem Buch „Leichenschmaus“ (Kaplan, 1993a) als Belege für tierliche Intelligenz angeführt. Dies wurde (von Rippe, 1994, S. 137) mit „Verwunderung“ registriert, handle es sich doch bei Dröscher um einen so „menschelnden Popularautor“. Das ist eine vornehme Umschreibung für den Totschlagvorwurf Anthropomorphismus, also Vermenschlichung: Von ganzen Forschergenerationen wurde tierliches Bewußtsein und tierliche Intelligenz mit dem gebetsmühlenartig wiederholten Hinweis vom Tisch gefegt, hier handle es sich um eine unzulässige Vermenschlichung der Tiere, in Wirklichkeit beruhe tierliches Verhalten, das wir naiverweise als bewußt oder intelligent betrachten, auf bloßem Instinkt, stupidem Lernen oder reinem Zufall.
Dazu zweierlei: Erstens gibt es etwas ungleich Schlimmeres als Vermenschlichung, nämlich das Gegenteil: Verdinglichung. Solange leidensfähige Wesen in Tierfabriken und Versuchslabors wie gefühllose Roboter behandelt werden, ist es eine unerträgliche Unverschämtheit und Frivolität, das Wort „Anthropomorphismus“ auch nur in den Mund zu nehmen!
Zweitens können jene wackeren Forscher und Philosophen, denen die Sorge um wissenschaftliche Objektivität schlaflose Nächte bereitet, von ihren Seelenqualen erlöst werden: Die Feststellung, daß Tiere über Bewußtsein und Intelligenz verfügen, entspringt nicht dem naiven Wunschdenken sentimentaler Tierfreunde, sondern ist inzwischen eindeutiges Ergebnis nüchterner Forschung.
So hat etwa die bekannte Zoologin und Dozentin für Verhaltensbiologie an der Universität Oxford Marian Stamp Dawkins (1994) mit ihrer Studie „Die Entdeckung des tierischen Bewußtseins“ eine Arbeit vorgelegt, die an Logik und Stringenz nichts zu wünschen übrig läßt. Zunächst fahndet die Autorin gewissenhaft nach allen möglichen Voreiligkeiten, Nachlässigkeiten und anderen Fehlern, die beim Schließen auf tierliches Bewußtsein und tierliche Intelligenz passieren können. Dabei wendet sie stets das methodische Prinzip des Ockhamschen Messers an, wonach wir stets die einfachste, plausibelste Erklärung annehmen sollen.
Ein Beispiel soll diesen Grundsatz verdeutlichen: Wenn ich am Morgen im Postkasten einen Brief vorfinde, ist es sinnvoll anzunehmen, daß ihn der Briefträger hineingelegt hat. Theoretisch sind natürlich auch andere Erklärungen möglich. Etwa diese: In der Nacht ist ein UFO vor dem Haus gelandet, dem ist ein grünes Marsmännchen entstiegen, das den Postkasten mittels mentaler Kräfte geöffnet und dann den Brief hineingelegt hat.
Solange es die einfachere, plausiblere Erklärung mit dem Briefträger gibt, sollten wir entsprechend dem Ockhamschen Messer auch bei dieser bleiben, anstatt die zwar logisch mögliche, aber doch ziemlich unwahrscheinliche Marsmännchen-Version in Erwägung zu ziehen. Aufgrund des systematischen und konsequenten Aussonderns unwahrscheinlicher Erklärungen gelangt Dawkins schließlich zu tierlichen Verhaltensphänomenen, bei denen Bewußtsein und Intelligenz die einfachste Erklärung darstellen.
Erfreulicherweise können wir diese Methode anhand eines Beispieles veranschaulichen, das dem letzten – mit Anthropomorphismus-Verdacht versehenen – Dröscher-Beispiel nicht unähnlich ist:
„Hans Kummer, der viele Jahre lang Paviane erforschte, beschrieb einen Fall, bei dem sich alle Mitglieder des Trupps, den er gerade beobachtete, ausruhten. Dann verlagerte eines der Weibchen innerhalb von 20 Minuten nach und nach seine Position über zwei Meter hinweg, so daß es schließlich hinter einen Felsen gelangte, wo es begann, einem halberwachsenen Männchen das Fell zu pflegen. Hätte das dominante Männchen der Gruppe das gesehen, hätte es die beiden angegriffen, doch von der Stelle, an der es saß, konnte es nur den Schwanz, den Rücken und den oberen Teil des Kopfes des Weibchens sehen. Seine Vorderseite und seine Hände waren für das dominante Männchen unsichtbar, ebenso das junge Männchen, das sich hinter den Felsen gekauert hatte. Mit anderen Worten, das erwachsene Männchen sah zwar, wo das Weibchen war, aber nicht, was es tat.“ (Dawkins, 1994, S. 178 f.)
Natürlich könnte das Verhalten des Pavianweibchens auch als das Ergebnis eines reinen Lernvorgangs ohne jegliche Einsicht oder Intelligenz gedeutet werden: Es hat im Laufe der Zeit gelernt, daß man nur dann etwas in Ruhe machen kann, wenn man sich hinter einen Felsen zurückzieht. Dies hat das Tier vielleicht irgendwann zufällig entdeckt. Jetzt wendet es diese „Taktik“ eben immer wieder an. Mit Planung oder der Absicht, das „betrogene“ Tier zu täuschen, hat dies alles nichts zu tun. (Ebenda, S. 179)
Zwei Dinge sprechen aber klar gegen diese Interpretation: Erstens passierten solche Täuschungsmanöver nicht ständig, sondern waren seltene Ereignisse – eingestreut zwischen „normalem“, „echtem“ Verhalten ohne Täuschung. Hätte das Pavianweibchen einfach ohne jegliche Einsicht einen „Trick“ gelernt, würden wir annehmen, daß es diesen dauernd anwendet und nicht nur ab und zu. (Ebenda, S. 179 f.)
Zweitens und vor allem ist da die extrem langsame Bewegung zum Felsen hin. Hätte das Pavianweibchen einfach stur gelernt, daß die einfachste Methode, um nicht vom dominanten Männchen verjagt zu werden, darin besteht, sich hinter einem Felsen zu verstecken, dann würden wir doch annehmen, daß es sich direkt dorthin begibt und sich nicht während einer Dauer von zwanzig Minuten buchstäblich zentimeterweise hinschmuggelt! (Ebenda, S. 180)
Letzteres verwundert hingegen überhaupt nicht, wenn wir annehmen, daß das Weibchen erkannt hat, daß es vom Männchen beobachtet wird, und nun absichtlich versucht, dieses zu täuschen. Dafür spricht auch die Position des Weibchens hinter dem Felsen: der Hinterkopf war für das Männchen sichtbar, nicht aber Gesicht und Hände. So wußte das Männchen, daß das Weibchen in der Nähe war, sah aber nicht, was es „Verbotenes“ tat. (Ebenda)
„Dies ließe sich zwar als komplizierter Lernprozeß erklären (das Weibchen hatte sich gemerkt, daß es gejagt wird, wenn es nicht eine bestimmte Position zum Felsen einnimmt). Die einfachste Erklärung lautet jetzt aber: Das Weibchen wußte, was das Männchen reizt, und täuschte es daher absichtlich, indem es versuchte, seine Bewegungen auf den Felsen zu so unauffällig wie möglich zu machen. Als es dann hinter dem Felsen angelangt war, versuchte es, sein Tun vor dem Blick des Männchens zu verbergen. (…) Ockhams Messer favorisiert in diesem Fall wirkliche Einsicht, beziehungsweise Intelligenz.“ (Ebenda, S. 180 f.)
Zum gleichen Ergebnis kämen wir übrigens bei Anwendung von „Morgans Kanon“, einem anderen methodischen Prinzip. Es richtet sich gegen naiv anthropomorphisierende, also vermenschlichende Deutungen tierlichen Verhaltens. C. Lloyd-Morgan, ein britischer Psychologe und Verhaltensforscher, stellte 1894 folgende Forderung auf: Wir sollten eine Handlung nicht als Ergebnis eines höheren geistigen Vermögens interpretieren, wenn sie auch als Ergebnis eines „geistig niederstufigeren“ Vermögens interpretiert werden kann. (Perler / Wild, 2005, S. 16 f., Wild, 2013, S. 74–79) Ein mögliches Ergebnis der Anwendung dieser Methode ist freilich auch, daß, wie beim listigen Pavianweibchen, eine Handlung verünftigerweise nur durch ein „geistig höherstufiges“ Vermögen erklärt werden kann.
Berichte über Täuschungsmanöver bei Affen sind Legion. (Z. B. Blick zurück, 1988, S. 210 f., Gnadenlose Geduld, 1994, S. 215, Barth, 1992, S. 266 ff). Aber auch von anderen Tieren werden erstaunliche Intelligenzleistungen berichtet. Etwa von Schweinen (Comstock, 1992, S. 122 f., Schweine!, 1996, S. 14 ff.), Delphinen (Scheub, 1989, S. 30 f.), Tintenfischen („Sehr alt, sehr klug“, 1997, S. 150 ff.), Vögeln im allgemeinen (Clifton, 1990, S. 19–24) und Hühnern im besonderen (Robbins, 1989, S. 12 ff.) sowie von Würmern (Rachels, 1991, S. 134 f.). Für einen Überblick über die Intelligenzforschung in bezug auf Tiere siehe Linden, 1994, S. 22 ff.
In bezug auf die Manifestationen tierlicher Intelligenz sind vor allem die Bereiche Kommunikation und Werkzeuggebrauch bedeutsam. Über „Unerhörte Töne aus der Welt der Tiere“ berichtet Sy Montgomery (1992, S. 34 ff). Damit meint er zweierlei: die geradezu unglaublichen Kommunikationsleistungen, die Tiere vollbringen, und die Wahrnehmungskanäle, innerhalb derer diese Kommunikationen stattfinden. Ein Großteil der Verständigung unter Tieren erfolgt nämlich auf Wahrnehmungsebenen, die dem Menschen unzugänglich sind, so etwa im Infraschallbereich. Zur Kommunikation unter Tieren siehe vor allem auch das bereits erwähnte Buch „Die Supersinne der Tiere“ von John Downer (1990) sowie den Bericht „Ein Mensch kann sie um diese Vielfalt nur beneiden“ von Christian Quatmann (1990/91, S. 22–24).
Neben der Kommunikation ist, wie gesagt, auch der Werkzeuggebrauch ein wichtiger Beleg für tierliche Intelligenz. Auch hierzu exisiert eine Fülle von Berichten, zum Beispiel „Frühform des Heimwerkers“, 1997, S. 196, „Spinne am Haken“, 1996, S. 162 f., „Siegeszug aus der Sackgasse“ (II), 1995, S. 140, 145, und Goodall, 1994, S. 23.
Der Werkzeuggebrauch bei Tieren ist im übrigen noch aus einem anderen Grund ein interessantes Thema: Anhand dieses Merkmals lassen sich wie kaum irgendwo sonst die ebenso verzweifelten wie vergeblichen Versuche, die Sonderstellung des Menschen zu verteidigen, veranschaulichen. Volker Arzt und Immanuel Birmelin (1993, S. 290 f.) rekonstruieren die Demontage einer Illusion:
Lange Zeit galt der Gebrauch von Werkzeugen als exklusiv menschliches Merkmal. Doch dann entdeckte man, daß Galapagos-Finken mit kleinen Ästen nach Insekten stochern und Laubenpieper mit Rindenpinsel und Beerenfarbe ihre Laube ausmalen. Umgehend wurde umdefiniert: Nicht der Gebrauch von Werkzeug unterscheidet den Menschen von allen anderen Wesen auf Erden, sondern die Herstellung von Werkzeug.
Das war ja gerade noch einmal gutgegangen – bis man entdeckte, daß Brillenbären Stöcke zurechtbrechen, um damit Früchte vom Baum zu holen, und Schimpansen Zweige exakt so stutzen und zerfasern, daß sie eine optimale Termitenangel abgeben. Also wieder nichts mit der feinsäuberlichen Trennung der „Krone der Schöpfung“ vom Rest der Welt!
Eine weitere Kriteriumsverschärfung mußte her: Werkzeuggebrauch zur Werkzeugherstellung hieß die neue Zauberformel, um die Exklusivität des Clubs Homo sapiens zu retten. Doch der Zwergschimpanse Kanzi machte auch einen Strich durch diese Rechnung:
Er beobachtete, wie seine Lieblingsspeise in eine Schachtel gegeben und diese versperrt wurde. Weiter sah er, daß der Schlüssel in einer zweiten Schachtel deponiert und diese mit reißfestem Band verschnürt wurde. Kanzi erinnerte sich an einige Flintsteine, die er einmal während eines Ausflugs gefunden und mitgenommen hatte. Diese zertrümmerte er nun auf hartem Zementfußboden und wählte aus den so entstehenden Stücken einen besonders handgerechten und scharfen Splitter aus. Mit diesem „Messer“ durchschnitt er nun die Verschnürung der Schlüsselbox und öffnete mit dem sich darin befindenden Schlüssel die Leckerbox. „Kanzi hatte mit Bedacht Steine und Zementuntergrund eingesetzt, um sich ein Werkzeug herzustellen, mit dem er sich ein anderes Werkzeug verschaffen konnte, um es gezielt einzusetzen“ (S. 291).
Nachdem sich somit auch das Kriterium Werkzeuggebrauch zur Werkzeugherstellung als untaugliches Mittel zur Abgrenzung des Menschen von allen anderen Wesen erwiesen hatte, wurde der Versuch, die menschliche Einzigartigkeit über den Umgang mit Werkzeug zu definieren, schließlich aufgegeben. (Ebenda)
Als nächstes mußte, wie Frans de Waal (2013, S. 247) die Fortsetzung der unendlichen Ab- bzw. Ausgrenzungsgeschichte humorvoll-resignativ erzählt, die Sprache herhalten – zunächst als symbolische Kommunikation definiert. Als man erkennen mußte, daß Menschenaffen Zeichensprachen erlernen können, ließ man die Sache mit den Symbolen fallen und setzte auf die Syntax. De Waal ebenso treffend wie anschaulich: „Des Menschen besondere Stellung im Universum beruht auf widerrufenen Behauptungen und ständig versetzten Torpfosten.“ Die aktuellen Einzigartigkeitshoffnungen ruhen übrigens auf der sogenannten „Theorie des Geistes“. (Ebenda; dazu später mehr.)
Ein so komplexes Phänomen wie Intelligenz läßt sich nur schwer isoliert darstellen. Insbesondere ist Intelligenzverhalten untrennbar verknüpft mit Sozialverhalten (was vor allem im Bereich Kommunikation deutlich wird). Dieser engen Verbindung zwischen Intelligenz und Sozialleben werden wir im nächsten Abschnitt noch Rechnung tragen.