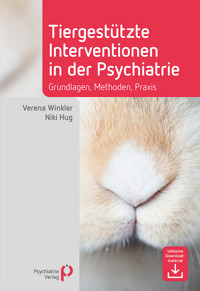
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Psychiatrie Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Fachwissen
- Sprache: Deutsch
Damit Tiere ihre therapeutische Wirkung voll entfalten können, ist es wichtig, sie gut lesen zu können und für ihr Wohlbefinden zu sorgen. Die Beispiele im Buch handeln nicht wie sonst oft von Hunden und Pferden, sondern von Schafen, Ziegen oder Kaninchen, die eingesetzt werden, um Heilungsprozesse bei ganz unterschiedlichen Diagnosen anzustoßen. Durch den Umgang mit Tieren wird das Erleben von Vertrauen, Empathie und Wertschätzung in der therapeutischen Beziehung unterstützt. Patient*innen fühlen sich kompetent und spüren auch ihre körperliche Belastbarkeit und Handlungsfähigkeit. Für tiergestützte Interventionen braucht es nicht zwingend eine eigene Abteilung oder Einrichtung, aber Fachwissen, das in diesem Buch vermittelt wird. Psychiatrisch Tätige aller Professionen werden so ermutigt, den Einsatz von Tieren in bestehende Konzepte zu integrieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Verena Winkler, Niki Hug
Tiergestützte Interventionen in der Psychiatrie
Grundlagen, Methoden, Praxis
Verena Winkler, Sozialpädagogin HF, CAS-Weiterbildung in tiergestützter Therapie Universität Basel, arbeitet als Leiterin der Naturnahen Therapien in den Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) in Basel.
Niki Hug, Psychologie MSc & Health Sciences MA, arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Bildung, Forschung und Entwicklung der UPK Basel für den Medizinisch-Therapeutischen Dienst.
Downloadmaterialien
Angebote
Tiergestützte Therapien in der DACH-Region
Dokumentation
Identifikation des Tieres (Herkunft, Merkmale etc.)
Behandlungsjournal des Tieres
Intervention
Hühner – Eigenschaften und Interventionsmöglichkeiten
Meerschweinchen – Eigenschaften und Interventionsmöglichkeiten
Kaninchen – Eigenschaften und Interventionsmöglichkeiten
Katzen – Eigenschaften und Interventionsmöglichkeiten
Ziegen – Eigenschaften und Interventionsmöglichkeiten
Schafe – Eigenschaften und Interventionsmöglichkeiten
Checkliste einer Interaktion
Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung
Interaktionsbeispiele
Interaktion mit Schaf und Ziege
Schafherde auf die Weide führen
Mit Ziegen spazieren gehen
Das Passwort finden Sie auf Seite 124.
Abkürzungsverzeichnis
AAII Animal Assisted Intervention International
ESAAT European Society for Animal-Assisted Therapy
IAHAIO International Association of Human-Animal Interaction Organizations
IEMT Institut für Interdisziplinäre Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung
ISSAT International Society for Animal-Assisted Therapy
TGA Tiergestützte Aktivitäten
TGC Tiergestütztes Coaching
TGI Tiergestützte Intervention
TGP Tiergestützte Pädagogik
TGT Tiergestützte Therapie
TGF Tiergestützte Förderung
UPK Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
es freut mich außerordentlich, Ihnen dieses besondere Buch vorstellen zu dürfen. Zu Tieren pflegen Menschen seit langer Zeit eine besondere Beziehung und ihr Einsatz als therapeutische Unterstützung gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Verena Winkler und Niki Hug schaffen es mit viel Herzblut und Expertise, ihre Leser*innen auf eine besondere Reise einzuladen – eine Reise in die Welt der tiergestützten Therapie, die in der psychiatrischen Klinik Bestandteil der multimodalen stationären Behandlung ist. Dieses Buch ist mehr als nur eine Sammlung wissenschaftlicher Fakten und persönlicher Geschichten; es ist eine Herzensangelegenheit, die die heilende Kraft der Natur und ihrer Geschöpfe beleuchtet. Neben einem umfangreichen Überblick über die Geschichte der tiergestützten Therapie und konkreten Beschreibungen verschiedener Tierarten und Methoden wird dies insbesondere durch Fallbeispiele, aber auch durch Beschreibungen der Behandlung einzelner psychiatrischer Erkrankungen vermittelt.
In einer Zeit, in der unser Alltag oft von Hektik und Stress geprägt ist, nehmen psychische Erkrankungen zu. Daher suchen viele Menschen nach Wegen, um zur Ruhe zu kommen und Heilung zu finden. Tiergestützte Therapie bietet bei körperlichen wie auch seelischen Erkrankungen genau dies: eine intensive und positiv besetzte Unterstützung, die Körper, Geist und Seele anspricht. Besonders positiv finde ich, dass hier (neben den häufig eingesetzten Tieren Hund und Pferd) der Schwerpunkt auch auf den Einsatz sogenannter »Bauernhoftiere« gelegt wurde. Denn auch Kaninchen, Meerschweinchen, Schafe, Ziegen, Hühner und viele mehr haben einzigartige Fähigkeiten, Menschen zu berühren, positive Veränderungen herbeizuführen und so den Genesungsweg zu unterstützen.
Dieses Buch bietet Laien und Fachpersonen einen umfassenden Einblick in die Praxis und Wirkungsweise der tiergestützten Therapie. Es basiert auf neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, praktischen Erfahrungen und berührenden Geschichten von Menschen, die durch die Interaktion mit Therapiebegleittieren zu einer neuen Lebensqualität gefunden haben. Ich wurde beim Lesen immer wieder an Geschichten von und mit eigenen Patient*innen erinnert, die ich in meiner Zeit in psychiatrischen Kliniken und Praxen begleiten durfte. Zahlreiche Dankeskarten und Geschenke an die eingesetzten Therapiebegleittiere zeugen von der Begeisterung für dieses Therapieverfahren.
Im Buch erfährt man detailliert, wie die unterschiedlichen Tiere in der Klinik eingesetzt werden, welche besonderen Fähigkeiten sie mitbringen und welche erstaunlichen Fortschritte bei verschiedenen Zielgruppen erreicht werden. Dabei wird immer wieder auch auf die wichtige Rolle der Therapeut*innen eingegangen, die mit viel Empathie und Fachwissen die therapeutischen Prozesse begleiten.
Ein besonderes Augenmerk wird in diesem Buch auch auf das Wohl der Tiere gelegt. Es ist von größter Bedeutung, dass Tiere artgerecht gehalten und mit Respekt behandelt werden. Eine tiergerechte Haltung und ein achtsamer Umgang sind unerlässlich, damit die Tiere ihre therapeutische Wirkung voll entfalten können und dabei selbst gesund und glücklich bleiben. Hierzu ist es wichtig, die eingesetzten Tiere gut lesen zu können, um ihr Wohlbefinden nicht zu gefährden.
Leonardo da Vinci soll gesagt haben: »Die Sprache der Tiere ist begrenzt, aber was sie damit zum Ausdruck bringen, ist wichtig und nützlich«. In diesem Buch lernen wir viel über den Ausdruck der verschiedenen Tierarten (aber auch einzelner Tiere) und wie reichhaltig die Kommunikation untereinander und mit den Menschen ist.
Verena Winkler und Niki Hug gelingt es mit Leichtigkeit, die besondere Beziehung zwischen Mensch und Tier zu würdigen. Eine Beziehung, die geprägt ist von Vertrauen, Respekt und gegenseitiger Zuwendung. Sie lehrt uns Achtsamkeit, Geduld und das einfache Glück, das in der Verbindung mit einem Lebewesen liegt.
Ich hoffe, dass Sie dieses Buch inspiriert und neue Perspektiven eröffnet. Möge es Ihnen helfen, die heilende Kraft der Tiere im therapeutischen Kontext zu entdecken und zu verstehen, wie sie sich vielfältig, individuell und gesundheitsfördernd in den Begegnungen im klinischen Kontext entfaltet.
Kreuzlingen, Februar 2025
Ann-Kristin Hörsting
Einführung
In psychiatrischen Kliniken werden Menschen mit unterschiedlichen Krankheitsbildern in erster Linie mit Psychotherapie, Pharmakotherapie und störungsspezifischen Therapien behandelt. Im Bereich der psychosozialen Therapien empfehlen die S3-Leitlinien der DGPPN die Ergotherapie, Künstlerische Therapien und Bewegungs- und Sporttherapien. Naturnahe Therapien wie die Gartentherapie oder die tiergestützte Therapie werden in den Leitlinien der DGPPN nicht erwähnt.
Gleichzeitig gewinnen Tiere in verschiedenen gesundheitsbezogenen Institutionen in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. Mehrere Studien zeigen, dass Tiere und Natur eine positive Wirkung auf den Gesundungsprozess von ganz unterschiedlichen Erkrankungen haben können. Gut untersucht und in der Praxis etabliert ist die tiergestützte Arbeit mit Pferden und Hunden. Es gibt auch Belege dafür, dass Katzen eine allgemein positive Wirkung auf unsere Gesundheit haben. Insgesamt ist die wissenschaftliche Befundlage jedoch noch unzureichend, um sich ein abschließendes Urteil über die Wirkweisen und Effekte von tiergestützter Therapie bilden zu können. Insbesondere bei Kleintieren wie Kaninchen, Meerschweinchen, Hühnern sowie größeren Tieren wie Schafen und Ziegen sind tiergestützte Interventionen noch wenig untersucht und verbreitet. In den UPK Basel arbeiten wir dagegen erfolgreich mit Kleintieren sowie Schafen und Ziegen.
In unterschiedlichen psychiatrischen Kliniken sowie in den Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel werden Hunde in psychotherapeutischen Settings eingesetzt und teilweise auch Einsätze durch ein externes Sozialhundeteam organisiert. Zudem können in Basel Hunde in der Privatklinik und in der Klinik für Erwachsene nach Absprache mit auf die stationären Abteilungen genommen werden, ebenso kann das Personal seinen Hund mitführen, insofern die Vorgesetzten und das Team damit einverstanden sind und eine entsprechende Ruhezone für das Tier eingerichtet werden kann. Auf zwei Abteilungen leben Katzen, die Abwechslung in den Alltag der Patient*innen bringen und sich frei auf dem Gelände der Klink bewegen.
Als Fachkraft für tiergestützte Therapien ist es wichtig, auch die Bedürfnisperspektive des Tieres aufzuzeigen. Dabei sind die artgerechte Haltung, die Empfehlungen des Tierschutzes sowie die Definitionen für tiergestützte Interventionen und die internationalen Richtlinien für das Wohlbefinden der beteiligten Tiere zu berücksichtigen.
Wenn das Tier sich wohlfühlt und den Raum erhält, sein arttypisches Verhalten zu leben, sein Charakter und seine Begabungen wahrgenommen werden, kann es seine Wirkung entfalten. Werden die Bedürfnisse beider geachtet, gelingt der Dialog zwischen Mensch und Tier. Für den Menschen wirkt sich der direkte Kontakt mit dem Tier und der fürsorgliche Umgang mit ihm gesundheitsfördernd aus.
Anhand von anonymisierten Fallbeispielen zeigen wir, wo Widerstände entstanden sind und wo positives Erleben möglich wurde. In der Arbeit mit Lebewesen müssen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Wie sehen diese aus? Worauf muss die Fachkraft achten? Diese Fragen werden wir beantworten. Und wir werden Abläufe aufzeigen, die sich bewährt haben.
Die Erfahrungen aus der Praxis werden mit wissenschaftlichen Erkenntnissen ergänzt und verknüpft. Dazu werden zunächst die wichtigsten Modelle und Konzepte vorgestellt und ein Überblick zum aktuellen Wissensstand gegeben.
Danksagung
An dieser Stelle möchten wir den vielen Personen danken, welche uns auf dem Weg zur Verwirklichung dieses Buches tatkräftig unterstützt haben:
Karin Koch vom Psychiatrie Verlag, welche uns während des gesamten Prozesses dieses Buchprojekts unterstützend, neugierig und geduldig zur Seite stand. Durch ihre Initiative ist das Buch entstanden.
PD Dr. sc. Dennis C. Turner und Dr. phil. Elisabeth Frick Tanner für das aufmerksame und interessierte Lesen unseres Manuskripts und die wertvollen Rückmeldungen und ermutigenden Worte.
Dr. med. Ann-Kristin Hörsting für das Verfassen des Vorworts und die anerkennenden Worte.
Nadine Pfaff für die zahlreichen und wundervollen Illustrationen.
Thomas Rosky der unser Manuskript gelesen korrigiert und mit unzähligen Ideen bereichert hat.
Unseren ehemaligen Patienten Basil und Manuel sowie den Patientinnen Melanie und Barbara für ihre aufschlussreichen Erfahrungsberichte und persönlichen Einblicke, welche sie uns mit ihren Beiträgen ermöglichen.
Petra Maria Kruger und Larissa Ganguin-Rimann, Andrea Jaggi und Katja Scholze, José Francisco Javier Márquez Barroso, Bettina Marti und Martina Hoby, Michael L. Pietzsch und seinen Kolleg*innen der Vincera Kliniken sowie Alexandra Schwetje, Romana Gill, Ramona Vökl-Simbeck, Christiane Degenhardt für die Beantwortung der Fragebögen und den wertvollen Einblick in unterschiedliche Praxisfelder der tiergestützten Therapie in der Schweiz, Deutschland und Österreich.
Tiergestützte Interventionen in der Psychiatrie
Das York Retreat, eine psychiatrische Klinik in England, wurde Ende des 18. Jahrhunderts von William Tuke und der Quäkergemeinschaft, der Society of Friends gegründet. Bekannt wurde diese Klinik, da Tuke mit dieser Institution den »unmenschlichen Irrenhäusern« ein Ende setzten wollte und Freundlichkeit und Toleranz in den Mittelpunkt rückte. Jede*r Patient*in wurde ermuntert, etwas Sinnvolles zu tun, wie Lesen, Schreiben oder Handarbeiten. Zu der Anstalt gehörten ein Garten und viele Kleintiere, welche die Patient*innen versorgen durften. In der Folge setzte sich das Modell von Tuke jedoch nicht durch und geriet in Vergessenheit.
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurde in Deutschland im Zentrum für Epilepsie in Bethel die Idee von Tuke, auf die heilenden Kräfte von Tieren zu vertrauen, aufgegriffen. Diese Versuche wurden jedoch nicht dokumentiert und blieben somit für die wissenschaftliche Forschung ohne Wert (Greiffenhagen & Buck-Werner 2012). Im Jahr 1942 wurde in New York das Army Air Force Convalescent Hospital für kriegsbeschädigte und -traumatisierte Soldaten gegründet. Auch hier wurden Tiere in der Psychotherapie eingesetzt. Enten und Wild konnten in einer natürlichen Umgebung beobachtet werden, Nutztiere wurden auf dem innerbetrieblichen Bauernhof von den Patient*innen versorgt. Nach Kriegsende wurde dieses Genesungskrankenhaus aufgelöst.
Die Anfänge der tiergestützten Intervention an den Universitären Psychiatrischen Kliniken (UPK) Basel liegen in den 1960er-Jahren, als der Klinikpark mit Kronenkranichen und Sikahirschen belebt wurde. Später wurden Pferde für die Reittherapie eingesetzt sowie Kaninchen, Wollschweine, Hühner und Ziegen für die Unterhaltung der Patient*innen angeschafft. Im Jahr 1999 wurde ein Tierhaus gebaut mit dem Ziel, Patient*innen in die Arbeit mit den Tieren einzubinden. Heute werden in den tiergestützten Interventionen verschiedene Bauernhoftiere gezielt eingesetzt. (Angebote tiergestützter Therapien in der DACH-Region finden Sie im Downloadbereich des Buches; den Zugangscode zu den Materialien finden Sie auf Seite 124.
Definition der tiergestützten Therapie
In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Formen des therapeutischen Einbezugs von Tieren zumeist unter dem Oberbegriff »Tiergestützte Interventionen« (engl. Animal-Assisted Interventions) zusammengefasst.
Die am weitesten verbreiteten Definitionen von tiergestützten Interventionen sind diejenigen der 1992 gegründeten International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO). Diesem Dachverband haben sich mittlerweile zahlreiche Organisationen aus aller Welt angeschlossen, die sich mit dem Thema Mensch-Tier-Beziehung beschäftigen. Die Schwerpunkte der einzelnen Organisationen liegen in den Bereichen Forschung, Praxis oder Ausbildung. Die IAHAIO hat ein Grundlagenwerk (engl. white paper) erstellt, in dem eine Terminologie für tiergestützte Interventionen festgelegt wurde. Das White Paper wurde in verschiedene Sprachen übersetzt und 2018 aktualisiert (IAHAIO 2018). Dieses Grundlagenwerk war eine Reaktion auf die zahlreichen und unterschiedlichen Terminologien, die weltweit zu den tiergestützten Interventionen kursierten. Neben der Festlegung von Terminologien und Definitionen enthält das Grundlagenwerk auch Richtlinien zur ethischen Praxis und zur Sicherstellung des Tierwohls.
Aktuell (Frühling 2024) erarbeiten verschiedene internationale Verbände, darunter die IAHAIO, die International Society for Animal Assisted Therapy (ISAAT) und die Animal Assisted Intervention International (AAII) Empfehlungen für neue Terminologien. Dies wird für die über 100 Mitgliedsorganisationen der IAHAIO mit einer Anpassungsfrist von zwei Jahren Änderungen mit sich bringen, wodurch alle Dokumente und Richtlinien angepasst werden müssen.
www.iahaio.org
Um die jeweils aktuellste Version der Terminologien und Definitionen einzusehen, empfehlen wir einen Abgleich mit der IAHAIO-Website.
Die IAHAIO-Definitionen haben grundsätzlich Vorschlags- bzw. Empfehlungscharakter und sind in ihrer Umsetzung von den lokalen Gegebenheiten abhängig. Im Folgenden sind die Definitionen von Tiergestützter Intervention, Tiergestützter Therapie und Tiergestützter Aktivität zitiert:
Tiergestützte Intervention (TGI): »Eine Tiergestützte Intervention ist eine zielgerichtete und strukturierte Intervention, die bewusst Tiere in den Bereichen Gesundheitswesen, Pädagogik und Sozialwesen (z. B. Soziale Arbeit) einbezieht und integriert, um therapeutische Verbesserungen bei Menschen zu erreichen. Tiergestützte Interventionen sind formale Ansätze, bei denen Teams von Mensch und Tier im Gesundheits- und Sozialwesen einbezogen werden und umfassen Tiergestützte Therapie (TGT), Tiergestützte Pädagogik (TGP), Tiergestütztes Coaching (TGC), unter bestimmten Voraussetzungen auch Tiergestützte Aktivitäten (TGA). Solche Interventionen sollten anhand eines interdisziplinären Ansatzes entwickelt und durchgeführt werden«. (IAHAIO 2018)
Tiergestützte Therapie (TGT): »Tiergestützte Therapie ist eine zielgerichtete, geplante und strukturierte therapeutische Intervention, die von professionellen, im Gesundheitswesen, der Pädagogik oder der Sozialen Arbeit ausgebildeten Personen angeleitet oder durchgeführt wird. Fortschritte im Rahmen der Intervention werden gemessen und professionell dokumentiert. Tiergestützte Therapie wird von beruflich (durch Lizenz, Hochschulabschluss oder Äquivalent) qualifizierten Personen im Rahmen ihrer Praxis innerhalb ihres Fachgebiets durchgeführt und/oder angeleitet. Tiergestützte Therapie strebt die Verbesserung physischer, kognitiver verhaltensbezogener und/oder sozio-emotionaler Funktionen bei individuellen Klienten an. Die Fachkraft, welche Tiergestützte Therapie durchführt (oder der Betreuer der Tiere unter Supervision dieser Fachkraft) muss adäquate Kenntnisse über das Verhalten, die Bedürfnisse, die Gesundheit sowie die Indikatoren und die Regulation von Stress der beteiligten Tiere besitzen.« (IAHAIO 2018)
Tiergestützte Aktivitäten (TGA): »TGA sind geplante und zielorientierte informelle Interaktionen/Besuche, die von Mensch-Tier-Teams mit motivationalen, erzieherischen-bildenden oder entspannungs- und erholungsfördernden Zielsetzungen durchgeführt werden. Die Mensch-Tier-Teams müssen mindestens ein einführendes Training, eine Vorbereitung und eine Beurteilung durchlaufen haben, um im Rahmen von informellen Besuchen aktiv zu werden. Mensch-Tier-Teams, die TGA anbieten, können auch formal und direkt mit einem professionell qualifizierten Anbieter von gesundheitsfördernden, pädagogischen oder sozialen Leistungen hinsichtlich spezifischer und dokumentierter Zielsetzungen zusammenarbeiten. In diesem Fall arbeiten sie im Rahmen einer Tiergestützte Therapie oder TGP, die von einer professionellen, einschlägig ausgebildeten Fachkraft in ihrem jeweiligen Fachgebiet durchgeführt wird. Beispiele für TGA umfassen tiergestützte Hilfe bei Krisen, die darauf abzielt, Menschen nach einer Traumatisierung, einer Krise oder Katastrophe Trost und Unterstützung zu geben oder auch einfache Tierbesuchsdienste für Bewohner von Pflegeheimen. Die Person, welche TGA durchführt, muss adäquate Kenntnisse über das Verhalten, die Bedürfnisse, die Gesundheit und die Indikatoren von Stress der beteiligten Tiere besitzen.« (IAHAIO 2018)
Tiergestützte Interventionen an den UPK Basel
Die tiergestützten Interventionen in den UPK orientieren sich an den Empfehlungen der IAHAIO. Qualifiziertes Gesundheitspersonal mit dem Abschluss in »Certificate of Advanced Studies (CAS) Tiergestützte Interventionen« leitet neue Mitarbeiter*innen an, wie sie mit Tieren und Menschen arbeiten können. Angelehnt an die Kriterien des IAHAIO haben wir Gruppen für störungsspezifische Krankheitsbilder und für den Wiedereinstieg in den beruflichen Alltag aufgebaut.
Die zeitliche Teilnahme richtet sich nach dem Befinden der Patient*innen, die Inhalte nach Indikation, Ressourcen und Möglichkeiten.
Die Mensch-Tier-Beziehung im Laufe der Geschichte
Betrachtet man die Beziehung zwischen Mensch und Tier in der Geschichte, so wird deutlich, dass Tiere immer schon eine Anregung für die menschliche Entwicklung dargestellt haben.
Tiere spielten in allen Kulturen eine bedeutende Rolle.
Bereits in den ersten Höhlenmalereien tauchen Tiere als Motive auf. Das Tier scheint ein immer wiederkehrender Begleiter des Menschen gewesen zu sein und seine Fantasien stark beeinflusst zu haben, wobei der Mensch das Tier sowohl geächtet als auch vergöttert hat. Der Wandel der gesellschaftlichen Stellung des Tieres und seiner Nutzung wird auch durch die soziale und kulturelle Entwicklung des Menschen beeinflusst. »Die Mensch-Tier-Beziehung kann somit nicht losgelöst von dem Gesamtkontext menschlicher Kultur und Gesellschaft gesehen werden.« (Olbrich & Otterstedt 2003, S. 15) Biologen und Verhaltensforscher weisen immer wieder auf die große Ähnlichkeit zwischen Tier und Mensch hin. Die Wissenschaften öffnen uns heute erneut die Augen für Verbindungen, die eine tiefe Gemeinschaft zwischen Tier und Mensch vermuten lassen (Greiffenhagen & Buck-Werner 2012).
Dass das Zusammenleben mit Tieren das Wohlbefinden und die Lebensfreude vieler Menschen steigert, wurde schon früh vermutet und bereits im 18. Jahrhundert von William Tuke (siehe Seite 21) in der klinischen Praxis umgesetzt. Später wurden Tiere auch während des Zweiten Weltkriegs in tiergestützter Psychotherapie bei traumatisierten Soldaten eingesetzt, insbesondere um deren Stimmung und Motivation zu verbessern (Greiffenhagen & Buck-Werner 2012). Eine systematische Erforschung und Dokumentation der Erkenntnisse blieb jedoch zunächst aus. Die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen zur Wirkung von Tieren auf Menschen, die bis heute dokumentiert sind, wurden in den 1960er-Jahren von dem amerikanischen Kindertherapeuten Boris Levinson durchgeführt. Der Fokus lag dabei auf der physischen, psychischen und sozialen Befindlichkeit des Menschen. Die damals von ihm publizierten positiven Wirkungen von Tieren auf den Menschen legten den Grundstein für den gezielten therapeutischen Einsatz in der Praxis und die weitere Forschung.
Das folgende Zitat von Erhard Olbrich gibt eine eindeutige Antwort auf die Frage, welche Bedeutung die Mensch-Tier-Beziehung für den Menschen hat:
» Die uralten, evolutionär bewährten Prinzipien des Zusammenlebens mit anderen Lebewesen sind für die Lebensgestaltung der Menschen im 21. Jahrhundert nach wie vor gültig. Sie prägen unser Leben ebenso wie die Kultur und das effiziente, nach wissenschaftlichen und technologischen Erkenntnissen geführte Leben. Wir sind auf eine Verbundenheit mit Tieren, mit dem gesamten belebten und unbelebten Kosmos angewiesen. Gehen wir aus dieser Verbundenheit heraus, dann reduzieren wir unsere Lebensmöglichkeiten, dann schränken wir unsere Gesundheit und unsere Lebensqualität selber ein. « (Otterstedt 2012, S. 10)
Die Biophilie-Hypothese
Die Biophilie-Hypothese wird häufig als theoretischer Ansatz herangezogen, um die Wirkungsweise von tiergestützten Interventionen zu erklären. Biophilie (griech. Bios, »Leben«, und philia, »Liebe«) heißt so viel wie »Liebe zum Leben« oder »Liebe zu allem Lebendigen«.
Die Verbundenheit mit Tier und Natur ist Teil des menschlichen Entwicklungsprozesses.
Der Soziobiologe Edward O. Wilson führte in seiner Biophilie-Hypothese aus, dass der Mensch seit der Frühzeit eine biologisch begründete Verbundenheit mit der Natur und anderen Lebewesen bildete, die ihn prägte und beeinflusste während seines evolutionären Entwicklungsprozesses. Vernooij und Schneider (2018) resümieren, dass diese Verbundenheit nicht einfach ein Instinkt ist, sondern die Komplexität von Verhalten, Gefühlen, geistigen Fähigkeiten, Ästhetik und sogar die spirituelle Entwicklung des Menschen umfasst. Der Wille zum Leben und die Fähigkeit, diesen auch in anderen Lebewesen zu sehen, zu respektieren und sich daran zu erfreuen, haben sich vermutlich als Überlebensvorteil erwiesen. Die Sinnesausstattung der Tiere ermöglicht es, Gefahren, insbesondere Umweltveränderungen, viel früher wahrzunehmen als der Mensch. Tiere signalisieren durch ihr Verhalten Entspannung oder Anspannung, Sicherheit oder Gefahr (Vernooij & Schneider 2018). Biophilie beinhaltet also nicht nur die positive Verbundenheit des Menschen mit der Natur und den Tieren, sondern auch negative Vermeidungssignale durch Gefahren, wie z. B. die Verbreitung der Angst vor Schlangen und Spinnen. Inzwischen hat sich die Technisierung und Urbanisierung unserer Umwelt erheblich verstärkt, während sich der Mensch dieser rasanten Entwicklung nur verzögert und ungenügend angepasst hat. Für eine persönliche, geistige oder emotionale gesunde Entwicklung wird es daher wieder notwendig, erneut die Verbundenheit mit der Natur und den Tieren zu suchen oder eine Beziehung zu einem Tier einzugehen (Olbrich & Otterstedt 2003).
Die Biophilieforschung hat sich lange Zeit auf die positive Beziehung zwischen Mensch, Tier und Natur konzentriert. In den Anfängen der wissenschaftlichen Untersuchungen stand im Vordergrund vor allem der Nutzen, den Menschen aus der Interaktion mit Tieren ziehen, oder die wohltuende Wirkung, die natürliche Landschaften auf den Menschen haben. Forschungen zur Wirkung der Natur auf den Menschen zeigen nicht erst beim Spaziergang durch Wiesen und Wälder positive Effekte auf die Zufriedenheit des Menschen. Am Arbeitsplatz reicht bereits der Blick durch das Fenster in die Natur, um das subjektive Wohlbefinden und die Produktivität am Arbeitsplatz zu steigern (Shin 2007). Im Rahmen der Biophilieforschung zu Tieren haben wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt, dass Kinder ein instinktives Interesse an lebenden Tieren haben, welches deutlich über das an bewegten, unbelebten Objektiven hinausgeht (DeLoache u. a. 2011). Die sogenannte Animal monitoring hypothesis besagt, dass Menschen als Folge unserer Evolution über speziell ausgebildete Aufmerksamkeitsprozesse verfügen, um lebende Tiere zu erkennen und zu beobachten (New u. a. 2007). Eine Studie mit Neugeborenen (Simion u. a. 2008) lässt vermuten, dass unser visuelles Wahrnehmungssystem bereits bei der Geburt eine Präferenz der Aufmerksamkeit für biologische Bewegungsmuster aufweist. Neuere Untersuchungen (Loucks u. a. 2023) deuten darauf hin, dass zusätzlich die Klasse des Tieres entscheidend dafür ist, wie schnell wir unsere Aufmerksamkeit auf ein Tier richten. Klasse bezieht sich hier auf eine Rangstufe in der hierarchischen Taxonomie nach Linné, die folgende Tierklassen unterscheidet: Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Insekten und Vögel. Die Untersuchungen von Loucks u. a. deuten darauf hin, dass Säugetiere im Vergleich zu den anderen Klassen (Vögel, Insekten, Reptilien, Amphibien) signifikant schneller erkannt werden. Die Forschung hierzu steht allerdings erst am Anfang. Die bisherigen Erkenntnisse zeigen jedoch, dass die Tierspezies in der Mensch-Tier-Beziehung und vor allem auch in tiergestützten Interventionen berücksichtigt werden muss und dies bereits bei basalen Aufmerksamkeitsprozessen beginnt.
Die Du-Evidenz als Voraussetzung sozialer Mensch-Tier-Beziehungen
» Da, wo der Respekt gegenüber dem Baum, der Pflanze, dem Tier fehlt, da verliert sich auch der Respekt gegenüber dem Menschen. Der Respekt gegenüber Leben entsteht vor allem aber in der persönlichen Begegnung mit dem Lebendigen: mit der Natur, dem Tier, letztlich mit dem Menschen, dem Du und dem eigenen Ich. « (Otterstedt 2015, S. 27)
Ähnliche Bedürfnisse und Emotionen sind die Grundlage der Mensch-Tier-Beziehung.
Die Du-Evidenz dient als ein weiterer Erklärungsansatz, um die Wirkungsweise tiergestützter Interventionen zu begründen. Sie basiert auf der Annahme, dass zwischen Menschen und höheren Tieren Beziehungen möglich sind, die den innerartlichen entsprechen. Voraussetzung ist eine gemeinsame Basis des gegenseitigen Verstehens und das Bedürfnis nach Nähe und Zuneigung. Meist geht die Initiative vom Menschen aus, es gibt aber auch Fälle, in denen sich Tiere einen Menschen als Du-Partner wählen (Greiffenhagen & Buck-Werner 2012). Dabei handelt es sich um ein subjektives Erleben, das weniger auf der kognitiven als vielmehr auf der sozio-emotionalen Ebene wirkt (Vernooij & Schneider 2018).
Maurice, ein elfjähriger Junge, wurde nach zwei notfallmäßigen Hospitalisationen und einem Suizidversuch mit Concerta in die Kinder- und Jugendpsychiatrie überwiesen. Bis dahin lebte er mit seinen berufstätigen Eltern und zwei Schwestern zusammen. Bei Schuleintritt wurde das Thema ADHS bekannt. Auf der Kinderpsychiatrischen Abteilung hatte er enorme Schwierigkeiten, sich anzupassen, er verfiel in große Passivität und Vermeidung und zeigte zunehmend ein depressives Verhalten.
Zu Hause hatte er eine Katze, die er vermisste. Als er die tiergestützte Therapie besuchte, zeigte er ein sensibles Einfühlungsvermögen im Umgang mit Tieren. Seine ganz besondere Zuneigung galt dem Kaninchen Niggi. In ihm fand er sein Gegenüber, Niggi wurde sein Freund. Er kannte und respektierte die Signale des Tieres und konnte es ausgiebig streicheln. Es verging keine Therapiestunde, in der das Kaninchen Niggi nicht zu ihm kam oder Maurice das Kaninchen aufsuchte, um zu sehen, wie es ihm ging. Regelmäßig brachte er ihm gesammelte Kräuter und Gräser mit. ▄
Positive Anthropomorphisierung bedeutet, dass Tieren menschliche Eigenschaften zugeschrieben werden. Dies stellt in den tiergestützten Interventionen einen spannenden Umstand dar, weil Menschen Tiere als Identifikationsmöglichkeit wahrnehmen. Dazu kommt die Du-Evidenz als subjektives Erleben zum Tragen und bezieht sich auf das Verhältnis und die Einstellung einer Person zu einzelnen Individuen einer Tierart. Die Anthropomorphisierung bezieht sich in der Regel auf eine bestimmte Tierart.
Klaus, ein 28-jähriger Patient mit Verhaltenssüchten, war in der Klinik wegen Spielsucht und wurde für die tiergestützte Therapie angemeldet, da er unter Grübelgedanken litt, welche sich negativ auf die Stimmung und Konzentrationsfähigkeit auswirkten. Klaus war fasziniert von den Meerschweinchen. Tamyna, eines der neuen Meerschweinchen, war gerade dabei, die anderen Meerschweinchen kennenzulernen. Dafür wurden die beiden Gehege wieder nebeneinandergestellt und über eine Brücke verbunden. Klaus beobachtete die offene Zusammenführung und die ersten Direktkontakte unter den Tieren. Dabei stellte er fest, dass Tamyna am ehesten seinem Verhalten entsprach. Sie war scheu und zurückhaltend, verteidigte jedoch mutig das Gehege, wenn die anderen Meerschweinchen ihr Zuhause aufsuchen wollten. Klaus erklärte, dass er eher still und zurückhaltend sei, aber wenn ihm jemand zu nahekomme, es ihm unangenehm sei oder sich etwas abzeichne, was er nicht wolle, äußere er sich deutlich. Klaus entwickelte zu Tamyna eine besondere Beziehung und achtete beim Füttern darauf, ihr eine größere Portion zukommen zu lassen, damit sie nicht zu kurz kam. Beim Füttern der Meerschweinchen erlebte er sich als entspannt und präsent. Nach der Stunde formulierte er positive Gefühle und Gedanken. ▄
Um das Gegenüber einer anderen Spezies als »Du« wahrzunehmen und verstehen zu können, bedarf es einer gemeinsamen Ausdrucksebene. Sie ist die Grundlage des Kontaktes. Für solche Beziehungen bevorzugen Menschen eher Tiere, die in Verbänden, Herden und Rudeln leben. Diese Tierarten haben auch das Bedürfnis nach Nähe und können daher gewisse Grundbedürfnisse des Menschen, wie Nähe und Zuneigung, stillen (Schöll 2015). Es ist die subjektive Gewissheit, dass es sich bei einer solchen Beziehung um Partnerschaft handelt, in der die sozio-emotionale Ebene angesprochen wird (Greiffenhagen & Buck-Werner 2012). Bei domestizierten Haustieren kann man die Beziehung zu diesen auch daran erkennen, dass man ihnen einen Namen gibt, was auch als Zeichen der Zuneigung gesehen werden kann. Durch unseren Umgang mit Haus- und Nutztieren können wir einiges über unseren Umgang mit uns selbst und unseren Mitmenschen erfahren. Wenn wir mit Tieren, die in menschlicher Obhut leben, in einen Dialog treten, schenken wir ihnen Zeit und Aufmerksamkeit. Wir beobachten und studieren, wie sie reagieren und welche Bedürfnisse sie haben. Die Mensch-Tier-Beziehung führt uns zurück zur Mensch-Mensch-Beziehung und daraus können wir für das soziale Miteinander einen Nutzen ziehen.
Jimmy,





























