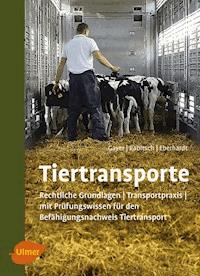
41,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Eugen Ulmer
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Professionell Tiere transportieren. Wer Tiere transportiert muss dazu befähigt sein und muss die gesetzlichen Anforderungen kennen. Dieses Buch dient Transporteuren, Landwirten und Studierenden als praktischer Leitfaden. Die Autoren stellen alle wichtigen Regelungen vor. Gleichzeitig dient dieses Buch als Unterlage für den Erwerb des Befähigungsnachweises Tiertransporte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Robert Gayer / Alexander Rabitsch / Ulrich Eberhardt
Tiertransporte
Rechtliche Grundlagen | Transportpraxis |
mit Prüfungswissen für den Befähigungsnachweis Tiertransport
107 Abbildungen und Fotos
36 Tabellen
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Vorwort
1Einleitung
1.1Ethische Fragen, Grundsätze des Tierschutzes
2Tiertransporte im Blickfeld der Öffentlichkeit
2.1Die Bedeutung von Tiertransporten im Straßenverkehr
2.1.1Statistikdaten zu Nutztiertransporten
2.1.2Tiertransporte in der Kritik
2.1.3Belastungsfaktoren auf Tiertransporten
2.1.3.1Tierbedingte Belastungsfaktoren:
2.1.3.2Klimatische, umgebungsbedingte Belastungsfaktoren:
2.1.3.3Fahrzeugbedingte Belastungsfaktoren:
2.1.3.4Personalbedingte Belastungsfaktoren:
2.2Verschiedene Transportmittel im Tiertransportverkehr
3Grundlagen verhaltensgerechter Tiertransporte
3.1Körperbau und Körperfunktionen verschiedener Tierarten – Anatomie und Physiologie
3.1.1Allgemeine Merkmale der Tiergesundheit
3.1.2Erkennen von Gesundheitsstörungen
3.1.3Tierartspezifische Merkmale
3.1.3.1Pferde, Esel
3.1.3.2Rinder
3.1.3.3Schweine
3.1.3.4Schafe, Ziegen
3.1.3.5Geflügel
3.1.3.6Heimtiere
3.1.3.7Kaninchen
3.1.3.8Fische
3.2Tierartspezifische Normal- und Bedarfswerte
3.2.1Fütterungs- und Tränkebedürfnisse von Tieren
3.2.1.1Pferde
3.2.1.2Rinder
3.2.1.3Schweine
3.2.1.4Schafe, Ziegen
3.2.1.5Geflügel
3.3Tierverhalten und Stressbewältigung
3.3.1Grundsätzliches Transportgebaren
3.3.2Pferde
3.3.3Rinder
3.3.4Schweine
3.3.5Schafe, Ziegen
3.3.6Geflügel
3.3.7Heimtiere
3.3.8Fische
3.3.9Gatterwild
4Hygiene und Desinfektion beim Tiertransport
4.1Allgemeine Hygieneaspekte
4.2Personalhygiene: Schutzkleidung und Hygieneschleusen
4.3Reinigung und Desinfektion (R+D) beim Transport
4.3.1Desinfektion zur Vorbeugung
4.3.2Spezielle Desinfektion bei Tierseuchen
4.3.3Auswahl des Desinfektionsmittels
4.3.4Einsatzkonzentration und Einwirkzeit
4.3.5Sicherer Umgang mit Desinfektionsmitteln
4.3.6Herstellen einer Gebrauchslösung
4.3.7R+D von Oberflächen
4.3.8R+D von Transportfahrzeugen
4.3.8.1Mehrstufiges Verfahren zur Fahrzeugdesinfektion im Routinebetrieb
4.3.8.2Reifendesinfektionen
4.3.8.3Desinfektionskontrollbuch
4.3.8.4Fahrzeugdesinfektionen bei Seuchengefahr – desinfizierendes Einweichen
4.3.9R+D von Rampenanlagen und Verladeeinrichtungen
4.3.10R+D von Behältnissen, Gerätschaften, Transporthilfsmitteln und Fahrzeugeinrichtungen
4.3.11R+D von Schutzkleidung
4.3.12Reinigungs- und Desinfektionsplan
5Rechtsvorschriften zum Tiertransport auf der Straße
5.1Tierschutzgesetz
5.2Tierschutz-Transportvorschriften
5.2.1Europäisches Recht und internationale Normen
5.2.2EU-Tiertransportverordnung – das Hauptregelwerk
5.2.2.1Geltungsbereich und allgemeine Regelungen der Verordnung (EG) Nr. 1/2005
5.2.2.2Allgemeine Bedingungen beim Tiertransport
5.2.2.3Der Tiertransporteur – ein Transportunternehmer
5.2.2.4Transportfähigkeit von Tieren und Transportverbote
5.2.2.5Transporte von Jungtieren
5.2.2.6Abtrennung und Gruppenbildung
5.2.2.7Beförderungsdauer, Versorgungspausen und Ruhezeiten
5.2.2.8Fahrtunterbrechung an Raststätten oder Kontrollstellen
5.2.3Einzelstaatliche Tiertransportvorschriften in Deutschland (Tierschutztransportverordnung)
5.2.4Einzelstaatliche Tiertransportvorschriften in der Schweiz und in Österreich
5.2.4.1Tiertransportvorschriften in der Schweiz
5.2.4.2Tiertransportvorschriften in Österreich
5.2.5Tierartspezifische Besonderheiten, Platzbedarf
5.2.5.1Pferdetransporte
5.2.5.2Rindertransporte
5.2.5.3Kälbertransporte
5.2.5.4Schweinetransporte
5.2.5.5Schaf- und Ziegentransporte
5.2.5.6Geflügeltransporte
5.2.5.7Heimtiertransporte
5.2.5.7.1Beförderung von Kaninchen
5.2.5.7.2Transportvorschriften für Hunde und Katzen
5.2.5.7.3Mit Tieren auf Reisen
5.2.5.8Wildtiertransporte
5.2.5.9Bienentransporte
5.2.5.10Fischtransporte
5.3Tierseuchenrecht
5.3.1Tiergesundheitsgesetz
5.3.2Viehverkehrsverordnung
5.3.2.1Überwachung der Tiergesundheit
5.3.2.1.1.Tiermeldung- und Tierhalter-Registrierung
5.3.2.1.2Bestandsregister
5.3.3.3Tierkennzeichnung, elektronische Tiererkennung
5.3.2.1.4Begleitpapiere für Nutztiere
5.3.3Handel mit Tieren
5.3.3.1Viehhandelskontrollbuch
5.3.3.2Innergemeinschaftlicher Handel
5.3.3.2.1Risikovorbeugung – Die Tiergesundheitsstrategie der EU
5.3.3.2.2Handelskontrollen
5.3.3.2.3Bestätigte Tiergesundheit
5.3.3.2.4Transparenz von Handelswegen und Transportstrecken
5.3.4Tierverwertung
5.4Arbeitsschutz und Sozialvorschriften im Tiertransportgewerbe
5.4.1Fahrpersonal- und Sozialvorschriften im Straßenverkehr
5.4.1.1Arbeitsschutzbestimmungen für das Fahrpersonal
5.4.1.2Gefährdungsermittlung und Risikobeurteilung
5.4.1.3Fahrpersonalrecht
5.4.1.4Lenk- und Ruhezeiten
5.4.1.5Digitale EG-Kontrollgeräte (Digitaler Tachograph, DTCO)
5.4.1.6Mindestalter für Fahrer
5.4.2Beachtung von Fahrverboten
5.4.2.1Sonn- und Feiertagsfahrverbot für LKW in Deutschland und Österreich
5.4.2.2Ferienreisefahrverbot
5.4.3Schutzkleidung
5.4.4Unfallverhütung im Umgang mit Tieren (siehe Kap. 11)
5.4.4.1Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
6Professioneller Tiertransport
6.1Allgemeine Voraussetzungen:
6.2Unterschiede privater, landwirtschaftlicher und gewerblicher Tiertransporte
6.2.1Private Tiertransporte
6.2.2Landwirtschaftliche Tiertransporte
6.2.3Gewerbliche Tiertransporte
6.3Güterkraftverkehrsvorschriften
6.3.1Gewerbliche Güterkraftverkehre
6.3.2Erlaubnispflicht nach dem Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)
6.3.3Erlaubnisfreie Güterkraftverkehre
6.3.4Nachweise der fachlichen Eignung
6.4Versicherungspflichten
6.4.1Private Versicherung von Anhängern
6.5Behördliche Anforderungen an Tiertransporteure
6.5.1Registrierung und Anzeigepflicht
6.5.2Genehmigung
6.5.3Zulassung
6.5.3.1Zulassung für Tiertransporteure
6.5.3.2Zulassung für Tiertransportfahrzeuge
6.5.4Erlaubnis
6.5.5Tiertransportspeditionen, Viehhandelsunternehmen, Viehsammelstellen
6.5.5.1Unternehmensanzeige und Zulassungspflicht
6.5.5.2Zulassungsvoraussetzungen
6.5.5.3Betriebsführung
6.5.6Kontrollstellen (Aufenthaltsorte, staging points)
6.5.7Anforderungen für Landwirte
7Transport-Begleitdokumente
7.1Begleitdokumente im nationalen Bereich
7.1.1Deutschland
7.1.2Österreich
7.1.3Schweiz
7.2Begleitdokumente im grenzüberschreitenden Verkehr
8Anforderungen an die Transportfahrzeuge
8.1Anforderungen an einfach ausgestattete Straßentransportfahrzeuge
8.1.1Aufbauvorrichtungen
8.1.1.1Materialien im Fahrzeugbau
8.1.1.2Böden
8.1.1.3Seitenwände
8.1.1.4Fahrzeugdächer
8.1.2Verladeeinrichtungen, Rampen
8.1.2.1Fahrzeugrampen
8.1.2.2Hebebühnen
8.1.2.3Verladebuchten, Stallrampen
8.1.2.4Rampenbeleuchtungen
8.1.3Abtrennungen
8.1.4Größe der Tiergruppen
8.1.5Laderaumhöhe:
8.1.6Transporthilfsmittel
8.1.6.1Treibhilfen
8.1.6.2Anbindungen, Befestigungs- und Führmaterial
8.1.6.3Sonstige nützliche Hilfsmittel
8.2Anforderungen an Langzeit-Tiertransportfahrzeuge (Typ 2)
8.2.1Tränkeanlage und Wassertank
8.2.2Belüftung
8.2.3Temperaturkontrolle
8.2.4Navigationssystem
8.2.5Besondere Regelungen
9Behältnisse zum Tiertransport
9.1Eigenschaften von Behältnissen
9.2Fahrzeuge zum Transport von Behältnissen
9.3Transportvorschriften für Behältnisse
10Qualitätssicherung beim Transport (QS)
10.1QS-Qualitätssicherung: Leitfaden Tiertransport
10.2Handbuch Tiertransporte
11Mitarbeiter qualifizieren und informieren
11.1Personalschulungen und laufende Fortbildung
11.2Befähigungsnachweis und Lehrgänge
11.3Verantwortlichkeiten beim Tiertransport
11.3.1Tierhalter/Versender
11.3.2Organisator
11.3.3Transporteur/Transportunternehmer
11.3.4Fahrer/Betreuer
11.3.5Empfänger
12Mit Tieren sicher umgehen – Arbeitssicherheit beim Transport
12.1Praktische Aspekte der Transportsicherheit
13Tiertransporte vorbereiten und durchführen
13.1Planung und Transportvorbereitung im Stall
13.2Beurteilung der Transportfähigkeit
13.3Prinzipien der Tierverladung
13.4Tipps zum Verladen von Nutztieren
13.4.1Verladetipps für Pferde
13.4.2Verladetipps für Rinder
13.4.3Verladetipps für Schweine
13.4.4Verladetipps für Schafe und Ziegen
13.4.5Verladetipps für Geflügel
13.5Tierbetreuung und Versorgung während des Transportes
13.6Fahrverhalten beim Tiertransport
13.6.1Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Tiere
13.6.2Auswirkungen auf die Fleischqualität
13.7Entladen der Tiere
14Besonderheiten bei regionalen und innerstaatlichen Tiertransporten
14.1Transporte auf kurze Distanz
14.2Lange Beförderungen im innerstaatlichen Bereich
14.3Schlachttiertransporte
15Amtstierärztliche Abfertigung grenzüberschreitender Transporte
15.1Abfertigung ab Hof oder über Sammelstellen
15.2Internationale Transporte unter 8 Stunden
15.3Internationale Langstreckentransporte
16Kontrollen von Tiertransporten
16.1Moderne Überwachung von Tiertransporten
16.2Das elektronische Überwachungsnetz TRACES
16.3Häufig festgestellte Mängel
16.4Maßnahmen bei Verstößen
16.5Verhaltensmaßregeln bei Verkehrskontrollen
17Erste Hilfeunterwegs – Notfälle im Tierverkehr
17.1Notfallplan
17.2Sofortmaßnahmen bei Notfällen
17.2.1Pannen und technische Störungen
17.2.2Transportverzögerungen und Staus
17.2.3Verhalten bei Unfällen mit Tiertransportfahrzeugen
17.2.4Akute Notfälle
17.2.4.1Umgang mit verletzten oder erkrankten Tieren
17.2.4.2Ersthilfemöglichkeiten
17.2.4.3Das gehört in den Nutztier-Notfallkoffer
17.3Arzneimittelanwendung beim Transport
17.4Weitertransport erkrankter oder verletzter Tiere
17.5Notschlachtung und Nottötung
17.5.1Tierschutzgerechtes Töten von Tieren
17.5.2Betäubungs- und Nottötungsmethoden
17.5.3Entsorgung toter Tiere
18Service
18.1Musterdokumente und Checklisten
18.2Gesetzgebung und Rechtstexte
18.2.1Rechtsgrundlagen
18.2.2Literatur
18.2.3Behörden
18.2.4Organisationen
Bildquellen
Über die Autoren
Impressum
Endnoten
Vorwort
Der Transport von Tieren ist seit vielen Jahren ein fachlich, gesellschaftlich und politisch umstrittenes Betätigungsfeld. Grund dafür sind die vielfältigen Belastungen, denen Tiere durch Transporte ausgesetzt sind. Deshalb wird zu Recht über Begrenzungen der Transportdauer, die Ausstattung der Transportmittel und selbstverständlich über den Umgang mit den Tieren beim Verladen und Transportieren debattiert. Seit dem Jahr 2005 existiert ein EU-weit einheitlicher Rechtsrahmen für Tiertransporte. Dieser Rechtsrahmen kann allerdings nur dann seine volle Wirkung zum Schutz der Tiere entfalten, wenn alle beteiligten Personen die Hintergründe und Regelungen kennen, verstehen und in der Transportpraxis umsetzen.
Das vorliegende Buch arbeitet die Thematik sehr systematisch und zugleich praxistauglich auf. Als Einstieg wird die zunehmende Bedeutung von Tiertransporten geschildert, woraufhin im folgenden Abschnitt sachkundig auf die erforderlichen tierschutzfachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten beim transportbedingten Umgang mit den unterschiedlichen Tierarten eingegangen wird. Daran anschließend - und auf diese Weise gut begründet - werden die Rechtsvorgaben vorgestellt. Dankenswerterweise beschränkt sich diese Darstellung nicht auf die veterinärrechtlichen Regelungen, sondern schließt auch die Rechtsgebiete Arbeitsschutz und Sozialvorschriften ein.
Nachdem auf diese Weise die fachlichen und rechtlichen Voraussetzungen eingeführt wurden, befassen sich die Autoren vor dem Hintergrund ihres breiten Erfahrungswissens anschaulich mit der praktischen Umsetzung. Dabei werden neben der notwendigen Ausstattung der Fahrzeuge auch die Voraussetzungen für die Zulassung der Transportunternehmen und die Anforderungen an die Sachkunde des Personals geschildert. Darüber hinaus erklären die Autoren den Umgang mit den Transportdokumenten, die Transportvorbereitung einschließlich der Routenplanung und den Umgang mit den Behörden. Die genannten Aspekte werden zudem sehr sinnvoll durch klare Hinweise für tierschonendes Verladen und geradezu eindringliche Anleitungen für Zwischen- und Notfälle ergänzt.
Wie ein roter Faden zieht sich durch die gesamte Darstellung, dass die Autoren in gut verständlicher Sprache unmissverständlich formulieren, was die Tiere benötigen, was Transporteure tun müssen und wer die Verantwortung trägt. Dank der langjährigen Erfahrung der Autoren nimmt das Buch viele Antworten auf entstehende Fragen vorweg und stellt insgesamt einen Maßstab für die Durchführung von Tiertransporten dar. Den Autoren sei um der Tiere willen ausdrücklich für diese praxisorientierte, klare Aufarbeitung des komplexen Themas gedankt.
1Einleitung
Unzählige Tiertransportfahrzeuge rollen täglich über Europas Straßen. Sowohl die Öffentlichkeit als auch Kunden von Tiertransporteuren fordern zu Recht tierfreundliche Transportbedingungen. Medien, Tierschutzorganisationen und Behörden sind seit langem für das Thema Tiertransport sensibilisiert. Obwohl sich die Transportbedingungen die letzten Jahre stetig gebessert haben, werden, allen europäischen Rechtsvorgaben zum Trotz, immer wieder Missstände bei allerlei Tierbeförderungen aufgezeigt. Theoretisch kann jeder, der Tiere befördert, unweigerlich ins Visier der Öffentlichkeit bzw. der Kontrollorgane geraten. Für solche Fälle ist es gut zu wissen, was beim Tiertransport erlaubt ist und was nicht.
Das vorliegende Buch will keine Wertung zu Tiertransporten an sich abgeben, vielmehr will es die rechtlichen Rahmenbedingungen umfassend darstellen sowie die notwendigen fachlichen Inhalte erläutern, welche Transporteure für eine ordnungsgemäße Durchführung von Tierbeförderungen benötigen.
Spezialwissen ist gefragt
Grundvoraussetzungen für schonende und tiergerechte Beförderungen sind hinreichendes Spezialwissen und ausreichende Erfahrung. Den eigenen Hund oder die eigene Katze von A nach B zu transportieren, dürfte selbst dem Unerfahrenen keine Schwierigkeit bereiten. Anders sieht es jedoch bei Nutztieren und allen größeren Tieren aus, die in Gruppen auf die Ladefläche eines Transportanhängers oder eines Lasters gebracht werden sollen. Wie kann jemand, der über keine Erfahrung in diesem Bereich verfügt, landwirtschaftliche Zucht- oder Nutztiere dazu bewegen, aus der gewohnten Stallumgebung ohne Widerstand auf einen Anhänger oder gar auf einen hohen LKW zu gehen? Schreie und laute Geräusche helfen nicht wirklich weiter, Gewaltanwendung ist verboten und grundsätzlich abzulehnen. So leuchtet ein, dass man für das Verladen und Befördern nicht nur mit der jeweiligen Tierart vertraut sein muss und deren Bedürfnisse und Verhaltensgewohnheiten kennen sollte, sondern auch noch genaue Kenntnisse der Rechtsvorschriften benötigt. Zu Recht wird deshalb vom Gesetzgeber ein Befähigungsnachweis für Tiertransporteure verlangt.
Viehhandelsbetriebe und Transportspeditionen sind auf sachkundige Fachkräfte angewiesen. Gesucht sind verantwortungsbewusste Fahrer, die bereit sind, das anspruchsvolle und in der Öffentlichkeit mit Argwohn beobachtete Geschäft zu übernehmen. Die wenigsten im Transportgewerbe beschäftigten Fahrer kommen allerdings aus der Landwirtschaft oder haben eine Ausbildung im Agrar- oder Tierhaltungssektor. Viele Neueinsteiger besitzen gerade mal einen LKW-Führerschein und hatten gelernt, ihre Maschine mit der schweren Ladung sicher zu steuern. Doch beim richtigen Umgang mit lebender Fracht, sei es beim Auf- und Abladen oder beim Versorgen der Tiere unterwegs, betreten viele einfach Neuland. Zudem kommen ausländische Fahrer häufig aus anderen Kulturkreisen, in denen andere Regeln im Zusammenhang mit Tierwohl und Transportbedingungen gelten.
Prüfungsvorbereitung für den Befähigungsnachweis – Schulungsunterlagen
Innerhalb der Europäischen Union sind Schulungen für das Transportpersonal vorgeschrieben, die mit einer erfolgreichen Prüfung über die wichtigsten Inhalte der EU-Tiertransportverordnung abzuschließen sind. Es ist gut, solche Schulungen zum Erlangen ausreichender Sachkunde zu fordern. Sie können jedoch allenfalls die theoretischen Grundlagen liefern und einen begrenzten Einblick in die Praxis bieten. Die praktische Erfahrung wird erst mit dem Tun erworben, denn das beste Lernfeld bietet der Transportalltag. Theorie und Rechtsvorschriften sind jedoch die notwendige Basis für eine erfolgreiche Erfüllung der anspruchsvollen Aufgaben im Tiertransportgewerbe.
Das vorliegende Buch stellt die rechtlichen Bestimmungen im Zusammenhang mit Tiertransporten vor. Dabei soll es sowohl zu Schulungszwecken als auch zum Nachschlagen bestimmter Anforderungen dienen. Neben einem grundlegenden Einblick in das Tiertransportwesen vermittelt es eine Übersicht über die besonderen Eigenheiten und Ansprüche verschiedener Tierarten, die üblicherweise transportiert werden. Dabei beschränken sich die Inhalte vorwiegend auf den Straßentransport.
Abb. 2 Tiere zu transportieren ist ein anspruchsvoller Job.
Der Stoff kann bei der Ausbildung an Lehranstalten und an landwirtschaftlichen Schulen zum Einsatz kommen. Daneben bietet das Buch sich jedoch auch dem Unerfahrenen an, um sich auf einen Lehrgang zum Befähigungsnachweis vorzubereiten oder sich einfach einen Überblick über die Thematik zu verschaffen. Somit werden die Inhalte sowohl dem Neueinsteiger als auch dem erfahrenen Tiertransporteur empfohlen.
Allen, die von Berufs wegen mit dem Befördern von Tieren zu tun haben, kann es im Transportalltag bei der praxisgerechten Umsetzung der umfangreichen Bestimmungen helfen. Auch Kontrolleure, die Tiertransporte zu überwachen haben, müssen stets die fachlichen und rechtlichen Vorgaben berücksichtigen und können die Grundlagen hierzu im Bedarfsfall finden.
Nicht zuletzt mögen alle anderen Interessierten die richtigen Antworten auf Ihre Fragen bekommen, insbesondere was es im Zusammenhang mit dem Tiertransport alles zu berücksichtigen gilt und was als rechtskonform anzusehen ist.
1.1Ethische Fragen, Grundsätze des Tierschutzes
Beziehung Mensch/Tier – Nutzobjekt oder Mitgeschöpf?
Die Geschichte der Menschheit ist eng mit den Tieren verbunden. Haustiere begleiten den Menschen schon seit Jahrtausenden und sie leben in Gemeinschaft mit dem Menschen als Nutztiere oder Heimtiere. Der moderne Mensch denkt ganz bewusst über sein Verhältnis zu Tieren nach. Die wissenschaftliche Ethik, das ist einfach ausgedrückt die Lehre vom guten Leben und sittlichen Handeln, befasst sich als Teilgebiet der Philosophie mit der menschlichen Moral innerhalb menschlicher Gemeinschaften. Tierethik beschäftigt sich darüber hinaus mit allen menschlichen Geboten und Verboten, die für uns in der Beziehung und im Umgang mit Tieren eine Rolle spielen. Überlegungen, was den Tieren zumutbar und was schädlich ist, spiegeln sich in vielen alten Schriften wider, in Berichten, in Vorschriften und Verhaltensregeln. Zwar steht der Mensch nach abendländischer Weltsicht im Mittelpunkt der Welt, aber er hat eine Verantwortung für die Schöpfung, also insbesondere auch für die Tiere.
Aus ethischer Sicht lassen sich Kriterien für gutes und schlechtes Handeln des Menschen gegenüber Tieren ableiten. Wiewohl die Ansätze solcher Überlegungen bereits in der Antike und auch in der Bibel auszumachen sind, ist der menschliche Umgang mit Tieren in den verschiedenen Regionen der Erde höchst unterschiedlich und dabei einem zeithistorischen und gesellschaftlich-politischen Wandel unterworfen. Erst in neuerer Zeit setzte sich die Ansicht durch, dass das Tier um seiner selbst willen zu schützen ist (Ethischer Tierschutz).
Die Vernunft gebietet, dass mit Nutztieren sorgfältig umgegangen werden muss, um deren Wert und Nutzen möglichst lange zu erhalten. Also bestimmte zunächst die wirtschaftliche Qualität den Umgang mit dem Tier. Früher war oft zu hören, bei Schlachttieren sei die Behandlung nicht so wichtig, „sie würden ja sowieso geschlachtet“. Heute weiß jeder, dass Tiere Schmerz empfinden und leiden können und dass durch einen schonenden Umgang mit Tieren vor dem Schlachten weniger Verluste entstehen und eine bessere Fleischqualität erzielt wird. Kenntnisse über das Tier, seine Verhaltensweisen und Ansprüche bringen zudem Arbeitserleichterung und Arbeitssicherheit mit sich.
Über den wirtschaftlichen Wert hinaus muss man feststellen, dass Tiere als Lebewesen dem Menschen ähnlich sind, auch wenn sie nicht sprechen können und nicht vernunftbegabt sind. Tiere besitzen ähnliche Bedürfnisse wie Menschen. Sie haben Grundbedürfnisse wie Luft, Licht, Wohlfühltemperatur, eine Versorgung mit Wasser und Futter; sie haben einen bestimmten Platzbedarf und brauchen Bewegungsmöglichkeit. Tiere müssen gepflegt werden. Auch haben sie Anspruch auf körperliche Unversehrtheit, den Schutz vor Verletzungen oder Stress. Sie benötigen Sozialkontakte mit Artgenossen und sollen ihr arteigenes Verhalten ausleben können.
Die Tierschutzgesetzgebung basiert auf der Erkenntnis, dass Tiere – vor allem Wirbeltiere – empfindungsfähig sind und auch leiden können, möglicherweise ähnlich wie der Mensch. Nach den Grundsätzen der neuzeitlichen mitteleuropäischen Tierschutzgesetze sollen Tiere stets als Mitgeschöpfe behandelt werden und in menschlicher Obhut eine artgerechte Unterbringung, Fütterung und Pflege erhalten. Außerdem muss gewährleistet sein, dass sie weder Schmerzen, noch Angst, noch Leiden erfahren.
Die fünf „Freiheiten“
1.Freier Zugang zu frischem Trinkwasser und Nahrung
2.Anspruch auf ein angemessenes Lebensumfeld
3.Freisein von Schmerzen, Angst und Leiden
4.Freies Ausleben normaler Verhaltensweisen
5.Frei sein von Krankheiten
Diese Tierschutzaspekte gelten für alle vom Menschen gehaltenen Tieren, unabhängig davon, ob es sich um Streicheltiere, Freizeit- und Hobbytiere, Nutz- und Zuchttiere oder um Schlachttiere handelt.
Demzufolge ist es auch eine der Kernaufgaben der Transporteure sicherzustellen, dass Tiere während des Transportes „würdig“ behandelt werden und frei von Schmerzen, Ängsten und Leiden sind. Tierwohl und schonende Transportweisen werden auch gesetzlich gefordert, ganz besonders beim Ferntransport. Vielfach ist es der Staat selbst, der Tierschutz als seine ureigene Aufgabe erkennt und wahrzunehmen gewillt ist. Tierschutz ist sogar als Staatsziel im Grundgesetz verankert. So heißt es im § 20 a: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung“. Das Tier ist rechtlich längst keine Sache mehr, sondern ein lebendiges Wesen. Tierquälerei ist somit keinesfalls nur eine Sachbeschädigung.
„Erbarme dich“
(aus: Reinhard Mey: „Einhandsegler“)
Die Räder rumpeln den schlaglochzerfurchten Weg entlang,
Die Zugmaschine ächzt und dröhnt im zweiten, dritten Gang,
Der Hänger folgt schlingernd den Schlangenlinien.
Zwei Dutzend Pferde sind die Ladung, Schlachtvieh ist die Fracht,
Vier Nächte und vier Tage und vielleicht noch eine Nacht,
Von Litauen bis nach Sardinien.
Dreitausend Kilometer liegen vor dem Elendstreck
Durch Kälte, Angst und Hitze auf dem zug’gen Ladedeck,
Mit groben Seilen lieblos festgebunden.
Dreitausend Kilometer eingepfercht und festgezurrt
Bei jeder Kurve schmerzt der raue Strick, der harte Gurt
Scheuert bei jedem Rucken in den Wunden.
Erbarme dich,
Erbarme dich!
Erbarme dich der Kreatur,
Sieh hin und sag nicht, es ist nur Vieh!
Sieh hin und erbarme dich!
Mitempfinden für Tiere
Wie der Liedermacher Reinhard Mey mit seinem Songtext auf die erbärmliche Situation stundenlanger Tiertransporte aufmerksam macht, so rütteln Medien immer wieder die Öffentlichkeit mit Berichten über Missstände im Transportalltag von Tieren auf. Wie lieblos Menschen manchmal mit dem Geschöpf Tier umgehen, wenn es nur als Ware zählt, macht betroffen und auch wütend. Besonders bei internationalen Tierschutzkontrollen fielen in der Vergangenheit leider immer wieder schwarze Schafe der Branche auf. Häufig liegen die Ursachen von Mängeln jedoch nicht in böser Absicht oder Ignoranz der Beförderer, sondern einfach an menschlicher Unzulänglichkeit oder auch an mangelndem Fachwissen des Personals. Lange Beförderungen müssen gut geplant und organisiert werden. Alle am Transport Beteiligten, ob Landwirte, Viehhandelskaufleute, Transportunternehmer oder Begleitpersonal, müssen über ein spezielles Fachwissen verfügen. Je mehr Fahrer und Betreuer von Tieren bei Transporten über die Bedürfnisse der einzelnen Tierarten und die Anforderungen an eine tiergerechte Beförderung wissen, umso sorgsamer werden sie die anvertrauten Tiere beim Transport begleiten können.
Allen Beteiligten sollte auch stets bewusst sein, dass die Öffentlichkeit ein waches Auge auf alle Unregelmäßigkeit hat und oft emotional reagiert. Daher genügt es nicht, hierbei nur die übliche Sorgfalt im Umgang mit Tieren walten zu lassen, sondern man muss darüber hinaus die wichtigsten gesetzlich vorgeschriebenen Regelungen kennen und einschlägiges Basiswissen besitzen. Dazu gehört auch, sich die nötige Erfahrung im Viehhandel, Viehverkehr und Transportwesen anzueignen und sein Wissen auf diesem Sektor durch regelmäßige Fortbildung auf dem Laufenden zu halten.
2Tiertransporte im Blickfeld der Öffentlichkeit
2.1Die Bedeutung von Tiertransporten im Straßenverkehr
Die Auswirkungen der allgemeinen Mobilität sind in unserer modernen Welt längst nicht mehr nur im Personenverkehr zu spüren. Die Möglichkeit, jederzeit alle Arten von Gütern, Tiere eingeschlossen, uneingeschränkt überall hin transportieren zu können, ist in unserer mobilen Gesellschaft zur Selbstverständlichkeit geworden. Für Tiere bedeutet dies jedoch häufig eine völlig ungewohnte und unnatürliche Belastung. Je reizarmer Nutztiere aufwachsen, umso eher werden sie bei ungewohnten Ereignissen, so auch bei ungeübtem Befördern, mit Stressreaktionen reagieren.
Landwirtschaft – bedeutendster Wirtschaftssektor innerhalb der Europäischen Union
Die europäische Agrar- und Ernährungsindustrie zählt zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen im Europäischen Binnenmarkt. In den europäischen Staaten werden ca. 730 Mio. Nutztiere (184 Mio. Rinder, 320 Mio. Schweine, 213 Mio. Schafe, 12 Mio. Ziegen) und ca. 400 Mio. Legehennen gehalten. Registriert sind ca. 8 Mio. Equiden, [das sind Pferde, Esel und deren Kreuzungen], die hauptsächlich für Sport- und Freizeitzwecke gehalten werden (Quelle: EDS – Europäischer Datenservice).
Laut Europäischer Kommission (COM 2013) werden „Im Landwirtschaftssektor […] EU-weit die meisten Tiere verwendet, und zwar mindestens 2 Milliarden Hähnchen, Legehennen, Truthühner und anderes Geflügel sowie 34 Millionen Säugetiere, wie Schweine, Schafe, Ziegen, Rinder, Pelztiere usw. Es gibt 13,7 Millionen Tierhaltungsbetriebe in der EU. Der Produktionswert der landwirtschaftlichen Tierhaltung in der EU beläuft sich auf 156 Milliarden EUR jährlich“.
Genauso wie Waren im internationalen Handel heutzutage um den ganzen Erdball wandern, werden auch lebende Tiere über Ländergrenzen hinweg und sogar global zwischen den Kontinenten hin und her geschickt. Rund 50 Milliarden Tiere sind weltweit jährlich in Fahrzeugen unterwegs. Zwischen Herkunfts- und Bestimmungsort liegen dabei oft Tausende von Kilometern.
Wie alle Marktbeteiligten nutzen Viehhandel und Transportgewerbe den freien Warenverkehr im EU-Binnenmarkt, seit die Grenzbarrieren 1993 zwischen den Mitgliedsländern gefallen sind. Gewaltig angewachsen ist daher in den vergangenen Jahren der innergemeinschaftliche Handelsverkehr mit Nutztieren. Jedes Jahr werden in der EU mehr als 30 Mio. Tonnen Fleisch von Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen sowie mehr als 11 Mio. Tonnen Geflügelfleisch erzeugt. Allein in Deutschland werden ungefähr 63 Mio. Nutztiere jährlich geschlachtet (Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland). Man geht davon aus, dass hierdurch jedes Nutztier im Laufe seines Lebens mindestens einmal in einem Fahrzeug transportiert wird. So sind auf europäischen Straßen jährlich rund 360 Millionen Schweine, Schafe, Ziegen und Rinder sowie mehrere Milliarden Stück Geflügel unterwegs. Der grenzüberschreitende Nutztierverkehr wird auf ca. 60 Mio. Tiere beziffert.
Dass angesichts dieser Zahlen auch Probleme und Missstände bei Tiertransporten auftreten, ist unvermeidbar. Moderne Transportlogistik von Speditionen sowie neuartige Fahrzeugtechnologie tragen sicherlich dazu bei, die Beförderung von Tieren effektiv, wirtschaftlich und auch immer schonender für das Tier zu bewerkstelligen. Aufbauten und Ausstattungen neu zugelassener Tiertransportfahrzeuge führen zu immer mehr Komfort für die Tiere. Andererseits ermöglicht die Technik mittlerweile aber auch vielfältige und präzise Überwachungsmöglichkeiten für Fahrer, Transportunternehmer und Behörden. Trotz aller Fortschritte sind die Möglichkeiten des tierschutzgerechten Umgangs und Transports bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Es ist daher Aufgabe aller Beteiligten, sich um kontinuierliche Verbesserungen beim Schutz der Tiere auf dem Transport zu bemühen. Nationale und internationale Gesetzgeber versuchen, die Rahmenbedingungen für einen möglichst tierschutzgerechten Straßentransport genau vorzugeben. Ziel dabei ist in jedem Fall, Tiere vor unnötigen Belastungen und Stress zu bewahren, besonders auf langen Strecken. Wirtschaftliche Erwägungen sind in der Praxis zwar angemessen zu berücksichtigen, müssen jedoch in Hinblick auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Tiere eine untergeordnete Rolle spielen.
Abb. 3 Fleischverbrauch. (Quelle: FAO)
Angesichts der rechtlichen Vorgaben, der Qualitätsanforderungen der Wirtschaft und der Sensibilität der Bevölkerung erfordert die Arbeit im Tiertransportgewerbe zunehmend spezifische und umfangreiche Fachkenntnisse. Wer sich mit Tieren als Fahrer auf die Straße wagt, muss nicht nur sein Fahrzeug sicher beherrschen, sondern auch den Umgang mit der lebenden Fracht.
2.1.1Statistikdaten zu Nutztiertransporten
Zunahme der Transporte
Das erhebliche Wachstum des allgemeinen Güterverkehrs in Europa ist fast ausschließlich auf den Straßenverkehr zurückzuführen. Auch mit der kostbaren Fracht „Lebendtiere“ gibt es neben einer regen Ein- und Ausfuhr von und nach Drittstaaten einen tagtäglichen umfangreichen Handelsverkehr zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Denn Tiertransporte eröffnen insgesamt höhere Absatzchancen am innergemeinschaftlichen und internationalen Markt. In der EU sind mehr als 6000 Tiertransportfahrzeuge zugelassen (Franzky 2013).
Von allen registrierten Tiertransporten in der EU entfallen nur etwa 25-30 % auf Langstreckentransporte. 2004 lag die Zahl noch bei ca. 10 % (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-04-1391_de.htm). Die meisten der grenzüberschreitenden Tiertransporte (65-70 %) sind Kurzstreckentransporte (KOM, 2011).
Der Trend zum Anstieg der Tiertransporte bleibt auch weiterhin ungebrochen. Innerhalb Deutschlands fahren jährlich etwa 4,5 Mio. Rinder, 1 Mio. kleine Wiederkäuer, 80 Mio. Schweine, 45.000 Equiden, 1,25 Mrd. Vögel und Kaninchen sowie 50 Mio. Wirbeltiere sonstiger Arten über die Straßen (Statistisches Bundesamt 2013).
Abb. 4 Rinderhandel der Europäischen Union: Importe, Exporte, innergemeinschaftlich (Quelle: ec.europa.eu/agriculture/statistics/agricultural/2012/index_en.htm).
Der Fleischkonsum der Menschen nimmt weltweit ständig zu. Der Pro-Kopf-Verbrauch in Industriestaaten nähert sich der 100-kg-Marke. Dementsprechend werden immer mehr Tiere transportiert. Die Transporte zu den Schlachthöfen sind nur ein Teil davon. Viele Tiere müssen zuvor auch vom Geburtsort zu den Mast- oder Aufzuchtplätzen verbracht werden. Die einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe haben einen sehr hohen Spezialisierungsgrad erreicht. Der Bauernhof, auf dem ein Tier geboren, aufgezogen und anschließend auch geschlachtet wird, stellt die große Ausnahme dar.
EU-Handel und Exporte
Betrachtet man die Europäische Union, so ist der Viehhandel zwischen den Mitgliedstaaten weitaus größer als Exporte in Drittstaaten oder Importe aus Drittstaaten. Das hohe Ausmaß an innereuropäischen Tierbeförderungen hängt damit zusammen, dass einzelne Staaten die Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung an Fleisch oft nicht selbst erfüllen können, andere Staaten wiederum produzieren weit mehr Tiere als im eigenen Land benötigt werden (s. Abb. 5). So erscheint es logisch, dass entweder Tiere oder das von diesen stammende „Produkt“ Fleisch von den Staaten mit Überproduktion in Staaten mit Mangelversorgung transportiert werden.
Eine ungenügende Versorgung mit Fleisch weisen auch zahlreiche Drittstaaten, speziell im arabischen Kulturkreis auf. Dies hat zur Folge dass viele Produktionsstaaten der Europäischen Union, aber auch beispielsweise Australien, Brasilien und Argentinien, Lebendvieh mit dem LKW und schließlich per Schiff dorthin liefern. Diese Tiere werden unmittelbar nach Ankunft in Nordafrika, im Nahen Osten und in der Türkei geschlachtet, oftmals aber auch noch weiter ins Hinterland oder weitere Länder verbracht.
Abb. 5 Selbstversorgungsgrad einzelner Europäischer Staaten mit Fleisch (Quelle: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft „Agrarmärkte 2013“).
Zucht- und Schlachtvieh-Verkehr
Unberücksichtigt und statistisch kaum erfasst sind innerstaatliche Beförderungen von Tieren innerhalb eines Mitgliedstaates der Union. Einem Bericht des Statistischen Bundesamtes zufolge sind 2001 auf deutschen Straßen etwa 6,35 Millionen Tonnen Tiere lebend befördert worden, wobei der größte Teil auf Transporte zu Schlachtstätten entfiel. Dabei fanden etwa 70 % der Fahrten im Nah- und Regionalbereich bis 150 km Transportweite statt. Mehr als 90 % dieser Beförderungen, knapp 5,9 Mill. t, erfolgten mit inländischen Lastkraftfahrzeugen, davon 5,65 Mill. t innerhalb Deutschlands und annähernd 0,25 Mill. t im grenzüberquerenden Verkehr. Die mit Eisenbahnen, Schiffen und Flugzeugen im Jahr 1999 beförderte Menge an lebenden Tieren war dagegen mit schätzungsweise 0,04 Mill. t verhältnismäßig gering (Stat. Bundesamt 2001, www.destatis.de).
Rinder
In den EU-Staaten (28 Länder) wurden 2013 insgesamt etwa 87, 6 Mio. Rinder gehalten (Eurostat, 2013). Innerhalb Europas werden jährlich 3 bis 4 Millionen Rinder auf der Straße transportiert (Bätza 2011).
Davon werden jährlich etwa 800.000 Rinder lebend aus der EU ausgeführt. 80-90 % davon sind gewöhnlich Schlachttiere, der Rest entfällt auf den Export von Zuchtvieh. (Zuchtviehexporte 2009: 80.000 Tiere, 2010: 116.000 Tiere, 2011: 158.000, COM-AGRI 2012).
Drittländer versuchen häufig eigene Rinderherden durch den Import von Zuchtrindern aufzubauen. Hierbei ist in Europa Deutschland als Lieferant von Milchvieh federführend. Auch andere EU-Länder sind interessiert an deutschem Zuchtvieh. Der stärkste Abnehmer war im Jahr 2013 Algerien mit 12.244 Tieren. An zweiter Stelle der Empfängerländer folgten im Jahr 2013 die Niederlande mit 6.166 Tieren. Die drittgrößte Position ging nach Polen.
Abb. 6 Zuchtrinder-Exporte Deutschland 2003 bis 2012.
Abb. 7 Zuchtrinder-Exporte Deutschland 2013 (Quelle: Bundesrat, Drucksache 17/14718 vom 6.9.2013).
In Deutschland gibt es etwa 12 Mio. Rinder, die vor allem zur Milcherzeugung gehalten werden. Im Mai 2011 gab es rund 4,2 Millionen Milchkühe. 2015 wurden 3,5 Mio. Rinder in Deutschland geschlachtet. Die Entwicklung der gesamten Rinderbestände hängt stark von der Entwicklung der Milchkuhbestände ab, da die Kälber, die zur Mast vorgesehen sind, vor allem aus der Milchkuhhaltung stammen (Quelle: Stat. Bundesamt) Lebende Kälber werden zum großen Teil in südeuropäische Staaten (Italien, Spanien) vermarktet und dort ausgemästet. Niederlande und Frankreich zählen ebenfalls zu den Abnehmerländern deutscher Mastkälber.
Vermarktung über Sammelstellen
Die meisten Rinder (Zucht- und Masttiere) werden über Vieh-Sammelstellen vermarktet. Das Verhältnis der Verbringungen über Sammelstellen ist zwischen 2005 und 2009 leicht angestiegen und lag 2009 bei etwa 73%. Für zur Schlachtung bestimmte Rinder hat sich das Verbringen über Sammelstellen zwischen 2005 und 2009 auf 44% verdoppelt. Neben den 3.7 Mio. Rindern wurden 2009 noch ca. 78.000 Equiden, ca. 27,7 Mio. Schweine, ca. 104.000 Ziegen, ca. 4,2 Mio. Schafe und 730 Mio. Stück Geflügel innergemeinschaftlich verbracht (BÄTZA 2011).
Abb. 8 Schlachtrinderexporte der EU-27, 2008 bis 2012 (nach: Bundesrat, Drucksache 17/14718 vom 6.9.2013).
Schweine
Deutschland gilt als größter Schweineproduzent in der Europäischen Union. Die Bedeutung der Schweinehaltung in Deutschland ist in den letzten Jahren gewachsen, zeigt jedoch weltwirtschaftsabhängig eine abnehmende Tendenz. Der gesamte Schweinebestand betrug 2011 in der BRD 26,8 Mio. Tiere. Die Mast macht mit 42 % aller Schweine den wichtigsten Zweig der Schweinehaltung aus. Im Jahr 2011 wurden 11,2 Millionen Mastschweine gehalten, das waren 12 % mehr als im Mai 2000. Die Bedeutung der Zucht nimmt demgegenüber seit 2000 ab. Etwa 2,2 Millionen Zuchtsauen und Zuchteber wurden 2011 noch gezählt (Quelle: Stat. Bundesamt, www.destatis.de).
Deutschlands Schweinemäster importieren rund 4 Millionen Ferkel jährlich aus dem angrenzenden Ausland, im Wesentlichen aus Dänemark und den Niederlanden. Bei einem Schlachtaufkommen von jährlich knapp 60 Mio. Schweinen in Deutschland hat rund ein Viertel der Tiere eine ausländische Herkunft (Quelle: Agrarmarkt Informations-GmbH (AMI), www.ami-informiert.de).
Zwischen den EU-Staaten werden jährlich etwa 9 Mio. Schlachtschweine gehandelt. Dabei sind die Niederlande der größte Versender und Deutschland das wichtigste Importland. Aus Deutschland werden jährlich etwa 5-8 % der Schlachtschweine in andere europäische Länder verbracht, nur wenige Tiere gehen dabei in Drittländer außerhalb Europas.
Weitere Nutztierarten:
Der Schafbestand in der BRD betrug 2010 ca. 2 Mio. Schafe, darunter 1,3 Mio. Mutterschafe. In Deutschland wurden 2013 ca. 1,1 Mio. kleine Wiederkäuer (Schafe, Ziegen) befördert. Die jährlichen Schlachtzahlen in deutschen Schlachtbetrieben liegen bei ca. 1 Mio. Tieren.
Geflügel
Geflügelwirtschaft und Geflügelfleischerzeugung verzeichnen eine steigende wirtschaftliche Bedeutung in Deutschland und vielen europäischen Ländern. Die Produktionszahlen an Schlachtgeflügel sind beeindruckend. Weltweit werden ca. 100 Millionen Tonnen Geflügelfleisch erzeugt; innerhalb der EU sind es ca. 12,7 Millionen Tonnen (davon Broiler ca. 10 Millionen Tonnen, Puten ca. 1,9 Millionen Tonnen). In der Summe werden ca. 6,9 Milliarden Geflügel EU–weit jährlich befördert. (MITCHELL, 2014). Der Geflügelbestand in Deutschland lag 2010 bei 129 Mio. Tieren, darunter 27,2 Millionen Hennen. Die Legehennenhaltung ist allgemein durch große Einheiten gekennzeichnet. Rund 1100 Betriebe verfügen über 3000 oder mehr Hennenhaltungsplätze (Stat. Bundesamt, www.destatis.de).
2.1.2Tiertransporte in der Kritik
Medienberichte über Tierquälereien auf Ferntransporten brachten vor Jahren die öffentliche Diskussion über Tiertransporte in Gang und sensibilisierten zunehmend die Bevölkerung für die Belange des Tierschutzes beim Befördern von Tieren. Das Thema wird vielfach emotional diskutiert. Dadurch kann es jedoch zu einseitigen oder verzerrten Wahrnehmungen kommen. Kritisieren hilft aber in der Sache nicht weiter. Tierbeförderungen sind nun mal notwendig. Verbesserungen lassen sich dagegen durch Sachverstand, Aufklärung, praktikable Änderungsvorschläge, Gesetzesinitiativen und deren konsequente Umsetzung sowie durch Motivation erreichen.
In erster Linie ist es die Ausfuhr von Schlachttieren, die von der öffentlichen Meinung beanstandet und heftig abgelehnt wird. Tatsächlich steht die in den letzten Jahren zu beobachtende Zunahme der Schlachtrinderexporte im krassen Widerspruch zu den Intentionen der Tiertransportverordnung, wonach grundsätzlich (zit. Erwägungsgrund 5 der VO (EG) 1/2005) „aus Tierschutzgründen […] lange Beförderungen von Tieren – auch von Schlachttieren – auf ein Mindestmaß begrenzt werden sollten.“
Tierschutzorganisationen sehen hauptsächlich bei Schlachtviehtransporten über lange Strecken das Tierwohl gravierend gefährdet und wollen diese auf wenige Stunden beschränken. Sie kämpfen auch seit längerem für ein Verbot von Langstreckentransporten. Dabei bemängeln sie u.a. Schlampereien oder brutale Umgangsformen des Personals, fehlende Pausen und Ruhezeiten, schlecht ausgestattete Fahrzeuge oder mangelnde Versorgung von Tieren. Eine Mehrheit in der Bevölkerung ist stark daran interessiert, die Beförderung von lebenden Schlachttieren durch den Transport von Fleisch zu ersetzen. Der Transport von Fleisch wäre tendenziell kostengünstiger als ein Lebendviehtransport. Dies liegt zum einen daran, dass das Lebendgewicht eines Tieres erheblich höher ist als das Gewicht des entsprechenden Schlachtkörpers. Darüber hinaus haben Lebendviehtransport-LKW bauartbedingt eine geringere Nutzlast und der Bedarf an Laderaum ist für Lebendvieh erheblich größer.
Deutschland kann sich zugutehalten, dass es Schlachttierexporte (im Unterschied zu Zuchttierexporten) nicht durch bilaterale Handelsabkommen erleichtert. „Vor diesem Hintergrund …“, dass nämlich Tiere insbesondere bei langen Beförderungen besonderen Belastungen ausgesetzt sein können, sollten Transporte von Schlachttieren über große Entfernungen grundsätzlich auf ein Minimum begrenzt und Langzeittransporte von Schlachttieren durch Fleischtransporte ersetzt werden, „…stimmt die Bundesregierung auch keine weiteren Veterinärbescheinigungen mehr für den Export von Schlachttieren in Drittländer ab“ (zit. Bundesrat 2013).
Betreffend der vielfach außer Streit gestellten Zuchtrinder-Exporte muss erwähnt werden, dass es europaweit kaum bestätigte öffentliche Daten dazu gibt, ob es dabei überhaupt zum Aufbau vermehrungsfähiger Herden im Empfängerland kommt, da in der Regel keinerlei Verlaufskontrollen über den Verbleib der Tiere existieren.
Um den vielen Beschwerden über tierquälerische Tiertransporte entgegenzutreten, den Wünschen weiter Bevölkerungskreise Rechnung zu tragen und um Verbesserungen zu erreichen, musste der Gesetzgeber handeln. Daraus resultierte bereits 1991 die EU-Richtlinie zum Schutz von Tieren beim Transport (RL 91/628/EWG). Sechs Jahre später (1997) wurden die europäischen Tierschutzziele mit der Tierschutztransportverordnung in deutsches Recht umgesetzt. Trotz einzelstaatlicher Bemühungen, Verbesserungen zu erreichen, haben viele EU-Mitgliedsländer diese Richtlinie nur ungenügend und uneinheitlich umgesetzt. Sodann versuchten die Brüsseler Behörden viele Jahre später, mit der Verordnung (EG) 1/2005 einheitliche Transportstandards im europäischen Tierverkehr durchzusetzen, ein wichtiger Schritt in Richtung Tierschutz. Die Anforderungen dieser Verordnung blieben aber aus Sicht von Tierschutzorganisationen noch immer weit hinter den allgemeinen Erwartungen zurück. Denn für die heftig umstrittenen Hauptproblempunkte auf Ferntransporten, namentlich Transportzeiten, Ladedichten und Anforderungen an das Klima im Laderaum, wurden die bereits seit längerem gültigen Gesetzesregelungen unverändert übernommen. Wünschenswert wäre – auch aus Sicht der Autoren – gewesen, wenn wissenschaftliche Untersuchungen zum Verhalten und zu Stressfaktoren für die einzelnen Tierarten stärker berücksichtigt und daraus höhere Anforderungen oder Verbote in der Rechtssetzung abgeleitet worden wären.
Abb. 9 Grenzkontrollstelle Polen – Russische Föderation, Durchgangspunkt für zahlreiche Nutztiertransporte.
Unterschiede in der Anwendung von Vorschriften
Die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 über den Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen gelten seit 5. Januar 2007 in allen Mitgliedstaaten der EU. Damit sind auf den ersten Blick einheitliche Standards gesetzt. Sowohl Transporteure als auch Überwachungsbehörden sollten damit eindeutige und praktikable Vorgaben haben, um den Belastungen beim Transport wirksam zu begegnen. Die Bestimmungen sind jedoch nur dann eine Verbesserung für die Not der Tiere, wenn sie in allen Ländern in die Praxis umgesetzt und wirksam kontrolliert werden. Leider fallen die Auslegungen der Regelungen, die in vielen Fällen recht allgemein gehaltenen sind, im Ländervergleich recht unterschiedlich aus. Es gibt daher begründete Zweifel an der Umsetzbarkeit der EU-Tiertransportverordnung, weil es unterschiedliche Fassungen in den Amtssprachen Europas gibt, weil viele Bestimmungen unzureichend definiert sind (z. B. „ausreichende“ Laderaumhöhe, „angemessene“ Luftzirkulation, „geeignete“ Einstreu) und weil keine Durchführungsbestimmungen erlassen werden.
Wie das FVO zu berichten weiß, entsprechen viele Langstreckentransportfahrzeuge auch noch Jahre nach Inkrafttreten der Tiertransportverordnung nicht den Anforderungen hinsichtlich der Ausstattung, was dann eine Gefahr für Leib und Leben der Tiere bedeutet (vgl. Abb. 010). Beispielsweise können Tränksysteme ungeeignet, falsch angebracht oder für die transportierte Tierart gänzlich ungeeignet sein; beispielsweise kann von Trennwänden und Hubböden eine eminente Verletzungsgefahr der Tiere ausgehen oder die Lüftungssysteme können die erforderlichen Innenraumtemperaturen nicht halten.
Manche Staaten führen auch nur unzureichende oder keine risikobasierten Straßenkontrollen von Tiertransporten durch, obwohl sie dazu verpflichtet sind. So nehmen Tiertransportunternehmer manchmal weite Routenabweichungen in Kauf, um Gebiete mit hoher Kontrolldichte und/oder hohen Strafen zu umfahren. Aus diesen und vielerlei anderen Gründen müssen vermehrt Anstrengungen unternommen werden, die Regeln überall einheitlich umzusetzen.
Sogar wenn Tiere das Gebiet der Europäischen Union verlassen, sind die Transportbestimmungen von der Ladestelle bis zum Zielort in einem Drittland einzuhalten. Demgegenüber lassen sich Ferntransporte in Drittländer nach wie vor nicht sicher kontrollieren. Denn es fehlen zumeist ausreichende Informationen über die Qualität von Transportstrecken oder die Möglichkeiten der Versorgung und Unterbringung von Tieren nach Passieren der EU-Grenzkontrollstellen. Gibt es Hinweise, dass die europäischen Tierschutztransport-Standards nach Verlassen der EU-Grenzen nicht mehr eingehalten werden können, dürfen solche Transporte von Veterinären nicht abgefertigt werden (EuGH-Urteil in der Rechtssache C-424/13, 2015). Ferntransporte mit lebenden Tieren wurden seit 1970 durch Ausfuhrerstattungen für Nutztiere mit EU-Mitteln gefördert. Sie sollten die Differenz zwischen dem höheren Preisniveau in Europa und dem niedrigeren Weltmarktpreis ausgleichen. Dabei setzte die Auszahlung der Exporterstattung den Nachweis über den tierschutzgerechten Transport bis zum Zielort voraus. Dies ließ sich jedoch nur anhand der am Ende des Transportes vorgelegten Dokumente überprüfen. Gegner der Ferntransporte forderten daher seit langem die Streichung aller Exporterstattungen für lebende Tiere, die letztendlich die Ferntransporte lukrativ gemacht hatten. Anreiz hierfür waren Millionen von Euros jährlich aus der EU-Kasse. Seit 2005 sind die Erstattungen für Lebendviehexporte immer stärker zurückgegangen bis sie im Jahre 2013 glücklicherweise ganz abgeschafft wurden. In der Folge kam es zu einem deutlichen Rückgang der Drittlandtiertransporte.
Abb. 10 Beispiel: Ungeeigneter Tränkenippel für Rinder.
Um die vielfältigen Transportvorschriften in Europa durchsetzen und überprüfen zu können, müssen den zuständigen Kontrollbehörden umfangreiche Befugnisse eingeräumt werden. Die wirksame Überwachung des internationalen Handels erfordert nicht nur eine grenzüberschreitende Kooperation zwischen Veterinärdiensten, Polizei- und Zollbehörden, sondern auch ausreichenden Rückhalt auf politischer Ebene. Hier kann jeder Bürger seinen Beitrag leisten, indem er die öffentlichen Interessen an die Politiker heranträgt.
Häufige Transporte von großen Tiergruppen quer durch Europa, besonders wenn diese auf Märkten für Lebendtiere und anderen Sammelplätzen zusammenkommen, bergen nicht nur Gefährdungspotential für das tierische Wohlbefinden, sondern auch große Risiken für die Tiergesundheit. Daher müssen beim Transport auch stets die tierseuchenrechtlichen Bestimmungen (z. B. Gesundheitsbescheinigungen, Desinfektionsmaßnahmen) beachtet werden.
Besserung in Sicht
Mittlerweile gibt es viele Verbesserungen. Der Bedarf an einem internationalen, einheitlichen und zuverlässigen System zur Identifizierung und Registrierung von Tieren und Fahrzeugen wurde frühzeitig von den EU-Behörden erkannt und in den einschlägigen Transport- und Viehhandelsvorschriften umgesetzt. Technische Fortschritte auf dem Gebiet der satellitengestützten Navigation erlauben heutzutage umfassendere Kontrollmöglichkeiten als früher. Die Vorteile der exakten Verfolgung von Transportstrecken und -zeiten kommen hauptsächlich bei der Beförderung von Tieren auf weite Entfernungen zur Geltung. Dennoch gibt es nach wie vor Bedarf, die bestehenden Transportvorschriften praktikabler und akzeptabler zu gestalten und die Kontrollmöglichkeiten stetig zu verbessern.
Doch trotz aller Ausweitung der Vorschriften und Kontrollverschärfungen sind Fälle, in denen der Tierschutz eklatant missachtet wird, auch in Zukunft nicht sicher auszuschließen. Es braucht eben auch Menschen, die in der Lage sind, die Erfordernisse im Alltag umzusetzen. Daher sollte alles dafür getan werden, die am Transport beteiligten Personen regelmäßig auf die Bedeutung tierschutzrelevanter Belange aufmerksam zu machen und sie regelmäßig und qualifiziert zu schulen. Dann kann Tierschutz in der Praxis gelingen.
2.1.3Belastungsfaktoren auf Tiertransporten
Transport heißt Ortsveränderung; einschneidende Umstellungen belasten die Tiere. Dabei reagieren Tiere je nach Art und Nutzungskategorie unterschiedlich auf die speziellen Belastungen beim Transport. Für viele reisegewohnten Turnierpferde oder Haushunde gehört die Beförderung zum Alltag. Deshalb hält sich deren Aufregung zumeist in Grenzen. Für transportungewohnte Nutztiere oder gefangene Wildtiere dagegen bedeuten das Verbringen in die ungewohnte und beengte Umgebung eines Transportmittels, das Gefahrenwerden und das Entladen eine erhebliche Belastung.
Neue oder unangenehme Reize können beim Transporttier zu Stressbelastungen führen. Wie die Tiere auf den Transport vorbereitet werden, entscheidet darüber, wie gut sie mit der häufig außergewöhnlichen Situation zu Recht kommen. Bei Tieren sind die Sinnesorgane sehr viel empfindlicher ausgebildet als beim Menschen. Auf plötzlichen Lichtwechsel, auf Verkehrslärm, laut zuschlagende Abteiltüren oder fremde Gerüche können daher manchmal sehr heftige Reaktionen der Transporttiere folgen und in Angst, Panik oder Angriffsverhalten münden. Stets haben diese emotionalen und körperlichen Belastungen im Tierkörper eine Aktivitätssteigerung der Muskeln und Organe zur Folge. Jeder, der Tiere verlädt, weiß, wie unruhig z. B. Schweine sind, die gerade aufgeladen werden. Obwohl die Abteiltür längst geschlossen ist, dauert es lange, bis alle Tiere ihren Platz gefunden haben und sich in Ruhe ablegen. Solange die allgemeine Aufregung anhält, steigen Herzschlag, Grundumsatz und Körpertemperatur. Diese Wärmeenergie lässt die Laderaumtemperatur sprunghaft und messbar ansteigen. Der stressbedingte Temperaturanstieg, der meist kurz nach der Beladung auftritt, trägt mehr zum Hitzestress beim Tier bei, als beispielsweise erhöhte Außentemperaturen (Marahrens 2014).
Tiere können sich im Allgemeinen gut an veränderte Klimaverhältnisse anpassen. Treten ungewohnte Witterungsverhältnisse jedoch plötzlich auf, insbesondere rasche Wetterwechsel, wirkt dies sehr belastend auf die Tiere.
Es ist Aufgabe aller Beteiligten, die Belastungen bei der Tierbeförderung möglichst gering zu halten. Denn wissenschaftliche Untersuchungen belegen: Transportbelastungen haben direkte und schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit von Nutztieren nach dem Transport und auch auf die Fleischqualität von Schlachttieren.
Zusammengefasst führen folgende Hauptursachen zu Stressbelastungen beim Tiertransport:
2.1.3.1Tierbedingte Belastungsfaktoren:
•Fehlende Transportroutine, Krankheit, ungenügende Futter- oder Wasseraufnahme, genetische Veranlagung, schlechte Vorerfahrungen
•Verlust der vertrauten Umgebung, Zurechtfinden an fremdem Ort, Rangordnungskämpfe, direkter Kontakt mit fremden Tieren und fremden Personen, fehlende Ausweichmöglichkeiten, eingeschränkte Bewegungsmöglichkeit
Abb. 11 Das Fahrpersonal trägt die Verantwortung dafür, dass die Belastung für die Tiere so gering wie möglich gehalten wird.
Folgereaktionen:
Körperlich: Anstieg von Körpertemperatur, Herz- und Atemfrequenz, Anstieg der Stresshormone, Herz- Kreislaufbelastung, Muskelzittern.
Verhalten: Angst, panische Flucht oder Angriffsreaktion, Lautäußerung, Kot- und Harnabsatz.
Weitere Folgen bei langer Beförderung: Durst und ggf. Austrocknung, Hunger verbunden mit Abbau der Körperreserven, sinkende Abwehrleistung, Erschöpfung.
2.1.3.2Klimatische, umgebungsbedingte Belastungsfaktoren:
•Hitze, Kälte
•Luftfeuchtigkeit
•Luftbewegung, Zugluft
•Sonneneinstrahlung
•Sauerstoffgehalt
Folgereaktionen: Schwitzen, Frieren, Sauerstoffmangel
2.1.3.3Fahrzeugbedingte Belastungsfaktoren:
•Ungeeignete Fahrzeuge oder Ausstattung
•Platzmangel durch zu kleine Ladefläche oder Überbelegung
•Schadgase bzw. Sauerstoffmangel durch mangelnde oder fehlerhafte Belüftung
•Erheblicher Lärm und Fahrzeugvibrationen
•Beschleunigungskräfte durch unangepasste, ruppige Fahrweise oder schlechte Straßenbeschaffenheit
•Abrupter Wechsel von Licht, Schatten, Dunkelheit
•Gefährlicher Kontakt mit Fahrzeugteilen (Gefahr von Einklemmen, Verletzung, Verbrennung oder Erfrierung)
•Erschwerter Zugang zu Wasser und Futter (ungeeignete Tränke- bzw. Futtereinrichtungen, überlange Transportdauer)
•Panne oder Unfall mit unterbliebenen oder nicht angemessenen Maßnahmen
Folgeschäden: Verletzungen, Quetschungen, Schmerzen, Leiden, körperliche Schäden
Abb. 12 Belastungsfaktoren.
2.1.3.4Personalbedingte Belastungsfaktoren:
•Mangelnde oder fehlende Transportvorbereitung
•Ungünstige Be- und Entladesituation, falsche Treibhilfen
•Fehlende Pflege und Kontrolle während des Transports (insbesondere bei langer Beförderung ohne Versorgung mit Wasser und Futter oder fehlendes Melken)
•Unterbliebene oder nicht angemessene Notfallmaßnahmen
Belastungen können also beim Transport auf vielfache Arten entstehen. Die Auswirkungen sind dementsprechend unterschiedlich. Umfangreiche internationale Studien unter deutscher Beteiligung bewerten diese Faktoren und schätzen das Risiko ein (EU-Projekte „AIR“ und „CATRA“ zur Belastung von Schweinen und Rindern beim Transport, EFSA-Projekt „TRAW“ zur Erstellung von Leitlinien für die Risikobewertung beim Tiertransport).
Als besondere Risikopunkte wurden erkannt:
•Das Mischen von Tiergruppen
•Belastende Belade- und Entladevorgänge
•Überlange Transportdauer
•Zeitpunkt der Wasser- und Futteraufnahme
•Wirksamkeit der Fahrzeugbelüftung
•Fahrweise und Straßenbeschaffenheit
Abb. 13 Tiertransportschiff für Rinder.
Es lohnt sich für den Transporteur, nicht nur aus Tierschutzgründen und zur Tiergesundheitsvorsorge, diese Risikopunkte zu beachten und bei Mängeln einzugreifen. Die technische Ausstattung der Fahrzeuge und der Verladeeinrichtungen, die Ladedichte sowie die fachliche Kenntnis und Erfahrung des Fahrpersonals spielen ebenfalls eine große Rolle. Der Tierschutz beim Transport wird dadurch optimiert, dass die Kenntnisse und Fähigkeiten des Personals sich verbessern und die Transporteure sensibilisiert werden.
2.2Verschiedene Transportmittel im Tiertransportverkehr
Als Transportmittel gelten Straßenfahrzeuge, Schienenfahrzeuge, Schiffe, Luftfahrzeuge oder Behältnisse, die für den Transport von Tieren benutzt werden. Die meisten Tiere sind auf Straßen unterwegs. In Anhang I der VO 1/2005 sind die wesentlichen Details zur technischen Ausstattung jeweils ausgeführt.
Tiertransport mit dem Flugzeug
Seit den 1930er Jahren werden Tiere in stetig wachsender Zahl in Flugzeugen transportiert. Sie müssen dabei stets in Behältern untergebracht werden. Die Tiere werden im Frachtraum von Passagierflugzeugen einquartiert oder mit speziellen Cargo-Flugzeugen versandt (Göbel, 2011). Gerade auf weite Strecken bietet der Flugverkehr deutliche Vorteile wegen kürzerer Transportzeiten, allerdings bei einem höheren Preis.
Tiertransport auf der Schiene
Der Transport von Tieren mit der Eisenbahn spielt in Europa so gut wie keine Rolle mehr. Die Deutsche wie auch die Österreichische Bundesbahn führen beispielsweise keine Tiertransporte mehr durch.
Tiertransport per Schiff
Tierschutz muss auch auf hoher See eingehalten werden. Die Zahl von Tiertransporten auf dem Seeweg hat in den letzten Jahren zugenommen. Über das Mittelmeer ist Europa über die Häfen Kroatiens, Sloweniens, Italiens, Großbritanniens und Frankreichs mit Nordafrika, mit dem Nahen Osten und mit Vorderasien verbunden. Tiere werden von Amerika über den Atlantik regelmäßig nach Europa und über den Nord-Ostseekanal bis nach Russland durchgeführt. Ebenso gibt es einen regen Schiffsverkehr mit Rindern und Schafen, z. B. von Australien in die arabischen Staaten.
Straßenfahrzeuge – wichtigstes Transportmittel im Tierverkehr
Beim Transport von Haussäugetieren finden verschiedene Fahrzeug-Aufbauten Verwendung. Die Grundtypen sind in Abb.14 schematisch dargestellt. Es gibt in Abhängigkeit von den zu befördernden Tierarten Fahrzeuge mit nur einer Ladeebene oder auch mehrstöckige Fahrzeuge. Die Ladeebenen können Starrböden oder auch bewegliche Hubböden sein. Die meisten Lastkraftwagen haben aufklappbare Rampen, manche auch Außenlifte (Hebebühnen). Da die Zahl der Varianten und der konstruktiven Details groß ist, haben sich in Europa ganze Industriezweige auf die Herstellung von Aufbauten spezialisiert.
Geflügeltranporte erfolgen auf Ladeebenen, in welche die Transportbehältnisse mittels Hubstapler oder Rollwagen verladen werden können. Die mehrfächerigen Container für Hähnchen oder Puten werden zumeist mit vorstehenden Zapfen in Aussparungen des LKW-Daches verankert, sodass Container und Aufbau eine solide Einheit bilden. Rollwagen finden sowohl bei Transporten von Eintagsküken als auch von Junghennen Verwendung. Sie werden, ebenso wie die übereinander stapelbaren Plastikboxen, durch Querbügel zwischen den Seitenwänden des LKWs verrutschungssicher befestigt.
Die zulässigen Abmessungen von Kraftfahrzeugen und Anhängern sind europaweit uneinheitlich, betragen aber zumeist für das Zugfahrzeug wie auch für den Anhänger 4 m Höhe und 2,55 m Breite. Weder das Zugfahrzeug noch der Anhänger dürfen 12 m Länge überschreiten; dabei ist aber zu beachten, dass die Gesamtlänge von Lastzügen (d.i. der Motorwagen und sein Anhänger) maximal 18,75 m, die von Sattelkraftfahrzeugen 16,5 m nicht überschreiten darf.
Das höchst zulässige Gesamtgewicht eines dreiachsigen LKWs beträgt in Europa zumeist 26 Tonnen, das eines dreiachsigen Anhängers 24 Tonnen. Lastzüge wie auch Sattelschlepper dürfen in den meisten Mitgliedstaaten 40 Tonnen Gesamtgewicht nicht überschreiten. Abweichende Erfordernisse der Abmessungen und Tonnagen in den unterschiedlichen Staaten sind erhältlich und nachzulesen unter: www.internationaltransportforum.org.
Tiertransport in Behältnissen
Behältnisse werden häufig für kleinere Tiere aller Art verwendet. Für größere Tiere gibt es spezielle Container oder Käfige, die vorwiegend im Schiffs-, Bahn- und LKW-Verkehr Verwendung finden. In Flugzeugen ist die Beförderung in Behältnissen verpflichtend. Statistisch sind die mit Eisenbahnen, Schiffen und Flugzeugen beförderten Zahlen an lebenden Tieren bislang verhältnismäßig gering, lässt man die Zierfischimporte und Eintagskükenexporte unberücksichtigt.
Anmerkung:
Die Anforderungen an Transportfahrzeuge und an Behältnisse werden in Kap. 8 und 9 näher beschrieben. Die Zulassungserfordernisse für Straßentransportmittel sind in Kap. 6.5.3.2 zu finden.
Abb. 14 Verschiedene Fahrzeuge und Anhänger für Tiertransporte:
a) Kleinanhänger,
b) Starrdeichselanhänger – LKW/Zugfahrzeug,
c) 2-achsiger Anhänger,
d) Sattelkraftfahrzeug,
e) Sattelkraftfahrzeug mit Schwanenhals,
f) Sattelkraftfahrzeug mit Schwanenhals und Tiefbett.
3Grundlagen verhaltensgerechter Tiertransporte
Im Rahmen einer Tierbeförderung sind die arttypischen Eigenschaften der jeweiligen Tierart, deren Körperbau, Körperfunktionen, Verhalten sowie ihre sonstige biologische Veranlagung zu berücksichtigen. Neben dem Wissen um Krankheiten, Hygiene und Ernährungsbedürfnisse sind vor allem den Verhaltensweisen und Stressreaktionen Beachtung zu schenken.
3.1Körperbau und Körperfunktionen verschiedener Tierarten – Anatomie und Physiologie
3.1.1Allgemeine Merkmale der Tiergesundheit
Das gesunde und das kranke Tier
Transporte stellen für Tiere stets eine besondere Situation dar. Besonders bei hohen Außentemperaturen mit starker Sonneneinstrahlung und hoher Luftfeuchte kann es zu lebensbedrohlichen Belastungen der Tiere kommen. Deshalb dürfen nur gesunde Tiere verladen werden, bei denen alle Lebensvorgänge wie Futter- und Wasseraufnahme, Stoffwechsel, Bewegungsapparat und Beschaffenheit der Organe in Ordnung sind. Tiere, die sich erkennbar unwohl fühlen oder deren Allgemeinzustand deutlich von der Norm abweicht, sind vom Transport auszuschließen. Die Körperfunktionen dürfen nicht durch Unterkühlung, Überhitzung oder Fieber bereits beim Aufladen vorbelastet sein. Bei erkennbar durch Krankheit oder Verletzung beeinträchtigten Tieren ist sehr streng zu prüfen, ob das Tier den bevorstehenden Transportanforderungen gewachsen ist. Deshalb muss ein Transporteur den aktuellen Gesundheitszustand im Hinblick auf die Beförderung beurteilen können. Dazu wird das Tier sorgsam und genau von allen Seiten betrachtet. Praktischerweise geht man bei der Gesundheitsüberprüfung systematisch vor, indem das Tier von oben nach unten und von vorne nach hinten beschaut wird.
•Körperhaltung: Beurteilt werden die Kopf-Hals-Haltung einschließlich Ohren, Gliedmaßen, Schwanz, Rückenlinie und Bauchdecke.
•Verhalten: Die Tiere sollen ruhig und aufmerksam sein, Jungtiere auch lebhaft und aufmerksam; durch den Stress der Verladung und des Transportes können sich die Tiere manchmal schreckhaft oder ängstlich zeigen. Lautäußerungen dürfen keinen Hinweis auf Schmerzen geben. Die Körperhaltung gibt gemeinsam mit der Verhaltensreaktion Auskünfte über den Bewusstseinszustand des Einzeltieres, insbesondere ob es teilnahmslos und apathisch, oder aber hochgradig erregt, flucht- oder angriffsbereit ist.
•Ernährungszustand: Manche Tiere können in der Entwicklung gegenüber Artgenossen zurückgeblieben sein (Kümmerwuchs). Tiere dürfen nicht verladen werden, wenn sie hochgradig abgemagert, verfettet oder geschwächt sind; in solchen Fällen ist ein Tierarzt beizuziehen.
•Körperoberfläche: Ein über das Tier schweifender Blick auf das Haar- oder Federkleid und/oder auf die Hautoberfläche kann Hinweise auf Verletzungen geben. Gesundes Fell ist glatt, glänzend und anliegend.
•Bewegung: Beurteilt werden das Stehen und Gehen der Tiere. Bewegungsabläufe müssen ohne Probleme und ohne Schmerzen oder stärkere Lahmheit erfolgen können. Gegebenenfalls wird auch das Aufstehen und Niederlegen beurteilt.
•Körperorgane: Die Funktion der Verdauungsorgane kann anhand der Ausscheidungen beurteilt werden, insbesondere gibt die Kotbeschaffenheit (Durchfall/Verstopfung) Hinweise auf Verdauungsstörungen. Atmungsprobleme, insbesondere Schweratmigkeit oder Schnappatmung, können Hinweise auf Atemwegs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein. Erforderlichenfalls kann auch die innere Körpertemperatur gemessen werden. In bedenklichen Fällen ist ein Tierarzt beizuziehen.
Gesunde Tiere zeigen ein lebhaftes und aufmerksames Verhalten, straffe Körperhaltung, Ohren- und Augenspiel, das Haarkleid ist glatt und glänzend, die Rücken- und Bauchlinien erscheinen gerade und – für den Transporteur wichtig – alle Bewegungsabläufe laufen ungestört ab. Gesunde warmblütige Tiere können ihre Körpertemperatur auch bei wechselndem Außenklima konstant halten. Ein Tier fühlt sich am wohlsten, wenn es keine Energie zur Thermoregulation (z. B. durch Zittern, Hecheln, Schwitzen) aufwenden muss. Die thermoneutrale Zone ist tierartspezifisch und verändert sich im Laufe des Wachstums. Jungtiere haben grundsätzlich eine höhere Körpertemperatur als erwachsene Tiere. In den folgenden Abschnitten sind zu den einzelnen Nutztierarten die Gesundheitsanzeichen wie Allgemeinverhalten, Körpertemperatur, Pulsfrequenz, Atmungsfrequenz usw. aufgeführt.
3.1.2Erkennen von Gesundheitsstörungen
Gesundheitsstörungen liegen vor, wenn das Allgemeinbefinden gestört ist und bei Körpertemperatur, Pulsfrequenz oder Atmungsfrequenz stark abweichende Normalwerte festgestellt werden. Dies zeigt sich am Tier häufig durch Teilnahmslosigkeit, nachhaltiger Nahrungs- bzw. Trinkverweigerung oder bei Bewegungsstörungen. Der Tiertransporteur weiß: alle Tiere, die nicht von sich aus auf das Fahrzeug gehen können, dürfen nicht transportiert werden. Allgemeine Krankheitsanzeichen, die einen Transport zweifelhaft erscheinen lassen sind insbesondere: das Absondern von der Herde, Abseitsstehen bei der Fütterung, ein müder, matter und apathischer Eindruck, Verfärbung der Schleimhäute an Augen, Maulhöhle und Nase. Darüber hinaus kann die Atmungsfrequenz verändert sein; besonders alarmierend ist eine erschwerte Atmung mit Bewegung der Bauchdecke. Veränderte Körpertemperatur ist fühlbar an dem Wärmegrad der Ohren und auch durch Fieberthermometer messbar. Erhebliche Abmagerung ist immer ein Anzeichen einer längeren Krankheit bzw. Unterversorgung und ein Hinweis auf ein mögliches Transportverbot. Veränderte Ausscheidungen wie Durchfall, veränderter Urin, Schleim können auf Krankheitsanzeichen innerer Organe hindeuten.
3.1.3Tierartspezifische Merkmale
Alle Säugetiere und Vögel, darunter auch alle landwirtschaftlichen Nutztiere, gehören zum biologischen Stamm der Wirbeltiere (Vertebrata). Amphibien, Reptilien und Fische sind weitere Vertreter der Wirbeltiere. Nur für Wirbeltiere gelten die Bestimmungen der EU-Tierschutztransportvorschriften. Zudem sind alle landwirtschaftlichen Nutztiere einschließlich Nutzfische „Wirbeltiere“, von Bienen abgesehen.
3.1.3.1Pferde, Esel
Huftiere – Einhufer – Herdentiere – Fluchttiere – Pflanzenfresser
Die Entwicklung der Pferde bzw. insgesamt der Einhufer (Equiden) mit den echten Pferden, den Eseln, Mauleseln, Maultieren und Zebras hat sich in der Steppenlandschaft vollzogen. Dort weideten sie als Pflanzenfresser in Gruppen oder größeren Herden. Bei der Nahrungssuche und auf der Flucht vor Feinden waren diejenigen Tiere im Vorteil, die schnell große Strecken zurücklegen konnten. So bildete sich ein Lauf- und Fluchttier heraus, das nur noch mit einer Zehe den Boden berührte, mit leistungsfähigem Atmungs- und Herz-Kreislaufapparat, mit gut ausgebildeten Muskeln und hoch entwickelten Sinnesorganen. Pferde hören, riechen und sehen gut und zeigen als Herdentiere ein ausgeprägtes Sozialverhalten.
Pferde sind leistungsfähige Lauftiere, aber auch körperlich empfindlich, insbesondere beim Transport. Ihr einhöhliger Magen besitzt ein verhältnismäßig geringes Fassungsvermögen (8-15 Liter) und die aufgenommene Nahrung entleert sich rasch in die Gärkammern von Blind- und Dickdarm. Der Verdauungsapparat ist so beschaffen, dass praktisch dauernd Futter aufgenommen werden muss. Bereits nach 12 Stunden ohne Futteraufnahme können massive Anzeichen von Hunger auftreten (Unruhe, Schwitzen). Plötzliche Futterumstellungen vertragen Pferde schlecht, sie neigen dann zu einer Kolik. Ferntransporte sollten deshalb stets mit ausreichend Futter und Wasser von guter Qualität durchgeführt werden.
Pferde legen sich nur hin, wenn sie sich richtig sicher fühlen. Im Herdenverband passt immer ein Tier auf und döst nur, während die anderen schlafen. Ausgewachsene Pferde können nicht nur im Liegen, sondern auch im Stehen schlafen. Hierbei können sie Dösen, aber durchaus auch regelrechte Tiefschlafphasen (REM-Phasen) erleben. Eine anatomische Besonderheit, nämlich ein knöcherner Vorsprung an der Kniescheibe, ermöglicht das Einhängen der Beinsehne und damit die einseitige Entlastung der Hinterhandmuskeln. Das gegenüberliegende Vorderbein wird dabei leicht abgestellt und ebenfalls entlastet. Auch ältere oder gebrechliche Tiere, die sich nicht mehr hinlegen wollen oder können, müssen somit nicht auf Schlaf verzichten. Da Fohlen jedoch diese „Nase“ an der Kniescheibe noch nicht ausgebildet haben und ein erhöhtes Ruhebedürfnis haben, müssen sie sich zum Schlafen immer hinlegen.
Die langen und verletzungsanfälligen Beine sowie der hohe Körperschwerpunkt von Pferden erfordern speziell konstruierte Transportfahrzeuge und besondere Vorsorgemaßnahmen beim Verladen. Die kräftig ausgebildete Muskulatur kann bei übermäßiger Belastung erkranken ("Kreuzverschlag" der Rückenmuskulatur), bei nicht geeigneter Fütterung kann sich die Huflederhaut entzünden („Hufrehe").
Wer Pferde befördert, insbesondere auf Langzeittransporten, muss sie besonders sorgfältig beobachten. Um den Gesundheitszustand beurteilen zu können, sind Kenntnisse über die Körperwerte notwendig. Ein Großpferd scheidet pro Tag rund fünf bis sieben Liter Urin und zwölf bis fünfzehn Kilo Kot aus. Gesunde Pferde nehmen angebotenes Futter auf, sie sind aufmerksam, belasten alle vier Beine, das Haarkleid ist trocken, glatt und glänzend und die Hautoberfläche ohne Verletzungen.
Kranke Pferde erkennt man an starkem Schwitzen und angestrengter Atmung oder die Tiere sind teilnahmslos schläfrig und nach innen gekehrt. Bei starken Schmerzen zeigen die Tiere deutliche Unruhe, scharren mit den Vorderbeinen; häufiges Hinwerfen und Wälzen kann Anzeichen einer Kolik sein. Pferde brauchen viel Bewegung. Beinverletzungen oder -Erkrankungen zeigen sich in Schwellungen, unsicherer Bewegung oder Lahmheit.
3.1.3.2Rinder
Paarhufer – Herdentiere – Pflanzenfresser – Wiederkäuer
Körperbau und Körperfunktion
Rinder sind Pflanzenfresser mit mehrhöhligem Wiederkäuermagen (Gesamtinhalt von 100 bis ca. 250 Liter; 3 Vormägen, 1 Labmagen). Das Kalb besitzt noch keine ausgebildeten Vormägen, solange es mit Milch ernährt wird. Beim Kalb mit 1-höhligem Magen findet noch kein Wiederkauen statt. Typisch für milchentwöhnte Rinder ist das Wiederkauen: nach der Mahlzeit wird in 5-7 stündigen Ruhephasen die Nahrung immer wieder hochgewürgt und weiter zerkaut; Aufschluss der Nahrung durch Kleinlebewesen.
Der Wiederkäuermagen ermöglicht es, im Futter auch solche Kohlenhydrate durch Bakterien und Einzeller mikrobiell zu verdauen, die für andere Säugetiere mit nur einem Magen (Monogastrier) unverdaulich sind, z. B. Zellulose. Hierzu muss das Futter mehrmals gekaut, abgeschluckt und in Ruhephasen wieder hochgewürgt werden. Vor einem Transport von Rindern, insbesondere vor Ferntransporten, darf keine abrupte Futterumstellung erfolgen, z. B. von Grünfutter auf Heu. Bei längerem Futter- und Wasserentzug droht das Aufblähen des Pansens, das bis zum Tode führen kann. Für Rinder ist es wegen des hohen Schwerpunktes und des relativ hohen Körpergewichtes nicht einfach, auf einem bewegten Fahrzeug das Gleichgewicht zu halten. Nach einem Niederstürzen haben die Tiere Schwierigkeiten, wieder aufzustehen. Die Ladedichte ist entsprechend anzupassen; zu viel Platz sorgt für Instabilität; bei zu wenig Platz können die stehenden Tiere nicht ausbalancieren. Gestürzte Tiere laufen Gefahr, nicht mehr aufstehen zu können und verletzt oder gar erdrückt zu werden.
Die Haut des Rindes ist trotz ihrer Dicke sehr empfindsam. Beim Berühren bedarf es bei manchen nur eines kurzen, leichten Druckes mit dem Finger oder der Hand, um dem Tier einen Impuls zu geben. Andere Rinder zeigen sich dagegen störrisch.
Beachte bei Rindern:
keine rasche Futterumstellung; Gefahr des Aufblähens nach langem Futter-/Wassermangel Hoher Schwerpunkt – Schwierigkeit beim Aufstehen
Ladedichte:
zu viel Platz – Gefahr des Umfallens; zu wenig Platz – behindert das Ausbalancieren, mit Gefahr des Niedergehens und Festliegens Täglicher Wasserbedarf: 50–100 Liter, Täglicher Futterbedarf: 5–9 kg Heu (oder anderes Grundfutter)
Atemluft: 50 Liter bis 500 Liter pro Minute
Sehvermögen
Rinder können bis auf einen kleinen toten Winkel im Schwanzbereich fast komplett um sich herum sehen, allerdings nur zweidimensional (ca. 330° Rundumsicht). Dreidimensionales Sehen ist nur vor dem Kopf (ca. 30°) möglich. Hier sehen Rinder im Nahbereich scharf. Das Rinderauge besitzt nur zwei Farbrezeptoren. Es erkennt blau und grün gut, rot dagegen nur schlecht. Bei schlechten Lichtverhältnissen (Dämmerlicht) sehen Rinder besser als der Mensch, sie können sich jedoch bei Hell-Dunkel-Wechseln nur langsam umstellen. Kontraste sind für sie schwer erkennbar. Die Sehschärfe beträgt nur ca. 30 % des Menschen.
Trächtigkeit und Geburt
Die Bestimmung des Geburtstermins lässt sich am einfachsten anhand der Zuchtpapiere (Deckschein, Besamungsschein) bestimmen. Um zu entscheiden, ob die Geburt unmittelbar bevorsteht (im letzten Zehntel der Trächtigkeit Transportverbot!), müssen die sichtbaren Anzeichen einer Geburt erkannt werden.
Anzeichen der Geburt sind:
•Einsinken der Flanken und Beckenbänder
•Vergrößerung und Straffung der Milchdrüse („Aufeutern“)
•Anschwellen der Scham
•Schleimabsonderung aus der Scheide
Wie kann man den Geburtszeitpunkt abschätzen?
Je näher der Geburtstermin heranrückt, umso lockerer werden Bänder und Bindegewebe, erkennbar am Erschlaffen der Beckenbänder. Kreuzbein und Sitzbeinhöcker treten dadurch deutlich hervor, zwischen Schweifwurzel und Sitzbeinhöcker entsteht eine Mulde. Die Schamlippen vergrößern sich und werden weich. Zudem steigt die Körpertemperatur vor der Geburt um 1 °C bis 1,5 °C an. Anhand der Weichheit der Beckenbänder, evtl. in Kombination mit einer Temperaturmessung, lässt sich vorhersagen, ob das Tier in Kürze kalbt. Je weicher die Beckenbänder werden, umso näher rückt die Geburt. Ein sicheres Zeichen, dass die Kalbung unmittelbar bevorsteht, ist auch, wenn sich die Schwanzquaste komplett umbiegen lässt. Dies ist unter normalen Umständen nicht möglich.
Bei Herden, die ganzjährig im Freien gehalten werden (Mutterkuhherden), übernimmt meist ein Bulle die Belegung. In diesen Fällen gibt es oft keinerlei Hinweise auf das Deckdatum oder den zu erwartenden Geburtszeitpunkt. Solche Rinder lassen sich auch häufig nicht anfassen, geschweige denn untersuchen. Umso wichtiger ist hierbei die Beobachtung der äußeren Anzeichen (Vergrößerung von Bauchumfang, Euter und Genitalien, Ausfluss von Schleim oder Fruchtwasser).
3.1.3.3Schweine
Paarhufer – Herdentiere – Allesfresser
Schweine sind Allesfresser mit einhöhligem Magen, der nur ein Fassungsvermögen von etwa 3–5 Litern besitzt; Futter wird mittels Magensäften verdaut. Auf einer Fahrt mit raschem Beschleunigen und Bremsen sowie Kurvenfahren können starke Magenbewegungen und in der Folge Übelkeit und Erbrechen beobachtet werden, ähnlich der Reisekrankheit des Menschen.
Während Geruchs- und Geschmackssinn gut entwickelt sind, ist dagegen das Sehvermögen minder ausgeprägt. Schweine besitzen außer an der Rüsselscheibe keine Schweißdrüsen. Überschüssige Körperwärme wird daher vorwiegend durch Hechelatmung und Hautkontakt mit feuchtem Boden, Wasser oder Suhlen abgegeben. Auf Transportfahrzeugen muss daher für gute Lüftung gesorgt sein. Sprühanlagen mit Wassernebel können zusätzlich Abkühlung verschaffen.
Arttypisch ist das Wühlen mit dem Rüssel im Untergrund, um unterirdische Pflanzenteile, Würmer und Insekten freizulegen. Hausschweine wurden durch die Domestikation aus Wildschweinen erheblich verändert. Gegenüber dem Wildtier hat sich beim heute gezüchteten Hochleistungsschwein aus Sicht der Transporteure einiges zum Nachteil entwickelt:
•die fehlende Behaarung bietet keinen Schutz mehr vor Kälte oder Sonne.
•das schnelle Muskelwachstum bei verhältnismäßig geringem Herzvolumen bedingt eine schlechte Blutversorgung; somit sind die Tiere wenig belastbar.
•die Speckschicht isoliert und speichert Körperwärme, so dass Überhitzungsgefahr besteht.
Abb. 15 Anzeichen für Überhitzung beim Schwein.
Schweine sind gesellige Tiere, die vorzugsweise in Gruppen gehalten werden. Ein deutliches Anzeichen für gestörtes Allgemeinbefinden ist die nachhaltige Nahrungs- oder Wasserverweigerung. Krankhafte Zustände sind bei Schweinen auch an veränderter Bewegung, z. B. starke Lahmheit bis zum Festliegen, zu beobachten.





























