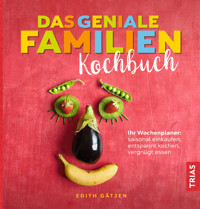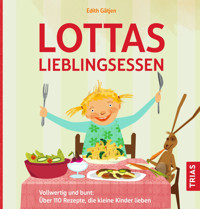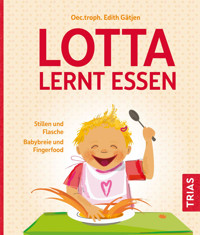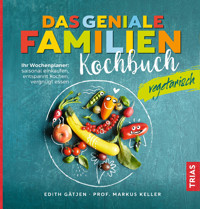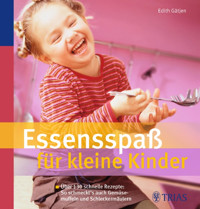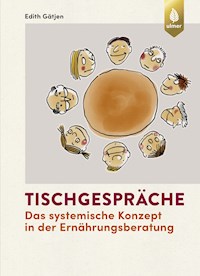
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Eugen Ulmer
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Ernährung ist in aller Munde, aber das, was wir tun, ist Essen – ein Verhalten und Beziehungsthema zugleich. Wenn der Ernährung in der Beratung eine größere Bedeutung beigemessen wird als dem Essen, ist nachhaltige Veränderung der Essgewohnheiten oft nicht gesichert. Systemisch arbeiten heißt Veränderung von Beziehungen. Im systemischen Konzept der Tischgespräche werden die vielfältigen Beziehungen im Kontext „Essen“ beschrieben. Das Buch gibt Einblick in die systemischen Denk- und Handelsweisen und stellt Handwerkszeug und Praxisunterlagen für die Ernährungsberatung zur Verfügung. Ein für Ernährungsberater und Klienten gleichermaßen eingängiges Buch, das über den Tellerrand blickt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Edith Gätjen
TISCHGESPRÄCHE
Das systemische Konzept in der Ernährungsberatung
Inhalt
Systemische Beratung
Systemisch beraten
Ressourcenorientiert arbeiten
Lösungsorientiert denken
Kontextorientiert blicken
Konstruktivistisch herangehen
Hypothesen bilden
Möglichkeitsräume öffnen
Unterschied machen
Klientenorientiert vorgehen
Methode der Neutralität
Systemische Haltung
Haltung annehmen
Haltung leben – das Klientenhaus
Klientenhaus entdecken
Haltung wahren
Haltung zeigen
Bedürfnisse
Essen – Sinneserfahrung für Körper und Seele
Von Erwartungen und Bedürfnissen
Mit Vertrauen Selbstvertrauen erlangen
Phasen der Essentwicklung
Erlerntes Muster
Essen ist an Mahlzeiten gebunden
Bedeutung einer Mahlzeit
Mahlzeiten strukturieren den Tag
Regeln bei Tisch
Essen – systemisch betrachtet
Essbiografie – warum wir essen, wie wir essen
Beziehung zu den virtuellen Mitessern
Beziehung zu den Menschen, mit denen gegessen wird
Beziehung zu den Lebensmitteln
Beziehung zu mir selbst
Grundsätze der systemischen Essberatung – Beraterqualifikation
Berater, die den Unterschied machen
Berater, die verstehen wollen, wie das Problem funktioniert
Berater, die Fragen stellen
Berater, die schenken wollen: Beziehung
Autonomie
Zeit
Berater, die lösungsorientiert arbeiten
Berater, die ressourcenorientiert arbeiten
Berater, die kontextorientiert arbeiten
Das systemische Erstgespräch
Vom Kontakt zum Kontrakt
Aufbau des Erstgesprächs
Kläger – Besucher – Kunde?
Beziehungspflege zwischen Berater und Klient
Systemische Essberatung – Möglichkeiten und Grenzen
Systemisches Handwerkszeug
Die wichtigsten Arten von systemischen Fragen
Frage nach Ausnahmen
Genauern mit den konstruktiven „W-Fragen“
Die „Was-noch-Frage“, eine erweiterte, konstruktive W-Frage
Die „Wofür-ist-das-gut-Frage“, eine erweiterte, konstruktive W-Frage
Hypothetische Frage
Bewältigungs-Frage
Zirkuläre Frage (triadische Frage)
Systemische Interventionen
Vor der Veränderung … steht die Verwirrung
Joining
Komplimente
Arbeiten mit der Landkarte des Essens
Skalieren
Time line
Arbeiten mit Bildern, Decken des inneren Esstischs
Aufstellung, Familienbrett
Bilderreise
Netzwerkkarte
Genogramm
Selbstwertstrauß
Transformation von Glaubenssätzen
Beobachtungsaufgabe
Orientierungsplan für Handlungsschritte
Systemische Interventionen auf einen Blick
Dies und das – Nützliches für die Beratung
Konzept der Tischgespräche
Das Konzept
Der bunt gedeckte Tisch
Der Mitessertisch
Der Familientisch
Der innere Esstisch
Der Beistelltisch
Tische und deren Bedeutung
Der Mitessertisch – Beziehung zu den virtuellen Mitessern
Familie als virtueller Mitesser
Gewohnheiten
Glaubenssätze
Angst
Lust
Genuss
Selbstbild/Körperbild
Ernährungsempfehlungen/ärztliche Ratschläge/Werbung
Allergien/Unverträglichkeiten
Stress/Schule/Arbeit
Zeit
Geld
Esskultur
Der Familientisch – Beziehung zu den Menschen, mit denen gegessen wird
Beziehungsmuster in Familien
Die Loyalität
Allianz
Koalition
Der innere Esstisch – Beziehung zu den Lebensmitteln
Der Beistelltisch – Beziehung zu mir selbst, meinen Gefühlen und Bedürfnissen
Essen aus emotionalem Stress
Wer ist der Klient?
Arbeiten mit den Tischen
Arbeiten mit dem Mitessertisch
Fallbeispiel Herr M.
Arbeiten mit dem Familientisch
Fallbeispiel Frau K.
Arbeiten mit dem inneren Esstisch
Fallbeispiel Frau Z.
Arbeiten mit dem Beistelltisch
Fallbeispiel Herr B.
Ergänzendes systemisches Beratungskonzept
Die systemische Sicht auf das Körpergewicht – Adipositas
Adipositas – systemisch betrachtet
Der Sinn hinter dem Symptom
Service
Unterlagen für die Praxis
Literatur
Die Autorin
Impressum
„Während der Kur habe ich mich wunderbar und mit großem Erfolg nach dem Diätplan der Ernährungsberaterin ernährt, wurde dort auch gut bekocht – alles war bestens. Aber wissen Sie, seitdem ich wieder zu Hause bin und mit meinen Lieben gemeinsam esse, ist alles wieder wie vorher – wie vor der Kur.“
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
diese oder ähnliche Aussagen hörte ich von Klientinnen und Klienten häufig – das war der Auslöser, über das Thema „Ernährungsberatung“ einmal grundsätzlich nachzudenken und die Arbeit zu reflektieren. Strukturiert hat mich meine Tätigkeit als systemische Paar- und Familientherapeutin. Herausgekommen sind dabei die „Tischgespräche – das systemische Konzept in der Ernährungsberatung“.
Auf der Hand liegt, dass es zwischen „sich nach einem vorgegebenen Plan zu ernähren“ und „mit den Lieben gemeinsam zu essen“ einen Unterschied geben muss, der so gewichtig ist, dass eine nachhaltige Veränderung des Essverhaltens häufig nicht funktioniert.
Wenn wir über Ernährung sprechen, dann geht es darum, was auf unsere Teller kommt. Der Bedarf steht im Vordergrund, die kognitive-rationale Ebene wird bedient. Essen hingegen ist ein Verhalten, das tun wir, dabei stehen die Bedürfnisse im Vordergrund, die emotional-sinnliche Beziehungsebene. So erfüllt Essen das „Wollen“, Ernähren hingegen das „Sollen“. Wenn die Klientinnen und Klienten nun das, was sie essen sollten, auch durchgehend essen wollten, wäre gewährleistet, dass unter anderem die Ziele der Gesundheitsverbesserung und das ökologische Bewusstsein erreicht würden und sie ohne empfundene Einschränkung genussvoll rundum satt würden.
Die Ernährungsberatung braucht einen Perspektivwechsel – denn dieser ermöglicht, Essen als ein vielschichtiges Beziehungsthema, ein intimes Verhalten eines jeden Menschen in seiner Gesamtheit als Teil mehrerer Systeme zu betrachten. Essen ist von Anfang an in zwischenmenschliche Interaktion eingebunden – Essen steht in Beziehung. Wenn Klientinnen und Klienten ihr Essverhalten nachhaltig verändern wollen, brauchen sie Beraterinnen und Berater, die im besten Fall das Thema „Essen“ systemisch angehen. Systemisch zu arbeiten heißt primär, eine systemische Haltung einzunehmen – wohlwollend und wertschätzend. Diese Haltung bestimmt unser Verhalten als Beraterinnen und Berater und somit unsere Kommunikation. Diese Haltung ermöglicht in der bisherigen Ernährungsberatung einen ergänzenden Blick. Die Tischgespräche erweitern dabei ihre Möglichkeiten um entscheidende Elemente – sie verbessern Beziehungen, sie lassen den Blick auf die Menschen in ihren Systemen zu und helfen beim Finden der Lösungen in den Klientinnen und Klienten selbst. Die Tischgespräche machen Spaß, sind überraschend, machen den Unterschied und ermöglichen, dass Klientinnen und Klienten die Veränderungen ihres Essverhaltens als eine bedürfnisbefriedigende Ressource erleben.
Mein besonderer Dank gilt zunächst meinem Freund und Kollegen Michael Steinbrügge, der mich bei der Entwicklung der Tischgespräche ständig unterstützt hat und mit dem ich gemeinsam seit mehreren Jahren auch Seminare zu diesem Thema beim UGB durchführe. Diese brachte mich letztendlich auch zu der Idee, dieses Buch zu schreiben. Weiterhin gilt der Dank meinem Mann, Dr. Bram Gätjen für seine Zeit und seine Unterstützung dabei, meine Gedanken zu sortieren. Lisa Seibel vom Ulmer Verlag danke ich dafür, dass sie mich und meine Idee, dieses Buch zu schreiben, von Anfang immer unterstützt hat, jederzeit ansprechbar war und meine Wünsche stets realisiert hat. Anja Fleischhauer danke ich dafür, das Buch respektvoll redigiert zu haben und Susanne Dinkel für ihre Illustrationen, ihr ist es gelungen, meine nicht vollständig formulierten Ideen aufzunehmen und genial umzusetzen.
Ihre Edith Gätjen
Köln, im Januar 2019
… Tischgespräche – lassen den Klientinnen und Klienten nicht nur die geliebte „Butter auf dem Brot“, sie geben sogar etwas dazu!
In diesem Buch finden Sie aus Gründen der besseren Lesbarkeit fast ausschließlich die männlichen Formen „Klient“ und „Berater“. Selbstverständlich gelten diese Bezeichnungen auch für andere Geschlechtsformen.
Ich widme das Buch unseren Kindern Lennart, Justus, Frieder, Philine und unserer Enkeltochter Carlotta.
Systemische Beratung
Der Begriff „Systemische Beratung/Therapie“ wird allgemein assoziiert mit „Familienaufstellungen“, „bestimmten, gewagten Methoden“, „um die Ecke denken und fragen“, „von Problemen nichts wissen wollen“ und nach „Wundern gefragt werden“. An diesen Aussagen ist viel Wahres, sie beschreiben allerdings nicht, was systemisches Denken und Handeln wirklich bedeutet. In diesem Kapitel werden die allgemeinen Grundlagen der systemischen Beratung, der Haltung und der Arbeitsweise beschrieben.
Sicherlich ist es so, dass jede Schule für Beratung und/oder Therapie, auch die verschiedenen systemischen Schulen, eigene Methodologien entwickelt haben. Daher gibt es in der Praxis nicht die eine Methode. Denn solche Abgrenzungen, eventuell auch Einengungen hindern den Berater daran, die Vielfalt der vorhandenen Richtungen und Methoden zu nutzen und sie werden insbesondere den diversen Anliegen unserer Klienten und ihrer Unterschiedlichkeit, aus systemischer Sicht, nicht gerecht. So ist der systemische Ansatz in der Ernährungsberatung als ein ergänzender – vielleicht neuer – Blick zu verstehen und nicht als für sich alleinstehende Beratungsmethode.
Der systemische Ansatz in der Ernährungsberatung ist als ein ergänzender – vielleicht neuer – Blick zu verstehen und nicht als für sich alleinstehende Beratungsmethode.
Als systemische Beratung wird heute ein Ansatz bezeichnet, der sich ab 1950 zunächst im Bereich der Familientherapie etabliert hat. Als „Mutter“ der Familientherapie und damit auch des systemischen Ansatzes gilt ohne jeden Zweifel Virginia Satir. Mitte des 20. Jahrhunderts hatte sie die revolutionäre Idee, statt Einzelpersonen ganze Familien zu therapieren. Die Familie wird als ein in sich selbst organisierendes System gesehen, in dem alle Elemente bzw. Mitglieder miteinander vernetzt sind. Irritationen, Störungen von außen oder innen bringen das ganze System oder Teile in Bewegung, vergleichbar wie bei einem Mobile.
Später entwickelten sich aus den Methoden des Familiensettings mehr und mehr neue Methoden und Konzepte für die systemische Beratung/Therapie. Heute findet man die systemische Arbeit im psychotherapeutischen Bereich und im Beratungskontext, auch als Einzel-, Paar-, Familien-, Gruppen- und Multi-Familien-Gruppen-Therapie/Beratung. Seit 2008 ist die systemische Beratung als wissenschaftliches Verfahren anerkannt. Den systemischen Ansatz findet man im Erziehungs- und Sozialwesen, besonders stark in Unternehmen als systemische Management-, Führungskräfte-, Team- und Organisations-Beratung. Seit einigen Jahren blicke ich in der Beratung und auch in meiner Arbeit als Dozentin systemisch auf „essen und trinken“. Hierfür habe ich ein eigenes Konzept entwickelt, die Tischgespräche.
Für die systemische Beratung gibt es keine Definition im eigenen Sinne und dennoch gibt es ein gemeinsames Merkmal für das systemische Arbeiten. Im Fokus jeder Beratung steht der Klient, wie er lebt und handelt, in seinem System, mit den vielfältigen Rückkopplungsprozessen. So ist das systemische Arbeiten gekennzeichnet durch Interventionen, die auf Hypothesen, Haltungen und Zielsetzungen gründen. Diese Interventionen sollen Veränderungen im Kontext des Klienten anregen.
Im Vordergrund der Beratung steht der Mensch in seinem Wachstum und seiner Entwicklung. Der Klient und seine Veränderungen sind das zentrale Thema. Die systemische Beratung orientiert sich am Anliegen und den Wünschen des Klienten. Sie ist ressourcen-, lösungs- und kontextorientiert. Der Berater und der Klient suchen nach Bedingungen, unter denen der Klient seine Ressourcen aktivieren kann, um eigenverantwortlich und selbst-organisiert zu neuen und individuellen Lösungen zu kommen. Der Klient ist Experte in der Sache „Problemlösung“, der Berater ist Experte im Machen von Experten.
Der Klient und seine Veränderungen sind das zentrale Thema.
In der systemischen Beratung werden nicht Probleme und deren Entstehung besprochen, sondern Ausnahmen von Problemen (systemische Frage: Wann trifft das Problem nicht auf? – siehe systemische Fragen, Fragen nach Ausnahmen). Damit werden mögliche Lösungen in den Blick genommen. Systemisch zu beraten bedeutet auch, zu kontextualisieren. Der Berater versteht seinen Klienten mit seinen Problemen innerhalb seines Lebenszusammenhangs und abhängig von diesem. Der Klient ist zwar der Symptomträger, gestört ist jedoch das System. Die Kontextualisierung von Problemen ist ein zentrales Moment von systemischen Beratungen und steht im Gegensatz zur individuumsbezogenen Vorgehensweise.
Was ist ein System?
Ein System ist eine Gesamtheit von Elementen, die untereinander durch Beziehungen verbunden sind. Systeme gibt es in verschiedenen Bereichen, auf molekularer Ebene, bei lebenden Systemen in der Biologie, aber auch als z.B. Sozial-, Kultur-, Wirtschaftssysteme und Familiensysteme. Jeder Mensch ist ein Teil mehrerer Systeme, eines übergeordneten Systems, z. B. Familie, Freunde, Schule, Firma, Gesundheitssystem, verschiedener Subsysteme der übergeordneten Systeme, z. B. Geschwister, beste Freunde, Schulklasse, Kollegen und Subsysteme in sich selbst bzw. der inneren Anteile – z. B. biologisch/physiologisch, psychisch, sozial. Innerhalb dieser Systeme gibt es Rückkopplungsprozesse. Bezeichnend für ein System ist, dass jeder Teil eines Systems mit jedem anderen Teil so verbunden ist, dass eine Änderung in einem Teil eine Änderung in allen Teilen und damit im gesamten System bewirkt.
Systemisch beraten
Der systemische Berater berät seine Klienten wohlwollend, wertschätzend, neutral und er ist empathisch. In der systemischen Beratung interessiert sich der Berater, wie Menschen in ihren sozialen Systemen gemeinsam eine Wirklichkeit erzeugen, welche Vorstellungen ihrem Denken und Erleben zugrunde liegen und welche Möglichkeiten sie haben, diese Vorstellungen zu hinterfragen. Kernpunkt der systemischen Beratung ist es, wie diese Vorstellungen verändert werden können. Die Arbeitsweise richtet sich nach den Ressourcen des Klienten. Die Lösung und nicht das Problem steht im Vordergrund – dabei wird stets der Zusammenhang zwischen dem Problem des Klienten und der Lösung zu seinem Umfeld /Kontext einbezogen.
Ressourcenorientiert arbeiten
Jeder Mensch verfügt über Ressourcen, Möglichkeiten und Kompetenzen, die er benötigt, um sein persönliches Anliegen/Problem zu klären und zu lösen – jeder ist sein eigener Experte. Der Berater geht davon aus, dass diese Ressourcen im Moment vergessen oder verschüttet sind und nicht genutzt werden können. Die Aufgabe des Beraters ist es, die Klienten dazu einzuladen, ihre Ressourcen wiederzuentdecken bzw. neuzuentdecken und kennenzulernen. Der Berater begibt sich gemeinsam mit dem Klienten auf die Suche nach dessen Ressourcen. Und das mit der Haltung, dass immer mehr in Ordnung als nicht in Ordnung ist. Er fragt nach den Ressourcen und forscht in den Erzählungen und Handlungen des Klienten danach. Er stellt ihm seine Beobachtungen zur Verfügung. Die gezielten Fragen nach Möglichkeiten und das darauf „Stupsen“ erzeugen bei den Klienten zuerst eine Verstörung ihrer aktuellen Sichtweise – eine Grundvoraussetzung für Veränderung. Anliegen des Beraters ist es hier, den Klienten zum Experten in der Sache Problemlösung zu machen.
Jeder Mensch verfügt über Ressourcen, um sein persönliches Problem zu klären. Das Anliegen des Beraters ist es, Menschen zu Experten ihrer selbst zu machen.
Lösungsorientiert denken
Das Denken in Lösungen ist ein zentrales Element in der systemischen Beratung, und zwar weg vom Problem/Defizit und hin zur Lösung. Hier geht man davon aus, dass die Lösung schon immer im System vorhanden ist. Der Klient verfügt über alle Ressourcen, die er zur Lösung seiner Probleme benötigt, nutzt diese aber nicht bzw. noch nicht. Dem Klienten ist dies auch nicht bewusst. Eigenschaften wie Kreativität, Organisationstalent oder in der Vergangenheit nachhaltig gelöste Probleme lernt der Klient in der Beratung auf aktuelle Lösungskonstruktionen zu übertragen. Jeder, der sein Problem analysiert bzw. beschreibt, weiß so auch implizit um die angestrebte Lösung, denn niemand kann ein Problem wahrnehmen, ohne auch nur eine Idee davon zu haben, dass es auch anders oder besser laufen könnte. In der Beratung gilt es, mit Hilfe von systemischen Interventionen den Wahrnehmungskontext des Systems so zu erweitern bzw. den Fokus der Wahrnehmung so zu verändern, dass für den Klienten andere und eigene Lösungen möglich werden. Dies bewirkt, dass der Klient kreativer mit seinem Problem umgehen kann und eigene Lösungen entwickeln wird. Der Klient wird so in der systemischen Beratung zum Lösungstäter und nicht zum Lösungsopfer.
Der Klient verfügt über alle Ressourcen, die er zur Lösung seiner Probleme benötigt. Er wird in der systemischen Beratung zum Lösungstäter und nicht zum Lösungsopfer.
Kontextorientiert blicken
Im Systemischen betrachten wir nie nur den einzelnen Menschen. Wir sehen den Menschen und seine Probleme immer im aktuellen und biografischen Kontext. So wird der Klient mit seinen Problemen nicht isoliert betrachtet, sondern auch sein „Drumherum“, welches man in der Gesamtheit „System“ nennt. Denn wiederkehrende Verhaltensmuster sind keine Eigenschaften einer sozialen Person, sondern resultieren aus dem sozialen System selbst. Kontextorientiertes Denken und Handeln bedeutet weg vom linearen/ kausalen Denken (Ursache-Wirkung) hin zum systemisch zirkulären Denken, einem Denken in Kreislaufprozessen. Jedes Verhalten der Mitglieder eines Systems ist in einen Kreislaufprozess eingebunden. So bekommt ein Problem seine Bedeutung durch den Kontext – jedes Problem kann praktisch alles bedeuten und jedes Verhalten in seinem dazugehörigen Kontext macht Sinn. Für die Lösung ist es interessant zu schauen: „Was bedeutet das Problem für den Betroffenen, für sein Umfeld oder: Wer leidet am meisten darunter bzw. welche Auswirkung hat das Problem auf die familiären Beziehungen.“
Konstruktivistisch herangehen
Tatsachen an sich haben zunächst absolut keine Bedeutung, erst, wenn jemand ihnen eine Bedeutung gibt. Denn was ein Mensch beobachtet, beobachtet er auf der Basis seiner bisherigen Erfahrungen und deren Bewertungen. Wir sehen nur das, was die Öffnung unseres Sichtfensters zulässt. Wir beobachten dasselbe, sehen und fühlen aber alle etwas Unterschiedliches. Daher hat jeder im System Recht mit dem, was er beobachtet und schildert. Jeder hat und vertritt seine eigene Wahrheit, seine subjektive Konstruktion der Wirklichkeit. Diese ist geprägt durch unseren Blick auf die Welt und wie wir diese mit Hilfe unserer Sinneseindrücke wahrnehmen. So geht der Konstruktivismus davon aus, dass jeder Organismus in der Lage ist, Wirklichkeit abzubilden oder zu repräsentieren sowie ein passendes Modell der Welt zu konstruieren. Jede Aussage, die dann ein Klient über die Welt macht, sagt mehr über ihn aus als über die Welt. Die Frage, die sich stellt, ist folgende: Wer gibt welcher Tatsache welche Bedeutung und mit welcher Konsequenz?
Jeder Mensch hat und vertritt seine eigene Wahrheit, seine subjektive Konstruktion der Wirklichkeit.
Wir sehen nicht die Dinge, wie sie sind, sondern wir sehen sie, wie wir sind. (Talmud)
Hypothesen bilden
Der Berater stellt Hypothesen auf der Basis seiner Erfahrung und der Basis seiner Beziehung zum Klienten auf. Diese Hypothesen stellt er dem Klienten implizit oder explizit zur Verfügung. Eine Hypothese/Annahme muss weder richtig noch falsch sein. Es zählt nur, inwieweit die Hypothese nützlich ist für den Klienten. Ob sie nützlich ist, zeigt sich darin, inwieweit sie hilfreich ist für dessen Orientierung und die Trennung von bedeutsamen und unbedeutsamen Informationen. Mit der Bereitstellung der Hypothese, ob direkt oder indirekt, werden dem Klienten durch die Fragen des Beraters neue Sichtweisen und neue Möglichkeiten von Verhalten und Lösungen ermöglicht. So dienen die Hypothesen dem Öffnen von sogenannten Möglichkeitsräumen.
Hypothesen sind unbestätigte Vorannahmen, die der Berater aufstellt. Sie beschäftigen sich mit dem Sinn des Symptoms/Problems des Klienten. Hypothesen sind Annahmen über
•Beziehungen im Klientensystem, deren Wechselwirkungen zwischen Symptomen und Beziehungen sowie
•Zusammenhänge zwischen Klienten und Helfersystemen und der
•Zusammenhänge zwischen Symptom und der Geschichte des Symptoms.
Hypothesen sind unbestätigte Vorannahmen, die der Berater aufstellt. Sie müssen nicht der Wahrheit entsprechen.
Auch werden sie gebildet aus internalisierten Mustern aus früheren Systemen, die der Klient in aktuellen Systemen reproduziert. Grundsätzlich müssen Hypothesen nicht der Wahrheit entsprechen, sie müssen nur nützlich sein. Der Klient wird zur Veränderung angeregt, indem sie Fragen aufwerfen und neue Erkenntnisse hervorbringen. Hypothesen konstruiert der Berater auf der Grundlage von Fragestellungen:
•Welchen Sinn hat ein gezeigtes Symptom/Problem für den Klienten oder sein System?
•Welche Absicht könnte unterstellt werden und könnten die Symptome Bewältigungsstrategien sein?
Hypothesen werden im Konjunktiv konstruiert. Wenn die Beziehung zwischen Klient und Berater stabil ist und wenn ein sicherer Rahmen für den Klienten gegeben ist, werden sie auch formuliert. Mit verschiedenen Interventionen können Hypothesen überprüft, verworfen und durch eine neue ersetzt werden. Sie verändern sich im Arbeitsprozess. Das Konzept der Tischgespräche beruht auf Hypothesen, die nützlich sind in der Ernährungsberatung.
Das Konzept der Tischgespräche beruht auf Hypothesen, die nützlich sind in der Ernährungsberatung.
Möglichkeitsräume öffnen
In der systemischen Beratung geht es darum, die Selbststeuerungsfähigkeit eines Systems zu erhöhen. Mit Hilfe der systemischen Fragen und Interventionen arbeitet der Berater gezielt darauf hin, dass sein Klient, aber auch er als Berater handlungsfähig und offen für Optionen wird. Diese Fragen oder Interventionen werden sparsam eingesetzt, um so die größtmögliche Selbsthilfefähigkeit des Klienten zu unterstützen und Abhängigkeiten zu vermeiden. Ziel ist es, mit dem Klienten Möglichkeitsräume zu schaffen, also den Fokus seiner Wahrnehmung so zu verändern, dass diese Räume als mögliche Optionen zur Verfügung stehen. Die Anzahl der Möglichkeiten vergrößert sich und so entsteht eine Erweiterung der Handlungskompetenzen.
Unterschied machen
Der Unterschied ist die Grundoperation. Die systemische Beratung hat den Anspruch, Unterschiede zu erzeugen, Neues zu induzieren. Wenn in der Beratung das Gleiche geschieht wie sonst, zu Hause oder in vorherigen Beratungen, dann macht es keinen Unterschied und erzeugt keinen Veränderungsprozess. Systemisches Arbeiten beinhaltet viele Optionen. Sprachliche Spiele und überraschende Umdeutungen, das Erkunden gefühlsmäßiger Bewertungen und auch das Arbeiten am konkreten Verhalten. An welchem der vier Punkte angesetzt wird, um den stärksten Impuls zur Veränderung zu geben, obliegt dem Berater mit seinen Erfahrungen, den Präferenzen des Klientensystems und der Berater-Klienten-Beziehung. Sicher ist, wenn z. B. Neues auf der Handlungsebene eingeführt wird, dass sich über neue Erfahrungen, die der Klient macht, Bedeutungsgebungen, Bewertungen und Sichtweisen verändern. Wenn an einer Stelle etwas leicht in Bewegung gerät …!
Der Unterschied ist die Grundoperation.
Klientenorientiert vorgehen
Eine gute Auftragsklärung steht am Anfang einer jeden systemischen Beratung. Dies ermöglicht, eng am Bedarf des Klienten zu arbeiten. Der Berater richtet sein Angebot also genau auf den Bedarf seines Klienten und dieses Angebot bestimmt er auch. Alle Fragen und Interventionen richten sich nach dem persönlichen Bedarf des Klienten. So ist der Berater der Experte für den Veränderungsprozess und der Klient Experte für sein System. Gute und klare Zielvereinbarungen sichern Berater und die Beratungsqualität und erhöhen somit die Selbstwirksamkeit des Klienten.
Der Berater ist Experte für den Veränderungsprozess und der Klient Experte für sein System.
Berater – Teil des Systems?
In dem Moment, in dem Menschen in einer Problemsituation einen Berater hinzuziehen, ist der Berater auch automatisch Teil des Systems und steht mit diesem in Interaktion. Wenn Menschen sich zu einer Beratung entscheiden, haben sie schon allein dadurch ihr System verändert, indem sie einen Berater hinzunehmen.
Methode der Neutralität
Eine wesentliche Grundhaltung des systemischen Beraters ist die Neutralität. In der Praxis heißt das konkret: Für die Sichtweisen von jedem Klienten und seinem System wird Raum geschaffen. So achtet der Berater darauf, dass einzelne Sichtweisen und Positionen nicht benachteiligt werden und jeder bekommt die Zeit, die Neugier und Wertschätzung, die er von dem Berater braucht. Aus systemischer Sicht handelt es sich bei der Neutralität um die Haltung des Beraters, die auf den Klienten/das System wirkt. Die innerpsychische Verfassung des Beraters soll dabei keine Rolle spielen und die Neutralität nur ein Merkmal des konkreten Verhaltens sein. Es kommt also darauf an, was der Berater tut, und nicht, was er denkt und fühlt. Die Methode der Neutralität kann einerseits als Haltung gelebt werden, andererseits auch als ein konkretes Kommunikationsverhalten des Beraters, das der Klient beobachten und bewerten kann. Ziel ist es, dass jeder im System – dabei müssen nicht alle Mitglieder des Systems anwesend sein – gleich unterstützt wird und dass der Berater für niemanden Partei ergreift. Obwohl Neutralität ein sehr wichtiges Merkmal eines systemischen Beraters ist, gibt es kein neutrales Verhalten an sich gegenüber dem Klienten. Es existiert gar keine richtige Neutralität, denn Bewertung ist immer subjektiv. Fakt ist, dass der Klient immer Recht hat, denn es gibt kein richtig und falsch, sondern lediglich ein sowohl als auch. Es sind allein die Klienten, die entscheiden, ob und auch welches Verhalten neutral ist oder nicht. Ein Berater ist dann dem Klienten und seinem Thema gegenüber neutral, wenn es im Verlauf der Beratung auf beiden Seiten keine Anzeichen von Widerstandsverhalten gibt.
Soziale Neutralität
Eine neutrale Haltung eines Beraters zeigt sich darin, dass er Verführungsangebote, Koalitionsangebote oder Sonderstellungsangebote erkennt und neutralisiert.
Moralische Urteile sollte der Berater nicht fällen, denn jedes moralische Urteil verbündet den Berater mit einer Person aus dem System. Nun könnte man den Eindruck haben, dass man als systemischer Berater keine eigene Meinung haben darf. Dem ist nicht so – lediglich der erhobene Zeigefinger sollte vermieden werden („So sollen Sie es machen – und so nicht!“). Die Neutralität unterstützt so die wohlwollende, wertschätzende und empathische Haltung des Beraters gegenüber seinen Klienten.
Fallbeispiel
Ein zehnjähriger Junge mit Adipositas ist mit seinen Eltern in der Beratung. Der Vater ist stark übergewichtig, die Mutter normalgewichtig. Es gibt einen Auftrag vom Arzt und der Mutter, der Junge möge abnehmen. Der Vater versucht mit der Beraterin eine Koalition gegen seine Frau einzugehen mit dem Ziel, seinen Sohn vor der Nahrungsmittelrestriktion zu beschützen …
Problemneutralität
Der Berater verhält sich gegenüber dem Problem des Klienten neutral. Ob das Problem schnell oder langsam gelöst wird – in dieser Frage ist er unparteiisch. Auch wessen Erklärungen aus dem System zu den Ursachen des Problems zutreffen, ist für ihn irrelevant.
Ergebnisneutralität
Der Berater ist dem Ergebnis gegenüber neutral. Es ist ihm gleichgültig, ob sich das eine oder andere Ergebnis durchsetzt. Wessen Ergebnis sich bei einem Familiensystem während der Beratung als richtig für das System erweist, ist ebenfalls unwesentlich. Es geht nur darum, dass der Klient das System, sein Ergebnis, seine Lösung findet. Es gibt Ausnahmen, wo sicherlich die Meinung und Position des Beraters gefragt ist, wo er nicht ergebnisneutral handeln kann – wenn z. B. die Gesundheit gefährdet ist. Wenn Eltern ihrem Kind kein Essen anbieten oder ihm bei einer veganen Ernährung Vitamin-B12-Supplemente vorenthalten.
Verlust der Neutralität
Der Verlust der Neutralität spiegelt sich einerseits in Reaktionen der Klienten und andererseits im Verhalten des Beraters wider. Verliert der Berater die Neutralität, wird er möglicherweise zum Mitspieler in Beziehungs-, Problem- und Lösungsfragen. Als Mitspieler spielt er das Spiel des Klienten mit und bewirkt nur eine Stabilisierung des Spiels. Neues entsteht dabei nicht und die Klienten treten auf der Stelle. Die neutrale Grundhaltung bedarf Reflexion und ständigen Übens. Sobald während der Beratung private Gedanken kreisen, verliert der Berater die Neugier für die Klienten. Langeweile stellt sich ein. Das Verlassen der Neutralität erkennt der Berater auch daran, dass er innerlich abwesend, traurig, belustigt oder aggressiv gegenüber dem System ist (Supervision!).
Systemische Haltung
Systemisches Beraten setzt eine Haltung voraus. Es ist nicht getan mit dem Einüben bestimmter Techniken, sondern systemisch beraten heißt, sich mit dem grundlegenden systemischen Denken auseinanderzusetzen und dies zu reflektieren.
Diese systemische Haltung gilt es, beruflich und privat zu leben und immer wieder zu überdenken. Die Haltung, mit der man berät, kann man jeden Tag neu annehmen und immer wieder daran arbeiten – ein lebenslanger Prozess. Unsere Haltung bestimmt unser Verhalten und somit die Kommunikation. Wir kommunizieren immer unsere innere Haltung, 90 Prozent davon nonverbal, zum Großteil über unser Sein und zu einem kleineren Teil über unser Tun. Wir kommunizieren nicht, was wir gelernt haben, sondern das, was wir sind.
Unsere Haltung bestimmt unser Verhalten
Haltung annehmen
Der Grundstein für die innere Haltung eines Menschen sind seine persönlichen Beziehungen. Die innere Haltung bildet sich aus Einstellungen, Glaubenssätzen (Seite 43 u. 109 f.), Denk- und Gefühlsmustern, dem Unbewussten, der Sozialisation, aus Werten und vielem mehr. Die innere Haltung speist sich aus Erfahrungen, Wissen, Nachdenken und insbesondere aus dem Denken in Zusammenhängen. Sie bestimmt, wie wir den Bildern in unserem Kopf begegnen.
Die Haltung eines systemischen Beraters ist wohlwollend. Er versteht sich als Begleiter und Impulsgeber, als „Mittel zum Zweck“ und verhält sich gegenüber dem Klienten, dem Problem und dem Ergebnis neutral.
Sie ist wertschätzend. Der systemische Berater bewertet nicht. Alles „ist so wie es ist“ und er sieht im vermeintlich Schlechten immer das Gute. Jedes Problem ist ein Lösungsversuch und macht Sinn.
Jedes Problem ist ein Lösungsversuch und macht Sinn.
Die Haltung ist annehmend und offen. Der systemische Berater macht den Klienten zum Experten seiner eigenen Lösung und behält sich seine Neugier.
Die systemische Haltung ist aufdeckend und anerkennend bezogen auf die Ressourcen, Kraftquellen, Fähigkeiten und Potenziale des Klienten. Sie erfordert Gelassenheit – im Sinne von etwas lassen – und Achtsamkeit für sich und den Klienten.
Haltung leben – das Klientenhaus
Im Folgenden möchte ich Ihnen das „Klientenhaus“ vorstellen – eine Metapher. Es ist ein gedachtes Haus, das den Menschen/Klienten mit seinen verschiedenen Bedürfnissen – insbesondere im Kontakt zu anderen, hier dem Berater, bildlich zeigt. Es dient als eine Orientierungshilfe, die den Berater darin unterstützt, seine systemische Haltung zu leben. Es macht dem Berater seine Chancen für die Beratung sicht- und überprüfbar. Sie hilft ihm, die Grenzen der Beratung wahrzunehmen und einzuhalten. Das Bild des Klientenhauses ermöglicht es dem Berater, seinen Klienten den Veränderungsprozess als bedürfnisbefriedigende und würdevolle Ressource erlebbar zu machen. Nachhaltige Motivation zur Veränderung wird möglich, indem der Berater sich an die „Hausordnung“ des Klientenhauses hält und seine systemische Haltung lebt. Dann kann der Klient eine innere Haltung annehmen, die sein Verhalten verändert und ihm ermöglicht, die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.
Das Bild des Klientenhauses ermöglicht es dem Berater, seinen Klienten den Veränderungsprozess als bedürfnisbefriedigende und würdevolle Ressource erlebbar zu machen.
Klientenhaus entdecken
Das Klientenhaus (Seite 22) ist ein Haus mit Parterre, zwei Stockwerken und einem Dachgeschoss. Im Parterre befindet sich die Haustür, die gleich in den ersten Raum führt, dem öffentlichen Raum. Von dort aus geht eine Tür in den sozialen Raum. Im sozialen Raum befindet sich die Treppe in den ersten Stock, diese endet dort vor der Tür des emotionalen Raumes. Im ersten Stock gibt es nur diesen einen emotionalen Raum – aus diesem führt eine Treppe in den zweiten Stock, diese endet vor der Tür des privaten Raumes. Der Zugang vom privaten Raum in das Dachgeschoss, in dem sich das „Privatissimum“ befindet, ist nur zu erahnen. Vermutlich gibt es eine Deckenklappe mit einer ausklappbaren Leiter. Auf dem Dach sind außen acht Solarzellen angebracht. Das Klientenhaus ist freistehend, auf dessen Grundstück auch andere Häuser stehen können. Übertragen auf den Beratungskontext stellt sich die Frage, was passiert in den einzelnen Räumen, was wird dort gearbeitet und wie verschafft sich der Berater Eintritt in diese Räume.
Vor der ersten Beratungsstunde steht die Terminabsprache, sei es über Mail, Telefon oder das Anmeldeformular der Webseite. Nach der Terminvereinbarung findet das Erstgespräch statt – bezogen auf das Klientenhaus betritt der Berater für das Erstgespräch erst einmal nur den öffentlichen Raum seines Klienten. Der Eintritt in den öffentlichen Raum gelingt mit den Methoden „Joining“ und „Komplimente“. Im öffentlichen Raum findet dann das Erstgespräch statt. Eine Beziehung wird aufgebaut, der Klient formuliert sein Anliegen und der Auftrag wird geklärt. Im öffentlichen Raum stellt der Berater den Klienten schon auf „Lösungen“ ein.
Die Tür zum sozialen Raum öffnet der Berater über die systemischen Fragen. Informationserhebung und -weitergabe finden hier statt. Die Berater-Klienten-Beziehung etabliert sich, der Berater erfährt mehr von dem „Problem“ des Klienten. Da jedes Problem praktisch alles bedeuten kann, bekommt es erst seine wahre Bedeutung durch den Kontext, in dem es sich befindet. Für das Lösen des Problems ist es wichtig für den Berater und den Klienten zu erarbeiten, was das Problem für diesen bedeutet. So erfragt der Berater im sozialen Raum den Kontext des Klienten. Davon ausgehend, dass der Klient über alle Ressourcen zur Lösung seines Problems verfügt, lädt der Berater den Klienten ein, diese kennenzulernen und/oder neu zu entdecken. Da – systemisch betrachtet – die Lösung im System steckt, verändert der Berater den Fokus der Wahrnehmung des Klienten so, dass für ihn andere Lösungsideen aufkommen und möglich werden.
Die Treppe in den ersten Stock führt aus dem sozialen Raum vor die Tür des emotionalen Raums. Diese öffnet der Berater mit Hilfe der „Tischgespräche“. Im emotionalen Raum wird die Berater-Klienten-Beziehung weiterhin gepflegt. Beziehungen im Kontext des Klienten werden erarbeitet, z. B. „Wer hat was von dem Problem?“. Die wiederentdeckten bzw. neu kennengelernten Ressourcen des Klienten werden aktiviert, so dass der Klient die für sich beste machbare Lösung findet und der Berater diese Lösung optimiert. Er macht den Klienten zum Experten in Sachen Problemlösung, er, der Berater, ist Experte im Machen von Experten. Im emotionalen Raum führt eine weitere Treppe in den zweiten Stock vor die Tür des privaten Raums.
Aus dem privaten Raum führt eine Verbindung zum Dachgeschoss in das Privatissimum. Der private Raum sowie das Privatissimum sind Räume, die für das Setting „Beratung“ nicht relevant sind.
Bezogen auf die unterschiedlichen systemischen Settings, im Bild des Klientenhauses bleibend, bewegt sich Coaching im Erdgeschoss, Beratung im Erdgeschoss und ersten Stock. Wird der private Raum im zweiten Stock hinzugenommen, handelt es sich um Therapie. Das therapeutische Verfahren der Hypnose bedient sich dann der Dachluke und gelangt so in das Privatissimum.
Coaching findet im Erdgeschoss statt, Beratung im Erdgeschoss und ersten Stock.
Haltung wahren
Entscheidend ist, und das möchte ich Ihnen mit dem Bild des Klientenhauses ans Herz legen, die Einhaltung der Wege durch das Haus Ihrer Klienten. Ein Begehen des emotionalen Raumes unter Umgehung des öffentlichen Raum führt dazu, dass die Berater-Klienten-Beziehung sich nicht etablieren kann und die Bedürfnisse des Klienten sowie seine Würde nicht wertgeschätzt werden. Auch mögliche Einladungen des Klienten in den privaten Raum im Setting „Beratung“ sollten als Einladung zur Grenzüberschreitung erkannt und nicht angenommen werden. Es empfiehlt sich für den Berater, ein gutes interdisziplinäres Netzwerk aufzubauen und den Klienten weiter zu vermitteln.
Haltung zeigen
Auf dem Dach des Klientenhauses befinden sich acht Solarzellen. Sie sind die Metapher für die Energiebereitstellung im Motivierungsprozess. Der Klient stellt seine Energie (Goldmine) dann zur Verfügung, wenn er in seinen individuellen Fähigkeiten gesehen und gefördert wird. Zudem braucht es einen würdevollen Schutzraum, der dem häufig beschämten Klienten Wege von Scheitern ins Gelingen ebnet. Jede einzelne Solarzelle hat eine besondere Bedeutung, sie steht für Beziehung, Orientierung, Lust, Selbstwerterhöhung, Anerkennung, Schutz, Integrität und Zugehörigkeit. In der Beratungsarbeit ist jeder Berater dazu angehalten, in jedem Moment diese Bedürfnisse des Klienten im Blick zu haben und seine Würde zu wahren.
Klienten sind häufig beschämt und sie brauchen daher einen würdevollen Schutzraum, der ihnen Wege von Scheitern ins Gelingen ebnet.
Wenn Klienten zu uns in die Beratung kommen, dann sind einzelne Solarzellen mehr oder weniger mit Blättern, Moos und Staub bedeckt. Die Sonne kommt nicht durch, sie können nicht arbeiten. Möglicherweise versperren aber auch dicke graue Wolken den Durchtritt der Sonnenstrahlen. Die Aufgabe des Beraters ist es, die Wolken „anzustupsen“, so dass sie sich entladen und verziehen und der Regen die Solarzellen von „Unrat“ befreit. So können die Sonnenstrahlen die Solarzellen wieder erreichen. Neues Licht erscheint in den Räumen des Klienten. Der Regen ist sicherlich erst einmal nicht angenehm für den Klienten, aber er macht den „Unterschied“, den er braucht, damit Veränderung möglich wird, denn: Vor der Veränderung steht die Verwirrung. Die Aufgabe des Beraters ist es, diese Verwirrung, also die Phase des Umbruchs/Übergangs zu begleiten, indem er mit seiner inneren systemischen Haltung in jedem Moment die Grundbedürfnisse des Klienten achtet, seine Würde wahrt und ihn nicht beschämt. Als „Regenmacher“ macht man sich erst einmal nicht so beliebt, man ist unbequem – umso wichtiger ist es, dass der Berater sich und seine Haltung stets reflektiert und regelmäßig Supervision in Anspruch nimmt.
Vor der Veränderung steht die Verwirrung.
Was ist ein Problem?
Ein Problem ist eine negativ bewertete Soll-Ist-Differenz. Ein Zustand, der unerwünscht ist, veränderungsbedürftig und prinzipiell veränderbar. Hier ist das Vermeidungssystem aktiv. Wenn das Problem nicht veränderbar ist, handelt es sich nicht um ein Problem.