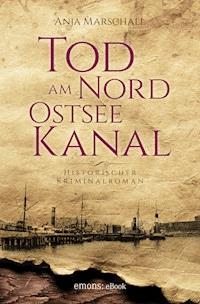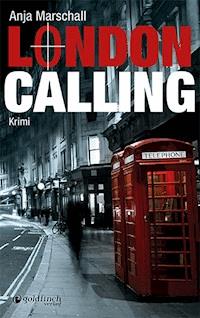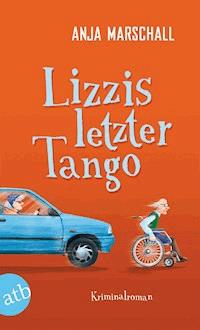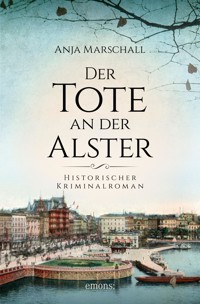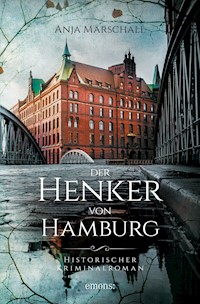9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Duft von frisch gemahlenem Kaffee und der Traum von Freiheit Drei starke Frauen in bewegten Zeiten: Band 2 der großen Familiensaga rund um den Aufstieg einer Hamburger Kaffeedynastie vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte zwischen 1889 und 1989. Hamburg 1929: Anders als ihre Mutter Maria hat Cläre Behmer zunächst kein großes Interesse am Kaffeekontor der Familie. Sie will lieber studieren und ihren eigenen Weg gehen, was ihrem Verlobten missfällt, hofft er doch, durch die Heirat mit Cläre »Behmer & Söhne« übernehmen zu können. Doch Cläres Leben ändert sich schlagartig, als sie den freiheitsliebenden Journalisten Fritz Waltershausen kennen und lieben lernt, während die neuen nationalsozialistischen Machthaber das Überleben des Kaffeekontors gefährden. Endlich erwacht in Cläre die Kämpfernatur ihrer Mutter, und sie setzt alles daran, ihr Erbe und ihre Liebe zu retten. Die Hamburger Speicherstadt: weltweit größter historischer Lagerhauskomplex, Architektur-Juwel, UNESCO-Welterbe, Touristen-Magnet – und Herz des Hamburger Kaffeehandels Mit dem »schwarzen Gold« wird an der Waterkant schon lange gehandelt. 1887 eröffnete in der Speicherstadt die Hamburger Kaffeebörse und wurde zum wichtigen Handelsplatz für das begehrte und lukrative Genussmittel. 24 Millionen Jutesäcke Kaffee aus Brasilien und Zentralamerika sollen dort in den ersten eineinhalb Jahren gehandelt worden sein. Bis zum Ersten Weltkrieg blieb Hamburg führend für diesen besonderen Markt, und noch heute ist die Hansestadt für den Kaffeehandel von großer Bedeutung. Für LeserInnen der neuen historischen Sagas von Fenja Lüders und Anne Jacobs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Töchter der Speicherstadt – Der Geschmack von Freiheit« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Redaktion: Birgit Förster
Covergestaltung: Teresa Mutzenbach
Covermotiv: Elly De Vries / Trevillion Images und Shutterstock.com
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem E-Book hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen und übernimmt dafür keine Haftung.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
1929–1934
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1938–1941
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1941–45
38
39
40
41
42
Nachwort
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
1929–1934
1
Cläre Behmer stand im Vestibül der Villa und biss sich auf die Unterlippe. In ihren Händen hielt sie einen Briefumschlag, unschlüssig, ob sie ihn öffnen sollte. Ihr Herz schlug bis zum Hals. Seit Wochen wartete sie auf Nachricht aus Bern. Und nun war sie da. Cläre schluckte und überlegte, ob sich Zusagen anders anfühlten als Absagen. Müssten gute Nachrichten nicht in feineren Umschlägen versendet werden? Sie wusste es nicht. Woher auch, bisher hatten alle infrage kommenden Universitäten sie abgelehnt. Und nun wohl auch Bern.
»Das Anstarren ändert nichts am Inhalt, Kleine«, sagte Stine hinter ihr, als sie mit einer Kanne frisch aufgebrühten Kaffees aus dem Souterrain in die Halle trat. »Nun mach den Brief schon auf. Du quälst dich nur unnötig.« In ihrem schwarzen Kleid, das sie seit Heinrichs Tod trug, eilte Stine in den Garten, wobei sie eine Wolke würzigen Kaffeegeruchs mit sich nahm. Kaum waren ihre grauen Haare, die sie als strengen Knoten am Hinterkopf trug, verschwunden, hörte Cläre noch einmal ihre Stimme. »Und beeile dich, Kind. Die Rede von Herrn Ehmke ist sicherlich gleich zu Ende.«
»Ich komme«, rief Cläre und faltete eilig den ungeöffneten Brief zusammen. Dann schob sie ihn in die kleine Tasche ihrer eleganten Wolljacke, die sie über dem dünnen Strickpullover und dem hellblauen Plisseerock trug. Eilig folgte sie Stine zu den Gästen in den Garten hinaus.
Noch saß Familie Behmer mit ihren Freunden an der langen Geburtstagstafel zwischen Teich und blühendem Kirschbaum am weiß gedeckten Geburtstagstisch. Eine leichte Brise ging durch das Blätterwerk der Bäume über ihnen. Ihr Rauschen erfüllte die Luft.
Cläre setzte sich neben ihre Mutter Maria, die am Kopf der Tafel Platz genommen hatte. Ihr zu Ehren hatte man sich heute eingefunden. Und Cläre musste zugeben, dass dieser Geburtstag statt des sechzigsten genauso gut der fünfzigste hätte sein können, wenn man die stolze Hausherrin so betrachtete. Sie trug ihr Haar modisch kurz als Bob, wobei sie stets darauf achtete, dass die silbernen Strähnen günstig zur Geltung kamen. Ihr noch immer schmales und kaum von Falten durchsetztes Gesicht machte es so manchem schwer, das Alter der Firmenchefin zu erraten, auch wenn sie nie einen Hehl daraus gemacht hätte.
Wohlwollend glitt Marias Blick aus azurblauen Augen über die Gesellschaft, während die Gäste aufmerksam der Rede des Prokuristen von Behmer & Söhne lauschten, der mit dem Glas in der Hand aufgestanden war und sprach.
»Die Jahre nach dem Großen Krieg haben uns allen viel abverlangt. So mancher gute Name im Hamburger Kaffeehandel verschwand auf immer aus den Büchern, weil Inflation und Krieg ihm den Garaus machten. Aber während überall das Chaos herrschte, bahnte sich für Behmer & Söhne dank unserer wunderbaren Gastgeberin ein Neuanfang an. Sie umschiffte jede einzelne Klippe mit Entschlossenheit, wie Kapitän Ahab auf der Jagd nach dem weißen Wal …«
Jemand beugte sich zu seinem Nachbarn. »Hatte dieser Ahab nicht ein Holzbein?«, flüsterte der Gast, erhielt aber nur ein »Psst« als Antwort.
»… und sie machte durch höchst ungewöhnliche Ideen von sich reden.« So mancher unter den Gästen wusste, wovon der dünne Mann mit der Brille sprach. Einige an der Tafel nickten.
»Erinnern Sie sich«, unterbrach Eduard Lassally ihn. Der alte Kaffeehändler hatte mittlerweile längst die siebzig überschritten, es sich aber nicht nehmen lassen, zu Marias Ehrentag zu erscheinen. Auch seine Firma hatte nach dem Krieg Federn lassen müssen, was ihn in den letzten Jahren hatte über Gebühr altern lassen. Heute jedoch wirkte er fast schon jugendlich, was vielleicht an dem vierten Glas Sekt liegen mochte, das er jetzt in seiner altersfaltigen Hand erhob. »Erinnern Sie sich noch daran, als wir alle dachten, die verdammte Inflation würde auch Behmer & Söhne ruinieren? Alfons Behmer hatte in bester Absicht Kredite für Kriegsanleihen aufgenommen, war nach der Kapitulation zahlungsunfähig geworden, und die Banken wollten liquidieren. Ha, diese Erbsenzähler!«, lachte er auf. »Statt Konkurs anzumelden, vertröstete unsere Maria die Herren von der Bank immer wieder, hielt sie hin, lavierte sich durch die Monate mit unbeugsamem Charme, und – peng! Als ’24 die Reichsmark kam, ging sie persönlich zu Alfred Blinzig …«
»Blinzig? Wer ist das?«, raunte eine Dame ihrem Tischherrn zu.
»Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank«, antwortete dieser, so leise es ging.
»… Da legte unsere Maria ihm ein neues Zehnpfennigstück auf den Schreibtisch und sagte: ›… den Rest können Sie behalten.‹«
Alle am Tisch lachten über die Anekdote, die jeder Kaufmann in der Stadt kannte. Lassally, der alte Weggefährte der Familie, wies mit dem jetzt leeren Glas zu Maria, die am Ende der Tafel saß und still lächelte. »Ich sage Ihnen, wäre diese Frau doch nur ein Mann! Was hätte sie alles erreichen können …« Lassallys Sohn Karl legte dem leicht beschwipsten Vater die Hand auf den Arm. Der alte Mann verstand. »Ein dreifaches Hoch auf unser Geburtstagskind.« Jetzt erhoben sich alle Anwesenden mit ihren Gläsern und riefen: »Hoch! Hoch! Hoch!«
Cläre umarmte ihre Mutter. »Ich bin so stolz auf dich«, flüsterte sie Maria ins Ohr, ahnte sie doch, wie schwer es für eine Frau sein musste, in einer geistig verstaubten Stadt wie Hamburg gegen alle Widrigkeiten Erfolg zu haben.
Maria bedankte sich bei den Rednern, vor allem aber bei ihrem Weggefährten der ersten Stunde, Gustav Ehmke. »Ich denke, dass das zu viel der Ehre für mich ist.« Ihr Blick glitt über die Anwesenden, mit denen sie so viele gute wie auch schlechte Erinnerungen teilte. Da war die treue Stine, die soeben den Gästen Kaffee nachschenkte. Seit vielen Jahren war sie im Hause Behmer angestellt und hatte sie selbst in den allerschwersten Zeiten nie verlassen. Statt selbst eine Familie zu gründen, war sie mehr als einmal mit einem klaren, ehrlichen Wort zu Marias Rettung geeilt.
Zwischen Eduard Lassally und Gustav Ehmke saß Marias Schwägerin Gertrud. Ebenso wie Stine trug sie seit Jahren Schwarz, als müsse sie Buße leisten. Die Gier des Krieges hatte auch sie zur Witwe gemacht. Nach der Kapitulation mussten Maria und Gertrud, die ewigen Feindinnen, eine schwere Entscheidung treffen. Die Firma hatte damals am Boden gelegen und die Familienehre zerschmettert daneben. Sie hatten nicht gewusst, ob es ihnen gelingen würde, den privaten Kriegsgraben zu überwinden, um Behmer & Söhne aus dem Scherbenhaufen wiederauferstehen zu lassen. Zehn Jahre war das nun schon her, und es war ihnen geglückt.
Maria hob ihr Glas und sah Gertrud mit einem Lächeln an. »Das Lob gebührt auch meiner unermüdlichen Schwägerin. Sie hat mich gelehrt, dass der gute Ruf einer Firma nicht nur zwischen den Seiten eines Kontobuches liegt, sondern auch auf hart erarbeitetem Vertrauen beruht. Ehre und Erfolg einer Firma sind nur möglich, wenn jede Partei die Gewissheit besitzt, dass ein Versprechen zählt. Der Handschlag zwischen Kaufleuten ist im Geschäft ein unverbrüchliches Versprechen. Gertrud gab mir vor zehn Jahren ein Versprechen und hält es bis heute.« Sie nickte ihrer Schwägerin zu.
Nun gab es auch ein dreifaches Hoch für die Witwe von Alfons Behmer, der in einigen Salons der Stadt noch immer hinter vorgehaltener Hand der »falsche Bruder« genannt wurde. Auch wenn Alfons kein Behmer gewesen war und damit Gertruds Familie offiziell nicht mit Maria und Cläre verwandt war, so nannten sich die beiden Frauen weiterhin Schwägerinnen.
Und auch die Kinder der beiden so unterschiedlichen Frauen blieben bei Cousin und Cousine. Die Leute in der Stadt hatten sich daran gewöhnt. Und so sprach kaum noch jemand über die dramatischen Vorkommnisse von damals.
Zwei Kinder kamen vom Teich her auf die Gesellschaft zugelaufen. Der Junge war etwa fünf Jahre alt und hatte dunkelblondes Haar. Er zerrte ein kleines Mädchen an der Hand hinter sich her, das stolpernd versuchte, mit ihm Schritt zu halten.
Gertruds Tochter Emma sprang von der Tafel auf. »Bruno! Irma! Ihr seid ja ganz nass.« Sie eilte den Kindern entgegen. Mit Mitte dreißig hatte Emma den aufstrebenden Anwalt Otto Röpcke geheiratet und war Mutter von zwei Kindern geworden, deren Erziehung sie mit größter Leidenschaft pflegte.
»Genug der Reden!«, rief Maria ihren Gästen zu. »Auf unsere Stadt und ihre Menschen. Möge unser aller Zukunft wie ein Schiff auf ruhiger See dahingleiten. Wir hätten es verdient.«
Endlich durften sich alle über die Köstlichkeiten hermachen, die Stine in den letzten Tagen in der Küche der Villa gezaubert hatte. So thronten auf gläsernen Tortenplatten zwei Erdbeertorten, umrahmt von Rosenblättern und mit reichlich Sahnetupfen verziert. Der hanseatischen Bescheidenheit entsprechend, hatte sie noch einen Hamburger Puffer mit in Rum eingelegten Rosinen aufgetischt und für die Kinder Kemm’sche Kuchen besorgt, die ein gewisser Heinrich Flentje seit Jahren in Lokstedt herstellte. Dem Ort, wo Stine und Maria während des Krieges einige Jahre gewohnt hatten, bevor sie in die Villa zurückkehren durften.
Bald schon drehten sich die Tischgespräche an diesem schönen Sommertag um die politische Lage im Reich. Besonders Emmas Ehemann tat sich mit flotten Reden hervor, als er von dieser Partei anfing, die von einem gewissen Adolf Hitler angeführt wurde. »Im Circus Busch sprach er vor über dreitausend Hamburgern. Glauben Sie mir, mit dem Mann muss man rechnen.«
»Politik, junger Mann«, unterbrach ihn Eduard Lassally, »ist kein Thema für eine Kaffeetafel.«
Dem widersprach Otto Röpcke. »Seit der Kaiser zur Abdankung gezwungen wurde und man diesen Ebert, der nichts weiter als ein Sattler war, zum Reichspräsidenten machte, lacht die Welt über uns. Wie lange wollen wir uns das noch bieten lassen?«
»Aber er ist seit vier Jahren tot«, mischte Cläre sich ein, »Generalfeldmarschall Hindenburg ist unser neuer Reichspräsident. Stimmt dich das nicht etwas milder, Otto? Immerhin war der Mann Soldat.«
»Der Präsident ist nicht die Regierung«, unterbrach Otto Röpcke die Cousine seiner Frau, welche im Hintergrund tadelnd die beiden Kinder mit einem weißen Taschentuch säuberte. »Eine starke Regierung«, fuhr Röpcke fort, wobei er seinen Zeigefinger wie ein Lehrer hob, »hätte niemals zugelassen, dass wir Pommern oder Ostpreußen verlieren. Und dann die Schande im Ruhrgebiet! Wie kann ein Mensch mit deutscher Ehre im Leib zulassen, dass Frankreich es noch immer besetzt hält?« Er nahm die Gabel und stieß sie wie ein Bajonett in die Erdbeertorte. »Unserem Land fehlt es an starken Männern, die den Erbfeind aus dem Land jagen. Zu Großem sind wir bestimmt. Das sagt auch der Führer.«
»Führer?«
»Der Führer der Nationalsozialisten, Adolf Hitler.«
»Ach ja, die gibt es ja noch immer«, bemerkte Gertrud. »Ich dachte, man hätte diese NSDAP verboten. Nun, ich muss mich dann wohl geirrt haben.«
Da ließ ein Scheppern die Gäste zusammenfahren. Die Köpfe drehten sich zu Wilhelm, der bisher schweigend neben seiner Mutter Gertrud gesessen hatte, nun aber aufgesprungen war. Die Tasse war mit lautem Gepolter aus seiner zitternden Hand gefallen. Der Kaffee saugte sich bereits als brauner Fleck in die weiße Damasttischdecke und lief dann die Kante hinunter. Wilhelm stützte sich mit beiden Händen auf dem Tisch ab. Schweiß stand auf seiner Stirn. Seine Augäpfel rollten.
Schnell erhob sich Gertrud von ihrem Stuhl, warf den Anwesenden einen entschuldigenden Blick zu und wollte ihren Sohn behutsam fortführen, als der sie wegschubste.
»Lass das, Mutter! Ich bin kein Kind.« Dann wankte er über den Rasen, hin zum Haus.
Peinlich berührt, sah Gertrud ihm nach. Dann setzte sie sich wieder und legte mit stoischer Miene ihre Serviette zurück auf den Schoß. »Das Herz«, murmelte sie unbestimmt.
Verächtlich schüttelte Otto Röpcke den Kopf. »Es wird Zeit, dass du etwas unternimmst, Schwiegermama. Du bist zu nachsichtig mit diesem Kriegsneurotiker.«
Maria legte ihre Hand auf Cläres, die gerade Anstalten machte, Röpckes Bemerkung zu erwidern. »Sei so lieb, Kind, und hole mir mein Schultertuch. Es wird frisch.«
Wütend funkelte Cläre Röpcke an. Dann nickte sie und erhob sich.
Maria indes widmete sich wieder ihrem Stückchen Torte, als sei nichts geschehen. »Darf ich fragen, ob jemand von Ihnen schon in der Schauburg am Millerntor diesen Film gesehen hat, in dem die Darsteller auch sprechen? Wie ich hörte, soll Ende des Jahres ein Filmpalast am Gänsemarkt eröffnet werden, wo ausschließlich Sprechfilme gezeigt werden.« Sie lächelte munter in die Runde. »Ich frage mich, ob ich wohl zu alt bin, um mir das einmal anzusehen.«
Cläre lief über den Rasen, zurück zur Villa. Wie hatte dieser dreiste Otto nur so etwas sagen können?, wütete es in ihr. Wilhelm hatte Verdun erlebt, war verschollen gewesen und krank an Geist und Seele zurückgekommen, nachdem das Rote Kreuz ihn in einem Gefangenenlager bei Brest wiedergefunden hatte. Was hatte dieser Stubenhocker Otto Röpcke denn schon in seiner warmen Amtsstube im Generalkommando an der Palmaille erlebt, wo er als Unteroffizier Telegramme und Berichte geschrieben hatte? Nichts! »In seiner Uniform ist er herumstolziert, der feine Herr Röpcke«, grummelte Cläre, als sie die Stufen in den Westflügel hinaufging. »Der hat noch nie einen Schützengraben gesehen oder Granaten gehört!«
Vor einigen Jahren hatte Wilhelm ihr stockend vom Krieg erzählt, von den letzten Tagen, an die er sich noch erinnern konnte. Sie war entsetzt gewesen und zugleich überzeugt, dass er ihr nicht all die Schrecklichkeiten offenbart hatte, die er erleben musste. Seither glaubte Cläre, ein gewisses Vertrauen bei ihrem Cousin zu spüren, das weit über jenes zu seiner Schwester Emma und seiner Mutter Gertrud hinausging.
Vom ersten Stock führte eine etwas weniger pompöse Treppe hinauf unter das Dach, wo Wilhelm ein Zimmer bewohnte, das möglichst weit vom Familienleben entfernt war. Sie bog in den halbdunklen Gang.
Vielleicht war es für einen Mann von fast vierzig keine standesgemäße Bleibe, und auch sonst hätte ihr Cousin in seinem Alter mehr vorweisen müssen, als bei seiner Tante unterm Dach zu wohnen. Doch Anfälle wie eben machten Wilhelm ein normales Leben unmöglich.
Hinter der letzten Tür im Gang hörte Cläre Musik. Als Wilhelm nicht auf ihr Klopfen reagierte, öffnete sie vorsichtig die Tür. »Willi?« Sie sah seine Silhouette am Fenster stehen. Die Zigarette in der Hand, schaute er hinaus in den Park, wo die Gäste saßen. Cläre trat ein. »Geht es dir jetzt besser?«
Er schwieg.
»Dein Schwager ist ein …«
»… Großredner, überheblicher Dummkopf«, unterbrach er sie barsch.
Cläre nahm einige Kleidungsstücke von einem Sessel und setzte sich. »Ja, so etwas in der Art wollte ich auch sagen.« Ihr Blick fiel auf eine Spritze, die neben einer leeren Pappschachtel für Glasampullen auf dem Schreibtisch lag. Sie wusste, dass ihr Cousin sich Medikamente gegen das Zittern und die Angstanfälle in der Apotheke besorgte. »Was sagt Doktor Günther? Kann er dir deine … Medizin weiterhin verschreiben, wenn das Verbot kommt?«
Wilhelm schüttelte den Kopf. Er drückte die halb aufgerauchte Atika in einem vollen Aschenbecher auf der Fensterbank aus, griff nach dem Whiskyglas daneben und trank es in einem Zug leer. Dann legte er sich auf das Bett, die Hände hinter dem Kopf verschränkt. »Er weigert sich, einem Simulanten wie mir Morphium zu verschreiben.«
»Aber was wirst du tun?« Cläre wusste nicht, ob Wilhelm die Medizin wirklich half. Sie wusste nur, dass ihn die Spritzen müde machten, ihm aber auch die Angst und das Zittern nahmen. Er antwortete nicht.
Auf dem Fußboden sah sie ein halb zusammengeknülltes Stück Papier. Sie hob es auf und faltete es auseinander. Es zeigte die sehr detaillierte Ansicht eines französischen Schlosses, mit Türmchen und Fresken, Ornamenten und Giebeln. »Oh, wie schön! Du zeichnest wieder?«
Wilhelm hatte die Zeichnung nicht beendet. Die Linien waren irgendwann immer eckiger geworden, die Fenster schief und krumm. Das Gebäude wirkte wie durch ein Brennglas verzerrt. Früher hatte Wilhelm Architektur studieren wollen, galt als äußerst talentiert. Doch dann kam der Krieg. Cläre legte die Zeichnung auf das Bett und wollte ihm gerade Mut machen, nicht nachzulassen, als er zu sprechen begann.
»Mutter will mich wieder zu einer Kur schicken«, sagte er, ohne auf die Zeichnung einzugehen, wobei er das Wort Kur förmlich ausspuckte. »Ich bin ihr peinlich, weißt du.«
Cläre wusste nicht, was sie sagen sollte. Wilhelms Ausfälle machten ein Leben mit ihm schwer. »Wie geht es Lieselotte?«, wechselte sie eilig das Thema. »Siehst du sie noch? Du hast so lange nichts von ihr erzählt.«
»Wer?« Wilhelm hatte seine Augen bereits geschlossen. Das Morphium begann zu wirken.
»Deine Verlobte! Du wolltest sie uns doch vorstellen.«
»Verlobte?«, wiederholte er, wobei er das Wort in die Länge zog. »Wer will schon mit einem Krüppel wie mir verheiratet sein und in diesem staubigen Kasten hier vegetieren, der nicht einmal mir gehören wird? Keine Zukunft, keine Zukunft.«
Seufzend stand Cläre auf, hob den Tonarm vom elektrischen Grammofon und stoppte das eigentümliche Klavierkonzert von einem gewissen George Gershwin, welches Wilhelm tagein, tagaus hörte. Leise summend, gab sich ihr Cousin auf dem Bett dem erlösenden Rausch hin. Cläre verließ das Zimmer.
*
Es war schon spät, als die letzten Gäste die Villa in ihren Automobilen verließen. Maria unterdrückte ein Gähnen, während sie mit Gertrud zurück ins Haus ging.
»Wir sollten bei der nächsten Gelegenheit auch Herrn Doktor Lang zu uns bitten«, schlug Gertrud vor. »Er ist der Generalstaatsanwalt.«
»Und warum sollten wir ihn einladen? Wir kennen ihn nicht und haben auch, Gott sei Dank, keine rechtlichen …«
»Nein, nicht darum.« Die beiden Frauen traten ins Vestibül. »Er sollte Otto kennenlernen.« Gertrud begab sich in den Wintergarten, und Maria folgte ihr, obwohl sie viel lieber zu Bett gegangen wäre. »Mein Schwiegersohn benötigt Kontakte in der Stadt. Ich denke, als Staatsanwalt und später als Richter wäre er famos.«
»Er soll in den Staatsdienst?« Maria wies eines der Mädchen an, ihr noch einen Riesling zu bringen. »Will er das denn?«
Gertrud setzte sich ihr gegenüber. »Strafverteidigung ist kein Metier mit Zukunft. Otto muss an seine Familie denken. Als Richter hätte er ausgesorgt.«
»Wie immer nimmst du die Dinge energisch in die Hand.« Maria lächelte. »Gut, nächstes Mal laden wir Doktor Lang ein.«
Das Dienstmädchen reichte den Damen die Gläser. »Und Justizsenator Nöldeke. Nur pro forma. Er würde sich übergangen fühlen, wenn wir nur den Oberstaatsanwalt einlüden.«
»Und zu welchem Anlass? Der Weihnachtsball ist noch zu weit hin.«
Gertrud nickte und nahm einen Schluck Wein, bevor sie antwortete. »Ich denke, eine kleine Automobilpartie ins Alte Land wäre angebracht.«
Maria seufzte. »Gut, aber bitte halte es bescheiden. Und lade unbedingt einige Herren vom Kaffeeverein dazu samt Ehefrauen und Kindern.«
»Haben Sie uns schon wieder abgelehnt?«
Maria nickte. »Wir hatten drei Befürworter, ganz so, wie es die Regularien vorsehen. Aber die Versammlung entschied mit einer Stimme dagegen.«
Gertruds Mund wurde schmal. »Mache Wilhelm zum Teilhaber von Behmer & Söhne, dann wird der Kaffeeverein unsere Firma aufnehmen müssen. Du weißt, dass das der beste Weg ist.«
Maria schüttelte den Kopf. »Dein Sohn ist nicht in der Lage, eine Firma zu leiten, Gertrud. Er schaffte es nicht einmal, die Kaffeetafel heute Nachmittag ohne Eklat zu überstehen.« Auch sie nahm einen Schluck aus ihrem Glas. »Nein, mein Neffe wäre bedauerlicherweise eine schlechte Wahl.«
Die beiden Frauen schwiegen eine Weile. »Ich habe vor, meinen Sohn zu einer Behandlung bei Doktor Nannemann zu schicken«, begann Gertrud, »denn er verspricht eine Blitzheilung in Fällen wie bei Wilhelm. Dr. Nannemann soll bei Kriegsneurotikern erstaunliche Erfolge erzielt haben.«
Maria war nicht überzeugt. Ihr Neffe hatte in den letzten Jahren unzählige Kuren und Anwendungen über sich ergehen lassen müssen, doch keine hatte seine Beschwerden gelindert.
Gertrud bemerkte Marias Unschlüssigkeit. »Dr. Nannemanns Klinik ist hier in Hamburg, im Eppendorfer Krankenhaus. Er würde Wilhelm bestimmt aufnehmen.«
»Und was soll die Behandlung dieses Mal kosten?«
Gertrud hob das Kinn. »Wie kannst du von Geld reden, wenn es um die Gesundheit meines Sohnes geht!«
Maria seufzte. Wie oft hatten sie solch ein Gespräch schon geführt. »Ich bin müde.« Sie erhob sich. Auf dem Weg zur Tür drehte sie sich noch einmal zu Gertrud um. »Also, wie viel?«
»Zweitausend Mark, wenn er einen Monat dortbleibt.«
»Zweitausend? Ist dieser Doktor Nannemann verrückt?« Maria schüttelte den Kopf. »Nein! Das Geld ist sinnvoller woanders eingesetzt. Ich traue all diesen Wunderheilern nicht mehr. Und das solltest du auch nicht tun. Finde dich damit ab, dass der Krieg Wilhelm gebrochen hat.«
Gertrud sprang auf. »Weißt du, was es für eine Mutter bedeutet, den eigenen Sohn so zu sehen? Sie sagen, er wäre ein Feigling, ein Simulant, der sich vor ehrlicher Arbeit drücken wolle.« Sie kam zu Maria und sah sie mit feuchten Augen an. »Ein Irrer in der Familie ist nicht gut für unseren Ruf.«
Wie so oft war Gertrud mehr an Reputation als an allem anderen interessiert. »Aber du hast doch Emma und ihren Anwalt. Sie und die Kinder tilgen das Manko eines Verrückten sicherlich.« Maria konnte sich den schnippischen Ton nicht verkneifen.
Gertrud musterte sie mit schmalem Mund. »Besser noch wäre es für uns alle, wenn Cläre endlich heiraten würde.«
»Bitte, Gertrud, nicht schon wieder.« Maria trat in die Halle. Ihre Schwägerin folgte ihr.
»Cläre sollte den jungen Münchmeyer heiraten«, schlug Gertrud vor. »Eine Verbindung mit einem Mitglied dieser alteingesessenen Hamburger Familie wäre von großem Vorteil für uns. Er könnte die Firma leiten, schließlich ist er ja vom Fach.«
Maria drehte sich um. »Der junge Münchmeyer? Gertrud, er ist gerade einmal zwanzig Jahre alt! Jahre jünger als Cläre! Soll meine Tochter ein Kind heiraten?« Kopfschüttelnd nahm Maria ihren Weg in den Westflügel wieder auf, wo ihre Räume lagen.
»Nun, der Münchmeyer ist auf alle Fälle besser geeignet als dieser Herbert Staller aus Bremen«, rief Gertrud ihr nach. »Seit zwei Jahren sind er und Cläre nun schon verlobt, und noch immer wurde kein Termin für eine Hochzeit vereinbart. Diese Liaison ist doch lächerlich.«
»Das ist nicht unsere Sache, Gertrud.«
»Und ob es das ist! Mit einem Bremer in der Familie haben wir die Chancen auf eine Mitgliedschaft im Kaffeeverein endgültig vertan. Und dann können wir auch keine Kaifirma werden. Du weißt genau, dass die Herren am Sandtorkai alle lukrativen Geschäfte unter sich ausmachen. Entweder, wir schaffen es dort hinein, oder wir werden niemals unsere alte Bedeutung zurückerhalten.« Gertrud folgte Maria. »Sag Cläre, sie soll die Verlobung mit Herbert Staller lösen.«
»Das werde ich nicht tun. Es ist Cläres Entscheidung. Und jetzt gute Nacht.« Müde von den Tiraden, begab Maria sich in ihr Schlafzimmer und schloss die Tür hinter sich.
2
Cläre hörte noch den letzten Glockenschlag von St. Petri, als sie einige Tage später in die Colonnaden eilte. Es war bereits kurz nach zehn!
Sie rannte die Prachtstraße zwischen Jungfernstieg und Gänsemarkt entlang, vorbei an Stadthäusern, die wie ein venezianisches Zuckerbäckerwerk wirkten. Ihre Schritte hallten durch den Säulengang, während sie an den vielen kleinen Läden vorbeilief, die um diese Zeit längst geöffnet hatten. Dass ausgerechnet heute das Automobil nicht angesprungen war, ärgerte Cläre. Ein älterer Herr trat gerade aus Teschs Pfeifenladen. Fast hätte sie ihn umgerannt.
»Verzeihen Sie!«, rief Cläre hastig und eilte weiter.
Der Herr zog seinen Hut. »Pardon, Fräulein, ich hätte aufmerksamer sein müssen!«, hörte sie ihn noch hinterherrufen. Hamburg war wahrlich eine vornehme Stadt. Und natürlich wusste Cläre, dass ihr Gerenne alles andere als rücksichtsvoll war, aber sie wollte nicht zu spät zur Arbeit kommen, auch wenn ihr Arbeitgeber in dieser Hinsicht äußerst tolerant war. Felix Jud betrieb mit seiner Geschäftspartnerin Erna Kracht die Hamburger Bücherstube und neigte selbst nicht dazu, vor elf dort zu erscheinen.
Und tatsächlich! Als Cläre Hausnummer 104 erreicht hatte, stand bereits ein Kunde vor dem verschlossenen Eingang ins Souterrain. »Bitte verzeihen Sie«, sagte Cläre ein wenig außer Atem, fingerte den Ladenschlüssel aus ihrer Handtasche, trat die vier Stufen hinunter und schloss die Tür auf.
Während der junge Mann unsicher eintrat, warf sie schnell ihren Mantel hinter den Vorhang, richtete ihren zerzausten Bubikopf und begab sich hinter den Ladentisch, auf dem mehrere Stapel Bücher darauf warteten, in die Regale einsortiert zu werden.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte sie und lächelte.
Zu den Kunden der HaBü, wie die Hamburger Bücherstube mittlerweile genannt wurde, zählte vornehmlich das literarisch gebildete Publikum der Stadt. Man verstand sich als »Pflegestätte für das gute und schöne Buch«. Doch auch Studenten waren im Souterrain der Buchhandlung zu finden. Sie garantierten zum Beginn der Semester eine klingelnde Kasse, wenn sie ihre Fachbücher in der HaBü kauften. Ab und zu waren auch Frauen unter den Studiosi. Sie bediente Cläre besonders gerne, denn manchmal gelang es ihr, die Kundinnen in ein Gespräch zu verwickeln. So erfuhr Cläre, wie die Damen es fertiggebracht hatten, einen Studienplatz zu ergattern, und wie sich das Leben an der Universität gestaltete. Doch die meisten Frauen studierten, wenn überhaupt, Medizin oder Pädagogik. Eine Ausnahme bildete Magdalene Schoch. Sie war allerdings längst keine Studentin mehr, sondern arbeitete als promovierte Juristin für einen gewissen Professor Bartholdy. Sie hatte selbst erfahren müssen, wie schwer es für eine Frau war, in der Männerdomäne der Juristerei Fuß zu fassen, und nahm Anteil an Cläres Versuch, einen Studienplatz zu ergattern, selbst wenn es nur im Fachbereich Wirtschaft war. Für die Tochter eines Kaufmanns sei dieses Studiengebiet nur zu natürlich, hatte sie Cläre einmal wissen lassen und versprochen, über Cläres Herkunft zu schweigen, denn Cläre befürchtete, Felix Jud würde ihr als Tochter aus wohlhabendem Hause nicht mehr erlauben, in seinem Laden zu arbeiten. Es gab in diesen schwierigen Tagen genügend Frauen, die eine Arbeit nötiger hatten als sie.
Darüber aber machte Cläre sich heute keine Gedanken. Sie hoffte, dass Frau Schoch, diese energiegeladene kleine Person, heute im Laden vorbeischauen möge, damit sie ihr ein wenig das Herz ausschütten konnte. Die Absage aus Bern schmerzte Cläre noch immer.
Der junge Mann legte seine Bücherliste auf den Tresen. Cläre warf einen kurzen Blick darauf, nickte und holte aus dem Eckregal das erste der gewünschten Bücher. Sie reichte es ihm. »Freiheit und Form. Studien zur deutschen Geistesgeschichte von Professor Cassirer.«
Der junge Mann, er mochte kaum älter als zwanzig Jahre sein, blickte müde auf das dicke Buch in ihren Händen. Er seufzte.
Sie musste schmunzeln. »Ich befürchte, die anderen Bücher auf der Liste werden nicht viel dünner sein.«
Es folgten die Bände 1 bis 10 der kantischen Werke. Sie wusste nicht, ob es das Gewicht der Bücher oder ihres Inhaltes war, das den jungen Mann in die Knie zu zwingen drohte. »Sie sind bei Professor Cassirer im ersten Semester, richtig?«
Stumm nickte er. »Ich weiß gar nicht«, flüsterte er kaum hörbar in leicht schwäbischem Akzent, »wie ich das alles lesen soll, geschweige denn verstehen.«
Cläre hatte Mitleid mit ihm. »Sollen wir Ihnen die Bücher liefern?«, fragte sie, um ihn abzulenken.
»Ja bitte.« Er nannte seinen Namen und die Adresse. »Und die restlichen Bücher?«, fragte er dann.
»Vielleicht leihen Sie sich diese in der Bibliothek von Herrn Warburg aus«, schlug Cläre vor. »Er hat in seinem Haus in der Heilwigstraße eine umfangreiche Gelehrtenbibliothek für Kunst und Kultur, die er Interessierten gerne zur Verfügung stellt.«
Überrascht sah der junge Mann sie an. »Ich darf dort auch etwas ausleihen?«
»Das sollten Sie sogar, denn auch Professor Cassirer lässt sich dort öfter blicken. Für so manchen Studenten ist das eine willkommene Gelegenheit, den Herrn Professor das eine oder andere zu fragen.« Sie zwinkerte. »Und um sich bei ihm in gute Erinnerung zu bringen.«
Der junge Mann schien zu verstehen. »Sie studieren auch Philosophie?«, fragte er hoffnungsfroh.
»Nein, aber ich höre hier im Laden so manches.«
Mit federnden Schritten verließ der junge Mann kurz darauf die Hamburger Bücherstube.
Schon bald klingelten die Glöckchen über der Ladentür ein weiteres Mal. Cläre sah auf. Der Besitzer der Buchhandlung, Felix Jud, trat ein. Selbst kaum älter als der erste Kunde des Tages, ließ sich der schlaksige junge Mann auf den Stuhl fallen, der vor dem Regal mit den französischen Romanen stand.
»Cläre, Cläre, Cläre«, jammerte er kopfschüttelnd, und sie wusste, dass er wieder bis spät in die Nacht mit seinen Freunden diskutiert und gestritten hatte. »Ich brauche einen starken Kaffee.« Mit beiden Händen hielt er seinen Kopf. »Einen sehr, sehr starken. Ich glaube, meine Denkerstirn platzt gleich.«
Während sie in die kleine Küche ging und den Behmer-Traditionskaffee aus dem Regal nahm, erzählte er, dass sein Freund, der Berliner Verleger Ernst Rowohlt, mal wieder in der Stadt sei. »Aber sagen Sie es nicht der Erna!«, rief er, als Cläre gerade das Kaffeepulver in die Filtertüte gab. »Ich habe ein paar Novitäten geordert. Nicht viele, aber es wird reichen, um Erna aus der Contenance zu bringen. Sie wird zetern, aber es lohnt sich, für die Bücher zu leiden. Ich brauche nur vorher einen starken Kaffee.«
Cläre goss das heiße Wasser über das Kaffeepulver und wartete darauf, dass sie nachgießen konnte. Sie grinste.
Nach dem ersten Schluck seufzte der »Herr der tausend Bücher«, wie Felix Jud sich manchmal selbst nannte. »Und ein weiteres Mal haben Sie mein Leben gerettet«, meinte er und nahm gleich noch einen Schluck.
Über den Rand der Tasse blickte er Cläre fragend an. »Wieder eine Absage?«
Sie nickte. »Bern.«
Er schüttelte den Kopf. »Es ist unglaublich, dass die Dummheit noch immer regiert. Wer kann in der heutigen Zeit nur etwas dagegen haben, dass Frauen zu Wirtschaft und Wissenschaft beitragen?«
Cläre lächelte dankbar. All die Absagen, die sie erhielt, schienen ihren Arbeitgeber ebenso in die Verzweiflung zu treiben wie sie. Es tat ihr gut, dass hier so viele auf ihrer Seite waren.
Anders als ihre Familie zu Hause, von der Herr Jud nichts wissen sollte. Hier im Laden war sie nur eine junge Frau, die ihren Unterhalt verdienen musste und von einem Studium träumte.
Felix Jud stellte die Tasse auf den Tisch und fuhr sich mit der Hand durch die lockigen Haare, dann richtete er seine Brille und räusperte sich. »Fräulein Cläre, ich muss Ihnen leider sagen …« Er räusperte sich ein weiteres Mal. Dann griff er in die Taschen seiner Jacke und zog das Futter hervor. Mit enttäuschtem Gesicht blickte er sie an. »Es tut mir leid. Ich kann Sie diese Woche schon wieder nicht bezahlen.«
Cläre unterdrückte ein Lächeln. »Herr Jud, ich sagte Ihnen doch, dass ich eine entfernte Verwandte habe, die mir ab und zu ein wenig Geld schickt«, versuchte sie, ihn zu trösten. »Ich werde nicht verhungern.«
»Ach, Fräulein Cläre, ich stehe so sehr in Ihrer Schuld.«
»Wir machen es einfach wie sonst auch: Sie erlauben mir, statt des Geldes ein paar Bücher mitzunehmen.«
Erleichtert nickte er. »Nehmen Sie sich auch Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin mit. Ein Name, den man sich merken muss. Glauben Sie mir.«
»Aber das ist doch gerade erst erschienen«, erwiderte sie. »Ich nehme lieber ein etwas staubigeres Buch von hinten, aus dem Lager. Eines, das schon älter ist und nicht mehr so leicht einen Kunden finden wird.«
»Nehmen Sie den Döblin, bitte.« Er reichte ihr das Buch.
»Gut, aber nur, wenn Sie den vollen Preis auf meinen Lohn anrechnen. Kein Rabatt.«
Er lachte. »Ach, Fräulein Cläre, Sie klingen wie ein echter Hamburger Kaufmann.«
Die Stunden, in denen Cläre im Souterrain der Buchhandlung von Herrn Jud stand, waren die schönsten der Woche. Hier fand sich die Welt ein. Wenn schon nicht persönlich, so doch zwischen den Buchdeckeln und mit all den Kunden. Nach Geschäftsschluss trafen sich Herr Jud und seine Freunde im Hinterzimmer, wo sie über dieses und jenes philosophierten, die aktuelle Politik kommentierten oder sich gegenseitig aus Büchern vorlasen, die sie entdeckt hatten. Cläre saß dann mitten unter ihnen und fühlte sich unendlich lebendig zwischen all den Künstlern und Schriftstellern. Oft wurde heiß darüber diskutiert, wie es zum Großen Krieg hatte kommen können und wie künftig Derartiges verhindert werden könne. Während einige der Anwesenden mal eine philosophische oder eine politische oder auch eine religiöse Erklärung suchten, war Cläre der Meinung, dass Kriege sich nur durch Geld verhindern ließen. Je abhängiger die Länder voneinander waren, je verflochtener ihre Wirtschaften, umso weniger war man geneigt, einen Krieg zu führen, der dem eigenen Land mehr Nachteile als Vorteile bringen würde. Diese Ansicht aber schien den anderen eine zu einfache Lösung zu sein. Und so diskutierte man munter weiter mit erhitztem Gemüt, während Cläre weit nach Ladenschluss zurück in die Villa Behmer fuhr.
3
»Fahre bitte nicht so rasant, Kind.« Im Fond des Wagens hielt Maria sich an der Schlaufe über der Tür fest, als der laubfroschgrüne Opel 10 den Hauptbahnhof passierte.
Cläre saß am Steuer und lachte. »Mama, ich fahre gerade einmal dreißig Stundenkilometer.« Sie überholte ein Fuhrwerk mit Bierfässern. »Der Wagen könnte mehr als doppelt so schnell fahren, wenn ich wollte.«
»Um Himmels willen! Lass das! Ich möchte lebend im Kontor ankommen.«
Cläre grinste. Seit sie sich mit dem Argument hatte durchsetzen können, dass es günstiger sei, ihr einen Führerschein zu bezahlen, als einen Chauffeur zu beschäftigen, kutschierte sie Mutter und Tante mit Begeisterung mal hierhin oder dorthin. Leider aber erlaubte man ihr nur, den Opel zu fahren, wenn es um die beiden alten Damen ging. Vergnügungsfahrten jeglicher Art hatten zu unterbleiben. Das bedauerte Cläre sehr, denn Autofahren machte ihr schrecklichen Spaß, gab es ihr doch ein wenig das Gefühl von Freiheit. Und so nahm sie gerne jede Gelegenheit wahr, ihre Mutter oder auch Tante Gertrud zu Bekannten zu fahren oder in die Stadt zu bringen.
»Ich muss gleich noch zu Ladage & Oelke, Mama, um den geänderten Mantel abzuholen. Soll ich dir den neuen Katalog mitbringen?«, fragte Cläre über ihre Schulter nach hinten, ohne den Blick von der Straße zu lassen. Das vornehme Bekleidungsgeschäft lag in den Alsterarkaden, beim Rathaus. Sie würde sich einen Parkplatz am Jungfernstieg suchen.
»Nein, Kind, aber bitte gehe noch zu Tietz. Die Umsätze für unseren Kaffee gingen in den letzten Monaten zurück, und ich frage mich, welchen Grund das wohl haben mag.«
Das beliebte Kaufhaus Tietz am Jungfernstieg war seit vielen Jahren ein guter Kunde von Behmer & Söhne. Man röstete und verpackte exklusiv für den Konsumtempel am Jungfernstieg den Behmer-Traditionskaffee. Nicht einmal in den anderen Tietz-Kaufhäusern in Berlin und Frankfurt gab es diesen fast schon nach Haselnuss schmeckenden Arabica. Dass die Nachfrage nach der feinen Mischung zurückgegangen war, lag allerdings nicht am Kaffee, wie Cläre wusste. Sie hatte Gerüchte gehört, wonach ein Teil der Kundschaft bei Tietz mittlerweile ausblieb. Der Grund hierfür seien die unerquicklichen Schlägertrupps, die das jüdische Kaufhaus seit einiger Zeit immer wieder heimsuchten, um die Ausstellungsräume zu zertrümmern und das Personal zu bedrohen. Kürzlich hätten sie sogar den Geschäftsführer vor aller Augen niedergeschlagen.
In den Zeitungen hatte es mal geheißen, die Nationalsozialisten steckten dahinter, dann wieder, es seien Kommunisten gewesen. Doch egal, wer recht hatte: Die Täter hatten ihr Ziel erreicht. Die ängstliche Kundschaft blieb bei Tietz aus. Man kaufte stattdessen lieber in der mondänen Mönckebergstraße bei Karstadt ein.
Cläre wusste, dass ihre Mutter von dem Leben außerhalb des Kontors und der Villa nicht viel mitbekam. Seit dem Tod ihres Mannes hatte Maria Behmer gesellschaftliche Anlässe auf ein Minimum reduziert, verließ nur selten das Haus und beschäftigte sich wenig mit all den Dingen, die nichts mit der Firma zu tun hatten. Sie las jedoch gerne Bücher und ließ sich wichtige internationale Zeitungen nach Hause liefern. Der Alltag in Hamburg, den sie als Klatsch bezeichnete, interessierte sie nicht sonderlich. Für diesen Teil war Tante Gertrud zuständig.
Langsam rollte der Wagen am Zollkanal entlang. Dahinter lag die Speicherstadt mit ihren Türmchen und Giebeln. Im Sonnenlicht glänzten die glasierten Ziegel wie bunte Edelsteine in Grün und Rot, Blau und Schwarz.
Am Dovenhof, dem ersten modernen Kontorhaus der Stadt, in dem die Firma Behmer & Söhne seit vierzig Jahren ein Kontor betrieb, hielt Cläre an und ließ ihre Mutter aussteigen.
»Bitte hole mich in einer Stunde wieder ab, Kind.«
Cläre nickte und wartete, bis ihre Mutter durch das Portal im Inneren des fünfstöckigen Gebäudes verschwunden war. Während sie sich auf den Weg zum Jungfernstieg machte, dachte Cläre an den Brief aus Bern.
Dass sie sich seit Jahren um einen Studienplatz bemühte, hatte ihre Mutter zur Kenntnis genommen, anfänglich auch begrüßt, dann aber für Zeitverschwendung gehalten, da das Studium der Ökonomie weder einen Nutzen für Cläre noch für die Firma bringen würde. Im Gegenteil hatte Tante Gertrud in seltener Einigkeit ihrer Schwägerin zugestimmt. Ein Studium würde Cläre nur vom Heiraten abhalten. Außerdem sei das Studium der Ökonomie eindeutig unweiblich. Wenn schon, sei Medizin oder Pädagogik angebracht. Aber Wirtschaft? Nein, absolut nicht.
Vielleicht ist es Zeit, die Dinge zu akzeptieren, überlegte Cläre. Ein Wirtschaftsstudium war nun einmal ein unerfüllbarer Traum für eine Frau. In schwere Gedanken versunken, bog sie auf den Jungfernstieg, wo um diese Zeit bereits viele Leute unterwegs waren. Plötzlich sah sie aus dem Augenwinkel einen Schatten schnell näher kommen. Im nächsten Moment war da das Gesicht eines jungen Mannes am Beifahrerfenster. Als Nächstes hörte Cläre nur einen Rums!
Sofort trat sie die Bremse durch, wurde nach vorn geschleudert. Die Reifen quietschten. Der Wagen rutschte. Dann blieb er stehen. Das Gesicht war verschwunden. Draußen schrie jemand auf. Leute kamen herbeigelaufen.
Cläres Herz raste. Das Blut trommelte in ihren Ohren. Ihre Finger umkrallten das Lenkrad.
Draußen rief jemand nach der Polizei. Mit zitternden Beinen stieg Cläre aus.
Als sie um den Wagen herumging, musste sie sich mit einer Hand auf dem heißen Kühler abstützen, weil sie Angst hatte, ohnmächtig zu werden. Niemand beachtete sie. Alle beugten sich zu dem Radfahrer hinunter, der halb auf dem Bürgersteig und halb auf der Straße lag. Er versuchte aufzustehen.
»Danke, danke«, sagte er einer Frau, die ihm empfahl, liegen zu bleiben, bis eine Ambulanz käme. »Mir geht es gut. Bestimmt.«
»Aber Sie bluten am Kopf«, bemerkte jemand, während ein herrisch dreinblickender Mann mit Stock und Zweifingerbärtchen über der Oberlippe kundtat, dass man Frauen das Autofahren endlich verbieten müsse. Lautstark rief er nach einem Wachtmeister.
Umringt von Passanten, stand der Radfahrer da und klopfte mit einer Hand den Staub aus seiner Hose, während er ein Taschentuch auf eine Wunde in seinem Gesicht drückte, das ein Herr ihm gegeben hatte.
»Polizei ist nicht nötig«, wiegelte der junge Mann den übereifrigen Herrn mit dem Bärtchen ab. »Mir geht es gut.« Er lächelte über die Köpfe der Leute hinweg zu Cläre, die noch immer dastand und sich nicht rührte. Sie sah, wie er sich durch die Menschenansammlung drängelte, um zu ihr zu gelangen. »Geht es Ihnen gut?«, fragte er Cläre. »Sie sind weiß wie eine Wand.«
»Es tut mir so leid«, stammelte Cläre mit trockenem Mund. »Ich hatte Sie nicht kommen sehen. Ich war so in Gedanken.« Da entdeckte sie das Fahrrad. »O nein, das Vorderrad!«
Er lachte. »Das wird lustig, mit so einer Acht im Reifen nach Hause zu fahren.«
»Ich ersetze Ihnen natürlich den Schaden.«
»Das ist ja wohl das Mindeste«, meckerte der Mann mit dem Bart. »Und lassen Sie das Autofahren sein. Nächstes Mal fahren Sie sonst noch kleine Kinder um.«
Gerne hätte Cläre etwas erwidert, aber ihr Kopf war leer. Langsam hörten ihre Beine zu zittern auf, während die Leute nach und nach wieder ihrer Wege gingen, da nun wohl doch nichts Aufregendes mehr passieren würde und noch immer kein Wachtmeister in Sicht war.
»Wohin wollten Sie denn?«, fragte Cläre.
»Zur Universität.«
»Darf ich Sie dorthin bringen?«
Er legte den Kopf etwas schief, blickte zwischen ihr, seinem Fahrrad und dem Automobil hin und her, als überlege er, wie gefährlich eine Fahrt mit ihr wohl sein könne.
Cläre erschrak. »Sie müssen natürlich nicht mit mir fahren … Ich bin eigentlich eine gute Fahrerin, wissen Sie. Noch nie zuvor hatte ich einen Unfall! Seit drei Jahren fahre ich schon …«
Da lachte er. »Unsinn. Natürlich wäre es nett, wenn Sie mich mitnähmen. Das war nur ein Scherz. Darf ich Ihren Namen wissen, Fräulein …?« Sie zögerte. »Nun, Fräulein Ohne-Namen, bitte haben Sie Verständnis, dass ich nicht mit jeder hübschen Frau im Auto mitfahre, die sich mir nicht vorzustellen gedenkt. Das würde meine Mutter nicht gutheißen.« Sie entdeckte Grübchen in seinem Gesicht, während er das Taschentuch auf seine Wunde drückte.
»Behmer, Cläre Behmer. Ich wohne in Hamm.« Vorsichtig lächelte sie.
Mit der freien Hand hob er sein Fahrrad auf, dessen Vorderreifen tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Acht aufwies. Dann stellte er es an einen Laternenpfahl und nahm einen kleinen schwarzen Koffer vom Gepäckträger. »Ich hole mein Fahrrad morgen ab«, meinte er, als er zurückkam.
Jemand hupte hinter Cläres Wagen. »Schnell«, rief er, »lassen Sie uns losfahren, bevor die Polizei doch noch kommt.«
Als sie den Alsterpavillon passierten, stellte er sich als Fritz Waltershausen vor. Mehrmals entschuldigte Cläre sich für den Vorfall, während der Wagen erst am Gänsemarkt und dann am Stadttheater vorbeifuhr. Unter der Brücke zum Dammtorbahnhof blieben sie stehen, während ein Zug über ihre Köpfe hinwegdonnerte, der Richtung Hauptbahnhof fuhr. Sein schrilles Pfeifen ließ Cläre zusammenschrecken. So nervös kannte sie sich gar nicht.
Ein weißer Mercedes-Benz mit knallroten Ledersitzen und offenem Verdeck zog hupend an ihnen vorbei. Der Fahrer, ein Geck mit Zigarettenspitze im Mund, schimpfte.
Fritz Waltershausen grinste. »Sie können gerne etwas schneller fahren, Fräulein Behmer. Meinetwegen brauchen Sie nicht zu kriechen. Ich habe keine Angst.«
»Aber ich«, murmelte Cläre leise. Dass sie vor wenigen Minuten einen Menschen umgefahren hatte, steckte noch immer in ihren Knochen. »Hat die Wunde am Kopf aufgehört zu bluten? Ich kann Sie gerne zu einem Arzt bringen.«
»Zu einem Arzt?«, stöhnte er. »Bitte, kein Arzt. Ärzte gibt es in meiner Familie genug.« Prüfend sah er auf das Taschentuch. »Ich denke, es blutet auch nicht mehr. Somit ist also kein Doktor vonnöten«, stellte er zufrieden fest.
Aus den Augenwinkeln schaute Cläre sich diesen Fritz genauer an. Er war in etwa so alt wie sie, hatte volles braunes Haar, das er modisch kurz und gegelt am Kopf trug. Sein Gesicht war glatt rasiert. Er hatte hohe Wangenknochen und eine vielleicht etwas zu große Nase. Seine schönen Hände, die sie an einen Klavierspieler erinnerten, waren aufgeschürft. Das alles tat ihr so schrecklich leid.
»Sie studieren Musik?«, fragte Cläre ihn unvermittelt, weil sie nicht wusste, was sie sonst hätte sagen sollen.
»Wie kommen Sie denn darauf?«
Cläre warf einen kurzen Blick auf den Koffer, der auf seinem Schoß lag. »Ach so, wegen meiner Trompete. Nein, ich studiere zwar, aber nicht Musik. Gelegentlich spiele ich in einer Tanzcombo mit, um mein armseliges Studentendasein etwas aufzufrischen, wenn Sie verstehen, was ich meine.« Er rieb Zeigefinger und Daumen der freien Hand gegeneinander.
»Und was studieren Sie?«
»Mal Philosophie, dann Medizin. Derzeit Juristerei bei Professor Bartholdy. Seit sieben Jahren. Ich kann von allem ein wenig.«
Cläre spürte, wie seine Worte sie verärgerten. Wie konnte es sein, dass dieser Fritz alles studieren konnte, was er wollte, sie hingegen nicht? Nur, weil er ein Mann war? Dabei wollte er offenbar gar nicht studieren. »Sie scheinen ein recht unsteter Mensch zu sein«, sagte sie schnippisch.
»Das meint Professor Bartholdy auch. Er würde alles tun, um mich von der Universität zu jagen«, sagte er, ohne auf die Spitze zu reagieren.
»Warum denn das?«
Fritz lachte auf. »Ich frage zu viel und denke zu wenig, meint er.«
»Das aber sehen Sie anders, richtig?«
»Genau. Ich möchte kein Jurist werden.«
»Sondern?«
»Journalist oder Musiker.« Er tippte mit den Fingern auf den schwarzen Kasten auf seinem Schoß.
»Wir sind da.« Cläre hielt den Wagen vor dem Hauptportal der Universität. Studenten strömten aus dem Gebäude hinaus oder hinein. »Sollte man als Journalist nicht auch etwas Vernünftiges gelernt haben?«
»Richtig, Fräulein Behmer, etwas Vernünftiges.« Er strahlte sie an. »Und Sie?«
»Ich?« Sie zögerte. Sollte sie zugeben, eine unnütze Tochter aus reichem Hause zu sein, die seit Jahren einem dummen Traum hinterherlief und ihr Ziel wohl niemals erreichen würde? »Ich möchte studieren.«
»Ah ja, und was?«
»Ökonomie. Also Volkswirtschaft, um genau zu sein.«
»Bei Sieveking in Hamburg?«
Er klang interessiert. Das machte ihr ein wenig Mut. »Man hat mich in Hamburg abgelehnt. Ebenso an sieben anderen Universitäten. Aber ich versuche es weiter, denn es kann nicht an meinen Noten liegen. Wohl eher daran, dass ich eine Frau bin.«
Er schwieg einen Moment. Schon dachte sie, er würde sich jetzt über ihren Studienwunsch lustig machen oder ihr eine Predigt darüber halten, dass Frauen sich ihrer Rolle bewusst sein und nicht aufstrebenden jungen Männern die Studienplätze wegnehmen sollten …
»Würden Sie mit mir ausgehen, Fräulein Behmer? Sagen wir, am Samstag um acht?«, fragte er unvermittelt.
Erschrocken sah Cläre ihn an. »Nein, natürlich nicht!«
»Und wenn ich Ihnen einen Gefallen tue?«
»Auch dann nicht.«
»Gut, dann ist es abgemacht.« Er stieg aus und drehte sich noch einmal zu ihr um. »Bis Samstag dann. Ich hole Sie ab.« Mit Schwung schlug er die Tür zu und lief auf das halbrunde Portal der Universität zu.
»Nein, das werden Sie nicht! Außerdem wissen Sie gar nicht, wo ich wohne!«, rief Cläre ihm noch nach.
»Aber natürlich weiß ich es. Cläre Behmer, Hamm.« Er hob die Hand zum Abschied und verschwand im Gebäude.
»Unverschämter Kerl.«
4
»Wagner?« Herbert Staller hielt die Schellackplatte in der Hand. Es war Donnerstagabend, und Cläres Verlobter war wie üblich zum Abendessen erschienen.
Cläre saß im Salon auf dem Sofa und blätterte gelangweilt in einem Modemagazin, während sie darauf wartete, dass Stine das Essen fertig hatte. »Ja, ein Geschenk von Otto zu Mutters Geburtstag. Das Koffergrammofon gab es gleich dazu.« Ohne aufzusehen, blätterte sie weiter. »Es klingt schrecklich.«
»Wagner?« – »Ja, der auch.«
Herbert Staller legte die Platte zurück in die Papphülle und nahm neben seiner Verlobten auf dem Sofa Platz. Obwohl er erst Mitte dreißig war, lagen seine Haare schütter über dem Scheitel. Er würde mit den Jahren sicherlich zur Glatze neigen. Staller kam aus Bremen, wo sein Vater einen kleinen Kaffeehandel betrieb. Cläre wusste, dass ihr Verlobter in Hamburg große Pläne hatte. Er verstand sich prächtig mit Tante Gertrud, die in ihm dennoch nur einen mehr oder minder geeigneten Heiratskandidaten für ihre Nichte sah. Zumindest besäße Herbert Staller den nötigen Ehrgeiz, den Tante Gertrud bei Cläre nicht ausmachen konnte, wie sie einmal meinte. Natürlich sei der junge Münchmeyer eine bessere Partie, aber wenn es unbedingt ein Bremer Kaufmann sein solle, dann sei Herbert Staller nicht die schlechteste Wahl.
Cläre hatte sich mit Staller nur verlobt, um dem ewigen Drängen ihrer Familie und ihrer Freundinnen aus dem Weg zu gehen. Sie war in ihrem Freundeskreis jene gewesen, die mit über zwanzig noch immer keinen Heiratskandidaten hatte vorweisen können. Irgendwann aber, so hatte eine Freundin gemeint, müsse man in den sauren Apfel beißen.
Sicherlich war Herbert Staller kein Traummann, aber er schien gewisse Dinge vorweisen zu können, die man von einem Hamburger Kaufmann erwartete. Zielstrebigkeit gehörte auf alle Fälle dazu. Manchmal fragte Cläre sich, ob der Heiratsantrag das Nebenprodukt seiner Ambitionen sein könnte, Mitglied im »Verein der am Caffeehandel betheiligten Firmen« zu werden, zu dem nur Hamburger Firmen Zutritt erhielten. Der Verein war eine international mächtige Institution und das Rückgrat des Kaffeehandels. Er bestand aus einer eingeschworenen Gruppe von alten Männern, die weltweit großen Einfluss auf Regierungen hatte und diesen fraglos nutzte, um ihre Interessen durchzusetzen. In den vier Jahren des Großen Krieges hatten die traditionellen Kontakte der Hamburger Kaufleute nach Südamerika und Afrika allerdings sehr gelitten. Und so war der Kaffeehandel noch immer nicht zu seiner alten Blüte zurückgekehrt. Das aber, so meinte Herbert Staller, sei nur eine Frage der Zeit.
Tante Gertrud und Herbert Staller teilten den großen Traum einer Mitgliedschaft im Kaffeeverein, koste es, was es wolle. Genau dieser Traum war es wohl, so vermutete Cläre, der Staller die Geduld aufbringen ließ, seit zwei Jahren darauf zu warten, endlich die Erbin von Behmer & Söhne heiraten zu dürfen. Einer Traditionsfirma, die sich einmal im Zentrum des Vereins befand, dann dieses Privileg verlor, doch längst an ihrer Rückkehr arbeitete.
Cläre spürte seine blassgrauen Augen auf sich.
»Du weißt, was ich davon halte«, durchbrach Herbert die Stille.
»Wovon?«
»Deiner fixen Idee, studieren zu wollen.«
»Es ist keine fixe Idee«, murmelte sie matt und dachte an Sisyphos, der genau wie sie unermüdlich Felsen einen Berg hinaufrollte, nur, um dann kurz vor dem Ziel wieder zu scheitern. Vielleicht war es ja besser, sich in das hineinzufinden, was das Schicksal für sie bestimmt hatte. Die Zukunft saß neben ihr, roch nach 4711 und hatte schütteres Haar.
Cläre blätterte weiter. Ihr Verlobter stand auf und ging zur Anrichte, um sich ein Glas Cognac einzugießen, obwohl es noch nicht einmal zum Abendessen geläutet hatte. »Zwei Jahre Verlobungszeit sind eine Zumutung für einen Mann«, meinte er und nahm einen Schluck. »Die Leute reden schon.«
»Ich weiß.« Sie neigte ihren Kopf noch tiefer, damit er den Kampf in ihren Augen nicht bemerkte. Sie dachte an all die Reisen, die sie doch eigentlich noch hatte machen wollen, bevor es zu spät war. Griechenland. Ägypten. Norwegen. Mit dem Schiff wollte sie einmal nach Brasilien, um mit ihrer Mutter die Fazenda Santo Antônio zu besuchen. Sie dachte an einen Artikel in der Gartenlaube, in dem von einem Luftderby nur für amerikanische Pilotinnen die Rede gewesen war. Sie dachte an Frauen wie Marie Curie, die den Nobelpreis gleich zwei Mal erhalten hatte, oder an Coco Chanel, die ein Weltunternehmen leitete und von der sie selbst ein kleines Schwarzes im Schrank hängen hatte, sich aber nicht traute, es zu tragen, da es doch recht gewagt war.
Und während jene Frauen all diese aufregenden Dinge erlebten, sollte sie heiraten. Wie gerne würde sie mit dem Auto über die Alpen nach Italien fahren, um den Wind in ihren Haaren zu spüren. Sie wollte den blauen Himmel über dem Mittelmeer sehen und einmal den Canal Grande entlangfahren.
In all diesen Träumen hatte Herbert keinen Platz. Aber was waren schon Träume? Wertlose Gedanken, die arme Seelen wie Irrlichter zum Sterben ins Moor lockten. Sie spürte, wie der Kampf um ihren Traum sie immer mehr anstrengte und müde machte. Vielleicht war es wirklich besser, vernünftig zu sein. »Wenn wir heiraten, Herbert, dann nur in Hamburg.«
Zufrieden grinste ihr Verlobter. Seine Vorderzähne waren etwas schief. »Wunderbar. Ich denke, der September ist ein guter Monat. Meine Eltern und Geschwister werden aus Bremen anreisen. Selbstredend überlasse ich euch Frauen die Planungen. Meine Mutter kommt sicherlich früher, um …«
In diesem Moment schrillte das Telefon auf dem Sekretär. Verärgert über die Unterbrechung, starrte Herbert den Apparat an. Cläre erhob sich, ging hinüber und nahm den Hörer ab.
»Anschluss 4-5-3-9, Behmer. Wer spricht?«
In der Leitung war eine Frauenstimme zu hören. »Hier das Vorzimmer von Professor Bartholdy. Spreche ich mit Fräulein Cläre Behmer?«
»Am Apparat.« Cläre drückte ihren Rücken durch, presste den Hörer fester an ihr Ohr. Sie spürte, wie ihr Herz eifrig zu pochen begann. Es knackte. Dann hörte sie eine Männerstimme. Während Cläre der sonoren Stimme lauschte, spürte sie Herberts Blick in ihrem Rücken. Ob sie vorbeikommen könne, wollte der Anrufer wissen. »Wenn es Ihnen keine Umstände macht, wäre sofort am allerbesten.« Cläre zögerte mit einer Antwort, drehte sich zu Herbert. Überlegte.
»Sehr gerne«, sagte sie dann. »Ich bin in einer halben Stunde bei Ihnen.« Professor Bartholdy gab ihr die Adresse durch, die Cläre notierte. Dann legte sie auf.
Sie wusste nicht genau, was ein Professor der Jurisprudenz von ihr wollte, aber etwas sagte ihr, dass ihr Leben gerade eine äußerst spannende Wendung zu nehmen schien. Kurz überlegte sie, ob das die Überraschung war, die Fritz Waltershausen ihr versprochen hatte.
Gerade wollte sie aus dem Raum eilen, als ihr einfiel, dass sie sich von dem Anrufer gar nicht verabschiedet hatte. Sie nahm den Hörer noch einmal in die Hand, zögerte und legte ihn dann wieder zurück auf die Gabel. Sie lief zur Tür, die ins Vestibül führte, als Herbert sich ihr in den Weg stellte.
»Darf ich erfahren, wer am Apparat war?«
»Aber natürlich!« Cläre lief um ihn herum. »Sobald ich zurück bin.« Die Absätze ihrer Schuhe klackten auf dem weißen Marmor, als sie zur Garderobe eilte, den Mantel überwarf und ihren Hut vor dem Spiegel aufsetzte. Sie nahm den Wagenschlüssel vom Tisch und wollte hinausgehen, doch Herbert versperrte ihr den Weg.
»Wer war der Mann?«
Cläre brauchte einen Moment, bevor sie verstand, was er meinte. Erleichtert lachte sie auf. »Keine Angst, ich pflege keine heimlichen Männerbekanntschaften«, sagte sie ihrem Verlobten. Kurz erschien vor ihrem inneren Auge das Bild von Fritz, dem frechen Fahrradfahrer mit den Grübchen. »Es ist Professor Bartholdy von der Universität gewesen. Er will mich sprechen.«
»Gerade eben sagte ich dir, dass du diese Flausen aufgeben musst. Du wirst demnächst eine verheiratete Frau sein. Da hast du keine Zeit für so einen Firlefanz.«
Cläre wollte widersprechen, als er sie am Arm festhielt.
»Als dein künftiger Ehemann verbiete ich dir, zu diesem Herrn zu gehen.« Sein Mundwinkel zuckte.
Cläre hielt die Luft an. Sie spürte, dass er Streit suchte. Dieses Mal aber würde sie nicht nachgeben, würde nicht um des lieben Friedens willen einen Kompromiss suchen. »Nicht jetzt, Herbert«, sagte sie und wollte seine Hand fortschieben. Er aber ließ sie nicht los.
Erbost sah sie ihn an. »Ich werde zu Professor Bartholdy fahren«, sagte sie und hoffte, energisch genug zu klingen. »Und sei es nur, um zu erfahren, dass es für mich in Hamburg noch immer keine Chancen auf einen Studienplatz gibt.« Sie schaute ihm direkt in die Augen. »Bitte, Herbert. Wie kann ich je frei sein, wenn ich mein Leben lang darüber nachgrübeln muss, ob ich es nicht vielleicht doch …?«
»Du wirst meine Frau, Cläre Behmer«, unterbrach er sie. »Das sollte dir genügen.« Er wies zur Tür. »Wenn du dort hindurchgehst, werde ich unsere Verlobung überdenken müssen. Ich lasse mich nicht noch länger zum Narren halten.« Seine Stimme dröhnte durch die Halle.
In diesem Moment trat Gertrud oben auf der Galerie an das Geländer und blickte neugierig auf die Szenerie hinunter.
»Was ist da los?«, verlangte sie zu wissen. Auch Stine lugte um die Ecke.
Mit klopfendem Herzen überlegte Cläre, ob sie nicht doch bleiben sollte. Der Herr Professor hatte mit keinem Wort verraten, warum er sie sehen wollte. Vielleicht ging es gar nicht um ihr Studium. Cläres Gedanken rasten. Sie war eine Behmer. Die einzige echte Behmer, die noch einen Mann in die Familie bringen und einen Sohn in die Welt setzen konnte, die Tradition … Der Skandal, den das Lösen der Verlobung mit Herbert heraufbeschwören würde … Schon ging ihre Hand zum obersten Knopf des Mantels. Sie öffnete ihn, um ihn auszuziehen. Langsam fuhren ihre Finger unter Herberts Augen über den Stoff, hin zum zweiten Knopf, als Stine zu ihr trat.
»Du solltest diesen Herrn Professor nicht warten lassen, Kind. Frage ihn, was er möchte, und komme dann schnell zurück. Ich sage deiner Mutter, dass du dich zum Essen verspäten wirst.«
Herbert fuhr herum. »Was fällt dir ein, dich einzumischen, wenn deine Herrschaften sich unterhalten?!«, brüllte er.
Stine wich keinen Schritt zurück. »Sie können mich ja rauswerfen, Herr Staller, wenn Sie hier erst einmal das Sagen haben«, zischte sie. »Bis dahin sind Sie nur Gast.«
Er hob die Hand, als wolle er sie schlagen, überlegte es sich dann aber noch einmal anders, als Gertruds Stimme von oben zu hören war. »Stine! Was fällt Ihnen ein!?«
Da alle so trefflich mit Stine beschäftigt waren, huschte Cläre schnell aus dem Haus. Seit sie denken konnte, war die Köchin ihr Fels in der Brandung gewesen. Nichts und niemand konnte sie beugen. Darum hielt sich Cläres schlechtes Gewissen, Stine allein mit Gertrud und Herbert zurückzulassen, auch in Grenzen.
*
»Es ist unverzeihlich, dass du dich auf so eine Erpressung einlassen willst, Albrecht«, sagte der weißhaarige Herr in dem Salonsessel vor der Bücherwand, während er in einem Buch blätterte.
Professor Albrecht Mendelssohn Bartholdy nahm die Pfeife aus dem Mund und lehnte sich in seinem Schreibtischstuhl zurück. Vor ihm lagen die Abschlussarbeiten seines Seminars zur Vergleichenden Rechtswissenschaft, die alle noch bis zum Wochenende durchgesehen werden mussten. Er schaute seinen Freund Cassirer an. »Du hast wie immer recht, lieber Ernst. Aber dies ist keine philosophisch-moralische Frage. Glaube mir, wenn Fritz noch einen Tag länger in meine Vorlesungen kommt, geschieht ein Unglück!«
»Du übertreibst. Dein Patenkind ist sicherlich ein wenig, wie soll ich sagen …?« – »Impertinent!«
Professor Cassirer lächelte seinen erbosten Freund nachsichtig an. »Nein, ich wollte sagen, wissbegierig. Du hegst doch eine eher liberale Denkweise, in der jeder seine Meinung sagen soll.«
»Herr Kollege! Der Fritz hat keine Meinung. Und wenn, dann höchstens eine unreflektierte. Der Junge hat absolut kein Talent für die Wissenschaft. Und seine politischen Ansichten sind derart laissez faire, dass ich um unsere Zukunft fürchte, sollte der Junge es je zu etwas bringen oder auch nur mit einer herausragenden Persönlichkeit unserer Zeit zu tun haben.«
Professor Cassirer lachte lauthals los. »Der Junge ist genau so, wie du einmal warst, Albrecht. Ein Träumer mit einer unglaublichen Kraft, Realitäten in Neues zu verwandeln. Ich muss es wissen, ich bin Professor für Philosophie. Du aber nur Jurist.«
Bartholdy schien nicht überzeugt zu sein.
»Doch, Albrecht, glaube mir. Du unterschätzt den Fritz. Er wird noch Großes vollbringen.«
»Unsinn. Der Junge wird mit seiner Verantwortungslosigkeit Schaden anrichten«, widersprach Bartholdy.
»Aber ist es wirklich nötig, dass du diese junge Dame empfängst, um ihr Hoffnungen auf einen Studienplatz beim Kollegen Sieveking zu machen, nur, weil du es Fritz versprochen hast?«
»Ich bin zum Äußersten bereit, Ernst. Zum Äußersten. Außerdem habe ich nie behauptet, dass sie hier studieren könne. Ich habe Fritz nur gesagt, ich würde sie mir ansehen.«
»Vom moralischen Standpunkt aus ist das verwerflich, Albrecht.«
Bartholdy erhob sich und strich durch seinen weißen Vollbart. »Ich weiß«, meinte er zerknirscht und klopfte seine Pfeife aus.
Cassirer stellte das Buch zurück in das übervolle Regal hinter seinem Sessel. »Was sagt Kollege Sieveking zu deiner Scharade?«
»Er hat gelacht und gemeint, dass er noch nie eine Frau im Seminar hatte und damit auch nicht anzufangen gedenke.«
»Und nun?«
Bartholdy seufzte. »Mir wird schon noch etwas einfallen.«
Es klopfte an der Tür.
»Das wird sie sein.« Ernst Cassirer erhob sich aus dem Sessel. »Bringe es der jungen Dame schonend bei, Albrecht.«
5
Auf Gleis 3 wartete der Zug nach Berlin auf die letzten Passagiere. Elise Zwillenberg, geborene Tietz, stand hinter ihrem vierjährigen Sohn Lutz Oscar, der sich, so weit es ging, aus dem Abteilfenster beugte. »Tschühüss, Tante Maria!«, rief der Kleine, und Maria winkte dem Tietz-Sprössling vom Bahnsteig aus zu. Er und seine Cousins würden in einigen Jahren den Warenhauskonzern erben, zu dem nicht nur das Kaufhaus am Hamburger Jungfernstieg gehörte, sondern seit drei Jahren auch das KaDeWe in Berlin.
»Danke für die schöne Zeit in Hamburg, Maria«, rief Elise ihrer Gastgeberin zu. Sie hatte mit Lutz Oscar einige Tage an der Elbe verbracht, und Maria hatte es sich zur Aufgabe gemacht, Mutter und Kind eine unvergessliche Zeit zu bereiten. Sie mochte die Familie Tietz, seit sie für das Kaufhaus am Jungfernstieg vor vielen Jahren die erste Kaffeemischung kreiert hatte. Wenn alles gut ging, würden wohl bald auch die anderen Konsumtempel der Familie in Hamburg, Berlin, Weimar, Bamberg und München zu den Kunden von Behmer & Söhne zählen. Maria war mit dem Besuch aus Berlin in jeder Hinsicht mehr als zufrieden.
Ein schriller Pfeifton erfüllte die gläserne Abfahrtshalle des Hauptbahnhofs. Der Schaffner schritt an den Waggons vorbei. »Einsteigen, bitte!«
Aufgeregt hüpfte Lutz Oscar derweil vor dem Fenster der ersten Klasse auf und ab, wobei er immer wieder das neu gelernte Hamburger Wort »Tschühüss« rief, bis seine Mutter ihm den Mund verbot.
Der Schaffner schloss die Türen und ging zur zweiten Klasse. Maria stellte sich an das Fenster und reichte Elise Zwillenberg die Hand. »Grüß deinen Mann von uns. Und kommt recht bald wieder! Es gibt noch so viel zu sehen in Hamburg.«
»Das werden wir sehr gerne tun, liebe Maria. Bitte sage deiner Familie, dass wir uns freuen würden, wenn ihr uns in Berlin besuchen kämt. Ich vergesse auch nicht, meinem Hugo von deinem wunderbaren Tietz-Kaffee vorzuschwärmen.«
Ein weiterer Pfiff, dann fuhr der Zug schnaufend an.