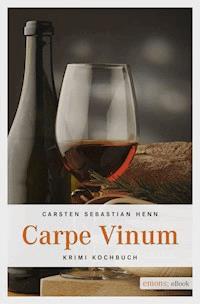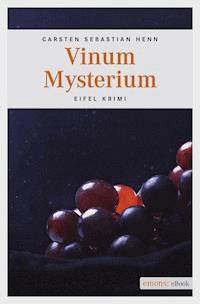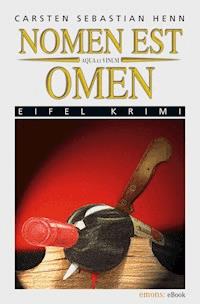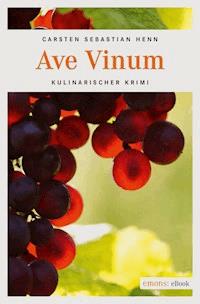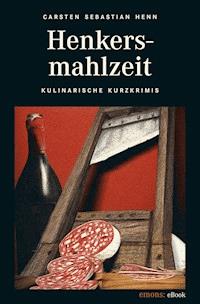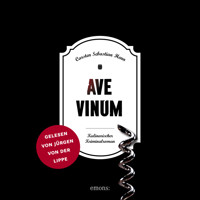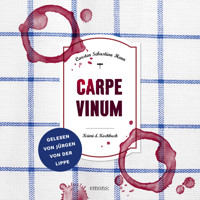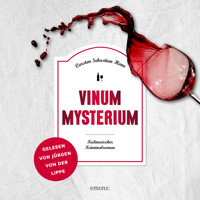4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Windspiel Niccolò und Trüffelhund Giacomo ermitteln in ihrem ersten Fall: Für alle Fans von Glennkill! Eines Morgens ist das verschlafene piemonter Dorf Rimella menschenleer. Auf den Tischen steht noch das Geschirr, in den Gärten hängt noch die Wäsche. Das junge Windspiel Niccolò macht sich verzweifelt auf die Suche nach seinen Menschen. Nur der erfahrene Trüffelhund Giacomo kann ihm helfen, die Hintergründe eines Unglücks aufzuklären - und damit ein noch größeres zu verhindern. Für die beiden Hunde beginnt ein gefährliches Abenteuer… »Auf die Idee muss man erst einmal kommen: ein liebenswerter Trüffelhund als Weinkenner! Ich habe diesen Roman mit großem Vergnügen gelesen.« (Ingrid Noll)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
© dieser Ausgabe, Piper Verlag GmbH, 2019© der deutschsprachigen Ausgabe: List im Ullstein Buchverlage GmbH 2009Covergestaltung: Favoritbüro MünchenCovermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Zitat
I DREI REISENDE
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
II VON DER DICKE DES BLUTES
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
III DAS SPIEL DER KRÄFTE
Kapitel 11
Kapitel 12
EPILOG
Zitat
Wir haben wohl hienieden
Kein Haus an keinem Ort,
Es reisen die Gedanken
Zur Heimat ewig fort.
Joseph von Eichendorff, »Wehmut«
I DREI REISENDE
Kapitel 1
RIMELLA
Niccolò roch die heranreifenden Trauben der Rebstöcke, noch bevor seine Augen sich geöffnet hatten. Seine jungen Muskeln ließen den Körper emporschnellen, und er rannte in den Tag, als wäre dieser so verheißungsvoll wie ein luftgetrockneter San-Daniele-Schinken. Und nur für ihn angeschnitten worden.
Der Wind trug das Parfum der Langhe wie seit Jahrhunderten über die Hügel des Dorfes Rimella. Die Nacht war kühl gewesen und ruhig, das Rascheln der Blätter des alten, weit ausladenden Maronenbaums hatte Niccolòs Träume begleitet und sie weich gebettet. Er hatte von Cinecitta geträumt, der zierlichen Terrierhündin der Bolgheris, die immer so hochwohlgeboren von ihrem schmiedeeisernen Balkon auf das Geschehen der Piazza sah, wo er mit den Jungs lag. Dort behielten sie stets alles im Blick und schnappten nach von der Hitze trägen Mücken.
Die Morgenwärme lag wie ein Versprechen über Rimella, als Niccolò von den Hügeln herabschoss. Die Sonne stand hinter dem Dorf, und die kleinen Häuser, von denen der farbige Putz alter Haut gleich abblätterte, bildeten eine dunkle, undurchdringliche Mauer. In Niccolòs Hundeaugen gab es nur Schattierungen von Grau. Düfte dagegen, Düfte funkelten in allen Farben.
Trotz der Geräusche seines Laufs bemerkte er die Veränderung sofort.
Und er begann seine Pfoten langsamer zu setzen. Dann blieb er ganz stehen, nahe dem Ortsschild, das nun schon seit drei Jahren schief stand, seit dem Tag, an dem der alte Bruno mit dem Motorroller nach einem langen Abend im Wirtshaus dagegen gekracht war. Niccolò stand gerne hier, denn von dieser Stelle aus konnte er beinahe wie ein Vogel auf sein Heimatdorf blicken und beobachten, was auf der Hauptstraße, den drei seitlich davon abzweigenden Gassen und der kleinen Piazza mit dem steingefassten Brunnen vor sich ging. Die Mauersegler zogen in Schwärmen große Kreise über Rimella. Schnell und elegant, ihre langen, dünnen Flügel sichelförmig gebogen, immer wieder ihr durchdringendes Srriiii ausstoßend. Noch waren die Schatten lang, die von den Dächern der Häuser fielen. Sie verbargen vieles, selbst vor Niccolòs ungewöhnlich scharfen Hundeaugen. Doch er meinte, sein Rimella läge zu ruhig da, so als wäre es mitten in der Nacht, als schliefen alle noch in ihren Häusern.
Niccolòs Augen mochten von der ihm entgegenstehenden Sonne beeinträchtigt sein, seine Ohren waren es nicht. Und sie hörten Merkwürdiges. Die Geräusche schienen wie durch Geisterhand verwandelt.
Er machte sich auf, den Grund dafür herauszufinden. Seine Schritte hinunter ins Dorf waren langsam, als müsste er sich auf dünnem Eis vorwärtstasten. Kein Auto war zu hören, und was noch ungewöhnlicher war, keine Abgase waren zu riechen, obwohl Niccolò diese lange im Nachhinein erschnuppern konnte. Vor allem der neue Dieseltraktor seines Herrn stieß Gerüche aus, die wie schwere Inseln in der Luft lagen. Doch selbst davon fand sich nichts in der jungfräulichen, von der Nacht geklärten Luft, die von Rimella zu ihm drang.
Die Ohren zum Dorf hin ausgerichtet horchte Niccolò mit jedem Schritt in den Wind. Kein dumpfer Schlag des Hackbeils vom Metzger Donadoni ertönte, üblicherweise begleitet von einem zufriedenen Schnaufen, kein Rascheln der Brottüte, die der junge Luca in der Bäckerei der weiblichen Kundschaft immer mit einem verführerischen Lächeln über den Tresen reichte, kein Saugen, Gurgeln und Sprotzeln der Espressomaschine in Marcos kleiner Trattoria, kein scharfes Klacken der Scheren in Signorina Elisabethas Friseursalon, den viele Frauen als Freudenhaus verspotteten, da Elisabetha es nicht einsah, ihre geschäftsfördernd kurzen Röcke gegen damenhaftere Längen einzutauschen.
Nichts von alldem trug der Wind zu Niccolò. Denn nichts von alldem geschah.
Aurelius’ Blut floss heiß durch die Adern, das Bild vor seinem einen verbliebenen Auge hatte es hochkochen lassen, denn es verhieß ein Lob von Grarr. Und genau ein solches brauchte er, um wieder näher an dessen Macht zu kommen.
Der Hügel erstreckte sich unter ihm. Aurelius warf seinen Blick darauf, er sah für Grarr, verschmolz für diesen mit der kargen Natur, als sei er der Rumpf eines vom Sturm geknickten Baumes. Sein graubraunes Fell glich der Erde, auf der er stand, war ein Teil von ihr.
Dies war das Land der Wölfe, hier herrschten sie. Hier herrschte Grarr.
Für einen alten Wolf, der im Kampf sein rechtes Auge verloren hatte, einen Krüppel, einen Geschlagenen, war dieser Fund ein unerwartetes Geschenk. Ein Knurren drang aus Aurelius. Es kam nicht vom Hunger, es zeugte von wiedererwachender Kraft. Sein alter Leib wurde in eine Schwingung gebracht, die er schon lange nicht mehr verspürt hatte.
Der leblose Körper, den er mit seinem Auge fixierte, hatte sich nicht mehr bewegt, seit die Sonne über der höchsten Pappel des kleinen Waldes erschienen war. Aurelius zweifelte nicht daran, dass kein Blut mehr in den Bahnen zirkulierte, dass dieser Leib ohne Leben war. Aber Aurelius war alt, und er hatte schon viel gesehen, was eigentlich nicht sein konnte. Er ging einfach auf Nummer sicher. Er wollte sich nicht lächerlich machen, das überließ er der Jugend.
Grarr würde besonders freuen, wie der Tod eingetreten war. Er schätzte das Grausame und das Ausgefallene.
Aurelius würde es nun melden gehen.
Dies war ein guter Tag. Die Langhe zeigte Gnade mit einem alten Graurücken. Aurelius streckte langsam die Hinterläufe durch und wendete seinen Körper, den die Morgensonne nun zärtlich erwärmte wie eine Mutter ihr frierendes Kind. Drei junge Wölfe schossen hechelnd an ihm vorbei. Sie waren wie ein Sturm auf zwölf Beinen. Und er wusste, wie gefährlich dieser Sturm sein konnte.
Aurelius hörte, worüber sie sprachen, und er roch das wie Fontänen aus ihren Poren dringende Adrenalin.
Sie hatten die Leiche ebenfalls gesehen. Und sie waren auf dem Weg zu Grarr.
In Donadonis Metzgerei hing das Fleisch wie stets an den Haken und roch köstlich. Der Laden war leer, die Messer lagen noch auf dem Block, als würden gleich mit ihnen Filets herausgeschnitten und Knochen gespalten. Niccolò ging erwartungsvoll hinter die Theke und damit an einen geheimen Ort, den er nie hatte betreten dürfen. Vielleicht machte Donadoni dort ein Nickerchen, oder er war einfach nur den Ausdünstungen seiner Angestellten erlegen, die verführerische Blütenaromen auf ihren Hals auftrug, und beide lagen ineinander versunken auf den kühlen weißen Kacheln.
Doch der Boden war leer, bis auf einige Blutspritzer.
Der Weg ins Hinterzimmer, in die eigentliche Metzgerei, war versperrt, die Tür verschlossen. Niccolò hörte nichts von dahinter, roch auch nicht den warmen, salzigsüßen Geruch lebender Menschen. Sondern nur Fleisch. Direkt über ihm. Doch zu hoch, um mit einem beherzten Sprung dorthin gelangen zu können, hing die Verheißung an spitzen Metallhaken. Niccolò leckte sich trotzdem die Lefzen, als hätte er ein Stück davon im Maul.
Was konnte Donadoni, einen guten Menschen mit wichtigem Handwerk, dazu bringen, sein Fleisch allein zu lassen? Welches Unglück musste geschehen sein, um diesen Mann von seinem Liebsten fernzuhalten?
Niccolò hatte gesehen, wie der Metzger das Fleisch berührte, wie seine Finger es massierten und streichelten. Nie ließ er einem der Hunde Rimellas solche Liebkosungen zukommen.
Er musste irgendwo sein. Die Menschen Rimellas würden sich bestimmt irgendwo versammelt haben, wahrscheinlich, weil ein Fest stattfand. Die Mangialonga in den Weinbergen zum Beispiel oder der Palio degli Asini in Alba, von dem Niccolò bisher nur gehört hatte, dass dort störrische Esel gejagt wurden.
Schon anhand der Struktur von Kiesel und Stein in den Gassen Rimellas wusste Niccolò stets, wo im Dorf er sich befand. Trotzdem erschien ihm nun alles fremd und gefahrvoll. Sein eigenes Heim war verschlossen, kein Futternapf stand vor seiner Unterkunft, es gab keinen Klang vertrauter Schritte und lieb gewonnener Stimmen. Nicht die seiner beiden ausgewachsenen Menschen, und auch nicht der schrille Klang des kleinen Mädchens mit dem hellen, geflochtenen Haar und den Zähnen, auf denen ein Metalldraht funkelte. Nur die Hühner im Stall hinten im Garten gackerten wie eh und je. Es war sein Zuhause und doch nicht, denn zu diesem gehörten die Menschen und ihre Töne, die Gerüche und die Hände, die ihm ab und an das Fell kraulten.
Mit jedem Haus, in das er blickte, wurde er bedrückter, sank sein Kopf tiefer zu Boden. Vor dem der Bolgheris, Cinecittas Heim, schreckte er lange zurück, hob es sich auf.
Doch nun drängte es ihn, genau dorthin zu gehen, denn die Piazza war nicht deshalb so schrecklich leer, weil keine Autos fuhren, keine Menschen miteinander sprachen, sondern weil Cinecitta nicht von ihrer Loge herabblickte.
Das Tor zum Innenhof des dotterfarbenen Eckgebäudes stand einladend offen. Innen sah es aus wie immer, im herzförmigen Schwimmbecken trieben ein paar Rosenblätter, der gestreifte Sonnenschirm war geöffnet. Im Türrahmen des Haupthauses fand Niccolò ein Herrenhemd auf dem Boden, dreckige Fußspuren darauf. Die Luft und die Stufen des Treppenhauses waren bedeutend kühler als draußen. Dieses Rimella hinter den dicken Mauern war auch im Sommer erfrischend wie ein klarer Bach, in diesem Rimella stach die Sonne niemals aufs Fell.
Niccolò war die Stufen zu Cinecitta noch nie emporgegangen. Er hatte sich immer nur vorgestellt, wie es bei den Bolgheris wohl aussah, wie sie ihre edle Hündin auf feinsten Kissen betteten und Näpfe aus Marmor benutzten. Als er die Tür zur Wohnung der Familie mit der Schnauze aufstieß, konnte Niccolò sehen, dass er nicht allzu weit von der Wahrheit entfernt gelegen hatte. Überall im Flur hingen gerahmte Fotos von Cinecitta, eine Glasvitrine enthielt Pokale, deren Deckel von posierenden Hunden gekrönt waren. Sie sahen alle aus wie Cinecitta. Niccolòs Weg führte ihn zuerst in die Küche. Die Näpfe standen auf einer kleinen runden Stickdecke und waren aus Porzellan in Knochenform. Erst danach bemerkte Niccolò die Teller auf dem Tisch, darauf eine einfache Pasta mit Sardellen gekrönt. Und nur zu einem Drittel gegessen, auf beiden Tellern. Im Schlafzimmer der Bolgheris war das Bett zerwühlt, Kleidung lag verstreut auf dem Boden, und der große Schrank war aufgerissen, viele Fächer leer.
Doch nirgendwo Cinecitta. Ihr Geruch, ihr betörender Duft, hing überall in den Stoffen und Wänden, wie eine Erinnerung an bessere Tage. Niccolò ging hinaus auf den Balkon, um wie sie auf die Piazza zu schauen. In diesem Moment stürzte sich die Einsamkeit auf ihn und fraß ihn auf mit einem Bissen, schluckte ihn in ihren dunklen Magen, dessen Wände zu eng und dessen Säure beißend war.
Niccolò war allein. Zum ersten Mal in seinem Leben. Hunde waren nicht allein, dachte Niccolò, und suchte Fenster für Fenster die umliegenden Gebäude nach einem Lebenszeichen ab. Hunde lebten mit ihrer Familie, mit Freunden. Sie waren nicht gemacht zum Alleinsein. Sie konnten nicht allein sein. Durften es nicht.
Er war der Hund seines Herrn Aldo, er war Giuseppes, Canaiolos und Ernestos Freund, er war Cinecittas Bewunderer und der schnellste Läufer von Rimella. Doch wer war er ohne Bianca, Giuseppe, Canaiolo, Ernesto und Cinecitta, wer ohne sein Rimella? Wer war er dann?
Cinecittas Duft lag überall, in jeder Ecke der Wohnung und sogar auf dem Balkon. Er machte Niccolòs Einsamkeit noch schlimmer. Der junge Hund rannte hinaus aus ihrem Reich, rannte die Treppenstufen hinunter, rannte durch die schattige Dunkelheit zum Tor.
Und spürte plötzlich scharfe, spitze Zähne in seinem Rücken.
Namen trugen sie nicht, sie waren eine Einheit. Drei Wölfe, zwölf Klauen, unzählige Zähne. Sie waren bekannt als ›Die Kralle‹, da sie nicht mehr losließen, was sie einmal hatten, und es schneller wegtrugen als ein Vogel. Sie jagten über den Feldweg wie ein einziges Tier, ihre Beine verschwommen zu einem braungrauen Schemen, und ihr Lauf klang wie ein Felsblock, der durch das Unterholz rollte. Sie stießen kurze Laute aus, keine Worte, doch jeder von ihnen wusste, was gemeint war. Grarr hatte ihnen einen Befehl gegeben, nachdem sie ihm von der Leiche berichtet hatten, sie postwendend auf den Weg nach Rimella geschickt und Blutdurst in ihre Fänge gelegt. Den alten Aurelius liefen sie fast über den Haufen. Nicht aus Versehen, sondern weil sie es so wollten. Er war alt und er war schwach, er war nicht nur eine Last, er war eine Schande für das Rudel.
Aurelius kannte das traurige Spiel und blieb stehen, als er sie näherkommen hörte. Er wurde ganz ruhig, ließ der Jugend ihren dummen Übermut. Früher war er wie sie gewesen, nur hatte er stets alles allein regeln müssen. Wenn er einem Gegner gegenüberstand, gab es keine Drei-zu-eins-Chance, dass dieser jemand anderen angriff. Er hatte immer Aurelius angegriffen. Aurelius hatte immer überlebt.
Der Wald lichtete sich. Es kam Aurelius stets vor, als machten die Bäume an dieser Stelle einen furchtsamen Schritt zur Seite, denn in der Höhle vor ihnen hauste Grarr. Ein schmächtiger Wolf stand neben dem engen Loch, das hineinführte ins Dunkel. Keine Wache, das hätte Grarr für ein Zeichen der Schwäche gehalten. Es war mehr ein Diener, der Besuch ankündigte.
Als Aurelius sich näherte, versperrte ihm dieser den Eingang.
»Wir haben dich nicht so früh erwartet, Graufell«, sagte der Diener. Aurelius hatte ihn einst selbst ausgebildet.
»Ich habe eine dringende Nachricht für ihn. Sie kann nicht warten.«
»Die Kralle …«, begann der Diener, doch Aurelius unterbrach ihn.
»Die drei wissen nicht alles. Ihr Blick ist zu schnell und ihr Verstand zu langsam. Jetzt geh aus dem Weg.«
Doch der Diener ging nicht, er ließ sich stattdessen auf den Boden nieder und knurrte leise.
Früher wäre Aurelius über ihn hinweggesprungen. Doch nun wusste er, dass nicht jeder Kampf es wert war, gekämpft zu werden.
Er brauchte nicht lange zu warten, konnte alsbald aufhören, die beiden Krähen zu beobachten, welche schweigend ihre Kreise über Grarrs Höhle zogen. Der Wolfsdiener machte den Eingang frei – jedoch nicht, um Aurelius hineinzulassen. Eine Wölfin kam heraus, ihr Fell so rot wie das eines Fuchses. Sie war nicht mehr so jung und biegsam wie die begehrtesten des Rudels, doch besaß sie mehr Eleganz als jede andere, und ihr Schritt war federnd leicht. Wie sie jetzt aus der Höhle kam, war er sogar noch federnder als sonst, was Aurelius nicht verborgen blieb. Sie blickte sofort zur Seite, als sie ihn sah, verbarg ihr Gesicht, lief schnell davon.
Nun auch Laetitia, dachte Aurelius. Ausgerechnet Laetitia.
»Komm zu mir, Bruder!«, kam es von innen.
Aurelius sah noch einen Moment zu der Eiche, hinter der Laetitia verschwunden war, bevor er durch das enge Loch trat.
Der Schmerz raste in Niccolòs Nervenbahnen. Doch noch schneller kam der Schock. Es war doch noch jemand in Rimella! Griff ihn an! Ihn allein! Bevor er sich wehren konnte, wurde der zweite Biss gesetzt.
Und ließ nach.
Der Druck verschwand.
»Du verdammter Idiot!«
Etwas köstlich Süßes lag plötzlich in der Luft, Niccolò nur zu gut bekannt, doch nun mit einer stechenden Schärfe versehen. Er drehte sich um. Seine Augen hatten sich mittlerweile an die Dunkelheit gewöhnt.
»Du bist noch da – was für ein Glück!«
Cinecitta sah ihn wütend an, Blut auf ihren Lefzen. Ihr weißes Fell war dreckig von Erde und auch nicht gebürstet wie sonst. Doch sie bewegte sich immer noch wie eine Königin, und ihr Tonfall entsprach auch einer solchen. Cinecitta war majestätisch, obwohl sie nicht viel größer als ein Laib Brot war.
»Das kann ich überhaupt nicht finden. Mit einem Plünderer als einziger Gesellschaft! Ich hab dich erst überhaupt nicht erkannt.«
»Macht ja nichts«, sagte Niccolò und humpelte näher zu ihr heran. »Tut schon gar nicht mehr weh.« Und so war es auch. »Von Plündern kann aber keine Rede sein, ich wollte nur nach dir sehen.«
»Wir müssen reden«, sagte Cinecitta und ging aus dem Tor. »Ich muss dir etwas zeigen. Es gibt da ein Problem.«
»Wenn du damit meinst, dass Rimella entvölkert ist, das ist mir doch tatsächlich auch schon aufgefallen.«
»Noch eins«, sagte Cinecitta, »ein totes Problem, um genau zu sein.«
Niccolò fühlte sich so geborgen mit Cinecitta, dass die Bedeutung dieses Satzes nicht zu ihm durchdrang. Er folgte ihr nun, als steckte er in einem Halsband und die Leine hielte sie. Es ging aus Rimella hinaus, südlich über die Landstraße, dann hinauf zu der Wiese unter dem Felsmassiv, das muskulös wie der Rücken eines Stierbullen die Steinwand zusammenhielt.
Der Weg entging Niccolò, er folgte dicht hinter Cinecitta, sog ihren Duft ein, der für ihn wie Nahrung war, und bewunderte den Schwung ihres Hinterteils. Seine Welt bestand aus nichts anderem mehr. Doch dann blieb diese Welt plötzlich stehen, kein Schwung erhitzte seine Gedanken mehr, und in den süßen Duft Cinecittas mischte sich ein verdorbener, der unter sein Fell kroch und Kälte in den Körper goss. Aus großen Kübeln.
Cinecitta trat zur Seite, und Niccolò sah ihn. Und doch war er es nicht. Nur wenige Meter entfernt lag Sylvio. Eine Art Sylvio. Es waren sein kurzes sandfarbenes Fell, sein breiter Schädel, seine ebene Stirn mit den Falten, seine leicht hängenden Lefzen. Es war fraglos der große, massige Hund, den er kannte, seit er in Rimella war. Es war das unbestrittene Oberhaupt aller Hunde im Dorf, der zwei Zentner schwere Mastiff Sylvio.
Und doch auch nicht.
Cinecitta wandte sich um, ihr Blick noch härter als sonst. »So sah er nicht aus, als ich ihn gefunden habe. Geh näher ran, Niccolò. Schau auf den Bauch.«
Mit jedem Schritt wurde der Gestank stärker, verwandelte sich in dichtes Gestrüpp, das in Niccolòs Nase stach, schließlich hineinkroch und die Schleimhäute angriff wie ätzende Säure.
»Was stehst du nur so zitternd da?«, hörte er Cinecitta hinter sich zischen. »Bringt der flinke Niccolò nicht dasselbe zustande wie eine zierliche Hündin?«
Das Fell des alten Freundes war zerfetzt. Die Stücke lagen über einem viel zu kleinen Bauch, Blut hatte das Gras und die wilden Kräuter darunter dunkel gefärbt. Doch es sah nicht aus, als hätte ein anderes Tier Sylvio gerissen, Spuren von Zähnen fehlten, und eine so unregelmäßige Öffnung eines Bauches hatte er noch nie gesehen.
Es passte einfach nichts zusammen.
Denn in und um Rimella gab es niemanden, der Sylvio hätte bezwingen können. Er war gutmütig gewesen, ja, kaum aus der Ruhe zu bringen, aber wenn wirkliche Gefahr bestand und er wütend wurde, war gegen sein schieres Gewicht, seine Wucht kein Kraut gewachsen gewesen. Ein von einem privaten Züchter in Fossano entlaufener Vielfraß hatte diese Erfahrung machen müssen, als er hungrig im Winter umherirrend den schlafenden Sylvio für einen jungen Luchs gehalten und angeknabbert hatte. Sylvio hatte zurückgeknabbert. Und mehr.
»Er ist aufgeplatzt«, sagte Cinecitta. »Ich habe seine Gedärme überall verstreut gefunden.« Niccolò blickte sich um, doch sah er nur frische Erdhügel, ordentlich gescharrt.
»Nun bist du an der Reihe, Niccolò«, sagte Cinecitta. »Es ist kein anderer mehr da. Jetzt ist Rimella dein Dorf.«
Niccolò hörte gar nicht zu, er wich vom Leichnam zurück, erschrocken über sich selbst. Denn egal, wie sehr ihn der Gedanke schockierte, dass Sylvio gestorben war, wie sehr der Geruch des alten Mentors in der Luft lag, das da vor ihm war Fleisch, frisches totes Fleisch, und er hatte schon länger nichts gegessen.
»Kein Hund platzt einfach so«, sagte Niccolò, den Blick von Sylvios Leichnam abwendend und die Nase schnell in den frischen Nordwind haltend.
Cinecitta machte sich auf zu gehen. »Wir müssen die anderen suchen.« Sie schlug den Weg Richtung Hauptstraße ein. Menschen benutzten Straßen, dachte die Hündin. Und andere Menschen würden wissen, wo ihre Menschen waren.
Plötzlich grummelte der Bauch des Berges.
Es klang dumpf und schwer, als hätte er Verdorbenes zu sich genommen, und viel davon. Es wurde lauter, glich nun mehr einem dunklen Schrei, fand Niccolò, wie von einem Tier, das tief unter der Erde lebte, das noch nie die Sonne gesehen hatte. Die Haut des Berges begann zu zittern, dann krachte sie und zersprang.
Niccolò und Cinecitta standen wie verwurzelt auf der wilden Wiese.
Der Berg kam näher.
Dass er seine Pfoten vorsichtig zu setzen hatte, wusste Aurelius, als er in die Höhle seines Bruders trat. Sonst drohte Verletzung. Knochen, einige alt und verblichen, andere frisch und scharf, mit verrottenden Fleischresten, lagen verstreut auf dem steinigen Boden.
So liebte es sein Bruder.
Trübes Licht drang durch einen Spalt weit oben in der Höhle und fiel wie ein träger Wasserfall auf den Vorsprung, der Grarrs Platz in dieser Welt war. Der Rest der Höhle erhielt nur den Abglanz seines Lichtes, nicht mehr als Reflexionen in der Dunkelheit. Aurelius schob mit der Pfote einen Beinknochen beiseite, setzte sich und wartete. Denn sein Bruder putzte sich sorgfältig das Fell zwischen den Hinterflanken. Es war Bewunderung in Aurelius’ Blick, als er seinen Bruder sah, trotz der Wut über Laetitia, und obwohl Grarr sich ihm gegenüber nicht immer brüderlich verhalten hatte. Doch was zählte, war nur das Rudel. Und diesem stand Grarr vor, auch wenn viele versucht hatten, ihm seine Position streitig zu machen. Sie alle hatten den schlohweißen Wolf mit den roten Augen unterschätzt, der von seiner Statur her eher klein gewachsen war. Auch die Kralle hatte vor drei Jahren versucht, ihn zu stürzen, zu dritt. Sie hatte ihm aufgelauert, als er des Nachts seine Höhle verlassen hatte, um dem Vollmond zu huldigen, wie es seine Pflicht war. Einer der drei war von vorne gekommen, die beiden anderen von den Seiten.
Alle anderen Wölfe waren zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Hügel versammelt.
Grarr war allein gewesen.
Er hatte keine Chance gehabt.
Drei spitze Schreie, kurz nacheinander, waren zu hören gewesen, und schließlich war nur Grarr aus dem Wald getreten, kein Tropfen Blut auf seinem weißen Fell, keine Wunde an seinem Körper. Die Kralle wurde danach zwei Monate lang nicht mehr gesehen. Dann kam sie zurück und rollte sich vor Grarr auf den Rücken, die Hinterbeine gespreizt, und er hatte sie huldvoll an Fell und Männlichkeit geleckt.
Sie hatten sich unterworfen.
Als Grarr nun mit der Fellpflege fertig war, blickte er nach oben, als würde er im Tageslicht duschen. Sein Fell schimmerte, wie von innen leuchtend. Das Licht fiel so auf seine Augen, dass sie wie blutrote Rubine erstrahlten.
»Und?«, fragte Grarr. »Du hattest es also eilig, zu mir zu kommen?«
»Ich weiß, dass die Kralle bereits bei dir war. Doch …«
Grarr unterbrach ihn. »Du musst mir nicht sagen, wer zu mir gekommen ist, Bruder. Weißt du mir etwas Neues zu berichten?«
»Sylvio starb anders als die unserigen. Er starb von innen heraus.«
»Es kann trotzdem kein Zufall sein, dass es vier Tote an einem Tag gibt. Die Dinge hängen zusammen. Wie ist die Lage in dem Menschennest?«
»Es ist leer, keine Zweibeiner zu riechen.«
»Du meinst keine lebenden?« Grarr rollte sich auf den Rücken und ließ das Tageslicht seinen Bauch erwärmen.
»Sowohl als auch. Es sind nur zwei Hunde da, schwächliche Tiere. Das ist alles. Und einige Katzen, aber die sind überall. Wie Ungeziefer.«
Grarr stand wieder auf und blickte, den Kopf wie zum Angriff gesenkt, hinüber zu seinem Bruder im Knochenmeer. »Der Gott des Berges ist blind. Wir aber nicht. Drei von uns sind getötet worden. Dabei hatten sie keine Schuld auf sich geladen. Diese Ungerechtigkeit muss gesühnt werden. Die Kralle ist unterwegs, um den Blutzoll Rimellas einzufordern. Egal von wem.«
»Ich werde es überwachen, Bruder.«
Grarr schüttelte sein Haupt und schritt in einen Unterschlupf im Fels, der von Aurelius’ Platz nicht einzusehen war. Er hörte die Stimme seines Bruders nur als hohles Echo zu ihm dringen.
»Du wirst nicht gebraucht. Ruh dich für heute aus.« Als Aurelius schon am Ausgang war, fügte Grarr noch etwas hinzu. »Schick Laetitia morgen früh zu mir. Sie darf wiederkommen. Ihr Schlafplatz ist doch nah an deinem, oder?«
Der Berg war für Niccolò immer ein fester Teil seiner Welt gewesen, wie der Himmel mit seinen Sternen, wie der schlichte alte Brunnen in der Mitte von Rimellas Piazza. Sie alle waren einfach da, von ihnen ging keine Gefahr aus, Konstanten in einer sich ständig wandelnden Welt. Die Sonne stand steil am Himmel und ließ die im Bergmassiv eingeschlossenen Gesteinsschichten blitzen wie rasiermesserscharfe Klingen.
Und sie kamen näher.
Weg, nur fort, jetzt! Cinecitta und Niccolò rannten davon.
Doch plötzlich verfing sich einer von Cinecittas Läufen in einem Erdloch, zwischen einem Stein und einer kräftigen Wurzel.
Der Bergrücken brach vollends. Rutschte so sanft ab wie die Eiskugel auf dem Waffelhörnchen eines gierigen Kindes.
Und Cinecitta kam nicht weg.
»Ich helfe dir!«, bellte Niccolò. »Ich hol dich da raus!« Und er drückte mit seiner Schnauze so sehr, wie es sein kleiner Körper zustande brachte. Es half nichts. Er schaufelte mit seinen schmalen Pfoten den Boden um das eingeklemmte Bein weg.
Doch der Himmel rückte viel zu schnell näher. Er war dunkel und schwer.
Cinecittas Bein kam nicht frei, zu sehr hatte sie sich durch das ständige Herausreißen verhakt, zu groß war der unnachgiebige Stein.
Niccolò sah nur noch eine Möglichkeit, und er war so verzweifelt, sie zu ergreifen. Er biss zu, biss in ihr Bein, bis das Blut quoll, wollte es durchtrennen, wollte Cinecitta mit den Zähnen von den Wurzeln lösen. Die Hündin jaulte auf, trat aus, versuchte noch verzweifelter, wegzukommen.
Dann bemerkte Niccolò den Wind. Den Sturm, den der abgleitende Berg vor sich hertrieb, der durch sein Fell fuhr auf der Flucht vor der erdrückenden Masse.
Niccolòs Körper folgte dem Wind ohne Niccolòs Kopf, ohne sein Herz anzuhören. Er setzte sich in Bewegung mit der fliehenden Luft, er rannte schneller als je zuvor, immer geradeaus, immer schneller, immer weiter.
Hinter ihm änderte sich die Landschaft.
Der Berg wurde immer niedriger.
So schnell wie es begonnen hatte, hörte es wieder auf. Die Erde wurde langsamer, das Grammeln nahm ab, doch Steine schossen immer noch wie wild an Niccolò vorbei, tanzten und sprangen hinab nach Rimella, als seien sie froh, endlich befreit worden zu sein aus ihrem jahrtausendealten Gefängnis.
Dann wurde es völlig still. So still hatte Niccolò die Welt noch nie vernommen.
Er blickte sich um. Zersprungener Fels, umgeknickte Bäume, aufgewühlte Erde. Wo Cinecitta lag, war nicht einmal zu erahnen. Verschwunden unter meterhohem Schutt.
Niccolòs Welt brach zusammen wie der Berg eben vor ihm. Der Tod Cinecittas würde fortan auf seinem Gewissen lasten.
Dreckiger Staub stieg einer Nebelwand gleich von den Erdmassen auf. Und aus dem Nebel trat ein Wolf, groß gewachsen, mit schmutziggrauem Fell und einer braunen Schnauze. In seinen Augen stand nur Bosheit. Langsam kam er näher, verfiel dann in einen Trab, der zu einem Rennen wurde. Er senkte den Kopf.
Niccolò drehte sich um.
Von hinten kamen zwei weitere Wölfe auf ihn zu. Sie glichen dem ersten aufs Haar. Auch ihr Blick. Je länger er wartete, schoss es Niccolò durch den Kopf, desto kleiner wurde der Korridor, durch den er fliehen konnte. Mit jedem Schritt kesselten die Wölfe ihn weiter ein. Sie waren schnelle, flinke Jäger.
Es gab nur eine Lösung. Er musste rennen.
Jetzt!
Und Niccolò rannte los.
Die Kralle schoss in wilder Hatz hinter ihm her, den Blutdurst pulsierend in ihren Leibern. Rimella verschwand so schnell hinter ihnen wie eine über die Theaterbühne gezogene Kulisse. Quer über Felder, durch die Rebgänge der Weingärten und über Straßen jagten sie einander nach. Die Wölfe waren schnell und hatten über die Jahre eine Ausdauer erlangt, die sie lange Jagden lieben ließ. Die Beute hetzen, bis sie umfiel, das Ende auskosten, so schmeckte sie am süßesten.
Doch der Abstand zu ihrer Beute wurde immer größer.
Die Kralle wusste es nicht, doch Niccolò war ein Italienisches Windspiel.
Und niemand, wirklich niemand, rannte schneller als er.
Kapitel 2
ALBA
Seine Nase erwachte zuerst. Noch halb im Schlaf sog Giacomo die von der Mittagssonne erhitzten Ausdünstungen der Stadt in seine großen Nüstern. Er war von der uralten Rasse der Lagotto Romagnolo, die seit Jahrhunderten wegen ihres Geruchssinns im Piemont zur Trüffelsuche eingesetzt wurden. Doch von dieser ruhmreichen Vergangenheit war an ihm wenig zu erkennen. Sein gekräuseltes, leicht öliges Fell, das es allen Vertretern seiner Rasse ermöglichte, selbst im kältesten Eiswasser unversehrt zu bleiben, war schmutzig-weiß. Der Dreck der Straßen Albas hatte sich in vielen seiner Locken verfangen. Er trug die Stadt auf diese Weise überall mit sich hin. Nur Giacomos Nase war vom Verfall nicht betroffen, sie machte der Historie der Lagotto Romagnolo weiterhin alle Ehre.
Zuerst nahm er die tiefsten Aromen der Stadt wahr, die sich so in das alte Mauerwerk Albas eingeprägt hatten, dass kein Regen, kein Schnee und kein Sturm sie hinforttragen konnten. Es waren der leicht säuerliche Geruch von zu lange geöffnetem Wein, der von süßer Torrone und von reifen, weißen Trüffeln. Er lag wie ein erotisierendes Parfum über der Stadt und ließ die Röcke der jungen Mädchen für die Augen der Männer noch kürzer aussehen, die Schenkel der Frauen noch strammer. Für Giacomo war dies das olfaktorische Grundrauschen, es legte die Farben des Bildes fest, das er mit seiner Nase einsog. Es gab ihm die Sicherheit, zu Hause zu sein. Faszinierender waren jedoch die Gerüche der Speisen, der Salamis wie der in Barberawein getränkten Muletta oder der aus Eselfleisch hergestellten Salame d’asino, der Duft vom Ziegenmilchkäse Formaggetta und natürlich das unnachahmliche Aroma frischer Pasta. Eng damit verwoben waren die Aromen der Menschen, die mit prall gefüllten Einkaufstaschen vorübergingen. Doch bislang ließ kein Duft Giacomo aus seinen Träumen aufschrecken, keiner versprach umgehenden Genuss. Die Vorderläufe weit von sich gestreckt lag er hinter der gesplitterten Holztür mit der schiefhängenden Nummer drei in der Vicolo dell’Arco, einer kleinen Gasse, die von der Piazza Risorgimento mit seiner prachtvollen Cattedrale di San Lorenzo abging und von den meisten Touristen, die tagtäglich verlässlich wie Gezeiten morgens und nach dem Mittag in die Stadt geschwemmt wurden, übersehen wurde.
Durch den Spalt am unteren Ende der Holztür drang warme Luft wie ein Föhn ins Innere des schon lange verlassenen Hauses, in dem Giacomos Nase nicht nur die Vicolo dell’ Arco erfasste und die gesamte Piazza Risorgimento, sondern auch die Haupteinkaufsstraße Albas, die Via Vittorio Emanuele II. Es war nicht nur ein Bild der Gegenwart, das die gewaltigen Nüstern in Giacomos Kopf entstehen ließen, es zeigte ihm auch die Vergangenheit. Er konnte erkennen, welcher Zweibeiner welchen Weg gegangen war, welche Autos frische Waren gebracht hatten und sogar, wo jemand länger verharrt, seinen Duft intensiver in der Luft verteilt hatte. Es war eine Welt der Schlieren, eine Welt des Jetzt und des Damals, die Giacomo auch viel über die Zukunft sagte, denn die meisten der Schlieren kannte er schon lange und gut.
Und es war eine Welt, die kein anderer Hund der Stadt mit solcher Präzision erschnüffeln konnte.
Plötzlich erschien einer der schönsten Düfte. Giacomo öffnete die Augen.
Der hektische Mann mit den teuren Ledersohlen und der alten Aktentasche kam aus dem Gebäude der vielen Anzugträger. In der Tasche konnte Giacomo die beiden Dreiecke eines Tramezzino doppio erschnuppern, belegt mit Ei, Thunfisch, Schinken und Pilzsalat. Genau wie immer.
Es leuchtete geradezu durch das mürbe Leder. Giacomo wusste, dass ein Teil davon für ihn bestimmt war. Die Schritte des Mannes würden sich nun wie immer seiner Gasse nähern. Der Mann war verlässlich wie kein Zweiter, und er hatte immer ein Streicheln für ihn übrig, auch wenn Giacomo das eigentlich nicht leiden konnte. Der alte Trüffelhund stemmte sich auf. Es fiel seinen Muskeln mittlerweile schwer, den Körper aufzurichten und ihn zu bewegen. Sie taten es nur noch für Nahrung oder eine ruhige Schlafstätte. Giacomo drückte sich unter dem Spalt ins Freie und baute sich vor der Tür auf. Er wandte keinen der üblichen Tricks an, riss die Augen nicht weit auf, ließ nicht die Zunge heraushängen, senkte nicht geschwächt den Kopf. Und vor allem wedelte er nicht freudig.
Der Mensch kam näher.
Sein Weg führte an der Cattedrale di San Lorenzo vorbei. Eine Menschenmenge stand davor, drängte hinein. Um diese Tageszeit sollte eigentlich keine Messe sein, dachte Giacomo, der Menschenansammlungen stets mied. Ein junger, wuscheliger Bobtail lag vor der Kirche, die Leine noch um den Hals, und schien das Tramezzino ebenfalls zu wittern. Tapsigen Schrittes und mit hängender Zunge kam er auf Giacomos Tramezzino-Mann zu. Wedelte und bellte. Dann riss er die Augen freudig auf.
Der Mann öffnete seine Aktentasche.
Der Duft des Tramezzino wurde intensiver, stach nun wie ein Neonleuchten in der Welt der Gerüche Albas hervor.
Giacomos Beine bewegten sich wie von selbst darauf zu.
Doch kamen sie schnell zu einem Halt. Denn das Tramezzino verschwand in Gänze im Hals des jungen Bobtails.
Giacomo würde nichts mehr davon abbekommen.
Und schuld daran war nur die Kirche, und was auch immer darin stattfand.
Wenn er schon sein wohlverdientes Mahl verlor, wollte er wenigstens wissen warum.
Und so ging er zur betenden Bracke.
Niccolò wich nur aus, egal was oder wem. Und wenn die Bäume und Autos, die Häuser und Zäune, die Rebstöcke und Büsche es zuließen, rannte er geradeaus. Einfach weg. Kein Blick zurück. Sein Herz pumpte so laut durch den kleinen, schlanken Körper, dass er nicht hörte, ob er seine Verfolger abgeschüttelt hatte oder die drei Wölfe immer noch hinter ihm herjagten. Umdrehen konnte Niccolò sich bei diesem Tempo nicht, und er wollte nicht anhalten, auf keinen Fall anhalten, bloß rennen, weg und immer weiter weg. In seinem Kopf war nur Platz für das Setzen seiner Füße und das nächste Hindernis, dem es auszuweichen galt.
Bis er stolperte und fiel, einen Weinberg hinunterstürzte und schmerzvoll mit Bauch und Vorderläufen an einem Barolo-Rebstock hängenblieb.
Er hatte keine Kraft mehr in seinen Augen, um zu fokussieren und Herannahendes zu erkennen, keine Kraft in seinen Beinen, um im Fluchtreflex den Hang hinunterzulaufen. Niccolò konnte nur liegenbleiben und atmen. So verharrte er über Stunden am Hang, und als sein Körper nicht mehr schmerzte, schlief er ein, wachte erst wieder auf, als es bereits Nacht war.
Als er sich mühsam auf die Beine stellte und den Weinberg hochstieg, kam dunkler als ein Wolf die Erkenntnis über ihn, dass er im Nirgendwo war und nicht mehr wusste, wo Rimella lag. Kein Hügel glich einem seiner Hügel, kein Duft der Heimat lag in der Luft. Zwar wuchsen auch hier Haselnusssträucher und Pappeln, Rebstöcke bedeckten wie daheim die Hügel, doch sie waren falsch. Die Landschaft hatte so nicht zu sein. Wie ein Albtraum hatte sich die Welt gewandelt. Der steinige Boden schlitterte unter seinen Pfoten, als Niccolò sich der Straße näherte und immer stärker den Urin anderer Hunde riechen konnte, die ihr Revier markiert hatten. Dies war ihr Reich und er ein Eindringling. Doch er musste hoch zur Straße, denn Straßen führten zu Menschen, und Menschen hatten Essen, Menschen würden ihm helfen.
Die Nacht war klar, und die Sterne stachen wie Nadelspitzen aus dem dunklen Samt des Himmels. Der Mond lag jedoch hinter der Hügelkuppe, sodass alles rings um Niccolò fahl erschien. Endlich erreichte er die betonierte Straße, sie war rau und menschenleer. Der junge Windhund konnte nicht erkennen, wohin sie sich schlängelte, doch er ging bergauf. Das erschien ihm verheißungsvoll. Denn fast alle Dörfer der Langhe, das hatte er von Rimella aus sehen können, lagen auf Hügeln und nicht im Tal. Die Menschen lebten gerne ganz oben, dem Himmel am nächsten.
Schon bald fand ein angenehmer Geruch den Weg in seine Nase und bestätigte Niccolòs Ahnung. Es roch nach Mortadella di fegato, einer derben, fetten Spezialität, genau wonach ihm jetzt der Sinn stand. Er nahm Witterung auf und landete schon nach kurzer Zeit an einer kleinen, windschief aus Wellblech zusammengeschraubten Weinbergshütte. Nun konnte er auch einen Ort erkennen, der tatsächlich oben auf dem Hügelkamm thronte, ein gutes Stück über ihm. Als dunkler Schemen hob er sich vom düsteren Himmel ab. Wie Mauern wirkten die eng aneinanderkauernden Häuser, wie Zinnen die Schornsteine.
Schon aus der Entfernung roch Niccolò, dass die Mortadella vermutlich ein, zwei Tage in der Wellblechhütte gelegen hatte, von der Tageshitze erwärmt und so schneller gealtert war. Doch das störte ihn überhaupt nicht. Die Tür des Schuppens war nur angelehnt, schnell glitt er hinein und fand zwischen den Weinbergswerkzeugen, den Scheren und Handschuhen, den Bütten und Eimern, Heftern und Pheromonfallen in einer Ecke das alte Mortadella-Stück.
Mit der Pfote schob Niccolò es zu sich, das Stück hatte noch keinen Schimmel angesetzt und war nur zweimal angebissen. Er würde es essen und danach schlafen. Er würde sich nicht vom Wind stören lassen, der so an der Hütte rüttelte, dass sie wie ein zusammenbrechender Traktor klang. Sein Fell würde hier trocken bleiben und sein Magen voll. Das war erst einmal genug.
Doch jemand hatte sich hinter ihn geschlichen. Und schnüffelte nun seelenruhig an seinem Hinterteil.
»Das ist meine Mortadella, kleiner Scheißer. Dreh dich nicht um und rühr sie nicht an, sonst verlierst du eines deiner schnuckeligen kleinen Ohren.«
»Ich habe es zuerst gesehen«, sagte Niccolò knurrend. »Deshalb gehört es mir!«
»Seit ich denken kann, lässt der alte Banfi seine Reste hier für mich liegen. Es steht mir zu, und du dreckige Töle bekommst nichts davon ab.«
Niccolò nahm all seinen Mut zusammen und drehte sich um. Er versuchte mit freundlicher Stimme zu sprechen. »Ich habe seit ich-weiß-nicht-wie-lange nichts mehr gegessen. Gib mir etwas ab, Bruder.«
»Bruder?«, fragte der massige Bullterrier und baute sich vor Niccolò auf. »Du? Ich musste lange schnüffeln, um zu erkennen, dass du keine Katze bist.«
Niccolò hielt an sich, um nicht auf sein Gegenüber loszugehen. Der Bullterrier drückte ihn rüde zur Seite und nahm das ganze Stück Mortadella ins Maul. »Du und dein Hunger, ihr seid nicht mein Problem. Und ihr gehört nicht hierher, schert euch weg. Wenn ich zu Ende gegessen habe und du bist noch da, probiere ich, wie so ein Katzenhund schmeckt.«
Niccolò konnte sehen, wie die köstliche Wurst von den Zähnen des Bullterriers zerkleinert und nach und nach weniger wurde.
»Sag mir, wo ich noch so ein Stück finde, und ich bin weg. Auf der Stelle!«
»Da müsstest du schon eine Nase wie Giacomo haben, um hier in der Gegend noch so eines zu finden. Und jetzt verschwinde.«
Aber Niccolò verschwand nicht.
»Was sollen wir nur machen, wenn er sich auch an dieser Stelle nicht findet?«, fragte Vespasian panisch und buddelte trotz schwindender Kraft immer tiefer in der aufgewühlten Erde. Commodus flog der Dreck wie Pfeilspitzen ins Gesicht, und er wendete sich ab. Die beiden jungen Wölfe waren zum herabgestürzten Berg abkommandiert worden, um nach Leichen zu suchen. Sie standen in Grarrs Hierarchie noch weit unten, weshalb sie in jede Aufgabe ihren ganzen Ehrgeiz stecken mussten. Vespasian hatte einen geschmeidigen Körper und rotes Fell schloss kreisrund sein rechtes Auge ein. Commodus war kräftiger gebaut, sein Fell war grau, doch die Vorderbeine schlohweiß, als hätte er sie gekalkt.
»Lass dein Blut nicht unnötig aufwallen. Er muss hier sein, die Kralle hat es selbst gesehen«, sagte Vespasian und beförderte die nächste Fuhre Erde an die Oberfläche.
Commodus rollte mit der Schnauze den bereits geborgenen Körper Cinecittas auf den Rücken und sog den Duft ein. »Sie riecht immer noch widerwärtigst nach Mensch.«
Mit einem wütenden Knurren beendete Vespasian seine Suche. Hier war er auch nicht. Und damit hatten sie alle abgesucht. Sie hätten einen Hund von Sylvios Größe längst finden müssen. »Grarr belohnt den, der liefert. Und wir werden nicht liefern. Du weißt, was das bedeutet!«
Die Schnauze immer noch an der Leiche der Hündin, hörte Commodus seinem Wolfsbruder gar nicht richtig zu. Der sich vor ihm entfaltende Duft war auf eine abstoßende Weise faszinierend. Menschenduft klebte überall an diesem Tier, so intensiv hatte er ihn noch nie gerochen.
»Wie erklären wir Grarr, dass wir Sylvio nicht gefunden haben?«, fragte Vespasian mit Nachdruck und sprang aus der Kuhle, schubste Commodus fort von der Leiche.
Dieser schüttelte amüsiert das Haupt und blickte in aller Ruhe auf diesen neu entstandenen Hang frischer, dunkler Erde, gesprenkelt mit Gesteinsbrocken, grau und groß wie Wölfe, die in sich gerollt schliefen.
»Wir sagen, dass er vollends von den Steinen zermalmt wurde, als sie den Berg herunterstürzten, und dass bereits Würmer und Schaben seine verstreuten Körperreste fressen. Grarr schätzt kein Ungeziefer. Er wird deshalb zufrieden mit uns sein. Wir haben doch die Hündin.« Er packte Cinecitta am Nacken, legte sie Vespasian auf den Rücken und spuckte dann verächtlich aus. »Trag du sie zuerst, ich übernehme, wenn wir am verbrannten Baum sind.« Ich werde es sein, dachte Commodus, der die Leiche vor Grarr ablegt und das Lob erhält.
Sie nahmen den Weg durch Rimella zum Lager. Es kitzelte die Wölfe fast in den Füßen, dieses einst verbotene Land zu betreten, nun leer gefegt von den Feinden, ihren Wagen, ihren Waffen.
»Es ist unnatürlich still«, sagte Vespasian und rückte näher an Commodus’ Seite. »Im Wald hörst du Vögel, das Rauschen der Blätter, ja selbst die Insekten am Boden. Doch hier ist es wie tot.«
Ehrfürchtig gingen sie durch Rimella, als schritten sie über einen Friedhof. Am Dorfplatz sahen sie die anderen Wölfe, acht an der Zahl. Es waren die beiden von Grarr nach Rimella gesandten Trupps, angeführt von Tiberius und Domitian, die Nahrungsmittel finden sollten.
»Es löst sich auf«, hörten Commodus und Vespasian einen der Wölfe sagen. »Das Dorf löst sich auf, jetzt, wo die Menschen es verlassen haben.«
Commodus ging näher heran, Vespasian folgte ihm zögerlich. Doch sie blieben auf Abstand, spürten, dass etwas nicht stimmte.
»Vor zwei Nächten noch! Ich habe es selbst gesehen, bei Romulus und Remus!«, sagte ein anderer Wolf vor ihnen. »Es war schön, weiß und glänzend. Prächtiger noch als die anderen.«
Jetzt wusste Commodus, worüber sie sprachen. Links stand ein Haus, ein altes mit offenliegenden Steinen, und rechts war ebenfalls eines errichtet, ockergelb mit großen Fenstern. Doch zwischen ihnen klaffte eine Lücke. Hier hatte ein Haus der Menschen gestanden, aber nun war es weg, einfach verschwunden.
So, als wäre es nie da gewesen.
Die Cattedrale di San Lorenzo an der Piazza Risorgimento war nur wenige Schritte von dem verfallenen Haus entfernt, das Giacomo nun seit vier Jahren seine Heimstatt nannte. Das Gotteshaus war seit jeher ein Ort der Ruhe, die Stille der imposanten, gotisch-romanischen Kathedrale zog wie Wasserwellen Kreise über die Piazza.
Nun strömte ein tiefes Brummen aus der Kathedrale. Es schien aus vielen Tönen zu bestehen, die leise und ängstlich ausgestoßen wurden. Wie ein Resonanzkörper spiegelte der Platz diese Unruhe. Die Schritte der Menschen um Giacomo waren deshalb unsicher, ihre Augen blickten sich häufig nervös um.
Giacomo musste diesmal nicht vor dem großen Eisenportal warten, bis es von innen aufgestoßen wurde. Die Menschenmasse strömte hinein, das Tor schloss sich nicht mehr. Die Kirche war brechend voll. Die Bracke schlief wie immer am Taufbecken zur linken Seite. Wäre es nicht wegen des ihm entgangenen Tramezzino gewesen, er wäre nicht gekommen. Denn die Bracke konnte sehr speziell sein. Giacomo stupste den Hund mit der Schnauze an. Seine Augenlider hoben sich langsam wie alte Rollläden.
»Giacomo! Giacomo, was führt dich denn zu mir? Ich habe dich schon lange nicht mehr im Haus des Herrn gesehen. Dabei lebst du doch nebenan. Und ich freu mich jedes Mal sehr, dich zu sehen.«
Der Priester, wie die Hunde Albas ihn nannten, war ein Bracco Italiano, in dessen Ahnenlinie auch die mächtigen Molosser mitgewirkt hatten. Der Priester war schwer und feist, die Spitzen seiner Schlappohren waren stets mit Speiseresten bedeckt, das Fell mit seinen großen bernsteinfarbenen Flecken wirkte wie ausgebeult durch das ständige, ausufernde Fressen. Neben dem goldenen Napf des Priesters stapelten sich Hundefutterdosen, Knochen und teure getrocknete Fleischstreifen, einzeln verpackt. Doch egal wie viel der Priester hatte, er gab nie etwas ab.
Deshalb fragte Giacomo gar nicht erst, obwohl sein Magen knurrte. Jetzt, da er das ganze Futter vor sich liegen sah, sogar noch mehr. Doch er würde den Priester niemals nach Essen fragen. Das machten nur Neuankömmlinge.
»Du kennst die Menschen doch«, sagte Giacomo und setzte sich. »Ich dagegen habe mich nie sehr mit ihnen beschäftigt. Deshalb erklär mir bitte etwas …«
Plötzlich stand der Priester auf. »Es läutet«, sagte er. »Ich muss.« Und er erhob sich flinker, als Giacomo es ihm zugetraut hätte, setzte sich auf die Hinterbeine, wuchtete sich mit den Vorderläufen empor und legte die Pfoten aneinander. Der Priester betete. Die Menschen in den hölzernen Gebetsbänken wandten die Köpfe, flüsterten sich erstaunt zu, einige schossen Fotos und wurden dafür von anderen zurechtgewiesen. Ein Pfarrer erschien am Altar und bat um Ruhe, indem er den Zeigefinger an die Lippen hob.
Es war vor etlichen Monaten gewesen, dass sich die völlig heruntergekommene Bracke in die Kirche gestohlen und um Essen gebettelt hatte. Dafür hatte sich der Rüde wie immer auf die Hinterbeine gesetzt und die Pfoten erhoben – doch es hatte nichts genützt. Irgendwann war er so müde gewesen, dass er die Pfoten nicht mehr hochbekam, sie nur noch kraftlos gegeneinander fielen. Er hatte »gebetet«. Da hatte er vom Pfarrer höchstselbst einige Hostien bekommen.
Seither betete er täglich.
Als das Läuten endete, legte sich die Bracke wieder hin. »Ich mach’ nur noch beim Mittagsläuten. Reicht völlig. Das Futter rollt beständig an«, sagte er und wandte sich dem alten Trüffelhund zu. »Du sprachst eben von Menschen, Giacomo. Es sind merkwürdige Wesen, diese Menschen. Sie haben den Hang zu unnötigen Bewegungen, weißt du. Sie rennen, wenn sie nicht jagen oder gejagt werden, sie schlagen und treten Bälle, die sie nicht angreifen, sie rollen auf Brettern, wo sie doch Füße haben. Merkwürdige Gestalten, diese Menschen. Doch mit Futter kennen sie sich aus.« Er schob eine neongelbe Dose verächtlich von sich. »Zumindest die meisten.«
»Es geht mir darum, was gerade geschehen ist. Eigentlich sollte ich jetzt ein Tramezzino essen, aber dazu ist es nicht gekommen. Weil Folgendes passiert ist …«
»Weißt du, Menschen müssen dressiert werden«, unterbrach der Priester Giacomo. »Es dauert lange, doch es geht. Sie sind nicht dumm, nur manchmal zu unaufmerksam. Also muss man als Hund Geduld aufbringen. Du lernst das auch noch.«
Giacomo hasste es, belehrt zu werden, vor allem von einem Hund, der jünger war als er. »Wir haben alle noch vieles zu lernen«, sagte er.
»Siehst du die ganzen Menschen hier? Viele sind wegen mir gekommen, und von Tag zu Tag werden es mehr. Sie verehren mich und bringen mir Speisen. Es ist manchmal lästig, doch ich lasse ihnen die Freude.« Er schlug mit der Pfote lautstark auf eine Tüte mit getrockneten Fleischstreifen, und ein Mädchen aus der letzten Bankreihe mit blondem, geflochtenem Zopf, einer funkelnden Zahnspange und verheulten Augen spurtete zu ihm, um sie zu öffnen.
»Siehst du«, sagte der Priester. »Auch diese Freude gönne ich ihnen. Natürlich könnte ich die Packung ebenso gut selbst öffnen, aber wo sie doch so einen Spaß daran haben.« Er öffnete das Maul wie ein träges Nilpferd und ließ sich den Streifen hineinschieben. »Doch was ich eigentlich über diese merkwürdigen Menschen sagen wollte: Die Kirche ist nicht nur wegen mir so voll, sondern weil sie ein großes Fest abgesagt haben, das für heute geplant war. Nun sitzen sie hier, sind traurig und beten, senken die Köpfe, als habe jemand sie geschlagen. Schon den ganzen Tag. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Warum feiern sie nur nicht?«
»Ist vielleicht jemand gestorben? Eines ihrer Leittiere?«
»Niemand ist aufgebahrt.«
Der Duft des Fleischstreifens drang zu Giacomo, und er musste mit ansehen, wie die feiste Bracke ein Stück nach dem anderen herunterschlang. »Hast du auch Hunger, Giacomo? Du schaust so?«
»So sehe ich immer aus«, sagte Giacomo.