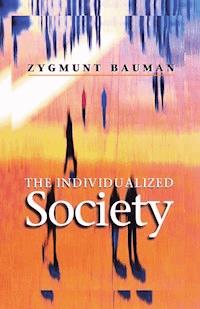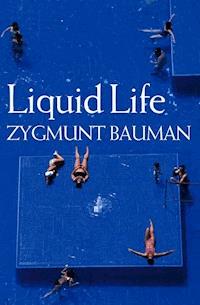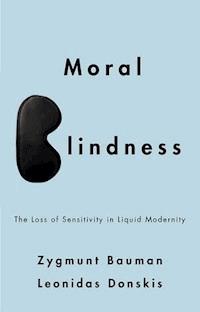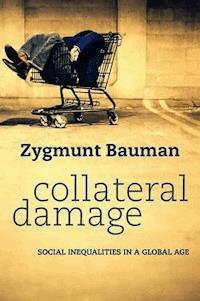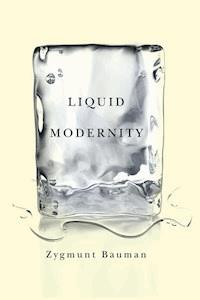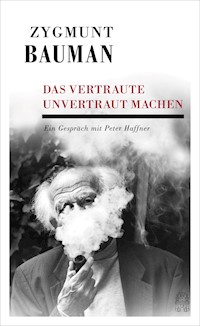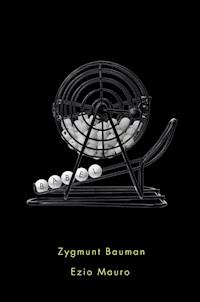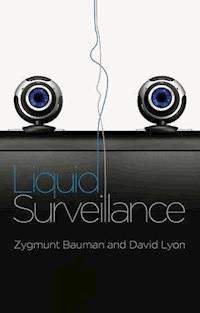14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Die Dekonstruktion der Sterblichkeit machte die Gegenwart des Todes mehr als je zuvor allerorten spürbar: Sie erhob das Überleben zum Sinn des Lebens und die magische Beschwörung des Todes zu Lebensmodellen. Demgegenüber schien die Dekonstruktion der Unsterblichkeit den Sinn zu vernichten und die Notwendigkeit eines Modells zu leugnen. Paradoxerweise gipfelte das Projekt der Moderne in der Vernichtung ihres Werkes. Der Tod ist wieder zurück – un-dekonstruiert, un-rekonstruiert. Selbst die Unsterblichkeit ist nun in den Bann und unter die Herrschaft des Todes geraten. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Ähnliche
Zygmunt Bauman
Tod, Unsterblichkeit und andere Lebensstrategien
Aus dem Englischen von Christiana Goldmann
FISCHER Digital
Inhalt
Zu diesem Buch
Dieses Buch ist keine soziologische Studie über Tod und Sterben; kein Buch darüber, wie wir die Sterbenden behandeln oder der Toten gedenken, wie wir geliebte Menschen betrauern und auf ihren schmerzlichen Verlust reagieren; kein Buch über all die Rituale, die verhindern sollen, daß die Toten allzu schnell und spurlos aus der Welt der Lebenden verschwinden – und die ihr Verschwinden schmerzlos machen. In den letzten vierzig Jahren sind in geradezu atemberaubendem Tempo immer mehr und ausgezeichnete Untersuchungen zu diesem großen und wichtigen Abschnitt unseres Alltagslebens veröffentlicht worden (d.h. seitdem der Tod den Fängen der langanhaltenden Verschwörung des Schweigens entkommen konnte, in die er gegen Ende des 19. Jahrhunderts geraten war und die, wie Geoffrey Gorer so treffend bemerkte, jede Erwähnung des Todes nach Pornographie schmecken ließ). Mittlerweile hat sich die Soziologie des Todes und Sterbens zu einem vollentwickelten Zweig der Sozialwissenschaften ausgewachsen, versehen mit allem, was eine akademische Disziplin für ihren Fortbestand benötigt – einer eigenen reichhaltigen Literatur und einem Netz akademischer Anlaufstellen, Zeitschriften und Konferenzen. Dieses Buch profitiert eher vom Stand der Dinge, statt ihn weiterzuführen. Sein Thema ist weder der Tod noch der »Umgang mit dem Tod«, betrachtet als ein getrennter, wenn auch großer Bereich des sozialen Lebens und als spezifisches, wenn auch umfassendes Gebilde gesellschaftlich gestützter Verhaltensmuster.
Ebensowenig beschäftigt es sich mit einem Wandel in der Wahrnehmung des Todes: mit den Bildern des Todes und seinen Nachwehen, mit dem »Jenseits« oder der Leere, die sich nach dem Ende des Lebens auftut – mit jener mentalité collective, die unsere veränderlichen Einstellungen zur menschlichen Sterblichkeit bestimmt und ihrerseits von ihnen bestimmt wird. Nach Philippe Ariès und Michel Vovelle (und ohne über ihre hervorragenden historiographischen Fähigkeiten zu verfügen) wäre es in der Tat vermessen zu meinen, ich könnte dem großartigen historischen Gemälde, das uns nun vorliegt, etwas Wesentliches hinzufügen.
Dieses Buch handelt in der Hauptsache nicht von jenen Aspekten der menschlichen Geisteshaltung und jener sie stützenden wie von ihr gestützten Verhaltensweisen, die sich unmittelbar und ausdrücklich auf die Gegebenheiten und Vorstellungen des Todes und der Sterblichkeit richten. Es ist im Gegenteil die unbescheidene Absicht dieser Studie, die Anwesenheit des Todes (d.h. das bewußte oder unterdrückte Wissen der Sterblichkeit) in all den Institutionen, Ritualen und Meinungen der Menschen aufzudecken und einer Untersuchung zugänglich zu machen, die dem Anschein nach ausdrücklich und bewußt Aufgaben und Funktionen dienen, welche von den in gewöhnlichen Studien über die »Geschichte des Todes und des Sterbens« untersuchten Tätigkeiten völlig verschieden und unabhängig sind.
Wir alle »wissen« sehr gut, was der Tod ist, jedenfalls solange wir nicht aufgefordert sind, unser Wissen genau darzulegen – den Tod so zu definieren, wie wir ihn »verstehen«. Erst dann beginnen die Schwierigkeiten. Es zeigt sich, daß es letzten Endes unmöglich ist, den Tod zu definieren, auch wenn solche Definitionsversuche – Versuche, den Tod (und sei es nur im Geiste) zu beherrschen, ihm einen angemessenen Platz zuzuweisen und ihn dort zu bannen – nie aufhören werden. Der Tod ist undefinierbar, steht er doch für jene letzte Leere, für jene Nicht-Existenz, die absurderweise allem Sein Existenz verleiht. Der Tod ist das ganz Andere des Seins, ein unvorstellbar Anderes, das sich der Kommunikation entzieht. Wann immer das Sein über dieses Andere redet, erkennt es, daß es mittels negativer Metaphern über sich redet. Daher sind auch die Sätze dieses Abschnittes ausnahmslos metaphorisch: der Tod ist nicht wie die übrigen »Anderen« – jene, die das Ich nach Belieben mit einem Sinn füllen kann und die es im Laufe der Sinngebung konstituiert bzw. sich unterordnet.
Der Tod kann nicht wahrgenommen und erst recht nicht verbildlicht oder »vorgestellt« werden. Seit Husserl wissen wir, daß jede Wahrnehmung intentional ist. Als Tätigkeit des wahrnehmenden Subjektes geht sie über dieses hinaus, erfaßt etwas außerhalb des Subjekts, bringt zugleich ein »Objekt« als Teil einer Welt hervor, die prinzipiell allen zugänglich ist, und schlägt in ihm Wurzeln. Es gibt aber kein »Etwas«, das der Tod ist, nichts, wo sich die angespannte, auf Wahrnehmung abzielende Intention des Subjekts niederlassen und Halt finden könnte. Der Tod ist ein absolutes Nichts, und ein »absolutes Nichts« ergibt keinen Sinn. Wir wissen nur dann, daß »es nichts gibt«, wenn wir das Fehlen einer Wahrnehmung wahrnehmen können, jedes »Nichts« ist ein angeschautes, wahrgenommenes, betrachtetes Nichts. Daher kann kein »Nichts« absolut – ein Nichts schlechthin – sein. Der Tod ist jedoch das Aufhören jedes »handelnden Subjekts« und in eins damit das Ende jeder Wahrnehmung. Ein solches Ende der Wahrnehmung ist ein Zustand, den das wahrnehmende Subjekt nicht heraufbeschwören kann: es kann sich nicht selbst aus der Wahrnehmung »tilgen« und immer noch eine Wahrnehmung haben wollen. (Husserl würde sagen, es gibt keine noesis, keinen Akt der Erkenntnis, ohne noema [bewußt zu machende Gegenstände] und umgekehrt.) Angesichts dieser Unmöglichkeit kann sich das wahrnehmende Subjekt nur auf ein täuschendes Spiel mit Metaphern einlassen, das mehr verbirgt als offenbart, was wahrgenommen werden soll, und am Ende den Zustand der Nicht-Wahrnehmung, welcher der Tod wäre, Lügen straft. Konfrontiert mit diesem Fehlschlag, bleibt dem erkennenden Subjekt nichts anderes übrig, als sein Unvermögen einzugestehen und aufzugeben.
Deshalb ist der häufig vorgeschlagene Ausweg aus diesem Dilemma (»Ich kann mir meinen eigenen Tod nicht vorstellen, aber ich beobachte den Tod anderer. Ich weiß, daß alle Menschen sterben, daher »kenne ich« – gewissermaßen stellvertretend – »den Tod«. Ich weiß um die Unentrinnbarkeit des Todes. Ich habe eine klare Vorstellung von der Sterblichkeit.«) in Wahrheit keiner. Der Tod anderer Menschen ist ein Ereignis »da draußen«, in der Welt der Objekte, das ich wie jedes andere Ereignis oder Objekt auch wahrnehme. Es ist mein Tod, und nur mein Tod, der nicht ein Ereignis jener »erkennbaren« Welt der Objekte ist. Der Tod anderer zerstört nicht die Kontinuität meiner Wahrnehmung, und gerade deshalb ist er schmerzhaft und erschütternd. Ich mag den Tod anderer mehr fürchten als meinen eigenen und mit rückhaltloser Aufrichtigkeit ausrufen, daß ich lieber selbst sterben würde, als den Tod eines geliebten Menschen mitzuerleben – doch wenn ich dies tue, dann deshalb, weil ich nach jenem Tod mit einem bestimmten Nichts konfrontiert bin, mit einer Leere, die durch den Weggang des geliebten Menschen entsteht, mit einer Leere, die ich nicht wahrnehmen will, die jedoch, beharrlich und zu meinem Entsetzen, unumwunden und deutlich wahrnehmbar ist. Was ich in Wahrheit nicht begreifen kann, ist ein ganz anderer Zustand – eine Leere oder Fülle ohne mich, der ich sie als solche empfinden könnte. Es ist mein Tod, der sich nicht erzählen läßt, der unaussprechbar bleibt. Ich kann ihn nicht erfahren, und wenn ich ihm erlegen bin, werde ich nicht mehr da sein, um davon zu erzählen.
Im Lichte des oben Gesagten ist es durchaus merkwürdig, daß unser eigener Tod uns mit Schrecken erfüllen sollte. Ich werde nicht da sein, wenn er gekommen sein wird, ich werde ihn nicht erleben, wenn er kommt, und gewiß erlebe ich ihn nicht jetzt, bevor er gekommen ist, – warum sollte ich also beunruhigt sein, warum sollte ich jetzt unruhig sein? Dieser – logisch korrekte – Epikur zugeschriebene Schluß ist heute nicht weniger logisch als in der Antike. Und dennoch vermochte er, seiner unbestreitbaren Einsicht, seiner logischen Eleganz und angeblichen Überzeugungskraft zum Trotz, keine Generation zu trösten. Obwohl der Schluß offensichtlich korrekt ist, klingt und wirkt er wie ein Taschenspielerstück. Mit unserer wirklichen Unruhe scheint er nichts zu tun zu haben. Er ist auf seltsame Weise abgeklärt, ja scheint mit all unseren Meinungen und Empfindungen über den Tod und dem, was ihn für uns so furchtbar macht, in keinem Zusammenhang zu stehen. Welche Erklärung können wir für die verwirrende Unfähigkeit unserer Vernunft, die qualvolle Angst zu mildern, anbieten? Weshalb versagt die Philosophie so eklatant, wenn sie Trost spenden soll? Das Folgende ist nur eine tastende Antwort auf diese Frage, die sich wohl kaum endgültig beantworten lassen wird.
Menschen sind die einzigen Wesen, die nicht nur wissen, sondern auch wissen, daß sie wissen – und ihr Wissen nicht »ungewußt« machen können. Vor allem können sie das Wissen über ihre Sterblichkeit nicht »ungewußt« machen. Haben die Menschen erst einmal vom Baum der Erkenntnis gekostet, so können sie den Geschmack nicht mehr vergessen. Möglich ist ihnen allein, sich nicht mehr daran zu erinnern – jedenfalls in der kurzen Zeitspanne, in der sie sich mit anderen Eindrücken beschäftigen. Einmal erkannt, läßt sich das Wissen von der Unentrinnbarkeit des Todes nicht mehr vergessen – wir können nur eine Weile nicht daran denken, wenn wir uns um anderes kümmern. Wissen beruht gewissermaßen auf dem Geruchssinn und weniger auf dem Gesichts- oder Hörsinn; Gerüche sind, wie Wissen, unzerstörbar, wir können sie lediglich »unriechbar machen«, indem wir sie durch stärkere Gerüche überdecken.
Man könnte sagen, Kultur, eine weitere »spezifisch menschliche« Eigenschaft, sei von Anfang an ein Mittel gewesen, um den Geruch zu unterdrücken. Das heißt nicht, daß alle schöpferischen Triebe der menschlichen Kultur der Verschwörung entspringen, »den Tod zu vergessen«, denn einmal in Gang gesetzt, erhält die kulturelle Findigkeit einen eigenen Impuls und wie viele andere Teile oder Aspekte der Kultur »entwickelt sie sich, weil sie sich entwickelt«. Wohl aber heißt es, es gäbe keine Kultur, verlangten wir nicht danach, ein Leben lebenswert zu gestalten, von dem wir, wie Schopenhauer sagt, wissen, daß es nur eine kurzfristige Anleihe beim Tod ist. Der Tod (genauer gesagt, das Wissen um die Sterblichkeit) ist nicht die Wurzel all dessen, was Kultur ausmacht, denn schließlich handelt Kultur von der Transzendenz, vom Überschreiten dessen, was vorgegeben ist und vorgefunden wird, bevor sich die schöpferische Imagination der Kultur entfaltet. Kultur strebt nach jener Dauer und Beständigkeit, die dem Leben selbst auf so schmerzliche Weise abgeht. Aber der Tod (genauer gesagt, das Gewahrsein der Sterblichkeit) ist die entscheidende Bedingung für die kulturelle Schöpferkraft. Ihm ist es zu verdanken, daß Dauer zu einer Aufgabe, zu einer dringenden, höchsten Aufgabe – zum Ursprung und Maß aller Aufgaben – wird, und so schafft der Tod die Kultur, jene riesige, stets emsige Fabrik der Dauer.
Die merkwürdige Wirkungslosigkeit der epikureischen Logik resultiert unmittelbar aus dem Erfolg der Kultur. Man könnte meinen, Kultur habe den »Plan übererfüllt«, sei »über ihn hinausgeschossen«. (Fairerweise wird man wohl sagen müssen, die Kultur hätte den Plan nicht erfüllen können, ohne zu viel des Guten zu tun.) Epikurs Diktum würde vielleicht überzeugender klingen, hätten wir den Tod in seinem »Rohzustand« vor uns – erschiene er uns nur als Aufhören des biologischen Lebens: des Essens, Verdauens, Zeugens. Der Kultur verdanken wir, daß dies auf so verwirrende Weise nicht der Fall ist. Wir sind weit über das hinausgelangt, was wir nun, mit mehr als einem leichten Anflug von Verachtung, »animalisches Leben« nennen. Ohne Zweifel werden wir aufhören, zu essen, zu verdauen, zu zeugen, wenn unser Leben zu Ende ist. Aber das alles ist nicht der wirkliche »Lebensinhalt«. Was uns die längste Zeit beschäftigt (d.h. wenn uns nach der Befriedigung unserer »animalischen« Bedürfnisse noch Zeit bleibt) und was, wie man uns lehrte, das Wichtigste und Wertvollste im Leben ist, braucht nicht mit unserem Stoffwechsel aufhören, nicht am Tag danach und niemals. Dem Wertvollsten Dauer zu verleihen, es nicht enden, nicht »mit uns ins Grab sinken« zu lassen, ist jene Mission, die Kultur uns aufgetragen hat. Das »Hinausschießen« der Kultur findet täglich seinen Widerhall in unserem persönlichen Ungenügen. Gleichgültig was wir tun, um unserer geglaubten Verantwortung nachzukommen, es wird wahrscheinlich immer zu wenig sein. Das Nahen des Todes wird unser Werk grausam unterbrechen, noch bevor wir die Aufgabe erledigt und unsere Mission erfüllt haben. Deshalb haben wir allen Grund, den Tod jetzt zu fürchten, wo wir noch voller Leben sind und der Tod nichts als eine entrückte, abstrakte Aussicht ist.
So treiben wir neue Schößlinge – Nachkommen für die wir sorgen und die wir sicher um alle künftigen Klippen leiten wollen; werden sie sie umschiffen, wenn sie verwaist sind? Wir gründen Firmen, von denen wir nie mit Gewißheit sagen können, nun hätten sie keine Konkurrenz mehr zu fürchten oder müßten nicht weiter expandieren. Wir »machen Geld«, und je erfolgreicher wir dabei sind, um so mehr treibt es uns, noch mehr Geld zu machen. Wir widmen unsere Gefühle und Energien Institutionen oder Gruppen, deren Geschicke wir jetzt und in der unbestimmten Zukunft verfolgen wollen und denen wir zu einer hoffentlich nie abreißenden Erfolgskette zu verhelfen wünschen. Wir werden zu Sammlern – von Antiquitäten, Gemälden, Briefmarken, Eindrücken oder Erinnerungen –, wohl wissend, daß unsere Sammlungen niemals vollständig und »abgeschlossen« sein werden und die erregendste Befriedigung gerade in ihrer Unvollständigkeit liegt. Wir werden zu schöpferischen Menschen – aber läßt sich das »Lebenswerk« eines Künstlers, eines Malers, eines Schriftstellers je zu seinem »natürlichen Abschluß« bringen? Wir entwickeln einen leidenschaftlichen Erkenntnisdrang, wir verschlingen Wissen, erweitern es, und jede neue Entdeckung zeigt nur, wie viel noch zu lernen bleibt. Gleichgültig welche Aufgabe wir ergreifen, jede scheint dieselbe ärgerliche Eigenschaft zu besitzen: sie überschreitet unsere vermutliche biologische Lebenszeit – unsere Fähigkeit, Aufgaben zu erfüllen, Dinge herzustellen. Und was noch schlimmer ist, gegen diese irritierende Eigenschaft aller Aufgaben, die unserem Leben einen »wirklichen Inhalt« geben, ist kein Kraut gewachsen: Sorgt doch gerade diese Eigenschaft dafür, daß die Aufgaben unserem Leben einen die biologischen Lebensgrenzen transzendierenden Sinn geben und es uns ermöglichen zu leben, das Leben zu genießen und uns zu bemühen, es noch reizvoller zu machen – und das, obgleich wir um die Grenzen, die naturgegebene Kürze und letztendliche Nichtigkeit der Lebensanstrengungen wissen. Verlören die Anregungen der Kultur aus dem einen oder anderen Grund teilweise oder gar völlig diese Eigenschaft oder hörten sie auch ohne deren Verlust auf, entwicklungsfähige Vorschläge zu machen – dann büßte das Leben seinen Sinn ein und der Tod wäre die einzige Abhilfe gegen die von ihm verursachte Qual und Not. Durkheims »anomischer Selbstmord« tritt auf, wenn die Kultur keine Reize und Lockungen mehr bietet.
Transzendenz ist es, wovon Kultur alles in allem handelt. Mit dem Ziel, sie ganz niederzureißen, strebt sie danach, die räumlichen und zeitlichen Grenzen des Seins zu erweitern. Deren Ausweitung und Aufhebung sind teils voneinander unabhängige, teils miteinander verflochtene Unternehmungen, und Kultur verfolgt sie mit Mitteln und Wegen, die partiell auf einzelne Bereiche beschränkt bleiben, sich aber auch überschneiden.
In erster Linie bemüht sich Kultur um das Überleben – das Hinausschieben des Todes, die Verlängerung der Lebensspanne, die Zunahme der Lebenserwartung und somit der Fähigkeit des Lebens, Inhalte aufzunehmen; darum, den Tod zu einer wichtigen Sache, einem bedeutenden Ereignis zu machen – ihn dem Profanen, Gewöhnlichen und Natürlichen zu entrücken; und (was noch wichtiger ist) darum, das Geschäft des Todes unmittelbar oder mittelbar ein wenig zu erschweren. In seinen Bemerkungen zu Camus weist Maurice Blanchot darauf hin, daß »es schon immer die Aufgabe der Kultur war, dem Tod eine gewisse Reinheit zu verleihen: ihn authentisch, persönlich, eigentlich zu machen […] Wir spüren instinktiv, daß es gefährlich ist, die menschlichen Grenzen auf einem zu niedrigen Niveau zu suchen […] an einem Punkt, wo das Dasein – durch Leiden, Not und Enttäuschung – so bar jeden ›Wertes‹ ist, daß sich der Tod rehabilitiert und Gewalt gerechtfertigt sieht.« Auf jenem untersten Niveau, wo der Tod haust, bis er durch die Mühen der Kultur verarbeitet und veredelt wird »löst (er) keinen Schrecken, nicht einmal Interesse aus«. Möglicherweise ist er »nicht wichtiger als das Spalten eines Kohlkopfes oder das Trinken eines Glas Wassers«.[1]
Das zweite Bestreben der Kultur gilt der Unsterblichkeit – wenn man so will –, der Möglichkeit, den Tod zu überleben, der Leugnung, daß der Augenblick des Todes das letzte Wort sei, um ihm so etwas von seiner unheilvollen und erschreckenden Bedeutung zu nehmen. »Er starb, aber sein Werk lebt weiter«; »Sie wird auf ewig in unserem Gedächtnis bleiben«. Obwohl die beiden Bestrebungen verschieden sind, hängen sie von einander ab. Offensichtlich kann man nicht von Unsterblichkeit träumen, so lange das Überleben nicht gesichert ist. Andererseits schafft jedoch die kulturell beglaubigte Zuschreibung eines das Leben transzendierenden, unsterblichen Wertes an bestimmte menschliche Handlungen und Errungenschaften ein Potential für die »Erweiterung des Lebens«.
»Wie vielen wird es noch der Mühe wert sein zu leben, sobald man nicht mehr stirbt?« fragte Elias Canetti in rhetorischer Absicht. Rhetorisch deshalb, weil die Frage nur gestellt wurde, um eine bestimmte, für offensichtlich gehaltene Antwort hervorzurufen: nicht vielen, vielleicht niemanden. Doch noch aus einem anderen, entscheidenderen Grund ist die Frage rhetorisch: wir müssen alle sterben, und wir wissen es. Hier liegt die Wurzel des düstersten und schöpferischsten Paradoxes der menschlichen Lage: die Unentrinnbarkeit des Todes verurteilt alle Überlebensanstrengungen a priori zum Scheitern, während das Wissen um die Sterblichkeit sehr wohl die großartigsten Pläne der Menschen beschneiden, sie vergeblich, aufgeblasen und absurd machen kann. Wenn »Sinn« aus Intention hervorgeht, wenn Handeln allein als zweckgerichtetes sinnvoll ist – worin besteht dann der Sinn des Lebens? Diese Frage, die beharrliche Notwendigkeit und der unbarmherzige Zwang, sie zu stellen, ist der Fluch des menschlichen Geschicks und die Quelle endloser Pein. Freilich ist sie auch die furchteinflößende Chance des Lebens. Vor uns liegt eine Leere, die wir ausfüllen müssen, eine Leere, die in keiner Weise das Spektrum der Inhalte einschränkt, mit denen sie sich füllen läßt. Zwecke und Bedeutungen sind nicht »vorgegeben«, daher sind Zwecke wählbar, können Bedeutungen aus dem Nichts geschaffen werden. Das Elend der Sterblichkeit macht Menschen gottgleich. Weil wir wissen, daß wir sterben müssen, sind wir so fleißig dabei, das Leben zu gestalten. Weil wir uns der Sterblichkeit bewußt sind, bewahren wir die Vergangenheit und schaffen wir die Zukunft. Die Sterblichkeit fällt uns ungebeten zu – Unsterblichkeit hingegen müssen wir selbst erlangen. Unsterblichkeit ist nicht bloß die Abwesenheit des Todes; sie ist Verhöhnung und Verneinung des Todes. »Bedeutungsvoll« ist sie allein deshalb, weil es den Tod gibt, jene unerbittliche Realität, der wir trotzen müssen. Ohne Sterblichkeit gäbe es keine Unsterblichkeit. Ohne Sterblichkeit keine Geschichte, keine Kultur – keine Humanität. Sterblichkeit »schuf« die Gelegenheit dazu: alles andere wurde von Wesen geschaffen, die sich ihrer Sterblichkeit bewußt sind. Sterblichkeit sorgte für die Möglichkeit. Die menschliche Lebensweise entspringt jedoch der Tatsache, daß die Möglichkeit wahrgenommen wurde und wahrgenommen wird.
Daher macht der Tod seine Anwesenheit im menschlichen Leben nicht notwendig (und auch nicht hauptsächlich!) an jenen Orten und zu jenen Zeiten gewichtig und spürbar, wo er unter eigenem Namen in Erscheinung tritt. Zweifellos ist der Tod das ausdrückliche Ziel einer Reihe von Dingen, die wir tun und denken. Wir haben Krankenhäuser und Hospize, Friedhöfe und Krematorien, Begräbnisse und Nachrufe, Rituale des Gedenkens und der Trauer, und pflegen auf besondere Weise, mit den Hinterbliebenen und Verwaisten umzugehen. Wäre dies die ganze Geschichte, würde der Tod lediglich nach einem weiteren Fundus spezialisierter Funktionen verlangen, dann hätten wir kaum einen Grund, ihn von den vielen anderen »objektiven Umständen« in den Geschicken der Menschen abzusondern. Dies ist jedoch nicht der Fall. Am machtvollsten und (schöpferischsten) wirkt sich der Tod aus, wenn er nicht unter seinem Namen in Erscheinung tritt, also in Bereichen und zu Zeiten, die ihm nicht ausdrücklich gewidmet sind, genau dort, wo wir so zu leben vermögen, als gebe es keinen Tod oder als sei er nicht wichtig, genau dann, wenn wir unserer Sterblichkeit nicht eingedenk sind, nicht vor dem Gedanken an die letztendliche Vergeblichkeit des Lebens zurückschrecken oder an ihm leiden.
Ein solches Leben – ein Leben, das den Tod vergißt, das sinnvoll und lebenswert ist, ein zweckvolles Leben, das nicht von Ziellosigkeit zermalmt und verkrüppelt wird – ist eine großartige menschliche Leistung. Um sie zu ermöglichen, bedarf es der Zusammenarbeit der gesamten sozialen Organisation, der ganzen menschlichen Kultur (nicht nur bestimmter arbeitsteiliger Institutionen und auch nicht bestimmter arbeitsteiliger Kulturvorschriften). Dies wird nicht offen zugestanden; es wird nicht gesagt, daß nahezu alles, was wir tun, letztlich dem »Zweck aller Zwecke« dient, nämlich ein sinnvolles Leben in einer Welt zu ermöglichen, die »an sich« keinen Sinn hat. (Im Gegenteil, gesellschaftlich und kulturell wird der Glaube erzeugt, wir täten all das aus ganz anderen Gründen.) Gesellschaft und Kultur dürfen auch den wahren Sachverhalt nicht offenlegen, denn dadurch würde die Wirksamkeit der Leistung gefährdet, die ja hauptsächlich darin besteht, ihre wahren Gründe zu verhehlen. Die von der sozialen Organisation ausgeübte oder von der Kultur versprochene Emanzipation von der Sterblichkeit muß zwangsläufig gefährdet und letztlich illusorisch bleiben: Denken muß selbst heraufbeschwören, was die Wirklichkeit weder bereitstellt noch zuläßt. Damit dieses Kunststück plausibel ist, benötigen wir eine kräftige Dosis Wagemut, die nur dann ausreicht, wenn sich der Mut seiner Vergeblichkeit nicht bewußt ist. Die Erinnerung an die illegitime Geburt muß ausgelöscht werden, wenn wir unbefangen ein würdiges Leben führen wollen.
Menschliche Kultur ist einerseits eine gigantische (spektakulär erfolgreiche) und ununterbrochene Anstrengung, dem menschlichen Leben Sinn zu verleihen, und andererseits eine hartnäckige (nicht ganz so erfolgreiche) Bemühung, das Bewußtsein der unrettbaren Unbeständigkeit und Ersatzhaftigkeit eines solchen Sinns zu verdrängen. Die erste Anstrengung bliebe ohne die ständige Unterstützung durch die zweite beklagenswert erfolglos.
Mein Buch versucht, dieses Werk der Kultur aufzudecken. Es ist im großen und ganzen eine abenteuerliche Detektivarbeit. (Wie jede Enthüllung hat es sich daher ebenso auf Vermutungen zu stützen, wie es sich auf die unbestreitbare Kraft der Deduktion verläßt, und soweit es wünschenswert ist, auch auf die strengen Beweise der Induktion.) Mit gewissen vorhersagbaren Einschränkungen ließe sich die hier angewandte Methode als »Psychoanalyse« jenes »kollektiven Unbewußten« bezeichnen, das sich im kulturell erzeugten und aufrechterhaltenen Leben verbirgt, aber durch die Analyse zu Tage fördern läßt. Die Analyse arbeitet mit der Hypothese – der heuristischen Annahme –, daß die analysierten gesellschaftlichen Institutionen und »kulturellen Lösungen« Ablagerungen jener Prozesse sind, die zum einen vom factum brutum der menschlichen Sterblichkeit angestoßen und durch die Notwendigkeit motiviert wurden, die so aufgeworfenen Probleme zu bewältigen, und zum anderen von der parallelen Notwendigkeit, das Bewußtsein der wahren Beweggründe solcher Einrichtungen zu unterdrücken. Diese Arbeit möchte herausfinden, inwiefern sich, falls überhaupt, unser Verständnis der sozio-kulturellen Institutionen vertiefen läßt, wenn wir die genannte Voraussetzung machen und deren Folgen untersuchen.
Auf die hier analysierten, gesellschaftlichen Institutionen und kulturellen Muster würden wir selten in Untersuchungen stoßen, die sich mit dem Problem des Todes und Sterbens beschäftigen. Die meisten Studien nehmen den Faden erst an dem Punkt auf, an den uns die Kultur bereits geführt hat. Sie halten nicht allein die Form, sondern auch die Gegebenheit »sozialer Wirklichkeiten« für selbstverständlich, und dringen nicht in die »künstliche« Natur kultureller Produkte ein. Daher beschränken sie den Tod (oder genauer seinen herausstechenden und sichtbaren, unangepaßten Widerstand gegen alle kulturelle Verarbeitung, seine »hartnäckigen Überbleibsel«) ganz selbstverständlich auf ausdrückliche und zweckmäßige Enklaven und Funktionen und akzeptieren die kulturell vollzogene Reduktion der Frage der Sterblichkeit auf eine Reihe benannter und öffentlich anerkannter Probleme der Sterbenden und Hinterbliebenen. Zweifellos sind solche Untersuchungsverfahren durchaus legitim und wissenschaftlich honorig. Tatsächlich ist kaum vorstellbar, wie sich die unterschiedlichen, aber unterschiedslos sinnreichen Behandlungen, die das Problem des Todes in verschiedenen Kulturen und in verschiedenen historischen Epochen erfahren hat, so penibel und überzeugend inventarisieren ließen, würden sich diese Forschungsunternehmen nicht durch wohlerwogene Beschränkungen des Gesichtspunktes auszeichnen.
Gleichwohl fällt dabei etwas recht Entscheidendes unter den Tisch und wird solange unerörtert bleiben, wie sich die Blickrichtung nicht ändert. Ich denke hier an die »Sterblichkeits-Verbindung« jener Aspekte des Lebens, welche die betreffenden Kulturen der tödlichen Umarmung zu entreißen vermochten, um dann jegliche Herkunftserwähnung durch eine Art ungeschriebener Geheimhaltungsverordnung zu unterdrücken. Für diese Aspekte des sozialen Lebens ist das Unterdrücken der Erinnerung an ihre vormalige »Sterblichkeits-Verbindung« notwendige Bedingung ihrer Emanzipation. Gerade solche Aspekte des gesellschaftlichen Dasein sind zum Hauptgegenstand dieses Buches erhoben worden; daher will diese Studie vor allem das Geheimnis enträtseln, wie ihre Verbindungen zur Frage der Sterblichkeit »übergangen« oder gewaltsam unterdrückt werden konnten.
Ich meine, das Faktum der menschlichen Sterblichkeit und die Notwendigkeit, stets mit dem Wissen um dieses Faktum zu leben, kann zur Erklärung vieler wesentlicher Aspekte der sozialen und kulturellen Organisation aller bekannten Gesellschaften beitragen. Darüber hinaus glaube ich, daß sich die meisten, vielleicht sogar alle, bekannten Kulturen besser (oder jedenfalls anders, auf neue Weise) verstehen lassen, sobald wir sie als alternative Möglichkeiten auffassen, den wichtigsten Zug der menschlichen Existenz – das Faktum der Sterblichkeit und das Wissen darum – in den Griff zu bekommen und so zu verarbeiten, daß er nicht länger die Unmöglichkeit eines sinnvollen Lebens verschuldet, sondern statt dessen zur primären Quelle für den Sinn des Lebens wird. Der Tod, eine Naturtatsache, ein biologisches Phänomen, geht aus einem derartigen Prozeß als ein kulturelles Kunstprodukt hervor, und in dieser kulturell verarbeiteten Gestalt liefert er uns die entscheidenden Baustoffe für jene sozialen Institutionen und Verhaltensmuster, die für die Reproduktion der jeweiligen Gesellschaftsformen ausschlaggebend sind.
Sterblichkeit und Unsterblichkeit (nebst ihrem gedachten Gegensatz, der als eine kulturelle Realität ebenfalls von Denkmustern und Verhaltensweisen geschaffen wurde) werden mit anderen Worten zu anerkannten und angewandten Lebensstrategien. Alle menschlichen Gesellschaften bedienen sich ihrer in der einen oder anderen Form. Allerdings können Kulturen darauf hinwirken, daß die Vermeidung des Todes eine mehr oder weniger große Bedeutung für die Lebensführung hat. (Ariès lieferte eine Fülle von Hinweisen auf die »Zähmung« oder »Domestizierung« des Todes in vormodernen Gesellschaften. Demgegenüber ist die Todesvermeidung, die in die tägliche Beschäftigung mit Gesundheitsfragen und der obsessiven Sorge über todbringende Stoffe umgeformt wurde, zum herausstechendsten Merkmal des modernen Lebens geworden.) Kulturen geben uns auch Rezepte an die Hand, um die Furcht vor dem Tod durch die Hoffnung, manchmal auch durch institutionelle Garantien auf Unsterblichkeit zu zerstreuen. Letztere mag entweder als kollektives Schicksal oder als persönliche Leistung vorgestellt werden. Im ersten Fall ist sie ein ausgezeichnetes Mittel zur sozialen Spaltung und tritt am spektakulärsten im Phänomen des Stammeswesens und der Stammesfeindschaft auf. Im zweiten Fall dient sie als Hauptmotor für die soziale Schichtung und liefert den eigentlichen Gehalt von Rangunterschieden und Privilegien wie auch den wichtigsten Köder für statusorientierte Bestrebungen (gesellschaftlichen Aufstieg) und einen begehrten Siegespreis im Wettstreit um gesellschaftliche Positionen.
Die ersten drei Kapitel des Buches untersuchen in allgemeinen (man möchte sagen, existentiellen) Hinsichten die universale und permanente Rolle, die Sterblichkeit im Prozeß gesellschaftlicher Strukturierung und bei der Abfassung der kulturellen Tagesordnung spielt. Die letzten beiden Kapitel beschäftigen sich demgegenüber mit der Tatsache, daß sich die konkreten Weisen, mit dieser universalen Rolle der Sterblichkeit fertig zu werden, im Laufe der Zeit wandeln und kulturspezifisch sind. Es wird sich zeigen, daß dieser Umstand weitreichende Folgen für die Gesellschaft als Ganze hat – und ihren Charakter weitgehend bestimmt, selbst in bezug auf Aspekte, die mit dem Phänomen des Todes und des Sterbens scheinbar nichts oder nur indirekt etwas zu tun haben.
Zwei Strategietypen (welche die heutige Gesellschaft, nicht ohne sich dabei in einen Widerspruch zu verstricken, gleichzeitig anwenden will – mit dem Resultat, daß die ohnehin fruchtlose Bemühung, eine zeitliche Grenze zwischen der »modernen« und der »postmodernen« Epoche zu ziehen oder zu verwischen, noch vergeblicher wird) werden näher untersucht: erstens der moderne Typ und sein charakteristischer Trieb, Sterblichkeit zu »dekonstruieren« (d.h. die Frage des Kampfes gegen den Tod in stets neue und unerschöpfliche Schlachten gegen bestimmte Krankenheiten und andere Bedrohungen des Lebens aufzulösen und den Tod, der früher am äußersten, entfernten Horizont der Lebensspanne wartete, geradewegs in den Mittelpunkt des täglichen Lebens zu rücken, so daß der Alltag mit der Abwehr nicht endgültiger, verhältnismäßig kleiner und somit prinzipiell »lösbarer« Fragen der Gesundheitsrisiken ausgefüllt wird), und zweitens der postmoderne Typ und dessen Bemühung, Unsterblichkeit zu »dekonstruieren« (d.h. die historische Erinnerung durch allgemeine Bekanntheit und den endgültigen – unumkehrbaren – Tod durch das Verschwinden zu ersetzen und das Leben in eine unaufhörliche, tägliche Einübung der allgemeinen »Sterblichkeit« der Dinge und der Auslöschung des Gegensatzes zwischen dem Vergänglichen und dem Dauerhaften zu verwandeln).
Lassen Sie mich zusammenfassen: seiner Intention nach ist dieses Buch kein Beitrag zur Spezialdisziplin der Soziologie des Todes, des Sterbens und des Verlustes, sondern zur soziologischen Theorie im allgemeinen. Hier wird der Versuch unternommen, jenen Erkenntnisgewinnen nachzuspüren, die sich aus einer bestimmten Deutung entscheidender soziokultureller Prozesse ergeben: nämlich aus der Interpretation, daß jene Prozesse einerseits aus der Prominenz des Todes in der existentiellen Situation des Menschen folgen (bzw. von ihr ausgelöst werden) und andererseits diese Prominenz als wichtigsten Baustoff für die soziokulturelle Organisation historisch spezifischer Formen menschlicher Praxis verwenden. Diese Untersuchung eröffnet eine Perspektive, von der aus sich die scheinbar vertrauten Themen des sozialen und kulturellen Lebens aus einem ungewöhnlichen, aber doch grundlegenden Blickwinkel erneut betrachten lassen.
Was dem Leser hier vorliegt, ist eine Übung in soziologischer Hermeneutik. Es wird versucht, die Bedeutung sozialer Institutionen und gemeinschaftlich verfolgter Verhaltensmuster zu entschlüsseln, indem sie als Glieder von Strategien betrachtet werden, die gewissermaßen in bestehenden sozialen Figurationen vorselektiert und real wurden (um so ausgewählt und möglicherweise verwandt werden zu können). In diesem Fall verlangt die soziologische Hermeneutik, daß sowohl die dauerhaften wie veränderlichen Aspekte von Lebensstrategien zu jenen sozialen Figurationen zurückverfolgt werden, denen sie (in einem dialektischen Prozeß wechselseitiger Determinierung) dienen. Doch darüber hinaus müssen sie auch nach vorne ausgezogen, zu jenen Mustern des Alltagslebens verlängert werden, in denen sie sich niederschlagen.
Sämtliche oder sehr viele Interpretationen – jene Übungen im Verstehen, in der »Sinnsuche« – schreiben den interpretierten Phänomenen eine größere, systemartige Kohärenz zu, als sie tatsächlich besitzen. Was im wirklichen Leben einen quälend konfusen, widersprüchlichen und häufig zusammenhanglosen Sachverhalt darstellt, kann so gezeichnet werden, als weise es einfache und regelmäßige Eigenschaften auf. Ich habe mich sehr bemüht, dieser Gefahr zu entgehen und nicht der Versuchung zu erliegen, die untersuchten Lebensstrategien und ihre Folgen für das Verhalten zusammenhängender und eindeutiger zu beschreiben, als sie tatsächlich sind. Allerdings war es unvermeidlich, den Strategien »Identitäten« zuzuweisen, um sie von ihren Alternativen zu trennen und zu unterscheiden. Infolgedessen war es kaum zu verhindern, daß sie geschlossener und abgerundeter dargestellt wurden, als sie in Wahrheit je waren oder sein können. Der Leser sollte diesen Vorbehalt nie aus den Augen verlieren. Schließlich leben wir nicht abwechselnd in einer vormodernen, einer modernen und einer postmodernen Welt. Alle drei »Welten« sind nichts als abstrakte Idealisierungen wechselseitig widersprüchlicher Aspekte eines einzigen Lebensprozesses, den wir alle nach besten Kräften so zusammenhängend wie möglich gestalten wollen. Idealisierungen sind nicht mehr (aber auch nicht weniger) als Ablagerungen und unverzichtbare Werkzeuge solcher Bemühungen.
I. Leben mit dem Tod
Im Gegensatz zu anderen Tieren, wissen wir nicht nur, vielmehr wissen wir, daß wir wissen. Wir sind uns dessen gewahr, daß wir gewahr sind, wir sind uns bewußt, daß wir ein Bewußtsein »haben«, bewußte Wesen sind. Unser Wissen selbst ist Gegenstand des Wissens, wir können unsere Gedanken auf »dieselbe Weise« betrachten wie unsere Hände oder Füße bzw. wie die uns umgebenden, nicht zu unserem Körper gehörigen »Dinge«. Unser Wissen besitzt dieselbe wesenhafte, unveräußerliche, bestimmende Eigenschaft aller Dinge: es läßt sich (außer in der Phantasie) nicht wegwünschen, d.h. nicht durch pure Willensanstrengung auslöschen. »Es ist da«, in dem Sinne hartnäckig, unnachsichtig und »dauerhaft«, daß es länger währt als unser aktives Gewahrsein seiner Anwesenheit und sein »Dableiben« zeitlich nicht mit unserem Blick zusammenfällt. Wir wissen, daß wir es immer wieder anschauen können, daß wir es an seinem Platz finden, sobald wir unsere Wachsamkeit auf die richtige Stelle lenken – unsere Augen (unsere Aufmerksamkeit) in die richtige Richtung gehen lassen. (Wenn sich der Gedanke, den wir suchen und von dem wir wissen, daß »er da ist«, in dem betreffenden Augenblick nicht »finden« läßt, nennen wir dieses Versagen »Gedächtnisausfall«, wir erklären die Schwierigkeit auf dieselbe Weise, wie wir über das Fehlen anderer Dinge urteilen, die wir an einem bestimmten Ort erwarten aber nicht vorfinden – etwa einen verlorenen Federhalter oder eine Brille. Wir glauben nicht, die Dinge hätten aufgehört zu existieren, wir meinen lediglich, sie seien verlegt worden oder unentdeckbar, weil wir in die falsche Richtung geschaut haben.) Belastet uns unser Wissen allzu stark, bleibt uns nur ein Ausweg offen. Wir müssen es ebenso behandeln, wie andere uns verletzende Dinge auch, die wir wegschieben, verstecken oder so weit entfernen, daß ihr übler Geruch oder ihr widerwärtiger Anblick uns wahrscheinlich nicht mehr beeinträchtigen kann. Schmerzliche Gedanken müssen unterdrückt werden. Sollte dies unmöglich sein, müssen sie verniedlicht oder auf sonst eine Weise verhüllt werden, damit ihr häßlicher Anblick uns nicht stört. Allerdings gelingt die Flucht wie in anderen Fällen auch selten vollkommen und endgültig. Unsere Wachsamkeit darf nicht erlahmen, wir müssen es stets von neuem versuchen – und wir wissen es.
Kaum ein Gedanke ist anstößiger als der Gedanke an den Tod oder vielmehr die Unvermeidlichkeit des Sterbens, der Vergänglichkeit unseres In-der-Welt-Seins. Schließlich trotzt dieser Teil unseres Wissens radikal und unaufhebbar unseren geistigen Fähigkeiten. Der Tod ist die entscheidende Niederlage der Vernunft, denn der Verstand kann den Tod nicht »denken« – nicht das, was wir über den Tod wissen; der Gedanke des Todes ist – und kann nichts anderes sein als – ein Widerspruch in sich. »Weder meine Geburt, noch mein Tod können mir als meine Erfahrungen gegeben sein«, bemerkte Merleau-Ponty. »Ich kann mich nur als ›schon geboren‹ und ›noch lebend‹ begreifen – meine Geburt und meinen Tod nur als meiner Person vorausliegende Horizonte erfassen.« Sigmund Freud ist ähnlicher Ansicht: »Der eigene Tod ist ja auch unvorstellbar, und so oft wir den Versuch dazu machen, können wir bemerken, daß wir eigentlich als Zuschauer weiter dableiben.« In seiner bahnbrechenden Untersuchung über den anthropologischen Status des Todes kam Edgar Morin zu dem Schluß, daß »die Vorstellung des Todes eine Vorstellung ohne Inhalt« oder, anders formuliert, »die hohlste Vorstellung überhaupt« sei, da ihr Inhalt »undenkbar, unerklärbar und ein begriffliches je ne sais quoi ist«. Der Schrecken des Todes ist der Schrecken der Leere, der endgültigen Abwesenheit, des »Nicht-Seins«. Das Bewußtsein des Todes ist und muß traumatisch bleiben.[2]
Wissen, das nicht geglaubt werden kann
Es gibt mehr als einen Grund dafür, daß das Bewußtsein unserer Sterblichkeit traumatisch sein muß. Zunächst und vor allem deshalb, weil das Nachdenken über den Tod sich dem Denken selbst entzieht. Die Natur des Denkens ist seine Unbeschränktheit, seine »Nicht-Gebundenheit« an Raum und Zeit, seine Fähigkeit, sich Zeiten zuzuwenden, die nicht mehr oder noch nicht gewesen sind, sich Orte vorzustellen, die das Auge nicht sehen und die Hand nicht berühren kann. Aber mögen die Zeiten auch vergangen oder zukünftig, die Orte auch entfernt sein, so bleibt doch das Denken, welches sie heraufbeschwört, gegenwärtig; sie »existieren nur im Denken und durch seinen Akt des Heraufbeschwörens«. Was das Denken allein nicht zu erfassen vermag, ist die eigene Nicht-Existenz: es kann sich weder eine Zeit, noch einen Ort vorstellen, in denen es nicht mehr enthalten ist, da alles Vorstellen es – das Denken, das Denkvermögen – als die »vorstellende Kraft« einschließt. (Diese Unfähigkeit des Denkens, sich sein eigenes Nicht-Sein vorzustellen, hat Descartes umgekehrt als die welterhaltende Kraft des Denkens dargestellt: wir denken, also sind wir, unser Akt des Denkens, ist die eine und einzige Existenz, an der sich nicht zweifeln läßt, eine Existenz, an der sich alle anderen Gewißheiten messen lassen müssen.) Aufgrund dieser organischen Unfähigkeit des Denkens kann es uns einfach nicht in den Sinn kommen, daß unser – so offensichtliches, universelles und allgegenwärtiges – Bewußtsein gleich anderen Dingen aufhören könnte zu sein. Die Kraft des Denkens ist gewissermaßen aus seiner Schwäche geboren. Das Denken scheint allmächtig zu sein, weil sich gewisse Gedanken nicht denken lassen und daher eher durch Unterlassung als absichtlich getilgt werden. Was jedoch am wichtigsten und entscheidendsten ist: jener Gedanke, der sich nicht denken läßt und daher der Überprüfung entrinnen kann, ist der Gedanke der Nicht-Existenz des Denkens. Die daraus folgende behagliche, so tröstliche und erstrebenswerte Selbstsicherheit des Denkens wäre narrensicher, gäbe es nicht das Wissen um den Tod. Schließlich ist der Tod gerade das Undenkbare: ein Zustand ohne Gedanken, ein Zustand, den wir uns nicht vorstellen, ja nicht einmal begrifflich erfassen können. Aber der Tod ist, er ist wirklich – und wir wissen es.
Natürlich gibt es noch andere Dinge, von denen wir wissen, ohne sie uns bildlich vorstellen oder »verstehen« zu können. Ein klassisches Beispiel ist die räumliche und zeitliche Unendlichkeit des Weltalls. Tatsächlich ist dieser Sachverhalt so furchteinflößend, weil sich das Gegenteil – die zeitliche oder räumliche Beschränktheit des Weltalls – ebenso einer bildlichen Vorstellung entzieht. Diese spektakuläre Erkenntnis der unaufhebbare Trennung zwischen Körper und Geist, zwischen dem, was der Geist denken und der Körper, unmittelbar oder metaphorisch, »sehen« kann, birgt schon genug Schrecken. Aber das Rätsel, daß die Realität des Todes für das Denken aufwirft, geht noch tiefer. Die mißliche Lage, die der Tod offenbart, weiß noch sehr viel radikaler zu ängstigen. Zwar ist eine Existenz ohne Sterne und Galaxien, ja sogar ohne Materie denkbar, aber keine Existenz ohne Denken. So ist der Tod – ein ungeschminkter Tod mit all seiner nüchternen, unnachgiebigen Derbheit, ein Tod, der das Bewußtsein zum Stillstand bringt – die höchste Absurdität, während er zugleich die höchste Wahrheit ist! Der Tod enthüllt, daß Wahrheit und Absurdität eins sind. – Wir können uns den Tod nur als ein Ereignis vorstellen, dessen Zeugen wir sind (wir, von denen wir wissen, daß sie dann aufgehört haben zu existieren), als ein Ereignis, bei dem wir (wir, die denkende und sehende Grundlage jeglicher Erfahrung) auf die eigensinnige und hartnäckige, das Bewußtsein auszeichnende Weise anwesend sind. Wann immer wir uns als tot »vorstellen«, sind wir unweigerlich in dem Bild als jene gegenwärtig, die sich etwas vorstellen: unser lebendiges Bewußtsein schaut auf unseren toten Körper. Der Tod trotzt nicht allein unserer Vorstellungskraft: der Tod ist das Urbild eines Widerspruchs in sich. Es ist schwer, ja unmöglich, sich das Nicht-Sein der Materie vorzustellen, sich die Nicht-Existenz des Bewußtseins (Geistes) vorstellen ist schlechthin unmöglich. Ein solches Nicht-Sein läßt sich nur als seine Verneinung denken. Der bloße Akt, den Tod zu denken, ist schon dessen Verneinung. Unsere Gedanken über den Tod, sollten sie überhaupt gedacht werden können, müssen bereits verarbeitet und aufbereitet sein, wir müssen schon an ihnen herumgeflickt und ihre ursprüngliche Absurdität weginterpretiert haben. Wie La Rochefoucauld zu sagen pflegte, ist es uns nicht möglich, unmittelbar die Sonne oder den Tod anzuschauen.
Der Tod fordert auch noch auf andere Weise die Macht der Vernunft lauthals heraus. Vernunft soll uns helfen, die richtige Wahl zu treffen, aber der Tod ist keine Frage der Wahl. Der Tod ist das Ärgernis, die äußerste Demütigung der Vernunft. Er untergräbt das Vertrauen in sie und in die von ihr versprochene Sicherheit. Er erklärt laut, daß die Vernunft lügt. Er flößt eine Furcht ein, welche die von der Vernunft angebotene Zuversicht unterminiert und letztlich zunichte macht. Die Vernunft kann sich von dieser Schmach nicht reinwaschen. Sie kann sie nur zu verbergen suchen, was sie auch tut. Seit der Entdeckung des Todes (und der Zustand danach ist das bestimmende und entscheidende Charakteristikum der Menschheit) haben menschliche Gesellschaften in der Hoffnung, dieses Ärgernis vergessen zu können, stets neue kunstvolle Ausflüchte gesucht. Als dies nicht fruchtete, hofften sie zumindest, nicht darüber nachdenken zu müssen, und als auch dies fehlschlug, verboten sie darüber zu sprechen. Für Ernest Becker »ist die ganze Kultur, alle schöpferischen Lebensweisen des Menschen in großen Teilen ein ausgeklügelter Protest gegen das natürliche Geschick. Sie leugnen die Wahrheit über die menschliche Lage und versuchen vergessen zu machen, was für ein bemitleidenswertes Geschöpf der Mensch ist […] Die Gesellschaft selbst ist ein kodifiziertes Heldensystem, das heißt, die Gesellschaft ist überall ein lebendiger Mythos der Bedeutung menschlichen Lebens, eine trotzige Sinnschöpfung.«[3]
Der Tod ist die größte Niederlage der Vernunft, denn er deckt zum einen die der Logik der Vernunft zugrundeliegende Absurdität auf und zum anderen jene Leere, welche die Kühnheit und das Selbstvertrauen der Vernunft unterstreicht, ja ihr sogar Nahrung gibt. An dieser Niederlage vermag die Vernunft wenig zu ändern, und ihre ureigensten Versuche, die Scharte auszuwetzen, verstärken lediglich ihre Demütigung. Wie Charles W. Wahl sagte, »fügt sich (der Tod) nicht der Wissenschaft oder der Rationalität« und daher sind »wir gezwungenermaßen genötigt, schwerere Verteidigungsgeschütze aufzufahren, d.h. zu Magie und Irrationalität Zuflucht zu nehmen«.
Wann immer wir vom Tod sprechen, neigen wir zur Lüge (zum Überspielen des Schweigens, in das wir hoffnungslos versinken würden, wären wir bereit oder fähig zu sagen, was wir wohl wissen, aber woran wir uns nicht erinnern wollen); wir lügen, wann immer wir das Ereignis des Todes als »Verscheiden« und die Toten als »Dahingegangene« bezeichnen. Die Lüge ist jedoch nicht bewußt, denn wie Freud sagt, »im Grunde glaube niemand an seinen eigenen Tod«, und »im Unbewußten sei jeder von uns von seiner Unsterblichkeit überzeugt«.[4]
Freuds Bemerkung wäre jedoch hinzuzufügen, daß es keiner Anstrengung bedarf, nicht an den Tod zu glauben; hinter dem Unglauben steht keine aktive Bemühung, den Tod zu verneinen – es kostet vielmehr Mühe, sich mit dem Gegenteil des Unglaubens zu konfrontieren. Ohne Veranlassung oder Antrieb fallen wir leicht in jenen Bewußtseinszustand zurück, in dem der Gedanke an unseren eigenen Tod (das heißt an das Ende jenes Bewußtseinszustandes) schlicht abwesend ist. Dieser mühelose, »natürliche« Zustand, den wir nicht verlassen, solange keine Kraft auf uns einwirkt, scheint eben aus diesem Grunde falsch benannt worden zu sein; die Vorsilbe »Un« in Un-glaube läßt an ein »betontes« Glied des Gegensatzes denken, während doch sein Gegenteil (der Glaube an den eigenen Tod) als außergewöhnliche Unterbrechung der »Normalität« gedacht und konstruiert ist. Die konstitutive Ordnung der Überzeugungen dreht gewissermaßen die Ordnung der begrifflichen Anstrengung der Vernunft um. Wenn wir über Sein und Nicht-Sein nachdenken, bemühen wir uns stark (und normalerweise vergeblich) das Nichts als Fehlen von Existenz zu konstruieren. Logisch gesehen ist das Nicht-Sein das »betonte« Glied des Gegensatzes. Die Psychologie spottet jedoch der Logik, und im Falle von Überzeugungen (und Nicht-Überzeugungen) hinsichtlich des Todes verhält es sich umgekehrt: die Nicht-Überzeugung, die Annahme des Nicht-Seins des Todes ist die Meßlatte anhand deren wir die Glaubwürdigkeit ihres Gegenteils bewerten – der Wirklichkeit des persönlichen, des eigenen Todes. Es ist der Glaube an den Nicht-Tod (der fälschlicherweise »Unglaube an den Tod« genannt wird), der »gegeben«, offensichtlich und selbstverständlich ist.
Durch die Arbeit des Glaubens maskiert sich das Imaginäre als Wahrheit, während das Wahre entgiftet oder aus dem Bewußtsein verbannt wird. Wir leben so, als ob wir nicht sterben würden. Dies ist, wie man es auch dreht und wendet, eine bemerkenswerte Leistung, ein Sieg des Willens über die Vernunft. Angesichts der Mühelosigkeit, mit der die meisten Menschen dieses bewundernswerte Kraftstück täglich vollziehen, ergeben sich Zweifel daran, ob dies allein individuellen Mitteln geschuldet ist. Machtvollere Kräfte müssen hier am Werk gewesen sein. Der Unglaube muß zuvor erlaubt, sanktioniert und für rechtens erklärt worden sein, so daß schwache individuelle Verstehensfähigkeiten selten durch den Zwang zu argumentieren, zu begründen, zu überzeugen und Gegenbeweise zu widerlegen, auf die Probe gestellt werden – was selbst unter den günstigsten Bedingungen eine hoffnungslose Aufgabe ist. Der Unglaube übt seinen Schutzdienst gleichsam nur solange zufriedenstellend aus, wie er nicht überprüft, nicht genau und aufmerksam unter die Lupe genommen wird. Der Unglaube ist zu kontrafaktisch, zu unlogisch und absurd, als daß er auch nur einer oberflächlichen Untersuchung standhalten könnte, von einer bohrenden ganz zu schweigen. Daher ist es letztlich ein glücklicher Umstand, daß jenes »Problem«, welches der Unglaube auszulöschen versucht, eigentlich gar kein Problem ist. Probleme sind dadurch definiert, daß sie Lösungen haben. Dieses Problem hat keine. Die Entdeckung, daß es keine Lösung gibt, ist der primäre Ursprung des Schreckens. Der gesellschaftlich sanktionierte Unglaube läuft auf die Erlaubnis hinaus, nicht nach Gründen suchen oder fragen zu müssen.
Gesellschaften sind bekannterweise Arrangements, die es Menschen ermöglichen, mit Schwächen zu leben, die dem Leben sonst schaden würden. Vielleicht ist das wichtigste Arrangement dieser Art eines, das die äußerste Absurdität der bewußten Existenz sterblicher Wesen verbirgt oder, sollte es mißlingen, die potentiell verderblichen Auswirkungen ihrer unverhüllten, bewußten Gegenwart zerstreut. (Wir sollten festhalten, daß sich Gesellschaften hier – wie bei ihren übrigen wohltätigen Funktionen auch – bemühen, mit den Folgen ihres eigenen Tuns fertig zu werden. Schließlich schulden wir unser »Wissen, daß wir wissen« und somit unser Gewahrsein der Absurdität des Todes, der Tatsache, daß wir in Gesellschaft leben und sprachbegabte Tiere sind, was sowohl Folge als auch existentielle Grundlage ebenderselben Gesellschaft ist, die später angestrengt den von ihr angerichteten Schaden beheben will.)
Die existentielle Ambivalenz des Seins
Als Individuen sind wir uns der Sterblichkeit unseres Körpers bewußt, obschon – wie wir sahen – die Tatsache, daß wir über ein solches Wissen verfügen, darauf hinweist, daß unser Bewußtsein jedenfalls nicht in derselben Weisen sterblich ist: das Denken muß sich nicht um die Zeit kümmern und kann die Grenzen der körperlichen Sterblichkeit überschreiten. Dank dieser unheimlichen »Außerzeitlichkeit« des Denkens wissen wir jedoch auch, daß das Gegenteil wahr ist: während mein eigenes, individuelles Denken sehr wahrscheinlich im Augenblick meines Todes endet, hört die körperliche Existenz an sich mit dem Hinscheiden meines individuellen Körpers nicht auf. Sie wird fortdauern, so wie sie lange vor dem Auftreten meines Körpers, vor dem Beginn meines eigenen Denkens, »vor meinem Eintreten in die Welt« ihren Anfang nahm. Sie wird als die körperliche Anwesenheit anderer Menschen fortbestehen. Meine persönliche Existenz ist auf beiden Seiten von der Existenz von Vorgängern und Nachfolgern umgeben. Umgeben, aber nicht verankert, nicht verwurzelt, nicht gebunden: warum ist meine persönliche Existenz in diesen besonderen Ort hineingezwängt worden und nicht in einen der unzähligen anderen, die ich kenne oder die ich mir vorstellen kann? Vielleicht hat niemand dieses grundlegende Rätsel der persönlichen Existenz, diese angsteinflößende Zufälligkeit und Kontingenz des Seins vollkommener ausgedrückt als Pascal:
Bedenke ich die kurze Dauer meines Lebens, aufgezehrt von der Ewigkeit vorher und nachher; bedenke ich das bißchen Raum, den ich einnehme, und selbst den, den ich sehe, verschlungen von der unendlichen Weite der Räume, von denen ich nichts weiß und die von mir nichts wissen, dann erschaudere ich und staune, daß ich hier und nicht dort bin, keinen Grund gibt es, weshalb ich gerade hier und nicht dort bin, weshalb jetzt und nicht dann.[5]
Weder Anfang noch Ende sind absolut. Nicht nur der Geist, auch der Körper ist gewissermaßen zwischen Sterblichkeit und Unsterblichkeit unaufhebbar hin und hergerissen: in einer Hinsicht dazu verurteilt zu enden, sind beide dazu bestimmt, in anderer Hinsicht zu überdauern. Keines ist eindeutig, beide sind dort ambivalent, wo sie am verletzlichsten sind: bezüglich der Gründe oder des Fehlens von Gründen, die erklären, warum sie dort sind, wo sie sind. Es ist diese Ambivalenz, mit der Gesellschaften spielen. Die Ambivalenz des Seins ist ein Abfallprodukt der Gesellschaft, gleichzeitig aber liefert die unauslöschliche Ambivalenz der Existenz das Rohmaterial, aus dem gesellschaftliche Organisationen gesponnen und Kulturen plastisch geformt werden.
Nach Freud geht diese Ambivalenz, um genau zu sein, der Gesellschaft voraus: sie ist schon da, bevor die Gesellschaft ans Werk geht. Freud erkannte in den Menschen, jener einzigartigen Gattung, bei der die Fähigkeit und Notwendigkeit zu lernen nahezu vollständig das natürliche Überlebensrüstzeug verdrängt und ersetzt hat, zwei Triebe: den Lebens- und den Todestrieb.[6] Alle Triebe, betont Freud, seien konservative, angeborene Triebe, die auf eine Rückkehr zum Gleichgewicht drängen, »zur Wiederherstellung eines früheren Zustandes«. Aber der »frühere Zustand«, der »Ausgangszustand«, von dem sie sich einst entfernten und zu dem sie aufgrund der Triebe zurückkehren wollen, ist für alle lebenden Organismen derselbe: der Zustand anorganischer Materie. Aus diesem Grund »ist das Ziel alles Lebens der Tod«. Der Tod, die Rückkehr zum leblosen Zustand anorganischer Materie, ist das Ziel auf das alles Leben zuläuft und das es schließlich aus eigener Kraft und zu seiner Zeit erreicht, sofern es nicht durch äußere Einwirkungen gestört wird.[7] Dennoch zog der Status quo ante nicht nur die Nicht-Existenz des Organismus nach sich, sondern auch die Existenz der Gattung. Damit die erhaltende Funktion angemessen erfüllt wird, muß der Todesinstinkt durch den Lebensinstinkt ergänzt werden: Thanatos durch Libido, der Todestrieb durch den Sexualtrieb. Die beiden angeborenen Triebe erfüllen und befriedigen sozusagen gemeinsam die Forderungen der Natur. Von der nicht-menschlichen, »objektiven« Warte der Natur aus arbeiten sie eng zusammen, um eine vereinte, aber zusammenhängende Leistung zu erbringen, die als Erhaltung und Fortsetzung der Gattung betrachtet werden kann. Dies gilt freilich nicht für den menschlichen, allzumenschlichen Standpunkt individueller Existenz: hier sind sie unvereinbar, senden widersprüchliche Signale aus und schlagen verschiedene Richtungen ein. Was sich anderenorts ergänzte, gerät hier in Konflikt. Der funktionale Zusammenhalt der Natur hallt als Ambivalenz des menschlichen Lebens wider.
Der naturgegebene Lebensinstinkt richtet sich auf die unzuverlässigste, vergänglichste und unbestreitbar sterbliche Komponente der menschlichen Person – den Körper. Die Gattung erhält sich durch den menschlichen Körper und zwar immer zu Lasten der Nicht-Erhaltung des individuellen, zur Reproduktion des Kollektivs beitragenden Körpers. Daher ist es der Körper, der zum Objekt der Libido, des sexuellen Verlangens, wird, damit er seiner schöpferischen/selbstzerstörerischen Funktion nachkommt. Freilich hört er dadurch nie auf, bloß eine zeitweilige Suspendierung des Nichts zu sein, eine »Abweichung« vom »normalen«, anorganischen Zustand der Materie. Seine übrigen, nicht-sexuellen Tätigkeiten (seine physiologische Abhängigkeit von einer unbelebten Umwelt, sein beständiger Stoffwechsel) mahnen an seine Vergänglichkeit, an sein Altern als die natürliche Folge der Jugend, an das rohe Fleisch, das nur von der ein paar Millimeter dicken Epidermis verhüllt wird. (Die Schönheit, welche die Libido lockt und die Phantasie ihrer poetischen Sänger anregt, geht in der Tat nicht »tiefer als die Haut«, sie ist bloß die Tünche, die die abstoßende Wahrheit des sterblichen Fleisches verbirgt.) Derselbe Körper, der die unerschöpfliche Quelle libidinöser Lust ist, ist zwangsläufig auch die letzte Verkörperung des Todesschreckens: »Die Natur will uns zum Narren halten und Dichter müssen Qualen erleiden.«[8]
In Jenseits des Lustprinzips, der 1920 veröffentlichten, begeistert aufgenommenen und bahnbrechenden Studie, stellte Freud (nicht ohne eine Portion Verwirrung) fest, daß der Gegensatz von Lebens- und Todestrieb in das Innere von Beziehungen einzudringen scheint, die »logisch« gesehen getrennt bleiben sollten, eine jede von einem (und nur einem) der beiden großen feindlichen Triebe vollständig geleitet und strukturiert. Erstaunlicherweise scheint die Objekt-Liebe mit ambivalenten Haltungen durchsetzt zu sein. Am meisten überrascht jedoch, daß sie neben der erwarteten Liebe (Zärtlichkeit) auch Haß (Aggression) einschließt – eine Haltung, die »augenscheinlich« fehl am Platze ist und in der Liebe nur als logisch widersinnig betrachtet werden kann. »Wenn es uns gelänge diese beiden Polaritäten in Beziehung zueinander zu bringen, die eine auf die andere zurückzuführen!« grübelt Freud gedankenvoll über seine Entdeckung nach. Der Versuch dies zu tun, folgt der orthodoxen Gedankenrichtung: die aggressive Haltung und die haßerfüllte Abneigung in der Objekt-Liebe sind Phänomene, die – auf die Spitze getrieben – in sadistische Perversion umschlagen. In weniger verdichteter, abgeschwächter Form sind sie jedoch notwendige, durch und durch zweckdienliche Werkzeuge des Eros: »… im oralen Organisationsstadium der Libido fällt die Liebesbemächtigung noch mit der Vernichtung des Objekts zusammen […] auf der Stufe des Genitalprimats (übernimmt) er (der sadistische Trieb) zum Zwecke der Fortpflanzung die Funktion, das Sexualobjekt so weit zu bewältigen, als es die Ausführung des Geschlechtsaktes erfordert.«[9]
In der drei Jahre später erschienenen Schrift Das Ich und das Es, jenem Werk Freuds, das nach Meinung vieler Kommentatoren die letzte, umfassendste und entscheidendste der zahlreichen Reformulierungen der psychoanalytischen Theorie enthält, erfährt die Deutung eine subtile Verschiebung: von der Zweckdienlichkeit dieser ansonsten widersinnigen Mischung ist nicht mehr die Rede. Statt dessen lesen wir, daß Ambivalenz »so ursprünglich« ist, daß sie vermutlich »eine nicht vollzogene Triebmischung« darstellt. Der Leser darf, ganz zu recht, mutmaßen, daß die Vermischung nicht vollzogen werden kann: die ständige Ko-präsenz von Eros und Thanatos wirft einen haushohen Schatten von Ambivalenz auf die ganze menschliche Existenz. »Das Weiterleben« und »das Streben nach dem Tod« sind unauflösbar miteinander verknüpft: »Das Leben selbst (wäre) ein Kampf und ein Kompromiß zwischen diesen beiden Strebungen.«[10] Man beachte, daß der Kampf nicht ausgetragen wird, sondern nur einen Kompromiß erzielt, der nie vollständig befriedigen kann und stets vorläufig, zerbrechlich und »vorbehaltlich« sein muß.
Andere Autoren – Freuds Schüler und Nachfolger – haben beschrieben, wie das in diesem Schatten geführte Leben beschaffen ist. (Lassen Sie mich wiederholen: worum es geht, ist bewußtes Leben, ein Leben im Wissen um das »Kopplungsgeschäft«, das den Tod ein für allemal zur letzten Bestimmung aller lebenserhaltenden und -fördernden Handlungen erklärt hat.) Nach diesem Schritt kamen zahlreiche Theoretiker zu dem Schluß, es sei weniger der – wenn auch widersinnige – »Beschluß der Natur«, der unmittelbar für die Qualen der Ambivalenz verantwortlich sei (wie Freud bei seiner besessenen Suche nach »wissenschaftlichen« Gründen für seine Theorie mehr als einmal und mehr als zögernd nahelegte). Der von der Natur eingeschlagene Weg, die kollektive Fortdauer der Gattung durch die individuelle Sterblichkeit ihrer Mitglieder zu sichern, erscheint nur dann als widersinnig, wenn man ihn kennt. Schließlich ist Widersinnigkeit kein Merkmal der bewußtlosen »Wirklichkeit«, sondern ihrer bewußten, nach Stimmigkeit strebenden Modelle. Die Widersinnigkeit ist »einfach« die Niederlage des dem Geiste eigentümlichen, todestriebartigen Dranges nach jener unerschütterlichen Ruhe, die nur durch den Zusammenhang, das Fehlen von Widersprüchen, erreichbar ist. Die bewußte Anwesenheit des Menschen in einer bewußtlosen Welt ist es, welche die »Wege der Natur« als widersinnig enthüllt. Das Bewußtsein der Widersinnigkeit wird als unaufhebbare Ambivalenz der kontingenten Existenz wieder zurückgeworfen. »Die menschliche Natur«, betont Erich Fromm, »kann nicht mit einer bestimmten Eigenschaft positiv definiert werden, wie etwa mit Liebe, Haß, Vernunft, dem Guten oder dem Bösen, sondern nur mit den fundamentalen Widersprüchen, die die menschliche Existenz charakterisieren.«
Bewußtsein seiner selbst, Vernunft und Phantasie haben die »Harmonie« zerstört, welche die tierische Existenz kennzeichnet. Durch ihr Erscheinen ist der Mensch zu einer Anomalie, zu einer grotesken Laune des Universums geworden. Er ist Teil der Natur, ihren physikalischen Gesetzen unterworfen und unfähig, sie zu ändern, und doch transzendiert er die Natur. Er ist getrennt von ihr und doch ein Teil von ihr. Er ist heimatlos und doch an die Heimat gekettet, die er mit allen Kreaturen teilt. An einem zufälligen Ort und zu einem zufälligen Zeitpunkt in diese Welt geworfen, ist er gezwungen, sie, wie es der Zufall will und gegen seinen Willen, zu verlassen. Da er sich seiner selbst bewußt ist, erkennt er seine Ohnmacht und die Begrenztheit seiner Existenz. Er ist nie frei von der Dichotomie seiner Existenz. Er kann sich nicht von seiner Denkfähigkeit freimachen, selbst wenn er es wollte. Er kann sich nicht von seinem Körper freimachen, solange er lebt – und sein Körper zwingt ihm den Wunsch, zu leben, auf.[11]
Derartige Widersprüche sind wahrhaft existentiell (oder wie die Franzosen sagen würden »anthropologisch«). Das gesellschaftlich gestützte Bewußtsein legte sie bloß offen und formte sie in das schmerzhafte Bewußtsein der Ambivalenz oder der unterbewußten Angst um. Sie sind von der Natur verordnet worden, lange bevor die menschliche Kultur Gelegenheit hatte, sie zu entdecken und somit gezwungen wurde einzugreifen. Der Kultur blieb es überlassen, aus dem Stegreif hervorzubringen, was Natur nicht lieferte – doch welche Melodien die Kultur auch komponierte, sie mußte sich dabei der von der Natur gelieferten Töne bedienen. Die Natur determinierte sozusagen die Undeterminiertheit des Menschen. Der Kultur fiel es – wenn auch nicht aus eigenen Stücken – zu, das Zufällige zu verfestigen, das Wurzellose einzupflanzen, dem Ohnmächtigen einen Anstrich von Macht zu geben, nicht ersonnene Absurdität hinter ersonnenen Bedeutungen zu verbergen. Und Kultur tat, was ihr zu tun aufgegeben war, mit solch rückhaltloser Hingabe, mit so großartigen (wenn auch keineswegs zufriedenstellenden) Auswirkungen, daß Hegel guten Gewissens sagen konnte, die ganze Geschichte erzähle davon, »wie der Mensch mit dem Tode umgeht«, und W.B. Yeats konnte seinen Lesern mitteilen, es sei der Mensch gewesen, der »den Tod schuf«.
Das Bemühen, die entscheidende Absurdität der menschlichen Lage zu verbergen, oder wenn nicht zu verbergen, so doch zu dämpfen und zu entschärfen, nahm einen strategisch so bedeutsamen Platz im Wirken der Kultur ein, daß sich immer mehr Historiker Hegels Einsicht anschließen und behaupten, das Wesen des geschichtlichen Dramas lasse sich durch die Aufzeichnung der aufeinanderfolgenden Wandlungen in den Todesbildern und der Art und Weise erfassen, wie Menschen mit Tod und Sterben fertigwerden. Wie sich die Einstellungen zum Tod und die damit verbundenen Verhaltensweisen verändern, kann auf kausalem Wege nicht überzeugend erklärt werden (schließlich handelt es sich ja nur um Bemäntelungen, um Pseudo-Lösungen für ein dauerhaftes Bedürfnis, von denen man früher oder später abrücken muß, weil ihr normatives Potential zwangsläufig an Glaubwürdigkeit verliert), aber sie mögen ihrerseits als Erklärungen für umfassendere Veränderungen dienen – für solche, die Kulturen im Ganzen berühren, da sie mit dem schwer greifbaren, aber machtvollen Stoff der »Sensibilitäten« gesättigt sind. Todesvorstellungen und -riten würden somit den Rang »ursprünglicher Tatsachen« einnehmen, welche die Vorrangigkeit der individuellen Sterblichkeit unter den Grundbestandteilen der menschlichen Lage widerspiegeln.
Diese seit einigen Jahrzehnten (vor allem von französischen Historikern)[12] akzeptierte Auffassung steht bis heute eher für Hoffnungen und methodologische Postulate, denn für eine empirisch bestätigte Wahrheit. Soweit es den Umgang mit der Sterblichkeit betrifft, scheinen »Kulturen im Ganzen« völlig heterogene Haltungen zu tolerieren – was durchaus merkwürdig und uncharakteristisch ist. (Gleichwohl weisen die Haltungen anscheinend einen Verhaltenskomplex auf, der von ihren geistigen Eliten mit mehr oder weniger großem Nachdruck bevorzugt, gepriesen und praktiziert wird.) Die Reaktionen der Menschen auf den Tod sind offenbar zu komplex und vielleicht auch zu beharrlich, als daß sie sich erfolgreich von irgendeiner Kultur auf eine allgemein akzeptable Weise kanalisieren ließen. Freilich würde es der Kultur nie gestattet sein, alle derartigen Versuche aufzugeben, doch scheinen sie bislang keinen überzeugenden Erfolg gehabt zu haben. Nach Joachim Whaleys Zusammenfassung der zermürbenden Erfahrung der Historiker mit ihrem angestrebten, aber schwer faßbaren Ziel »zeichnen sich die Haltungen gegenüber dem Tod in allen Zeitaltern durch denkbar unterschiedliche Gefühle aus – Furcht, Trauer, Wut, Verzweiflung, Unmut, Resignation, Trotz, Mitleid, Habsucht, Siegesfreude, Hilflosigkeit«.[13] Zweifellos ist dies ein so gemischtes Bündel von Gefühlen, daß alle Bemühungen, sie zu »standardisieren«, ein recht großer Auftrag wäre. Angesichts dieser enormen Aufgabe waren gesellschaftlich beaufsichtigte Anstrengungen, die innere Ambivalenz der sterblich / unsterblichen Existenz des Individuums / der Gattung aufzulösen, lediglich eine Abfolge zum Teil erfolgreicher, letztlich aber unbefriedigender Hilfsmittel. (Die Ambivalenz ist insofern eigentümlich menschlich