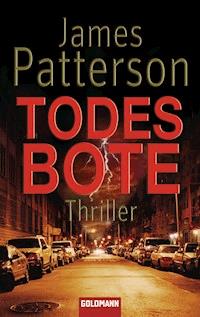Inhaltsverzeichnis
Buch
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Erster Teil – Ein fotogenes Mädchen
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Zweiter Teil – Nachtflug
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Dritter Teil – Leichen zählen
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Kapitel 83
Kapitel 84
Kapitel 85
Kapitel 86
Kapitel 87
Kapitel 88
Kapitel 89
Kapitel 90
Kapitel 91
Vierter Teil – Großwildjagd
Kapitel 92
Kapitel 93
Kapitel 94
Kapitel 95
Kapitel 96
Kapitel 97
Kapitel 98
Kapitel 99
Kapitel 100
Kapitel 101
Kapitel 102
Kapitel 103
Kapitel 104
Kapitel 105
Kapitel 106
Kapitel 107
Kapitel 108
Kapitel 109
Kapitel 110
Kapitel 111
Kapitel 112
Kapitel 113
Kapitel 114
Kapitel 115
Kapitel 116
Kapitel 117
Kapitel 118
Kapitel 119
Kapitel 120
Kapitel 121
Kapitel 122
Kapitel 123
Nachwort
Danksagung
Copyright
Buch
Ben Hawkins, ehemaliger Polizist und mehr oder weniger erfolgreicher Kriminalreporter bei der Los Angeles Times, verspricht sich eigentlich keine allzu spannende Story von seiner Reise nach Hawaii. Die nur mäßig aufregende Meldung, dass das atemberaubend schöne Supermodel Kim McDaniels nach einem Photoshooting am Strand nicht mehr im Hotel aufgetaucht ist, dient ihm eher als Vorwand für einen spesenfinanzierten Kurzurlaub denn als wirklich heiße Spur. Doch als man wenig später Kims Leiche und ihren abgetrennten Kopf findet, ist Ben schnell klar, dass sein Kurzurlaub zu einem jähen Ende gekommen ist.
Der Mord an Kim bleibt nicht das einzige Verbrechen auf der Insel, und es wird klar, dass ein gerissener Serienkiller die Polizei an der Nase herumführt. Ben versucht, ihm auf eigene Faust auf die Spur zu kommen, doch schon bald muss er entmutigt aufgeben ̶ zu raffiniert verwischt der Killer, der den Decknamen Henri benutzt, seine Spuren, zu schnell wechselt er die Identitäten, zu gewaltig sind seine Ressourcen. Entmutigt kehrt Ben nach Los Angeles zurück.
Als er dort Trost bei seiner Freundin Amanda suchen will, erlebt er eine böse Überraschung: Der Jäger ist zum Gejagten geworden. In L. A. wartet der Killer Henri mit gezogener Waffe auf Ben, um ihm ein ebenso perverses wie verführerisches Angebot zu unterbreiten: Ben soll die Geschichte des Mörders aufschreiben, soll sie zu einem Buch verarbeiten ̶ zu einem sicheren Bestseller. Nur dann wird Henri ihn und Amanda leben lassen. Und Ben muss sich entscheiden, ob er von nun an der Chronist eines blutigen Kreuzzugs sein will – oder ob er unter Einsatz seines und Amandas Lebens den Kampf gegen einen Wahnsinnigen aufnimmt...
Autor
Von James Patterson sind im Goldmann Verlag außerdem lieferbar: Sams Briefe an Jennifer. Roman (45908) ’ Honeymoon. Roman (45907) • Sündenpakt. Roman (46333) • Todesschwur. Roman (46430) • Totenmesse. Thriller (46669). Im Affekt. Roman (46598). Todesahnung. Roman (46764)
Für die Mannschaft an der Heimatfront: Suzie und John, Brendan und Jack
Prolog
Nichts als Tatsachen
1
Ich weiß Dinge, die ich nicht wissen will.
Ein mordender Psychopath hat nichts mit dem klassischen Stereotyp »Der Mörder ist immer der Gärtner« gemein. Er ist weder ein bewaffneter Räuber, der sein Gewehr auf einen unglückseligen Schnapsladenbesitzer entlädt, noch ein Mann, der in das Büro eines Aktienhändlers stürmt und ihm den Kopf wegpustet, oder ein Ehemann, der seine Frau wegen einer tatsächlichen oder eingebildeten Affäre erwürgt.
Psychopathen werden nicht durch Liebe, Angst, Wut oder Hass angetrieben. Solche Gefühle kennen sie nicht.
Glauben Sie mir: Sie fühlen überhaupt nichts.
Gacy, Bundy, Dahmer, BTK und die anderen Mitglieder der Liga krankhafter Mörder waren völlig unbeteiligt; sie wurden lediglich von sexuellem Verlangen und dem Nervenkitzel angetrieben, den sie beim Morden verspürten. Die Reue, die man in Ted Bundys Augen zu sehen glaubte, nachdem er den Mord an dreißig jungen Frauen gestanden hatte, war das Ergebnis der eigenen Vorstellung. Ein Psychopath unterscheidet sich nämlich von anderen Mördern dadurch, dass ihn alles unberührt lässt – das Leben seiner Opfer genauso wie ihr Tod. Doch Psychopathen können durchaus vorgeben, sich Sorgen zu machen. Sie ahmen menschliche Gefühle nach, um sich unauffällig unter uns zu bewegen und ihre Beute zu ködern. Sich immer näher an sie heranzuschleichen. Nach dem Mord geht es auf zu neuen Taten, zu noch größerer Spannung ohne Grenzen und Tabus. Unaufhaltsam.
Ich habe gehört, dieser Appetit lenke einen Psychopathen ab, weswegen er beim Morden auch mal etwas vermasselt und einen Fehler begeht.
Vielleicht erinnern Sie sich an den Fall, als das Bikinimodel Kim McDaniels von einem Sandstrand auf Hawaii entführt worden war. Lösegeld wurde nie gefordert. Die örtliche Polizei war langsam, arrogant und ahnungslos, es gab keine Zeugen oder Informanten, die Hinweise darauf geben konnten, wer diese schöne, begabte junge Frau entführt hatte.
Damals war ich ein Expolizist, der zum Krimiautor umgesattelt hatte, doch nachdem mein letztes Buch schon kurz nach der Auslieferung auf den Wühltischen gelandet war, tat ich als Autor auf der Ersatzbank das Einzige, was mir noch blieb, wenn ich keine Schundliteratur schreiben wollte.
Ich berichtete für die L. A. Times über Verbrechen, wo, mal anders betrachtet, auch die Anfänge des Autors Michael Connelly für Ruhm und Ehre lagen.
Ich saß am Freitagabend, vierundzwanzig Stunden nach Kims Entführung, an meinem Schreibtisch. Ich ließ mich gerade in einem der üblichen Artikel über tödliche Unfälle mit Fahrerflucht aus, als mein Redakteur, Daniel Aronstein, sich um meine Trennwand schob, »fang« rief und mir ein Ticket nach Maui zuwarf.
Ich war fast vierzig, abgestumpft von den vielen Tatorten, die ich gesehen hatte, und redete mir ein, dass ich genau an der richtigen Stelle saß, um eine Idee für ein Buch zu bekommen, die meinem Leben ein weiteres Mal eine Wende geben würde. Es war eine Lüge, an die ich glaubte, weil sie meine schwindende Hoffnung auf eine bessere Zukunft nährte.
Komisch ist nur, als sich mir die große Idee förmlich aufdrängte, bemerkte ich sie nicht.
Aronsteins Ticket nach Hawaii versprach mir die dringend benötigte Abwechslung. Ich stellte mir einen Fünf-Sterne-Schuppen, Strandbars und halbnackte Mädchen vor, um deren Gunst ich buhlen würde. Und all das auf Kosten der L. A. Times.
Ich schnappte mir das Ticket und flog los zur größten Geschichte meiner Karriere.
Kim McDaniels’ Entführung hatte einen Flächenbrand von noch unbestimmter Dauer ausgelöst. Alle Nachrichtensender unseres Planeten berichteten bereits über diese brandheiße Geschichte, als ich mich zu der schnatternden Schar der Reporter an der Polizeiabsperrung vor dem Wailea Princess Hotel gesellte.
Zunächst dachte ich, was alle Journalisten dachten – dass Kim, nachdem sie sich betrunken hatte, von ein paar bösen Jungs abgeschleppt, vergewaltigt, zum Schweigen gebracht und beseitigt worden war. Und auch ich dachte, dass die »vermisste Schönheit« eine Woche oder einen Monat lang die Schlagzeilen beherrschen würde, bis eine bigotte Berühmtheit oder das Ministerium für Heimatschutz die Titelblätter zurückerobern würden.
Doch ich musste mir meine Selbsttäuschung bewahren und meine Ausgaben rechtfertigen, weswegen ich nur zu gern bereit war, über eine gehässige, unwiderstehliche Räuberposse zu berichten.
Indem ich dies tat, und nicht, weil ich es darauf anlegte, wurde ich Teil der Geschichte, ausgewählt von einem schwerwiegend geistesgestörten Mörder, der sich seinerseits an seine Selbsttäuschung klammerte.
Das Buch, das Sie in Händen halten, ist die wahre Geschichte eines versierten, schwer fassbaren Ungeheuers der allerersten Güte, wie man vielleicht sagen könnte. Er nannte sich Henri Benoit. Wie hatte er sich mir gegenüber ausgedrückt? »Jack the Ripper wäre es nicht im Traum eingefallen, so zu töten, wie ich es getan habe.«
Seit Monaten halte ich mich an einem abgelegenen Ort auf, um »Henris« Geschichte niederzuschreiben. Wegen der vielen Stromausfälle, die es hier gibt, habe ich mich an eine normale Schreibmaschine gewöhnt.
Wie sich zeigte, brauchte ich das Internet nicht, weil das, was meine Bänder, Aufzeichnungen und Zeitungsausschnitte nicht enthalten, fest in meinem Gehirn eingebrannt ist.
In »Todesbote« geht es um einen beispiellosen Mörder, der den Einsatz in bisher ungekannte Höhen trieb; es geht um einen Mörder, wie es ihn zuvor noch nie gegeben hatte und den es auch nicht so schnell wieder geben wird.
Beim Schreiben allerdings muss ich mir eine gewisse literarische Freiheit gönnen, da ich nicht weiß, was Henri oder seine Opfer dachten.
Aber dies ist kein Grund zur Sorge, überhaupt nicht. Die Tatsachen nämlich hat mir Henri mit eigenen Worten erzählt.
Und die Tatsachen entsprechen der Wahrheit.
Und wenn Sie die Wahrheit lesen, werden Sie mehr als schockiert sein. Mir erging es nicht anders.
Erster Teil
Ein fotogenes Mädchen
2
Barfuß und in einem blauweiß gestreiften Minikleid erwachte Kim McDaniels durch einen Schlag gegen ihre Hüfte, der einen blauen Fleck hinterlassen würde. Fragen drängten in ihr Bewusstsein, während sie in der Dunkelheit ihre Augen öffnete.
Wo war sie? Was, zum Teufel, war hier los?
Sie fummelte an der Decke herum, die über ihrem Kopf lag, bis sie sie endlich von ihrem Gesicht ziehen konnte. Sie bemerkte mehrere Dinge: Ihre Hände und Füße waren gefesselt, und sie befand sich in einem sehr engen Raum.
»Hey!«, beschwerte sie sich, als sie von einem weiteren Stoß durchgeschüttelt wurde.
Ihr Ruf verhallte im Nichts, wurde abgedämpft vom engen Raum und einem vibrierenden Motor. Sie lag, wie ihr klar wurde, im Kofferraum eines Autos. Aber warum, verdammt noch mal? Werde endlich wach, ermahnte sie sich.
Doch sie war wach, spürte die Stöße und kämpfte vergeblich gegen das Nylonseil an, mit dem ihre Handgelenke gefesselt waren. Sie drehte sich auf den Rücken, zog die Beine an und – wumm! Sie trat gegen den Kofferraumdeckel, der sich aber keinen Zentimeter weit öffnete.
Wieder und wieder trat sie dagegen, Schmerzen schossen von ihren Fußsohlen nach oben zu ihren Hüften. Von Panik gepackt, begann sie am ganzen Körper zu zittern.
Sie war gefangen, saß in der Falle. Das Wie oder Warum kannte sie nicht, doch sie war weder tot noch verletzt. Also würde sie wieder freikommen.
Mit gefesselten Händen tastete sie wie mit Klauen im Kofferraum nach einem Werkzeugkasten, Wagenheber oder Brecheisen umher, fand aber nichts. Die Luft wurde immer dünner und schaler, als sie sich keuchend hin und her wand.
Warum war sie hier?
Kim suchte nach ihrer letzten Erinnerung, doch sie war benebelt, als hätte man auch eine Decke über ihr Hirn geworfen. Sie konnte nur vermuten, dass man sie unter Drogen gesetzt hatte. Jemand hatte ihr etwas ins Glas gekippt, aber wer? Und wann?
»Hilfe! Lasst mich raus!«, rief sie. Sie trat mit den Füßen gegen den Kofferraumdeckel und stieß mit dem Kopf gegen eine harte Metallkante, ihre Augen füllten sich mit Tränen. Ihre Todesangst brachte sie an den Rand des Wahnsinns.
3
Kims Klauenhände zitterten, als sie nach oben griff, mit ihren Fingern den Hebel umfasste und nach unten zog. Die Stange bewegte sich... ganz ohne Widerstand. Der Kofferraumdeckel öffnete sich nicht.
Immer wieder zog sie daran, kämpfte verzweifelt gegen ihre Gewissheit an, dass jemand die Kabel durchtrennt und den Hebel außer Funktion gesetzt hatte.
Plötzlich spürte Kim, dass der Wagen die Straße verließ. Er holperte weniger, weil er vielleicht über Sand rollte.
Fuhr er aufs Meer zu?
Würde man sie im Kofferraum ertränken?
Sie schrie, so laut sie konnte, bis ihr Schrei zu einem gestotterten Gebet verebbte. Lieber Gott, lass mich lebend hier raus, dann verspreche ich dir... und als sie völlig verstummte, hörte sie Musik hinter ihrem Kopf. Eine weibliche Stimme, Blues, ein Lied, das sie nicht kannte.
Wer saß am Steuer? Wer hatte ihr das angetan? Aus welchem Grund?
Langsam lichtete sich der Nebel in ihrem Kopf, ihre Gedanken eilten zurück zu den Bildern der vergangenen Stunden. Sie erinnerte sich. Sie war um drei Uhr aufgestanden. Make-up um vier. Am Strand um fünf. Sie, Julia, Darla, Monique und dieses andere tolle, aber seltsame Mädchen, Ayla. Gils, der Fotograf, hatte Kaffee mit den anderen getrunken, Männer hatten sich um den Set herum niedergelassen, Jungs mit Handtüchern und frühmorgendliche Jogger, die zufällig vorbeigekommen waren und gespannt auf die Mädchen in den winzigen Bikinis warteten.
Kim erinnerte sich, wie sie nach Gils Anweisungen mit Julia verschiedene Positionen eingenommen hatte. »Weniger lächeln, Julia. Das ist prima. Wunderschön, Kim, wunderschön, genauso brauche ich mein Mädchen. Augen in meine Richtung. Perfekt!«
Sie erinnerte sich an die anschließenden Telefonanrufe während des Frühstücks und des ganzen Tages.
Zehn verrückte Anrufe, bis sie ihr Telefon ausgeschaltet hatte.
Douglas hatte sie angerufen, ihr Nachrichten geschickt, ihr nachgestellt, sie in den Wahnsinn getrieben. Es war Douglas, der sie hier im Kofferraum festhielt!
Und sie dachte daran, was nach dem Abendessen geschehen war. Sie hatte mit Del Swann, dem verantwortlichen Art Director, in der Hotelbar gesessen. Er hatte Anstandsdame für sie gespielt, bis er, von dem ebenso stockschwulen Gils gefolgt, auf der Toilette verschwunden war.
Und sie erinnerte sich, dass sich Julia mit einem Typen an der Bar unterhalten hatte. Vergeblich hatte sie versucht, Julia ein Zeichen zu geben, und war dann am Strand spazieren gegangen... an mehr erinnerte sie sich nicht.
Ein Strandspaziergang mit ausgeschaltetem Mobiltelefon. Und darum dachte sie jetzt, Douglas wäre ausgeflippt. Douglas, dem schnell der Kragen platzte. Douglas, der ihr nachstellte. Vielleicht hatte er jemanden dafür bezahlt, ihr etwas ins Glas zu schütten.
Jetzt wurde ihr alles klar. Ihr Gehirn arbeitete bestens.
»Douglas?«, rief sie. »Dougie?«
4
Kim hielt den Atem an und lauschte.
Ein Telefon klingelte, aber es war nicht ihr Klingelton. Ein tiefes Schnarren, nicht ihre vier Takte aus Weezers »Beverly Hills«. Aber wenn das Telefon so gewöhnlich war wie der Klingelton, würde es nach dreimaligem Klingeln auf die Mailbox umschalten.
So weit durfte Kim es nicht kommen lassen!
Wo steckte dieses verdammte Telefon?
Das Seil schnitt in ihr Handgelenk, als sie nach dem Telefon tastete. Sie spürte einen Klumpen unter der Ecke des Teppichs, stieß ihn unbeholfen weiter von sich fort... oh, nein!
Als das zweite Klingelzeichen endete und das dritte einsetzte, begann ihr Herz zu rasen, als wäre es außer Kontrolle geraten, bis sie endlich das Telefon zu fassen bekam, ein altmodisches Ding, das sie mit ihren zitternden Fingern umklammerte.
Es wurde kein Name angezeigt, nur die Rufnummer, die sie allerdings nicht kannte.
Aber es war egal, wer sie anrief. Jeder war ihr recht.
Sie drückte die grüne Taste und hielt sich das Telefon ans Ohr. »Hallo?«, fragte sie mit heiserer Stimme. »Hallo? Wer ist da?«
Doch statt einer Antwort hörte Kim nur Singen, diesmal Whitney Houston. »I’ll always love you« drang laut und deutlich aus den Lautsprechern aus dem Wageninnern.
Er rief sie vom Fahrersitz aus an! »Dougie?«, rief sie über Whitneys Stimme hinweg. »Dougie, verdammt. Antworte mir!«
Doch er antwortete nicht, und Kim, festgebunden wie ein Hühnchen und schwitzend wie ein Schwein, zitterte in dem engen Kofferraum. Whitney schien sie zu verspotten.
»Doug! Was soll der Scheiß?«
Dann wurde es ihr klar. Er zeigte ihr, wie es war, ignoriert zu werden. Er wollte ihr eine Lektion erteilen, doch diesen Sieg wollte sie ihm nicht gönnen. Schließlich befanden sie sich auf einer Insel. Wie weit würden sie kommen?
Kim nutzte ihre Wut als Ansporn für ihr Hirn, mit dem sie es bis zum Vorbereitungskurs für ihr Medizinstudium gebracht hatte. Sie überlegte, wie sie Doug beschwichtigen konnte. Sie müsste ihm etwas vorspielen, ihm sagen, wie leid es ihr tue. Er müsse doch verstehen, dass es nicht ihr Fehler war. Sie bastelte sich ihre Erklärung in Gedanken zurecht.
Hör mal, Dougie, ich darf keine Anrufe entgegennehmen. Laut Vertrag ist es mir strikt verboten, jemandem zu erzählen, wo wir die Aufnahmen machen. Sonst fliege ich raus. Das verstehst du doch, oder?
Sie würde ihm zu verstehen geben, dass sie trotz ihrer Trennung und obwohl er ihr diesen Wahnsinn, dieses Verbrechen antat, immer noch sein Liebling war.
Doch ihr Plan war, ihm bei der erstbesten Gelegenheit in die Eier oder gegen die Kniescheiben zu treten. So weit wusste sie über Judo Bescheid, dass sie ihn trotz seiner Größe außer Gefecht setzen konnte. Dann würde sie um ihr Leben rennen und ihn der Polizei überlassen.
»Dougie?«, rief sie ins Telefon. »Antwortest du mir bitte? Bitte. Das ist echt nicht lustig.«
Plötzlich wurde die Musik leiser gedreht.
Wieder hielt sie in dem dunklen Kofferraum den Atem an. Ihr Herz schlug bis zu den Ohren hinauf. Diesmal sprach jemand zu ihr, ein Mann mit warmer, fast liebevoller Stimme.
»Eigentlich ist es doch recht lustig. Und hochromantisch obendrein.«
5
Eine noch nie da gewesene Angst erfasste sie und drohte, sie in eine Ohnmacht zu treiben. Doch sie fing sich wieder, presste ihre Knie fest zusammen und biss sich in ihre Hand, um sich wach zu halten. Und sie ließ die Stimme in ihrem Kopf noch einmal erklingen.
»Eigentlich ist es doch recht lustig. Und hochromantisch obendrein.«
Sie kannte diese Stimme nicht, hatte sie noch nie gehört.
Alles, was sie sich soeben noch vorgestellt hatte, Dougs Gesicht, seine Schwäche für sie, das Jahr, in dem sie gelernt hatte, ihn in den Griff zu bekommen, wenn er außer Kontrolle geriet – all das verblasste.
Die Wahrheit sah ganz anders aus.
Ein völlig Fremder hatte sie gefesselt und in den Kofferraum seines Wagens geworfen. Sie war entführt worden – aber warum? Ihre Eltern waren nicht reich! Was würde er ihr antun? Wie würde sie fliehen können? Ja, sie würde fliehen – aber wie?
Kim lauschte, bevor sie fragte: »Wer sind Sie?«
Er antwortete mit sanfter, ruhiger Stimme.
»Entschuldige meine Unhöflichkeit, Kim. Ich werde mich gleich vorstellen. Es dauert nicht mehr lange. Und keine Sorge – alles wird gut.«
Die Leitung wurde unterbrochen.
In ihrem Kopf entstand die gleiche Stille wie in der Leitung. Es war, als wäre auch er abgeschaltet worden. Dann kehrten ihre Gedanken zurück. Sie schöpfte Hoffnung aus der beruhigenden Stimme des Fremden. Sie klammerte sich daran. Er verhielt sich... nett. Er hatte gesagt: »Alles wird gut.«
Als der Wagen nach links abbog, rollte Kim an die Seitenwand des Kofferraums, wo sie sich mit den Füßen abstützte. Und sie merkte, dass sie das Telefon immer noch umklammerte!
Sie hielt das Tastenfeld nah an ihr Gesicht. Obwohl sie kaum die Zahlen erkennen konnte, schaffte sie es, die Notrufnummer einzutippen.
Es klingelte dreimal, dann ein viertes Mal, bevor sich jemand meldete. »Notrufstelle, um welchen Notfall geht es?«
»Mein Name ist Kim McDaniels. Ich wurde...«
»... ich habe Sie leider nicht verstanden. Bitte buchstabieren Sie Ihren Namen.«
Kim rollte nach vorne, als der Wagen anhielt. Dann wurde die Tür auf der Fahrerseite zugeschlagen... und der Schlüssel drehte sich im Schloss des Kofferraumdeckels.
Kim umklammerte das Telefon, weil sie Angst hatte, die Stimme am anderen Ende könnte zu laut sein und sie verraten. Aber mehr noch hatte sie Angst, die Polizei wäre nicht mehr in der Lage, das Telefon aufzuspüren, wenn sie auflegte.
Die Polizei konnte doch Telefone immer aufspüren, oder?
»Ich wurde entführt«, flüsterte sie.
Der Schlüssel drehte sich im Schloss, zuerst nach rechts, dann nach links. Als sich der Kofferraumdeckel nicht gleich hob, überdachte Kim verzweifelt ihren Plan. Es war noch immer nicht zu spät. Vielleicht wollte der Entführer sie vergewaltigen. Das würde ihr noch nicht den Tod bringen, aber sie würde es geschickt anstellen müssen, um ihn für sich zu gewinnen, und alles aufmerksam wahrnehmen, um es anschließend der Polizei zu erzählen.
Als sich der Kofferraumdeckel hob, wurden ihre Füße vom Mondlicht beleuchtet.
Und Kims Plan, ihren Entführer zu umgarnen, löste sich in Wohlgefallen auf. Sie zog ruckartig die Beine an und trat gegen die Oberschenkel des Mannes. Er wich ihrem Tritt aus, und bevor sie sein Gesicht sehen konnte, hatte er die Decke bereits über ihren Kopf gezogen und ihr das Telefon aus der Hand gerissen.
Dann... dann spürte sie einen Nadelstich in ihrem Oberschenkel.
Sie hörte noch seine Stimme, als ihr Kopf nach hinten kippte und es dunkel um sie herum wurde.
6
Kim kam wieder zu Bewusstsein.
Sie lag mit dem Gesicht nach oben auf einem Bett in einem hellen Zimmer mit gelb gestrichenen Wänden. Ihre Arme waren über ihrem Kopf gefesselt und festgebunden, ihre Beine an den Metallrahmen des Bettes gebunden. Vom Kinn bis zu ihren Beinen war sie mit einem weißen Satinlaken bedeckt. Sie war sich nicht hundertprozentig sicher, aber sie dachte, unter dem Laken müsste sie nackt sein.
Sie zerrte an den Seilen, mit denen ihre Arme oben gehalten wurden. Bilder von dem, was mit ihr als Nächstes passieren könnte, blitzten in ihrem Kopf auf, und nichts davon passte zu dem beruhigenden Versprechen des Mannes, dass alles gut werden würde. Stöhn- und Piepslaute drangen aus ihrer Kehle, Geräusche, die sie noch nie zuvor von sich gegeben hatte.
Das mit den Seilen hatte keinen Zweck. Also hob sie den Kopf und blickte sich um, soweit es ging. Das Zimmer wirkte unwirklich, wie eine Bühnenkulisse.
An der rechten Wand befanden sich zwei geschlossene Fenster, die von halb durchsichtigen Vorhängen verdeckt wurden. Unter dem Fenster stand ein Tisch voller Kerzen in allen Größen und Farben, daneben eine Vase mit Hawaii-Blumen.
Paradiesvogelblumen und Ingwer – in ihren Augen sehr männliche, fast schon phallisch wirkende Pflanzen, die kerzengerade in einer Vase standen.
Rechts und links waren Stative mit Kameras und Scheinwerfern aufgebaut. Über ihrem Kopf hing ein Mikrofongalgen. Alles sah sehr professionell aus.
Erst jetzt bemerkte sie das laute Tosen, als brächen sich Wellen an den Wänden.
Sie lag mitten in einem Zimmer, aufgespannt wie ein Schmetterling.
Sie holte tief Luft und schrie laut um Hilfe.
Als ihre Stimme erstarb, hörte sie die eines Mannes hinter sich. »Hey, hey, Kim, hier kann dich niemand hören.«
Kim drehte ihren Kopf nach links und reckte angestrengt den Hals. Dort saß ein Mann auf einem Stuhl. Er trug Kopfhörer, die er sich auf die Wangen vorzog.
Ihr erster Blick auf den Mann, der sie geraubt hatte.
Sie kannte ihn nicht.
Er hatte mittellanges, schmutzig blondes Haar, war vielleicht Ende dreißig. Seine ebenmäßigen, nicht auffälligen Gesichtszüge konnten fast als hübsch durchgehen. Er war muskulös, trug körperbetonte, teuer aussehende Kleidung, eine goldene Uhr, die Kim in der Vanity Fair gesehen hatte. Patek Philippe. Der Mann auf dem Stuhl blickte Kim an wie dieser Daniel Craig, der aktuelle Bond-Darsteller.
Er setzte den Kopfhörer wieder auf und schloss die Augen. Er ignorierte sie.
»Hey! Mister! Ich rede mit Ihnen«, rief Kim.
»Das solltest du dir anhören«, erwiderte der Mann. Er nannte die Musik, eine der ersten Studioaufnahmen dieses Künstlers, den er persönlich kenne.
Er erhob sich und hielt ihr einen Kopfhörer ans Ohr.
»Ist das nicht großartig?«
Kims Fluchtplan löste sich in Luft auf. Ihre große Chance, ihn zu verführen, hatte sie verpasst. Er würde seine Sache durchziehen, dachte sie, egal, was er vorhatte. Aber sie konnte immer noch um ihr Leben betteln. Ihm sagen, es mache mehr Spaß, wenn sie sich aktiv beteilige – doch sie war von der Spritze noch benommen und viel zu schwach, um sich zu bewegen.
Sie blickte in seine hellgrauen Augen, er blickte zurück, als würde er etwas für sie empfinden. Vielleicht könnte sie das ausnutzen. »Hören Sie«, begann sie, »die Leute wissen, dass ich vermisst werde. Wichtige Leute. Life Incorporated. Haben Sie von denen gehört? Ich habe Ausgangsverbot. Das gilt für alle Models. Die Polizei sucht bereits nach mir...«
»Darüber würde ich mir keine Sorgen machen, Kim«, antwortete James Blond. »Ich war sehr vorsichtig.« Er setzte sich neben sie aufs Bett und legte bewundernd eine Hand auf ihre Wange, bevor er sich Latexhandschuhe überstreifte.
Kim fiel die Farbe der Handschuhe auf – blau. Er nahm etwas von einem Nagel an der Wand, eine Art Maske, die er sich aufsetzte. Sie verzerrte sein Gesicht zu einer Angst einflößenden Fratze.
»Was haben Sie vor? Was machen Sie da?«
Kims Schreie hallten von den Wänden des kleinen Zimmers wider. »Das war toll«, sagte der Mann. »Kannst du das noch mal machen? Bist du bereit, Kim?«
Er ging zu den Kameras, kontrollierte den Einstellwinkel durch die Linsen und schaltete sie ein. Grelles Licht erfüllte den Raum.
Kims Blick folgte den blauen Handschuhen, die das Laken von ihr rissen. Obwohl es kühl war im Zimmer, bildeten sich Schweißperlen auf ihrem Körper.
Er würde sie vergewaltigen.
»Das müssen Sie nicht tun«, wollte sie ihn aufhalten.
»Doch.«
Kims Wimmern ging in Weinen über. Sie wandte ihr Gesicht ab, blickte zum geschlossenen Fenster, hörte, wie die Gürtelschnalle des namenlosen Fremden auf den Boden schlug. Hemmungslos schluchzend spürte sie die Latexhandschuhe auf ihren Brüsten, spürte seine Zunge, die in ihren Schoß eindrang, spürte ihre Muskeln, die sich anspannten, um ihn aufzuhalten.
Sanft wehte sein Atem über ihr Gesicht, als er ihr ins Ohr flüsterte.
»Mach ruhig weiter, Kim. Mach einfach weiter. Es tut mir leid, aber diese Arbeit hier tue ich für viel Geld. Die Leute, die zuschauen, sind große Fans von dir. Versuch, das zu verstehen.«
»Ich will, dass du stirbst«, keuchte sie und biss kräftig in sein Handgelenk. Die Schläge, die er ihr rechts und links ins Gesicht verpasste, trieben ihr die Tränen in die Augen.
7
Als Kim aufwachte, saß sie in einer Badewanne mit warmem Wasser. Ihre Hände, vom Schaum bedeckt, waren gefesselt. Der blonde Fremde saß neben ihr auf einem Stuhl und wusch sie mit einem Naturschwamm, als hätte er dies schon viele Male zuvor getan.
Kims Magen zog sich zusammen, und sie erbrach Gallenflüssigkeit ins Wasser. Der Fremde hob sie schwungvoll auf die Beine – »Allez hopp« -, und wieder bemerkte sie, wie kräftig er war. Diesmal hörte sie auch einen leichten Akzent aus seiner Stimme heraus. Sie konnte ihn nicht zuordnen. Vielleicht russisch. Oder tschechisch. Oder deutsch. Schließlich zog er den Stöpsel heraus und drehte die Brause auf.
Kim schwankte unter dem Strahl, so dass er sie festhalten musste. Sie schrie auf und schlug nach ihm, versuchte sogar, nach ihm zu treten. Sie verlor das Gleichgewicht, aber er fing sie wieder auf. »Du bist mir schon ein eigenartiges Früchtchen«, lachte er.
Dann wickelte er sie in ein flauschiges, weißes Badetuch und rubbelte sie ab wie ein Baby. Als er sie auf die Toilette setzte, hielt er ihr ein Glas hin.
»Trink das«, forderte er sie auf. »Das wird dir helfen. Ehrlich.«
Kim schüttelte den Kopf. »Wer sind Sie?«, fragte sie. »Warum tun Sie mir das an?«
»Willst du dich an diesen Abend erinnern, Kim?«
»Sie machen wohl Witze, Sie verdammter Perversling.«
»Dieses Getränk wird dir dabei helfen zu vergessen. Und ich möchte, dass du schläfst, wenn ich dich nach Hause bringe.«
»Wann werden Sie mich nach Hause bringen?«
»Es ist fast vorbei«, antwortete er.
Als Kim ihre Hände hob, bemerkte sie, dass ihre Gelenke mit einem anderen Seil zusammengebunden waren. Es war dunkelblau, vielleicht aus Seide, der knifflige Knoten beinahe schön. Sie nahm das Glas aus seinen Händen und leerte es in einem Zug.
Als Nächstes bat der Fremde sie, den Kopf nach vorn zu beugen, weil er ihr Haar trocknen wollte. Anschließend bürstete er es und zog mit den Fingern Strähnchen und Locken, bevor er Fläschchen und Pinsel aus einer Schublade neben dem Waschbecken holte.
Mit flinker Hand legte er Make-up auf ihre Wangen, Lippen und Augen auf, tupfte Abdeckcreme auf eine gerötete Stelle neben ihrem linken Auge, befeuchtete den Pinsel mit seiner Zunge und verwischte die Grundierung. »Das kann ich sehr gut«, beruhigte er sie.
Als er seine Arbeit beendet hatte, hob er sie mitsamt dem Handtuch hoch und trug sie ins Zimmer.
Kims Kopf rollte nach hinten, als er sie aufs Bett legte. Sie merkte, dass er sie ankleidete, leistete ihm allerdings keine Hilfe, als er ihr ein Bikinihöschen über die Schenkel nach oben zog. Schließlich band er das Oberteil in ihrem Nacken zu.
Der Bikini sah aus wie der von Vittadini, den Kim gegen Ende des Fotoshootings getragen hatte. Rot mit einem silbernen Schimmer.
Sie musste »Vittadini« gemurmelt haben, weil »James Blond« erwiderte: »Der ist noch besser. Ich habe ihn höchstpersönlich in St. Tropez ausgesucht. Nur für dich.«
»Sie kennen mich nicht«, lallte sie aus dem Mundwinkel heraus.
»Alle kennen dich, Schätzchen. Kimberly McDaniels. Auch der Name ist wunderschön.« Er schob ihr Haar zur Seite, knotete das Band des Oberteils zu einer Schleife und entschuldigte sich sogar, falls es in ihrem Haar ziepen sollte.
Kim wollte etwas sagen, vergaß aber, was. Sie konnte sich nicht bewegen. Sie konnte nicht schreien. Sie konnte kaum ihre Lider oben halten, als sie in diese blassgrauen Augen blickte, die sie zu streicheln schienen.
»Verblüffend«, stellte er fest. »Du bist wunderschön für die Nahaufnahme.«
8
In einer Privatbibliothek auf der anderen Seite der Erde lehnte sich ein Mann namens Horst in seinem Ledersessel zurück und blickte auf den großen HD-Bildschirm neben dem Kamin.
»Mir gefallen die blauen Hände«, sagte er zu seinem Freund Jan, der sein Glas schwenkte. Horst stellte mit der Fernbedienung den Ton lauter.
»Ein hübscher Zug«, stimmte Jan zu. »Mit dem Bikini und der Haut ist sie so typisch amerikanisch wie apple pie. Bist du sicher, dass du den Film abgespeichert hast?«
»Natürlich. Jetzt schau hin«, forderte Horst ihn auf. »Schau, wie er sein Tier zum Schweigen bringt.«
Kim lag auf dem Bauch, an allen vieren gefesselt wie ein Tier – die Hände hinter dem Rücken, angebunden an ihre Beine, die an den Knien nach hinten gebogen waren. Außer dem roten Bikini trug sie glänzende, schwarze, zwölf Zentimeter hohe Lacklederschuhe mit roten Sohlen. Es waren Topdesignerschuhe, Christian Louboutin, die besten. Auf Horst wirkten sie eher wie Spielzeug, nicht wie Schuhe.
Kim flehte den Mann an, den seine Zuschauer als »Henri« kannten. »Bitte, bitte, binden Sie mich los«, wimmerte sie leise. »Ich werde meine Rolle spielen. Das wird Ihnen doch mehr Spaß machen, und ich werde es niemandem erzählen.«
Horst lachte. »Da hat sie Recht. Sie wird es niemandem erzählen.«
Jan stellte sein Glas ab. »Horst, spule bitte das Video zurück«, verlangte er gereizt.
»Ich werde es niemandem erzählen«, wiederholte Kim schluchzend auf dem Bildschirm.
»Das ist gut, Kim. Das ist unser Geheimnis, hm?«
Henris Gesicht wurde durch die Plastikmaske verunstaltet und seine Stimme digital verzerrt, doch seine großartige Vorstellung begeisterte die Zuschauer. Beide Männer beugten sich vor, beobachteten Henri, der Kim mit Schlägen malträtierte, über ihren Rücken strich und ihr etwas ins Ohr flüsterte, bis sie aufhörte zu wimmern.
Und dann, als sie einzuschlafen schien, setzte er sich rittlings auf sie und grub seine Hände in ihr langes, feuchtes Haar.
Er zerrte ihren Kopf so weit nach oben, dass sich ihr Rücken bog und sie vor Schmerzen aufschrie. Vielleicht hatte sie gesehen, dass er mit der rechten Hand zu einem Sägemesser gegriffen hatte.
»Kim«, sagte er, »du wirst bald aufwachen. Und wenn du dich je an das hier erinnerst, wird es dir wie ein böser Traum vorkommen.«
Die schöne junge Frau blieb überraschenderweise still, als Henri den ersten tiefen Schnitt in ihrem Hals anbrachte. Doch als der Schmerz schließlich in ihr Bewusstsein drang, sie mit Gewalt aus ihrer Benommenheit holte, riss sie die Augen weit auf und stieß einen gellenden Schrei aus. Sie wand sich hin und her, während Henri durch ihre Muskeln sägte und auch ihr Schreien ersterben ließ. Mit drei langen Schnitten trennte er Kims Kopf von ihrem Körper ab.
Blut spritzte gegen die gelb gestrichenen Wände, ergoss sich auf das Satinlaken, lief am Arm und an den Lenden des nackten Mannes nach unten, der über dem toten Mädchen kniete.
Henris Lächeln war auch hinter der Maske noch zu sehen, als er Kims Kopf mit dem immer noch verzweifelten Gesicht am Haar hielt und sanft vor der Kamera hin und her schwenkte.
Die verzerrte Stimme des Mörders klang unheimlich und mechanisch, doch Horst gefiel sie ausgesprochen gut.
»Ich hoffe, es sind alle zufrieden«, sagte Henri.
Zweiter Teil
Nachtflug
9
Ein Mann stand am Rand der Kaimauer aus Lavagestein und blickte hinaus auf das dunkle Wasser und die sich rosa färbenden Wolken, als die Abenddämmerung über der Ostküste von Maui hereinbrach.
Er hieß Henri Benoit, was nicht sein richtiger Name war. Doch es war der Name, den er derzeit benutzte. Er war Anfang dreißig, hatte mittellanges, dunkelblondes Haar und hellgraue Augen und war vielleicht einszweiundachtzig groß. Im Moment trug er keine Schuhe, seine Zehen hatte er halb im Sand vergraben.
Sein weißes Leinenhemd hing locker über seinen grauen Baumwollhosen, und er beobachtete die kreischenden Möwen, die über die Wellen hinwegflogen.
Henri dachte, diese Möwenschreie könnten das Präludium für einen weiteren vollendeten Tag im Paradies sein. Doch der Tag hatte noch gar nicht richtig begonnen, da war er schon im Eimer.
Henri wandte sich vom Meer ab, schob seinen PDA in seine Hosentasche und ging, seine Jacke vom Wind wie ein Segel aufgebläht, den Hang hinauf zu seinem Bungalow.
Dort zog er die Gittertür auf, überquerte die mit hellem Holz ausgelegte Veranda zur Küche und schenkte sich eine Tasse Kona-Kaffee ein. Damit trat er wieder hinaus auf die Veranda, wo er sich neben dem Pool auf einem Liegestuhl niederließ, um nachzudenken.
Dieser Ort, das Hana Beach, stand ganz oben auf seiner Liste der bevorzugten Hotels: exklusiv, bequem, ohne Fernseher oder Telefon. An der Küste gelegen und von ein paar tausend Quadratmetern Regenwald umgeben, bildete die unauffällige Gebäudegruppe einen perfekten Rückzugsort für die Reichsten der Reichen.
Dieser Ort gab einem Menschen die Möglichkeit, sich vollständig zu entspannen, der zu sein, der er wirklich war, und das Wesen seines Menschseins zu erkennen.
Der Anruf von irgendwo aus Osteuropa hatte die Sache mit seiner Entspannung über den Haufen geworfen. In dem kurzen Gespräch war alles Wesentliche gesagt worden. Horst hatte sowohl gute als auch schlechte Nachrichten gehabt, die Henris Gefühl als Freiberufler verletzt hatten wie ein Stich in seine Eingeweide.
Horst hatte Henri erzählt, seine Arbeit sei gut aufgenommen worden, hätte aber Fragen aufgeworfen.
Hatte er das richtige Opfer gewählt? Warum hatte Kim McDaniels’ Tod so wenig Staub aufgewirbelt? Wo war die Presse? War das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich angemessen?
»Ich habe brillante Arbeit geleistet«, hatte Henri zurückgeschnauzt. »Das kannst du nicht von der Hand weisen.«
»Immer mit der Ruhe, Henri. Wir sind doch schließlich unter Freunden.«
Ja. Freunde in streng geschäftlicher Hinsicht, wobei die eine Seite der Amigos das Geld hatte. Und jetzt erzählte Horst ihm, seine Kumpels seien nicht vollständig zufrieden. Sie wollten mehr. Mehr von diesen schrägen Sachen. Mehr Handlung. Mehr Beifall am Ende des Films.
»Benutz deine Vorstellungskraft, Henri. Überrasche uns.«
Sie würden natürlich für zusätzliche vertraglich vereinbarte Dienstleistungen mehr bezahlen, und nach einer Weile hatte die Aussicht auf mehr Geld Henris schlechte Laune etwas gemildert, nicht allerdings seine Verachtung für die Spanner.
Sie wollten mehr?
Sollten sie haben.
10
Leise rieselte der Schnee auf das praktisch aufgeteilte, aber gemütliche Haus von Levon und Barbara McDaniels in Cascade Township, einer im Grünen gelegenen Vorstadt von Grand Rapids in Michigan. Es war Nacht, und die beiden Jungs schliefen bereits.
Am Ende des Flurs lagen Levon und Barbara Rücken an Rücken in ihrem Doppelbett. Auch die Fußsohlen hatten sie aneinandergelegt. Selbst im Schlaf schienen die beiden nach fünfundzwanzigjähriger Beziehung unzertrennlich.
Auf Barbaras Nachttisch häuften sich um ihre Flasche mit grünem Tee Zeitschriften und halb gelesene Taschenbücher, Ordner mit Testberichten und Notizzetteln sowie Unmengen von Vitaminpräparaten. Darum brauchst du dich gar nicht zu kümmern, Levon, und rühr bitte nichts an. Ich finde, was ich brauche.
Barbaras Anordnung auf dem Nachttisch war durch ihre rechte Gehirnhälfte gelenkt, Levons hingegen durch seine linke: sauberer Stapel mit Jahresberichten, das mit Bemerkungen versehene Buch, das er gerade las, ein Kugelschreiber, ein Notizblock und eine Reihe elektronischer Geräte – Telefone, Laptop, Wetterstation -, die sauber ausgerichtet zehn Zentimeter vom Rand entfernt lagen und in einer Steckdose hinter der Lampe mündeten.
Der Schnee hatte das Haus wie in Watte gehüllt – alles war still, bis das Telefon Levon aus dem Schlaf riss. Sein Herz begann zu rasen, und seine Gedanken überschlugen sich panisch. Was war passiert?
Wieder klingelte das Telefon, bis Levon schließlich abhob.
Er blickte auf die Uhr. Drei Uhr vierzehn. Wer, um Himmels willen, rief um diese Uhrzeit an? Doch die Erleuchtung kam schnell. Es war Kim. Bei ihr war es fünf Stunden früher, und irgendwie musste sie die Zeit durcheinandergebracht haben.
»Kim? Schatz?«, meldete sich Levon.
»Kim ist verschwunden«, erwiderte eine männliche Stimme.
Levons Brustkorb schien sich zusammenzuziehen, so dass er kaum atmen konnte. Bekam er einen Herzinfarkt? »Bitte? Was haben Sie gesagt?«
Barbara setzte sich auf und schaltete das Licht ein.
»Levon?«, fragte sie. »Was ist denn los?«
Levon hob eine Hand nach oben – warte einen Moment. »Wer ist da?«, wollte er wissen und rieb über seinen Brustkorb, um den Schmerz zu lindern.
»Ich habe nur eine Minute Zeit, also hören Sie gut zu. Ich rufe aus Hawaii an. Kim ist verschwunden. Sie ist in schlechte Hände geraten.«
Seine Angst wurde schier unerträglich. Er umklammerte das Telefon, während in seinem Kopf der Satz widerhallte: »Kim ist in schlechte Hände geraten.«
Das ergab keinen Sinn.
»Das verstehe ich nicht. Ist sie verletzt?«
Keine Antwort.
»Hallo?«
»Haben Sie gehört, was ich gesagt habe, Mr. McDaniels?«
»Ja. Wer spricht denn da?«
»Ich kann es Ihnen nur einmal sagen.«
Levon zog am Ausschnitt seines T-Shirts und versuchte nachzudenken. War der Kerl ein Lügner, oder sagte er die Wahrheit? Er kannte seinen Namen und seine Telefonnummer und wusste, dass Kim in Hawaii war. Aber woher wusste er all das?
»Was ist los, Levon?«, fragte Barbara. »Geht’s um Kim?«
»Kim ist gestern Morgen nicht am Set erschienen«, fuhr der Anrufer fort. »Die Zeitschrift hält sich bedeckt. Drückt die Daumen. Hofft, dass sie zurückkommt.«
»Wurde die Polizei verständigt? Hat jemand die Polizei benachrichtigt?«
»Ich lege jetzt auf«, sagte der Anrufer. »Aber wenn ich Sie wäre, würde ich ins nächste Flugzeug nach Maui steigen. Zusammen mit Barbara.«
»Warten Sie! Bitte warten Sie. Woher wissen Sie, dass sie vermisst wird?«
11
»Was wollen Sie? Sagen Sie mir, was Sie wollen!«
Levon hörte ein Klicken und dann Tuten. Er drückte die Taste für die eingegangenen Anrufe, doch es wurde nur »unbekannt« und nicht die Nummer des Anrufers angezeigt.
Barbara zog an seinem Ärmel. »Levon! Sag schon! Was ist passiert?«
Barbara beschrieb sich gern als die Flammenwerferin in der Familie und Levon als den Feuerwehrmann. Diese Rollen hatten sich im Lauf der Jahre verfestigt. Also begann Levon zu erzählen, was der Anrufer gesagt hatte. Er hielt sich an die Fakten, ohne seine Angst durchblicken zu lassen.
Auf Barbaras Gesicht zeichnete sich der Schrecken ab, der ihn selbst plagte.
Wie aus weiter Ferne hörte er ihre Stimme: »War er glaubhaft? Hat er gesagt, wo sie steckt? Hat er gesagt, was passiert ist? Mein Gott, worüber reden wir hier überhaupt?«
»Er hat nur gesagt, dass sie weg ist...«
»Sie geht nie ohne ihr Handy irgendwohin.« Barbara, die einen Asthmaanfall bekam, rang nach Luft.
Levon sprang aus dem Bett, stieß mit zittriger Hand Dinge von Barbaras Nachttisch, Tabletten und Blätter segelten über den Teppich. Er schnappte sich den Inhalator aus dem Wirrwarr und reichte ihn ihr.