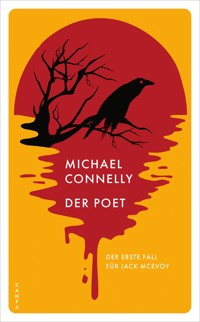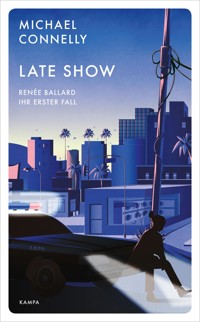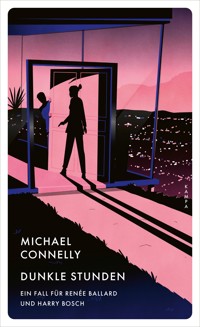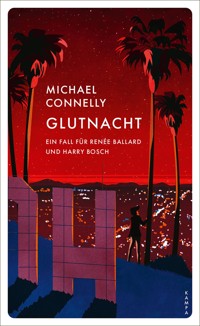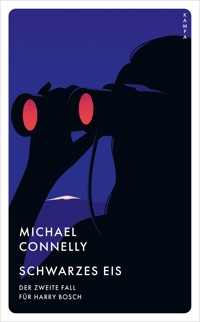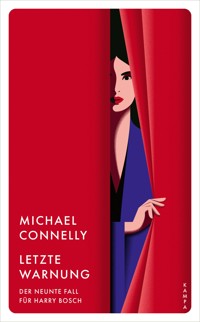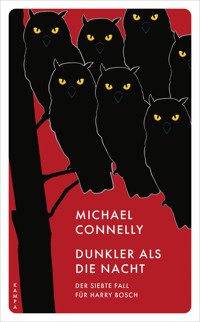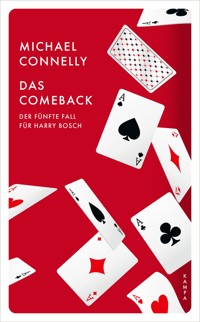Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Red Eye
- Sprache: Deutsch
Die Glanzzeiten von Polizeireporter Jack McEvoy sind schon lange vorbei. Der einge- fleischte investigative Journalist, der zuletzt für die L. A. Times arbeitete, ist inzwischen bei einer Website namens Fair Warning angestellt, einem Nachrichtenportal, das sich dem Verbraucherschutz verschrieben hat und Miss- stände in Automobil-, Pharma- oder Tabakindustrie aufzeigt. Als er von dem brutalen Mord an Tina Portrero erfährt und sogar selbst unter Verdacht gerät, weil er vor einem Jahr einen One-Night-Stand mit ihr hatte, zögert McEvoy nicht lange. Gegen den Willen seines Chefs und der Polizei stürzt er sich in die Ermittlungen und macht eine furchtbare Entdeckung: Tina ist nicht die Einzige. Mehrere Frauen scheinen ein und demselben Mann zum Opfer gefallen zu sein: Alle wurden auf die gleiche Art getötet, alle haben kurz vor ihrem Tod ihre DNA an ein Analyseinstitut geschickt, um mehr über ihre Abstammung zu erfahren. McEvoy gerät in die düstersten Ecken des Darknet und sieht sich einem Gegner gegenüber, wie er noch nie einen hatte, einem Gegner, dem er womöglich nicht gewachsen sein wird und der schon sein nächstes Opfer im Visier hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Connelly
Tödliches Muster
Der dritte Fall für Jack McEvoy
Aus dem amerikanischen Englisch von Sepp Leeb
Kampa
Für Detective Tim Marcia.
Vielen Dank für deinen Dienst an der Stadt der Engel.
Wer wird nicht gleichzeitig abgestoßen und angezogen von einer diabolischen Handlung?
David Goldman,
Our Genes, Our Choicesy
PROLOG
Sie fand seinen Wagen klasse. Es war das erste Mal, dass sie in einem Elektroauto saß. Außer dem Fahrtwind war nichts zu hören, als sie durch die Nacht glitten.
»So leise«, sagte sie.
Nur zwei Wörter, aber sie hatte sie gelallt. Der dritte Cosmo hatte etwas mit ihrer Zunge angestellt.
»Er schleicht sich an einen ran«, sagte der Fahrer. »Das auf jeden Fall.«
Er schaute zu ihr hinüber und lächelte. Aber sie glaubte, er wollte nur sichergehen, dass bei ihr alles okay war, weil sie die Worte nicht richtig herausbekommen hatte.
Dann schaute er wieder nach vorn und deutete mit dem Kinn durch die Windschutzscheibe.
»Da wären wir«, sagte er. »Kann man hier irgendwo parken?«
»Stell dich einfach hinter meinen Wagen«, sagte sie. »Ich habe zwei Stellplätze in der Garage, aber sie sind … hintereinander. Totem, nennt man das, glaube ich.«
»Tandem?«
»Ach so, natürlich, klar. Tandem.«
Sie begann über ihren Fehler zu lachen, eine Lachspirale, aus der sie nicht mehr herauskam. Diese blöden Cosmos. Und die Tropfen aus der Naturheilmittelapotheke, die sie genommen hatte, bevor sie am Abend mit dem Uber weggefahren war.
Der Mann ließ das Fenster auf seiner Seite herunter, und frische Abendluft strömte in die behagliche Wärme im Wageninnern.
»Erinnerst du dich an die Kombination?«, fragte er.
Um das Schwindelgefühl abzuschütteln und sich besser orientieren zu können, zog Tina sich aus dem Sitz hoch. Sie merkte, dass sie bereits vor dem Garagentor ihrer Wohnanlage waren. Das kam ihr eigenartig vor. Sie konnte sich nicht erinnern, ihm gesagt zu haben, wo sie wohnte.
»Die Kombination?«, fragte er noch einmal.
Das Tastenfeld befand sich in Reichweite vom Fahrerfenster an der Wand. Sie stellte fest, dass sie sich zwar an die Zahlenkombination erinnern konnte, mit der sich das Tor öffnen ließ, aber nicht an den Namen des Mannes, den sie nach Hause mitgenommen hatte.
»4-6-8-2-5.«
Als er die Kombination eingab, musste sie sich zusammenreißen, um nicht wieder zu lachen. Manche Typen fanden das schrecklich.
Sie fuhren in die Garage, und sie deutete auf die Stelle, wo er hinter ihrem Mini parken konnte. Wenig später standen sie im Lift, wo sie auf den richtigen Knopf drückte und sich dann Halt suchend an ihn lehnte. Er legte den Arm um sie und hielt sie.
»Hast du einen Spitznamen?«, fragte sie.
»Einen Spitznamen?«, fragte er.
»Na ja, wie nennen dich die Leute, die du gut kennst?«
Er schüttelte den Kopf.
»Sie nennen mich eigentlich nur mit meinem Namen«, sagte er.
Das brachte sie nicht weiter. Sie ließ es auf sich beruhen. Später würde sie seinen Namen schon noch herausbekommen. Aber höchstwahrscheinlich musste sie ihn gar nicht wissen. Zu einem später würde es nicht kommen. Wie eigentlich immer.
Im zweiten Stock ging die Lifttür auf, und sie stiegen aus. Ihre Wohnung befand sich zwei Türen den Gang hinunter.
Der Sex war gut, aber nicht außergewöhnlich. Ungewöhnlich war nur, dass er nichts einzuwenden hatte, als sie auf der Verwendung eines Kondoms bestand. Er hatte sogar selbst eines dabei. Hut ab, dachte sie. Trotzdem würde es ein One-Night-Stand bleiben. Die Suche nach diesem nicht zu beschreibenden Etwas, das die Leere in ihr füllte, würde weitergehen.
Nachdem er das Kondom die Toilette hinuntergespült hatte, kam er zurück ins Bett. Sie hoffte auf eine Ausrede – früh zur Arbeit, eine Frau, die zu Hause wartete, egal was –, aber er wollte wieder zu ihr ins Bett und kuscheln. Er legte sich unsanft hinter sie und drehte sie herum, sodass ihr Rücken gegen seine Brust zu liegen kam. Er hatte sich rasiert, und sie konnte das Piksen der nachwachsenden Stoppeln in ihrem Rücken spüren.
»Weißt du …«
Weiter kam sie nicht mit ihrer Klage. Er veränderte seine Körperhaltung, und plötzlich lag sie auf dem Rücken und er unter ihr. Seine Brust war wie Schmirgelpapier. Sein Arm kam von hinten um sie herum und beugte sich zu einem V. Dann schob er ihren Hals mit der freien Hand in das V. Er spannte die Arme an, und sie spürte, wie ihre Atemwege zugedrückt wurden. Sie konnte nicht um Hilfe rufen. Sie bekam keine Luft, um einen Laut hervorzubringen. Sie begann zu strampeln, aber ihre Beine verhedderten sich in den Laken, und er war zu stark. Sein Arm hatte sich wie ein Schraubstock um ihren Hals gelegt.
Die Ränder ihres Blickfelds verdunkelten sich. Er hob den Kopf vom Bett und kam mit den Lippen an ihr Ohr.
Und flüsterte: »Sie nennen mich den Shrike.«
JACK
1
Ich hatte der Story den Titel »Der König der Schwindler« gegeben. Jedenfalls war das meine Überschrift. Ich tippte sie oben hin, war aber ziemlich sicher, dass sie geändert würde. Es überstieg nämlich meine Kompetenzen als Reporter, einen Artikel mit einer Überschrift einzureichen. Für die Überschriften und die Kurzzusammenfassungen darunter war der Redakteur zuständig, und ich konnte Myron Levin bereits schimpfen hören: »Schreibt der Redakteur etwa deine Einleitungen um, oder ruft er die im Artikel erwähnten Personen an, um ihnen zusätzliche Fragen zu stellen? Nein, tut er nicht. Er bleibt bei seinen Leisten, und genauso bleibst du bei deinen.«
Da Myron Levin dieser Redakteur war, würde es schwer werden, zu meiner Rechtfertigung etwas vorzubringen. Trotzdem schickte ich den Artikel mit meinem Titelvorschlag ein, weil er einfach perfekt war. Die Meldung befasste sich mit den undurchsichtigen Machenschaften der Inkassobranche – sechshundert Millionen Dollar verschwanden jährlich in dunklen Kanälen –, und die Grundregel bei FairWarning lautete, jeden Schwindel mit einem Gesicht in Verbindung zu bringen, egal, ob mit dem des Betrügers oder dem des Betrogenen, ob mit dem des Opfers oder dem des Täters. Und diesmal war es der Täter. Arthur Hathaway, der König der Schwindler, war der Beste der Besten. Mit seinen zweiundsechzig Jahren hatte er in seinem um Betrug kreisenden Leben jede nur erdenkliche Gaunerei begangen, vom Verkauf falscher Goldbarren bis hin zur Einrichtung gefälschter Spendenportale nach Naturkatastrophen. Jetzt war seine neueste Masche, Leuten weiszumachen, Geld schuldig zu sein, das sie gar nicht schuldig waren, und sie dazu zu bringen, zu zahlen. Er war sogar so gut, dass angehende Betrüger dafür bezahlten, an den Kursen teilnehmen zu dürfen, die er montags und mittwochs in einer ehemaligen Schauspielschule in Van Nuys hielt. Ich hatte mich als einer seiner Schüler eingeschlichen und versucht, so viel wie möglich über ihn und seine Tricks herauszufinden. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, den Artikel zu schreiben und mithilfe Hathaways eine Branche zu entlarven, die jedes Jahr die unterschiedlichsten Leute, angefangen von netten alten Ladys mit schwindenden Ersparnissen bis hin zu jungen, wegen ihrer Collegekredite hoch verschuldeten Berufseinsteigern, um Millionen prellte. Sie alle fielen auf Arthur Hathaway herein und schickten ihm ihr Geld, weil er sie dazu überredete. Und jetzt brachte er elf angehenden Trickbetrügern und einem verdeckten Reporter für fünfzig Dollar zweimal wöchentlich bei, wie man das am besten anstellte. Möglicherweise war die Schwindlerschule sogar sein größter Coup. Der Kerl suchte wirklich seinesgleichen und hatte die totale Gewissenlosigkeit eines Psychopathen. Ich berichtete in meinem Artikel auch über die Schicksale der Opfer, deren Bankkonten er geplündert und deren Leben er ruiniert hatte.
Myron hatte den Artikel bereits bei der Los Angeles Times untergebracht, sodass er breitere öffentliche Beachtung finden und auch vom Los Angeles Police Department zur Kenntnis genommen würde. König Arthurs Herrschaft würde bald ein Ende finden und seine Ritterrunde aus angehenden Betrügern gleich mit aus dem Verkehr gezogen werden.
Ich las den Artikel ein letztes Mal, schickte ihn an Myron und setzte William Marchand in cc, den Anwalt, der pro bono sämtliche FairWarning-Meldungen prüfte. Wir veröffentlichten auf der Website nichts, was juristisch nicht hundertprozentig abgesichert war. FairWarning war ein Fünf-Personen-Unternehmen, wenn man die Reporterin mit einrechnete, die in Washington, D.C. von zu Hause aus für uns arbeitete. Eine einzige »unrichtige Meldung«, die einen Prozess oder einen außergerichtlichen Vergleich nach sich zog, konnte uns das Genick brechen, und dann wäre ich wieder, was ich schon mindestens zweimal in meinem Leben war: ein Reporter, der nicht wusste, wohin.
Ich verließ meinen Schreibtisch, um Myron zu sagen, dass der Artikel endlich fertig war, aber er telefonierte gerade an seinem Platz mit einem potenziellen Sponsor. Myron war Gründer, Herausgeber, Chefredakteur, Reporter und Hauptspendenbeschaffer von FairWarning, einem kostenlosen Nachrichtenportal ohne Paywall. Es gab zwar unter jedem Artikel, und manchmal auch darüber, einen Spendenbutton, aber Myron hielt ständig nach dem großen weißen Wal Ausschau, der uns sponsern und – zumindest eine Weile – aller finanziellen Nöte entheben würde.
»Wir sind wirklich die Einzigen, die so etwas machen – kompetenten investigativen Journalismus für den Verbraucher«, erzählte Myron jedem potenziellen Spender. »Wenn Sie mal auf unsere Seite schauen, werden Sie im Archiv viele Beiträge finden, die mächtige Schlüsselindustrien wie Auto-, Pharma-, Tabak- und Mobilfunkunternehmen aufs Korn nehmen. Und angesichts der aktuellen staatlichen Maßnahmen zu Deregulierung und Aufsichtsbeschränkung gibt es niemand mehr, der für den kleinen Mann die Augen offen hält. Mir ist selbstverständlich klar, dass es Spendenoptionen gibt, bei denen Sie auf den ersten Blick mehr für Ihr Geld bekommen. Mit fünfundzwanzig Dollar im Monat können Sie in den Appalachen ein Kind mit Kleidung und Nahrung versorgen. Keine Frage. Das vermittelt Ihnen ein gutes Gefühl. Spenden Sie allerdings für FairWarning, unterstützen Sie ein Team von Journalisten, die sich der Aufgabe verschrieben …«
Diese Platte bekam ich mehrmals am Tag zu hören, tagaus, tagein. Ich nahm auch an den sonntäglichen Jours fixes teil, bei denen Myron und Vorstandsmitglieder zu wohlmeinenden potenziellen Spendern sprachen, und mischte mich hinterher unter sie, um ihnen von den Artikeln zu erzählen, für die ich recherchierte. Als Autor zweier Bestseller hatte ich bei diesen Zusammenkünften einen Sonderstatus, auch wenn nie erwähnt wurde, dass ich schon über zehn Jahre nichts mehr veröffentlicht hatte. Ich wusste, mit diesen Veranstaltungen stand und fiel mein Gehalt – auch wenn ich damit in Los Angeles kaum meine laufenden Kosten decken konnte –, aber in meinen vier Jahren bei FairWarning hatte ich diese Sprüche schon so oft gehört, dass ich sie im Schlaf aufsagen konnte. Rückwärts.
Myron hörte auf, seinem potenziellen Spender zuzuhören, und stellte das Mikrophon stumm, bevor er zu mir aufschaute.
»Bist du fertig?«, fragte er.
»Hab dir gerade alles geschickt«, sagte ich. »Und Bill auch.«
»Okay, ich lese es heute Abend. Und wenn es irgendwas gibt, können wir morgen reden.«
»Es ist druckreif. Mit einer super Schlagzeile. Du musst nur noch den Vorspann schreiben.«
»Pass bloß …«
Er deaktivierte die Stummschaltung des Telefons, um eine Frage zu beantworten. Ich salutierte und ging zum Ausgang, blieb aber vorher noch an Emily Atwaters Schreibtisch stehen, um mich von ihr zu verabschieden. Im Moment war sie die einzige andere Mitarbeiterin im Büro.
»Cheers«, sagte sie mit ihrem klaren britischen Akzent.
Unser Büro lag in einer typischen zweigeschossigen Plaza in Studio City. In der unteren Etage waren ausschließlich Einzelhandels- und Lebensmittelgeschäfte, in der oberen Dienstleister: Autoversicherer, Maniküre/Pediküre, Joga und Akupunktur. Wir waren die Ausnahme. Wir bedienten keine Laufkundschaft, aber das Büro war günstig, weil es über einer Cannabis-Verkaufsstelle lag, aus der die Lüftungsanlage des Gebäudes sieben Tage die Woche rund um die Uhr Marihuanadämpfe in unsere Räumlichkeiten leitete. Myron hatte einen satten Nachlass herausschinden können.
Die L-förmige Plaza hatte eine Tiefgarage mit fünf Stellplätzen für FairWarning-Mitarbeiter und -Besucher. Das war ein großes Plus. Einen Parkplatz zu finden, war in Los Angeles immer ein Problem. Und ein überdachter Parkplatz war für mich ein noch größeres Plus, weil ich mit meinem Jeep im sonnigen Kalifornien so gut wie immer ohne Verdeck unterwegs war.
Ich hatte den Wrangler mit dem Vorschuss für mein letztes Buch neu gekauft, und der Kilometerzähler erinnerte mich beständig daran, wie lange es schon her war, dass ich neue Autos gekauft und Bestsellerlisten angeführt hatte. Ich schaute darauf, als ich den Motor anließ. Ich war 260990 Kilometer von dem Weg abgekommen, auf dem ich einmal gewesen war.
2
Ich wohnte in der Woodman Avenue am Freeway 101. Es war eine Wohnanlage aus den achtziger Jahren im Cape-Cod-Stil, deren vierundzwanzig Einzelhäuser sich um einen rechteckigen Innenhof mit Gemeinschaftspool und Grillbereich gruppierten. Auch dort gab es eine Tiefgarage.
Die meisten Wohnanlagen in der Woodman hatten Namen wie Capri und Oak Crest und dergleichen. Meine war namenlos. Ich war vor eineinhalb Jahren dort eingezogen, nachdem ich die Eigentumswohnung verkauft hatte, die ich mit demselben Vorschuss für mein Buch gekauft hatte. Die Tantiemen fielen von Jahr zu Jahr spärlicher aus, und ich war gerade dabei, mein Leben so umzugestalten, dass ich mit meinem Gehalt bei FairWarning über die Runden kam. Die Umstellung fiel mir nicht leicht.
Als ich auf der abschüssigen Zufahrt zur Tiefgarage darauf wartete, dass das Tor hochging, sah ich am Fußgängertor der Anlage zwei Männer in Anzügen stehen. Einer war weiß und Mitte fünfzig, der andere zwanzig Jahre jünger und asiatischer Abstammung. Ein Windstoß fuhr in die Jacke des Asiaten und gab kurz den Blick auf die Dienstmarke an seinem Gürtel frei.
Ich schaute immer wieder in den Rückspiegel, als ich in die Garage fuhr. Sie folgten mir die Rampe hinunter. Ich parkte auf meinem Stellplatz und stellte den Motor ab. Bis ich mir meinen Rucksack geschnappt hatte und ausstieg, standen sie hinter dem Jeep und warteten.
»Jack McEvoy?«
Der Name stimmte, aber er sprach ihn falsch aus. Wie Mick-a-voy.
»Ja, McEvoy«, sagte ich und korrigierte ihn dabei. Mack-a-voy. »Was gibt’s?«
»Ich bin Detective Mattson, LAPD«, sagte der ältere von beiden. »Und das ist mein Partner, Detective Sakai. Wir hätten ein paar Fragen an Sie.«
Mattson öffnete sein Jackett, um mir zu zeigen, dass auch er eine Dienstmarke hatte – und die dazugehörige Pistole.
»Okay«, sagte ich. »Worüber?«
»Könnten wir in Ihre Wohnung raufgehen?«, fragte Mattson. »Dort sind wir wahrscheinlich etwas ungestörter als in der Tiefgarage.«
Er machte eine ausholende Armbewegung, als stünden überall Menschen herum, die uns zuhörten. Aber die Garage war leer.
»Wenn Sie meinen«, sagte ich. »Kommen Sie. Ich nehme normalerweise die Treppe, aber wenn Sie lieber mit dem Lift fahren, er ist da hinten.«
Ich deutete ans Ende der Garage. Mein Jeep stand in der Mitte, direkt gegenüber der Treppe, die in den Innenhof hinaufführte.
»Die Treppe ist völlig okay«, sagte Mattson.
Ich ging in diese Richtung los, und die Detectives folgten mir. Den ganzen Weg zur Wohnungstür überlegte ich fieberhaft, was ich beruflich getan hatte, um die Aufmerksamkeit des LAPD auf mich zu lenken. Die Reporter von FairWarning hatten zwar bei den Recherchen für ihre Berichte große Freiheiten, aber es gab eine grundsätzliche Arbeitsteilung, und in mein Ressort fielen jede Art von Bauernfängerei und kriminellem Betrug sowie Internet-Berichterstattung.
Ich begann, mich zu fragen, ob mein Artikel über Arthur Hathaway einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren gegen den Schwindler in die Quere gekommen war und ob Mattson und Sakai mich bitten wollten, mit seiner Veröffentlichung noch zu warten. Aber kaum war mir diese Möglichkeit in den Sinn gekommen, tat ich sie auch schon wieder ab. Wäre das der Fall, wären sie in mein Büro gekommen, nicht zu mir nach Hause. Und das Ganze hätte mit einem Anruf begonnen, nicht mit einem persönlichen Besuch.
»Von welcher Abteilung sind Sie?«, fragte ich, als wir über den Innenhof zu Apartment 7 auf der anderen Seite des Swimmingpools gingen.
»Wir kommen aus Downtown.« Mattson hielt sich bedeckt, während sein Partner gar nichts sagte.
»Schon klar«, sagte ich. »Aber von welcher Abteilung genau?«
»Robbery-Homicide Division«, sagte Mattson.
Aktuell berichtete ich nicht über das LAPD, doch früher hatte ich es getan. Ich wusste, dass die Eliteeinheiten Downtown im Hauptquartier stationiert waren, und die RHD, wie sie kurz genannt wurde, war die Elitetruppe der Elite.
»Und worüber wollen Sie jetzt mit mir reden?«, fragte ich. »Über Raub oder Mord?«
»Gehen wir lieber erst rein, bevor wir anfangen«, sagte Mattson.
Ich erreichte meine Wohnungstür. Seine Nichtantwort deutete eher auf Mord hin. Der Schlüssel lag bereits in meiner Hand. Bevor ich die Tür aufschloss, drehte ich mich um und sah die zwei Männer hinter mir an.
»Mein Bruder war Mordermittler«, sagte ich.
»Tatsächlich?«, sagte Mattson.
»Beim LAPD?« Das kam von Sakai. Seine ersten Worte.
»Nein«, sagte ich. »Oben in Denver.«
»Nicht schlecht«, sagte Mattson. »Im Ruhestand?«
»So würde ich es nicht nennen«, sagte ich. »Er wurde im Dienst getötet.«
»Das tut mir leid«, sagte Mattson.
Ich nickte und drehte mich wieder um, um die Tür aufzuschließen. Ich verstand selbst nicht, warum ich meinen Bruder erwähnt hatte. Damit rückte ich sonst nicht so schnell heraus. Leute, die meine Bücher gelesen hatten, wussten es, aber ich ließ es nicht eben mal nebenbei in ein Gespräch einfließen. Es war vor langer Zeit in einem, wie es schien, anderen Leben passiert.
Ich öffnete die Tür, und wir gingen nach drinnen. Ich machte Licht. Meine Wohnung war eine der kleinsten in der Anlage. Das Erdgeschoss war nicht durch Wände unterteilt. Das Wohnzimmer ging in einen kleinen Essbereich über, der nur durch eine Theke mit einer Spüle von der Küche getrennt war. An der rechten Seitenwand führte eine Treppe ins Dachgeschoss hinauf, das mein Schlafzimmer war. Dort oben war auch das eigentliche Bad. Ein kleineres befand sich unter der Treppe im Erdgeschoss. Insgesamt weniger als neunzig Quadratmeter. Die Wohnung war sauber und ordentlich, aber das lag nur daran, dass sie spärlich möbliert war und wenig persönliche Noten aufwies. Den Esstisch hatte ich zu meinem Arbeitsplatz umfunktioniert. An seinem Kopfende stand ein Drucker. Alles war für die Arbeit an meinem nächsten Buch gedacht – und so war es schon seit meinem Einzug.
»Schöne Wohnung«, sagte Mattson. »Wohnen Sie schon lange hier?«
»Etwa eineinhalb Jahre«, sagte ich. »Aber dürfte ich vielleicht mal erfahren, worum es …«
»Setzen Sie sich doch erst mal auf die Couch da.«
Mattson deutete auf das Sofa, das so ausgerichtet war, dass man auf den Flachbildschirm an der Wand über dem Gaskamin sehen konnte, den ich nie anmachte.
Auf der anderen Seite des Couchtischs standen zwei Sessel, die mich wie die Couch schon jahrzehntelang in meinen alten Wohnungen begleitet hatten und entsprechend durchgesessen und abgenutzt waren. Meine schrumpfenden Finanzen spiegelten sich in meiner Unterkunft und meinem fahrbaren Untersatz wider.
Mattson inspizierte die zwei Sessel, entschied sich für den, der am saubersten aussah, und setzte sich. Sakai, der Stoiker, blieb stehen.
»Also, Jack«, begann Mattson. »Wir ermitteln in einem Mordfall, in dem Ihr Name aufgetaucht ist. Deshalb sind wir hier. Wir haben …«
»Wer wurde umgebracht?«, fragte ich.
»Eine gewisse Christina Portrero. Sagt Ihnen der Name was?«
Ich ließ ihn in Höchstgeschwindigkeit durch alle Schaltkreise laufen. Ohne Erfolg.
»Nein, ich glaube nicht. Wie ist mein Name …«
»Sie war hauptsächlich als Tina bekannt. Hilft Ihnen das weiter?«
Ein weiterer Schnelldurchlauf. Diesmal mit mehr Erfolg. Den vollständigen Namen von zwei Mordermittlern gesagt zu bekommen, hatte mich so durcheinander gebracht, dass es nicht sofort klick gemacht hatte.
»Jetzt, warten Sie, klar. Ich kannte eine Tina … Tina Portrero.«
»Eben meinten Sie aber noch, dass der Name Ihnen nichts sagt.«
»Ich weiß. So aus heiterem Himmel hab ich nicht sofort geschaltet. Jedenfalls, wir sind uns ein Mal begegnet, aber dabei ist es geblieben.«
Mattson antwortete nicht. Er nickte seinem Partner zu. Sakai beugte sich vor und hielt mir sein Handy hin. Auf dem Display war ein Foto, ein sehr gestelltes Foto einer Frau mit dunklen Haaren und noch dunkleren Augen. Sie hatte eine intensive Bräune und sah aus wie Mitte dreißig. Aber ich wusste, dass sie eher Mitte vierzig war. Ich nickte.
»Das ist sie«, sagte ich.
»Gut«, sagte Mattson. »Woher kennen Sie sie?«
»Aus dem Mistral, einem Restaurant ein Stück die Straße runter. Ich war gerade von Hollywood hierher gezogen und dabei, mich einzuleben. Weil ich nicht das Auto nehmen musste, ging ich gelegentlich auf einen Drink ins Mistral. Dort habe ich sie kennengelernt.«
»Wann war das?«
»So genau kann ich Ihnen das nicht sagen, aber es dürfte etwa ein halbes Jahr nach meinem Einzug gewesen sein. Vor ungefähr einem Jahr also. Wahrscheinlich an einem Freitagabend. Dann bin ich normalerweise ins Mistral gegangen.«
»Hatten Sie Sex mit ihr?«
Mit dieser Frage hätte ich rechnen sollen, aber ich war nicht auf sie vorbereitet.
»Das geht Sie nichts an«, sagte ich. »Es war vor einem Jahr.«
»Ich fasse das als ein Ja auf«, sagte Mattson. »Haben Sie sie hierher mitgenommen?«
Mir war klar, dass Mattson und Sakai offensichtlich mehr über die Umstände von Tina Portreros Tod wussten als ich. Aber die Frage, was vor einem Jahr zwischen uns gelaufen war, schien enorm wichtig für sie zu sein.
»Was soll das alles?«, fragte ich. »Ich habe sie ein Mal getroffen, und danach haben wir uns nie mehr gesehen. Warum fragen Sie mich das alles?«
»Weil wir den Mord an ihr aufzuklären versuchen«, sagte Mattson. »Wir müssen möglichst alles über sie und ihre Aktivitäten in Erfahrung bringen. Wie weit etwas zurückliegt, spielt keine Rolle. Deshalb frage ich Sie noch einmal: War Tina Portrero jemals in dieser Wohnung?«
Ich warf in einer Geste der Kapitulation die Hände hoch.
»Ja, vor einem Jahr.«
»Ist sie über Nacht geblieben?«, fragte Mattson.
»Nein, nur ein paar Stunden. Dann hat sie ein Uber genommen.«
Mattson ging nicht sofort zur nächsten Frage über. Er musterte mich eine Weile, als überlegte er, wie er weitermachen sollte.
»Haben Sie irgendetwas, was ihr gehört hat, in dieser Wohnung?«, fragte er schließlich.
»Nein«, erwiderte ich ärgerlich. »Was sollte das sein?«
Er ignorierte meine Frage und stellte mir selbst eine.
»Wo waren Sie letzten Mittwochabend?«
»Das soll wohl ein Witz sein, oder?«
»Nein, ist es nicht.«
»Wann am Mittwochabend?«
»Sagen wir, zwischen zehn und zwölf.«
Ich wusste, dass ich bis zehn Uhr in Arthur Hathaways Seminar für angehende Betrüger gewesen war. Ich wusste aber auch, dass es ein Seminar für Schwindler war und deshalb gar nicht existierte. Sollten die Detectives versuchen, diesen Teil meines Alibis zu überprüfen, würde es ihnen weder gelingen, den Nachweis zu erbringen, dass es dieses Seminar überhaupt gab, noch würden sie jemanden finden, der ihnen bestätigte, dass ich daran teilgenommen hatte, denn damit hätte der Betreffende zugegeben, dass auch er daran teilgenommen hatte. Daran konnte niemand ein Interesse haben. Vor allem nicht, wenn der von mir gerade eingereichte Artikel einmal veröffentlicht war.
»Ähm, von zehn bis zwanzig nach zehn war ich in meinem Auto unterwegs, und dann war ich hier.«
»Allein?«
»Ja. Aber das ist doch vollkommen verrückt. Ich habe vor einem Jahr eine Nacht mit ihr verbracht, und danach hatten wir keinerlei Kontakt mehr miteinander. Das stand für uns beide nicht zur Diskussion. Verstehen Sie?«
»Sind Sie da sicher? Für Sie beide?«
»Und ob ich da sicher bin. Ich habe sie nie angerufen, und sie hat mich nie angerufen. Und im Mistral habe ich sie auch nicht mehr gesehen.«
»Wie war das für Sie?«
Ich lachte unbehaglich.
»Wie war was für mich?«
»Dass sie sich nicht mehr bei Ihnen gemeldet hat.«
»Haben Sie mir eigentlich zugehört? Ich habe sie nicht angerufen, und sie hat mich nicht angerufen. Es war gegenseitig. Es ist nicht weitergegangen.«
»War sie an diesem Abend betrunken?«
»Betrunken, nein. Wir hatten ein paar Drinks im Mistral. Ich habe für uns beide bezahlt.«
»Und hier? Noch ein paar Drinks oder gleich ab nach oben, ins Schlafzimmer?«
Mattson deutete die Treppe hinauf.
»Nein, hier keine Drinks mehr«, sagte ich.
»Und alles einvernehmlich?«, fragte Mattson.
Ich stand auf. Das reichte.
»Hören Sie, ich habe Ihre Fragen beantwortet«, sagte ich. »Sie verschwenden nur Ihre Zeit.«
»Ob wir unsere Zeit verschwenden, entscheiden wir«, sagte Mattson. »Wir sind hier fast fertig, und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich wieder setzen würden, Mr. McEvoy.«
Er sprach meinen Namen wieder falsch aus, wahrscheinlich absichtlich.
Ich setzte mich wieder.
»Ich bin Journalist, ja?«, sagte ich. »Ich habe über Verbrechen berichtet – ich habe Bücher über Mörder geschrieben. Ich weiß, was Sie machen. Sie wollen mich aus der Fassung bringen, mich verunsichern, damit ich irgendwas zugebe. Aber da können Sie lange warten, weil ich nichts über diese Sache weiß. Wenn Sie also bitte …«
»Wir wissen, wer Sie sind«, sagte Mattson. »Glauben Sie, wir würden hierherkommen, ohne uns vorher zu informieren, mit wem wir es zu tun haben? Sie sind der Velvet-Coffin-Typ, und nur damit Sie’s wissen, ich habe mit Rodney Fletcher zusammengearbeitet. Er war ein Freund, und was mit ihm passiert ist, war die reinste Verarschung.«
Da war er, der Grund der Feindseligkeit, die Mattson schon die ganze Zeit ausdünstete.
»Velvet Coffin gibt es schon seit vier Jahren nicht mehr«, sagte ich. »Hauptsächlich wegen der Fletcher-Geschichte – die hundert Prozent gestimmt hat. Es war unvorhersehbar, dass er tun würde, was er getan hat. Abgesehen davon arbeite ich inzwischen woanders und schreibe über Verbraucherschutzthemen. Nicht über die Polizei.«
»Schön für Sie. Können wir wieder zu Tina Portrero zurückkommen?«
»Ich weiß nicht, worauf wir da zurückkommen könnten.«
»Wie alt sind Sie?«
»Das wissen Sie doch sicher längst. Und was soll das hier zur Sache tun?«
»Sie kommen mir ein bisschen alt für sie vor. Für Tina.«
»Sie war eine attraktive Frau und älter, als sie aussah und zu sein behauptete. An dem Abend, als wir uns kennengelernt haben, hat sie mir erzählt, sie wäre neununddreißig.«
»Genau das ist doch der Punkt. Sie war älter, als sie aussah. Sie, ein Mann in den Fünfzigern, machen sich an eine Frau ran, die Sie auf Mitte dreißig geschätzt haben. Ein bisschen fragwürdig, finde ich.«
Ich spürte, wie ich vor Scham und Ärger rot wurde.
»Nur damit das klar ist: Ich habe mich nicht ›an sie rangemacht‹«, sagte ich. »Sie hat sich mit ihrem Cosmo zu mir an die Bar gestellt. So hat es angefangen.«
»Gut für Sie«, bemerkte Mattson sarkastisch. »Muss Ihrem Selbstwertgefühl einen gewaltigen Kick verschafft haben. Aber zurück zu Mittwoch. Von wo sind Sie in den zwanzig Minuten gekommen, in denen Sie an diesem Abend Ihren eigenen Aussagen zufolge nach Hause gefahren sind?«
»Von einer Arbeitsbesprechung.«
»Mit Leuten, die uns das nötigenfalls bestätigen könnten?«
»Wenn es sein muss. Aber sie sind …«
»Gut. Dann erzählen Sie uns von Ihnen und Tina.«
Ich wusste genau, was er damit bezweckte. Er sprang mit seinen Fragen ständig hin und her, um mich aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ich hatte fast zwanzig Jahre lang für zwei verschiedene Zeitungen und den Blog von Velvet Coffin über Polizisten berichtet. Ich wusste, wie das lief. Die kleinste Abweichung beim Wiedererzählen der Geschichte, und schon hatten sie, was sie brauchten.
»Nein, ich habe Ihnen schon alles erzählt. Wenn Sie mehr Informationen von mir haben wollen, müssen erst mal Sie welche rausrücken.«
Darauf schwiegen die Detectives eine Weile. Offensichtlich überlegten sie, ob sie sich auf einen solchen Deal einlassen sollten. Ich platzte mit der ersten Frage heraus, die mir einfiel.
»Wie ist sie ums Leben gekommen?«
»Genickbruch«, sagte Mattson.
»Atlantookzipitale Dislokation«, sagte Sakai.
»Was soll das denn sein?«, fragte ich.
»Innere Enthauptung«, sagte Mattson. »Jemand hat ihr den Hals umgedreht. Kein schöner Tod.«
Meine Brust schnürte sich immer enger zusammen. Ich hatte Tina Portrero über diesen einen gemeinsamen Abend hinaus nicht gekannt, aber ich bekam das – durch das Foto auf Sakais Handy aufgefrischte – Bild von ihr, und dass sie auf derart brutale Weise getötet worden war, nicht aus dem Kopf.
»Wie in dem Film Der Exorzist«, sagte Mattson. »Erinnern Sie sich noch? Wo sich der Kopf des besessenen Mädchens einmal ganz herumdreht.«
Das machte es nicht besser.
»Wo ist es passiert?«, fragte ich, um von den Bildern loszukommen.
»Der Hausmeister hat sie in der Dusche gefunden«, fuhr Mattson fort. »Weil ihre Leiche den Abfluss blockiert hat, ist die Wanne übergelaufen. Deshalb ist er nachsehen gekommen. Das Wasser lief noch, als er sie fand. Wahrscheinlich sollte es so aussehen, als wäre sie in der Dusche ausgerutscht und hätte sich bei dem Sturz das Genick gebrochen. Aber so leicht lassen wir uns nichts vormachen. Man rutscht in der Dusche nicht aus und bricht sich den Hals. Nicht so.«
Ich nickte, als wäre das eine nützliche Information.
»Okay«, sagte ich. »Damit hatte ich nichts zu tun und kann deshalb nichts zu Ihren Ermittlungen beisteuern. Wenn Sie also keine weiteren Fragen mehr haben, würde ich jetzt gern …«
»Wir haben aber noch weitere Fragen, Jack«, sagte Mattson streng. »Wir stehen mit unseren Ermittlungen erst ganz am Anfang.«
»Okay. Und was wollen Sie jetzt noch von mir wissen?«
»Sie sind Reporter. Da wissen Sie doch sicher, was Cyberstalking ist?«
»Meinen Sie, wenn man jemand über die sozialen Medien belästigt?«
»Die Fragen stelle ich. Sie sollen sie nur beantworten.«
»Dann müssen Sie sich genauer ausdrücken.«
»Tina hat einer guten Freundin erzählt, dass jemand sie im Internet gestalkt hat. Als die Freundin wissen wollte, wie sie das genau meint, sagte Tina, sie hätte in einer Bar einen Mann kennengelernt, der Dinge über sie wusste, die er nicht hätte wissen sollen. Es war, als hätte er bereits alles über sie gewusst, bevor er sie überhaupt ansprach.«
»Ich habe sie vor einem Jahr in einer Bar kennengelernt. Die ganze Geschichte ist … Moment, wie sind Sie überhaupt auf mich gekommen?«
»Ihr Namen war in ihrer Kontaktliste. Und sie hatte Ihre Bücher auf dem Nachttisch.«
Ich konnte mich nicht erinnern, ob ich mit Tina an besagtem Abend über meine Bücher gesprochen hatte. Da wir allerdings in meiner Wohnung gelandet waren, hielt ich es für wahrscheinlich.
»Und deswegen kommen Sie an, als wäre ich ein Verdächtiger?«
»Jetzt regen Sie sich doch nicht gleich so auf, Jack. Sie wissen, wie wir vorgehen. Wir führen gründliche Ermittlungen durch. Kommen wir also noch mal zu diesem Stalking zurück. Nur um das klarzustellen, sind Sie der Kerl, der sie ihrer Aussage nach gestalkt hat?«
»Nein, das war nicht ich.«
»Gut zu wissen. Dann zu unserer vorerst letzten Frage: Wären Sie bereit, uns für eine DNA-Analyse freiwillig eine Speichelprobe zu geben?«
Die Frage erschreckte mich. Ich zögerte. Meine Gedanken drehten sich plötzlich nur noch um das Gesetz und meine Rechte, und ich ließ völlig außer Acht, dass ich keine Straftat begangen hatte und dass meine DNA, ob nun in Gestalt von Sperma oder Hautschuppen, am vergangenen Mittwoch an keinem Tatort aufgetaucht sein konnte.
»Wurde sie vergewaltigt?«, fragte ich. »Wollen Sie mich jetzt auch noch einer Vergewaltigung beschuldigen?«
»Immer mit der Ruhe, Jack«, sagte Mattson. »Nichts deutet auf eine Vergewaltigung hin, aber sagen wir einfach mal, wir haben DNA-Spuren des Verdächtigen.«
Mir wurde klar, dass mich meine DNA am schnellsten aus ihrem Schussfeld bringen würde.
»Ich war es jedenfalls nicht. Wann wollen Sie die Speichelprobe nehmen?«
»Warum nicht gleich jetzt?«
Mattson sah seinen Partner an. Sakai fasste in eine Innentasche seines Jacketts und holte zwei fünfzehn Zentimeter lange Reagenzgläser mit roten Gummiverschlüssen heraus, von denen jedes einen langen Wattetupfer enthielt. An diesem Punkt wurde mir klar, dass sie mich vermutlich nur aufgesucht hatten, um eine DNA-Probe von mir zu bekommen. Sie hatten die DNA des Mörders, und sie wussten, dass das die schnellste Möglichkeit war, um festzustellen, ob ich etwas mit dem Mord zu tun hatte oder nicht.
Das sollte mir nur recht sein. Das Ergebnis würde sie enttäuschen.
»Dann wollen wir mal«, sagte ich.
»Gut«, sagte Mattson. »Da wäre allerdings noch etwas, was wir tun könnten, wo wir gerade dabei sind.«
Ich hätte es wissen müssen. Gib ihnen den kleinen Finger, und schon wollen sie die ganze Hand.
»Und was wäre das?«, fragte ich ungehalten.
»Würde es Ihnen was ausmachen, das Hemd auszuziehen?«, sagte Mattson. »Damit wir uns Ihre Arme und Ihren Oberkörper ansehen können.«
»Wozu das …«
Ich pfiff mich selbst zurück. Mir war völlig klar, was er wollte. Er wollte sich vergewissern, dass ich keine Kratzwunden oder sonstige Verletzungen von einem Kampf hatte. Die DNA, die sie zu Vergleichszwecken heranziehen wollten, stammte vermutlich von Tina Portreros Fingernägeln. Sie hatte sich gegen ihren Mörder gewehrt, weshalb sich Teile seines Körpers an ihrem befanden.
Ich machte mich daran, mein Hemd aufzuknöpfen.
3
Sobald die Detectives gegangen waren, holte ich mei- nen Laptop aus dem Rucksack und startete im Internet eine Suche nach Christina Portrero. Sie erzielte zwei Treffer, beide auf der Website der Los Angeles Times. Der erste war nur eine Kurzmeldung im Mordblog der Zeitung, wo jeder Mord im County vermerkt wurde, und stammte aus der Anfangsphase der Ermittlungen. Sie enthielt wenig mehr, als dass Portrero tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden war, nachdem eine Polizeistreife dort vorbeigeschaut hatte, weil sie nicht zur Arbeit erschienen war und nicht auf Anrufe oder Nachrichten in den sozialen Medien reagiert hatte. Außerdem hieß es dort, dass es bei Portreros Tod aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mit rechten Dingen zugegangen war, die Todesursache aber noch nicht festgestellt worden war.
Da ich ein treuer Leser des Blogs war, müsste ich die Meldung eigentlich überflogen haben, ohne dabei jedoch den Namen Christina Portrero mit der Tina Portrero in Verbindung zu bringen, mit der ich ein Jahr zuvor eine Nacht verbracht hatte. Ich fragte mich, was ich getan hätte, wenn ich sofort gewusst hätte, dass ich sie kannte. Hätte ich bei der Polizei angerufen und ihnen von meinem Erlebnis erzählt? Dass ich wusste, dass sie zumindest ein Mal allein in eine Bar gegangen war und sich mich für einen One-Night-Stand ausgesucht hatte?
Der zweite Treffer in der Times war eine ausführlichere Meldung, begleitet von dem gleichen Foto, das mir Detective Sakai gezeigt hatte. Dunkle Haare, dunkle Augen, jünger aussehend, als sie war. Diesen Zeitungsbericht musste ich übersehen haben, denn auf dem Foto hätte ich sie erkannt. Dem Artikel zufolge war Portrero die Chefsekretärin des Filmproduzenten Shane Sherzer gewesen. Das fand ich insofern interessant, als sie mir vor einem Jahr erzählt hatte, sie sei als freiberufliche Lektorin in der Filmbranche tätig und begutachte für verschiedene Hollywood-Produzenten und -Agenten Bücher und Skripte, ob sie sich als Vorlagen für Filme und Fernsehserien eigneten. Dann fasste sie den Inhalt der Bücher und Skripte zusammen und kreuzte auf einem Formular das jeweilige Genre an, wie zum Beispiel Komödie, Drama, Fantasy, Horror, Science-Fiction, Krimi usw.
Am Ende des Gutachtens äußerte sie ihre persönliche Meinung über die Eignung der Vorlage und empfahl, die Sache entweder nicht weiterzuverfolgen oder für eine weitere Beurteilung an die nächsthöhere Etage weiterzuleiten. Ich erinnerte mich auch, dass sie mir erzählt hatte, dass sie im Zuge ihrer Tätigkeit häufig Produktionsfirmen auf dem Gelände großer Studios wie Paramount, Warner Brothers oder Universal besuchte und dass das für sie immer mit einem besonderen Reiz verbunden war, weil sie bei diesen Gelegenheiten manchmal bekannte Stars zu sehen bekam, wenn sie zwischen Büros, Aufnahmestudios und Kantine unterwegs waren.
Der Artikel enthielt Äußerungen einer gewissen Lisa Hill, die als Portreros beste Freundin bezeichnet wurde. Sie sagte gegenüber der Zeitung, dass Tina abends immer viel unterwegs gewesen sei, sich aber nach einigen Suchtproblemen wieder in den Griff bekommen habe. Was für Probleme das genau gewesen waren, ließ Hill nicht durchblicken, und vermutlich war sie auch nicht danach gefragt worden. Es schien nichts mit der Frage zu tun haben, wer Portrero getötet hatte, indem er ihr den Hals umdrehte.
In keinem der beiden Times-Posts wurde die genaue Todesursache erwähnt. In der zweiten, ausführlicheren Meldung hieß es lediglich, dass Portrero einen Genickbruch erlitten hatte. Entweder hatten die Redakteure bewusst darauf verzichtet, im Artikel auf genauere Details einzugehen, oder sie hatten sie gar nicht gekannt. Die Hinweise auf die Informationsquellen beschränkten sich in beiden Artikeln auf ein standardmäßiges »laut Aussagen der Polizei«. Weder Detective Mattson noch Detective Sakai wurden namentlich erwähnt.
Ich schaffte es erst nach mehreren Anläufen, »atlantookzipitale Dislokation« richtig zu schreiben und eine Google-Suche zu starten. Die meisten Treffer erzielte ich auf medizinischen Seiten, wo es hieß, dass diese Verletzung vorwiegend bei Autounfällen auftrat, bei denen zwei Fahrzeuge mit hoher Geschwindigkeit kollidierten.
Am besten fasste es der Wikipedia-Eintrag zusammen:
Atlantookzipitale Dislokation (AOD), orthopädische Dekapitation oder innere Enthauptung bezeichnet die ligamentäre Trennung der Wirbelsäule von der Schädelbasis. Ein Mensch kann eine solche Verletzung überleben; allerdings führt sie nur in dreißig Prozent der Fälle nicht zum sofortigen Tod. Die gängige Ätiologie für solche Verletzungen ist eine abrupte und starke Verringerung der Geschwindigkeit, die zu einer Art Schleudertrauma führt.
Das Wort Schleudertrauma weckte in mir Assoziationen an einen Verkehrsunfall und die gewaltigen Kräfte, die dabei freigesetzt wurden. Jemand, der sehr kräftig war, hatte Tina Portrero, möglicherweise unter Verwendung eines Hilfsmittels, den Hals umgedreht. Jetzt war die Frage, ob an ihrem Kopf oder Körper Spuren gefunden worden waren, die darauf hindeuteten, dass dafür ein Gegenstand verwendet worden war.
Bei einer Google-Suche stieß ich auf ein paar Autounfälle, bei denen AOD die Todesursache gewesen war. Einer davon in Atlanta, ein anderer in Dallas. Der jüngste in Seattle. Hinweise auf einen Mordfall, bei dem AOD die Todesursache war, fand ich keine.
Ich musste mich erst eingehender mit dem Thema befassen. Als ich noch für Velvet Coffin arbeitete, hatte ich einmal den Auftrag erhalten, über einen internationalen Rechtsmedizinerkongress zu berichten, der in Los Angeles stattfand. Mein Redakteur spekulierte auf wahre Schauergeschichten und den Galgenhumor von Leuten, die tagaus, tagein mit Tod und Leichen zu tun hatten, und wollte einen Beitrag darüber bringen, was Rechtsmediziner bei so einem Treffen alles zu erzählen hatten. Bei der Arbeit an dieser Story stieß ich auf eine Website für Rechtsmediziner, die vor allem dem Zweck diente, den Rat von Kollegen einzuholen, wenn man es mit ungewöhnlichen Todesumständen zu tun hatte.
Die Seite hieß causesofdeath.net und war passwortgeschützt. Aber weil sie für Rechtsmediziner auf der ganzen Welt zugänglich war, wurde dieses Passwort in der auf dem Kongress verteilten Literatur häufig erwähnt. Nach meiner Teilnahme an dem Kongress war ich im Lauf der Jahre immer wieder auf die Seite gegangen, um dort ein bisschen herumzustöbern und mir einen groben Eindruck zu verschaffen, über welche Themen gerade diskutiert wurde. Selbst gepostet hatte ich dort bisher noch nichts. Ich formulierte meine Frage so, dass ich mich einerseits nicht fälschlicherweise als Rechtsmediziner ausgab, andererseits aber auch nicht ausdrücklich durchblicken ließ, dass ich keiner war.
Hallo allerseits. Wir haben hier in L.A. einen Mord mit atlantookzipitaler Dislokation – Opfer weiblich, 44 Jahre alt. Ist jemandem schon einmal eine AOD bei einem Mord untergekommen? Suche nach Ätiologie, Hilfsmittelspuren, Hautabschürfungen usw. Bin dankbar für jeden Hinweis. Hoffe, alle beim nächsten IAME-Kongress zu sehen. War bei keinem mehr, seit er hier in der Stadt der Engel war. Cheers @MELA
Die Verwendung von Fachjargon und Abkürzungen wie AOD für atlantookzipitale Dislokation sollten Fachkenntnis suggerieren. Der Hinweis auf die International Association of Medical Examiners war legitim, weil ich an dem Kongress teilgenommen hatte. Allerdings legte es Lesern meines Posts auch die Annahme nahe, dass ich Rechtsmediziner war. Ich wusste, dass das unter ethischen Gesichtspunkten fragwürdig war, andererseits tat ich es nicht in meiner Funktion als Journalist. Zumindest noch nicht. Ich trat als interessierte Partei auf. Die Cops hatten mich mehr oder weniger als Verdächtigen eingestuft. Sie hatten mich in meiner Wohnung aufgesucht, eine DNA-Probe genommen und meine Arme und meinen Oberkörper untersucht. Ich brauchte Informationen, und das war eine Möglichkeit, mir welche zu beschaffen. Mir war klar, dass es ein Schuss ins Blaue war, aber schaden konnte es sicher nicht.
Der nächste Punkt auf meiner Liste war Lisa Hill. Sie wurde in der Times-Meldung als enge Freundin Portreros bezeichnet. Bei ihr sattelte ich um – vom potenziellen Verdächtigen zum Journalisten. Die gängigen Versuche, an ihre Telefonnummer zu kommen, scheiterten, und ihr Facebook-Account – falls es überhaupt ihrer war – erwies sich als inaktiv. Also schickte ich ihr eine private Nachricht über Instagram.
Hi, ich bin Journalist und arbeite an einem Bericht über den Fall Tina Portrero. Ich habe Ihren Namen in der Times-Meldung gesehen. Mein aufrichtiges Beileid. Ich würde gern mit Ihnen reden. Wären Sie bereit, über Ihre Freundin zu sprechen?
Hill konnte mich zwar über die sozialen Medien erreichen, trotzdem fügte ich sicherheitshalber meinen Namen und meine Handynummer an. Wie bei der Nachricht auf dem IAME-Board hieß es jetzt erst einmal warten.
Bevor ich meine Bemühungen einstellte, ging ich noch einmal auf causesofdeath.net, um zu sehen, ob schon jemand auf meine Anfrage reagiert hatte. Das war nicht der Fall. Dann machte ich mich auf Google über Cyberstalking kundig. Das meiste, was ich dort fand, passte nicht zu dem, was Mattson erzählt hatte. Von Cyberstalking sprach man hauptsächlich bei Opfern, die von einer Person belästigt wurden, die sie zumindest oberflächlich kannten. Mattson hatte jedoch ausdrücklich gesagt, Tina Portrero habe einer Freundin – höchstwahrscheinlich Lisa Hill – erzählt, dass sie in einer Bar zufällig die Bekanntschaft eines Mannes gemacht hatte, der Dinge über sie zu wissen schien, die er nicht hätte wissen sollen.
Mit diesem Gedanken im Hinterkopf, machte ich mich daran, so viel wie möglich über Tina Portrero in Erfahrung zu bringen. Mir wurde schnell klar, dass ich dem geheimnisvollen Unbekannten, der ihr offensichtlich einen gehörigen Schrecken eingejagt hatte, möglicherweise bereits etwas voraus hatte. Als ich die gängigen Social-Media-Plattformen durchging, fiel mir ein, dass ich auf Facebook bereits mit ihr befreundet war und ihr auf Instagram folgte. Diese Verbindungen hatten wir an unserem gemeinsamen Abend ausgetauscht. Als es hinterher nicht zu einem zweiten Treffen kam, hatte keiner von uns sich die Mühe gemacht, den anderen zu entfreunden oder zu blockieren. Das war zugegebenermaßen reine Eitelkeit – jeder will seine Zahlen aufstocken statt sie schrumpfen zu lassen.
Auf Facebook war Tina nicht sonderlich aktiv gewesen und hatte es anscheinend hauptsächlich genutzt, um den Kontakt mit Familienangehörigen zu pflegen. Ich erinnerte mich, dass ihre Familie aus Chicago stammte. Über die letzten Jahre verstreut gab es mehrere Posts von Personen mit ihrem Nachnamen. Sie bestanden aus Routinenachrichten und Fotos. Ihr Feed enthielt außerdem mehrere Katzen- und Hundevideos.
Danach ging ich auf Instagram, wo Tina deutlich aktiver gewesen war. Dort hatte sie regelmäßig Fotos hochgeladen, auf denen sie allein oder mit Freunden bei allen möglichen Aktivitäten zu sehen war und in deren Bildunterschriften häufig die Aufnahmeorte und die abgebildeten Personen genannt waren. Ich scrollte mich durch die letzten Monate. Tina war einmal in Maui und zweimal in Las Vegas gewesen. Es gab Schnappschüsse von ihr mit allen möglichen Männern und Frauen, darunter viele Fotos aus Clubs und Bars und von privaten Partys. Aus den Aufnahmen wurde ersichtlich, dass Cosmo ihr Lieblingsgetränk war. Ich erinnerte mich, dass sie einen Cosmo in der Hand gehabt hatte, als sie sich an der Bar des Mistral zu mir gestellt hatte.
Obwohl ich wusste, dass sie tot war, wurde ich zugegebenermaßen neidisch, als ich mir die Fotos ihrer letzten Lebensmonate ansah und merkte, wie ausgefüllt und ereignisreich sie gewesen waren. Mein Leben war nicht annähernd so aufregend, und mich überkam eine gewisse Niedergeschlagenheit bei dem Gedanken an ihr Begräbnis, bei dem ihre Angehörigen und Freunde davon schwärmen würden, dass sie ihr Leben in vollen Zügen genossen hatte. Über mich würde das niemand sagen.
Ich versuchte, dieses Gefühl von Unzulänglichkeit abzuschütteln, und rief mir in Erinnerung, dass die sozialen Medien kein Abbild des wirklichen Lebens boten. Die Realität hinter der schönen Fassade sah oft ganz anders aus. Ich scrollte weiter. Der einzige Post von Interesse war ein vor vier Monaten aufgenommenes Foto von Tina und einer gleichaltrigen oder geringfügig älteren Frau. Sie hatten die Arme umeinander gelegt. In der Bildunterschrift hieß es: Endlich meine Halbschwester Taylor gefunden. Sie ist der Hammer!!!!!
Aus dem Post ging nicht hervor, ob Taylor eine Halbschwester war, die sie aus den Augen verloren hatte und deshalb hatte ausfindig machen müssen, oder ob Tina bis dahin nicht einmal von ihrer Existenz gewusst hatte. Unübersehbar war allerdings die auffallende Ähnlichkeit der beiden Frauen. Sie hatten die gleiche hohe Stirn und die gleichen hohen Wangenknochen, dunklen Augen und dunklen Haare.
Ich versuchte herauszufinden, ob es auf Facebook oder Instagram eine Taylor Portrero gab, landete aber keinen Treffer. Allem Anschein nach hatten Tina und Taylor, falls sie Halbschwestern waren, unterschiedliche Nachnamen.
Nach meinem Ausflug in die sozialen Medien schaltete ich ganz in den Reportermodus und hielt mithilfe verschiedener Suchmaschinen Ausschau nach anderen Informationen über Christina Portrero. Schon bald stieß ich auf die Seite von ihr, die sie in den sozialen Medien nicht zur Schau stellte. Einmal war sie wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden und einmal wegen Drogenbesitzes – und zwar von MDMA, besser bekannt als Ecstasy oder Molly, einer Partydroge mit stimmungsaufhellender Wirkung. Die Festnahmen zogen zwei gerichtlich angeordnete Einweisungen in Entzugsanstalten mit anschließenden Bewährungsauflagen nach sich, die sie, um die Vorstrafen aus ihrem Register getilgt zu bekommen, bis zum Ende durchzog. Beide Festnahmen waren vor mehr als fünf Jahren erfolgt.
Ich war noch immer mit meiner Suche beschäftigt, als mein Handy summte und das Display Nummer blockiert anzeigte.
Ich ging dran.
»Hier Lisa Hill.«
»Ah, gut. Danke, dass Sie anrufen.«
»Sie haben gesagt, Sie wollen einen Artikel schreiben. Für wen?«
»Also, ich arbeite für ein Onlineportal, das sich FairWarning nennt. Gut möglich, dass Sie schon von uns gehört haben. Unsere Meldungen werden nämlich oft von Zeitungen wie der Washington Post und der L.A. Times übernommen. Außerdem haben wir eine First-Look-Vereinbarung mit NBC News.«
Ich hörte sie auf einer Tastatur tippen. Vermutlich rief sie gerade die Website auf. Jedenfalls war sie nicht auf den Kopf gefallen und ließ sich nicht für dumm verkaufen. Darauf wurde es eine Weile still. Wahrscheinlich las sie die FairWarning-Homepage durch.
»Und da sind Sie drauf?«, fragte sie schließlich.
»Ja«, sagte ich. »Wenn Sie auf den Link in dem schwarzen Header MITARBEITER klicken, kommen Sie zu unseren Kurzbiographien. Ich bin der letzte. Der jüngste Neuzugang.«
Ich hörte das Klicken, während ich sie anleitete. Dann wurde es wieder still.
»Wie alt sind Sie?«, fragte sie. »Sie sehen älter aus als alle anderen. Bis auf den Inhaber.«
»Den Herausgeber, meinen Sie«, sagte ich. »Na ja, ich habe bei der L.A. Times mit ihm gearbeitet, und als er dann FairWarning gegründet hat, bin ich dazugestoßen.«
»Und Sie sind hier in L.A.?«
»Ja. Wir sind hier. In Studio City.«
»Aber wieso interessiert sich eine Verbraucherschutzseite für den Mord an Tina?«
Auf diese Frage war ich vorbereitet.
»In mein Ressort fällt auch Cybersicherheit«, sagte ich. »Deshalb habe ich beim LAPD verschiedene Quellen, die wissen, dass ich mich mit Cyberstalking befasse, weil das unter Verbraucherschutz fällt. So habe ich von Tina erfahren. Ich habe mit den zuständigen Ermittlern gesprochen – Mattson und Sakai –, und sie haben mir erzählt, dass sie Freunden gegenüber erwähnt hat, von einem Typ, den sie gerade kennengelernt hatte, im Internet gestalkt worden zu sein.«
»Und sie haben Ihnen meinen Namen genannt?«
»Nein. Den Namen eines Zeugen würden sie natürlich nie herausrücken. Ich …«
»Ich bin keine Zeugin. Ich habe nichts gesehen.«
»Sorry, so habe ich es nicht gemeint. Vom Standpunkt der Ermittler ist jeder, mit dem sie im Zuge ihrer Ermittlungen reden, ein Zeuge. Ich weiß, dass Sie nichts über den Fall als solchen wissen. Nein, Ihren Namen habe ich in der Times-Meldung gelesen und deshalb mit Ihnen Kontakt aufgenommen.«
Ich hörte sie erneut eine Weile tippen, bevor sie antwortete. Ich fragte mich, ob sie mich weiter überprüfte und eine Mail an Myron schrieb, der auf der Mitarbeiterliste von FairWarning ganz oben stand und als Gründer und geschäftsführender Leiter aufgeführt war.
»Haben Sie mal für einen Verein gearbeitet, der sich Velvet Coffin nennt?«, fragte sie schließlich.
»Ja, bevor ich zu FairWarning gestoßen bin«, sagte ich. »Wir haben investigativen Journalismus auf lokaler Ebene betrieben.«
»Hier steht, Sie waren dreiundsechzig Tage im Gefängnis.«
»Weil ich eine Quelle geschützt habe. Das FBI wollte ihren Namen wissen, aber ich habe ihn nicht rausgerückt.«
»Und dann?«
»Nach zwei Monaten hat sich die Quelle von selbst gemeldet, und weil das FBI bekam, was es wollte, wurde ich freigelassen.«
»Was wurde aus ihr?«
»Sie wurde gefeuert, weil sie Informationen an mich weitergegeben hat.«
»O Mann.«
»Ja. Dürfte ich Sie mal was fragen?«
»Ja.«
»Nur aus Neugier. Wie ist die Times auf Sie gekommen?«
»Ich war mal mit jemand zusammen, der für den Sportteil gearbeitet hat. Er hat in meinem Instagram-Account das Foto gesehen, das ich dort nach Tinas Tod gepostet habe. Und er hat dem zuständigen Reporter erzählt, dass er jemand kennt, der die Tote kennt.«
Manchmal war so ein Glücksfall nötig. Ich hatte im Lauf meiner Karriere mehr als ein paar davon gehabt.
»Verstehe«, sagte ich. »Aber jetzt meine Frage. Haben Sie den Ermittlern von dem Cyberstalking erzählt?«
»Sie wollten wissen, ob mir in letzter Zeit irgendwas Ungewöhnliches an ihr aufgefallen ist, und dazu ist mir eigentlich nur eingefallen, dass irgendein Arschloch, mit dem sie in einer Bar ins Gespräch gekommen ist, anscheinend zu viel über sie wusste. Das schien sie ziemlich beunruhigt zu haben.«
»Inwiefern hat er zu viel über sie gewusst?«
»Also, ausführlicher hat sie sich dazu nicht geäußert. Nur, dass sie diesen Typ in einer Bar kennengelernt hat und dass es eigentlich wie eine Zufallsbekanntschaft aussah, aber irgendwie geplant wirkte. Anscheinend haben sie zusammen was getrunken, und er hat Verschiedenes fallen lassen, aus dem für sie hervorging, dass er bereits wusste, wer sie war, und auch sonst alles Mögliche über sie wusste. Und das fand sie irgendwie so beängstigend, dass sie sich schleunigst aus dem Staub gemacht hat.«
Ich hatte Mühe, die verschiedenen Phasen der Geschichte nachzuvollziehen. Deshalb versuchte ich, sie in ihre einzelnen Bestandteile zu zerlegen.
»Okay, und wie hieß die Bar, in der sie sich kennengelernt haben?«, fragte ich.
»Keine Ahnung«, sagte Hill, »aber sie ging immer gern oben im Valley aus. Vor allem im Ventura Boulevard. Sie meinte, dort wären die Männer nicht so aufdringlich. Und mit ihrem Alter hatte es, glaube ich, auch was zu tun.«
»Inwiefern?«
»Sie wurde älter. Die Typen in den Clubs in Hollywood und West Hollywood, sie sind alle jünger und suchen entsprechend jüngere.«
»Schon klar. Haben Sie der Polizei erzählt, dass sie gern im Valley ausging?«
»Ja.«
Ich hatte Tina an der Bar eines Restaurants am Ventura Boulevard kennengelernt. Langsam konnte ich Mattsons und Sakais Interesse an mir verstehen.
»Sie hat nicht weit vom Sunset Strip gewohnt, oder?«, fragte ich.
»Ja«, sagte Hill. »Ein Stück den Hügel rauf. Nicht weit vom alten Spago’s.«
»Ist sie denn normalerweise über den Hügel ins Valley gefahren?«
»Nein, nie. Sie ist mal wegen Alkohols am Steuer verurteilt worden. Deshalb fuhr sie nie selbst, wenn sie ausging. Sie hat immer ein Uber oder Lyft genommen.«
Ich nahm an, dass sich Mattson und Sakai Tinas Uber- und Lyft-Unterlagen besorgt hatten. Damit konnten sie herausfinden, in welchen Bars sie gewesen war, und ihre sonstigen Aktivitäten rekonstruieren.
»Noch mal zurück zu dieser Stalking-Geschichte«, sagte ich. »Ist sie einfach in den Club gegangen und hat diesen Typ dort kennengelernt, oder hat sie sich vorher schon auf einer Dating-App mit ihm verabredet?«
»Nein, wenn sie wegging, wollte sie sich in erster Linie einen reinzwitschern und Musik hören und vielleicht einen Typ kennenlernen«, sagte Hill. »Und dann ist sie an der Bar mit diesem Typ ins Gespräch gekommen. Für sie war es reiner Zufall – oder zumindest sollte es wie einer aussehen.«
Was zwischen Tina und mir passiert war, war allem Anschein nach kein Einzelfall. Tina ging üblicherweise allein in Bars, um dort vielleicht jemanden kennenzulernen. Ich hatte keine altmodischen Vorstellungen von Frauen. Es stand ihnen frei, zu tun und zu lassen, was sie wollten, und ich war nicht der Ansicht, dass ein Opfer verantwortlich dafür war, was ihm zustieß. Aber neben den Festnahmen wegen Alkohols am Steuer und Drogenbesitzes hatte ich jetzt einen weiteren Hinweis, dass Tina durchaus risikobereit war. Bars aufzusuchen, wo die Männer weniger aufdringlich waren, ließ sich nicht unbedingt als Hang zur Vorsicht auslegen. Nicht einmal annähernd.
»Okay, sie kamen also in dieser Bar ins Gespräch miteinander und haben was zusammen getrunken«, sagte ich. »Und sie hatte diesen Mann nie zuvor gesehen?«
»Richtig«, sagte Hill.
»Hat sie Ihnen denn erzählt, was genau sie an dem Mann so unheimlich fand?«
»Eigentlich nicht. Sie hat nur gesagt: ›Er wusste alles über mich. Alles.‹ Als ob er scheinbar ganz beiläufig was fallen gelassen hätte, was er unmöglich wissen konnte.«
»Hat sie gesagt, ob er schon da war, als sie hinkam, oder ob er nach ihr kam?«
»Das hat sie nicht gesagt. Moment, ich bekommen gerade einen anderen Anruf.«
Sie wartete nicht auf meine Antwort. Sie schaltete auf den anderen Anruf, und ich dachte über den Vorfall in der Bar nach, während ich wartete. Als Hill zurückkam, waren ihr Ton und ihre Worte völlig anders. Sie waren schroff und wütend.
»Sie Schwein. Sie miese Drecksau. Sie sind dieser Typ.«
»Was? Wie …?«
»Das war gerade Detective Mattson. Ich habe ihm eine Mail geschickt. Er hat gesagt, Sie schreiben gar keine Zeitungsmeldung, und ich soll mich von Ihnen fernhalten. Sie kannten sie. Sie kannten Tina, und jetzt sind Sie ein Verdächtiger. Sie mieses Arschloch.«
»Halt, warten Sie. Ich bin kein Verdächtiger, und ich schreibe sehr wohl einen Artikel. Ja, ich habe mich mal mit Tina getroffen, aber ich bin nicht der Kerl aus …«
»Kommen Sie mir bloß nicht nahe!«
Sie legte auf.
»Scheiße!«
Ich fühlte mich, als hätte ich einen Schlag in die Magengrube bekommen. Mein Gesicht brannte vor Scham über meine billige Ausrede. Ich hatte Lisa Hill belogen. Ich wusste nicht einmal, warum. Oder was ich damit bezweckte. Der Besuch der Detectives hatte mich gewaltig aus der Bahn geworfen, und ich war mir selbst meiner Motive nicht mehr klar. Ging es dabei um Christina Portrero und mich oder um den Mordfall und den Bericht, den ich darüber vielleicht schreiben würde?
Das mit Christina war eine einmalige Angelegenheit gewesen. Sie hatte sich nach unserem gemeinsamen Abend ein Uber bestellt und war weggefahren. Ich hatte sie um ein weiteres Treffen gebeten. Das hatte sie abgelehnt.
»Ich glaube, du bist mir einfach zu langweilig«, hatte sie gesagt.
»Wie meinst du das?«, wollte ich wissen.
»Dass es mit uns nicht klappen würde.«
»Warum?«
»Das ist nichts gegen dich. Du bist nur nicht mein Typ. Heute Abend war klasse. Aber auf Dauer wäre das nichts mit uns.«
»Und wie müsste dein Typ sein?«
Eine richtig lahme Antwort. Sie lächelte bloß und sagte, ihr Wagen käme gerade. Sie ging zur Tür hinaus, und ich sah sie nie wieder.
Jetzt war sie tot, und das konnte ich nicht einfach auf sich beruhen lassen. Irgendwie hatte sich mein Leben geändert, seit mich die zwei Detectives in der Tiefgarage angesprochen hatten. Es schien aus den Fugen geraten, und ich hatte das Gefühl, dass mir jetzt nur noch eine Menge Ärger bevorstand. Aber ich witterte auch eine Story. Eine gute Story. Eine Story ganz nach meinem Geschmack.
Vor vier Jahren hatte ich wegen einer Story alles verloren. Meinen Job und die Frau, die ich liebte. Ich hatte es vermasselt. Ich hatte das Kostbarste, das ich hatte, vernachlässigt. Ich hatte mich und die Story über alles andere gestellt. Gewiss, ich hatte schwere Zeiten hinter mir gehabt. Ich hatte einmal einen Mann getötet und wäre selbst um ein Haar getötet worden. Ich war im Gefängnis gelandet, weil ich mich meiner Arbeit und meinen Prinzipien verpflichtet fühlte. Und weil ich in meinem tiefsten Innern gewusst hatte, dass sich die Frau opfern würde, um mich zu retten. Als alles aufflog, bestand meine selbst auferlegte Strafe darin, alles aufzugeben und eine vollkommen andere Richtung einzuschlagen. Früher hatte ich lange Zeit gesagt, der Tod sei mein Revier. Jetzt, nach dieser Geschichte mit Christina Portrero, war er es immer noch.
4
Myron wartete bereits auf mich, als ich am nächsten Morgen ins Büro kam. Die Redaktion, in der wir arbeiteten, war ein Großraumbüro ohne hierarchische Strukturen: eine Gruppe von identischen Abteilen. Alle, angefangen beim Chefredakteur bis herunter zum jüngsten Neuzugang (mich), hatten gleich viel Platz. Die Up-Light-Beleuchtung wurde von den Deckenpaneelen sanft auf unsere Schreibtische zurückgeworfen. Unsere Computer hatten Tastaturen mit SilentTouch-Technologie, und wenn nicht gerade jemand telefonierte, war es an manchen Tagen so still wie montags in einer Kirche; um niemanden zu stören, zog sich der Betreffende allerdings meistens ins Konferenzzimmer zurück. Es war nicht wie in den Redaktionen, in denen ich zu Beginn meiner Journalistenlaufbahn gearbeitet hatte und wo es einem schon das hektische Klicken der Tastaturen unmöglich machen konnte, sich auf die Arbeit zu konzentrieren.
Das Konferenzzimmer, von dem man durch ein Fenster in die Redaktion schauen konnte, wurde auch für interne Besprechungen und Gespräche mit Besuchern genutzt. Dorthin ging Myron jetzt mit mir und schloss die Tür hinter uns. Wir setzten uns an dem ovalen Tisch einander gegenüber. Myron legte einen Ausdruck, bei dem es sich vermutlich um meine »König der Schwindler«-Story handelte, auf den Tisch. Noch ganz von der alten Schule, redigierte er mit Rotstift auf Papier, um die Änderungen dann von unserer Büroassistentin Tally Galvin in die digitale Version übertragen zu lassen.
»Dann hat dir also meine Schlagzeile nicht gefallen«, sagte ich.
»Nein«, sagte Myron. »Die Schlagzeile muss zum Ausdruck bringen, was die Meldung für den Verbraucher bedeutet, und nicht, wie ihr Verfasser die darin dargestellte Persönlichkeit bewertet – ob diese nun gut oder böse, tragisch oder vorbildhaft ist. Aber das ist nicht, worüber ich mit dir sprechen möchte.«
»Worüber dann? Hat dir die ganze Story nicht gefallen?«