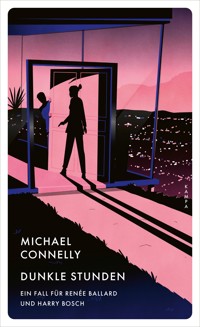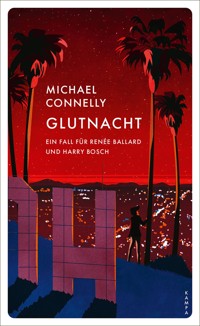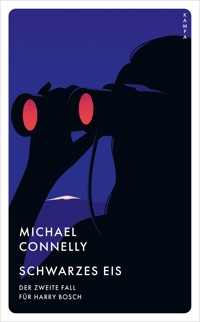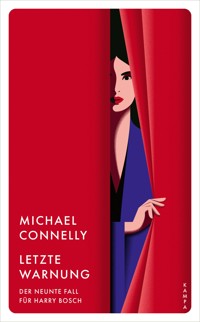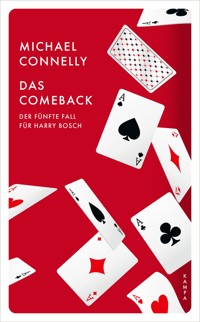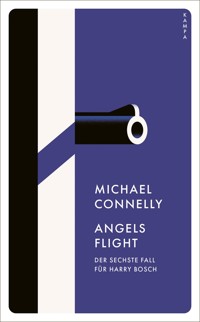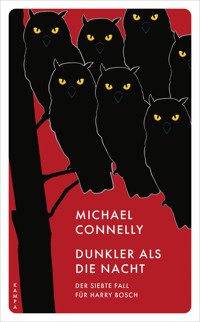
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Harry Bosch
- Sprache: Deutsch
Zwei spektakuläre Morde in Hollywood: Detective Harry Bosch muss als Hauptzeuge vor Gericht gegen David Storey aussagen. Der bekannte Regisseur, der sich mit Kinofilmen mit extremen Gewalt- und Sexdarstellungen einen Namen gemacht hat, soll eine junge Schauspielerin umgebracht haben. Das Interesse der Öffentlichkeit ist gewaltig. Zur selben Zeit wird Terry McCaleb, Ex-Cop und Spezialist für Serienmörder, in einem anderen Fall um Hilfe gebeten. Ein gewisser Edward Gunn wurde in einem Ritualmord getötet. Es stellt sich heraus: Zwischen den Verbrechen gibt es merkwürdige Parallelen. Und noch etwas wird sehr schnell klar: Harry Boschs und Terry McCalebs erster gemeinsamer Fall könnte beiden das Genick brechen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Connelly
Dunkler als die Nacht
Der siebte Fall für Harry Bosch
Aus dem amerikanischen Englisch von Sepp Leeb
Kampa
This is for Mary and Jack Lavelle,
who proved there are second acts
Vorspiel
Bosch blickte durch das kleine Quadrat aus Glas und sah, dass der Mann allein in der Zelle war. Er nahm seine Pistole aus dem Holster und reichte sie dem diensthabenden Sergeant. Standardvorgehen. Die Stahltür wurde aufgeschlossen und aufgeschoben. Sofort stach Bosch der Geruch von Schweiß und Erbrochenem in die Nase.
»Wie lang ist er schon da drinnen?«
»Ungefähr drei Stunden«, sagte der Sergeant.
Den Blick auf die am Boden liegende Gestalt gerichtet, betrat Bosch die Arrestzelle.
»Okay, Sie können abschließen.«
»Geben Sie mir einfach Bescheid.«
Mit einem durchdringenden Ruck und Knall wurde die Tür zugeschoben. Der Mann auf dem Boden stöhnte und bewegte sich ein wenig. Bosch ging zu der Bank direkt neben ihm und setzte sich. Er nahm das Tonbandgerät aus der Jackentasche und legte es auf die Bank. Er blickte zu dem Glasfenster in der Tür hoch und sah, wie das Gesicht des Sergeants verschwand. Er stieß dem Mann mit der Schuhspitze in die Seite. Der Mann stöhnte wieder.
»Wach schon auf, du Scheißhaufen.«
Der Mann auf dem Boden der Zelle drehte langsam den Kopf, dann hob er ihn. Seine Haare waren von Farbspritzern gesprenkelt, sein Hemd und sein Hals von Erbrochenem verklebt. Er öffnete die Augen, schloss sie aber wegen der grellen Deckenbeleuchtung der Arrestzelle sofort wieder. Seine Stimme war ein heiseres Flüstern.
»Sie schon wieder.«
Bosch nickte.
»Ja. Ich.«
»Unser kleiner Tanz.«
Die drei Tage alten Stoppeln im Gesicht des Betrunkenen durchschnitt ein Lächeln. Bosch sah, dass ihm ein Zahn fehlte, der ihm letztes Mal noch nicht gefehlt hatte. Er legte die Hand auf das Tonbandgerät, stellte es aber noch nicht an.
»Steh auf. Wir müssen reden.«
»Sie haben sie wohl nicht alle. Ich habe keine Lust …«
»Du hast nicht mehr viel Zeit. Sprich mit mir.«
»Lassen Sie mich in Ruhe, verdammte Scheiße noch mal.«
Bosch blickte zum Fenster hoch. Es war frei. Er sah wieder auf den Mann am Boden hinab.
»Dein Heil liegt in der Wahrheit. Jetzt mehr denn je. Ohne die Wahrheit kann ich dir nicht helfen.«
»Sind Sie jetzt plötzlich ’n Priester, oder was? Wollen Sie mir die Beichte abnehmen?«
»Willst du sie denn ablegen?«
Der Mann auf dem Boden sagte nichts. Nach einer Weile dachte Bosch, er wäre vielleicht wieder eingeschlafen. Wieder stieß er dem Mann die Schuhspitze in die Seite, in die Niere. Der Mann explodierte in Bewegung, schlug mit Armen und Beinen um sich.
»Leck mich!«, brüllte er. »Hau ab. Ich will einen Anwalt.«
Einen Moment blieb Bosch still. Er nahm das Tonbandgerät und steckte es in seine Tasche zurück. Dann beugte er sich vor, die Ellbogen auf den Knien, die Hände verschränkt. Er sah den Betrunkenen an und schüttelte langsam den Kopf.
»Dann kann ich dir wohl nicht helfen«, sagte er.
Er stand auf und sah durch das Fenster nach dem diensthabenden Sergeant. Er ließ den Mann auf dem Boden liegen.
1
»Wir kriegen Besuch.«
Terry McCaleb sah seine Frau an und folgte dann ihrem Blick auf die gewundene Straße hinab. Er konnte den Golfcart die steile, kurvenreiche Straße zum Haus heraufkommen sehen. Der Fahrer war durch das Dach des Gefährts verdeckt.
Sie saßen auf der hinteren Terrasse des Hauses, das er und Graciela in der La Mesa Avenue gemietet hatten. Die Aussicht reichte von der schmalen, kurvenreichen Straße unterhalb des Hauses bis nach Avalon und seinem Hafen und dann über die Santa Monica Bay hinaus zu der Smogschicht, die das Festland anzeigte. Diese Aussicht war der Grund dafür gewesen, dass sie sich bei ihrem Umzug auf die Insel für dieses Haus entschieden hatten. In dem Moment, in dem seine Frau sprach, hatte sein Blick jedoch auf dem Baby in ihren Armen geruht, nicht auf der Aussicht. Er konnte nicht weiter sehen als bis zu den großen blauen vertrauensvollen Augen seiner Tochter.
McCaleb sah die Mietnummer an der Seite des unter ihm vorbeifahrenden Golfcarts. Es war kein Einheimischer, der sie besuchen kam. Es war jemand, der wahrscheinlich mit der Catalina-Express-Fähre vom Festland gekommen war. Trotzdem fragte er sich, woher Graciela wusste, dass der Wagen zu ihrem Haus unterwegs war und nicht zu einem der anderen in der La Mesa.
Er fragte sie nicht danach – sie hatte schon öfter solche Vorahnungen gehabt. Er wartete bloß, und kurz nachdem der Golfcart verschwunden war, klopfte jemand an der Haustür. Graciela ging öffnen und kehrte wenig später mit einer Frau, die McCaleb drei Jahre nicht mehr gesehen hatte, auf die Terrasse zurück.
Sheriff’s Detective Jaye Winston lächelte, als sie das Kind in seinen Armen sah. Das Lächeln war aufrichtig, aber zugleich war es das zerstreute Lächeln von jemandem, der nicht gekommen war, um ein neugeborenes Baby zu bewundern. Der dicke grüne Ordner und die Videokassette, die sie bei sich hatte, konnten nur bedeuten, dass Winston in einer dienstlichen Angelegenheit hier war. In einer tödlichen dienstlichen Angelegenheit.
»Und, wie geht’s, Terry?«, fragte sie.
»Könnte nicht besser sein. Erinnern Sie sich noch an Graciela?«
»Aber natürlich. Und wer ist das da?«
»Das ist CiCi.«
In Anwesenheit anderer benutzte McCaleb nie den richtigen Namen seiner kleinen Tochter. Cielo nannte er sie nur, wenn er mit ihr allein war.
»CiCi«, sagte Winston und zögerte, als warte sie auf eine Erklärung des Namens. Als keine kam, fragte sie: »Wie alt?«
»Fast vier Monate. Sie ist sehr groß für ihr Alter.«
»Aber ja, klar, das sieht man … Und der Junge … wo ist er?«
»Raymond«, sagte Graciela. »Er ist mit Freunden unterwegs. Terry hatte einen Kunden, und deshalb ist er mit Freunden in den Park, Softball spielen.«
Die Unterhaltung war stockend und verkrampft. Entweder interessierte Winston das alles nicht wirklich oder sie war nicht an so banale Gespräche gewöhnt.
»Möchten Sie vielleicht was trinken?«, erkundigte sich McCaleb und reichte das Baby Graciela.
»Nein, danke. Ich habe auf der Fähre eine Cola getrunken.«
Wie auf ein Stichwort hin oder weil es sich ärgerte, von einem Händepaar zum nächsten weitergereicht zu werden, begann das Baby zu quengeln. Darauf sagte Graciela, sie würde es nach drinnen bringen, und ließ sie allein auf der Terrasse. McCaleb deutete auf den runden Tisch, an dem sie fast jeden Abend aßen, wenn das Baby schlief.
»Wollen Sie sich nicht setzen?«
Er bugsierte Winston auf den Stuhl zu, von dem man den besten Blick auf den Hafen hatte. Sie legte den grünen Ordner, in dem McCaleb sofort die Akte eines Mordfalls erkannte, auf den Tisch und das Video obendrauf.
»Schön«, sagte sie.
»Ja, sie ist unglaublich. Ich könnte sie den ganzen Tag …«
Er hielt lächelnd inne, als er merkte, dass sie das Panorama gemeint hatte, nicht seine Tochter. Auch Winston lächelte.
»Sie ist auch schön, Terry. Wirklich. Auch Sie sehen gut aus, so braun und überhaupt.«
»Ich fahre viel mit dem Boot raus.«
»Und gesundheitlich geht es Ihnen gut?«
»Nicht, dass ich klagen könnte, außer diesen Tabletten, die ich ständig nehmen muss. Aber die ganze Geschichte ist jetzt schon drei Jahre her und bisher ist alles glattgelaufen. Ich glaube, ich bin über den Berg, Jaye. Ich muss nur weiter diese blöden Pillen schlucken. Dann müsste es auch so bleiben.«
Er lächelte und er sah aus wie die Gesundheit in Person. Während die Sonne seine Haut dunkler gemacht hatte, hatte sie auf sein Haar die gegenteilige Wirkung gehabt. Ordentlich und kurz geschnitten, war es inzwischen fast blond. Durch die Arbeit auf dem Boot war auch seine Arm- und Schultermuskulatur ausgeprägter geworden. Das einzige verräterische Detail war unter seinem Hemd verborgen, die fünfundzwanzig Zentimeter lange Narbe, die von der Transplantation zurückgeblieben war.
»Das freut mich«, sagte Winston. »Wie es aussieht, haben Sie sich hier ja bestens eingerichtet. Neue Familie, neues Heim … weit weg von allem.«
Sie schwieg einen Moment, während sie den Kopf drehte, als wollte sie die ganze Aussicht und die Insel und McCalebs Leben gleichzeitig erfassen. McCaleb hatte Jaye Winstons jungenhafte Art schon immer attraktiv gefunden. Sie hatte loses rotblondes Haar, das sie schulterlang trug. Als er noch mit ihr zusammengearbeitet hatte, hatte sie sich nie geschminkt. Aber sie hatte durchdringende, wissende Augen und ein lockeres, aber etwas trauriges Lächeln, als sähe sie in allem Komik und Tragik gleichzeitig. Sie trug eine schwarze Jeans und einen schwarzen Blazer mit einem weißen T-Shirt darunter. Sie wirkte cool und abgebrüht, und McCaleb wusste, dass sie das auch war. Sie hatte die Angewohnheit, beim Sprechen immer wieder ihr Haar hinter die Ohren zu haken. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund fand er das anziehend. Er hatte immer gedacht, wenn er sich nicht mit Graciela zusammengetan hätte, hätte er vielleicht versucht, Jaye Winston näher kennenzulernen. Er spürte auch, dass Winston das intuitiv wusste.
»Da bekomme ich fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich an den Grund meines Besuchs denke«, sagte sie.
McCaleb deutete mit dem Kopf auf den Ordner und das Video.
»Sie sind dienstlich hier. Sie hätten auch anrufen können, Jaye. So hätten Sie sich wahrscheinlich etwas Zeit sparen können.«
»Nein. Sie haben keine Karten mit Ihrer neuen Adresse oder Telefonnummer verschickt. So, als wollten Sie nicht, dass jemand weiß, wo Sie stecken.«
Sie hakte ihr Haar hinter ihr linkes Ohr und lächelte wieder.
»Das war eigentlich nicht der Grund«, sagte er. »Ich dachte nur, es würde niemanden interessieren, wo ich abbleibe. Und wie haben Sie mich dann gefunden?«
»Ich habe im Jachthafen drüben auf dem Festland ein bisschen rumgefragt. In der Hafenmeisterei hat man mir gesagt, Sie hätten zwar noch einen Liegeplatz, aber das Boot hätten Sie hier drüben liegen. Ich bin mit der Fähre rübergekommen und ließ mich von einem Wassertaxi im Hafen rumfahren, bis ich es entdeckte. Ihr Freund war an Bord. Er hat mir erklärt, wie ich hierherkomme.«
»Buddy.«
McCaleb blickte auf den Hafen hinab und machte die Following Sea aus. Sie war ungefähr eine halbe Meile entfernt. Er konnte Buddy Lockridge vornübergebeugt im Heck stehen sehen. Nach wenigen Momenten wurde ihm klar, dass Buddy mit dem Schlauch vom Süßwassertank die Spulen abspritzte.
»Und worum geht es nun hier, Jaye?«, fragte McCaleb, ohne Winston anzusehen. »Muss ziemlich wichtig sein, dass Sie sich das alles an Ihrem freien Tag antun. Ich nehme mal an, Sie haben sonntags frei.«
»Meistens.«
Sie schob die Kassette beiseite und schlug den Ordner auf. Jetzt warf McCaleb einen Blick darauf. Obwohl für ihn alles auf dem Kopf stand, konnte er erkennen, dass das oberste Blatt ein Mordformular war, normalerweise die erste Seite in jeder Mordakte, die er bisher studiert hatte. Das war der Ausgangspunkt. Sein Blick wanderte zu dem Feld mit der Adresse. Selbst verkehrt herum konnte er erkennen, dass es ein West-Hollywood-Fall war.
»Ich habe hier einen Fall und … ich hätte gern, dass Sie mal einen Blick reinwerfen. In Ihrer Freizeit, natürlich. Ich denke, das könnte was für Sie sein. Vielleicht können Sie mir ja einen Tipp geben, mich auf eine Spur aufmerksam machen, der ich noch nicht gefolgt bin.«
Sobald er den Ordner in ihrer Hand gesehen hatte, hatte er gewusst, dass sie ihn um so etwas bitten würde. Doch nachdem sie ihre Bitte nun ausgesprochen hatte, löste sie einen Sturm sehr widersprüchlicher Gefühle in ihm aus. Die Aussicht, wieder in sein altes Leben einzutauchen, übte einen starken Reiz auf ihn aus. Gleichzeitig bekam er ein schlechtes Gewissen, dass er in ein Haus, das so voller neuem Leben und Glück war, den Tod brachte. Er spähte zu der offenen Schiebetür, um zu sehen, ob Graciela zu ihnen nach draußen blickte. Das tat sie nicht.
»Etwas für mich?«, fragte er. »Wenn es sich um einen Serienmord handelt, sollten Sie keine Zeit vergeuden. Gehen Sie zum FBI, verlangen Sie nach Maggie Griffin. Sie wird …«
»Das habe ich bereits alles getan, Terry. Trotzdem brauche ich Sie.«
»Wie weit liegt das alles schon zurück?«
»Zwei Wochen.«
Sie blickte vom Ordner zu ihm auf.
»An Neujahr?«
Sie nickte.
»Der erste Mord des Jahres«, sagte sie. »Zumindest in L.A. County. Es gibt Leute, die denken, das Jahrtausend beginnt erst dieses Jahr.«
»Glauben Sie, es ist so ein Millenniumsspinner?«
»Irgendeine Form von Spinner ist es auf jeden Fall. Glaube ich. Deshalb bin ich hier.«
»Was haben sie beim FBI gesagt? Waren Sie damit schon bei Maggie?«
»Sie sind nicht mehr auf dem Laufenden, Terry. Maggie wurde nach Quantico zurückversetzt. Die letzten Jahre war hier nicht mehr so wahnsinnig viel los. Deshalb hat das FBI die Verhaltensforschung zurückgezogen. In L.A. gibt es keine FBI-Außendienststelle mehr. Trotzdem, ich habe mit ihr gesprochen. Aber am Telefon. In Quantico. Sie hat alles in den Computer eingegeben, aber es kam nichts dabei heraus. Was ein Täterprofil oder sonstige Hilfen angeht, haben sie mich auf eine Warteliste gesetzt. Wussten Sie, dass es an Silvester und am Neujahrstag landesweit vierunddreißig Morde gab, die in Zusammenhang mit der Jahrtausendwende stehen? Deshalb haben sie im Moment alle Hände voll zu tun, und größere Polizei-Departments wie wir, die stehen im Moment ganz hinten in der Schlange, weil sie beim FBI denken, die kleineren Departments mit weniger Erfahrung und Know-how und Personal sind dringender auf ihre Hilfe angewiesen.«
Um McCaleb Zeit zum Nachdenken zu lassen, wartete sie einen Moment. Er konnte die Strategie des FBI verstehen. Es war eine Art Triage.
»Es macht mir nichts aus, einen Monat oder so zu warten, bis Maggie oder sonst wer mit irgendwas ankommt, nur sagt mir mein Riecher, dass bei diesem Fall die Zeit ein ganz wichtiger Faktor ist, Terry. Wenn es ein Serienmord ist, können wir es uns wahrscheinlich nicht erlauben, so lange zu warten. Deshalb bin ich schließlich auf Sie gekommen. Nachdem ich mir an dieser Nuss die Zähne ausgebissen habe, sind Sie vielleicht unsere letzte Hoffnung, noch einen Anhaltspunkt zu finden, der uns jetzt weiterbringen könnte. Ich kann mich noch gut an den Cemetery Man und den Code Killer erinnern. Ich weiß, was Sie aus einer Mordakte und einem Tatortvideo rausholen können.«
Die letzten paar Sätze waren überflüssig, fand McCaleb, und bisher ihr einziger falscher Schachzug. Ansonsten nahm er ihr ab, dass sie aufrichtig davon überzeugt war, der Mörder, nach dem sie suchte, könnte wieder zuschlagen.
»Für mich liegt das alles aber schon ganz schön lange zurück«, begann McCaleb. »Abgesehen von der Geschichte mit Gracielas Schwester habe ich schon …«
»Jetzt hören Sie mal, Terry, das glauben Sie doch selbst nicht. Auch wenn Sie hier noch so lange mit einem Baby im Schoß rumsitzen, ändert das nichts an dem, was Sie mal gewesen sind und was Sie mal gemacht haben. Ich kenne Sie. Wir haben uns zwar lange nicht mehr gesehen oder miteinander gesprochen, aber ich kenne Sie. Und ich weiß, es vergeht nicht ein Tag, an dem Sie nicht über irgendwelche Fälle nachdenken. Nicht ein Tag.«
Sie hielt inne und sah ihn an.
»Als sie Ihnen das Herz rausgenommen haben, haben sie Ihnen keineswegs auch das rausgenommen, was Sie so und nicht anders ticken lässt, wenn Sie wissen, was ich meine.«
McCaleb sah von ihr weg und wieder zu seinem Boot hinunter. Inzwischen saß Buddy, die Füße auf das Heckwerk gelegt, im Angelstuhl. McCaleb nahm an, er hatte ein Bier in der Hand, aber um das erkennen zu können, war er zu weit weg.
»Wenn Sie so gut wissen, was in anderen vorgeht, was brauchen Sie mich dann noch?«
»Ich mag ja in so was ganz gut sein, aber Sie sind der Beste, den ich kenne. Mein Gott, selbst wenn sie in Quantico nicht schon bis Ostern ausgebucht wären, würde ich lieber Sie nehmen als einen von den Profilern dort. Das ist mein voller Ernst. Sie waren …«
»Okay, Jaye, sparen Sie sich diese Masche, ja? Ich komme auch so ganz gut klar, ohne …«
»Was wollen Sie dann?«
Er sah sie an.
»Nur ein bisschen Zeit. Ich möchte in Ruhe darüber nachdenken.«
»Ich bin hier, weil mir mein Gefühl sagt, dass ich nicht viel Zeit habe.«
McCaleb stand auf und stellte sich ans Geländer. Sein Blick war aufs Meer hinaus gerichtet. Eine Catalina-Express-Fähre lief gerade ein. Er wusste, sie war fast leer. In den Wintermonaten kamen wenig Gäste.
»Da kommt gerade eine Fähre an«, sagte er. »Sie fährt jetzt nach dem Winterfahrplan, Jaye. Sehen Sie lieber zu, dass Sie sie auf der Rückfahrt erwischen, sonst sitzen Sie hier die ganze Nacht lang fest.«
»Wenn es sein muss, kann ich mich von der Zentrale mit einem Hubschrauber abholen lassen. Terry, alles, was ich von Ihnen verlange, ist allerhöchstens ein Tag. Vielleicht auch nur ein Abend. Heute Abend. Sie setzen sich hin, lesen die Akte, sehen sich das Video an, und dann rufen Sie mich morgen früh an und sagen mir, was Sie gesehen haben. Vielleicht ist es ja nichts oder zumindest nichts Neues. Aber vielleicht ist es auch was, das wir übersehen haben, oder Sie haben eine Idee, die uns noch nicht gekommen ist. Das ist alles, worum ich Sie bitte. Ich finde nicht, dass das zu viel verlangt ist.«
McCaleb sah von der einlaufenden Fähre weg und drehte sich um, sodass er mit dem Rücken am Geländer lehnte.
»Ihnen erscheint es vielleicht nicht viel. Schließlich befassen Sie sich ständig mit so was. Aber ich nicht. Ich habe damit nichts mehr am Hut, Jaye. Selbst wenn ich mich nur für einen Tag wieder auf so etwas einlasse, ändert das einiges. Ich bin hierhergezogen, um noch mal ganz von vorn anzufangen und diesen ganzen Kram, in dem ich mal gut war, zu vergessen. Um auf einem anderen Gebiet gut zu sein. Zum Beispiel als Vater und Ehemann.«
Winston stand auf und trat ans Geländer. Sie stellte sich neben ihn, betrachtete aber die Aussicht, während er seinem Zuhause zugewandt stand. Sie sprach ganz leise. Falls Graciela im Haus mithörte, konnte sie nichts verstehen.
»Wissen Sie noch, was Sie mir bei Gracielas Schwester gesagt haben? Sie haben gesagt, Sie hätten eine zweite Chance im Leben bekommen und dafür müsste es einen Grund geben. Jetzt haben Sie mit ihrer Schwester und ihrem Sohn und inzwischen sogar Ihrem eigenen Kind ein neues Leben angefangen. Das ist eine tolle Sache, Terry, finde ich wirklich. Aber trotzdem kann das nicht der Grund gewesen sein, nach dem Sie gesucht haben. Vielleicht denken Sie, er ist es, aber er ist es nicht. Wenn Sie ganz ehrlich sind, wissen Sie das auch. Sie waren gut darin, diese Leute zu fangen. Was ist im Vergleich dazu schon Fische fangen?«
McCaleb nickte kaum merklich und hatte kein gutes Gefühl dabei, dass er es so bereitwillig tat.
»Lassen Sie mir die Sachen da«, sagte er schließlich. »Ich rufe Sie an.«
Auf dem Weg zur Tür hielt Winston nach Graciela Ausschau, sah sie aber nirgendwo.
»Wahrscheinlich hat sie sich mit der Kleinen zurückgezogen«, sagte McCaleb.
»Dann grüßen Sie sie schön von mir.«
»Mache ich.«
Auf dem Rest des Wegs zur Tür herrschte verlegenes Schweigen zwischen ihnen. Erst als McCaleb sie öffnete, sagte Winston: »Und wie ist es, Terry? Vater zu sein?«
»Manchmal absolut unvergleichlich, manchmal zum Verzweifeln.«
Seine Standardantwort. Dann dachte er kurz nach und fügte etwas hinzu, was er schon ab und zu gedacht, aber nie gesagt hatte, nicht einmal zu Graciela.
»Es ist, als hielte einem ständig jemand eine Pistole an den Kopf.«
Winston sah ihn verdutzt und vielleicht sogar ein bisschen besorgt an.
»Wie das?«
»Weil ich weiß, wenn ihr irgendetwas zustößt, egal was, dann ist mein Leben zu Ende.«
Sie nickte.
»Ich glaube, das kann ich verstehen.«
Sie ging durch die Tür. Sie sah ziemlich albern aus, als sie wegfuhr. Eine mit allen Wassern gewaschene Ermittlerin des Morddezernats in einem Golfcart.
2
Das sonntägliche Abendessen mit Graciela und Raymond war eine stille Angelegenheit. Sie aßen weißen Seebarsch, den McCaleb am Vormittag während einer Chartertour auf der Rückseite der Insel in der Nähe der Landenge gefangen hatte. Seine Charterkunden wollten die Fische, die sie fingen, immer behalten, überlegten es sich aber oft anders, wenn sie in den Hafen zurückkehrten. Es hatte etwas mit dem Tötungstrieb bei Männern zu tun, glaubte McCaleb. Es genügte ihnen nicht, ihre Beute bloß zu fangen. Sie mussten sie auch töten. Das hieß, dass es in dem Haus in der La Mesa zum Abendessen oft Fisch gab.
McCaleb hatte den Fisch zusammen mit ein paar Maiskolben, noch in der Hülse, auf der Veranda gegrillt. Graciela hatte Salat und Brötchen gemacht. Beide hatten ein Glas Weißwein vor sich stehen, Raymond ein Glas Milch. Das Essen war gut, aber das Schweigen nicht. McCaleb sah zu Raymond hinüber und merkte, er hatte mitbekommen, was zwischen den Erwachsenen lief, und sich davon anstecken lassen. McCaleb erinnerte sich, dass es ihm als kleinem Jungen genauso gegangen war, wenn sich seine Eltern gegenseitig mit Schweigen beworfen hatten. Raymond war der Sohn von Gracielas Schwester Gloria. Seinen Vater hatte der Junge nie kennengelernt. Als Glory vor drei Jahren starb – ermordet wurde –, hatte Graciela Raymond zu sich genommen. McCaleb hatte sie beide kennengelernt, als er Ermittlungen zu dem Fall anstellte.
»Wie war’s beim Softball heute?«, fragte McCaleb schließlich.
»Ganz okay.«
»Hast du mal getroffen?«
»Nein.«
»Keine Sorge, das wird schon noch. Du darfst nur nicht aufgeben. Du musst es nur immer wieder versuchen.«
McCaleb nickte. Der Junge hatte am Morgen mit aufs Boot kommen wollen, hatte aber nicht gedurft. Die Tour war für sechs Männer vom Festland. Mit McCaleb und Buddy waren das acht Mann an Bord der Following Sea, und mehr durften nach den Sicherheitsbestimmungen nicht aufs Boot. McCaleb verstieß nie gegen diese Bestimmungen.
»Also, das nächste Mal fahren wir erst am Samstag wieder raus. Im Moment sind nur vier Leute für die Tour angemeldet. Wegen der Wintersaison bezweifle ich, dass noch jemand dazustößt. Wenn es so bleibt, kannst du mitkommen.«
Das dunkle Gesicht des Jungen schien sich aufzuhellen, und mit einem energischen Nicken bohrte er seine Gabel in das reinweiße Fleisch des Fisches auf seinem Teller. Die Gabel sah groß aus in seiner Hand, und McCaleb empfand flüchtige Traurigkeit wegen des Jungen. Raymond war für einen Zehnjährigen auffallend klein. Das machte ihm schwer zu schaffen und er fragte McCaleb oft, wann er endlich wachsen würde. McCaleb versicherte ihm dann immer, dass es bald so weit wäre, aber insgeheim dachte er, der Junge würde immer klein bleiben. Er wusste, dass seine Mutter durchschnittlich groß gewesen war, aber sein Vater, hatte ihm Graciela erzählt, war sehr klein gewesen – was seine Körpergröße und sein menschliches Format anging. Er hatte sich vor Raymonds Geburt aus dem Staub gemacht.
Da er zu klein war, um beim Sport mit den anderen Jungen in seinem Alter mithalten zu können, und immer als Letzter gewählt wurde, zog es Raymond zu anderen Formen des Zeitvertreibs hin als zu Mannschaftssportarten. Seine große Leidenschaft war Angeln und an seinen freien Tagen nahm ihn McCaleb gewöhnlich mit in die Bucht hinaus, um Heilbutt zu fangen. Wenn er eine Chartertour machte, bettelte der Junge immer, mitgenommen zu werden, und wenn genug Platz war, durfte er als zweiter Maat mitkommen. Es war McCaleb immer eine besondere Freude, einen Fünfdollarschein in einen Umschlag zu stecken, ihn zu verschließen und ihn am Ende des Tages dem Jungen zu geben.
»Wir werden dich im Ausguck brauchen«, sagte McCaleb. »Diese Leute wollen nach Süden, Marlins fangen. Das wird ein langer Tag.«
»Stark!«
McCaleb lächelte. Raymond machte gern den Ausguck. Er hielt dann mit dem Fernglas Ausschau nach schwarzen Marlins, die an der Oberfläche schliefen oder sich drehten. Das konnte er inzwischen ziemlich gut. McCaleb sah zu Graciela hinüber, um sich mit ihr zu freuen, aber sie hielt den Blick auf ihren Teller gesenkt. Auf ihren Lippen lag kein Lächeln.
Ein paar Minuten später war Raymond mit dem Essen fertig und fragte, ob er aufstehen und in seinem Zimmer Computer spielen dürfe. Graciela bat ihn, den Ton leise zu stellen, damit das Baby nicht wach wurde. Der Junge trug seinen Teller in die Küche und dann waren Graciela und McCaleb allein.
Er verstand, warum sie so still war. Sie wusste, sie konnte ihn schlecht daran hindern, sich an einem Ermittlungsverfahren zu beteiligen, denn vor drei Jahren hatte er auf ihre Bitten hin Ermittlungen zum Tod ihrer Schwester angestellt, was schließlich dazu geführt hatte, dass sie ein Paar geworden waren. In dieser ironischen Verquickung waren ihre Gedanken gefangen.
»Graciela«, begann McCaleb. »Ich weiß, du willst nicht, dass ich es mache, aber …«
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Musstest du ja auch nicht. Ich kenne dich. Und das Gesicht, das du machst, seit Jaye hier war, gibt mir deutlich zu verstehen, dass …«
»Ich will nur nicht, dass alles anders wird. Mehr nicht.«
»Das kann ich verstehen. Ich will ja auch nicht, dass etwas anders wird. Und es wird auch nichts anders werden. Alles, was ich machen werde, ist, mir eine Akte und ein Video ansehen und ihr sagen, was ich davon halte.«
»Dabei wird es nicht bleiben. Ich kenne dich doch auch. Ich habe dich so was schon machen sehen. Du wirst dich in die Sache verbeißen. Das ist doch der Grund, warum du so gut in so was bist.«
»Ich werde mich nicht festbeißen. Ich werde nur tun, worum sie mich gebeten hat, und damit hat es sich. Ich werde es nicht mal hier machen. Ich werde mit dem, was sie mir gegeben hat, aufs Boot gehen. Es wird also nicht mal im Haus sein. Einverstanden? Ich will es nicht im Haus haben.«
Er wusste, er würde es auch ohne ihr Einverständnis tun, aber trotzdem war er darauf bedacht, es von ihr zu erhalten. Ihre Beziehung war noch so neu, dass er bei allem ihre Zustimmung zu suchen schien. Darüber hatte er schon des Öfteren nachgedacht, und am Ende war es jedes Mal auf dieselbe Frage hinausgelaufen: ob es etwas damit zu tun hatte, dass es sich hier um seine zweite Chance handelte. Er hatte in den vergangenen drei Jahren eine Menge Schuldgefühle abgearbeitet, aber trotzdem tauchte dieser Punkt alle paar Kilometer wie eine Straßensperre wieder vor ihm auf. Irgendwie hatte er das Gefühl, solange er für seine Existenz nur die Zustimmung dieser einen Frau gewinnen könnte, wäre alles in Ordnung. Seine Kardiologin hatte es das schlechte Gewissen der Überlebenden genannt. Er war noch am Leben, weil ein anderer Mensch gestorben war, und brauchte deshalb das Gefühl, seine Schuld irgendwie begleichen zu können. Aber McCaleb fand, ganz so einfach war die Sache nicht.
Graciela runzelte die Stirn, aber ihrer Schönheit tat das in seinen Augen keinen Abbruch. Ihre Haut hatte einen warmen Bronzeton und ihr dunkelbraunes Haar umrahmte ein Gesicht mit Augen von einem so dunklen Braun, dass Iris und Pupille fast nahtlos ineinander überzugehen schienen. Ihre Schönheit war ein weiterer Grund, weshalb er bei allem ihre Zustimmung suchte. Das Strahlen ihres Lächelns hatte etwas Läuterndes, wenn es auf ihn fiel.
»Terry, ich habe euch beiden auf der Terrasse zugehört. Nachdem sich die Kleine beruhigt hatte. Ich habe gehört, was sie gesagt hat: Was dich so und nicht anders ticken lässt, und dass kein Tag vergeht, an dem du nicht daran denkst, was du mal gemacht hast. Sag mir nur eins: Stimmt das?«
Einen Moment schwieg McCaleb. Er blickte auf seinen leeren Teller und dann über den Hafen hinweg zu den Lichtern der Häuser, die sich den gegenüberliegenden Hügel zu dem Gasthaus auf dem Gipfel des Mount Ada hinaufzogen. Er nickte langsam und sah dann wieder sie an.
»Ja, es stimmt.«
»Dann ist also alles, was wir hier tun, das Baby, dann ist das alles eine Lüge?«
»Nein. Natürlich nicht. Das hier bedeutet mir alles, und ich würde mit allem, was ich habe, dafür kämpfen, es zu erhalten. Aber die Antwort ist: Ja, ich denke an das, was ich war und was ich getan habe. Als ich beim FBI war, habe ich Leben gerettet, Graciela, so einfach ist das. Und ich habe Böses aus dieser Welt entfernt, ich habe dazu beigetragen, dass es da draußen etwas weniger dunkel wurde.«
Er hob die Hand und deutete auf den Hafen.
»Jetzt habe ich mit dir und Cielo und Raymond ein wunderschönes Leben. Und ich … ich fange für reiche Leute, die mit ihrem Geld nichts Besseres anzufangen wissen, Fische.«
»Demnach willst du also beides.«
»Ich weiß nicht, was ich will. Aber ich weiß, dass ich, als Jaye Winston hier war, bestimmte Dinge nur gesagt habe, weil ich wusste, dass du zuhörst. Ich sagte Dinge, von denen ich dachte, dass du sie hören wolltest, aber in Wirklichkeit wusste ich ganz genau, dass das nicht war, was ich wollte. Was ich wollte, war, diese Akte auf der Stelle aufzuschlagen und mich an die Arbeit zu machen. Sie hatte, was mich angeht, vollkommen recht, Gracie. Sie hat mich drei Jahre nicht mehr gesehen, aber sie hat mich durchschaut.«
Graciela stand auf und ging um den Tisch herum zu ihm. Sie setzte sich in seinen Schoß.
»Ich habe nur Angst um dich, mehr nicht«, sagte sie.
Sie zog ihn an sich.
McCaleb nahm zwei hohe Gläser aus dem Küchenschrank und stellte sie auf die Theke. Das erste füllte er mit Wasser aus einer Flasche, das zweite mit Orangensaft. Dann begann er die siebenundzwanzig Tabletten einzunehmen, die er auf der Theke aufgereiht hatte. Um sie besser hinunterzubekommen, nahm er zwischendurch immer wieder einen Schluck Wasser oder Orangensaft. Die Tabletten zu schlucken, zweimal am Tag, war sein Ritual, und er fand es fürchterlich. Nicht wegen des Geschmacks – der machte ihm nach drei Jahren längst nichts mehr aus –, sondern weil ihn das Ritual daran erinnerte, wie sehr sein Leben von äußeren Dingen abhängig war. Die Tabletten waren eine Art Leine. Ohne sie konnte er nicht lang überleben. Im Moment ging es in seinem Leben in ganz erheblichem Umfang darum, dafür zu sorgen, dass er sie immer zur Verfügung hatte. Seine ganze Organisation drehte sich um sie. Er hortete sie. Manchmal träumte er sogar, dass er Tabletten nahm.
Als er fertig war, ging er ins Wohnzimmer, wo Graciela eine Zeitschrift las. Sie sah nicht zu ihm auf, als er den Raum betrat, ein weiteres Zeichen dafür, dass sie alles andere als froh war über das, was plötzlich in ihrem Heim geschah. Einen Augenblick stand er nur da und wartete, und als sie keine Reaktion zeigte, ging er den Flur hinunter zum Zimmer des Babys.
Cielo schlief in ihrem Kinderbett. Mit dem Dimmer drehte er die Deckenlampe gerade so hell, dass er sie deutlich sehen konnte. Er ging zum Bett und beugte sich darüber, um sie sehen und atmen hören und ihren Babygeruch riechen zu können. Mit ihrer dunklen Haut und dem dunklen Haar schlug Cielo ganz nach ihrer Mutter – nur ihre Augen waren meerblau. Ihre winzigen Hände waren zu Fäusten geballt, als wollte sie ihre Bereitschaft demonstrieren, ums Leben zu kämpfen. Am meisten hingerissen von ihr war McCaleb, wenn er sie im Schlaf beobachtete. Er dachte an all die Vorbereitungen, die sie getroffen hatten, an die Bücher und Kurse und an die guten Ratschläge von Gracielas Freundinnen aus dem Krankenhaus, die Kinderkrankenschwestern waren. Und das alles zu dem Zweck, für ein zerbrechliches Leben sorgen zu können, das so sehr von ihnen abhängig war. Nichts war gesagt oder geschrieben worden, um ihn auf das Gegenteil vorzubereiten, auf die Einsicht, die ihm in dem Moment gekommen war, in dem er sie zum ersten Mal in den Händen gehalten hatte: dass sein Leben von jetzt an von ihrem abhing.
Er legte seine Hand auf ihren Rücken. Sie rührte sich nicht. Er konnte ihr winziges Herz schlagen spüren. Es schien hastig und verzweifelt, wie ein geflüstertes Gebet. Manchmal zog er sich den Schaukelstuhl heran und wachte bis spät in die Nacht hinein an ihrem Bett. In dieser Nacht war es anders. Er musste gehen. Auf ihn wartete Arbeit. Blutarbeit. Er war nicht sicher, ob er nur hier war, um sich einfach für die Nacht zu verabschieden, oder ob er auch Inspiration oder Zustimmung von ihr suchte. Rational betrachtet ergab das keinen rechten Sinn. Er wusste nur, dass er sie ansehen und berühren musste, bevor er sich an die Arbeit machte.
McCaleb ging auf den Pier hinaus und dann die Stufen zum Anleger für die Beiboote hinunter. Er fand sein Zodiac unter den anderen kleinen Booten und kletterte hinein. Damit sie nicht nass wurden, verstaute er die Mordakte und die Videokassette unter dem Spritzdeck im Bug des Schlauchboots. Er zog zweimal am Starterseil, bevor der Motor ansprang, und nahm dann das mittlere Fahrwasser des Hafens. Im Avalon Harbor gab es keine Kais. Die Boote waren an Bojen vertäut, deren Reihen der konkaven Rundung des natürlichen Hafens folgten. Weil es Winter war, lagen nur wenige Boote im Hafen, aber McCaleb fuhr trotzdem nicht zwischen den Bojen hindurch. Er folgte den Fahrrinnen, etwa so, wie man mit dem Auto durch eine Wohngegend fährt. Da blieb man auch auf der Straße und nahm nicht einfach eine Abkürzung quer durch die Vorgärten.
Auf dem Wasser war es kalt und McCaleb zog den Reißverschluss seiner Windjacke hoch. Als er sich der Following Sea näherte, konnte er durch die Vorhänge der Kajüte das Flackern des Fernsehers sehen. Das hieß, Buddy Lockridge war nicht rechtzeitig fertig geworden, um die letzte Fähre zu erwischen, und blieb über Nacht.
McCaleb und Lockridge betrieben die Charterfirma gemeinsam. Während das Boot auf Gracielas Namen eingetragen war, liefen die Charterlizenz und alle anderen Firmendokumente auf Lockridges Namen. Die beiden hatten sich vor mehr als drei Jahren kennengelernt, als McCaleb die Following Sea in der Cabrillo Marina im Los Angeles Harbor liegen gehabt und in der Zeit, in der er sie von Grund auf restaurierte, an Bord gewohnt hatte. Buddy war ein Nachbar gewesen, der auf einem Segelboot in der Nähe lebte. Sie hatten Freundschaft geschlossen, und schließlich war auch eine Geschäftspartnerschaft daraus geworden.
Im Frühling und im Sommer, wenn viel los war, blieb Lockridge die meisten Nächte auf der Following Sea. Aber in geschäftlich ruhigeren Zeiten nahm er normalerweise die Fähre zurück aufs Festland, um auf seinem eigenen Boot in Cabrillo zu schlafen. In den Festlandbars schien er mehr Erfolg auf der Suche nach weiblicher Gesellschaft zu haben als in den paar Kneipen, die es auf der Insel gab. McCaleb nahm an, er würde am Morgen zurückfahren, da sie für die nächsten fünf Tage keine Tour hatten.
McCaleb rumpelte mit dem Zodiac gegen das Heck der Following Sea. Er machte den Motor aus und stieg mit dem Video und dem Ordner an Bord. Nachdem er das Schlauchboot an einer Heckklampe vertäut hatte, steuerte er auf die Kajütentür zu. Buddy, der das Zodiac entweder gehört oder gegen das Heck stoßen gespürt hatte, wartete dort bereits auf ihn. Er schob die Tür auf. In der linken Hand hatte er ein Taschenbuch. McCaleb warf einen Blick auf den Fernseher, konnte aber nicht erkennen, was lief.
»Was gibt’s, Terror?«, fragte Lockridge.
»Nichts. Ich muss nur ein bisschen arbeiten. Ich nehme die Bugkabine, okay?«
Er trat in die Kajüte. Es war warm. Lockridge hatte das Heizgerät angemacht.
»Klar, kein Problem. Kann ich dir was helfen?«
»Nein, es ist nichts Geschäftliches.«
»Hat es was mit der Frau zu tun, die heute hier war? Die Frau aus dem Sheriff’s Department?«
McCaleb hatte vergessen, dass Jaye Winston zuerst auf dem Boot gewesen war und sich von Buddy den Weg hatte zeigen lassen.
»Ja.«
»Übernimmst du einen Fall für sie?«
»Nein«, sagte McCaleb rasch, in der Hoffnung, Lockridges Interesse und Einbeziehung zu begrenzen. »Ich soll mir nur ein paar Sachen ansehen und mich dann bei ihr melden.«
»Ist ja stark, Mann.«
»Alles halb so wild. Ich tue ihr nur einen Gefallen. Was siehst du da gerade?«
»Ach, irgendeinen Mist im Fernsehen. Eine Sendung über diese Sondereinheit, die hinter Hackern her ist. Wieso, hast du sie schon mal gesehen?«
»Nein, aber ich dachte bloß, ob ich den Fernseher vielleicht eine Weile ausleihen könnte.«
McCaleb hielt die Videokassette hoch. Lockridges Augen leuchteten auf.
»Jederzeit. Schieb das Ding gleich mal rein.«
»Äh, nicht hier oben, Buddy. Das ist … Detective Winston hat mich gebeten, diese Sache vertraulich zu behandeln. Ich bringe den Fernseher zurück, sobald ich fertig bin.«
Lockridges Miene spiegelte seine Enttäuschung wider, aber McCaleb machte sich deswegen keine Gedanken. Er ging zu der Theke, die die Kombüse von der Kajüte trennte, und legte den Ordner und das Video darauf. Dann steckte er den Fernseher aus und hob ihn aus der Halterung, die verhindern sollte, dass er bei rauer See herunterfiel. Der Fernseher hatte einen eingebauten Videorekorder und war schwer. McCaleb hievte ihn die schmale Treppe hinunter und trug ihn in die Bugkabine, die zum Teil in ein Büro umfunktioniert worden war. Zwei Seiten des Raums wurden von jeweils zwei Kojen eingenommen. In der linken unteren Koje befand sich ein Schreibtisch und in den beiden oberen Kojen lagerte McCaleb die Ordner mit seinen alten FBI-Fällen. Graciela wollte sie nicht im Haus haben, damit Raymond sie dort nicht einmal zufällig entdeckte. Das einzige Problem war, dass McCaleb sicher war, dass Buddy mal in die Schachteln gesehen und einen Blick in die Akten geworfen hatte. Und das störte ihn. Er empfand es als Verletzung der Privatsphäre. McCaleb hatte überlegt, ob er die Bugkabine abschließen sollte, aber ihm war auch bewusst, dass sich das als ein tödlicher Fehler erweisen könnte. Die einzige Deckenluke auf dem Unterdeck war in der Bugkabine, und der Zugang zu ihr sollte nicht versperrt sein, falls sich einmal die Notwendigkeit einer Evakuierung durch das Vorschiff ergeben sollte.
Er stellte den Fernseher auf den Schreibtisch und steckte ihn ein. Als er sich umdrehte, um in die Kajüte zurückzugehen und den Ordner und das Video zu holen, sah er Buddy die Treppe herunterkommen. Er hielt das Video und blätterte in dem Ordner.
»Hey, Buddy …«
»Macht ’nen ziemlich abgedrehten Eindruck, Mann.«
McCaleb streckte die Hand nach dem Ordner aus und klappte ihn zu, dann nahm er ihn seinem Partner zusammen mit der Videokassette aus der Hand.
»Hab nur einen kurzen Blick reingeworfen.«
»Habe ich nicht gesagt, die Sache ist vertraulich?«
»Schon, aber wir sind ein gutes Team. Wie damals.«
Das stimmte. Wie es der Zufall wollte, war Lockridge eine große Hilfe gewesen, als McCaleb zum Tod von Gracielas Schwester Ermittlungen angestellt hatte. Aber das waren richtige Ermittlungen gewesen. Hier handelte es sich nur um eine nochmalige Überprüfung. Dabei konnte er niemanden brauchen, der ihm über die Schulter schaute.
»Das hier ist was anderes, Buddy. Nur was für eine Nacht. Ich werde mir das Material kurz ansehen, und damit hat es sich dann. Und jetzt halte mich nicht länger von der Arbeit ab, damit ich nicht die ganze Nacht hier rumhänge.«
Lockridge sagte nichts und McCaleb wartete nicht. Er schloss die Tür und wandte sich dem Schreibtisch zu. Als er auf die Mordakte in seinen Händen hinabblickte, spürte er einen starken Kitzel und das vertraute Aufsteigen von Angst und schlechtem Gewissen.
McCaleb wusste, es war Zeit, in die Dunkelheit zurückzukehren. Sie zu erforschen und kennenzulernen. Seinen Weg durch sie hindurchzufinden. Obwohl er inzwischen allein war, nickte er – zum Zeichen dafür, dass er lange auf diesen Augenblick gewartet hatte.
3
Das Video war scharf und verwacklungsfrei, die Beleuchtung gut. In technischer Hinsicht waren die Videoaufnahmen von Tatorten seit der Zeit, als McCaleb noch beim FBI gewesen war, wesentlich besser geworden. Am Inhalt hatte sich nichts geändert. Auf dem Video, das sich McCaleb ansah, war der grell ausgeleuchtete Schauplatz eines Mordes zu sehen. Schließlich hielt McCaleb das Bild an und studierte es. In der Kabine herrschte Stille und das leise Plätschern des Meerwassers gegen den Bootsrumpf war die einzige Störung von außen.
In der Bildmitte war die nackte Leiche einer mit Draht gefesselten Person zu sehen, bei der es sich um einen Mann zu handeln schien. Seine Arme und Beine waren so extrem nach hinten gebunden, dass sein Körper eine Art umgekehrter Embryonalstellung einzunehmen schien. Der Tote lag mit dem Gesicht nach unten auf einem schmutzigen alten Teppich. Der Bildausschnitt war zu klein, um erkennen zu können, in welcher Art von Umgebung die Leiche gefunden worden war. Dass das Opfer ein Mann war, schloss McCaleb einzig aus seiner Muskulatur und seiner kräftigen Statur. Sein Kopf war nämlich nicht zu sehen. Es war ein grauer Putzeimer darübergestülpt. McCaleb konnte erkennen, dass der Draht, mit dem der Mann gefesselt war, von den Fußgelenken zwischen den Armen hindurch straff den Rücken hinauf und unter den Eimer führte, wo er sich um den Hals schlang. Auf den ersten Blick sah das Ganze nach einer Schnürstrangulation aus, bei der die Hebelwirkung von Beinen und Füßen den Draht immer fester um den Hals des Opfers zusammenzog und ihm so die Luft abschnürte. Letztendlich war das Opfer so gefesselt worden, dass es sich selbst erdrosselte, sobald es seine nach hinten gebogenen Beine nicht mehr länger in dieser extremen Position halten konnte.
McCaleb fuhr mit der Inspizierung des Tatorts fort. Aus dem Eimer war etwas Blut auf den Teppich gesickert, was auf eine Kopfverletzung hindeutete.
McCaleb lehnte sich in seinen alten Schreibtischstuhl zurück und dachte über seine ersten spontanen Eindrücke nach. Den Ordner hatte er noch nicht aufgeschlagen, weil er sich zuerst das Tatortvideo ansehen und den Schauplatz des Verbrechens möglichst genau so studieren wollte, wie ihn die Ermittler ursprünglich vorgefunden hatten. Schon jetzt war er fasziniert von dem, was er sich ansah. Er spürte in der Szene auf dem Bildschirm Andeutungen eines Rituals. Außerdem spürte er wieder das Prickeln von Adrenalin in seinem Blut. Er drückte auf die Fernbedienung und das Video lief weiter.
Der Bildausschnitt wurde größer und Jaye Winston kam ins Bild. Jetzt konnte McCaleb mehr vom Raum sehen. Anscheinend handelte es sich um ein Zimmer eines kleinen, spärlich möblierten Hauses oder Apartments.
Zufällig trug Winston dieselben Sachen, in denen sie mit der Mordakte und dem Video zu ihm nach Hause gekommen war. Sie hatte Gummihandschuhe an, die sie über die Manschetten ihres Blazers gezogen hatte. Ihr Detective-Abzeichen hing an einem schwarzen Schnürsenkel, den sie sich um den Hals gebunden hatte. Sie ging auf die linke Seite des Toten, während sich ihr Partner, ein Detective, den McCaleb nicht kannte, auf dessen rechter Seite postierte. Jetzt wurde auf dem Video zum ersten Mal gesprochen.
»Das Opfer wurde bereits von einem Deputy Coroner untersucht und für die Tatortuntersuchung freigegeben«, sagte Winston. »Das Opfer wurde in situ fotografiert. Wir werden jetzt den Eimer entfernen, um mit den Untersuchungen fortzufahren.«
McCaleb wusste, sie achtete deshalb so genau auf ihre Wortwahl und ihr Verhalten, weil sie bereits an die Zukunft dachte, eine Zukunft, zu der ein Mordprozess gehörte, bei dem sich die Geschworenen das Video vom Tatort ansehen würden. Sie musste einen professionellen, vollkommen objektiven Eindruck erwecken und emotional völlig unberührt von dem erscheinen, was sie vor sich hatte. Alles, was davon abwich, konnte ein Verteidiger zum Anlass nehmen, das Video vor Gericht nicht als Beweisstück zuzulassen.
Winston hob eine Hand, um sich das Haar hinter die Ohren zu stecken. Dann legte sie beide Hände auf die Schultern des Opfers und drehte die Leiche mithilfe ihres Partners so auf die Seite, dass der Rücken des Toten der Kamera zugewandt war.
Dann ging die Kamera näher heran. Sie bewegte sich über die Schulter des Opfers und verharrte erst wieder, als Winston den Griff des Eimers unter dem Kinn des Toten hervorzog und dann den Eimer behutsam von seinem Kopf hob.
»Okay«, sagte sie.
Sie zeigte der Kamera das Innere des Eimers – es war gestocktes Blut darin – und legte ihn dann in eine offene Schachtel, die zur Aufbewahrung von Beweisstücken diente. Dann wandte sie sich wieder dem Opfer zu.
Um den Kopf des Toten waren auf Mundhöhe mehrere Lagen graues Klebeband gewickelt, die als Knebel dienten. Die offenen, stark vergrößerten Augen traten weit aus den Höhlen. Beide Hornhäute waren von einer Blutung gerötet. Ebenso wie die Haut um die Augen.
»KP«, sagte Winstons Partner und deutete auf die Augen.
»Kurt«, sagte Winston. »Der Ton ist an.«
»Entschuldigung.«
Sie gab ihrem Partner zu verstehen, alle Beobachtungen für sich zu behalten. Auch hier dachte sie wieder an die Zukunft. McCaleb wusste, dass ihr Partner sie auf die konjunktivalen Petechien aufmerksam gemacht hatte, die mit jeder Schnürstrangulation einherging. Allerdings handelte es sich dabei um ein Detail, auf das die Geschworenen von einem Gerichtsmediziner, nicht von einem Detective aufmerksam gemacht werden sollten.
Das mittellange Haar des Toten war mit Blut verklebt und an seiner linken Gesichtshälfte hatte sich im Eimer eine kleine Lache gebildet. Winston begann, den Kopf zu betasten und auf der Suche nach der Herkunft des Bluts mit den Fingern durch das Haar zu streichen. Schließlich fand sie die Stelle. Um sie sich anzusehen, zog sie das Haar so weit wie möglich zurück.
»Gehen Sie noch näher ran, Barney, wenn es geht«, sagte sie.
Die Kamera kam näher heran. McCaleb sah eine kleine runde Punktur, die jedoch die Schädeldecke nicht zu durchdringen schien. Er wusste, dass die Blutmenge nicht immer der Schwere einer Verletzung entsprach. Selbst bei kleinen, harmlosen Verletzungen der Kopfhaut konnte eine Menge Blut austreten. Eine vollständige formelle Beschreibung der Wunde würde er im Obduktionsbefund finden.
»Barn, nehmen Sie das auf«, sagte Winston, ihre Stimme eine Spur höher als ihre bisherige monotone Leier. »Da ist was auf das Klebeband beziehungsweise den Knebel geschrieben.«
Sie hatte es entdeckt, als sie den Kopf untersucht hatte. Die Kamera fuhr näher ran. Da, wo das Klebeband über den Mund des Toten ging, konnte McCaleb ganz schwach ein paar Buchstaben darauf erkennen. Sie schienen mit Tinte geschrieben, aber der restliche Text war vom Blut unkenntlich gemacht worden. Er konnte nur ein Wort der Nachricht erkennen.
»Cave«, las er laut, das englische Wort für Höhle. »Cave?«
Dann kam ihm der Gedanke, dass es sich vielleicht nur um einen Teil eines Worts handelte. Aber außer cavern, das ebenfalls Höhle bedeutet, fiel ihm kein längeres Wort ein, das diese Buchstaben in dieser Reihenfolge enthielt.
McCaleb hielt das Bild an und starrte wie gebannt auf den Bildschirm. Was er da vor sich sah, versetzte ihn in die Zeit zurück, als er noch als Profiler gearbeitet hatte, als ihn fast jeder Fall, den er zugeteilt bekam, vor dieselbe Frage gestellt hatte: Was für einem finsteren, gequälten Hirn ist das entsprungen?
Wörter von einem Mörder waren immer bedeutsam und stellten einen Fall auf eine höhere Ebene. In den meisten Fällen bedeutete es, dass der Mord ein Statement war, eine Botschaft, die vom Mörder an das Opfer übermittelt wurde und dann von den Ermittlern an die Welt.
Er stand auf, nahm einen der alten Aktenbehälter aus der oberen Koje und ließ ihn schwer auf den Boden plumpsen. Dann entfernte er rasch den Deckel und begann die Ordner nach einem Notizbuch mit ein paar unbeschriebenen Seiten zu durchforsten. Beim FBI war es McCalebs Ritual gewesen, jeden neuen Fall mit einem frischen Spiralnotizbuch zu beginnen. Nach einer Weile stieß er auf einen Ordner, in dem sich nur ein BAR-Formular und ein Notizbuch befanden. Aus dem geringen Umfang der Akte schloss er, dass es ein kurzer Fall war. Das Notizbuch musste also noch jede Menge leere Seiten enthalten.
Er blätterte das Notizbuch durch und stellte fest, dass es so gut wie unbenutzt war. Dann nahm er das Bureau-Assistance-Request-Formular heraus, mit dem eine Polizeidienststelle die Unterstützung des FBI beantragt hatte, und überflog kurz die erste Seite, um zu sehen, um welchen Fall es sich handelte. Obwohl das Ganze fast zehn Jahre zurücklag – er hatte damals noch von Quantico aus operiert –, konnte er sich sofort an den Fall erinnern, weil er ihn mit einem einzigen Anruf gelöst hatte. Der Antrag war von einem Detective aus White Elk, Minnesota, gestellt worden. Seinem beigefügten Bericht zufolge waren zwei Männer, die gemeinsam ein Haus bewohnten, im Suff in Streit geraten; sie hatten sich gegenseitig zum Duell herausgefordert und sich schließlich im Garten des Hauses mit zwei aus zehn Metern Entfernung gleichzeitig abgefeuerten Schüssen getötet. Was die beiden Tötungsdelikte anging, brauchte der Detective keine Hilfe, denn hier war der Fall sonnenklar. Aber es gab da ein Detail, das er sich nicht erklären konnte. Bei der Durchsuchung des Hauses der Opfer hatten die Ermittler in der Kühltruhe im Keller eine seltsame Entdeckung gemacht. In eine Ecke der Kühltruhe waren mehrere Plastiktüten mit jeder Menge benutzter Tampons unterschiedlicher Marken und Größen gestopft. Erste Blutanalysen hatten ergeben, dass das Menstruationsblut auf ihnen von lauter verschiedenen Frauen stammte.
Der für den Fall zuständige Detective konnte sich keinen Reim auf das Ganze machen, befürchtete aber das Schlimmste. Was er sich also von der Abteilung Verhaltensforschung des FBI erhoffte, war ein Hinweis, was die blutigen Tampons bedeuten könnten und wie er weiter vorgehen sollte. Oder genauer, er wollte wissen, ob die Tampons möglicherweise Andenken von einem oder zwei Serienmördern waren, denen niemand auf die Spur gekommen war, bis sie sich gegenseitig umgebracht hatten.
McCaleb musste grinsen, als er an den Fall zurückdachte. Es war nicht das erste Mal gewesen, dass er mit Tampons in einer Kühltruhe zu tun gehabt hatte. Er rief den Detective an und stellte ihm drei Fragen. Was waren diese Männer von Beruf? Waren außer den Schusswaffen, die bei dem Duell zum Einsatz kamen, irgendwelche Langwaffen oder ein Jagdschein in ihrem Haus gefunden worden? Und schließlich, wann war in den Wäldern von Northern Minnesota die Schonzeit für Bären zu Ende?
Die Antworten des Detective lösten das Tamponrätsel rasch. Beide Männer hatten am Flughafen von Minneapolis für einen Subunternehmer gearbeitet, der Reinigungstrupps für Verkehrsmaschinen zur Verfügung stellte. Im Haus wurden mehrere Jagdgewehre gefunden, aber kein Jagdschein. Und schließlich, die Bärenjagd begann in drei Wochen.
McCaleb sagte dem Detective, dass die beiden Männer aller Wahrscheinlichkeit nach keine Serienmörder seien, sondern die benutzten Tampons vermutlich aus den eigens dafür gedachten Abfallbehältern in den Toiletten der Flugzeuge hätten, die sie sauber machten. Sie hätten die Tampons nach Hause mitgenommen und dort eingefroren, um sie, wenn die Schonzeit zu Ende wäre, aufzutauen und dazu zu benutzen, Bären anzulocken, die den Geruch von Blut aus großer Entfernung riechen könnten. Die meisten Jäger benutzten als Köder Küchenabfälle, aber Blut sei mit Abstand am besten.
McCalebs Erinnerung nach war der Detective merklich enttäuscht gewesen, dass er es nicht mit einem oder zwei Serienmördern zu tun hatte. Entweder hatte er sich geschämt, dass ein FBI-Agent das Rätsel von seinem Schreibtisch in Quantico aus so schnell gelöst hatte, oder es hatte ihn einfach geärgert, dass sein Fall nicht landesweit für Aufsehen sorgte. Er hatte abrupt aufgehängt und McCaleb hatte nie mehr etwas von ihm gehört.
McCaleb riss die wenigen Seiten mit Notizen zu dem Fall aus dem Notizbuch, legte sie in den Ordner mit dem BAR-Formular und stellte den Ordner an seinen Platz zurück. Dann packte er den Deckel wieder auf die Schachtel und wuchtete sie in die obere Koje hoch. Er schob sie nach hinten und sie schlug laut gegen das Schott.
Mit einem kurzen Blick auf das angehaltene Bild auf dem Fernsehschirm setzte McCaleb sich wieder und starrte lange auf die leere Seite des Notizbuchs. Schließlich nahm er den Stift aus seiner Hemdtasche und wollte gerade zu schreiben beginnen, als die Tür aufging. Es war Buddy Lockridge.
»Ist irgendwas?«
»Wieso?«
»Da hat grade was ziemlich gescheppert. Das ganze Boot hat zu schaukeln begonnen.«
»Nein, nein, alles okay, Buddy. Ich habe bloß …«
»O Mann, was ist das denn?«
Er starrte auf den Bildschirm. McCaleb hob sofort die Fernbedienung und ließ das Bild verschwinden.
»Hör zu, Buddy, ich hab dir doch gesagt, das Ganze ist vertraulich, und ich kann …«
»Ist ja schon gut, ich weiß. Wollte ja nur nachsehen, ob du nicht umgekippt bist oder was.«
»Na schön, danke, aber mir fehlt nichts.«
»Ich werde mich noch nicht so bald hinhauen, falls du irgendwas brauchst.«
»Werde ich zwar nicht, aber trotzdem danke.«
»Du weißt ja, du brauchst eine Menge Strom. Da wirst du morgen den Generator anmachen müssen, wenn ich weg bin.«
»Mach ich. Kein Problem. Bis dann, Buddy.«
Buddy deutete auf den inzwischen leeren Bildschirm.
»Ganz schön verrückt.«
»Wiedersehen, Buddy«, sagte McCaleb ungeduldig.
Weil Lockridge immer noch nicht ging, stand er auf und machte die Tür zu. Diesmal schloss er sie ab. Er kehrte zu seinem Platz und dem Notizbuch zurück. Er begann zu schreiben, und nach Kurzem hatte er eine Liste zusammengestellt.
TATORT
1. Schlinge
2. Nackt
3. Kopfwunde
4. Klebeband/Knebel – »Cave?«
5. Eimer?
Er studierte die Liste eine Weile und wartete auf eine Idee, aber ihm kam keine. Es war noch zu früh. Sein Gefühl sagte ihm, dass die Wörter auf dem Klebeband ein Schlüssel waren, der sich erst im Schloss drehen ließe, wenn er den vollständigen Text hatte. Er kämpfte gegen den Drang an, die Mordakte aufzuschlagen und dort nachzusehen. Stattdessen machte er den Fernseher wieder an und spielte das Video von der Stelle, an der er es angehalten hatte, weiter ab. Die Kamera war jetzt ganz nahe rangegangen, direkt auf den Mund des Toten und das Klebeband, das sich straff darüber spannte.
»Das überlassen wir dem Coroner«, sagte Winston. »Haben Sie alles, was Sie davon draufbekommen können, Barn?«
»Ja«, sagte der unsichtbare Kameramann.
»Okay, dann fahren wir wieder zurück und sehen uns die Fesselungen an.«
Die Kamera folgte dem Draht vom Hals zu den Füßen. Der Draht schlang sich um den Hals und lief durch einen Slipstek. Dann führte er die Wirbelsäule entlang zu den Fußgelenken hinab, um die er mehrere Male geschlungen war und die so weit nach hinten gezogen waren, dass die Fersen des Opfers auf sein Gesäß zu liegen kamen.
Die Handgelenke waren mit einem separaten Stück Draht gefesselt, das sechsmal um sie geschlungen und dann verknotet worden war. Die Schlingen hatten tiefe Einkerbungen in der Haut der Hand- und Fußgelenke hinterlassen und deuteten darauf hin, dass sich das Opfer eine Weile zur Wehr gesetzt hatte, bevor es sich schließlich in das Unvermeidliche fügte.
Als die videografische Erfassung der Leiche abgeschlossen war, wies Winston den unsichtbaren Kameramann an, eine Videobestandsaufnahme jedes Zimmers der Wohnung zu machen.
Die Kamera schwenkte von der Leiche weg und erfasste den Rest des Wohn- und Essbereichs. Die Wohnung schien mit Möbeln aus einem Secondhandladen eingerichtet. Es gab keine einheitliche Linie, nichts passte zusammen. So, wie die wenigen gerahmten Bilder an den Wänden aussahen, hätten sie aus dem Zimmer eines Howard Johnson’s vor zehn Jahren stammen können – lauter orangefarbene und blaugrüne Pastellzeichnungen. An der Rückwand des Raums stand ein hoher Geschirrschrank, in dem sich jedoch kein Geschirr befand. Auf einigen Borden waren ein paar Bücher, aber die meisten waren leer. Oben auf dem Geschirrschrank stand etwas, das McCaleb eigenartig fand. Eine sechzig Zentimeter hohe, offensichtlich handbemalte Eule. McCaleb hatte schon viele solcher Vögel gesehen, vor allem im Avalon Harbor und in der Cabrillo Marina. Meistens waren diese Eulen aus Plastik und innen hohl. Sie waren an Mastspitzen oder an den Brücken von Motorbooten angebracht und sollten, was ihnen freilich selten gelang, Möwen und andere Vögel von den Booten fernhalten. Dem lag der Gedanke zugrunde, die anderen Vögel würden sich, weil sie die Eule für einen Raubvogel hielten, nicht in ihre Nähe wagen und daher die Boote nicht mit ihren Ausscheidungen verunreinigen.
Auch an den Fassaden öffentlicher Gebäude, die von Tauben heimgesucht wurden, waren McCaleb diese Eulen schon aufgefallen. Allerdings hatte er noch nie gesehen oder gehört, dass ein solcher Vogel zur Zierde oder aus sonst einem Grund in einer Wohnung aufgestellt wurde. Er wusste, es gab Leute, die alles Mögliche sammelten, Eulen eingeschlossen, aber er hatte in der Wohnung bisher außer der Plastikeule auf dem Geschirrschrank noch keine andere entdeckt. Rasch schlug er den Ordner auf und suchte nach den Personalien des Opfers. Der Beruf des Ermordeten war mit Anstreicher angegeben. McCaleb schloss den Ordner, und einen Augenblick lang dachte er, das Opfer könnte die Eule von einer Arbeitsstelle mitgenommen oder von einem Gebäude entfernt haben, das er für einen Anstrich vorbereitet hatte.
McCaleb spulte das Band zurück und sah sich noch einmal an, wie die Kamera von der Leiche zum Geschirrschrank schwenkte, auf dem die Eule hockte. Es schien McCaleb, dass der Kameramann dabei eine 180-Grad-Drehung vollführte. Demzufolge musste die Eule direkt auf das Opfer hinabgeblickt haben.
Auch wenn es andere Möglichkeiten gab, hatte McCaleb das untrügliche Gefühl, dass die Plastikeule irgendwie ein Bestandteil der Mordszenerie war. Er griff nach seinem Notizbuch und trug die Eule als sechsten Punkt in die Liste ein.
Die restlichen Videoaufnahmen vom Tatort enthielten nichts, was McCalebs Interesse weckte. Sie dokumentierten die übrigen Räume der Wohnung des Opfers – Schlafzimmer, Bad und Küche. Er entdeckte keine weiteren Eulen und machte sich keine weiteren Notizen. Als das Band zu Ende war, spulte er es zurück und sah es sich noch einmal von vorn an. Nichts Neues erregte seine Aufmerksamkeit. Er nahm die Kassette heraus und steckte sie in ihre Papphülle zurück. Dann trug er den Fernseher wieder in die Kajüte hinauf und stellte ihn in die Halterung auf der Theke.
Buddy lag lesend auf der Couch. Er sagte nichts, und McCaleb merkte, er war beleidigt, weil er die Bürotür abgeschlossen hatte. Er überlegte, ob er sich entschuldigen sollte, tat es aber nicht. Buddy war zu neugierig, und zwar was seine Vergangenheit und seine Gegenwart anging. Vielleicht machte ihm das diese Zurückweisung deutlich.
»Was liest du da gerade?«, fragte er stattdessen.
»Ein Buch«, antwortete Lockridge, ohne aufzusehen.
McCaleb schmunzelte. Jetzt war er sicher, dass es bei Buddy angekommen war.
»Hier hast du den Fernseher wieder, falls du die Nachrichten oder sonst was sehen möchtest.«
»Die Nachrichten sind vorbei.«
McCaleb sah auf die Uhr. Es war Mitternacht. Er hatte nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergangen war. Das war ihm oft so gegangen. Wenn er sich in seiner Zeit beim FBI mal voll in einen Fall reingehängt hatte, hatte er oft die Mittagspause durch oder bis spät in die Nacht hinein gearbeitet, ohne sich dessen bewusst zu werden.
Er ließ Buddy weiter schmollen und kehrte in sein Büro zurück. Wieder machte er – laut – die Tür zu und schloss sie von innen ab.
4
Nachdem er zu einer neuen Seite seines Notizbuchs weitergeblättert hatte, schlug er die Mordakte auf. Er ließ die Ringe aufschnappen, nahm die Dokumente heraus und schichtete sie ordentlich auf dem Schreibtisch auf. Das war eine Marotte von ihm, aber es gefiel ihm nicht, einen Fall so zu studieren, als blätterte er in den Seiten eines Buches. Es gefiel ihm, die einzelnen Berichte in den Händen zu halten. Es gefiel ihm, die Kanten des ganzen Stapels ordentlich auszurichten. Er legte den Ordner beiseite und begann die Ermittlungsresümees in chronologischer Reihenfolge aufmerksam durchzulesen. Bald war er ganz in die Akten vertieft.
Der Mord war am Mittag des ersten Januar, einem Montag, in der West Hollywood Station des Los Angeles County Sheriff’s Department gemeldet worden. Der anonyme Anrufer sagte, in Wohnung 2B der Grand Royale Apartments in der Sweetzer Avenue auf Höhe der Melrose Avenue sei ein Toter. Danach hängte der Mann auf, ohne seinen Namen zu nennen oder sonst noch etwas zu sagen. Weil der Anruf nicht auf einer Notrufleitung einging, wurde er nicht aufgezeichnet. Ebenso wenig war es möglich, mittels einer Fangschaltung seine Herkunft festzustellen.
Die zwei Deputys, die zu der Wohnung geschickt wurden, fanden die Tür angelehnt vor. Nachdem sich auf ihr Klopfen und ihre Rufe niemand meldete, betraten sie die Wohnung und stellten rasch fest, dass die Angaben des anonymen Anrufers stimmten. In der Wohnung war ein toter Mann. Die Deputys verließen die Wohnung und verständigten das Morddezernat. Der Fall wurde Jaye Winston und Kurt Mintz zugeteilt. Die Leitung der Ermittlungen hatte Winston.
Das Opfer wurde in den Untersuchungsberichten als der vierundvierzigjährige Anstreicher Edward Gunn identifiziert. Er hatte neun Jahre allein in der Wohnung in der Sweetzer Avenue gelebt.
Eine Computerüberprüfung auf Vorstrafen oder aktenkundige Straftaten hin ergab, dass Gunn wegen einer ganzen Reihe von geringfügigen Vergehen vorbestraft war. Diese reichten von Ansprechen von Prostituierten und Herumtreiberei bis zu wiederholten Festnahmen wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit und am Steuer. Allein in den drei Monaten vor seinem Tod war Gunn zweimal wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden, unter anderem auch am Vormittag des 31. Dezember. Er wurde gegen Kaution wieder freigelassen. Keine vierundzwanzig Stunden später war er tot. Die Kartei enthielt auch eine Festnahme wegen eines Kapitalverbrechens, die jedoch zu keiner Verurteilung geführt hatte. Gunn war sechs Jahre vor seinem Tod vom Los Angeles Police Department wegen Mordes festgenommen und vernommen worden. Er wurde jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt, ohne dass Anklage gegen ihn erhoben wurde.
Laut den Ermittlungsberichten, die Winston und ihr Partner in die Mordakte aufgenommen hatten, gab es keine Hinweise darauf, dass irgendwelche Gegenstände