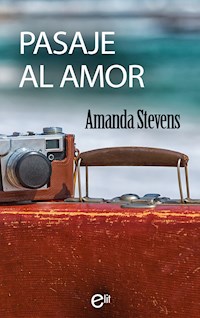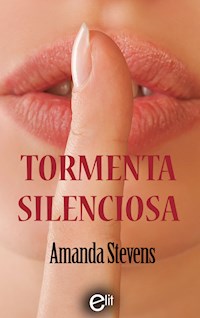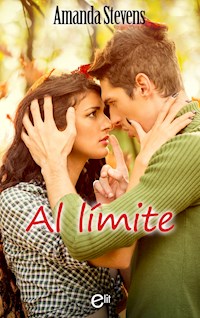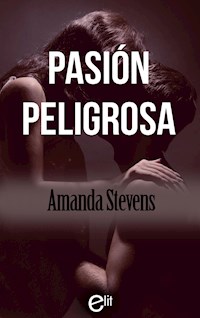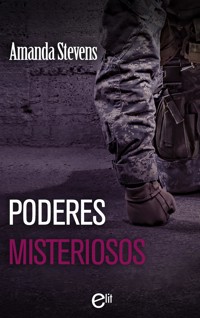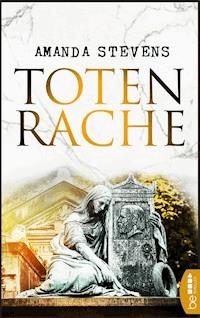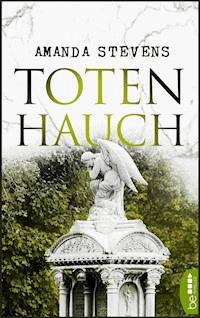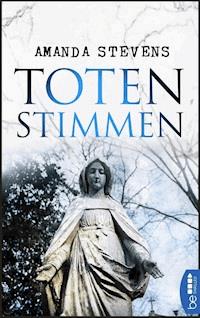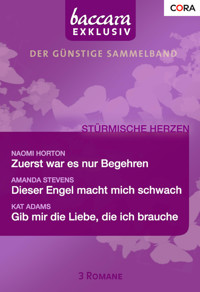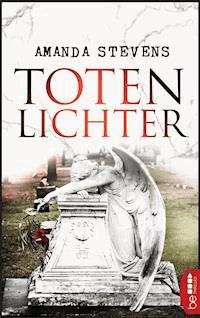
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Graveyard-Queen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Amelia Gray lebt mit den Toten. Sie restauriert Friedhöfe, und es heißt, sie habe einen Sinn für diese besondere Welt. Dass dies wörtlich zu nehmen ist, weiß jedoch niemand: Amelia kann die Geister der Verstorbenen sehen.
Als sie den Friedhof der abgelegenen Kleinstadt Asher Falls restauriert, kommt sie den Toten erneut gefährlich nahe. Amelia entdeckt ein verborgenes Grab im Wald und lüftet bald sein finsteres Geheimnis. Ein Geheimnis, das seit Jahrzehnten gewahrt wurde - und gewahrt bleiben soll ...
Die Graveyard-Queen Reihe jetzt als eBook bei beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung
"Ein mitreißendes Lesevergnügen!" NEW YORK JOURNAL OF BOOKS
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreissig
Zweiunddreissig
Dreiunddreissig
Vierunddreissig
Fünfunddreissig
Sechsunddreissig
Siebenunddreissig
Achtunddreissig
Neununddreissig
Vierzig
Über dieses Buch
Amelia Gray lebt mit den Toten. Sie restauriert Friedhöfe, und es heißt, sie habe einen Sinn für diese besondere Welt. Dass dies wörtlich zu nehmen ist, weiß jedoch niemand: Amelia kann die Geister der Verstorbenen sehen.
Als sie den Friedhof der abgelegenen Kleinstadt Asher Falls restauriert, kommt sie den Toten erneut gefährlich nahe. Amelia entdeckt ein verborgenes Grab im Wald und lüftet bald sein finsteres Geheimnis. Ein Geheimnis, das seit Jahrzehnten gewahrt wurde – und gewahrt bleiben soll …
Die Graveyard-Queen Reihe
Die Verlassenen (Novella)
Totenhauch
Totenlichter
Totenstimmen
Totenrache
Über die Autorin
Amanda Stevens ist in Missouri, in der Nähe des Ozark-Plateaus, geboren und aufgewachsen. Sie fühlte sich schon immer zu düsteren Themen hingezogen, liebt Friedhöfe, ist eine passionierte Leserin von Geistergeschichten und Fan von Alfred Hitchcock. In der Graveyard-Queen-Trilogie kombiniert sie auf gelungene Weise Elemente des Thrillers mit denen des Gruselromans.
Stevens lebt mit ihrem Ehemann und einer schwarzen Katze namens Lola in Houston, Texas. Weitere Informationen finden Sie auf ihrer Website: www.amandastevens.com
Amanda Stevens
Totenlichter
Aus dem Amerikanischen von Diana Beate Hellmann
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment | Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2012 by Marilyn Medlock Amann
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »The Kingdom«
Originalverlag: Mira Books
Dieses Buch wurde vermittelt durch die Literaturagentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2014/2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Monika Hoffko, Scripta Literaturagentur
Covergestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven © shutterstock: ZINGAYA TEXTURING | Squint Photography
eBook-Erstellung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7325-5748-6
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
EINS
Die Brise, die über den See strich, brachte eine leichte Kühle mit sich, obwohl die Sonne gerade erst begann, sich Richtung Westen zu neigen. Bis zur Dämmerung würden noch Stunden vergehen. Dann erst würde sich der Schleier zwischen unserer Welt und der anderen langsam heben. Trotzdem spürte ich schon jetzt, dass ich im Nacken eine Gänsehaut bekam; eine Empfindung, die mir in der Regel die Anwesenheit von etwas Übernatürlichem verriet.
Ich widerstand der Versuchung, umgehend über die Schulter zu blicken. Da ich schon jahrelang mit Geistern lebte, besaß ich eine eiserne Disziplin. Ich hütete mich davor, auf diese gierigen, habsüchtigen Wesen auf offensichtliche Weise zu reagieren. Also lehnte ich mich an die Reling und blickte unverwandt in die grünen Tiefen des Sees. Doch aus den Augenwinkeln spähte ich zu den übrigen Passagieren auf der Fähre.
Das vertraute Flüstern und leise Lachen des Paares, das in meiner Nähe stand, löste eine unerwartete Wehmut in mir aus. Plötzlich musste ich an John Devlin denken, den Detective, den ich in Charleston zurückgelassen hatte. Um diese Tageszeit arbeitete er vermutlich noch. Ich stellte mir vor, wie er sich über einen mit Papieren übersäten Schreibtisch beugte und Obduktionsberichte und Tatortfotos durchsah. Ob er hin und wieder an mich dachte? Natürlich spielte das ohnehin keine Rolle. Devlin wurde von den Totengeistern seiner verstorbenen Ehefrau und seiner Tochter heimgesucht, und ich konnte Geister sehen – eine unheivolle Kombination. Solange er an seiner Vergangenheit festhielt – und sie an ihm –, würde in seinem Leben kein Platz für mich sein.
Doch ich wollte mich nicht weiter mit Devlin befassen oder mit dieser entsetzlichen Tür, die sich durch meine Gefühle für ihn geöffnet hatte. Seit unserem letzten Treffen waren Monate vergangen, und mein Leben verlief inzwischen wieder normal. Falls man in meinem Fall von Normalität sprechen konnte. Ich sah immer noch Geister, aber die dunkleren Wesen – die Anderen, wie mein Vater sie nannte – waren wieder in ihre finstere Unterwelt zurückgekehrt. Ich betete, dass sie dort auch blieben. Die Erinnerungen an die vergangene Zeit verfolgten mich immer noch: Erinnerungen an Devlin und an die vielen Opfer eines besessenen Mörders, der auch mich ins Visier genommen hatte. Ich versuchte, mich dagegen zu wehren – aber sobald ich die Augen schloss, waren die Albträume wieder da.
Aber nun wollte ich mein Abenteuer genießen. Zu Beginn eines neuen Auftrags war ich stets voller Tatendrang, freute mich darauf, die Geschichte eines weiteren Friedhofs zu enthüllen und in das Leben derer einzutauchen, die man dort zur letzten Ruhe gebettet hatte. Ich betone gern, dass es bei meinem Job, der Friedhofsrestaurierung, um mehr geht als einfach nur das Entfernen von Abfall und Gestrüpp. Es geht um die Restaurierung: das Wiederherstellen des Originalzustandes.
In meinem Nacken prickelte es noch immer.
Erst nach einer Weile drehte ich mich um und ließ den Blick beiläufig über die geparkten Wagen schweifen. Mein silberfarbener SUV war eines von insgesamt fünf Fahrzeugen auf der Fähre. Ein anderer SUV gehörte dem Paar neben mir, der grüne Kleinbus einer Frau mittleren Alters, die in einen zerfledderten Taschenbuchroman vertieft war, und der rote Pick-up mit der verblassten Karosserie gehörte einem älteren Mann, der aus einem Styroporbecher Kaffee trank. Dann war da noch ein schwarzer Sportwagen. Ich bedachte den metallicschwarzen Lack mit einem anerkennenden Blick. In der Sonne schimmerte er wie Schlangenschuppen. Als ich die elegante Form des Wagens bewunderte, lief mir ein unerklärlicher Schauer über den Rücken. Die Scheiben waren zwar getönt, sodass ich nicht ins Innere sehen konnte, doch ich stellte mir vor, wie der Fahrer hinter dem Steuer saß und ungeduldig mit den Fingern aufs Lenkrad trommelte, während sich die Fähre zentimeterweise auf das Ufer zubewegte. Nach Asher Falls. Zum Thorngate Friedhof, dem Ziel meiner Reise.
Ich rieb mir den Nacken, wandte mich wieder dem Wasser zu und ging die wenigen Häppchen an Informationen durch, die ich bei meinen Recherchen zusammengetragen hatte. Asher Falls, gelegen in den üppig grünen Ausläufern der Blue Ridge Mountains in South Carolina, war früher einmal eine blühende Gemeinde gewesen, bis Mitte der Achtzigerjahre Pell Asher, einer der prominentesten Bürger der Stadt, ein ziemlich geschmackloses Geschäft abschloss. Er verkaufte dem Staat Land, auf dem ein Stausee als Wasserreservoir angelegt werden sollte. Das gesamte Gelände wurde überschwemmt – einschließlich der Schnellstraße, die nach Asher Falls führte. Weil das neue Autobahnnetz direkt an der Stadt vorbeiführte, geriet Asher Falls schnell in Vergessenheit. Die einzige Möglichkeit, in die Stadt hinein- oder wieder herauszukommen, war mit der Fähre oder über kleine Nebenstraßen. So dauerte es nicht lange, bis die Zahl der Einwohner zu schrumpfen begann, und Asher Falls reihte sich ein in die lange Statistik der sterbenden ländlichen Gemeinden.
Ich hatte noch nie einen Fuß in die Stadt gesetzt, auch nicht um den Friedhof vorab schon einmal in Augenschein zu nehmen. Ohne ein Vorstellungsgespräch war ich von einer Immobilienmaklerin namens Luna Kemper engagiert worden. Sie war außerdem die städtische Bibliothekarin und alleinige Verwalterin einer großzügigen Spende, die ein anonymer Gönner den Daughters of our Valiant Heroes gemacht hatte; einem Heimat- und Gartenbauverein, der sich der Verschönerung des Thorngate Friedhofs widmete. Lunas Angebot kam mir gerade recht. Ich brauchte dringend ein neues Projekt und einen Tapetenwechsel.
Die Fähre näherte sich dem Anlegesteg. Die Motoren wurden abgeschaltet, sodass sie fast zum Stillstand kam. Die hoch aufragenden Bäume am Ufer warfen dunkle Schatten auf das Wasser, das beinahe schwarz aussah. Ich konnte nicht bis auf den Grund des Sees blicken, doch für einen Moment hätte ich schwören können, dass ich etwas – jemanden! – dicht unter der Wasseroberfläche sah. Ein bleiches Gesicht, das zu mir heraufblickte …
Mein Herz setzte einen Schlag aus. Ich beugte mich tiefer über die Reling und starrte in die schwarzen Untiefen hinab. Menschen, die nicht solche Fähigkeiten haben wie ich, hätten sich bloß gefragt, ob das Spiel von Licht und Schatten ihnen einen Streich gespielt hatte. Oder, noch schlimmer, ob sie vielleicht eine Leiche erblickt hatten, die im Kielwasser der Fähre an Land gespült wurde. Doch ich dachte sofort an einen Totengeist und fragte mich, wer von den Menschen an Bord wohl von der goldblonden Erscheinung heimgesucht wurde, die ich soeben gesehen hatte.
»Ich glaube, das hier gehört Ihnen.«
Die männliche Stimme sorgte dafür, dass ich mich von der Reling löste und widerstrebend vom See abwandte. Als ich den Mann sah, wusste ich sofort, dass er zu dem Sportwagen gehörte: Das Fahrzeug und er hatten die gleiche dunkle, gepflegte Ausstrahlung. Er musste ungefähr in meinem Alter sein – siebenundzwanzig –, mit Augen in der Farbe von Gezeitenschlick. Er war ziemlich groß, wenn auch nicht so groß wie Devlin und auch nicht so dünn. Die jahrelange Heimsuchung durch Geister hatte aus dem einst hinreißenden Detective einen verhärmten Mann mit tief in den Höhlen liegenden Augen gemacht, während der Fremde, der vor mir stand, kerngesund aussah – schlank, kraftvoll und sonnengebräunt.
»Was sagten Sie?«
Er streckte mir die Hand entgegen. Im ersten Moment dachte ich, er wollte sich vorstellen. Doch dann öffnete er die Finger, und ich sah meine Halskette in seiner Hand.
Sofort griff ich mir an den Hals. »Oh! Sie muss wohl gerissen sein.« Ich nahm ihm die Kette aus der Hand und untersuchte die Glieder. Sie waren alle in Ordnung, und die Schließe war fest eingerastet. »Seltsam«, murmelte ich, öffnete den Verschluss und legte mir die Silberkette wieder um. »Wo haben Sie sie gefunden?«
»Sie lag hinter Ihnen auf dem Deck.« Sein Blick war auf den geschliffenen Stein gerichtet, der nun in meiner Halskuhle ruhte.
Ein kalter Griff schloss sich um mein Herz. Eine Warnung?
»Vielen Dank«, erwiderte ich steif. »Es wäre sehr schlimm für mich, wenn ich sie verloren hätte.«
»Das ist ein interessantes Stück.« Er musterte den Anhänger weiterhin eingehend. »Ein Glücksbringer?«
»Das könnte man so sagen.« Tatsächlich stammte der Stein vom geweihten Boden des Rosehill Friedhofs, auf dem mein Vater als Gärtner gearbeitet hatte, als ich noch klein war. Ich hatte keine Ahnung, ob der Stein solch schützende Eigenschaften hatte wie der Friedhof, doch ich wusste, dass ich mich gegenüber Geistern stärker fühlte, wenn ich ihn trug.
Gerade wollte ich mich wieder zum Wasser umdrehen, da hielt mich etwas in den Augen des Fremden zurück, ein rätselhaftes Funkeln.
»Geht es Ihnen gut?«, wollte er wissen; eine Frage, mit der ich nicht gerechnet hatte.
»Alles wunderbar«, antwortete ich. »Warum fragen Sie?«
Er nickte mit dem Kopf zum Wasser. »Als ich herüberkam, haben Sie sich sehr weit über die Reling gebeugt, dann habe ich Ihre Halskette auf dem Boden liegen sehen. Ich hatte schon befürchtet, Sie würden vielleicht springen.«
»Ach das.« Ich tat es mit einem Schulterzucken ab. »Ich dachte, ich hätte etwas im Wasser gesehen. War wahrscheinlich nur ein Schatten.«
Das Funkeln in seinen Augen wurde intensiver. »Da wäre ich mir nicht so sicher. Sie wären überrascht, was alles auf dem Grund dieses Sees liegt. Manchmal wird etwas davon nach oben gespült.«
»Was denn zum Beispiel?«
»Hauptsächlich Abfall. Glasflaschen, Kleiderfetzen. Einmal habe ich gesehen, wie ein Schaukelstuhl angespült wurde.«
»Und wo kommt das alles her?«
»Aus den gefluteten Häusern.« Als er den Kopf drehte, um über das Wasser zu schauen, betrachtete ich sein Profil genauer. Am meisten faszinierte mich, wie die Nachmittagssonne in seinem dunklen Haar spielte. Die kupferfarbenen Strähnen verliehen ihm eine Wärme, die seinen braungrünen Augen fehlte. »Bevor der Damm gebaut wurde«, fuhr er fort, »war der See nur halb so groß wie jetzt. Eine Menge Häuser wurden zerstört, als das Wasser gestiegen ist.«
»Aber das ist schon Jahre her. Sie meinen, die Häuser sind immer noch da unten?« Ich versuchte, durch die Schichten aus Algen und Grundnesseln zu blicken, konnte aber nichts erkennen. Nicht einmal das geisterhafte Gesicht, das ich vorhin gesehen hatte.
»Häuser, Autos – und ein alter Friedhof.«
Ich wandte den Blick wieder zu ihm. »Ein Friedhof?«
»Der Thorngate Friedhof. Noch ein Opfer der Asher-Gier.«
»Aber ich dachte …« Mir wurde unbehaglich zumute. Ich war gut in meinem Job, aber einen Friedhof zu restaurieren, der unter Wasser lag, fiel nicht gerade in mein Fachgebiet. »Ich habe Fotos vom Thorngate Friedhof gesehen, die erst vor Kurzem aufgenommen worden sind. Es sah trocken aus.«
»Es gibt zwei Thorngate Friedhöfe«, erwiderte er. »Und ich versichere Ihnen, dass einer davon auf dem Grund dieses Sees ruht.«
»Wie ist das passiert?«
»Der ursprüngliche Thorngate Friedhof wurde nur sehr selten genutzt. Er war fast in Vergessenheit geraten, und es ist kaum jemand hingegangen. Niemand hat einen Gedanken an ihn verschwendet – bis das Wasser kam.«
Entsetzt starrte ich ihn an. »Wollen Sie etwa sagen, dass man die Leichen nicht umgebettet hat, bevor der Stausee angelegt wurde?«
Er zuckte die Schultern. »Danach fingen die Leute an, Dinge zu sehen – und zu hören.«
Ich schlang die Finger um den Talisman an meinem Hals. »Was für Dinge?«
Er blickte unverwandt auf das Wasser. »Wenn Sie diesen Stausee auf irgendeiner Karte von South Carolina suchen«, fuhr er nach kurzem Zögern fort, »finden Sie ihn unter dem Namen Asher Reservoir. Aber wir hier nennen ihn Bell Lake, den Glockensee.«
»Warum das?«
»Früher hat man manche Särge mit einer Art Alarmsystem ausgestattet: Oben auf dem Grab befand sich eine Glocke, die an einem Draht befestigt war, der wiederum direkt in den Sarg führte – als Schutz für den Fall, dass man lebendig begraben wurde. Die Leute sagen, man kann diese Totenglocken manchmal hören – nachts, wenn der Nebel aufzieht.« Er schaute über die Reling in die Tiefen hinab. »Die Toten dort unten wollen nicht vergessen werden – nie wieder.«
ZWEI
Ein Zittern durchlief meinen ganzen Körper, bis ich das amüsierte Funkeln in den Augen des Fremden bemerkte.
»Tut mir leid«, sagte er mit einem zerknirschten Lächeln. »Örtliches Volksmärchen. Ich konnte nicht widerstehen.«
»Heißt das, dass nichts davon wahr ist?«
»Na ja, der Friedhof liegt wirklich dort unten, zusammen mit Autos, Häusern und Gott weiß, was sonst noch allem. Manche Leute behaupten, sie hätten nach einem schweren Sturm sogar Särge an die Oberfläche treiben sehen. Die Glocken allerdings …« Er stockte. »Lassen Sie es mich so sagen«, fuhr er dann fort. »Ich habe bereits als kleiner Junge an diesem See gefischt, und ich habe sie noch nie gehört.«
Doch was war mit dem Gesicht, das ich unter der Wasseroberfläche gesehen hatte?, fragte ich mich unmittelbar. Hatte ich mir das nur eingebildet? Oder war es eine ruhelose Seele, dessen Grab auf dem Grund dieses Sees lag?
Dass der Fremde mich unverwandt musterte, machte mich unsicher, obwohl ich nicht genau sagen konnte, warum. Vielleicht war sein Blick einfach nur ein bisschen zu unergründlich und geheimnisvoll – wie der Grund des Sees.
Er beugte sich vor, verschränkte die Arme und stützte sie auf die Reling. Er trug Jeans und einen schwarzen Pullover, der sich eng an seinen schlanken Oberkörper schmiegte. Ganz unerwartet fand jede Faser meines Körpers Gefallen an diesem Anblick. Ich schaute schnell woandershin. Das Letzte, was ich gebrauchen konnte, waren irgendwelche romantischen Verwicklungen. Ich war noch nicht über Devlin hinweg – und vielleicht würde ich das nie sein. Ein attraktiver Fremder könnte meine heftige Sehnsucht nur vorübergehend stillen. Er würde den körperlichen Schmerz bloß kurz lindern, den ich tief in meiner Brust fühlte seit jener Nacht, in der ich aus dem Haus geflüchtet war, in dem Devlin einst mit seiner Frau gelebt hatte: der sehr schönen und inzwischen sehr toten Mariama.
»Und was führt Sie nach Asher Falls?«, fragte der Fremde. »Das heißt, wenn Sie mir die Frage erlauben. Wir haben nicht oft Besucher hier. Wir sind weit ab vom Schuss, wie man so sagt.«
Er hatte eine angenehme Stimme, doch in seiner Frage schwang eine Spur Misstrauen mit. »Man hat mich engagiert, damit ich den Thorngate Friedhof restauriere. Den trockenen, der sich an Land befindet.«
Er antwortete nicht, sodass ich ihn nach einer Weile fragend ansah. Er starrte mich aus funkelnden Augen an, allerdings war es nun keine Erheiterung mehr und auch nicht Neugier. Jetzt drückte sein Blick Verärgerung aus. Der Moment verging rasch. Der Fremde schien sich wieder zu fangen, doch ich wusste, dass ich mir seinen Missmut nicht eingebildet hatte.
Ich bemühte mich, nicht zu viel hineinzuinterpretieren. Durch meine Arbeit stieß ich bei Einheimischen öfter auf Widerstand. Wenn es um ihre Friedhöfe ging, entwickelten viele Menschen plötzlich einen Beschützerinstinkt und waren außerdem recht abergläubisch. Ich wollte dem Fremden schon versichern, dass ich gut sei in meinem Job und Thorngate bei mir in guten Händen läge. Doch dann kam ich zu dem Schluss, dass es besser sei, wenn die Frau das übernahm, die mich engagiert hatte. Sie würde die Bedenken ihrer Gemeinde besser zerstreuen können als ich.
»Sie sind also hier, um Thorngate zu sanieren«, murmelte er. »Wessen Idee war das?«
»Der Name meiner Auftraggeberin lautet Luna Kemper. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, schlage ich vor, dass Sie sich direkt an sie wenden.«
»Oh, das werde ich«, entgegnete er mit einem angespannten Lächeln.
»Gibt es ein Problem?«, konnte ich nicht umhin zu fragen.
»Noch nicht. Aber ich sehe gewisse Spannungen voraus. Der Thorngate Friedhof, der sich an Land befindet, war früher der Familienfriedhof der Ashers. Nachdem der ältere Totenacker geflutet worden war, wurde dieser Familienfriedhof an die Stadt übergeben, und dazu so viel Land, dass er erweitert werden konnte. Das erregt nach wie vor die Gemüter.«
»Die Ashers haben ihren eigenen Familienfriedhof der Stadt gegeben? Das kommt mir ein bisschen extrem vor. Warum haben sie nicht einfach Land verschenkt, damit man einen neuen Friedhof anlegen konnte?«
»Weil nach dem, was der alte Pell Asher getan hatte, eine größere Geste nötig war.« Seine grünen Augen wirkten plötzlich finsterer. »Eine Wiedergutmachung, wenn Sie es genau wissen wollen. Die Ironie dabei ist natürlich, dass die protzigen Grabmale und das Familienmausoleum den Unterschied zwischen den Ashers und den Bürgern dieser Stadt nur noch mehr betonen.«
»Lebt Pell Asher denn noch?«
»Oh ja. Und ob.« Erneut sah ich ein Gefühl in seinen Augen aufblitzen, konnte aber nicht genau sagen, was es war. Dann schaute er schon wieder aufs Wasser.
»Und was machen Sie in Asher Falls, wenn Sie mir die Frage erlauben?« Ich wiederholte fast exakt seine Worte von vorhin, doch er schien es nicht zu bemerken.
»Ich trinke«, antwortete er. »Und ich warte auf den richtigen Augenblick.« Er sah mich an mit einem Blick, der mir einen Schauer über den Rücken jagte. Da lag etwas in seiner Stimme, ein dunkler Unterton, bei dem ich an versunkene Friedhöfe und an Geheimnisse denken musste, die man vor langer Zeit begraben hatte. Ich wollte wegschauen, doch dieser Blick unter schweren Lidern war auf entwaffnende Weise hypnotisch. »Ich bin übrigens Thane Asher. Der rechtmäßige Erbe des zerfallenden Asher-Imperiums, zumindest so lange, bis mein Großvater sein Testament wieder ändert. Er hat diese Angewohnheit, regelmäßig zwischen meinem Onkel und mir als Begünstigten hin und her zu springen. Diese Woche bin ich der Liebling. Sollte er also vor dem nächsten Donnerstag ins Gras beißen, bin ich reich.«
Ich wusste nicht, was ich darauf erwidern sollte, also streckte ich ihm einfach die Hand hin. »Amelia Gray.«
»Freut mich.« Er nahm meine Hand und drückte sie. Seine Handfläche war warm und weich, wie so oft bei Privilegierten, nicht wie meine voller Schwielen, die ich mir im Laufe der Jahre zugezogen hatte vom Gestrüppentfernen und Grabsteinherumwuchten.
Wieder einmal schweiften meine Gedanken zurück zu Devlin und daran, wie er mir mit seinen langen, schlanken Fingern über den Rücken strich.
Ich unterdrückte einen wohligen Schauer und versuchte, meine Hand aus dem Griff Thane Ashers zu lösen. Doch er hielt sie fest und sah mir tief in die Augen, bis die Fähre mit einem leichten Ruck anlegte, dann erst ließ er mich los.
»Wir sind da«, meinte er vergnügt. »Asher Falls. Willkommen in unserem Königreich, Amelia Gray.«
DREI
Ich fuhr hinter dem Kleinbus von der Fähre und hielt kurz am Straßenrand, um mein Navigationssystem neu zu programmieren. Ich hatte die Fenster heruntergelassen. Ein kühler Wind drang in den Wagen und duftete nach dem satten Grün und dem Harz des Upcountry, dem Norden von South Carolina. Obwohl bereits September war, hielt die hochsommerliche Hitze an, die Zitronenmelisse und der Sumpfziest blühten noch und überzogen die Wiesen mit einem lavendelfarbenen Teppich. Die Gegend, die sich über den sanften Hügeln des Piedmonts erhob, war wunderschön, trotzdem blieb mir diese Landschaft mit den hoch aufragenden Bergen, den dunklen Schatten und schwarzgrünen Wäldern aus Pinien und Hemlocktannen fremd. Mein geliebtes Lowcountry mit seinen dampfenden Sümpfen und der salzigen Luft schien weit weg zu sein.
Das Aufheulen eines Motors riss mich aus meinen Betrachtungen, ich blickte zur Straße hin. In diesem Augenblick zischte der schwarze Sportwagen an meinem Fenster vorbei und zog eine dünne Wolke aus Staub und Abgas hinter sich her.
»Willkommen in unserem Königreich«, murmelte ich vor mich hin und beobachtete, wie Thane Asher eine scharfe Kurve nahm, ohne vom Gas zu gehen – ein beeindruckendes Manöver, das von verwegener Unbekümmertheit zeugte, mit quietschenden Reifen und metallisch aufblitzender Farbe. Der schwere Motor brüllte noch einmal auf, dann war der Wagen verschwunden. Die Stille, die sich um mich herum ausbreitete, erschien mir bleiern und unheilverkündend, so als lastete die Schwere eines dunklen Zaubers darauf.
Ich schaute im Rückspiegel zur Fähre und kehrte in Gedanken nach Charleston zurück. Zu Devlin. Doch jetzt war ich hier, ich hatte einen Auftrag, und es gab kein Zurück mehr.
Ich bog auf die Straße und folgte Thane Asher in Richtung Stadt.
Asher Falls musste früher ein malerisches Städtchen gewesen sein, mit dem Kopfsteinpflaster und Häusern im neoklassizistischen Stil, die um einen großen Platz gebaut waren, gesäumt von schattenspendenden Virginia-Eichen voller Louisianamoos. Idyllisch war das Wort, das einem bei diesem Anblick spontan in den Sinn kam. Erst auf den zweiten Blick entdeckte man die Zeichen des Verfalls, die auf eine sterbende Gemeinde hinwiesen: mit Brettern vernagelte Fenster, verbogene Regenrinnen, die stehengebliebene Uhr in dem wunderschönen alten Turm.
Ich sah keine Menschenseele, während ich den Platz umrundete. Wenn nicht hier und da ein parkendes Auto gewesen wäre, hätte ich gedacht, der Ort sei verlassen. In den Straßen war es so still wie in einer Gruft, die Geschäfte waren dunkel und wirkten verwaist. Dieser Ort hatte die stille, einsame Ausstrahlung einer Geisterstadt.
Ich parkte den Wagen und stieg aus. Luna Kemper hatte mir eine E-Mail mit der Adresse ihres Immobilienmaklerbüros geschickt, ich fand es ohne Mühe. Doch die Tür war abgesperrt, und durch das Fenster konnte ich drinnen keine Menschenseele erkennen. Ich klopfte an die Scheibe, wartete einen Moment und machte mich dann auf den Weg zur Bibliothek. Die befand sich gleich nebenan in einem beeindruckenden dreistöckigen Gebäude mit Rundbogenfenstern und Säulen, die mich an einige meiner Lieblingsbauten in Charleston erinnerten.
Hinter dem Empfangstresen stand ein etwa sechzehnjähriges Mädchen und sortierte einen Stapel Bücher. Sie blickte auf, als ich durch die Tür trat, doch sie lächelte mir nicht zu und grüßte auch nicht. Stattdessen wandte sie sich wieder ihrer Arbeit zu. Ihre weißblonden, kurz geschnittenen Haare betonten ihr blutleer wirkendes Gesicht.
Bevor ich zum Empfangstresen ging, blieb ich einen Moment lang stehen, um den vertrauten Duft der Bibliothek einzuatmen. Ich hatte den Geruch von alten Büchern und Dokumenten schon immer geliebt und konnte mich stundenlang in muffigen Archiven vergraben. Intensive Recherchen waren wesentlich für eine erfolgreiche Friedhofsrestaurierung. Als ich nun den Anblick der sich biegenden Bücherregale und dunklen Nischen auf mich wirken ließ, verspürte ich einen Anflug von Erregung angesichts dessen, was ich vielleicht finden würde – hier in der Bibliothek und auf dem Thorngate Friedhof.
Die uralten Bodendielen knarrten unter meinen Stiefeln, als ich zum Empfangstresen ging. Die Blondine hob den Blick, aber nicht den Kopf. Ihre Augen waren kristallblau, hatten die klare leuchtend blaue Farbe eines Frühlingshimmels. Sie war sehr zierlich, kam mir aber trotzdem nicht zerbrechlich vor. Sie hatte eine besondere Ausstrahlung, eine ernsthafte Würde, die bei einem Mädchen ihres Alters ungewöhnlich und ein wenig beunruhigend war.
Sie sagte immer noch nichts, doch ich empfand ihr Schweigen nicht als unverschämt. Sie schien mir eher reserviert und misstrauisch zu sein, wie jeder, der zu viel Zeit in seiner eigenen kleinen Welt verbrachte.
»Mein Name ist Amelia Gray. Ich habe einen Termin mit Luna Kemper. Sie erwartet mich.«
Das Mädchen nickte knapp und hörte mit dem Sortieren auf, dann drehte es sich um und schritt auf eine geschlossene Tür zu, klopfte ein Mal und schlüpfte hindurch. Einen Augenblick später erschien es wieder und bedeutete mir, ich solle um den Empfangstresen herumkommen. Als es zur Seite trat, damit ich in den Raum gehen konnte, sah ich, dass sein Blick auf etwas gerichtet war – nicht auf mich, sondern auf eine Stelle über meiner Schulter. Ich hatte so eine Ahnung, dass ich, wenn ich ihrem Blick folgen würde, dort nichts sehen würde. Ein beunruhigendes Gefühl, denn von ein paar wenigen Ausnahmen abgesehen, war ich schließlich diejenige, die Dinge sah, die andere nicht wahrnehmen konnten.
Bevor ich darüber weiter nachdenken konnte, erhob sich Luna Kemper schon, um mich zu begrüßen. Sie scheuchte eine wunderschöne graue Tigerkatze weg und trat um ihren Schreibtisch herum. Der Duft von Wildblumen erfüllte plötzlich den Raum, so als würde sie ihn aus jeder Pore verströmen. An einer Ecke ihres Schreibtisches stand eine Vase mit purpurfarbenem Fingerhut – Papa nannte diese Blumen Hexenglocken –, doch ich war mir ziemlich sicher, dass der Geruch nicht von ihnen kam. Ich hatte noch nie erlebt, dass sie so durchdringend dufteten.
Nach ihrem Aussehen zu urteilen, war Luna etwa Anfang vierzig, eine sinnliche Brünette mit schimmerndem Teint und Augen in der Farbe von Regenwolken. »Herzlich willkommen, Amelia. Ich freue mich sehr, Sie endlich persönlich kennenzulernen.« Sie streckte mir die Hand hin, und wir begrüßten einander. Sie trug einen dunkelgrauen Bleistiftrock und einen lavendelfarbenen Pullover, darüber eine Kette mit einem großen Mondsteinanhänger. Ihr ungezwungenes Lächeln und freundliches Auftreten waren ein willkommener Gegensatz zu dem verhaltenen Benehmen ihrer Assistentin, die so ähnlich gekleidet war wie ich; mit Jeans und einem schwarzen T-Shirt unter einer leichten Sommerjacke.
»Hatten Sie eine gute Reise?«, fragte Luna und lehnte sich mit ihrer wohlgeformten Hüfte gegen den Schreibtisch.
»Es war beeindruckend. Ich bin schon sehr lange nicht mehr hier oben gewesen. Ich hatte ganz vergessen, wie schön das Vorgebirge um diese Jahreszeit ist.«
»Falls Sie die Gelegenheit haben, sollten Sie einen Ausflug zu den Wasserfällen machen. Das ist eine der schönsten Gegenden im ganzen Bundesstaat, obwohl ich da bestimmt etwas voreingenommen bin. Ich bin im Vorgebirge geboren und aufgewachsen. Meine Mutter hat immer gesagt, dass ich verkümmern würde, wenn ich nicht durch Berge und Wälder streifen könnte. Doch hin und wieder fahre ich am Wochenende auch gern an den Strand. Ich habe eine Cousine, die auf St. Helena ein Haus hat. Fahren Sie öfter mal da runter?«
»Nein, eigentlich nicht. Meistens habe ich zu viel zu tun.«
»Das verstehe ich gut. Wenn man eine Firma leitet, bleibt einem nicht viel Freizeit. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich zum letzten Mal richtig Urlaub gemacht habe. Vielleicht nächstes Jahr …« Sie brach ab, und ihr Blick wanderte zur Tür, wo das blonde Mädchen immer noch ausharrte. »Sidra, das hier ist Amelia Gray, die Friedhofsrestauratorin, von der ich dir erzählt habe. Amelia, das ist Sidra Birch. Sie hilft nach der Schule in der Bibliothek aus und manchmal auch am Wochenende.«
Ich blickte über die Schulter und nickte ihr zu. »Hallo, Sidra.«
Sie sagte immer noch nichts, aber legte den Kopf schräg und musterte mich so eingehend, dass es mir unangenehm war. Dieses Mädchen hatte etwas an sich – etwas, das vertraut war und abstoßend zugleich. Es hatte die Ausstrahlung von jemandem, der um dunkle Dinge wusste. So wie ich.
Ich unterdrückte ein Schaudern und wandte mich wieder Luna zu.
»Sie möchten jetzt bestimmt gern in Ihre Unterkunft«, sagte sie mit lebhafter Stimme. »Ich habe dafür gesorgt, dass Sie in Floyd Coveys Haus wohnen können; er ist zurzeit in Florida, um sich dort um seine Mutter zu kümmern. Sie hat sich den Oberschenkelhals gebrochen und ist bettlägrig, sodass ich davon ausgehe, dass er mindestens ein paar Monate wegbleiben …«
Ein Geräusch an der Tür sorgte dafür, dass wir beide dorthin schauten. Sidra starrte Luna an mit einem Ausdruck, den ich nicht ergründen konnte.
»Was ist?«, fragte Luna.
»Warum bringst du sie dort draußen unter?«
»Warum nicht?«, entgegnete Luna mit einem Anflug von Irritation in der Stimme.
Sidra musterte mich kurz mit ihren blauen Augen und schaute dann wieder weg. »Es ist gruselig.«
»Blödsinn! Es ist ein hübsches Haus direkt am See, die Lage ist perfekt. Es liegt genau auf halber Strecke zwischen der Stadt und dem Thorngate Friedhof«, erklärte Luna. »Ich glaube, dass Sie sich dort sehr wohlfühlen werden.«
»Das denke ich auch«, stimmte ich höflich zu, doch Sidras Bemerkung und Thane Ashers Geschichte von den ruhelosen Seelen im Bell Lake hatten bereits Spuren in mir hinterlassen und eine Saat des Misstrauens gelegt.
Luna erhob sich von der Schreibtischkante. »Warum machen Sie es sich nicht ein bisschen bequem, während ich nach nebenan gehe und die Schlüssel hole? Wir können noch kurz die Verträge und Genehmigungen durchgehen, dann fahre ich mit Ihnen raus, damit Sie sich das Haus ansehen können.«
Sidra war inzwischen verschwunden. Ich nahm an, dass sie sich wieder an ihre Arbeit hinter dem Empfangstresen gemacht hatte. Nachdem Luna gegangen war, überlegte ich, ob ich hinausgehen und das Mädchen fragen sollte, was es mit seiner Bemerkung über das Covey-Haus gemeint hatte. Doch dann kam ich zu dem Schluss, dass es wohl das Beste war, nicht solches Misstrauen zu zeigen und mir stattdessen meine eigene Meinung zu bilden.
Um die Zeit totzuschlagen, sah ich mich in Lunas Büro um. Es war einer jener bunten, vollgestellten Räume, die mich schon immer fasziniert hatten. Es gab so viele interessante und ungewöhnliche Schätze zu bewundern, angefangen bei dem handgeschnitzten Schreibtisch bis hin zu der Schiffsglocke aus Messing, die über der Tür hing. Bis zu diesem Augenblick hatte ich die Glocke noch gar nicht bemerkt, aber jetzt hörte ich ein ganz schwaches Klingeln, als hätte ein Windzug den Klöppel bewegt. In dem Raum gab es zudem noch eine zweite Tür. Sie war schmal und bogenförmig und hatte ein kunstvoll verziertes Schloss, sodass ich mich fragte, wohin sie wohl führte.
Langsam ging ich durch den Raum und bewunderte die Gegenstände in den Mahagonischränken: handgeblasene Glasfigürchen, antike Taschenuhren, Fossilien und Muscheln und eine Sammlung seltsam geformter Messer. Überall an den Wänden hingen gerahmte Fotos, von denen die meisten historische Gebäude von Asher Falls zeigten, aber die Porträts interessierten mich mehr. Eines erregte besonders meine Aufmerksamkeit – es war ein Bild, auf dem drei junge Frauen zu sehen waren, die sich untergehakt hatten und verträumt in die Kamera blickten. Ich erkannte Luna im Teenageralter, und eines der beiden anderen Mädchen hatte eine verblüffende Ähnlichkeit mit Sidra, auch wenn ich wusste, dass sie es nicht sein konnte. Das Bild war sicher fünfundzwanzig Jahre alt, sowohl die Frisuren als auch die Kleidung schrien förmlich nach den Achtzigerjahren. Damals war Sidra noch gar nicht auf der Welt gewesen.
Ein viertes Mädchen hielt sich im schattigen Hintergrund auf, ihr welliges Haar wehte in der Brise und sie starrte zornig in die Kamera. Ich spürte, wie sich mir die Brust seltsam zusammenschnürte, als ich ihre wie versteinert wirkenden Gesichtszüge betrachtete. Eine Zeit lang kam es mir so vor, als könnte ich nicht atmen, als könnte ich die Augen nicht abwenden von diesem wild glühenden Blick.
»Sind Sie okay?«
Ich trat einen Schritt zurück. Sidras Stimme hatte den seltsamen Bann gebrochen, den das Bild auf mich ausübte. Ich drehte mich um und sah, dass sie im Türrahmen stand und mich musterte. Das Licht, das durch das Fenster in den Raum fiel, schimmerte in ihrem weißblonden Haar und schuf zusammen mit ihrer Blässe ein ätherisches Bild, sodass ich mich einen Moment lang fragte, ob sie vielleicht ein Geist war. Ich hatte mich schließlich schon einmal täuschen lassen. Aber da Sidra sich vorhin mit Luna unterhalten hatte, war die Wahrscheinlichkeit wohl eher gering.
»Warum starren Sie mich so an?«, fragte sie und legte die Stirn in Falten.
»Habe ich das getan? Das tut mir leid«, gelang es mir, ruhig zu erwidern. »Ich war nur erstaunt, wie ähnlich du dem Mädchen auf dem Foto hier siehst.«
Sidra kam zu mir herüber und stellte sich neben mich. »Das ist meine Mutter, Bryn.« Dann wies sie mit dem Finger auf die Rothaarige, die rechts neben ihrer Mutter stand: »Das ist Catrice, und Luna kennen Sie ja schon. Die drei waren in der Highschool enge Freundinnen. Sind es, glaube ich, immer noch.«
»Leben sie alle hier in Asher Falls?«
Sie zögerte einen Moment. »Sie haben doch gehört, was Luna gesagt hat«, sagte sie dann. »Sie würde verkümmern, wenn sie die Berge verlassen müsste. Bei meiner Mutter wäre es genauso, denke ich. Draußen in der wirklichen Welt würde es keine von ihnen lange schaffen.«
»Ist das hier nicht die wirkliche Welt?«
»O Gott, ich hoffe nicht«, erwiderte sie mit einem Schaudern.
»Gefällt es dir hier nicht?«
»Ob es mir gefällt? Asher Falls ist eine Geisterstadt«, sagte sie. Etwas in ihrer Stimme ließ nun mich erschaudern.
»Es hört sich für mich aber so an, als hätte Luna hier viel zu tun.«
»Ja, sicher. Luna ist eine sehr beschäftigte Frau.«
Wir starrten beide auf das Foto, in dem Glas konnte ich Sidras bleiches Spiegelbild sehen.
»Ich mag ihren Namen«, sagte ich. »Er ist ungewöhnlich, aber er passt zu ihr. Und dein Name ist auch ungewöhnlich.«
»Wegen Luna hat meine Mutter mich auch so genannt. Sidra bedeutet ‚von den Sternen’, und Luna bedeutet Mond.« Sie zuckte die Schultern. »Irgendwie kitschig, aber sie hatten es schon immer mit diesem mystischen Kram.«
»Wer ist das vierte Mädchen?«
Ich hörte, wie Sidra nach Luft schnappte. Als ich sie ansah, stellte ich fest, dass sie erschrocken war – mit weit aufgerissenen Augen presste sie die Hand auf ihr Herz –, dann schluckte sie und versuchte, sich wieder zu sammeln. »Welches Mädchen?«, fragte sie mit dünner Stimme.
»Das Mädchen im Hintergrund. Die hier.« Ich hielt den Finger über das Glas und spürte, wie etwas Unangenehmes, Kaltes mich durchströmte.
Sidra schwieg. In der Stille, die folgte, hörte ich wieder die Glocke, so schwach, dass ich mich fragte, ob das Geräusch vielleicht doch bloß meiner Fantasie entsprang.
»Auf dem Bild ist sonst niemand«, sagte sie schließlich. »Ich weiß nicht, wovon Sie reden.«
Doch ich konnte das wütende Gesicht im Hintergrund ganz deutlich erkennen – und plötzlich begriff ich. Wer auch immer sie sein mochte, sie war bereits tot, als man das Bild aufgenommen hatte.
Es war das deutlichste Foto eines Totengeists, das ich je gesehen hatte. Doch wenn ich hier diejenige war, die Geister sehen konnte, warum war Sidra dann so erschüttert?
»Es ist nur ein Schatten oder irgendein Lichtspiel«, fuhr sie unbeirrt fort. »Da ist sonst niemand auf dem Bild.«
Wir sahen einander an, und ich nickte.
»Ja, das muss es sein«, pflichtete ich ihr bei, doch spürte, wie eisige Finger mir über den Rücken strichen.
VIER
Als ich kurze Zeit später Lunas Volvo durch die Stadt folgte, musste ich die ganze Zeit an Sidra denken und an ihren Gesichtsausdruck, als ich das vierte Mädchen auf dem Foto erwähnt hatte. Ich war immer davon ausgegangen, dass meine Fähigkeit, Geister zu sehen, eine seltene Gabe war, und aufgrund von Papas Warnungen hatte ich ein Eigensiedlerdasein geführt. Ich hatte keine engen Freunde, keinen Vertrauten, es gab nur meinen Vater, mit dem ich mein Geheimnis teilen konnte. Den größten Teil meines Lebens hatte ich hinter Friedhofsmauern verbracht, abgeschieden von der Welt und geschützt in meinen Friedhofskönigreichen, wie ich sie nannte. Manchmal ist die Einsamkeit unerträglich gewesen.
Jetzt fragte ich mich, ob Sidra die Geister auch sehen konnte. Ich wusste nicht so recht, was ich empfand, wenn ich an diese Möglichkeit dachte. Die Geister waren eine schwere Bürde. Eine so dunkle Gabe wünschte ich niemandem.
Meine Gedanken wanderten zurück zu jenem Tag, als ich zum ersten Mal einen Totengeist sah. Ich konnte mich noch ganz genau an die Dämmerung erinnern, an diese schimmernde Aura unter den Bäumen des Rosehill Friedhofs und daran, wie befremdlich es gewesen war, dass die Umrisse des Mannes klarer wurden, je mehr das Licht schwand. Irgendwie hatte ich gewusst, dass er ein Geist war, aber ich hatte mich nicht gefürchtet, bis Papa mir mit grimmiger Miene unsere Situation erklärte. Nicht jeder konnte sie sehen, hatte er zu mir gesagt, es war wichtig, dass wir nichts taten, wodurch wir uns verrieten. Geister waren gefährlich für Menschen wie uns. Denn das Einzige, was sie wollten, war, dass wir sie wahrnahmen und zeigten, dass wir sie sehen konnten, damit sie wieder Teil unserer Welt wurden. Um ihre irdische Präsenz auf Dauer aufrechtzuerhalten, hefteten sie sich an die Lebenden wie Parasiten, raubten ihnen Energie und Wärme, ähnlich Vampiren, die sich von Blut ernähren.
Papa hatte sehr viel Zeit drauf verwendet, mir beizubringen, wie ich mich vor ihnen schützen konnte. Er hatte mir eine Reihe von Regeln genannt, die ich mein ganzes Leben lang befolgt hatte: Ich sollte die Geister niemals merken lassen, dass ich sie sehen kann; sollte mich niemals zu weit von geweihtem Boden entfernen; mich nicht auf Menschen einlassen, die von Totengeistern heimgesucht wurden; und ich sollte nie das Schicksal herausfordern – niemals.
Doch dann war ich John Devlin begegnet. Ich verlor mich in ihm, verlor meine Vernunft und schlug alle Regeln in den Wind. Ich gewährte seinen Geistern Zutritt zu meiner Welt und entfernte mich zu weit von geweihtem Boden. Durch meine Schwäche, durch unsere Leidenschaft, hatte sich eine Tür geöffnet.
Wenn ich doch nur auf die Warnung meines Vaters gehört hätte … Wenn ich nur seinen Regeln gefolgt wäre.
Stattdessen war ich unachtsam geworden. Jetzt konnte ich nicht so tun, als hätte ich nicht gesehen, was in der Nacht passiert war, als ich aus Devlins Haus floh.
Er war und blieb mein schwacher Punkt. Wenn ich in den letzten paar Monaten eines gelernt hatte, dann, dass ich einen stärkeren Verteidigungswall gegen ihn errichten musste – gegen ihn und seine Geister. Egal, was ich dafür tun musste.
Während ich nun versuchte, den Volvo vor mir nicht zu verlieren, sah ich aus den Augenwinkeln plötzlich metallicschwarzen Lack aufblitzen und dann die Umrisse eines edlen Sportwagens: Thane Ashers Auto parkte vor einem Lokal namens Half Moon Tavern. Sofort musste ich an das denken, was er mir auf der Fähre gesagt hatte: »Ich trinke – und ich warte auf den richtigen Augenblick.« Ich konnte mir keine deprimierendere Existenz vorstellen, doch ich wusste nicht genug über seine Familie oder sein Leben, deshalb stand es mir nicht zu, ein Urteil zu fällen.
Während die Taverne in meinem Rückspiegel immer kleiner wurde, versuchte ich, Thane Asher – und Devlin – aus meinen Gedanken zu verbannen und mich auf die vorübergleitende Landschaft zu konzentrieren. Die Straße, die zu beiden Seiten von Wald gesäumt war, wurde immer schmaler, die malerischen Fachwerkhäuser, die mir bei meiner Ankunft aufgefallen waren, ließ ich hinter mir. Eine ganze Weile sah ich keinen Hinweis darauf, dass hier irgendwo Menschen lebten, bis auf ein verlassenes Getreidesilo und die eine oder andere verfallene Hütte. Ich ließ das Fenster auf der Fahrerseite herunter. Der schwache, doch aufdringliche Gestank nach Dünger strömte ins Wageninnere.
Ein Stück vor mir bog Luna links ab auf einen einspurigen Feldweg, der direkt in den Wald führte. An einer Stelle, an der man die Bäume ausgeforstet hatte, konnte ich die Spitze eines Hausdachs ausmachen.
Kurz darauf hielt ich neben ihrem Volvo, stieg aus dem Wagen und ließ den Blick über die Rundbogenfenster und die spitzen Giebel des Hauses wandern. Luna stand vorn auf der Veranda und wartete auf mich, den Schlüssel in der Hand, doch ich ließ mir Zeit, bis ich zu ihr trat. Zuerst musste ich mich an meine neue Umgebung gewöhnen.
Ich schlang die Arme um den Körper und ließ die tiefe Stille auf mich wirken. Wir waren umgeben von Wald und den Bergen, die in der Ferne aufragten, doch ich hörte kein Vogelgezwitscher in den Bäumen, keine Rascheln im Unterholz. Ich vernahm kein einziges Geräusch, nur das schwache Säuseln des Windes in den Blättern.
Ich drehte mich um zu Luna. Sie stand da, betrachtete mich mit einem ganz seltsamen Gesichtsausdruck und strich mit dem Daumen über den glatten ovalen Mondstein, den sie um den Hals trug. Sie sah nachdenklich aus, so als würde sie nicht recht schlau aus mir.
»Und?« Sie verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich mit der Schulter gegen den Verandapfosten. »Was halten Sie davon?«
»Es ist so still.«
Mit einem versonnenen Lächeln legte sie den Kopf in den Nacken und schaute in den Himmel. »Genau das liebe ich an diesem Ort.«
Ihre Stimme klang rauchig, was mir bisher noch gar nicht aufgefallen war, und sie sah plötzlich auch ganz anders aus. Nein, nicht anders, korrigierte ich mich. Sie sah aus – als sei sie mehrsie selbst. Ihre Figur wirkte voller, ihre Haut glatter und weicher, und ihr dunkles Haar war auf einmal so üppig, dass ich mich fragte, ob sie während der Autofahrt eine Perücke aufgesetzt hatte. Alles an ihr – das Funkeln in ihren Augen, der geheimnisvolle Zug um ihre Lippen, diese erdige Sinnlichkeit – schien von dem natürlichen Schauplatz verstärkt zu werden.
Aus irgendeinem Grund musste ich auf einmal an das Foto in ihrem Büro denken und an das wütende Gesicht, das im Hintergrund lauerte. Dann hörte ich plötzlich wieder den Wind in den Bäumen, ganz leise. Ich blickte am Haus hinauf.
»War das hier früher einmal eine Kirche?«
Erstaunt legte Luna den Kopf schräg. »Woher wissen Sie das?«
»Der Baustil ist neugotisch, wenn ich mich nicht irre. Er wurde im neunzehnten Jahrhundert meist für kleinere Kirchen verwendet.« Es wunderte mich, dass Luna als vorübergehende Unterkunft für mich ausgerechnet diesen Ort ausgesucht hatte. Der geweihte Boden von Kirchen und einigen Friedhöfen bot Schutz vor Geistern. Doch woher hätte sie wissen sollen, dass ich genau das brauchte?
»Was ist mit der Kirche passiert?«, fragte ich.
Ihre grauen Augen musterten mich neugierig. »Nichts Außergewöhnliches. Die Gemeinde ist geschrumpft, sodass es irgendwann naheliegend war, in eine der größeren Kirchen in Woodberry zu gehen. Etliche Jahre stand das Gebäude leer, dann hat Floyd Covey es gekauft, es ausbauen und komplett renovieren lassen. Mit allem modernen Komfort. Sie sollten sich hier eigentlich recht – wohlfühlen.«
Ich bemerkte das leichte Zögern, doch nickte bloß und folgte ihr ins Haus. Kurz blieb ich auf der Türschwelle stehen, damit der Frieden des geweihten Bodens mich einhüllen konnte. Ja, ich würde mich hier wohlfühlen, aber was noch viel wichtiger war: Ich wäre hier sicher. Was einmal mehr die Frage aufwarf, warum Luna Kemper ausgerechnet dieses Haus für mich ausgesucht hatte. Ein Zufall?
»Sie haben am Telefon eine anonyme Spende erwähnt«, sagte ich, während ich zusah, wie sie sich anmutig durch den Raum bewegte. Sie schien sich regelrecht in der Spätnachmittagssonne zu aalen, die durch die hohen Bogenfenster fiel, und erinnerte mich an die graue getigerte Katze in ihrem Büro – geschmeidig, exotisch und ein bisschen überlegen. »Ich fragte mich gerade, ob diese Person etwas mit meiner Anstellung zu tun hat. Ich bin nicht die einzige Friedhofsrestauratorin in South Carolina. War es Ihre Idee, mich zu engagieren, oder die des Spenders?«
Luna lächelte. »Spielt das irgendeine Rolle?«
»Eigentlich nicht. Ich bin nur neugierig, wie ich zu diesem Auftrag gekommen bin.«
»Das ist kein großes Geheimnis. Es war wirklich so einfach, wie ich Ihnen erzählt habe«, erwiderte sie.
»Und diese Unterkunft, war das auch Ihre Idee?«
»Ich bin die einzige Immobilienmaklerin in Asher Falls. Wer wüsste besser als ich, welche Häuser gerade zu haben sind? Falls Sie mit der Unterkunft aber nicht zufrieden sein sollten …«
»Nein, das ist es nicht. Das Haus ist ideal.«
Sie lächelte wissend und sagte: »Dann zeige ich Ihnen jetzt den Rest.«
Wieder folgte ich ihr pflichtschuldig. Auf der einen Seite des Hauses befanden sich die Schlafzimmer und das Bad, auf der anderen das Wohnzimmer und die große Wohnküche. Die Veranda an der Ostseite war rundum verglast, sodass ich mich jetzt schon darauf freute, morgens dort zu sitzen, meinen Tee zu trinken und den Sonnenaufgang zu bewundern.
Hintereinander gingen wir über einen mit Steinplatten gepflasterten Weg zum See hinunter und auf den privaten Anlegesteg. Als die Sonne hinter den Baumkronen verschwand, spürte ich die mir so vertraute bange Vorahnung, diesen unheimlichen Vorboten, der mir zu jeder Dämmerung wie ein Schauer über den Rücken kroch. Der Schleier hob sich. Schon bald würden die Geister hindurchschweben.
Am Ende des Steges schaukelte ein Boot auf den sanften Wellen, aber sonst regte sich nichts. Und ich hörte nichts. In dieser Zwischenzeit, zwischen Licht und Dunkel, regten sich die Geschöpfe der Nacht noch nicht.
Die Luft wurde unangenehm kühl. Ich war froh, dass ich meine Jacke dabeihatte, während ich auf das Wasser blickte. Ich sah etwas auf der Oberfläche erscheinen und dachte schon, es sei wieder ein Geist, dann stellte ich erleichtert fest, dass es mein eigenes verschwommenes Spiegelbild war.
Ich wollte mich gerade umdrehen und etwas zu Luna sagen, als ich aus den Augenwinkeln etwas erblickte. Ein dürrer brauner Köter – ein Schäferhundmischling – stand am Ende des hölzernen Stegs. Er starrte zu uns herüber. Der Hund war so ausgemergelt, dass sich die Rippen deutlich unter dem Fell abzeichneten. Was mich aber noch mehr verstörte, waren die Missbildungen des armen Tiers. Der Hund hatte keine Ohren mehr, seine Nase und seine Schnauze waren durch irgendeine schwere Verletzung schrecklich vernarbt.
»Was ist mit dem Hund passiert?« Ich sprach ganz leise, um ihn nicht zu erschrecken, doch als Luna sich ruckartig umdrehte, zuckte er zusammen.
Luna blickte finster und ablehnend drein. »Sieht aus wie ein Köderhund.«
»Ein was?«
»Wissen Sie etwas über Hundekämpfe?«
Mir drehte sich der Magen um. »Ich weiß, dass es illegal ist. Und dass mir schlecht wird, wenn ich bloß daran denke.«
Geistesabwesend nickte sie. »Man schneidet den Köderhunden oft die Ohren ab, um unnötige Verletzungen zu vermeiden, und bindet ihnen die Kiefer mit Draht zu, damit sie die Kampfhunde nicht beißen können. Wenn die Besitzer keine Verwendung mehr für sie haben, lassen sie die Tiere laufen.«
Eine unbändige Wut überkam mich. »Wie kann jemand so grausam sein?«
»Wir sind hier nicht in Charleston«, warnte sie mich. »Sie werden in dieser Gegend noch so einiges sehen, was Sie nicht verstehen.«
»Was gibt es bei Tierquälerei nicht zu verstehen?«, entgegnete ich voller Abscheu. »Dieser Hund ist misshandelt worden, wir müssen ihn zu einem Tierarzt bringen.«
»Zu einem Tierarzt? So etwas gibt es hier weit und breit nicht. Am besten lassen Sie ihn einfach in Ruhe. Irgendwann verzieht er sich wieder in den Wald.«
»Aber er braucht Hilfe!« Ich wollte gerade auf das Tier zugehen, als Luna mich am Arm packte und zurückhielt.
»Das würde ich lieber nicht tun. Er könnte die Tollwut haben.«
»Er sieht nicht tollwütig aus, nur hungrig.«
»Um Gottes willen, füttern sie den Köter bloß nicht!«
Ihre Heftigkeit erschreckte mich, ich musterte sie und spürte, wie mir vor Wut die Hitze in die Wangen stieg.
Bevor ich sie aufhalten konnte, klatschte sie laut in die Hände und scheuchte die arme Kreatur fort. »Verschwinde! Hau ab, los!«
»Lassen Sie das!«
Jetzt war ich diejenige, die sie am Arm packte. Augenblicklich fuhr sie zu mir herum und fixierte mich mit lodernden Augen. Ich hielt ihrem aggressiven Blick stand, doch die Art, wie sie boshaft die Lippen aufeinanderpresste, ging mir durch Mark und Bein. Fast wäre ich einen Schritt vor ihr zurückgewichen, doch ich fing mich wieder. Wir blitzten einander eine Weile an, dann entspannten sich ihre Züge so schnell, dass ich dachte, ich hätte mir diese beunruhigende Konfrontation nur eingebildet.
»Streunende Hunde gibt es hier viele, fürchte ich.« Bedauernd zuckte sie die Schultern. »Sie können sie nicht alle füttern, und Sie sollten auch nicht übermäßig sentimental werden. Aber ich schätze, Sie werden es auf die harte Tour lernen.«
Ich hatte keine Lust, weiter mit ihr zu streiten, also ließ ich es dabei bewenden. Der Hund hatte sich an den Waldrand zurückgezogen, von wo aus er uns in der zunehmenden Dunkelheit misstrauisch beobachtete. Er blieb noch eine Weile dort stehen, dann verschwand er zwischen den Bäumen.
Luna schaute auf ihre Armbanduhr. »Ich sollte in die Stadt zurückfahren. Ich habe heute Abend eine Sitzung.«
Wir gingen um das Haus herum zur Auffahrt.
»Falls Sie irgendetwas brauchen, haben Sie ja meine Telefonnummer.« Sie hatte es plötzlich eilig, von hier wegzukommen und öffnete die Tür ihres Wagens. »Die Nachbarin, die Ihnen am nächsten wohnt, heißt Tilithia Pattershaw. Alle hier nennen sie Tilly. Sie passt auf das Haus auf, während Floyd weg ist. Ich hatte sie gebeten, gestern vorbeizukommen, das Haus zu putzen und Ihnen ein paar Lebensmittel in den Kühlschrank zu stellen. Sie wohnt gleich am Ende des Pfads.« Sie wedelte mit der Hand in Richtung Wald. »Es kann sein, dass sie ab und zu vorbeischaut, um zu sehen, ob bei Ihnen alles in Ordnung ist. Machen Sie sich keine Sorgen. Tilly ist ein bisschen speziell, aber sie meint es gut.«
»Ich werde die Augen nach ihr offen halten.«
Luna lächelte, während ihr Blick Richtung Wald wanderte. »Oh, Sie werden Tilly erst sehen, wenn sie gesehen werden will.«
Ich folgte ihrem Blick zu den Bäumen. War die Frau gerade dort draußen?, fragte ich mich.
»Der Friedhof ist etwa zwei Kilometer die Straße hinauf«, sagte Luna. »Gleich wenn Sie um die erste Kurve biegen, kommt eine Abzweigung. Sie werden sie sehen.«
»Danke.«
Luna stieg in ihren Wagen, ließ den Motor an und winkte mir zu, als sie losfuhr. Das Motorgeräusch verklang schließlich, die Stille wurde tiefer. Ich drehte mich um und musterte wieder die Baumreihen.
FÜNF
Als Luna fort war, trug ich mein Gepäck ins Haus, ging noch einmal zum Wagen und überprüfte, ob ich auch nichts vergessen hatte. Als ich mich vom Auto abwandte, spürte ich wieder das warnende Prickeln und bemerkte, dass sich die Dämmerung verfinsterte. Der Abend war ruhig, aber nicht mehr ganz so still. Irgendwo draußen auf dem See konnte ich das Trillern eines Seetauchers hören und noch weiter entfernt das unheimliche Heulen eines Hundes. Ich dachte an den Streuner, der vorhin aus dem Wald geschlichen war, und fragte mich, wohin er sich wohl verkrochen hatte.
Wieder im Haus, ging ich direkt ins Schlafzimmer, packte meine Kleider und Toilettenartikel aus. Dann machte ich einen weiteren Streifzug durch die Räume, um mich mit allen Ecken und Winkeln vertraut zu machen und zu überprüfen, ob die Türen und Fenster auch fest verschlossen waren. Mein Rundgang endete in der Küche, wo ich nachschaute, was Tilly Pattershaw mir als Abendessen in den Kühlschrank gestellt hatte. Nachdem ich die Alufolie von einer geheimnisvollen Auflaufform gezogen hatte, schnupperte ich kurz und verzog das Gesicht. Zum Glück waren im Gemüsefach genug frische Sachen, aus denen ich mir einen Salat machen konnte. Zum Essen setzte ich mich an einen kleinen Tisch mit Blick auf den See. Auch den Wald konnte ich von hier aus sehen und den Pfad, von dem Luna behauptet hatte, er führe zu Tillys Haus. Ich bemerkte, dass sich in den Ästen, die tief über den Weg hingen, etwas bewegte. Umgehend begann meine Kopfhaut warnend zu kribbeln. Dabei konnte ich gar nichts Konkretes erkennen, es war mehr ein nagender Verdacht, dass da draußen etwas war. Vielleicht Tilly?
Ich wollte nicht direkt in den Wald starren, aus Angst, dass der Besucher nicht von dieser Welt sein könnte. Also tat ich so, als bewunderte ich die letzten Lichtreflexe auf dem Wasser, doch aus den Augenwinkeln behielt ich den Wald im Blick. Kurze Zeit später löste sich ein Schatten aus der Dunkelheit der Baumreihen und bewegte sich auf das Haus zu.
Mein Herz schlug wie wild, da erkannte ich, dass es der geprügelte Hund war. Offensichtlich hatte er sich im Wald verkrochen und gewartet, bis Luna verschwand, bevor er sich vorsichtig wieder hervorwagte. Er schnüffelte eine Weile herum und wühlte mit der Schnauze im Laub. Als er nichts Interessantes fand, ließ er sich genau in meinem Blickfeld, zwischen Haus und See, zu Boden fallen. Selbst in dem schwindenden Licht konnte ich sehen, wie verstümmelt sein Kopf war und wie seine Rippen hervorstachen. Und doch: Trotz allem, was er durchgemacht hatte, drückte seine Haltung Würde aus, eine große Seele.
Ich stand auf, durchsuchte noch einmal den Kühlschrank, warf etwas von dem unappetitlichen Gemisch aus Auflauf und Reis in eine Schüssel und trug sie nach draußen. In dem Wissen, dass es immer dunkler wurde, ging ich vorsichtig die Stufen hinunter. Ich stellte die Schüssel auf halbem Weg zwischen der Veranda und der Stelle, an der der Hund lag, auf den Boden. Er rührte sich nicht vom Fleck, bis ich mich hinter die Fliegengittertür zurückgezogen hatte. Dann trottete er herüber, um an der Schüssel zu riechen. Innerhalb weniger Sekunden war sie vollständig ausgeleckt. Er stand da und blickte mich aus klaren dunklen Augen an.
Ohne einen Gedanken an Gefahr zu verschwenden, öffnete ich die Tür und ging langsam die Stufen hinunter. Der Hund schaute auf die leere Schüssel, winselte leise und kam schließlich zu mir, um seine Nase an meiner Hand zu reiben. Ich streichelte ihn zwischen den Wunden, an denen seine Ohren hätten sein sollen, umfasste seine vernarbte Schnauze sanft mit den Händen. Wieder winselte er, dieses Mal eher zufrieden, wie ich meinte. Ich strich ihm mit der Hand über den Körper, um seine Knochen zu betasten.
»Hast du immer noch Hunger? Na ja, mach dir keine Sorgen. Es gibt noch jede Menge davon, doch wir warten lieber ein bisschen, damit dir nicht schlecht wird. Morgen fahre ich in die Stadt und besorge dir anständiges Futter.«
Seine Nase fühlte sich an meiner Hand kühl und feucht an.
»Wie heißt du eigentlich? Oder hast du gar keinen Namen? Für mich siehst du aus wie ein Angus. Stark und vornehm. Angus. Das hört sich gut an.«
Mit leiser, sanfter Stimme redete ich weiter, bis er sich vor meine Füße plumpsen ließ. Ich musste mich über ihn beugen, um ihn weiter zu kraulen. Eine ganze Weile blieben wir so, bis ich plötzlich spürte, dass er sich unter meiner Hand anspannte. Das Fell auf seinem Rücken stellte sich auf, und er knurrte leise, drohend.
Ich streichelte ihn weiter, doch er erhob sich und starrte nun in Richtung See. Ich lugte aus den Augenwinkeln an ihm vorbei, doch sah zunächst nichts. Dann gewöhnten sich meine Augen an das Zwielicht. Meine Nackenhaare sträubten sich wie Angus‘ Fell.
Sie stand einfach nur da, am Ende des Anlegesteges, eine durchsichtige Gestalt, schwankend wie ein Schilfrohr in der Strömung. Obwohl mein Herz hämmerte wie wild, ließ ich mir nichts anmerken. Irgendwie gelang es mir, Angus etwas zu beruhigen, der wild die Zähne fletschte. Tiere – ob Haustiere oder frei lebende – sind sehr empfänglich für Geister. Sie können sie nicht nur sehen, sondern sie spüren ihre Gegenwart auch. Das war einer der Gründe, weshalb Papa mir nie erlaubt hatte, ein Haustier zu halten. Es war so schon schwer genug, die Geister zu ignorieren, ohne ein Tier, das heftig auf sie reagierte.
»Was ist los?«, fragte ich Angus scheinbar unwissend. »Du hast ja wohl keine Angst vor der Dunkelheit, oder? Da draußen ist nichts, nur ein paar Eichhörnchen, Hasen und das eine oder andere Opossum.«
Und ein Geist.
Ich konnte ihr Gesicht nur vage erkennen, da ich sie nicht direkt ansah, aber anscheinend war sie bei ihrem Tod noch jung gewesen. Sie hatte langes welliges Haar, das ihr von einem unwirklichen Wind über die Schultern geweht wurde, und trug ein schwarzes Kleid, das viel zu streng war für ihre gertenschlanke Gestalt. Sie sah genau so aus, wie man sich einen Geist vorstellte – vergänglich, zart und liebreizend, ohne irgendein äußeres Anzeichen von körperlicher Qual, die sie vielleicht im Leben durchlitten hatte.
Dann richtete sie plötzlich ihren toten Blick auf mich. Ich schaute sie nicht an, aber ich konnte es spüren. Wie einen eisigen Befehl.
Sieh mich an!
Das war verrückt, denn sie konnte nicht wissen, dass ich von ihrem Dasein wusste. Ich hatte nichts getan, wodurch ich mich hätte verraten können. Und dennoch spürte ich etwas in meinem Kopf, in meinem Verstand – als wäre dort ein nebelhafter Fangarm, der mir das nackte Grauen durch den Körper jagte. So etwas hatte ich noch nie erlebt, nicht einmal mit Devlins Geistern. Shani, seine tote Tochter, hatte schon zweimal Kontakt zu mir aufgenommen. Mariamas Totengeist hatte mich sogar dazu gebracht, in Devlins Haus zu gehen. Aber so etwas wie das hier war mir noch nie passiert. Was ich jetzt fühlte, war keine Heimsuchung, sondern eher eine Art telepathische Verbindung, die es mir erlaubte, die Verwirrung des Geistes zu spüren. Diese intime Verbindung entsetzte mich. Ich musste meine ganze Willenskraft aufbieten, um nicht aufzuspringen und ins Haus zu rennen. Denn ich wusste es besser. Das Gefährlichste, was ich nun tun konnte, war, der Toten zu zeigen, dass ich sie wahrnahm.
Angus hatte seinen zitternden Körper inzwischen genau zwischen die Erscheinung und mich manövriert. Stark und vornehm, in der Tat. Ich hätte ihn in diesem Moment nicht mehr lieben können, wenn wir bereits zeitlebens Freunde gewesen wären. Denn ich war mir ziemlich sicher, dass er nichts lieber getan hätte, als den Schwanz einzuziehen und in den Wald zu flüchten.
»Guter Junge«, flüsterte ich.
Ein sanfter Wind kräuselte die Blätter, die Bäume begannen zu flüstern.
Wer bist du? Warum bist du hier?
Langsam stand ich auf und ging ins Haus. Der Geist der toten Frau stand immer noch am Ende des Anlegestegs und starrte mir nach. Angus winselte, ich öffnete die Fliegengittertür, damit er auf die verglaste Veranda springen konnte. Als ich mich umdrehte, um die Tür zu verriegeln, seufzte abermals der Wind in den Bäumen.
Bist du es wirklich?
Fast solange ich denken kann, waren Geister Teil meines Lebens gewesen. Sonntags nahm Papa mich am Nachmittag immer mit zum Friedhof, wo ich ihm half, die Gräber zu richten, während wir auf die Dämmerung warteten. Die Zeit des Tages, in der sich der Schleier hebt und die Geister in unsere Welt schlüpfen können. Am Anfang hatte ich versucht, diese Ausflüge zu vermeiden, aber dann begriff ich, dass dies Papas Art war, mir beizubringen, mit unserer Gabe zu leben. Nach einiger Zeit hatte ich mich so sehr an diese schwebenden Wesen gewöhnt, dass ich nicht einmal dann auf sie reagierte, wenn ich ihren eisigen Atem im Nacken oder ihre frostkalten Finger in meinem Haar spürte. Ich konnte sogar zwischen ihnen umherspazieren, ohne mich zu verraten.
Aber dann war Devlin in mein Leben getreten, und seitdem konnten mich Papas Regeln nicht mehr schützen. Meine Abwehr war von seinen Geistern durchbrochen worden.
Heute Abend hatte sich ein neues Phantom Zutritt zu meiner Welt verschafft – ein Phantom mit der Fähigkeit, mich ebenso seine Verwirrung spüren zu lassen, wie es vermutlich meine spüren konnte. Diese unmittelbare Form der Verbindung war neu und beängstigend, denn jetzt musste ich nicht mehr nur meine körperlichen Reaktionen kontrollieren, sondern auch meine Gedanken. Was würde ich als Nächstes schützen müssen … meine Seele?
In dieser Nacht lag ich endlos lange wach und stellte mir die gleichen Fragen. Ich hatte nie verstanden, welchen Platz ich in dieser Welt oder in der nächsten hatte. Warum besaß ich diese Gabe, wenn nicht für irgendeinen höheren Zweck? Papa hatte mir diese Fragen auch nie beantworten können. Er sprach nicht gern über die Geister. Er sagte immer nur, sie seien unser Geheimnis, das Kreuz, das wir zu tragen hätten, und dass wir Mama nie ein Wort davon sagen dürften, niemals. Denn sie würde es nicht verstehen.
Wenn ich jetzt zurückblickte, wurde mir bewusst, wie einfach er mich stets abgewimmelt hatte; was die Geister anging, was meine Geburt anging, alles. Er und Mama hatten mich aufgenommen, als ich gerade erst ein paar Tage alt gewesen war, aber ich wusste bis heute nicht, wie genau ich zu ihnen kam oder wer meine leiblichen Eltern waren. Auf mein Nachfragen hin hatten sie stets mit einer Vorsicht reagiert, die ein solches Unbehagen in mir auslöste, dass ich schließlich aufhörte zu fragen. Doch ich wusste, dass es Dinge gab, die sie mir verheimlichten. Vor allem Papa. Er hatte das Reich der unsichtbaren Geister – die er schlicht die Anderen