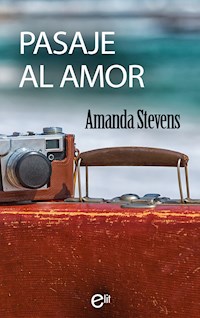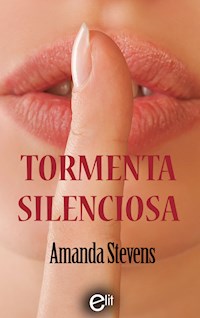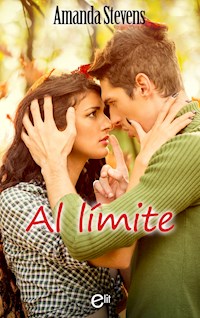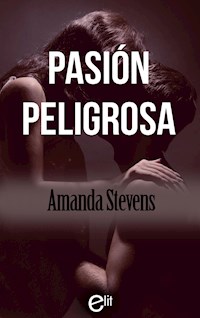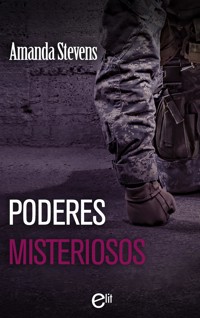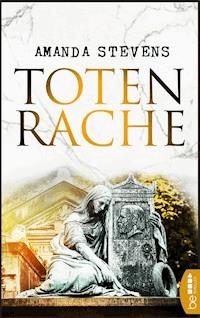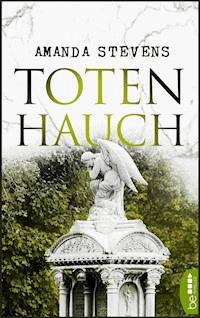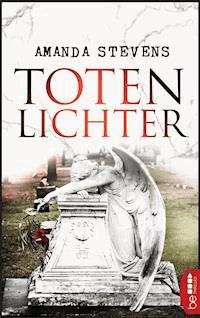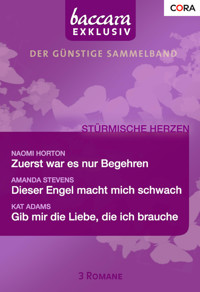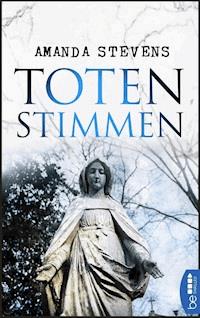
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Graveyard-Queen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Seit ihrer Kindheit lebt die Friedhofsrestauratorin Amelia Gray mit einer geheimen und gleichzeitig gefährlichen Gabe: Sie kann die Geister der Toten sehen. Mit ihnen zu kommunizieren ist eigentlich unmöglich, bis Amelia eines Tages direkt von einem Geist angesprochen wird. Und er stellt sie vor ein Ultimatum: Er droht damit, sie auf ewig zu verfolgen und von ihrer Lebensenergie zu zehren - es sei denn, sie findet seinen Mörder ...
Die Graveyard-Queen Reihe jetzt als eBook bei beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
NEUNUNDZWANZIG
DREISSIG
EINUNDDREISSIG
ZWEIUNDDREISSIG
DREIUNDDREISSIG
VIERUNDDREISSIG
FÜNFUNDDREISSIG
SECHSUNDDREISSIG
SIEBENUNDDREISSIG
ACHTUNDDREISSIG
NEUNUNDDREISSIG
VIERZIG
EINUNDVIERZIG
EPILOG
Über dieses Buch
Seit ihrer Kindheit lebt die Friedhofsrestauratorin Amelia Gray mit einer geheimen und gleichzeitig gefährlichen Gabe: Sie kann die Geister der Toten sehen. Mit ihnen zu kommunizieren ist eigentlich unmöglich, bis Amelia eines Tages direkt von einem Geist angesprochen wird. Und er stellt sie vor ein Ultimatum: Er droht damit, sie auf ewig zu verfolgen und von ihrer Lebensenergie zu zehren – es sei denn, sie findet seinen Mörder …
Die Graveyard-Queen Reihe
Die Verlassenen (Novella)
Totenhauch
Totenlichter
Totenstimmen
Totenrache
Über die Autorin
Amanda Stevens ist in Missouri, in der Nähe des Ozark-Plateaus, geboren und aufgewachsen. Sie fühlte sich schon immer zu düsteren Themen hingezogen, liebt Friedhöfe, ist eine passionierte Leserin von Geistergeschichten und Fan von Alfred Hitchcock. In der Graveyard-Queen-Trilogie kombiniert sie auf gelungene Weise Elemente des Thrillers mit denen des Gruselromans.
Stevens lebt mit ihrem Ehemann und einer schwarzen Katze namens Lola in Houston, Texas. Weitere Informationen finden Sie auf ihrer Website: www.amandastevens.com
Amanda Stevens
Totenstimmen
Aus dem Amerikanischen vonDiana Beate Hellmann
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment | Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2012 by Marilyn Medlock Amann
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »The Prophet«
Originalverlag: Mira Books
Dieses Buch wurde vermittelt durch die Literaturagentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2015/2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Monika Hoffko, Scripta Literaturagentur
Covergestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven © shutterstock: ZINGAYA TEXTURING | Taigi
eBook-Erstellung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7325-5749-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
EINS
Irgendetwas folgte mir seit Tagen. Ich wusste nicht, ob es ein Mensch war, ein Totengeist oder ein Wesen beider Welten – so wie ich. Ich erhaschte nie mehr als einen flüchtigen Schemen aus den Augenwinkeln, nie mehr als das kurze Aufflackern von Licht oder einen vorüberhuschenden Schatten. Aber es war auch jetzt da, ganz in meiner Nähe. Etwas Dunkles, das mich auf Schritt und Tritt begleitete, das rechts oder links abbog, wenn ich es tat, und langsamer wurde, wenn ich langsamer wurde.
Obwohl mein Herz raste, bemühte ich mich, ruhig und gleichmäßig zu gehen, während ich mich dafür schalt, dass ich mich so weit von geweihtem Boden entfernt hatte. Ich hatte zu lange auf meinem Lieblingsmarkt herumgetrödelt, und jetzt nahte die Dämmerung. Diese gefährliche Zeit, zu der der Schleier dünner wurde, sodass die Geister in unsere Welt gleiten und nach dem suchen konnten, was sie am meisten begehrten: die Wärme der Lebenden.
Seit ich neun Jahre alt war, hatte mein Vater mir beigebracht, wie ich mich vor diesen parisitären Wesen schützen konnte. Aber ich hatte alle seine Regeln gebrochen und mich in einen Mann verliebt, der von Geistern heimgesucht wurde. Dadurch hatte sich eine Tür geöffnet, eine Pforte, die es den Anderen ermöglichte, zu mir zu kommen. Und die es dem Bösen ermöglichte, mich zu finden.
Ein Wagen bretterte die Straße hinunter. Ich spannte mich an, obwohl mir ein so normales Geräusch im Grunde lieb war. Doch das Dröhnen des Motors verhallte sehr schnell, und die nachfolgende Stille hatte etwas Unheilvolles. Der Berufsverkehr hatte bereits nachgelassen. Es waren ungewöhnlich wenige Fußgänger und Jogger auf der Straße, ich hatte den Bügersteig ganz für mich allein. Es war, als wäre alles in den Hintergrund gerückt, als bestünde meine Welt nur noch aus dem dumpfen Geräusch meiner Schritte und meinem Herzschlag.
Ich wechselte meine Einkaufstasche von der einen Hand in die andere, sodass ich einen kurzen Blick nach links werfen konnte, wo die Sonne gerade über dem Ashley River untergegangen war. Der fleckige Himmel erstrahlte wie die Glutnester in einem erlöschenden Feuer. Das Licht warf einen goldenen Glanz auf die Spitzen und Türme, die die niedrige Skyline der sogenannten Stadt der Kirchen bestimmten.
Es war gut, wieder in meinem geliebten Charleston zu sein. Doch ich war nervös seit meiner Rückkehr. Dass meine Nerven blank lagen, war die Folge des emotionalen und körperlichen Traumas, das ich während einer Friedhofsrestaurierung in den Ausläufern der Blue Ridge Mountains erlitten hatte. Es gab aber noch einen anderen Grund, warum ich weder essen noch schlafen konnte; da war eine noch tiefer sitzende Unruhe, die mich dazu trieb, Tag und Nacht rastlos umherzuziehen.
Zitternd holte ich Luft.
Devlin.
Der von Geistern heimgesuchte Detective, der mir nicht mehr aus dem Kopf ging und auch nicht aus dem Herzen. Der bloße Gedanke an ihn war bereits wie eine geheimnisvolle Liebkosung, wie ein verbotener Kuss. Und jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, konnte ich sein aristokratisch langsames, schleppendes Flüstern hören, diese so verführerische Sprechweise. Ohne große Anstrengung konnte ich das brennende Verlangen seines perfekt geschwungenen Mundes auf meinem spüren, die honigsüße Berührung seiner Zunge, diese eleganten, forschenden Hände …
Ich richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf die Straße und blickte über die Schulter. Was immer mir da nachstellte, hielt jetzt entweder größeren Abstand, oder es war verschwunden. Meine Furcht ließ nach, wie immer, wenn ich mich geweihtem Boden näherte.
Da rief irgendwo in den Baumkronen ein Vogel. Das Geräusch überraschte mich so sehr, dass ich wie angewurzelt stehen blieb, um zu lauschen. Ich hatte dieses Trillern bisher nur ein einziges Mal gehört, und zwar im abendlichen Dunkel eines Innenhofes in Paris. Das Ständchen war mit nichts zu vergleichen. Einfühlsam und verträumt. Als würde man bei Kerzenlicht in einem warmen Bad liegen. Ich hätte den Vogel für eine Nachtigall gehalten, doch die gab es nur in Europa, und selbst dort hatten sie sich zu dieser Jahreszeit bereits auf ihren Fünftausend-Kilometer-Flug nach Afrika gemacht, um zu überwintern.
Mit dem Gesang des Vogels sank ein Duft auf mich herab, üppig und exotisch. Weder das Geräusch noch dieser Duft gehörten in diese Stadt – vielleicht nicht einmal in diese Welt. Warnend stellten sich mir die Nackenhaare auf.
Ich hörte ein Flüstern und drehte mich um, erwartete fast, Devlin aus der Dunkelheit treten zu sehen; genau so wie er in jener Nacht, als wir einander zum ersten Mal begegnet waren, aus dem Nebel aufgetaucht war. Ich hatte immer noch vor Augen, wie er damals ausgesehen hatte: ein rätselhafter Fremder, ein Mann, der auf so geheimnisvolle Weise attraktiv und grüblerisch war, als wäre er direkt den Fantasien meiner Pubertät entsprungen.
Aber Devlin stand nicht hinter mir. Um diese Uhrzeit war er vermutlich noch im Polizeipräsidium. Ich hatte nur Blätter rascheln hören, sagte ich mir. Das geisterhafte Flüstern meiner eigenen Sehnsucht.
Und dann wehte aus der Ferne das Lachen eines Kindes zu mir herüber, gefolgt von leisem Gesang. Irgendwie kam mir die Stimme bekannt vor, obwohl ich sie noch nie zuvor gehört hatte. Das Bild von Devlins verstorbener Tochter nahm vor meinem geistigen Auge so deutlich Gestalt an, als stünde sie vor mir.
Mein Vater hätte mich jetzt ermahnt, mich an die Regeln zu halten. Ich betete sie mir vor, während ich mich langsam umdrehte und mit den Augen die wachsende Dämmerung absuchte: Lass die Toten niemals wissen, dass du sie sehen kannst; entferne dich nie zu weit von geweihtem Boden; halte dich fern von Menschen, die von Geistern heimgesucht werden, und fordere das Schicksal nie heraus, niemals.
Wieder drang die Stimme des Geisterkindes zu mir. Komm, Amelia, suche mich!
Ich hatte keine Ahnung, warum ich sie nicht einfach ignorierte und meines Weges ging. Ich muss verzaubert gewesen sein. Das war die einzig mögliche Erklärung.
Die Nachtigall sang mir schmachtend zu, als ich vom Bürgersteig in eine schmale Gasse trat und zu einem verschnörkelten Tor ging, das in den von einer Mauer umgebenen Garten eines Privathauses führte. Indem ich hineinging, setzte ich mich der Gefahr aus, wegen unbefugten Betretens erschossen zu werden, sobald man mich entdeckte. Die Charlestoner lieben ihre Waffen. Doch ich war diesem seltsamen hypnotischen Zauber erlegen, und so hielt mich dieser Gedanke ebenso wenig zurück wie Papas Regeln.
Monate zuvor, als ich Shanis Totengeist zum ersten Mal an Devlins Seite hatte schweben sehen, hatte sie versucht, Verbindung mit mir aufzunehmen. Deswegen war sie mir an jenem ersten Abend nach Hause gefolgt und hatte einen winzigen Granatring in meinem Garten zurückgelassen. Dieser Ring war eine Botschaft gewesen, genau wie das Herz, das sie an mein Fenster gemalt hatte. Sie wollte mir etwas sagen.
Hier entlang. Beeil dich! Bevor sie kommt…
Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Um mich herum lauerte Gefahr. Ich konnte jetzt spüren, wie sie näher und näher kam, doch ich ging trotzdem weiter, folgte der Nachtigall und diesem verführerischen Duft durch ein Labyrinth aus Buchsbaumhecken und Palmettopalmen über Pfade, die von Nachtkerzen und Löwenmäulchen gesäumt waren. Das Plätschern eines Brunnens vermischte sich mit Shanis ätherischem Lachen. Im nächsten Moment stellten sich mir die Nackenhaare auf, denn sie fing an zu singen:
»Der kleine Dicky Dilver
Hatt’ ’ne Frau aus Silber.
Nahm ’nen Stock, brach ihr das Kreuz,
Verkauft’ sie an den Müller.
Der Müller wollt’ sie nicht haben,
Da warf er sie in den Graben.«
Es war ein scheußlicher Reim, ein Reim, den ich seit Jahren nicht mehr gehört hatte. Und durch den unschuldigen Klang von Shanis Singsang wirkten die Zeilen noch grotesker, als sie es ohnehin schon waren.
Ich kämpfte gegen diese unheimliche Lähmung an und drehte mich um, um auf dem gleichen Weg zum Tor zurückzugehen, auf dem ich gekommen war. Doch da materialisierte sie sich plötzlich hinter mir auf dem Gehweg, zunächst nur als ein Lichtschimmer, dann nahm sie langsam die Gestalt eines Kindes an. Zugleich wurde es in dem Garten immer kälter. Ich war erschrocken – eigentlich entsetzt –, denn ich wusste, dass ich hier etwas sehr Gefährliches tat. Ich ließ die Toten nicht nur wissen, dass ich sie sehen konnte, ich forderte geradezu das Schicksal heraus.
Doch das alles spielte in diesem Moment anscheinend keine Rolle. Ich konnte mich nicht abwenden. Ich konnte den Blick nicht losreißen von diesem schemenhaften Geist, der mir den Weg versperrte.
Shani trug ein blaues Kleid mit einer dazu passenden Schleife im Haar, und in der Spitzenborte um ihre Taille steckte ein Jasminzweig. Eine Mähne aus drahtigen Locken umrahmte ihr zartes Gesicht und verlieh ihr einen so gewinnenden Liebreiz, dass mir der Atem stockte. Sie erstrahlte in einer ganz weichen Aura, silbrig und durchscheinend, aber ihre Gesichtszüge konnte ich genau erkennen. Die hohen Wangenknochen, die dunklen Augen und die milchkaffeefarbene Haut verrieten ihr kreolisches Erbe. Ich glaubte, etwas von ihrer Mutter in dem hauchzarten Gesichtchen erkennen zu können. Doch nichts von Devlin. Der Goodwine-Einfluss war viel zu dominant.
Ganz absichtsvoll zog das Geisterkind den Jasminzweig aus dem Spitzenbund und hielt ihn mir hin.
Ich sollte ihn nicht nehmen. Die einzige Möglichkeit, mit Geistern umzugehen, bestand darin, sie nicht zu beachten und so zu tun, als würde man sie nicht sehen.
Aber dafür war es jetzt zu spät. Fast wie von selbst hob sich meine Hand und griff nach der Blume.
Der Geist schwebte näher – zu nah –, bis ich die Eiseskälte des Todes spüren konnte, die von ihrer winzigen Gestalt ausging. Mit den Fingerspitzen berührte ich die samtweichen Blüten, die sie mir entgegenhielt. Die Blütenblätter fühlten sich echt an, so warm und so geschmeidig wie meine eigene Haut. Ich konnte mir nicht erklären, wie das möglich war. Sie hatte sie von der anderen Seite mitgebracht. Die Blüten hätten eigentlich verwelken müssen.
Für dich.
Sie sprach nicht, aber ich hörte sie trotzdem. Ihre Stimme war in meinem Kopf, sie klang so süß und gefühlvoll wie das schwache Klimpern einer Kristallglocke. Ich hob den Jasmin an die Nase und ließ meine Sinne von dem berauschenden Duft betören.
Hilfst du mir?
»Ich soll dir helfen … aber wie denn?«, hörte ich mich fragen. Meine Stimme klang weit entfernt und hohl wie ein Echo.
Sie hob ihren zarten Zeigefinger und legte ihn an die Lippen.
»Was ist los?«
Sie schien zu verblassen, und zugleich begann die Luft im Garten zu vibrieren und sich zu bewegen. Mein Herz raste immer noch; ich sah, wie sich meine Atemwölkchen mit einem milchigen Dunst vermischten, der aus der Dunkelheit quoll. Auf einmal hatte ich einen seltsamen Geschmack nach Kupfer im Mund, so als hätte ich mir auf die Zunge gebissen. Doch ich spürte keinen Schmerz. Ich spürte nur eine eiskalte Furcht, die von meiner Brust in alle Glieder kroch und mich lähmte.
Der Jasmin fiel mir aus den gefühllosen Fingern, die Nackenhaare stellten sich mir auf. Es wurde totenstill. Alles in dem Garten hielt inne bis auf diese Spirale aus Dunstschwaden. Gebannt sah ich, wie sie sich auf mich zuschlängelte, sich drehte und wand wie eine Kobra bei einem Schlangenbeschwörer. Meine Nerven waren zum Zerreißen gespannt, so als müsste ich bei der leichtesten Berührung zerspringen.
Doch die Berührung, die folgte, war ganz und gar nicht leicht. Der Schlag war kurz und brutal und warf mich mit solcher Wucht nach hinten, dass ich das Gleichgewicht verlor. Ich stolperte über eine kleine Statue und fiel der Länge nach hin. Der Keramikengel zerbrach auf den Steinplatten, gleich darauf hörte ich Stimmen im Hintergrund, die aus dem Haus drangen. Etwas in mir wusste, dass die Bewohner den Lärm gehört haben mussten, doch meine Aufmerksamkeit war immer noch auf den Gehweg gerichtet. Ein weiterer Geist hatte sich im Garten materialisiert und schwebte nun über mir, die toten Augen glühten in der Dämmerung.
Mariama. Die Mutter von Shani. Devlins verstorbene Ehefrau.
Einen Moment lang war ich wie versteinert und nahm das Flattern ihres hauchdünnen Kleides wahr, die nackten Füße, die üppigen Locken, die ihr über den Rücken fielen. Und dieses spöttische Lächeln. Entsetzlich verführerisch. Selbst im Tod war Mariamas Zauber noch durchdringend und fast mit Händen zu greifen. Genau wie ihre Durchtriebenheit.
Etwas, was Devlin mir einmal über sie erzählt hatte, schoss mir durch den Kopf. Ihrer religiösen Überzeugung nach nahm die Kraft eines Menschen mit dem Tod nicht ab. Ein schlimmes oder plötzliches Ende konnte eine zornige Seele zur Folge haben, die die Macht hatte zurückzukehren und das Leben eines Menschen negativ zu beeinflussen oder ihn sogar zu ihrem Sklaven zu machen. Ich hatte mich immer schon gefragt, ob das nicht ihr eigentliches Ziel war: Devlin durch seine Trauer und seine Schuldgefühle an sich zu ketten. Sie bewahrte sich die Fähigkeit, auf dieser Seite des Schleiers zu sein, indem sie ihm seine Wärme und Energie aussaugte; aber wenn er sie gehen ließ, wenn er anfing zu vergessen, würde sie dann einfach verschwinden?
Fröstelnd kauerte ich da und machte mir Vorwürfe, dass ich Shanis Stimme und diesem seltsamen Singvogel gefolgt war. Ich hätte mich nicht in diesen Garten locken lassen dürfen. Das war Mariamas Werk. Das war mir jetzt klar. Sie mischte sich in mein Leben ein und warnte mich, ich solle mich von Devlin fernhalten.
Ich verspürte einen stechenden Schmerz und schaute nach unten, da sah ich, dass mir Ameisen über die Hand liefen. Ich schüttelte sie ab und rappelte mich hoch. In dem kurzen Moment, als ich die Geister aus den Augen ließ, verschwanden sie. Das Einzige, was von ihnen blieb, war Eiseskälte.
Die Hintertür wurde geöffnet, und eine Frau trat auf die Veranda. »Wer ist da?«, rief sie. Sie klang überhaupt nicht verängstigt, bloß verärgert.
Ich wusste nicht, wie ich erklären sollte, was ich in ihrem Garten zu suchen hatte, also schnappte ich meine Einkaufstasche und kauerte mich hinter ein Beet mit Azaleen, obwohl ich mir dabei feige vorkam. Ich sah, dass sie vor Kälte zitterte und den Pullover fester um den Körper zog, während sie in die Dunkelheit blickte.
Wenn ich nicht immer noch so aufgewühlt gewesen wäre von meiner Begegnung mit den Geistern, hätte ich mich vielleicht bemerkbar gemacht, statt mich wie ein Dieb im Gebüsch zu verstecken. Ich hätte irgendeine Geschichte erfinden und der Frau erzählen können, dass ich meiner Katze durch ihr Gartentor nachgelaufen sei. Und dann hätte ich ihr anbieten können, ihr die zerbrochene Figur zu bezahlen. Genau das wollte ich gerade tun, als ich hinter ihr im Türrahmen die Gestalt eines Mannes erblickte.
»Ich dachte, ich hätte etwas gehört«, sagte die Frau mit einem kurzen Blick über die Schulter, und im nächsten Moment trat er zu ihr auf die Veranda.
Mein Herz krampfte sich zusammen, als würde man mir einen weiteren heftigen Schlag versetzen. Ich erkannte den Mann, der da neben ihr stand. Es war Devlin. Mein Devlin.
Jetzt wusste ich, warum ich in diesen Garten gelockt worden war. Ich sollte das hier sehen.
Mariama erschien neben Devlin. Ich spürte ihren gletscherkalten Blick auf mir, höhnisch und magnetisch. Ein leichter Wind zerzauste ihr Haar, und der Saum ihres hauchdünnen Sommerkleides schlängelte sich um ihre Beine. Ich konnte durch sie hindurchsehen, dennoch wirkte sie in diesem Moment so lebendig wie ein lebendes Wesen.
Sie hob die Hand zu Devlins Gesicht, streichelte ihm langsam und besitzergreifend über die Wange und starrte mich dabei unverwandt an. Ich hörte sie zwar nicht in meinem Kopf, wie ich Shani gehört hatte, doch ihre Botschaft war nicht weniger klar. Sie würde ihn niemals gehen lassen.
In meiner Brust zog es sich schmerzhaft zusammen, so als hätte eine unsichtbare Hand in mich hineingefasst und sich um mein Herz gekrallt. Ich holte tief Atem und zwang mein Herz, langsamer zu schlagen, obwohl meine Beine zitterten und meine Knie weich waren. Irgendetwas Entsetzliches ging mit mir vor in diesem Garten. Ich wurde ausgesaugt, mir wurde meine Energie geraubt von diesem Geistwesen, das ich mir zur Feindin gemacht hatte.
Papa hatte mich so oft gewarnt: Die Toten wollen nur eines: wieder Teil unserer Welt sein. Sie sind wie Schmarotzer, sie werden angezogen von unserer Lebensenergie, sie nähren sich von unserer Körperwärme. Wenn sie wissen, dass du sie sehen kannst, werden sie sich an dich heften wie Pesthauch. Du wirst sie nie wieder los. Und dein Leben wird nie wieder dir gehören.
Mariama lachte mich jetzt aus, als hätte auch sie Papas Warnung gehört.
Shani materialisierte sich auf der anderen Seite neben ihrem Vater und tippte ihm gegen das Bein, um seine Aufmerksamkeit zu erzwingen. Er schaute weder nach unten, noch zuckte er zusammen – er konnte sie nicht spüren. Er hatte nicht die geringste Ahnung, dass sie da war. Seine ganze Aufmerksamkeit galt der braunhaarigen Frau. Er stellte sich hinter sie und schlang die Arme um ihre schmale Taille. Sie legte den Kopf zurück und lehnte ihn an seine Schulter. Das vertraulich klingende Murmeln ihrer Stimmen drang durch den Garten bis hin zu meinem Versteck.
Er küsste sie nicht, und er streichelte sie auch nicht so, wie ein Liebhaber es täte. Er stand einfach nur da und hielt sie fest, während seine Geister um ihn herum schwebten.
Ich konnte mich nicht bewegen, nicht atmen. Und ich konnte nicht wegschauen, obwohl das wahrscheinlich der schlimmste Augenblick in meinem ganzen Leben war.
Nach einer Weile ging Devlin wieder ins Haus, und auch seine Geister verschwanden. Doch die Frau blieb noch draußen und versuchte, mit den Augen die Dämmerung zu durchdringen, als könnte sie meine Gegenwart körperlich spüren.
Ich wagte nicht, mich zu bewegen, aus Angst, dass sie mich bemerken könnte, aber ich wollte sie unbedingt besser sehen. Ich konnte nicht viel mehr erkennen als eine wohlgeformte Gestalt mit dichten dunklen, glänzenden Haaren, die ihr über die Schultern fielen. Doch ich wusste, dass sie attraktiv war. Sie hatte etwas an sich, eine ganz bestimmte Ausstrahlung, die schönen Frauen eigen war.
Sie blieb noch paar Minuten lang auf der Veranda stehen, dann folgte sie Devlin ins Haus. Mit angehaltenem Atem wartete ich, um sicherzugehen, dass keiner der beiden wieder herauskam. Dann stürzte ich aus dem Garten und floh durch die Gasse, ohne noch weiter an meinen Stalker von vorhin zu denken.
Ich war so verstört, weil ich Devlin mit einer anderen Frau gesehen hatte, dass ich unachtsam wurde. Das war eigentlich gar nicht meine Art. Wenn man mit Geistern lebte, war Wachsamkeit unbedingt notwendig. Aber während mein Körper in Richtung Straße eilte, war mein Kopf noch immer in dem seltsamen Garten. Diesen Fehler sollte ich büßen.
Der unheilvolle Schatten kam wie aus dem Nichts. Im nächsten Moment wurde ich grob gepackt, gegen eine Steinmauer gepresst, und ein Unterarm drückte mir die Kehle zu.
Der Druck auf meine Luftröhre machte es mir unmöglich, nach Luft zu schnappen oder gar zu schreien, aber der Angriff dauerte nur den Bruchteil einer Sekunde. Ich versuchte noch, nach dem Pfefferspray zu tasten, das ich immer dabeihatte, da hatte der Angreifer schon von mir abgelassen. Er löste den Arm von meiner Kehle, und ich hörte ein scharfes Einatmen. Dann mit ungläubiger Stimme: »Amelia?«
Devlin.
Ich war so baff über sein plötzliches Auftauchen, dass ich kein Wort herausbrachte. Monate waren vergangen, seit ich ihn zum letzten Mal gesehen hatte, aber geträumt hatte ich fast jede Nacht von ihm. In meinen geheimnisvollen, wollüstigen Träumen konnte ich alle Fantasien ausleben, die ich mit ihm hatte, aber jetzt wurde mir klar, was für ein schwacher Ersatz diese Traumbilder gewesen waren. Selbst als er so vor mir stand und misstrauisch auf mich herunterblickte, konnte ich kaum an etwas anderes denken als daran, wie sehr ich mich nach seinen Berührungen sehnte. Wie sehr ich seine Küsse vermisste.
»Bist du okay?«, fragte er schnell.
Oh, diese Stimme! Diese tiefe, seidenweiche, schleppende Sprechweise, die mich ins Verderben stürzen würde.
Ich schluckte mühsam. »Ja, ich glaube schon.«
»Was um alles in der Welt machst du hier draußen? Und warum hast du nichts gesagt? Ich hätte dir wehtun können.« Er klang selbst ein bisschen erschüttert.
»Du hast mir keine Gelegenheit dazu gegeben«, erwiderte ich abwehrend. »Packst du immer Leute ohne irgendeinen Grund?«
»Ich hatte einen Grund. Ich bin zu Besuch bei einer Freundin, und wir dachten, wir hätten im Garten jemanden gehört.«
»Du meinst einen Herumtreiber?« Wie vollkommen unschuldig ich mich anhörte.
Es folgte ein eigenartiges Zögern, dann: »Ja, einen Herumtreiber. Ich bin um das Haus gelaufen, um ihm den Weg abzuschneiden.« Er schaute an mir vorbei in die Gasse. »Hast du gesehen, ob hier irgendjemand herausgekommen ist?«
Ich schüttelte den Kopf, dabei hämmerte mein Herz immer noch wild in meiner Brust.
»Was ist mit der Straße? Hast du da jemanden herumschleichen sehen?«
»Ich habe nichts gesehen.«
Er sah mich immer noch an mit düsterem, forschendem Blick. »Dann zu dir. Was machst du hier?«
»Ich … ich war auf dem Heimweg vom Markt.« Matt hielt ich meine Einkaufstasche hoch.
»Bist du da nicht leicht vom Kurs abgekommen?«
»Du meinst die Gasse?« Ich fuhr mir mit der Zunge über die trockenen Lippen. »Ich habe auch etwas gehört und wollte der Sache auf den Grund gehen.«
Er hob den Kopf, und ich spürte, dass er sich plötzlich anspannte. »Was hast du gehört?«
»Es hört sich jetzt verrückt an«, antwortete ich widerstrebend.
Er packte mich am Arm, und ein Schauer lief durch meinen Körper, halb Furcht, halb Sehnsucht. »Erzähl schon.«
»Ich habe einen Singvogel gehört.«
»Einen Singvogel?« Unter anderen Umständen wäre seine tiefe Verwirrung vielleicht belustigend gewesen.
»Es hörte sich an wie eine Nachtigall.«
Fast unmerklich umklammerte er meinen Arm noch fester. Ich hätte schwören können, dass ich sah, wie sich ein Schatten über sein schönes Gesicht legte. Was natürlich unmöglich war. Die Dämmerung hatte sich über uns gesenkt, und ich konnte kaum mehr von ihm sehen als das Glänzen seiner Augen. Doch ich hatte ganz klar den Eindruck, dass ich mit meinen Worten einen Nerv getroffen hatte.
»Es gibt keine Nachtigallen in diesem Teil der Welt«, sagte er. »Du musst eine Spottdrossel gehört haben.«
»Das dachte ich zuerst auch. Aber als ich in Paris war, haben dort fast jeden Abend Nachtigallen im Innenhof meines Hotels gesungen. Ihr Trillern ist unverkennbar.«
Sein Ton wurde schärfer. »Ich weiß, wie sich Nachtigallen anhören. In Afrika habe ich die verdammten Biester oft genug gehört.«
Noch eine Kleinigkeit, die ich bisher nicht über ihn gewusst hatte. »Wann warst du in Afrika?«
»Vor einer Ewigkeit«, murmelte er, legte den Kopf in den Nacken und starrte hinauf in die Baumkronen.
Jetzt war ich diejenige, die verwirrt war. »Was für eine Rolle spielt es, welcher Vogel es war?«
»Ganz einfach: Wenn du in Charleston eine Nachtigall gehört hast …« Er sprach nicht weiter und riss den Kopf herum auf das leise Klirren eines Tores hin. Dann zog er mich schnell an sich und führte uns wie in einem Tanz zurück in die Dunkelheit der Mauer. Ich war zu erschrocken, um zu protestieren. Dabei verspürte ich nicht das geringste Verlangen danach. Das Adrenalin, das durch meine Adern schoss, war berauschend, meine Hand stahl sich hinauf zum Revers seiner Jacke und hielt es einen Moment lang fest, bis die Stimme einer Frau in unser Paradies eindrang.
»John? Bist du da draußen?«
Als er nicht sofort antwortete, legte ich den Kopf schräg, um ihn von unten anzusehen. Unsere Gesichter waren ganz nah beieinander. So nah, dass ich mich nur auf die Zehenspitzen hätte stellen müssen, um seine Lippen mit meinen …
»Ich bin hier«, rief er.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte sie.
»Ja, alles prima. Ich komme gleich.«
»Beeil dich.« Ich hörte, wie sich das Tor hinter ihr schloss, eine Sekunde später fiel die Hintertür des Hauses zu. Aber Devlin und ich waren beileibe nicht allein. Ein leichter Wind kam auf, wisperte in den Blättern der Bäume, und ich spürte die unnatürliche Kälte seiner Geister. Ich konnte sie zwar nicht sehen, aber sie waren da, schwebten irgendwo in der Dunkelheit, trieben ebenso einen Keil zwischen uns wie die rauchige Stimme der fremden Frau.
Devlin hielt mich immer noch fest, aber jetzt war plötzlich eine Distanz zwischen uns. Eine unangenehme Kluft, die mich dazu brachte, mich innerlich zurückzuziehen. »Ich sollte jetzt gehen.«
»Ich fahr dich nach Hause«, sagte er. »Es ist schon fast dunkel.«
»Vielen Dank, aber nein. Es sind nur ein paar Blocks, und die Gegend hier ist sicher.«
»Sicher ist ein relativer Begriff.«
Das wusste ich nur zu gut.
»Mir passiert schon nichts.« Ich war bereits ein paar Schritte weit gegangen, da sagte er leise meinen Namen. Ich war versucht, das Flehen in seiner Stimme zu übergehen – aus Angst, ich könnte es mir nur eingebildet haben. Ich drehte mich um und hauchte: »Ja?«
Seine dunklen Augen schimmerten im schwindenden Licht. »Du hast eine Spottdrossel gehört. Es kann keine Nachtigall gewesen sein.«
Das Herz wurde mir schwer, und ich nickte. »Wenn du das sagst.«
ZWEI
Devlin rief mir nicht noch einmal nach, und ich blickte mich nicht mehr um. Doch ich spürte die Wärme seiner Berührung immer noch, genau wie die eisige Kälte seiner Geister. Ich hatte so manche schlaflose Nacht damit verbracht, mich selbst davon zu überzeugen, dass seine Totengeister keine Bedrohung für mich waren, solange ich Abstand hielt. Doch nach dem heutigen Abend konnte ich mir nichts mehr vormachen. Ich hatte nichts getan, was sie zurück in mein Leben hätte locken können. Aber sie waren trotzdem gekommen. Und ich wusste nicht, wie ich sie wieder loswerden sollte.
Shani hatte mich angefleht, ihr zu helfen. Auch jetzt noch lähmte die Erinnerung an ihre Stimme in meinem Kopf meine Entschlossenheit. Aber ich musste Abstand wahren, meine Distanz beibehalten. Was immer sie auch brauchte, ich konnte es ihr nicht geben. Was immer sie wollte, ich konnte ihr nicht helfen. Ich war kein Medium. Ich stand nicht in Verbindung mit den Toten – zumindest nicht absichtlich –, und ich führte auch keine Seelen ins Jenseits. Geister waren gefährlich für mich. Es waren ausgehungerte Parasiten. Hatte Mariama das nicht gerade bewiesen?
Wenn ich schlau war, würde ich Devlins Geister genauso wenig beachten wie die Hunderte von anderen Erscheinungen, die ich im Laufe der Jahre gesehen hatte. Ich würde mich verzweifelt an Papas Regeln klammern. Denn ohne die Regeln war ich so gut wie ungeschützt gegen all die Wesen aus dem Jenseits, die bei Sonnenuntergang durch den Schleier krochen.
Am besten wäre es, wenn ich dieses beunruhigende Erlebnis aus meinem Kopf verbannen würde.
Aber… selbst wenn es mir irgendwie gelang, die Geister nicht zu beachten, wusste ich, dass das Bild von Devlin und dieser fremden Frau mich quälen würde. Ich hatte kein Recht, mich betrogen zu fühlen. Ich hatte ja schließlich mit Devlin Schluss gemacht, noch dazu ohne eine richtige Erklärung. Denn wie hätte ich ihm sagen sollen, dass unsere Leidenschaft eine Pforte geöffnet hatte zu einem erschreckenden Reich von Geistern, die kälter und hungriger waren als sonst irgendein Wesen, das mir je begegnet war?
Zitternd atmete ich durch und versuchte, mich zu beruhigen. Eigentlich sollte ich dankbar sein, dass er jemand anderen gefunden hatte. Je eher er sein Leben weiterlebte, desto sicherer wäre er. Desto sicherer wären wir beide. Hatte ich mit Thane Asher nicht das Gleiche versucht?
Doch ich konnte das Ganze noch so rational betrachten, es linderte nicht den Schmerz in meiner Brust. Auch der Anblick meines Zuhauses spendete mir keinen Trost, obwohl es mehr war als nur eine Wohnung. Es war ein geweihter Zufluchtsort, der einzige Ort in ganz Charleston, an dem ich mich vor den Geistern zurückziehen und vor der Welt verstecken konnte.
Das schmale Haus, das sich auf den Überresten der Kapelle eines Waisenhauses erhob, war tief in das Grundstück hineingebaut worden und hatte, typisch für die Charlestoner Bauweise, oben und unten Balkone, einen Vorgarten und einen rückwärtigen Garten. Ich hatte das Erdgeschoss ganz für mich allein, das schloss auch die Nutzung des hinteren Gartens und des ursprünglichen Kellers mit ein. Ein Medizinstudent namens Macon Dawes hatte das obere Stockwerk gemietet. Doch im Moment war er nicht da, sodass sich Angus, der misshandelte Streuner, den ich aus den Bergen mitgebracht hatte, an seine neue Umgebung gewöhnen konnte, bevor er mit einem Fremden zurechtkommen musste.
Angus musste gespürt haben, dass ich nach Hause kam, denn ich hörte, wie er mich vom Garten hinter dem Haus her bellend begrüßte. Ich rief seinen Namen, als das Tor hinter mir ins Schloss fiel, blieb einen Moment lang stehen und ließ den Duft der süßen Blüten auf mich wirken. Später würden wir zwei hinter dem Haus sitzen und zusehen, wie mein Garten zum Leben erwachte, sobald der Mond über den Wipfeln aufging.
Das war ein allabendliches Ritual geworden, der einzige Anlass, bei dem ich die Dunkelheit willkommen hieß. Ich hatte die ummauerten Gärten von Charleston immer bewundert, aber meinen genoss ich ganz besonders bei Mondschein, wenn die Motten umherschwirrten und die Fledermäuse die Flucht ergriffen. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich könnte für immer da draußen sitzen und mein Leben einfach verträumen.
Die alten Friedhöfe des Südens, die ich restaurierte, übten eine ähnliche Faszination auf mich aus mit ihrem herabtropfenden Moos, dem kriechenden Efeu und der lavendelblauen Schwermut des Flieders im Frühling. Der Sommer bescherte süße Rosen, der Winter sinnlichen Seidelbast. Ein Duft des Todes für jede Jahreszeit. Jeder einzigartig. Und jeder beschwor eine andere Empfindung oder eine besondere Erinnerung herauf, gemahnte uns aber immer an die Vergangenheit und an die Vergänglichkeit des Lebens.
Ich wusste nicht, wie lange ich mit geschlossenen Augen dastand, in Schwermut versunken, und die Abenddüfte in mich aufsog. Das Elend hatte mich immer noch fest im Griff, das war vielleicht der Grund, warum ich ihn nicht sofort sah. Und ihn auch nicht spürte.
Als ich seine Silhouette erblickte, war es kaum mehr als ein etwas dunklerer Schatten auf der Veranda, aber irgendwie wusste ich trotzdem, wer er war. Was er war. Ich verspürte den seltsamen Drang, mich umzudrehen und durch das Tor zurück auf die Straße zu stürzen, doch meine Muskeln gehorchten mir nicht. So blieb ich starr vor Angst stehen.
In all den Jahren, in denen ich nun schon Geister sah, war ich noch nie jemandem begegnet wie Robert Fremont. Er konnte vor Sonnenunter- und nach Sonnenaufgang durch den Schleier treten – und er konnte sich mit mir unterhalten. Oder zumindest kommunizierte er mit mir auf eine Weise, die ich als Sprechen empfand. Seine Stimme war nicht nur in meinem Kopf, wie es bei Shani der Fall gewesen war. Ich konnte sie wirklich hören. Und ich konnte sehen, wie seine Lippen sich bewegten. Ich hatte keine Ahnung, wie er das machte … noch verstand ich, wie er so ruhig auf den Stufen meines Refugiums sitzen konnte; einem Ort, in den noch nie ein Totengeist hatte eindringen können.
Das war das Furchterregendste an seiner Erscheinung. Keine der Regeln schien für ihn zu gelten. Ich war ihm vollständig ausgeliefert ohne irgendeine Möglichkeit, mich vor ihm zu schützen.
Der Zeitpunkt seines Auftauchens konnte kein Zufall sein. Nichts an diesem Abend war Zufall. Weder die Nachtigall noch meine Begegnung mit Devlin und auch nicht Shanis verstörender Kinderreim. Jedes Vorkommnis für sich allein betrachtet konnte vielleicht noch wie Zufall erscheinen, doch zusammen bedeuteten sie etwas Bestimmtes. Es gab ein Wort für eine solche Abfolge von Ereignissen: Synchronizität.
Und als ich so dastand und durch die tiefer werdende Dämmerung auf den ermordeten Cop schaute, konnte ich spüren, wie ich in etwas Dunkles und Mystisches hineingezogen wurde. In ein übernatürliches Rätsel, für das es womöglich keine irdische Lösung gab.
Langsam wanderte ich durch den Garten, und der Duft der Engelstrompeten erfüllte die Luft mit einem süßlichen Geruch. Am Fuß der Treppe blieb ich stehen und blickte zu ihm hinauf.
Fremont sah ungefähr genauso aus wie damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte. Er trug die unauffällige Kleidung eines Undercover-Cops, der nahtlos im kriminellen Bauch Charlestons aufgehen musste. Wie immer waren seine Augen hinter einer dunklen Brille versteckt, doch ich konnte die Macht seines toten Blickes durch die Gläser hindurch spüren. Das Gefühl war schaurig.
»Amelia Gray.« Als er meinen Namen aussprach, fühlte es sich an, als würde eine eisige Nadel an meiner Wirbelsäule entlangstechen.
»Warum sind Sie hier?«, fragte ich ihn.
»Sie wissen, warum. Es ist Zeit.«
Mir stellten sich die Nackenhaare auf. »Zeit für was?«
»Die Dinge in Ordnung zu bringen.« Seine Stimme klang tief und hohl wie aus einem Brunnen. Wieder zitterte ich, als er mich durch die getönten Gläser ansah. Ich versuchte den Blick abzuwenden, doch er hielt mich in seinem Bann.
Ich hatte vergessen, wie attraktiv er war, wie unnatürlich charismatisch, selbst noch als Geist. Trotz seiner dunklen Haut – und trotz der Tatsache, dass er tot war – hatte er mich stets an Devlin erinnert. Beide hatten diesen schwelenden Charme, diese gefährliche Anziehungskraft. Sie waren einmal Freunde gewesen. Ich hatte das Gefühl, dass meine Beziehung zu Devlin Robert Fremont in meine Welt eingelassen hatte.
»Wir müssen eine Menge besprechen«, sagte er.
»Müssen wir das?«
»Ja. Vielleicht sollten Sie sich hinsetzen. Sie wirken ein bisschen wacklig auf den Beinen.«
War das ein Wunder?
Doch ich wollte mich nicht hinsetzen. Ich wollte, dass er wieder verschwand, dass er zurück ins Reich der Toten verbannt wurde, zusammen mit Shani und Mariama. Ich überlegte, ob ich an ihm vorbei in mein Haus stürzen sollte, in mein Refugium, doch ich war mir nicht ganz sicher, ob mich das vor Geistern wie ihm würde schützen können. Es war durchaus möglich, dass er mir ins Haus folgen konnte, und ich wollte nicht den Seelenfrieden eines geweihten Ortes verlieren, auch wenn er jetzt trügerisch erschien.
Meine Beine waren wie aus Blei, als ich die Stufen hinaufstieg. Die Last seiner unausgesprochenen Forderungen senkte sich auf mich wie ein schweres Gewicht. Er stand nicht auf, aber das konnte ich schließlich auch kaum von ihm erwarten. Warum sollte sich ein Totengeist an irdische Etikette gebunden fühlen? Zumal es sich hier um den Geist eines Mannes handelte, dessen Leben durch Mord beendet worden war.
Ich setzte mich auf die Veranda und ging ein wenig auf Abstand, indem ich die Einkaufstasche zwischen uns stellte. Ich spürte nicht mehr als eine leichte Kühle, die von ihm ausging, und selbst das war vielleicht nur Einbildung.
»Ich habe Ihnen einmal gesagt, dass ich Sie als Vermittlerin brauche, als Verbindung zwischen mir und der Polizei«, sagte er.
»Ich erinnere mich.«
»Ich fürchte, dass das jetzt nicht mehr reicht.«
Das fürchtete ich auch. Todsicher.
»Sie müssen Augen und Ohren für mich sein in dieser Welt. In der Welt der Lebenden.«
»Warum?«
»Weil Sie an Orte gehen können, die ich nicht betreten kann. Mit Leuten reden können, die mich nicht treffen wollen.«
»Nein, ich meine … zu welchem Zweck?«
»Auch wenn das vielleicht wie ein Klischee klingt: Ich brauche Sie, um meinen Mörder zu finden.«
Schweigend starrte ich ihn an. »Wieso können Sie das alles tun – mit mir reden, in mein Refugium eindringen, mir erscheinen, als würden Sie immer noch leben –, und trotzdem nicht wissen, wer Sie ermordet hat? Sie haben mir mal gesagt, Sie hätten eine Gabe. Dass sie der Grund gewesen sei, warum man Sie den Propheten genannt hat.«
»Ich habe nie behauptet, dass ich allwissend bin«, erwiderte er und klang verärgert; ob über meine Fragen oder wegen seiner derzeitigen Einschränkungen, konnte ich nicht sagen. »Ich habe keine Kontrolle über meine Visionen.«
Das konnte ich nachempfinden. Auch ich hatte keine Kontrolle über meine Gabe.
»Haben Sie irgendetwas über meinen Tod gelesen?«, fragte er.
»Nicht viel.«
»Das enttäuscht mich aber. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Sie nach unserem letzten Zusammentreffen mehr über mich wissen wollen. Ich habe Sie für eine neugierige Frau gehalten. Oder liege ich da falsch?«
Ich reagierte hitzig. »Ich bin ziemlich beschäftigt gewesen seit dem Abend damals. Ich wäre fast ermordet worden, wie Sie sich vielleicht erinnern. Und ich muss Geld verdienen, eine Firma leiten. Aber …« Ich stockte, um wieder Luft zu holen. »Einmal habe ich Sie gegoogelt. Im Internet stand aber nicht viel, und mit Devlin rede ich nicht. Wie hätte ich also etwas über Sie in Erfahrung bringen sollen?«
Er seufzte. »Ich hatte gehofft, Sie wären etwas erfinderischer.«
Nun, ich war auch nicht gerade begeistert von ihm. Ich wollte wirklich nur, dass er … verschwand. »Wenn das so ist, sollten Sie vielleicht jemand anderen um Hilfe bitten.«
»Es gibt niemand anderen. Ich musste lange suchen, bis ich Sie gefunden habe.«
Das gab mir zu denken. »Wie haben Sie mich denn gefunden?«
»Das geht Sie nichts an.«
»Das geht mich nichts an?« Meine Stimme wurde hart. »Ist Ihnen schon einmal in den Sinn gekommen, dass ich nicht über Sie recherchiert habe, weil ich nichts mehr mit Ihnen zu tun haben will?«
Vorsicht!, warnte mich eine innere Stimme. Ich hatte heute Abend schon einmal den Zorn eines Geistes zu spüren bekommen. Da war es nicht klug, noch einen zu provozieren.
Es dauerte einen Moment, bis er antwortete. »Sie haben wenigstens Rückgrat. Das trifft sich gut.«
»Danke. Schätze ich mal.«
»Vielleicht war mein Urteil über Sie etwas voreilig. Sie müssen verstehen, dass für mich eine Menge von dieser Beziehung abhängt.«
Ach, wir hatten eine Beziehung? Schon bei dem bloßen Gedanken fröstelte ich.
Eine Nachbarin ging auf der Straße vorbei. Sie schaute zum Haus herüber und eilte dann weiter. Doch ich sah, dass sie noch einmal einen Blick über die Schulter warf. Sie musste mich wohl für verrückt halten, wie ich da draußen in der Dämmerung saß und Selbstgespräche führte. Ich konnte es ihr nicht verdenken. Wenn Papa nicht auch die Fähigkeit gehabt hätte, Totengeister zu sehen, hätte ich mir schon vor langer Zeit Sorgen über meinen Geisteszustand gemacht.
»Was ist Ihnen passiert?«, fragte ich nun doch wider Willen neugierig. »Ich weiß, dass Sie im Dienst ermordet wurden …« Ich brach ab. »Ist es in Ordnung, so frei heraus darüber zu sprechen?«
»Anders würde ich es nicht wollen.«
Gut. Ich wollte nicht wie auf rohen Eiern um ihn herumlaufen.
Ich erstarrte wieder. Mein inneres Zwiegespräch machte mir selbst Angst. Wie hatte Robert Fremont es geschafft, sich so mühelos in mein Leben zu schleichen? Warum hatte ich ihn so bereitwillig hereingelassen?
Er ist ein Geist. Er ist ein Geist. Er ist ein Geist.
Ich sagte mir das Mantra noch vor, als er sich bereits wieder mit mir unterhielt.
»Man hat mir in den Rücken geschossen«, sagte er. »Ich habe meinen Mörder nicht gesehen. Am nächsten Tag hat man meine Leiche auf dem Friedhof von Chedathy gefunden. Das ist in Beaufort County.«
Mein Blick war immer noch auf die Straße geheftet gewesen, doch jetzt fuhr ich zu ihm herum. Mariama und Shani waren auf dem Friedhof von Chedathy beigesetzt.
»Sie waren ein Charlestoner Cop«, sagte ich. »Was hatten Sie denn so weit da unten in Beaufort County zu suchen?«
»Ich … weiß es nicht genau.«
»Was meinen Sie mit: Sie wissen es nicht genau?«
Er antwortete nicht.
Das Gefühl einer düsteren Vorahnung, das mir den Hals zuschnürte, gefiel mir überhaupt nicht. »Mir ist immer noch nicht ganz klar, was Sie eigentlich von mir erwarten.«
»Ich habe Ihnen doch schon gesagt, was ich brauche.«
»Ich weiß, aber …«
»Hören Sie mir einfach zu! Wir müssen schnell handeln. Verstehen Sie? Es muss jetzt sofort sein.«
Seine Dringlichkeit verblüffte mich. »Warum ausgerechnet jetzt? Es ist schon über zwei Jahre her, dass Sie erschossen worden sind.«
Er blickte hinauf zum Himmel. »Die Sterne stehen jetzt günstig. Die Spieler haben ihre Plätze eingenommen.«
Er hätte sich kaum kryptischer ausdrücken können.
»Schließt mich das mit ein?«
»Ja.«
Ich wandte mich um zum Garten und suchte mit den Augen die Dunkelheit ab. »Und wenn ich mich weigere, bei dem Ganzen mitzumachen?« Was immer das Ganze war.
»Haben Sie sich unlängst im Spiegel angeschaut?«, fragte er.
Jetzt war ich diejenige, die verstummte.
»Haben Sie die dunklen Ringe unter Ihren Augen bemerkt? Die eingefallenen Wangen? Den Gewichtsverlust? Sie können nicht essen und nicht schlafen. Ihre Energie schwindet dahin, selbst während wir uns unterhalten.«
Entsetzt starrte ich ihn an. »Sie suchen mich heim?«
DREI
Als ich mir die Bedeutung seiner Worte klarmachte, setzte mein Herz einen Schlag aus. Ich dachte an meinen Stalker, diesen schwer zu fassenden Beobachter, der mich seit Tagen verfolgte. Jetzt verstand ich, warum ich so matt war und warum ich nicht schlafen konnte. Fremonts bloße Gegenwart raubte mir meine Lebenskraft, so wie Mariama mir zuvor meine Energie ausgesaugt hatte. Oder war das vielleicht auch Fremont gewesen?
»Sie müssen mir helfen«, sagte er.
Ich senkte den Blick und schaute auf meine zitternden Hände. »Das wird mir allmählich klar.«
»Sobald wir ihn gefunden haben, sobald der Gerechtigkeit Genüge getan wurde, werde ich Sie in Ruhe lassen.«
»Geben Sie mir Ihr Wort?« Das Wort eines Totengeistes. Das war etwas ganz Neues.
»Was für einen Grund sollte ich dann noch haben, hierzubleiben?«, fragte er.
Ich schrak zurück vor dem Gedanken. »Sie sagten gerade: Sobald wir ihn gefunden haben. Wenn man Sie von hinten erschossen hat, wie können Sie dann so sicher sein, dass der Mörder ein Mann war?«
»Ich bin mir wegen gar nichts sicher«, gab er zu; und zum ersten Mal spürte ich so etwas wie Zweifel. »Ich weiß nicht einmal, warum ich an dem Abend überhaupt auf dem Friedhof war.«
»Leiden Sie an Gedächtnisschwund?«
»Was die Ereignisse an dem Abend angeht? Es sieht so aus.«
Er blickte auf die Straße, und ich betrachtete sein Profil prüfend. Es war erstaunlich, wie deutlich ich ihn in der Dämmerung sehen konnte. Die markante Kieferpartie und das Kinn, die hohen Wangenknochen, die Kontur seiner Lippen. Obwohl ich es genau wusste, fiel es mir immer noch schwer zu begreifen, dass er tot war.
»Ich denke, das klingt logisch«, sagte ich und riss den Blick von ihm los. »Ich habe gelesen, dass Unfallopfer sich oft nicht mehr an die Einzelheiten erinnern können, die unmittelbar vor dem Unfall passiert sind. Das ist hier wohl ganz ähnlich. Sie haben ein schweres Trauma erlitten.«
»Ja, es war ein schweres Trauma«, murmelte er.
»Was ist das Letzte, woran Sie sich erinnern? Bevor Sie gestorben sind, meine ich.«
Er schwieg, und jetzt spürte ich seinen inneren Aufruhr, einen inneren Konflikt. »Ich erinnere mich noch, dass ich mich mit jemandem getroffen habe.«
»Auf dem Friedhof?«
»Das weiß ich nicht. Ich erinnere mich nur noch an den Duft ihres Parfüms. Der Geruch hing in meiner Kleidung, als ich starb.«
»Der Mörder könnte also eine Frau gewesen sein.«
»Schon möglich. Ich erinnere mich auch ganz verschwommen an einen Streit.«
»Wissen Sie, wer die Frau war?«
Wieder zögerte er. »Ihr Name ist mir entfallen.«
»Wie hat sie ausgesehen?«
Obwohl nur der Bruchteil einer Sekunde verging, bis er antwortete, hätte ich schwören können, dass er erschauerte. Auch wenn es unwahrscheinlich erschien, dass ein Totengeist auf derart irdische Weise reagierte. Bestimmt schloss ich von meinen eigenen menschlichen Regungen auf ihn.
»Das weiß ich nicht. Aber ihr Parfüm …«
»Reden Sie weiter.«
»Der Geruch hängt immer noch in meinen Sachen«, fuhr er fast niedergeschlagen fort. »Ich rieche ihn sogar jetzt.«
Ich erinnerte mich an den exotischen Duft, der vorhin zu mir hergeweht war, mit dem gleichen gespenstischen Lufthauch wie der Gesang der Nachtigall. Wenn Fremont mich verfolgt hatte, könnte der Geruch von ihm gekommen sein.
Und dann ging mir noch etwas durch den Kopf. Hatte er die Totengeister von Mariama und Shani gesehen? War das der Grund gewesen, warum er verschwunden war? Und war das überhaupt möglich, dass Geister einander sehen, miteinander interagieren konnten?
Jahrelang schwelende Fragen kamen in mir hoch, doch es war sehr seltsam, dass ich sie nun einem Geist stellen konnte. Noch seltsamer war es, dass meine Furcht plötzlich verflogen war. Stand ich immer noch unter einem Zauber?
Wieder einmal war ich drauf und dran, mich auf gefährliches Terrain zu begeben, Papas Warnungen in den Wind zu schlagen und mit dem Unheil zu liebäugeln. Eine Tür war bereits aufgebrochen, weil ich die Regeln sträflich missachtet hatte. Würde sich durch meine Verbindung mit einem Geist noch eine weitere öffnen?
»Wie ist es dort?«, hörte ich mich fragen. »Hinter dem Schleier, meine ich.«
»Man nennt ihn das Grau. Den Ort zwischen Hell und Dunkel.«
Den Ort, hatte er gesagt. Nicht die Zeit. Der Unterschied schien wichtig zu sein.
»Tut sie immer noch weh? Die Stelle, an der Sie getroffen worden sind?«
»Es gibt dort keine Schmerzen«, erwiderte er. »Es gibt dort eigentlich gar nichts.«
»Aber Sie fühlen doch etwas. Sie müssen etwas fühlen. Sie sind hier, weil Sie Vergeltung wollen. Das bedeutet, dass Sie immer noch in der Lage sind, menschliche Regungen zu empfinden.«
»Ich bin hier, weil ich keine …« Seine geisterhafte Stimme verstummte.
»Weil Sie was?«
»Weil ich keine Ruhe finden kann«, antwortete er müde. »Irgendetwas hält mich hier fest.«
»Und Sie glauben, wenn wir Ihren Mörder entlarven, wären Sie frei?«
»Ja.«
Ich dachte einen Moment lang darüber nach. Sein innerer Drang, den Mörder zu finden, bestätigte, was ich immer vermutet hatte. Nicht alle Totengeister zog es durch den Schleier, weil sie nach menschlicher Wärme lechzten und von dem unstillbaren Verlangen getrieben wurden, wieder zu den Lebenden zu gehören. Manche waren an unsere Welt gebunden aus Gründen, die nicht in ihrer Macht lagen. Allem Anschein nach war Robert Fremont ein solcher Fall. Ich fragte mich, ob es mit Shani genauso war. Wenn Mariamas Totengeist Devlins Schuldgefühle und seine Trauer benutzte, um ihn an sich zu ketten, ketteten dann die gleichen Gefühle Shani an ihn?
»Können Sie sie sehen?«, fragte ich.
»Wen?«
»Die anderen Geister. Sie sind überall. Sie haben sie bestimmt schon bemerkt.«
»Ich halte Abstand.«
»Warum?«
»Sie sind hinterhältig«, sagte er in verächtlichem Ton. »Schmarotzer, die Jagd auf die Lebenden machen, weil sie sich weigern, den Tod zu akzeptieren. Ich bin nicht so.«
»Aber machen Sie nicht genau das mit mir?«
»Nur solange ich Ihre Hilfe brauche. Ich muss mich ja irgendwie erhalten, bis ich einen Weg finde zu gehen«, erwiderte er. »Ich will genauso wenig hier sein, wie Sie wollen, dass ich hier bin.«
»Also, was machen wir als Erstes?«
Er bewegte sich, sodass die Luft aufgewirbelt wurde. Ich spürte eine leichte Kühle, die mir den Rücken hinaufkroch, und musste mir einmal mehr in Erinnerung rufen, dass er trotz unserer seltsamen Vereinbarung immer noch ein Geist war und deshalb gefährlich für mich.
»Wir folgen den Spuren«, sagte er. »Ganz gleich, wohin sie führen. Verstanden?«
»Ich …«
»Verstanden?«
Ich wäre fast hochgefahren. »Ja. Verstanden.«
Er nickte und wandte sich ab. »Irgendjemand war auf dem Friedhof, nachdem man mich erschossen hatte. Nicht nur der Mörder, sondern noch jemand anderes. Wir müssen diejenigen finden und sie dazu bringen, dass sie reden.«
Ich sah ihn zweifelnd an. »Haben Sie jemanden gesehen?«
»Nein«, antwortete er. »Aber ich habe eine Präsenz gespürt.«
Eine Präsenz. »Wenn Sie dem Tod so nah waren, wie können Sie da sicher sein, dass Sie das nicht nur geträumt haben oder Halluzinationen hatten?«
»Ich habe gespürt, dass jemand meine Taschen durchsucht hat. Das war jemand Reales. Aber wenn Sie mir nicht glauben, lesen Sie den Polizeibericht. Mein Handy war weg, als man meine Leiche fand.«
»Wie soll ich denn an den Polizeibericht kommen?«
»Sie haben gesagt, Sie könnten erfinderisch sein, wenn es notwendig wäre. Lassen Sie sich etwas einfallen.«
Ich bekam wieder Angst. Das war die absolut merkwürdigste Nacht meines Lebens – und das wollte bei mir etwas heißen.
Wurde ich wirklich von einem Totengeist erpresst? Und erwartete er im Ernst, dass ich ganz allein in einem Mordfall ermittelte? Wenn ich versagte, wenn ich seinen Mörder nicht entlarven konnte, würde er mich dann für den Rest meines Lebens heimsuchen? Würde er weiter von meiner Wärme und Energie zehren, bis ich nur noch eine leere Hülle war?
Ich versuchte, ruhig zu bleiben. »Angenommen, wir schaffen es, diese … wer auch immer das war … zu finden, wie sollen wir sie dann Ihres Erachtens zum Reden bringen? Ich bin kein Cop. Ich weiß nicht, wie man jemanden verhört. Und offen gesagt, klingt das, was Sie da vorschlagen, unglaublich riskant. Obwohl Sie sich deswegen ja keine Sorgen zu machen brauchen.«
»Ich bin nicht darauf aus, dass man Sie umbringt«, sagte er.
»Das ist sehr beruhigend.«
»Solange Sie genau das tun, was ich sage, wird Ihnen nichts passieren.«
Und das sollte ich ihm glauben?
Trotzdem schoss selbst jetzt, da ich vor Angst zitterte, eine unerwartete Erregung durch meinen Körper. Mein Leben lang war ich behütet und beschützt worden, nicht nur vor den Geistern sondern auch vor der Welt außerhalb meiner Friedhofstore. Es hatte eine Zeit gegeben, in der ich an dieser Abschottung festgehalten hätte, an dieser Sicherheit, selbst an meiner Einsamkeit. Doch die Geheimnisse über mich, die ich in Asher Falls aufgedeckt hatte, hatten dazu geführt, dass ich meine Fähigkeit und mein Leben noch einmal auf den Prüfstand gestellt hatte. Ich wollte glauben, dass mein Leben einen Sinn hatte und es einen Grund dafür gab, dass ich Geister sah. Das war nicht nur ein gefährliches Erbe. Ich hatte eine Gabe geschenkt bekommen.
Und jetzt war hier ein Totengeist, der mir einen Weg wies, wie ich einem höheren Zweck dienen konnte. Der mir einen Grund gab, diese unheimliche Gabe einzusetzen, statt mich auf geweihtem Boden davor zu verstecken.
Wenn ich dem Propheten helfen konnte zu gehen, konnte ich für Shani und Mariama vielleicht das Gleiche tun. Und dann würde Devlin mir gehören …
Ich erschrak darüber, in welche Richtung meine Gedanken wanderten und vebot mir, sie weiterzuverfolgen. Es war zu gefährlich. Zu albern, überhaupt damit zu liebäugeln, dass Devlin und ich irgendwann einmal zusammensein könnten. Außerdem war er offenbar an der Brünetten interessiert. Es war durchaus möglich, dass er mit unserer Vergangenheit bereits abgeschlossen hatte.
Aber warum hatte er mir dann eine SMS geschickt an dem Tag, als ich Asher Falls verließ?
Warum hatten mich seine Geister heute Abend in den Garten dieser Frau gelockt? Warum fühlte Mariama sich so bedroht von mir?
Zwischen Devlin und mir war es noch nicht vorbei. Ein Teil von mir wusste das. Egal, was geschah, egal, wie viel Zeit oder wie viele Kilometer zwischen uns lagen, es würde nie wirklich vorbei sein. Devlin war mein Schicksal. Der Mann, den ich mehr wollte als irgendjemand sonst, war zugleich der Mann, den ich niemals haben konnte.
Es sei denn, ich fand irgendwie einen Weg, diese Tür wieder zu schließen.
Ich versuchte, den vagen Hoffnungsschimmer zu ersticken und musterte den Geist neben mir. »Wenn ich Ihnen helfe, sind wir quitt, richtig? Dann ist meine Schuld bei Ihnen beglichen.«
Robert Fremont lächelte. »Feilschen Sie nie mit den Toten. Wir haben nichts mehr zu verlieren.«
VIER
Noch lange nachdem Fremont verschwunden war, saß ich in der finsterer werdenden Dämmerung und fröstelte, obwohl der Abend noch recht warm war. Irgendwann fiel mir auf, dass Angus im Garten bellte. Seltsamerweise war er während Fremonts Anwesenheit ruhig gewesen, aber jetzt hatte ihn irgendetwas in Aufregung versetzt. Ich rief seinen Namen, aber meine Stimme brachte ihn nicht dazu, still zu sein.
Ich schnappte meine Einkaufstasche und rannte durch den Seitenhof zum rückwärtigen Tor, während ich darüber nachdachte, welche Folgen meine Begegnung mit Fremont hatte. Innerhalb von ein paar Minuten hatte sich mein ganzes Leben verändert. Ich war wissentlich in Beziehung zu einem Totengeist getreten … So viel zu dem Thema, dass man den Toten niemals zeigen sollte, dass man sie sah. Und so viel zu dem Thema, dass man das Schicksal niemals herausfordern sollte. Ich konnte mir zu gut vorstellen, was Papa über eine derartige Verbindung sagen würde.
Was die Frage aufwarf: War er jemals einem Geistwesen wie Robert Fremont begegnet?
Ich dachte an den Geist des alten weißhaarigen Mannes, den ich auf dem Friedhof von Rosehill gesehen hatte, dem geweihten Boden meiner Kindheit. Er war meine erste Erscheinung gewesen, und seit jenem weit zurückliegenden Tag hatte ich ihn nur noch einmal flüchtig gesehen.
Mein Vater hatte mir einst erzählt, dass er Angst gehabt hätte, irgendetwas Böses auf der anderen Seite des Schleiers habe den Geist des alten Mannes geschickt, damit er mich überwachte. Aber ich musste mich nun fragen, ob Papa mir die ganze Wahrheit gesagt hatte. Trotz der Dinge, die er mir über meine Geburt und über mein Erbe offenbart hatte, konnte ich den Gedanken nicht abschütteln, dass er mir noch etwas verschwieg. Dass er immer noch Geheimnisse wahrte, die ich erst noch ergründen musste.
Ich öffnete das hintere Tor und trat hindurch. Im Garten war immer noch Licht, obwohl der Mond noch nicht aufgegangen war. Angus stand mitten auf dem Rasen, den Blick auf die Schaukel geheftet. Sie bewegte sich langsam vor und zurück.
Shani?
Ich sprach ihren Namen nicht laut aus. Das brauchte ich nicht.
Sie antwortete nicht. Ich hörte kein Geräusch bis auf das leise Klimpern des Windspiels und das Hämmern meines Herzens, das mir in den Ohren dröhnte.
Doch die Schaukel bewegte sich weiter im Wind.
Irgendetwas war da. Ich spürte eine Kühle in der Luft, und während ich wie angewurzelt dastand, wehte ein Duft zu mir herüber. Nicht der exotische Duft von vorhin, sondern der vertraute Duft von Jasmin, der Shanis Erscheinung begleitete. Wieder einmal war sie mir nach Hause gefolgt, aber aus irgendeinem Grund wollte oder konnte sie nicht erscheinen. Hatte sie Angst vor Mariama?
Ich wollte nicht darüber nachdenken, was das bedeuten mochte. Ein Kind – auch wenn es ein Geisterkind war –, das Angst vor der eigenen Mutter hatte.
Ich hatte ganz sicher Angst vor Mariama.
»Shani?« Flüsternd brachte ich ihren Namen hervor.
Stille.
Ich sah die Schaukel vor- und zurückschwingen und stellte mir vor, wie sich das Haar des kleinen Mädchens bewegte und sich ihr blaues Kleidchen bauschte. Wie unschuldig ihr süßes Lachen klang.
Wie viele Male hatte Devlin sich so an sie erinnert? Wie viele Male war er aus einem Traum erwacht und hatte sich danach verzehrt, sein Kind in den Armen zu halten, nur um im nächsten Moment der schmerzhaften Wirklichkeit ins Auge sehen zu müssen? In den zwei Jahren, die sie jetzt nicht mehr da war, musste er ihren Tod immer und immer wieder durchlebt haben. Jedes Mal aufs Neue Verzweiflung, wenn er aufwachte.
Mein Herz zog sich zusammen. »Ich weiß, dass du da bist«, sagte ich leise.
Ich spielte mit dem Feuer und konnte fast hören, wie mein Vater mich verurteilte. Was machst du da, Kind? Warum hältst du dich nicht an die Regeln? Hast du deine Lektion immer noch nicht gelernt? Die Anderen sind immer noch da draußen. Das Böse ist immer noch da draußen. Wenn du den Toten zeigst, dass du sie sehen kannst, lässt du Mächte in deine Welt, über die du nichts weißt. Wenn sie erst einmal in deiner Welt sind, bist du ihnen ausgeliefert. Dein Leben wird nie wieder dir gehören…
Angus stand ebenso erstarrt da wie ich, den Blick auf die Schaukel gerichtet. Er knurrte nicht, wie man es in Gegenwart eines Geistes eigentlich erwarten würde. Er schien fast … verzaubert zu sein. Hypnotisiert.
Wie heißt er?
Ich hörte die Frage so deutlich, als wäre sie laut gestellt worden, doch die einzigen Geräusche im Garten waren die sanfte Musik des Windspiels und das Rascheln der Blätter in den Virginia-Eichen.
»Angus.«
Meine Stimme schien ihn aus seinem Bann zu lösen. Er trottete neben mich und jaulte mitleiderregend, während er seine kalte Nase an meiner Hand rieb. Selbst im trüben Licht des Gartens konnte ich die entsetzlichen Narben an seiner Schnauze sehen und dort, wo man ihm die Ohren abgeschnitten hatte. Ich strich ihm mit der Hand über den Rücken, wo sich das hellbraune Fell immer noch sträubte.
Hat der böse Mann ihm wehgetan?
War das etwa Furcht? Oder projizierte ich nur meine eigene Angst auf Shani? Auf einen Geist.
»Der böse Mann?«
Die Bäume schienen zu erschauern, und ich hörte ein Wimmern. Mit zitternder Hand strich ich Angus über das Fell, doch ich glaubte nicht, dass er den Laut von sich gegeben hatte.
»Wer ist der böse Mann?«, fragte ich vorsichtig.
Wieder ein Wimmern.
»Schon gut«, sagte ich sanft, nicht nur um Angus und Shani zu beruhigen, sondern auch mich selbst. »Alles wird gut.«