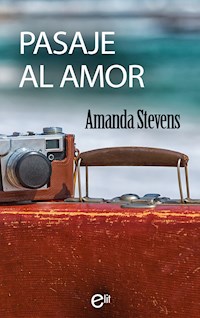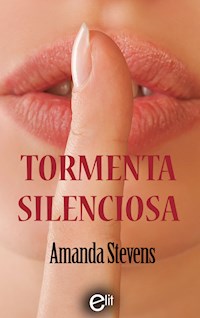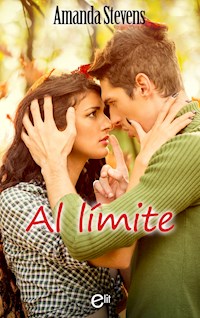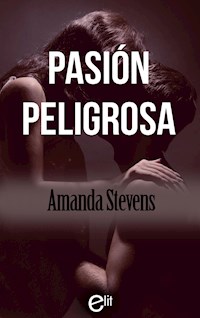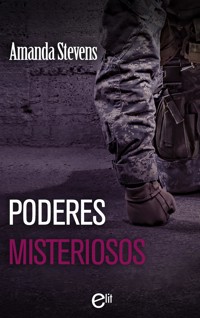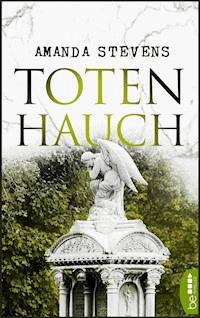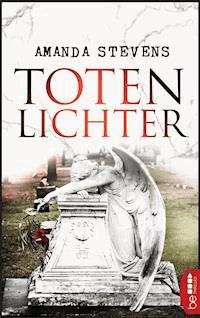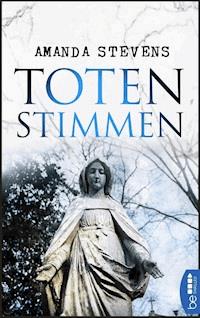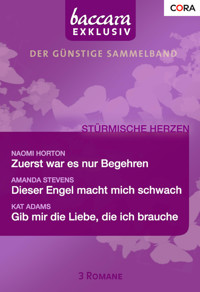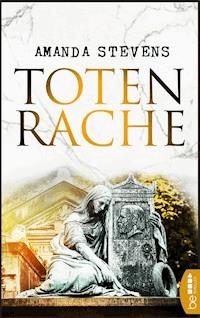
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Graveyard-Queen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Jeder Friedhof hat eine Geschichte, und jedes Grab birgt ein Geheimnis.
Charleston, South Carolina: Für die 28-jährige Amelia Gray sind die Toten ein wichtiger Teil ihres Lebens. Die studierte Archäologin und Friedhofsrestauratorin hat eine besondere Gabe: Sie kann Geister sehen. Diese Fähigkeit führt sie zu einem abgelegenen Friedhof, auf dem vor einem halben Jahrhundert die Opfer eines Massensuizids begraben wurden. Die Gräber sind mit merkwürdigen Zeichen versehen, und die junge Frau ist die Einzige, die das Rätsel dieses unheimlichen Ortes lösen kann. Doch Amelia muss sich auch ihren eigenen Geistern stellen, und ihr Kontakt zur Zwischenwelt bringt sie und ihren Geliebten John Devlin in große Gefahr ...
Der vierte Teil der spannenden Graveyard-Queen-Reihe jetzt als eBook bei beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
FÜNFUNDZWANZIG
SECHSUNDZWANZIG
SIEBENUNDZWANZIG
ACHTUNDZWANZIG
NEUNUNDZWANZIG
DREIßIG
EINUNDDREIßIG
ZWEIUNDDREIßIG
DREIUNDDREIßIG
VIERUNDDREIßIG
FÜNFUNDDREIßIG
SECHSUNDDREIßIG
SIEBENUNDDREIßIG
ACHTUNDDREIßIG
NEUNUNDDREIßIG
VIERZIG
EINUNDVIERZIG
ZWEIUNDVIERZIG
DREIUNDVIERZIG
VIERUNDVIERZIG
FÜNFUNDVIERZIG
SECHSUNDVIERZIG
SIEBENUNDVIERZIG
ACHTUNDVIERZIG
NEUNUNDVIERZIG
FÜNFZIG
EINUNDFÜNFZIG
Über dieses Buch
Charleston, South Carolina: Für die 28-jährige Amelia Gray sind die Toten ein wichtiger Teil ihres Lebens. Die studierte Archäologin und Friedhofsrestauratorin hat eine besondere Gabe: Sie kann Geister sehen. Diese Fähigkeit führt sie zu einem abgelegenen Friedhof, auf dem vor einem halben Jahrhundert die Opfer eines Massensuizids begraben wurden. Die Gräber sind mit merkwürdigen Zeichen versehen, und die junge Frau ist die Einzige, die das Rätsel dieses unheimlichen Ortes lösen kann. Doch Amelia muss sich auch ihren eigenen Geistern stellen, und ihr Kontakt zur Zwischenwelt bringt sie und ihren Geliebten John Devlin in große Gefahr …
Die Graveyard-Queen Reihe
·
Die Verlassenen (Novella)
·
Totenhauch
·
Totenlichter
·
Totenstimmen
·
Totenrache
Über die Autorin
Amanda Stevens ist in Missouri, in der Nähe des Ozark-Plateaus, geboren und aufgewachsen. Sie fühlte sich schon immer zu düsteren Themen hingezogen, liebt Friedhöfe, ist eine passionierte Leserin von Geistergeschichten und Fan von Alfred Hitchcock. In der Graveyard-Queen-Trilogie kombiniert sie auf gelungene Weise Elemente des Thrillers mit denen des Gruselromans. Stevens lebt mit ihrem Ehemann und einer schwarzen Katze namens Lola in Houston, Texas. Weitere Informationen finden Sie auf ihrer Website: www.amandastevens.com
Amanda Stevens
Totenrache
Aus dem Amerikanischen von Diana Beate Hellmann
beTHRILLED
Deutsche Erstausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2016 by Marilyn Medlock Amann
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »The Visitor«
Originalverlag: Mira Books
Dieses Buch wurde vermittelt durch die Literaturagentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Heiko Arntz
Lektorat/Projektmanagement: Eileen Sprenger / Kathrin Kummer
Covergestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven © shutterstock: cla78 | ZINGAYA TEXTURING
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-4318-2
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
EINS
Im Frühjahr kehrte der Totengeist der Blinden zurück, und mit ihm kamen weitere Albträume. Die Tage wurden wärmer, die ersten Magnolienblüten brachen auf, und eine düstere Vorahnung nistete sich wie ein unliebsamer Gast in meinem Inneren ein.
Nacht für Nacht lag ich in einem traumähnlichen Zustand da, war erschöpft von der körperlich anstrengenden Arbeit meiner Friedhofsrestaurierungen, aber zu verängstigt, um mich meiner Müdigkeit zu ergeben und fest einzuschlafen, denn dann würde sie mir erscheinen – das Geistwesen, das mir so ähnlich sah und das mir von der anderen Seite gefolgt war. Ich wollte glauben, dass sie lediglich meine Namensvetterin war, der Totengeist einer vor langer Zeit verstorbenen Ahnin. Ich hatte jedoch große Angst, sie könnte die Vision der Frau sein, die ich in der Zukunft werden würde. Die Manifestation der gepeinigten Seele, die ich eines Tages wäre.
Da mir diese Gedanken schwer zu schaffen machten, wandte ich den Kopf und sah John Devlin an, der schlafend neben mir lag. Er war Police Detective in Charleston, und seine Geister waren jetzt verschwunden. Der Totengeist seiner Tochter war endlich in der Lage gewesen, diese Welt hinter sich zu lassen, und damit das Bindeglied zu entfernen, mit dem ihre Mutter – Devlins verstorbene Ehefrau – sich an ihn gekettet hatte. In den Monaten seit Mariamas Fortgehen hatte ich die Hoffnung nicht aufgegeben, dass Devlin und ich endlich würden zusammen sein können. Wir hatten seit diesem schicksalhaften Tag eine enge Beziehung zueinander aufgebaut. Uns verband etwas, das durch nichts zu zerstören war, weder von einem Totengeist noch von einem Menschen. Das wollte ich zumindest glauben.
Doch während die Tage länger wurden und die Temperaturen stiegen, wollte mir das Blut in den Adern schier gefrieren. Der Wind drehte sich und wehte den Hauch von etwas Unnatürlichem in meine Richtung. Verzerrte Schatten krochen über die Decke meines Schlafzimmers. Da der Sog von der anderen Seite immer stärker wurde, konnte ich gar nicht mehr anders und beschäftigte mich zwanghaft mit der unheilschwangeren Prophezeiung der Blinden. Was du bist, bin ich einmal gewesen. Was ich bin, wirst du eines Tages sein.
Bisher war sie mir immer nur in meinen Träumen erschienen, aber jetzt war ich wach und konnte ihre Präsenz dennoch deutlicher spüren als je zuvor. Vorsichtig, um Devlin nicht zu wecken, stand ich auf und schlich auf Zehenspitzen aus dem Zimmer, durch den Korridor und die Küche in mein Arbeitszimmer, das sich im hinteren Teil des Hauses befand. Die langen Fenster boten mir einen Blick in den Garten, in dem die Fresien vom Licht des Mondes gesprenkelt wurden. Ich stand da und suchte mit den Augen die Schatten ab, und jedes flatternde Blatt, jeder zitternde Ast ließ meinen Puls in die Höhe schnellen.
Ein Luftzug drang durch die Fensterritzen in den Raum und trug den Duft von Staub und getrocknetem Lavendel herein. Angespannt starrte ich in das irreale Wechselspiel von Mondlicht und Finsternis – bis ich sie schließlich fand. Nach außen hin zeigte ich keine Reaktion auf ihre nahezu transparente Gestalt, doch in mir erstarrte alles, als ich mir klarmachte, dass ich der Wahrheit ins Auge blicken musste. Sie war hier. Nicht nur in meiner Fantasie, nicht nur in meinen Träumen, sondern hier. Und damit konnte ich nun nicht länger leugnen, dass ich von Geistern heimgesucht wurde.
Sie trug ein weißes Spitzenkleid, das für eine Hochzeit oder ein Begräbnis angemessen gewesen wäre. Das Licht des Mondes schien auf sie nieder und durch sie hindurch, sodass ich keine Mühe hatte, ihre nur allzu vertrauten Gesichtszüge zu erkennen – die gerade Nase, die hohen Wangenknochen, die leicht geöffneten Lippen. Die gleichen unaufdringlichen Züge, die mir aus dem Spiegel entgegenblickten, wenn man von der einen Auffälligkeit absah, die anders war: Sie hatte keine Augen.
Sie schwebte draußen vor meinem Fenster, presste plötzlich eine Hand gegen das Glas, und im gleichen Moment durchfuhr mich ein eisiger Schauer, eine klirrende Kälte, die ausschließlich von der anderen Seite kam. Raureif legte sich auf die Fenster, und in den Ecken der Scheiben bildete sich eine Eisschicht. Sie spreizte die Finger und winzige Risse breiteten sich in dem Reif aus, und das Glas knackte unter dem Druck ihrer Eiseskälte.
Warum bist du hier?, hätte ich am liebsten geschrien. Was willst du von mir?
Doch ich kannte die Antwort bereits. Sie wollte die Essenz meines Ichs, meine Lebenskraft, mein Mensch-Sein. Sie wollte, wonach alle Geister sich verzehrten – wirklich leben. Genau das machte sie so gefährlich. Das machte sie so gierig und unersättlich.
Sie bewegte den Mund, doch es kam kein Laut über ihre Lippen. Trotzdem konnte ich ihre Botschaft deutlich in meinem Kopf hören: Der Schlüssel. Er ist deine einzige Rettung. Finde ihn!
Dann löste sie sich auf und wurde eins mit den Schatten, und der Raureif verschwand von den Fenstern.
»Amelia?«
Früher wäre ich vielleicht zusammengezuckt, wenn ich in einer solchen Situation meinen Namen gehört hätte, doch inzwischen lebte ich schon seit so vielen Jahren mit Geistern, dass ich gelernt hatte, meine Reflexe zu beherrschen. Devlin trat hinter mich. Seine Stärke und Kraft zu spüren, erregte mich jedes Mal, doch in diesem Moment freute ich mich nicht über seine Nähe.
»Was tust du hier?«, wollte er wissen.
»Ich konnte nicht schlafen.«
»Was ist los?«
»Nichts«, log ich.
Er legte seine Hände auf meine Schultern. »Mein Gott, du bist ja eiskalt.«
»Es ist kühl im Raum.«
»Komm wieder ins Bett.« Er strich mit den Fingerspitzen über meinen Arm. »Ich werde dafür sorgen, dass dir ganz schnell wieder warm wird, Amelia.«
Er dehnte die Vokale, wenn er meinen Namen aussprach, so wie es für Südstaatler typisch war. Es ließ mich innerlich noch mehr erzittern als die anhaltende Kälte. »Gleich.«
Er legte von hinten die Arme um mich und seufzte. »Irgendetwas belastet dich. Was ist? Hattest du wieder einen Albtraum?«
Ich zögerte, suchte mit den Augen in der Finsternis. Ich wollte mich Devlin so gern anvertrauen, wollte die Karten offen auf den Tisch legen. Nur hätte ich ihm dann von den Geistern erzählen müssen. Wenn er sich an irgendetwas erinnert hätte, was ihm während seines Nahtoderlebnisses widerfahren war, wäre er im Hinblick auf meine Gabe vielleicht etwas aufgeschlossener gewesen. Er war jedoch aus seinem Koma erwacht, ohne sich an irgendetwas erinnern zu können, was unmittelbar vor und nach den Schüssen passiert war. Und je mehr seine Wunden heilten, desto mehr verachtete er alles Übernatürliche, sodass ich mir nicht auszumalen wagte, wie er wohl auf ein solches Geständnis reagieren würde.
Nach allem, was er mit der boshaften und nunmehr toten Mariama durchgemacht hatte, war eine Bindung an eine labile Frau vermutlich das Letzte, was er wollte. Also hatte ich den Weg des geringsten Widerstands gewählt und nichts gesagt.
Den größten Teil meines Lebens hatte ich abgeschieden von der Welt hinter Friedhofsmauern verbracht, wo Papas Regeln mich zwar vor Geistern beschützt, mich aber auch von anderen Menschen abgeschirmt hatten. Die Einsamkeit meiner Jugend- und frühen Erwachsenenjahre rechtfertigte jetzt mein Schweigen. Das redete ich mir zumindest ein. Ich hatte ein Recht auf Glück, ganz egal, wie vergänglich es sein mochte, und so klammerte ich mich ebenso fest an meine Geheimnisse, wie sich Efeuranken an alte vergessene Grabsteine klammerten, die ich restaurierte.
»Nun sag schon, was los ist.« Devlin ließ sich nicht beirren.
»Ich dachte, ich hätte im Garten etwas gesehen.«
Sofort war er hellwach. »Eben gerade?«
»Vor ein paar Minuten.«
Er drehte mich um, damit er mir ins Gesicht blicken konnte. »Warum hast du mich nicht geweckt?«
»Weil es vermutlich nichts weiter war als ein Schatten.« Warum hatte ich es überhaupt erwähnt? Wollte ich ihn prüfen? Wollte ich hier so lange bohren, bis er zugab, dass auch er eine Präsenz aus dem Jenseits spüren konnte?
»Ich werde mich draußen mal umschauen«, sagte er.
»Damit verschwendest du nur deine Zeit. Du wirst nichts finden.«
Seine Miene zeigte keine Regung, aber wenn ich ihn so betrachtete, empfand ich noch immer die gleiche Mischung aus Euphorie und Beklommenheit wie bei unserer ersten Begegnung. Ich fragte mich, ob ich mich in seiner Gegenwart wohl immer leicht verunsichert fühlen würde. Er hatte eine zuweilen überwältigende Ausstrahlung, wenngleich sein Benehmen stets förmlich und reserviert war. John Devlin war ebenso rätselhaft wie betörend. Ein Mysterium durch und durch.
»Wenn es dich beruhigt, ist es keine Zeitverschwendung«, sagte er und drückte mir einen Kuss auf die Stirn. Er verschwand in der Küche, und kurz darauf hörte ich, wie die Hintertür geschlossen wurde. Im nächsten Moment war er im Garten. Der Strahl seiner Taschenlampe erfasste die Baumstämme.
Im Mondlicht schimmerten seine Schläfen, die neuerdings grau waren – ein Souvenir von seiner Reise auf die andere Seite. Ich beobachtete ihn, und mein Atem beschleunigte sich. Da sich jetzt keine Geister mehr von seiner Energie ernährten, sah er nicht mehr ausgezehrt und zutiefst unglücklich aus. Seine Augen waren nicht mehr eingefallen, seine Wangen nicht mehr hohl, doch die Erinnerungen würden ihn immer peinigen, ungeachtet seines körperlichen Wohlbefindens. Es würde immer eine leere Stelle in seinem Herzen geben, die ich nicht füllen konnte.
Er stand in meinem weißen Garten und legte mit starren Schultern den Kopf in den Nacken, um zum Mond zu schauen, bevor er sich – mit einem Schaudern, wie ich hätte schwören können – wieder zum Haus umdrehte.
»Alles in Ordnung«, sagte er, als er neuerlich mein Arbeitszimmer betrat. »Da draußen ist nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssten.«
Er stellte sich wieder zu mir ans Fenster, und wir standen da und blickten in den Garten. Die Schafgarben funkelten im Mondlicht wie Silber. Wildrosen rankten sich an den Baumstämmen entlang und verliehen der Nacht einen ganz eigenen Hauch von Romantik.
Devlin schlang seine Arme um meine Taille und zog mich noch einmal fest an sich. Seine Umarmung war wie ein Zufluchtsort, an dem ich mich sicher fühlte, und so versuchte ich, weder an die Vergangenheit noch an die Zukunft zu denken. Die einzige Zeit, über die wir gebieten konnten, war die Gegenwart. Für diese Erkenntnis hatte ich ein hohes Lehrgeld gezahlt.
Doch selbst als er mich küsste, konnte ich mich der unheilvollen Stimmung nicht erwehren, die mich seit Wochen bedrückte. Irgendetwas stand uns bevor. Der Besuch des blinden Totengeistes war erst der Anfang.
ZWEI
Als die Sonne am nächsten Morgen den Horizont erklomm, war ich bereits angezogen und hatte mir eine erste Tasse Tee eingeschenkt. Ich trank ihn in kleinen Schlucken, während ich mich mit der Schulter gegen den Rahmen der Schlafzimmertür lehnte und Devlin dabei zusah, wie er sich im Halbdunkel das Hemd zuknöpfte.
Er übernachtete nicht immer bei mir. Durch seinen Beruf schlief er schlecht. Oft stand er mitten in der Nacht auf, um sich die Akten eines aktuellen Falles vorzunehmen. Auch ich wurde von meiner Arbeit sehr in Anspruch genommen. Doch in den kalten Wintermonaten war üblicherweise weniger zu tun. Er und ich waren uns daher sehr nahegekommen. In letzter Zeit spürte ich jedoch eine Distanz zwischen uns.
Ich hätte die Rückkehr der Geister dafür verantwortlich machen können, den Umstand, dass ich so viele Geheimnisse vor ihm hatte, aber Devlin war offensichtlich aus einem anderen Grund immer nachdenklicher geworden. Er hatte sich immer mehr in sich selbst zurückgezogen. Manchmal, wenn er sich unbeobachtet wähnte, starrte er mit dem seltsamsten Gesichtsausdruck aus dem Fenster oder sah sich um, als spüre er eine Präsenz, die nicht einmal ich sehen konnte. Ich versuchte mir einzureden, dass sein Verhalten aufgrund des Traumas, das er durch seine Schussverletzung erlitten hatte, nicht ungewöhnlich war. Trotzdem konnte ich nicht umhin, mir Sorgen darüber zu machen, dass ihn auch noch etwas anderes belasten könnte. Etwas, von dem er nicht wollte, dass ich es erfuhr.
Unsere Blicke trafen sich im Spiegel, und ich lächelte. »Tee?«
»Nein danke, keine Zeit. Ich muss vor der ersten Einsatzbesprechung noch zu Hause vorbeifahren und mich umziehen. Danach werde ich den ganzen Tag nicht mehr erreichbar sein. Ich weiß noch nicht, wann ich wieder zurück bin.«
Ich nickte. »Verstehe. Ich habe heute selbst den ganzen Tag zu tun.«
»Eine neue Restaurierung?«
»Wenn ich den Zuschlag bekomme.«
»Viel Glück.« Er legte sich Jackett und Krawatte über den Arm und ging zur Tür. Das Licht der ersten Sonnenstrahlen, die durch die Spitzenvorhänge drangen, tauchte ihn in einen unwirklichen Glanz, und für einen kurzen Moment wirkte er wie eine jenseitige Erscheinung. Doch John Devlin war kein Geist. Er war aus Fleisch und Blut. Er war ein Mensch, und er war äußerst lebendig.
An der Tür blieb er stehen, fuhr mir mit der freien Hand durchs Haar. Ich sah zu ihm auf, und er beugte sich zu mir herab und küsste meine Lippen. Sofort beschleunigte sich mein Herzschlag. Ich hatte größte Mühe, die Teetasse nicht fallen zu lassen, während ich auf seinen Kuss reagierte, indem ich die Lippen öffnete und mit meiner Zunge die seine berührte.
Er löste sich von mir und sah mich mit glänzenden Augen an. Dann warf er sein Jackett und die Krawatte aufs Bett, nahm mir Tasse und Untertasse aus der Hand, fuhr mit beiden Händen durch mein Haar und küsste mich erneut. Die Dringlichkeit dieses Kusses und die Hitze seines Körpers ließen mich vergessen, was erst eine Stunde zuvor zwischen uns passiert war. Das vertraute Flüstern, das leise Stöhnen, seine Hand, die langsam über meinen Schenkel glitt ... Ein stürmischer Kuss reichte, und schon war ich ihm neuerlich verfallen. In meinem ganzen achtundzwanzig Jahre währenden Leben war ich noch niemals einem Menschen wie Devlin begegnet. Er war alles, was ich mir von einem Mann wünschen konnte, und mehr, als ich mir je hätte erträumen können.
»Ich muss jetzt wirklich gehen«, sagte er.
»Ich weiß.« Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und küsste ihn noch einmal, dieses Mal aber nur ganz sacht, denn es wurde für uns beide Zeit, unseren Pflichten nachzugehen. »Sehe ich dich später?«
Er zögerte einen winzigen Moment. »Das kann ich noch nicht sagen. Ich weiß noch nicht, wann ich wieder zurück bin.«
»Verlässt du die Stadt?«
Wieder zögerte er, dieses Mal etwas länger und mit einem geheimnisvollen Flackern in seinen so sehr dunklen Augen. »Ich bin mit meinem Großvater in seinem Strandhaus in Myrtle Beach zum Abendessen verabredet.«
Ich sah ihn mit großen Augen an. Ich war baff. Devlin und sein Großvater hatten seit Jahren keinerlei Kontakt mehr gehabt, nicht mehr seit der Zeit, da Devlin beschlossen hatte, Polizeibeamter zu werden, statt in die Anwaltskanzlei seiner Familie einzusteigen. Ich hegte zwar den Verdacht, dass es für die Animositäten zwischen den beiden starrköpfigen Männern noch sehr viel schwerwiegendere Gründe gab als Devlins Berufswahl, wusste aber nichts Genaueres, denn er hatte sich mir gegenüber nie offen über seine Familie geäußert.
Er nahm sein Jackett und die Krawatte vom Bett. »Seine Assistentin schien die Angelegenheit für dringlich zu halten, also weiß ich nicht, wie lange ich mich dort aufhalten werde. Wenn das Abendessen allzu lange dauert, übernachte ich vielleicht dort und fahre erst morgen früh wieder zurück.«
»Ach so. Ich hoffe, er ist nicht ... Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist.«
»Ich bin überzeugt, dass es ihm gut geht«, sagte Devlin, doch sein besorgter Blick strafte diese locker geäußerte Behauptung Lügen.
Ich stellte keine weiteren Fragen. Dabei war ich immer schon neugierig gewesen, wenn es um Jonathan Devlin ging. Er war ein erfolgreicher Rechtsanwalt und Mäzen, dessen Vorfahren sich bis zu den Gründungstagen von Charleston zurückverfolgen ließen. Zahllose Male war ich bereits an seiner Villa südlich der Broad Street vorbeispaziert, Devlins einzigem noch lebenden Verwandten aber noch kein einziges Mal begegnet. Ich wollte ihn nur nicht mit Fragen nach seiner Verwandtschaft bedrängen, denn meine eigene Familie hatte schließlich ebenfalls Geheimnisse, und zwar mehr als genug.
Wild entschlossen, mich nicht weiter in Zweifeln und Bedenken zu ergehen, unternahm ich sofort, nachdem Devlin losgefahren war, meinen morgendlichen Spaziergang. Es machte mir immer Freude, strammen Schritts durch die Innenstadt zu laufen, in der die Magnolien bereits in voller Blüte standen und an jeder Straßenecke ein Stück Stadtgeschichte verborgen lag. An Tagen, an denen ich vor Sonnenaufgang unterwegs war, liebte ich es, auf der Battery haltzumachen und mir anzusehen, wie über dem Hafen die Sonne aufging. In dieser stillen Zeit, in der die Geister sich hinter einen unsichtbaren Schleier zurückzogen und die Touristen noch in ihren Betten lagen und tief und fest schliefen, hatte ich die Stadt ganz für mich allein. Keine Geheimnisse, um die ich mich sorgen musste, kein Kribbeln im Nacken, das mich vor einer unheimlichen Präsenz warnte. Nur der Tanz des Sonnenlichts auf dem Wasser und die am Horizont schimmernde Silhouette von Fort Sumter. Unmittelbar bevor der Morgentau verdunstete, glitzerten die Bäume, als seien sie voller Diamanten, ein Märchenland aus Kristallen, so strahlend und traumhaft, dass mir die Schönheit dieser Stadt jedes Mal fast den Atem verschlug.
Ich lebte erst seit relativ kurzer Zeit in Charleston. Geboren und aufgewachsen war ich in der kleinen Stadt Trinity. Meine Mutter war allerdings gebürtig aus Charleston. Sie und meine Tante waren in einem kleinen Haus in der historischen Altstadt groß geworden, in unmittelbarer Nähe der vielen großen Villen. Ihre Kindheit war geprägt gewesen von gutbürgerlichen Sitten und Traditionsbewusstsein.
Als kleines Mädchen hatte mich fasziniert, wie vornehm sie sich benahmen und sprachen. Sie waren exotische Wesen, die in Rosenwasser badeten und stets frisch gestärkte Kleider trugen. Erst als ich älter wurde, fing ich an zu begreifen, wie viel Kraft es sie kostete, derart formvollendet aufzutreten. Aber für meine Mutter und meine Tante – wie für so viele Südstaatlerinnen im fortgeschrittenen Alter – war die Herkunft zur Berufung geworden.
Ich war weder die leibliche Tochter meiner Mutter, noch hatte mich ihre Erziehung sonderlich geprägt. Ich trug an den meisten Tagen Jeans und Turnschuhe und machte mir nur selten einmal die Mühe, mich zu schminken. Mein Gesicht war von der Sonne gebräunt und voller Sommersprossen, und meine Hände hatten von der schweren körperlichen Arbeit einer Friedhofsrestauratorin Schwielen. Ich besaß rein gar nichts von der Eleganz meiner Mutter und meiner Tante, und wenn ich mich im Spiegel betrachtete, fragte ich mich zuweilen, wie eine Frau wie ich jemals die Aufmerksamkeit eines Mannes wie Devlin hatte erregen können.
Dass ich mich das fragte, hatte nichts mit falscher Bescheidenheit zu tun oder damit, dass ich mich selbst herabwürdigte. Ich war mir meiner Vorzüge durchaus bewusst. Ich besaß das, was man Bildung nannte, ich war in der Welt herumgekommen, und mein Beruf hielt mich körperlich fit. Meine Augen waren etwas Besonderes, das hatte ich schon immer gefunden. Ihre Farbe changierte je nach Umgebung und Kleidung von Blau zu Grau und manchmal ins Grünliche. Am unteren Rand meiner Iris waren winzige lang gezogene dunkle Flecken. Als ich noch klein war, entdeckte ich, dass ich beim Blick in den Spiegel lediglich die Augen leicht zusammenkneifen und ein bisschen Fantasie zum Einsatz bringen musste, und schon sorgten diese seltsamen Verfärbungen dafür, dass meine Pupillen wie Schlüssellöcher aussahen.
Doch all das – Augenfarbe, Bildung, Beruf – änderte nichts daran, dass ich niemals eine von diesen Frauen sein würde, die scheinbar mühelos durchs Leben schwebten. Die zu Mittag im Jachtklub aßen oder Gartenpartys gaben, bei denen die Damen weiße Handschuhe trugen, die sich mit harmlosen Flirts vergnügten und mit eisgekühlte Mint Juleps. Das war Devlins alte Welt gewesen. Und aufgrund meiner Herkunft und weil ich war, wer ich war, würde ich in dieser Welt niemals willkommen sein. Trotz ihres unbestreitbaren Charmes war Charleston eine engstirnige Stadt, in der Traditionen und Stammbäume zählten, eine Stadt, die von ihren Flüssen und ihrem Hafen ständig gemahnt wurde, sich auf sich selbst zu besinnen. Ich war von meiner Mutter her eine Asher – ein Name, der mit Geld und mit der entsprechenden Korruption verbunden wurde. Doch ich war auch eine Gray. Die Vorfahren meines Vaters waren einfache Leute aus den Bergen, und von diesem Zweig meiner Ahnen hatte ich meine fragwürdige Gabe geerbt. Glückshaubenträger nannte man uns manchmal. Darunter verstand man diejenigen unter uns, die mit einem Schleier zur Welt gekommen waren. Das kam in jeder Generation etwa einmal vor.
Doch als immer mehr von Papas Geheimnissen ans Licht kamen, begann mir zu dämmern, dass mein Erbe nicht nur aus der Fähigkeit bestand, Totengeister zu sehen. Ich war das tote Kind einer toten Mutter gewesen. Meine Großmutter Tilly hatte mich von der anderen Seite wieder auf diese zurückgeholt, indem sie die Fruchtblase weggeschnitten hatte, die mein Gesicht wie ein dünner Schleier bedeckt hatte, und Luft in meine noch nicht atmungsfähigen Lungen gepumpt hatte, und jetzt hatte ich manchmal das Gefühl, zu keiner der beiden Welten zu gehören. Ich war ein Geist aus Fleisch und Blut, eine ruhelose Wanderin, die ihre Lebensaufgabe und ihren Platz in der Welt noch nicht gefunden hatte. Doch mit jeder neuen Entdeckung, mit jeder Regel, die ich brach, kam ich meiner Berufung ein Stückchen näher.
Wäre ich in der Lage gewesen, durch die Schlüssellöcher meiner Augen in die Zukunft zu blicken, hätte ich mein Schicksal vielleicht irgendwie ändern können. Doch wie kämpfte man gegen das an, was einem vorherbestimmt war? Wie besiegte man das Schicksal?
Das war eine Frage, über die ich mir häufig mitten in der Nacht den Kopf zerbrach, während die Geister an meinem Fenster vorüberschwebten.
Als ich wieder zu Hause und frisch geduscht war, trug ich meine zweite Tasse Tee nach draußen in den Garten, wo ich beobachten konnte, wie die Schmetterlinge in der Rosmarinweide von einer Blüte zur anderen flatterten. Irgendwo weiter unten in der Straße ertönte eine Hupe, und ich konnte das gedämpfte Dröhnen des Verkehrs auf der Rutledge Avenue hören, auf der die Pendler vom einen Ende der Stadt zum anderen fuhren. Derweil war in meiner kleinen Oase alles ruhig und still. Oder das dachte ich zumindest.
Ich war offenbar immer noch nervös wegen der nächtlichen Heimsuchung, denn das Herz krampfte sich mir schmerzhaft zusammen, als ich sah, dass die Kellertür offen stand.
Ich lief kurz entschlossen durch den Garten zur Kellertreppe. Ich wollte etwas rufen, aber in diesem Moment wehte ein Geruch zu mir herauf – der Geruch von Moschus und Erde und Moder. Es war nicht der Gestank von Verwesung. Es war wie der Geruch einer Erinnerung an frühere Tode.
Totengeister hatten häufig einen Phantomduft. Devlins tote Tochter hatte nach Jasmin gerochen, und die blinde Erscheinung in der vergangenen Nacht nach Staub und getrocknetem Lavendel.
Das hier war jedoch nicht der Geruch eines Geistes.
Eine Wolke schob sich vor die Sonne, und ich erzitterte. Als die Sonne wieder zum Vorschein kam, starrte mir aus der Finsternis des Kellers ein nur schemenhaft erkennbares Gesicht entgegen.
[ranke.jpeg]
DREI
»Amelia?«
Mein Herz setzte für den Bruchteil einer Sekunde aus. Ich musste ich erst wieder zu Atem kommen. Dass irgendeine widerliche Kreatur meinen Namen in den Mund nahm, versetzte mich in einen regelrechten Schockzustand. Dann schaltete sich mein Verstand wieder ein, und mir ging auf, dass ich die Stimme kannte. Es war eine beruhigende Stimme.
»Entschuldigung, ich habe Ihnen hoffentlich keine Angst eingejagt«, rief Macon Dawes zu mir nach oben.
Ich konnte ihn so gerade eben in dem trüben Licht ausmachen. Das zerzauste Haar, die müden Augen, das spitze Kinn. Das war weder ein Dämon noch ein abscheuliches Halbwesen aus einer Sphäre zwischen den Welten. Vielmehr war es das wohltuend menschliche Antlitz des Nachbarn, der über mir wohnte.
Nur dieser Geruch ...
Ich klammerte mich mit beiden Händen an das Treppengeländer, denn ich hatte nach wie vor Mühe, mein wild pochendes Herz zu beruhigen. »Ein bisschen erschreckt haben Sie mich schon. Ich hatte nicht erwartet, dass um diese Uhrzeit schon jemand im Keller ist.«
»Hat das Hämmern Sie geweckt?« Er stellte seinen rechten Fuß auf die unterste Treppenstufe, sah mich mit gequältem Gesichtsausdruck an. Er trug schwarze Converse-Chucks – fast die gleichen, die ich anhatte –, zerrissene Jeans und ein altes kariertes Hemd über einem abgetragenen T-Shirt. Die Gewöhnlichkeit seines Äußeren hatte etwas Beruhigendes.
»Das tut mir leid. Ich hätte mir denken müssen, dass das Hämmern in ihrer Wohnung zu hören ist.«
»Nein, ich habe gar nichts gehört«, versicherte ich ihm. »Ich wollte nur eben im Garten eine Tasse Tee trinken, als mir die offen stehende Tür auffiel.«
»Trotzdem, es war nicht gerade sehr rücksichtsvoll. Ich bin vom Krankenhaus so an den Schichtdienst gewöhnt, dass ich ganz vergesse, dass es in der realen Welt Menschen wie Sie gibt, die normale Arbeitszeiten haben.«
»Es ist ja nichts passiert.« Ich ging ein paar Stufen zu ihm hinunter. Nachdem sich mein Herzschlag wieder beruhigt hatte, war ich neugierig geworden. Macon studierte an der Medical University of South Carolina Medizin, und ich hatte mich längst daran gewöhnt, dass er zu allen möglichen und unmöglichen Uhrzeiten kam und ging. Aber zu so früher Stunde aktiv zu sein, war selbst für ihn ungewöhnlich. »Was bauen Sie denn da?«
»Was ich baue? Nichts. Ich bringe nur ein paar von den Regalen wieder fest an die Wand, damit wir etwas mehr Platz haben, um Sachen zu verstauen.« Er ließ den Blick durch den Keller schweifen. »Sind Sie in letzter Zeit mal hier unten gewesen? Der Keller ist die reinste Feuerfalle. Ich habe jede Menge unnützen Mist hier unten gefunden. Kartons mit alten Schulbüchern und Zeitschriften. Truhen mit mottenzerfressener Kleidung. Und da hinten liegt was rum, das verdächtig nach einer mumifizierten Fledermaus aussieht.«
Ich ging eine weitere Stufe tiefer. »Was ist das für ein Geruch?«
Er rümpfte die Nase. »Da hätten Sie mal schnuppern sollen, bevor ich gelüftet habe. Ich glaube, irgendetwas nistet hier unten.«
»Nistet?« Ich sah ihn beunruhigt an. »Was soll denn hier nisten?«
»Ratten vielleicht. Oder Opossums. Und habe ich die Spinnen schon erwähnt?«
Er schüttelte sich demonstrativ.
»Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«, erkundigte ich mich, wenn auch nicht besonders begeistert, da mir die Sache mit den Spinnen zu denken gab. Ich litt schon seit meiner Kindheit an einer Aversion gegen Spinnen, die an Phobie grenzte, und obwohl ich seit Jahren durch in Spinnweben gehüllte Gruften und von Spinnen verseuchte Mausoleen pirschte, war mir nie so recht gelungen, meinen Ekel zu überwinden.
»Danke für das Angebot, aber es reicht, wenn sie alles, was Ihnen gehört, markieren würden. Ich kümmere mich dann um den Rest.«
»Ich habe hier eigentlich gar nichts abgestellt. In meinem Abteil sind nur ein paar Kisten, die bereits hier standen, als ich eingezogen bin. Ich werde aber nach unten kommen und noch einmal nachschauen.«
Ich ging ganz hinunter, tauschte nur widerwillig das Sonnenlicht des Gartens gegen die Düsternis des Kellers ein. Das Haus war auf einem Stück Land errichtet worden, auf dem früher die Kapelle eines Waisenhauses gestanden hatte, das um die Jahrhundertwende herum bis auf die Grundfesten abgebrannt war. Der Keller war das Einzige, was von dem ursprünglichen Bau noch übrig war, und manchmal, wenn ich nach unten ging, befiel mich das unbehagliche Gefühl, dass hinter diesen Backsteinmauern etwas versteckt war und wartete. Keine Spinnen oder Nagetiere, etwas anderes.
Das Haus hatte mir immer Schutz vor den Geistern geboten und einen sicheren Hafen dargestellt. Ich fragte mich jedoch manchmal, ob der Keller vielleicht eine Art Schwachstelle war, an der man den Schutzwall des geweihten Bodens durchdringen konnte. Das einzige Geistwesen, das je in mein Allerheiligstes hatte eindringen können, war der Totengeist von Devlins Tochter gewesen. Sie hatte irgendwie einen Weg in mein Haus gefunden, und wenn sie das fertiggebracht hatte, wie lange würde es dann dauern, bis auch andere es taten?
Im hinteren Teil des Kellers gab es noch eine zweite Treppe, die in meine Küche führte, doch diese Tür war während einer der Renovierungsmaßnahmen mit Brettern vernagelt worden. Es hatte einmal eine Zeit gegeben, in der mir dieser versperrte Durchgang das Gefühl vermittelt hatte, im Haus in Sicherheit zu sein. Jetzt fragte ich mich, ob mein Seelenfrieden vielleicht lediglich eine Illusion gewesen war.
Sonderbar, dass man auf eine vernagelte Tür blicken konnte und auf der einen Seite das Gefühl hatte, sicher zu sein, während man auf der anderen Seite glaubte, in der Falle zu sitzen. Ich spürte einen Anflug von Klaustrophobie, bei dem Gedanken, dass es nur diesen einen Ausgang gab, der hinter mir lag.
»Was ist das für ein Geräusch?« Mit gerunzelter Stirn legte ich den Kopf zur Seite.
Macon horchte. »Ich höre nichts.«
»So ein Summen. Wie elektrischer Strom.«
Er richtete den Blick auf die nackte Glühbirne unter der Decke. »Vermutlich eine defekte Leitung. Ich bezweifle, dass dieses Haus in den letzten Jahren einer anständigen Inspektion unterzogen wurde. Wie gesagt, die reinste Feuerfalle.«
Ich rieb mir mit den Händen über die Arme und schaute mich skeptisch um. Ich roch wieder den schwachen, animalischen Geruch von Moschus und Verwesung. »Ich bin noch nie gern hier unten gewesen«, gab ich zu. »Mir graust vor diesem Keller.«
»Sagt die Frau, die ihren Lebensunterhalt mit dem Restaurieren von Friedhöfen verdient.« Macon blies den Staub von einer Kiste, dann hob er den Deckel und schaute hinein. »Gerümpel, Gerümpel und noch mehr Gerümpel.« Als er den Karton mit Schwung vom Regal zog, fiel etwas heraus und landete auf den Fußboden. Es war eine altertümliche Fotografie – oder richtiger handelte es sich um zwei identische Fotografien, die nebeneinander abgebildet waren.
Ich betrachtete das merkwürdige Doppelfoto, und obwohl ich den Mann, der mir von beiden Bildern entgegenblickte, noch niemals gesehen hatte, und erst recht nicht die beiden auffallend kleinen Mädchen, die dort Rücken an Rücken vor ihm standen, kam mir irgendwas an der Aufnahme vertraut vor. Die Mädchen waren älter, als man aufgrund ihrer Körpergröße hätte annehmen mögen, schätzungsweise fünfzehn.
Nach ihrer Kleidung zu urteilen, waren diese Fotos lange vor meiner Geburt aufgenommen worden. Der Mann trug eine Latzhose ohne Hemd darunter, während die Mädchen in schwarze Umhänge gehüllt waren, die ihre zarten Körper vom Hals bis zu den Füßen bedeckten.
Irgendetwas an diesen unpassenden schweren Umhängen und an der Art, wie sie mit den Gesichtern zur Kamera gewandt dort standen, jagte mir einen unerklärlichen Schauer über den Rücken.
Ich reichte Macon den Fotoabzug. »Schauen Sie mal.«
Er ging zum Fuß der Treppe, wo er mehr Licht hatte. »Das ist ein Stereoskop-Foto«, sagte er schließlich. »Wenn Sie sich das durch ein entsprechendes Gerät anschauen, werden die beiden Fotos zu einem dreidimensionalen Bild.«
»Das Foto scheint recht alt zu sein.«
»Das ist es allerdings. Die Stereoskopie war schon im neunzehnten Jahrhundert sehr beliebt. Ich hatte einen Onkel, der solche Fotos gesammelt hat. Ich frage mich, ob irgendwo hier unten auch so ein Stereoskop herumliegt. Wo haben Sie das Bild gefunden?«
»Ist heruntergefallen, als Sie den Karton herausgezogen haben.«
Ich wartete geduldig, während er die staubigen Kartons durchwühlte – ein Mann mit einer Mission. Ein paar Minuten später stieß er ein triumphierendes »Aha« aus und hielt eine brillenartige Apparatur mit Holzgriff in die Luft. Mit diesem Teil ging er wieder zur Treppe, steckte die Karte in die Halterung und hielt das Stereoskop ins Licht. »Wow, das ist cool. Als würden die Leute direkt vor einem stehen.«
Ich trat zu ihm, und er reichte mir das Stereoskop. Er hatte recht: Man sah die Personen dermaßen deutlich, dass es einen fast erschreckte. Gleichzeitig übten sie eine nahezu magnetische Anziehungskraft auf mich aus – diese ernsten Gesichter, die von dunklen Augen beherrscht wurden, die mit stechendem Blick in die Kamera starrten.
Dann fielen mir verschiedene andere Dinge auf, die seltsam waren. Eine kleine karrenartige Vorrichtung im Hintergrund. Ein eingezäunter Bereich unter der Eingangsveranda, womöglich der Zwinger eines Hundes. Ich konnte am einem der Fenster im Obergeschoss sogar unscharf ein weiteres Gesicht sehen, das auf das Trio unten hinunterblickte.
Ein vertrautes Gesicht.
Das Bild verschwamm mir vor den Augen, und meine Finger umklammerten den polierten Holzgriff fester. Ich traute meinen Augen nicht. Entweder ich bildete mir das nur ein, oder aber es war eine seltsame optische Täuschung, anders konnte es gar nicht sein, denn eine vernünftige Erklärung gab es nicht für das, was ich sah. Andererseits war ich eine Frau, die umgeben von Totengeistern lebte. Meine Welt gehorchte nicht den Gesetzen von Verstand und Logik.
Ich ließ mir einen Moment Zeit, um mich innerlich wieder zu beruhigen, und konzentrierte meinen Blick dann neuerlich auf die eine Stelle. Zuerst verschwanden die Mädchen, und dann verblasste der Mann, bis ich schließlich nur noch dieses Gesicht sah, das aus dem Fenster im Obergeschoss nach unten blickte.
Die Augen, die Nase, der Mund – die gleichen unaufdringlichen Züge, die mir aus dem Spiegel entgegenblickten.
VIER
Nachdem ich eine Tasse Kamillentee getrunken hatte, begannen meine Nerven, sich wieder zu beruhigen. Ich versuchte, mir einzureden, dass ich einfach nur überreagierte, doch wie groß war die Möglichkeit, dass es reiner Zufall war, dass diese Stereofotografie zur gleichen Zeit in meinem Keller auftauchte, da ich vom Totengeist der Blinden heimgesucht wurde?
Macon war offenbar nichts Ungewöhnliches aufgefallen – weder an dem Foto noch an meinem Benehmen. Bevor er sich die Aufnahme genauer anschauen konnte, hatte er einen Anruf erhalten, und als er mit Telefonieren fertig war, wollte er nur noch mit seiner Arbeit weitermachen. Ich war mit dem Stereoskop und dem Foto nach oben geflüchtet und hatte beides in mein Arbeitszimmer getragen, in dem sie jetzt auf meinem Schreibtisch lagen, bis ich mich entschieden hatte, was ich mit ihnen anfangen wollte.
Die Vorstellung, diese beiden Gegenstände im Haus zu haben, bereitete mir keine allzu große Sorgen. Dass irdische Besitztümer, selbst Orte, von Geistern heimgesucht werden, hatte ich noch nie geglaubt. Menschen wurden von Geistern heimgesucht. Allerdings konnten Geistwesen zuweilen Objekte benutzen, um darüber mit den Lebenden zu kommunizieren, und deshalb musste ich mich fragen, ob dieses Stereoskop eine weitere Botschaft der Blinden war.
Das war ein großer Schritt, und obwohl ich mich den Rest des Tages um meine eigentliche Arbeit kümmerte, musste ich mir zwischendurch immer wieder in Erinnerung rufen, dass das jetzt nicht der richtige Moment war, um meiner Fantasie die Zügel schießen zu lassen. Ich musste ein Angebot für die Restaurierung des Seven Gates Cemetery erstellen, meinen Blog auf den neuesten Stand bringen und meine Rede für die Einweihung des Friedhofs von Oak Grove schreiben. Bis ich Zeit hatte, weitere Nachforschungen anzustellen, würde ich gut beraten sein, nicht weiter über dieses Foto nachzudenken.
Ich konnte mich jedoch noch so sehr bemühen, mich auf andere Dinge zu konzentrieren, meine Gedanken schweiften immer wieder ab. Das Foto rief förmlich nach mir. Ich wusste nicht, ob es eine Facette meines Charakters war oder in der Natur meines Berufes begründet war, aber wenn es galt, ein Rätsel zu lösen, konnte ich nicht ruhen, bis es gelöst war.
Schließlich erlag ich der Versuchung, steckte das Foto in das Stereoskop und hielt es mir vor die Augen. Ich drehte meinen Stuhl so ins Tageslicht, dass ich das dreidimensionale Bild nach Botschaften und Hinweisen absuchen konnte. Doch das Einzige, was eine Bedeutung für mich hatte, war das Gesicht am Fenster im Obergeschoss.
Zumindest konnte ich jetzt davon ausgehen, dass meine Doppelgängerin einstmals real existiert hatte. Sie war keine Vision meines zukünftigen Ichs, sondern ein Totengeist aus der Vergangenheit. Eigentlich hätte diese Erkenntnis mich beruhigen müssen, doch änderte das nichts an der Tatsache, dass sie einen Grund dafür gehabt hatte, mir durch den Schleier zu folgen. Sie hatte mich gemahnt, einen Schlüssel zu finden, aber wo sollte ich danach suchen?
Zitternd legte ich das Doppelfoto auf den Schreibtisch und sah mir die Spezialbrille genauer an. Erstmals fiel mir eine kleine Silberplatte auf der Unterseite auf. Die Buchstaben der Inschrift waren dermaßen klein, dass ich sie kaum lesen konnte: »Für Mott – von Neddy. Auf ewig vereint.«
Am Unterrand des Silberplättchens stand in noch kleinerer Schrift der Name eines Geschäfts: Dowling Curiosities, Charleston.
Angesichts der Tatsache, wie alt das Stereoskop war und wie lange es vermutlich schon im Keller gelegen hatte, war meine Hoffnung, dass es dieses Geschäft immer noch gab, nicht gerade groß. Wie ich jedoch erstaunt feststellte, lieferte eine entsprechende Google-Suche als Resultat eine Adresse in der King Street. Bei meinen Spaziergängen durch die historische Altstadt war ich zweifellos schon zigmal daran vorbeigelaufen. Ich gab die Informationen in mein Telefon ein, damit ich beim nächsten Mal nach dem Laden Ausschau halten konnte.
Den Rest des Nachmittags verbrachte ich an meinem Schreibtisch, wo ich abwechselnd an Angeboten arbeitete und immer wieder das Foto begutachtete, bis ich mich nicht mehr konzentrieren konnte, weil mir vor Hunger fast übel wurde. Da Devlin den Abend mit seinem Großvater verbrachte, beschloss ich, in das kleine Restaurant in der Rutledge Avenue zu gehen, um dort frühzeitig zu Abend zu essen. Als ich kurze Zeit später wieder nach Hause kam, saß zu meinem Erstaunen Devlin aber auf der Veranda und wartete auf mich. In dem Moment, in dem ich auf die Treppe zusteuerte, wehte eine sachte Brise den Duft seines Parfüms in meine Richtung, einen geheimnisvollen, würzigen Duft mit einem Hauch warmer Vanille und einer gefährlichen Note von Absinth. Sinnlich, verführerisch und ein wenig gewagt für diese Tageszeit, aber das war Devlin.
Das Licht der Spätnachmittagssonne stach durch die Bäume und blendete mich für einen Moment, sodass Devlin für mich zu einer dunklen Silhouette wurde. Fast sah es so aus, als schwebe noch eine weitere Gestalt neben ihm, doch dann blinzelte ich mit den Augen, und ebenso wie bei dem mysteriösen Stereoskop verschmolzen die beiden Bilder zu einem.
»Ich dachte, du isst heute mit deinem Großvater zu Abend«, sagte ich verwundert.
»Ja, ich bin nur zufällig vorbeigekommen. Ich wollte dich sehen, bevor ich mich auf den Weg mache.« Er sprach nicht weiter, sah mich verwundert an. »Ist alles in Ordnung mit dir?«, frage er nach einer Weile. »Du machst so ein ernstes Gesicht.«
»Wirklich? Muss an der Sonne liegen. Sie blendet.« Ich trat aus dem grellen Licht in den Schatten, und als sich meine Augen an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnt hatten, war ich wieder einmal sprachlos, als ich sah, wie umwerfend gut er aussah. Trotz der Hitze wirkte er so frisch wie der sprichwörtliche Morgentau, und sein Baumwollhemd war wie üblich frisch gewaschen und gestärkt, die Naht seiner maßgeschneiderten Hose saß makellos. Bis ich Devlin begegnet war, hatte ich eine gut sitzende Hose nie in ausreichendem Maße zu würdigen gewusst. Das fiel mir auf, als ich die Treppe hinaufging.
Ich hatte kaum die oberste Stufe erreicht, als er sich vorbeugte und mich küsste. Normalerweise hätte ich seine Umarmung willig erwidert, weil mich dieser betörende Duft und die ihm angeborenen Reize wie magisch anzogen, doch jetzt reagierte ich, ohne es zu wollen, merkwürdig zurückhaltend, unterdrückte mein Verlangen und versuchte, neuerlich die schützende Mauer zwischen uns zu errichten, die bei unserer ersten Begegnung eingestürzt war.
Allmählich begann ich zu begreifen, warum Papa sich in sich selbst zurückgezogen hatte. Sich hinter den Schutzwall seiner eigenen problembeladenen Gedanken zurückzuziehen, war der einzige Weg gewesen, der ihm vertraut war, um sich selbst und die Menschen in seinem Umfeld vor den Geistern zu schützen.
Fragend sah Devlin mir ins Gesicht. »Ich glaube nicht, dass es an der Sonne lag. Irgendetwas stimmt nicht. Das sehe ich dir an.«
»Ich bin nur müde.«
»Weil du nicht schläfst.« Er strich mir mit den Fingerknöcheln über die Wangen. »Ich wünschte, Rupert Shaw hätte dich nie dazu überredet, noch einmal nach Oak Grove zurückzukehren. Seit du dich bereit erklärt hast, die Restaurierung zu beenden, hast du diese Albträume.«
»Es ist ein unheimlicher Friedhof«, sagte ich. »Ein Ort der Schmerzen. Das war er schon vor den Morden.«
Er sah mich nur noch intensiver an. »Es ist aber nur ein Ort. Das Böse, was dort passiert ist, wurde von Menschen begangen, von Menschen, die heute tot sind. Das weißt du doch wohl hoffentlich, oder?«
Ich konnte schlecht mit ihm darüber streiten, deswegen wich ich aus. »Nicht alles, was ich mit Oak Grove verbinde, ist negativ. Wir sind uns wegen Oak Grove begegnet. Das ist ganz bestimmt nichts Negatives. Obwohl ich davon ausgehe, dass sich unsere Wege ohnehin gekreuzt hätten.«
Seine Augen bekamen einen sanfteren Ausdruck, und ein Teil der Anspannung, die zwischen uns herrschte, schmolz dahin. »Was für eine romantische Ansicht eines Menschen, der normalerweise so ernsthaft ist.«
»Das eine schließt das andere nicht aus.«
»Bei dir nicht. Ich bin noch niemals einem Menschen begegnet, der so viele Widersprüche in sich vereint wie du. Du bist eine sehr komplizierte Frau, was nur einer der vielen Gründe dafür ist, dass ich dich so faszinierend finde.«
»Du findest mich faszinierend?«, fragte ich unsicher.
»Solltest du das noch nicht bemerkt haben?« Er umfasste meinen Hinterkopf mit den Händen und blickte mir tief in die Augen. »Absolut faszinierend.«
Ich spürte, dass ich weiche Knie bekam, als ich das geheimnisvolle Flackern in seinen dunklen Augen sah, den aufreizenden Ton, mit dem er sprach. Im nächsten Moment beging ich den törichten Fehler, mich zu fragen, ob er Mariama damals wohl auch faszinierend gefunden hatte, und musste den Blick abwenden.
Er nahm mein Kinn und drehte meinen Kopf wieder zu sich her. »He. Was hast du?«
»Ich wunder mich manchmal immer noch«, sagte ich. »Über uns. Über dich und mich. Darüber, dass wir zusammen sind.«
»Warum?«
»Weil wir so verschieden sind.«
»Vielleicht ist das der Grund dafür, dass es zwischen uns klappt. So bleibt unsere Beziehung interessant.« Er sagte das zwar in lockerem Ton, aber sein Gesicht nahm plötzlich einen ernüchterten Ausdruck an. Er steckte mir eine Haarsträhne hinter das Ohr, die sich aus meinem Pferdeschwanz gelöst hatte. »Ich hasse es, dich so zu sehen. So erschöpft. So besorgt. Denk immer daran, dass du in Sicherheit bist, hörst du? Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um dich zu beschützen.«
»Das weiß ich. Und ich tue alles, um dich zu beschützen. Es gibt nur Dinge, die sich unserer Kontrolle entziehen. Über meine Albträume hast selbst du keine Macht.«
»Vielleicht unterschätzt du mich da«, sagte er und zog mich an sich.
Dieses Mal ließ ich es zu. Wenn es um Devlin ging, war es mit meiner Zivilcourage nie weit her. Falls der Totengeist der Blinden in den Schatten lauerte, nahm ich sie nicht wahr, denn ich registrierte in diesem Moment nur das Pochen meines Herzens und diese verführerischen Augen, die auf mich niederblickten.
Devlin flüsterte mir etwas zu. Was er sagte, entging mir sofort wieder, ich sollte mich später nur noch daran erinnern, wie zärtlich er meinen Namen ausgesprochen hatte. Sein Kuss war, als er endlich kam, sehr langsam, sehr bedächtig und verheerend effektiv. Seine Hände indes ... diese starken, eleganten Hände ... sie packten zu ... berührten mich hier, tasteten da ... ließen mich vor Verlangen so erzittern, dass ich mich an sein Hemd klammerte.
Aus irgendeinem Grund stand ich plötzlich mit dem Rücken an der Wand der Veranda, und sein Körper schützte mich vor Blicken von der Straße. Er hob meine Bluse, glitt mit seinen Händen über meine Brüste und küsste mich mit immer größerem Verlangen. Ich schlang meine Arme um seinen Hals und warf voller Leidenschaft den Kopf in den Nacken, als seine Lippen über meinen Hals glitten, zu meinem Ohr und zurück zu meinem Mund. Der Lärm des Straßenverkehrs verklang, und der Boden unter meinen Füßen löste sich auf. Nur der Klang seiner Stimme brachte mich wieder auf die Erde zurück.
»Entschuldigung. Ich konnte mich nicht bremsen.« Er trat einen Schritt zurück, um meine Bluse wieder in Ordnung zu bringen. »Verzeih mir bitte.«
»Hab ich mich etwa beschwert?«, entgegnete ich noch ganz außer Atem. »Ich wollte, dass du es tust. Alles, was du getan hast, habe ich gewollt. Wenn du mich so berührst, wie du es gerade getan hast ...«
»So?«, flüsterte er, und dabei glitten seine Hände neuerlich unter meine Bluse.
Knisternde Erregung fuhr durch meine Wirbelsäule. »Ja, genau so.«
Mit der Kuppe meines rechten Zeigefingers strich ich über die Konturen des silbernen Medaillons, das er unter seinem Hemd trug. Ich bildete mir ein, nicht nur die Kühle des Metalls unter dem Stoff spüren zu können, sondern auch das Vibrieren der Macht und der Geschichte, für die dieses ominöse Wappen stand.
»Du weißt immer, wie du es bei mir anstellen musst, nicht wahr?«, sagte ich. »Du weißt genau, wo du mich berühren und wie du mich anschauen musst, damit ich die Kontrolle verliere. Manchmal frage ich mich, wie du das machst.«
»Wie ich was mache?«
»Das hier«, sagte ich und erzitterte, als er mich daraufhin fester an sich zog. »Alles, was du tust, hat zur Folge, dass ich dich nur noch mehr will. So etwas habe ich noch nie erlebt. Es klingt wie ein Klischee, aber es ist die Wahrheit. Du brauchst nur meinen Namen auszusprechen, und schon schmelze ich dahin. Es ist, als hättest du mich verhext.«
Ich erwartete, dass er mich nach diesem freimütigen und möglicherweise unklugen Geständnis neuerlich küssen und dann ins Haus bringen würde, um mir im Schlafzimmer zu beweisen, wie wehrlos ich wirklich war, wenn er mich berührte. Stattdessen schien sich seine Stimmung plötzlich zu verändern. Auf einmal flackerte etwas Besorgniserregendes in seinen Augen auf, und aus einem unerfindlichen Grund musste ich wieder an Mariama denken, die eine sinnliche und genusssüchtige Frau gewesen war, die sich mit schwarzer Magie ausgekannt hatte. Sie war jetzt nicht mehr da, ihre Verbindung zu Devlin gottlob durchtrennt. Ich war aber nicht so naiv, den Einfluss zu unterschätzen, den sie früher auf ihn gehabt hatte, und ebenso wenig die Tatsache, dass sie ihm zweifellos gewisse Dinge beigebracht hatte.
War das der Grund dafür, dass er nach wie vor das Medaillon trug? Zum Schutz gegen ihren heimtückischen Zugriff?
Er behauptete, nicht daran zu glauben, dass ein Talisman über irgendwelche Macht verfügte, und trotzdem hatte ich ihn noch nie ohne das silberne Wappen am Hals gesehen, diese sich um eine Klaue windende Schlange, die ein erschütterndes Symbol für die Machenschaften und gefährlichen Allianzen war, in die man sich verstrickte, wenn man ein Mitglied des Geheimbundes war. Und wenn man Mariama Goodwines Ehemann war.
Da mir der Gedanke an seine tote Ehefrau die Laune verdorben hatte, löste ich mich aus seiner Umarmung. »Du hast eine lange Autofahrt vor dir. Ich will nicht, dass du dich meinetwegen verspätest.«
»Ich sollte den alten Mann warten lassen, bis er verrottet.« Auf der Stelle schien er diese harsche Reaktion zu bereuen. »Entschuldige. Du hast natürlich recht. Aber wie du sicher schon geahnt hast, freue ich mich nicht gerade auf den Abend.«
Ich legte meine Hand auf seinen Arm. »Bist du sicher, dass dich nicht sonst noch etwas belastet? Mir kommt es vor, als wäre ich nicht die Einzige, die in letzter Zeit etwas angespannt ist.«
Jetzt war es Devlin, der sich meiner Berührung entzog. Er trat aus dem Schatten. Das Licht der schwächer werdenden Sonne fiel auf sein Gesicht. »Mit mir ist alles in Ordnung.«
Er blieb auf der obersten Treppenstufe stehen und ließ seinen Blick eine Weile durch den Garten schweifen, bevor er sich wieder umdrehte und mich ansah. Der Ausdruck auf seinem Gesicht ließ mich innerlich erzittern, obwohl es mir schwerfiel, die undefinierbare Finsternis, die ich in seinen Augen entdeckte, zu benennen. War es Skepsis? Entschlossenheit?
Nein, durchfuhr es mich wie ein Stromstoß, was ich in Devlins Augen sah, war Furcht.
FÜNF
An jenem Abend ging ich früh zu Bett. Ich wollte noch ein wenig lesen, doch die Müdigkeit übermannte mich schon nach wenigen Seiten. Ich legte ein mit einer Kette aus Kristallen verziertes Lesezeichen, das meine Tante mir vor Jahren geschenkt hatte, ins Buch, löschte das Licht, kuschelte mich in die Laken und versuchte, an nichts zu denken, was mit Geheimnissen, Stereoskopien und dem Modergeruch in meinem Keller zu tun hatte.
Ich muss aber wohl von diesem Geruch geträumt haben, denn der Phantomduft weckte mich aus der ersten Tiefschlafphase, die mir nach Nächten beschert gewesen war. Mit geöffneten Augen lag ich regungslos da und versuchte, mich in der Dunkelheit zu orientieren. Der Geruch war so schwach und so schwer einzuordnen, dass durchaus die Möglichkeit bestand, dass ich ihn nur geträumt hatte. Angst hatte ich nicht. Nicht in diesem Moment. Die bekam ich erst, als ich Atemgeräusche vernahm.
Es war ein gleichmäßiges, leises und heiser klingendes Schnarchen. Ein menschliches Schnarchen – das aber nicht von einem Menschen kam.
Selbst bei dem Versuch, mir das Geräusch verstandesmäßig zu erklären, verspürte ich ein Kribbeln auf der Kopfhaut. Es war lediglich eines der vielen Geräusche, die ein altes Haus von sich gab, sagte ich mir, nur das übliche Knarren und Ächzen, das man ab und an hörte. Die Türen und Fenster waren alle fest verschlossen. Ein Mensch konnte hier nicht eindringen, ohne großen Lärm zu verursachen, und es kam nur selten vor, dass ein Totengeist auf geweihten Boden vordrang. Hier in meinem Refugium war ich in Sicherheit. Das musste ich glauben, unbedingt.
Doch als ich dort lag, eingetaucht in das Licht des Mondes und der Furcht, hörte ich das Atmen wieder, ein schnarrendes, hinterhältig klingendes Geräusch. Das aus der Nähe kam. Ganz aus der Nähe. Es war hinter dem Kopfteil meines Bettes, davon war ich jetzt überzeugt.
Mein eigener Atem beschleunigte sich, als ich mich langsam nach hinten umdrehte. Da war nichts. Nichts, was ich sehen konnte. Denn das Geräusch kam aus dem Inneren der Wand.
Am liebsten wäre ich in diesem Moment aus dem Bett gesprungen, um Distanz zwischen mich und diese beängstigenden Schnarchlaute zu bringen. Stattdessen blieb ich liegen, horchte in die Finsternis und versuchte dabei fieberhaft, mir meine Unterhaltung mit Macon ins Gedächtnis zurückzurufen. Er hatte am Morgen gesagt, im Keller würde etwas nisten. Vielleicht ein Opossum oder eine Ratte.
Ein Tier würde natürlich den moschusartigen Geruch erklären, aber was war mit den Atemgeräuschen? Dass sie stoßweise erfolgten, ließ darauf schließen, dass sie nicht von einem Nagetier kamen, sondern von etwas Größerem, einem fühlenden Wesen, das sich Zutritt zu geweihtem Boden verschaffen und sich seinen Weg in mein Refugium bahnen konnte.
Ich zog eine Hand unter meinen Laken hervor und griff nach dem Schalter der Nachttischlampe. Licht durchflutete den Raum, jagte Schatten aus Ecken und vertrieb für einen kurzen Moment meine Angst. Nichts regte sich. Ich erblickte nirgendwo einen Beweis für einen Besucher, weder für ein Tier noch für sonst etwas. Die heiseren Laute waren verstummt, doch ich hatte nach wie vor das Gefühl, dass sich in der Wand etwas verbarg. Ich konnte eine gierige Präsenz hinter dem Mauerputz spüren.
Ich kletterte aus dem Bett, klaubte einen meiner Pantoffeln vom Fußboden. Dann setzte ich mich ans Fußteil des Bettes und schleuderte den Schuh mit Wucht gegen die Wand über dem Kopfteil. Ich hörte ein gedämpft klingendes Quietschen, dem wilde Kratzgeräusche folgten, die jetzt plötzlich aus dem Korridor kamen.
Entsetzt sprang ich auf. Womit hatte ich es hier zu tun? War es ein Mensch, ein Tier ... etwas aus einer anderen Welt? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass in die Versorgungstunnel zwischen den Wänden irgendetwas passte, was größer war als ein Waschbär, doch falls das Geräusch tatsächlich aus dem Korridor vor meinem Schlafzimmer gekommen war ... Falls etwas durch den Keller in mein Haus eingedrungen war ...
Alle möglichen Bilder schossen mir durch den Kopf, während ich zitternd dastand. Mein Schlafzimmer zu verlassen, um der Angelegenheit auf den Grund zu gehen, war das Letzte, was ich wollte, doch blieb mir eine andere Wahl? Ich musste mich davon überzeugen, dass in meinem Haus nichts frei herumlief.
Oh, wie gern hätte ich in diesem Moment Angus an meiner Seite gehabt. Seit mich die misshandelte Promenadenmischung während einer Friedhofsrestaurierung in den Blue Ridge Mountains zu seinem Frauchen auserkoren hatte, war er mein ständiger Begleiter gewesen und hatte mich vor Eindringlingen aus dieser und der anderen Welt beschützt. Jetzt war er jedoch bei meinen Eltern auf dem Land, denn ich hatte gedacht, dass sie seines Schutzes dringender bedurften als ich. Womöglich hatte ich mich getäuscht.
Ich nahm aus der Nachttischschublade eine Taschenlampe, schlich aus der Tür nach draußen und bahnte mir dann zentimeterweise meinen Weg durch den Korridor, wobei ich immer wieder stehen blieb, um nach neuen Geräuschen zu horchen. War da das Kratzen einer Klaue zu hören, das leise Klicken einer Tür?
Bis ich die Küche erreichte, war mir fast gelungen, mir einzureden, dass alles in Ordnung war. Ich wollte gerade mein Arbeitszimmer betreten, als mich ein dumpfes Geräusch herumfahren ließ.
Mein Blick blieb an der Tür hängen, die von hier aus zum Keller führte. Mit wild hämmerndem Herzen stand ich da. Dann ging ich auf Zehenspitzen durch den Raum und presste mein Ohr gegen das dicke Holz. Im Keller regte sich nichts, doch ich konnte spüren, dass kalte Luft durch das Schlüsselloch strömte. Ich hätte mein Auge um nichts in der Welt vor die Öffnung gehalten, doch ich fragte mich, ob mich vielleicht von der anderen Seite jemand beobachtete.
Ich kniete mich auf den Fußboden und hielt den Strahl der Taschenlampe vor das Schlüsselloch. Ein schrilles Quietschen – oder war es ein Pfeifton? – hatte zur Folge, dass ich mich rückwärts und auf allen vieren in die Mitte der Küche flüchtete. Fest zog ich meine Knie vor die Brust und saß bebend da, ohne das Schlüsselloch auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen.
Ich konnte mir immer noch nicht vorstellen, wie ein Wesen aus Fleisch und Blut in mein Refugium hätte eindringen sollen. Es gab nur einen einzigen Weg durch den Keller ins Haus, und der führte durch diese verriegelte Tür. Es sei denn ...
Gab es hier vielleicht irgendwo noch einen verborgenen Verbindungstunnel?
Mein Blick schoss durch die Küche. Die Vorstellung, es könne einen Geheimgang geben, war in höchstem Maße beunruhigend. Ich hatte allerdings nicht die Absicht, nach einem solchen zu suchen. Für den Moment blieb mir nichts weiter übrig, als das Schlüsselloch mit einem Stück Isolierband zuzukleben und den Tisch vor die Tür zu schieben – sinnlose Vorsichtsmaßnahmen in dem vergeblichen Bemühen, meine Nerven zu beruhigen.
Ich ließ im gesamten Haus die Lampen brennen, ging wieder ins Schlafzimmer, kroch unter die Decke und machte mich auf eine weitere, lange und schlaflose Nacht gefasst. Als ich mich umdrehte, um meinen Roman vom Nachttisch zu nehmen, schnappte ich nach Luft und erstarrte.
Auf meinem Buch lag der durchsichtige Körper einer makellos erhaltenen Zikade, die immer noch an einem dünnen Zweig hing. Das silberne Lesezeichen mit der Kristallkette war verschwunden.
SECHS
Am nächsten Morgen war ich hundemüde. Ich hatte kaum Schlaf gefunden. Die Insektenhülle, die man mir auf meinen Nachttisch gelegt hatte, beunruhigte mich in höchstem Maße, weil sie ein konkreter Beweis dafür war, dass irgendetwas nicht nur in meinem Haus, sondern sogar in meinem Schlafzimmer gewesen war. Im Rückblick betrachtet wirkten die Handlungen meines seltsamen Besuchers nahezu kindisch – mir nach einem makaberen Versteckspiel mein Lesezeichen mit den Kristallen zu stibitzen. Diese Erkenntnis machte das Ganze aber nicht weniger beängstigend. Eher im Gegenteil.
Trotz meiner körperlichen Erschöpfung stand ich frühzeitig auf, sodass ich mich noch vor neun Uhr auf den Weg machen konnte. Ich hatte für den späten Vormittag einen Termin mit der hiesigen Historical Society vereinbart, bis dahin aber noch jede Menge Zeit, um Nachforschungen über Dowling Curiosities anzustellen.
Ich suchte einen Parkplatz, und als ich durch die im Schatten liegenden Straßen spazierte, trugen die Sehenswürdigkeiten, die Geräusche und die verlockenden Düfte, die ein Morgen in Charleston zu bieten hatte, dazu bei, meine überstrapazierten Nerven ein wenig zu beruhigen. Die Touristen waren bereits auf den Beinen, obwohl die meisten Nobelläden im Antiquitätenviertel der King Street noch nicht geöffnet hatten.
Nachdem ich an der Hausnummer des Geschäfts vorbeigelaufen war, ging ich noch einmal zurück, sah aber nirgendwo ein Hinweisschild. Ich dachte schon, ich hätte die falsche Adresse in mein Telefon eingegeben, als mir auffiel, dass sich der Laden im Hinterhaus eines anderen Gebäudes befand. Den Eingang erreichte man durch ein schmiedeeisernes Tor und über einen mit Kopfstein gepflasterten Weg, der von Blumentöpfen gesäumt wurde, in denen Gardenien blühten.
Ein Schild im Fenster informierte mich, dass der Laden um zehn Uhr öffnen würde. Also machte ich mich auf den Weg zum Hafen, um dort am Wasser entlangzuspazieren. Bei meiner Rückkehr war es wenige Minuten nach zehn, und ich konnte sehen, dass sich im Inneren des Geschäfts etwas regte. Eine Frau verließ den Laden gerade, und im Vorübergehen nickten wir einander zu. Ein Glöckchen meldete ihr Gehen und mein Hereinkommen, und dann schloss sich die Tür, und ich stand erst einmal einen Moment da und schaute mich um.
Der Verkaufsraum von Dowling Curiosities war klein und überfüllt und roch nach Mottenkugeln. Die Enge hätte ich normalerweise als bedrückend empfunden, doch das Licht, das durch die Fenster hereinfiel, war angenehm, und die dicht zusammengedrängt stehenden Verkaufsartikel waren sehr effektvoll zur Schau gestellt worden: altertümliche Puppen, die Trauerkleidung trugen, vergoldete Rahmen mit Postern von Jahrmarkt-Attraktionen vergangener Zeiten, Glasvitrinen, in denen alle möglichen Kuriositäten ausgestellt waren – von Duellpistolen mit Elfenbeingriffen bis hin zu kompliziertem mechanischem Spielzeug. Und auf langen Regalen über den Glasvitrinen standen zu Dutzenden alte Fotoapparate und Stereoskope.
Als ich auf die Ladentheke im hinteren Teil des Geschäfts zuging, öffneten sich die Vorhänge, und aus dem Hinterzimmer kam ein Mann, der bei meinem Anblick wie angewurzelt stehen blieb und sich mit der Hand ans Herz griff.
»Meine Güte«, sagte er und schnappte dabei nach Luft. »Sie haben mich erschreckt. Ich wusste nicht, dass jemand im Geschäft ist. Ich habe die Glocke gehört, aber ich dachte, es sei nur Mrs Hofstadter, die gerade gegangen ist.«
»Wir sind uns an der Tür begegnet«, sagte ich und sah ihn fragend an. »Sie haben doch geöffnet, oder?«
»Ja, natürlich.« Er lächelte und stellte sich hinter die Ladentheke. Ich betrachtete ihn fasziniert. Er trug eine karierte Hose, dazu einen Pullunder über einem lilafarbenen Hemd mit aufgestelltem Kragen. Er mochte Ende dreißig sein, doch die seidigen, dunkelblonden Locken, die ihm in die Stirn fielen, verliehen seinem Gesicht einen jungenhaften Ausdruck, der über die winzigen Falten unter seinen grauen Augen hinwegtäuschte. »Wie kann ich Ihnen behilflich sein?«
»Ich hoffe, Sie können mir ein paar Informationen über ein altes Stereoskop geben.«
»Also, da sind Sie in jedem Fall am richtigen Ort. Stereoskope sind zufällig unsere Passion«, sagte er. »Für was für eine Art von Betrachter interessieren Sie sich denn?«
»Ich bin nicht hier, um einen zu kaufen. Ich habe ein altes Stereoskop in meinem Keller gefunden und hoffe, dass Sie mir etwas dazu sagen können.«
Während wir uns unterhielten, zog ich das Stereoskop aus meiner Tasche und legte es auf die Ladentheke. Er nahm es in die Hand und hielt es sich kurz vor die Augen.