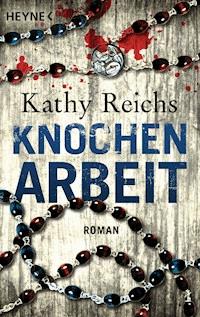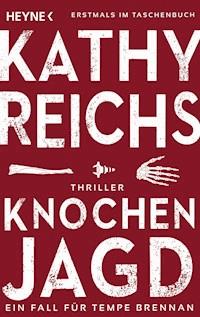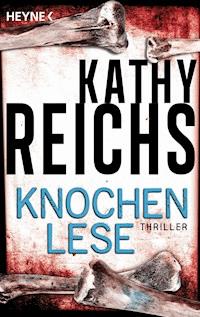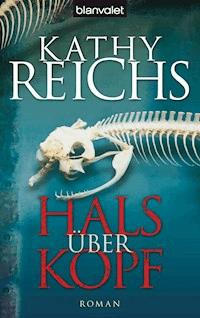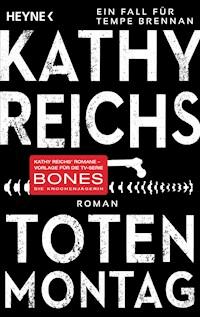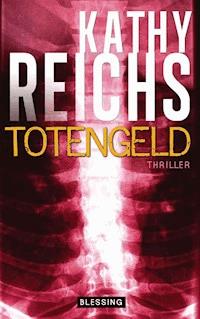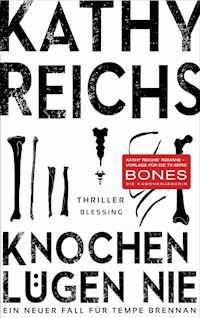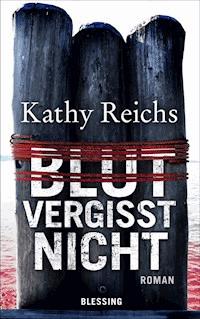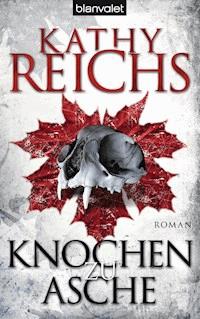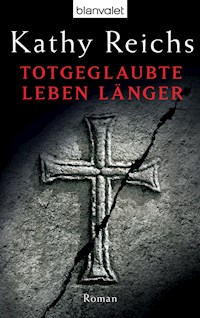
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Tempe-Brennan-Romane
- Sprache: Deutsch
Tempe Brennans 8. Fall
Die Leiche eines zwielichtigen Importeurs beschert Tempe Brennan Überstunden im Labor. Die Schusswunde am Kopf deutet auf Selbstmord hin, doch die Gerichtsmedizinerin kann ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen. Ihre Untersuchungen nehmen eine unerwartete Wendung, als ein Fremder ihr das Foto eines uralten Skeletts aus Israel zusteckt und beteuert, es sei der Schlüssel zum Tod des streng religiösen Mannes. So stößt Tempe auf ein abgründiges Geheimnis, das älter ist als die Bibel …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buch
Über Mangel an Arbeit kann sich die forensische Anthropologin Temperance Brennan nicht beklagen und mit ihrem neuesten Fall wird sie ihren Aufenthalt im kalten Quebec noch verlängern müssen. Der Geschäftsmann Avram Ferris wurde im Schrankzimmer seines Büros gefunden. Selbstmord ist naheliegend, doch ein winziges Detail passt nicht ins Bild. Und tatsächlich, nach mühevoller Rekonstruktion des Schädels steht fest, dass die Verletzungen an der Leiche von mehr als nur einer Kugel stammen müssen – und dass Tempe zusammen mit der Abteilung »Crimes contre le personne« in Sachen Mord ermitteln wird.
Kurz nach der Obduktion taucht ein Unbekannter in den Gängen des französischen Instituts auf und übergibt Tempe ein Foto, das angeblich aus Israel stammt und erklären soll, warum Ferris sterben musste. Es zeigt ein korrekt angeordnetes Skelett, daneben Fußabdrücke im Staub und einen Pinsel als behelfsmäßigen Kompass. Ein Schnappschuss von einer archäologischen Grabungsstätte, folgert Tempe. Auf die Kritzeleien auf der Rückseite kann sie sich allerdings keinen Reim machen. Sie ahnt nicht, dass sie den Schlüssel zu einem uralten Geheimnis in den Händen hält: Die katholische Kirche, israelische Behörden und einige dubiose Geschäftemacher haben allen Grund, nervös zu werden – und mörderisch unberechenbar …
Autorin
Kathy Reichs, geboren in Chicago, lebt in Charlotte und Montreal. Sie studierte u. a. Archäologie und ist heute als eine von nur fünfzig zugelassenen forensischen Anthropologen in Kanada und den USA tätig. Ihre Tempe-Brennan-Romane werden in dreißig Sprachen übersetzt und sind überaus erfolgreiche internationale Bestseller.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.kathy-reichs.de
Inhaltsverzeichnis
Für Susanne Kirk, Lektorin bei Scribner von 1975-2004 und für Dr. James Woodward, Chancellor der University of North Carolina in Charlotte von 1989–2005.
Danke für die Jahre der Unterstützung und der Ermutigung.
Genießt Euren Ruhestand!
Vorbemerkung des Übersetzers
Manchen Lesern, vor allem denjenigen, die eine eindeutschende Rechtschreibung jüdisch-hebräischer und arabischer Begriffe gewöhnt sind, mag die Schreibweise eben dieser Begriffe im vorliegenden Roman etwas merkwürdig vorkommen.
Der Übersetzer hat sich entschieden, konsequent die englische Schreibweise zu verwenden. Hierfür gibt es mehrere Gründe.
Zum einen ist in letzter Zeit in deutschsprachigen Publikationen, in den Printmedien und nicht zuletzt auch im Internet eine Aufweichung der eindeutschenden Rechtschreibung festzustellen. So findet man, manchmal sogar im selben Text, yarmulke neben jarmulke, yeshiva neben jeschiwa, dschihad neben jihad und sogar neben dem sehr zweifelhaften Kompromiss djihad. Um diesem orthografischen Chaos entgegenzuwirken, benutzt der Übersetzer konsequent die englische Schreibweise, nicht zuletzt auch deshalb, weil diese sich im internationalen Sprachgebrauch immer mehr gegenüber landessprachlichen Varianten durchsetzt.
Es gibt zum anderen auch einen textimmanenten Grund. Im Roman kommen einige historische Namen vor, Yigael Yadin etwa, der auch in Deutschland so geschrieben wird und nicht etwa Jigael Jadin. Es würde nun, was die orthografische Konsequenz angeht, nicht gut aussehen, wenn Yigael Yadin etwa eine Jeschiwa besucht. Deshalb die Entscheidung, sh statt sch und y statt j zu verwenden und sich generell an die englisch-internationale Schreibweise zu halten.
Klaus Berr
Meide das Böse und tue das Gute, suche den Frieden und jage ihm nach.
Jüdische Heilige Schrift, Psalm 34, 15
Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden gesät von denen, die Frieden halten.
Neues Testament, Brief des Jakobus, 3,18
Benutzt Allahs Namen nicht ständig zur Bekräftigung eurer Eidschwüre, um als gerecht, fromm und friedfertig unter den Menschen zu gelten. Allah hört alles, er weiß alles.
Koran, 2,225
1
Nach einem Osteressen aus Schinken, Erbsen und Kartoffelbrei klaute Charles »Le Cowboy« Bellemare seiner Schwester einen Zwanziger, fuhr zu einem Crack-Haus in Verdun und verschwand.
In diesem Sommer wurde das Haus für teures Geld verkauft. Im Winter ärgerten sich die neuen Besitzer über den schlechten Abzug ihres Kamins. Am Montag, den siebten Februar, öffnete der Herr des Hauses den Rauchfang und stocherte mit einem Rechenstiel nach oben. Ein vertrocknetes Bein fiel in den Aschekasten.
Papa rief die Polizei. Die Polizei rief die Feuerwehr und das Bureau du coroner. Der Coroner, der Leichenbeschauer also, rief das forensische Institut an. Pelletier bekam den Fall.
Pelletier und zwei seiner Techniker standen binnen einer Stunde nach Entdeckung des Beins auf dem Rasen. Zu sagen, dass große Verwirrung herrschte, wäre ungefähr so, als würde man den D-Day als hektisch bezeichnen. Entrüsteter Vater. Hysterische Mutter. Überdrehte Kinder. Neugierige Nachbarn. Verärgerte Polizisten. Ratlose Feuerwehrmänner.
Dr. Jean Pelletier ist der älteste und ranghöchste der fünf Pathologen am Laboratoire de Sciences Judiciaires et de Médecine Légale, Quebecs zentrales forensisches und gerichtsmedizinisches Institut. Er hat schlechte Gelenke und schlechte Zähne und null Toleranz, was die Vergeudung seiner knappen Zeit angeht. Er warf nur einen Blick auf die Szene und bestellte eine Abrissbirne.
Die Außenwand des Kamins wurde pulverisiert. Eine gut durchgeräucherte Leiche wurde herausgezogen, auf eine Bahre geschnallt und in unser Institut gebracht.
Am nächsten Tag warf Pelletier auch auf die Überreste nur einen kurzen Blick und sagte: »Ossements.« Knochen.
Auftritt meiner Wenigkeit, Dr. Temperance Brennan, forensische Anthropologin für North Carolina und Quebec. La Belle Province und Dixie? Eine lange Geschichte, die anfängt mit einem Fakultätsaustausch zwischen meiner Heimatuniversität UNC-Charlotte und der McGill in Montreal. Als das Austauschjahr zu Ende war, ging ich wieder in den Süden, arbeitete aber weiter als externe Beraterin für das Institut in Montreal. Ein Jahrzehnt später pendle ich noch immer zwischen beiden Orten hin und her und dürfte inzwischen, was Bonusmeilen für Vielflieger angeht, auf der Rangliste ziemlich weit oben stehen.
Pelletiers demande d’expertise en anthropologie lag auf meinem Schreibtisch, als ich für meinen Februar-Turnus in Montreal eintraf.
Inzwischen war es Mittwoch, der sechzehnte Februar, und die Knochen aus dem Kamin bildeten auf meinem Arbeitstisch ein komplettes Skelett. Obwohl das Opfer kein Freund regelmäßiger Kontrolluntersuchungen gewesen war, was einen Vergleich des Gebisses mit zahnärztlichen Unterlagen ausschloss, deuteten alle skelettalen Indikatoren auf Bellemare hin. Alters –, Geschlechts –, Abstammungs- und Größenschätzungen sagten mir, neben zwei Stahlstiften im rechten Schien- und Wadenbein, dass ich den lange vermissten Cowboy vor mir hatte.
Abgesehen von einem Haarriss an der Schädelbasis, der wahrscheinlich von dem ungeplanten Sturz in den Kamin herrührte, fand ich keine Hinweise auf äußere Verletzungen.
Ich überlegte mir gerade, wie und warum ein Mann auf ein Dach klettert und dann in einen Kamin fällt, als das Telefon klingelte.
»Wie es aussieht, brauche ich Ihre Unterstützung,Temperance.« Nur Pierre LaManche nannte mich bei meinem vollen Namen, den er auf der letzten Silbe betonte, so dass er sich auf »La France« reimte. LaManche hatte sich selbst einen Kadaver zugewiesen, der, wie ich vermutete, Verwesungserscheinungen aufwies.
»Fortgeschrittene Fäulnis?«
»Oui.« Mein Chef hielt kurz inne. »Und andere komplizierende Faktoren.«
»Komplizierende Faktoren?«
»Katzen.«
O Mann.
»Ich bin gleich unten.«
Nachdem ich den Bellemare-Bericht auf einer Diskette abgespeichert hatte, verließ ich mein Labor, ging durch die Glastüren, die die rechtsmedizinische Abteilung vom Rest der Etage abtrennen, bog in einen Nebenkorridor ein und drückte auf den Knopf neben einem einzelnen Fahrstuhl. Zugänglich nur von den beiden gesicherten Etagen des LSJML und vom Büro des Leichenbeschauers, hat dieser Lift nur ein einziges Ziel: die Leichenhalle.
Während ich in den Keller hinunterfuhr, wiederholte ich im Geiste noch einmal, was ich bei der Personalbesprechung an diesem Morgen erfahren hatte.
Avram Ferris, ein sechsundfünfzigjähriger orthodoxer Jude, war eine Woche zuvor verschwunden. Gestern am späten Nachmittag war Ferris’ Leiche in einer Abstellkammer im Obergeschoss seines Geschäftsgebäudes entdeckt worden. Keine Hinweise auf einen Einbruch. Keine Hinweise auf einen Kampf. Die Angestellte sagte, er habe sich in letzter Zeit merkwürdig verhalten.Tod durch einen selbst zugefügten Pistolenschuss lautete die Einschätzung vor Ort. Die Familie des Opfers beharrte jedoch stur darauf, dass ein Selbstmord ausgeschlossen sei.
Der Coroner hatte eine Autopsie angeordnet. Ferris’ Verwandte und der Rabbi hatten dagegen Einspruch erhoben. Die Verhandlungen waren ziemlich hitzig verlaufen.
Ich sollte nun gleich den Kompromiss sehen, den man erreicht hatte.
Und das, was die Katzen angerichtet hatten.
Vom Aufzug aus ging ich nach links und dann nach rechts auf die Leichenhalle zu. Als ich mich der äußeren Tür des Autopsieflügels näherte, hörte ich Geräusche aus dem Familienzimmer, einer tristen, kleinen Kammer, die für diejenigen reserviert war, die man für eine Identifikation der Toten einbestellt hatte.
Leises Schluchzen. Eine Frauenstimme.
Ich stellte mir den trostlosen kleinen Raum mit seinen Plastikpflanzen und Plastikstühlen und dem diskret mit einem Vorhang verhängten Fenster vor und spürte den üblichen Schmerz. Wir im LSJML machen keine Krankenhausautopsien. Keine Leberzirrhose im Endstadium. Kein Pankreaskrebs. Wir treten in Aktion bei Mord, Selbstmord, Unfällen und plötzlichen und unerwarteten Todesfällen. Im Familienzimmer warten diejenigen, die eben vom Undenkbaren und Unvorhergesehenen überfallen wurden. Deren Kummer rührt mich immer.
Ich zog eine hellblaue Tür auf und lief einen schmalen Korridor entlang, vorbei an Computerterminals, Trockengestellen und Edelstahlrollbahren zu meiner Rechten und weiteren blauen Türen zu meiner Linken, alle mit der Aufschrift SALLE D’AUTOPSIE. Vor der vierten Tür atmete ich einmal tief durch und trat dann ein.
Neben den Skelettierten bekomme ich die Verbrannten, die Mumifizierten, die Verstümmelten und die Verfaulten. Meine Aufgabe ist es, die Identität zu rekonstruieren, die der Tod ausgelöscht hat. Saal vier benutze ich ziemlich häufig, weil er mit einem speziellen Belüftungssystem ausgestattet ist. An diesem Morgen hatte das System gegen den Fäulnisgestank kaum eine Chance.
Einige Autopsien finden vor leerem Haus statt. Andere ziehen Publikum förmlich an. Trotz des Gestanks gab es bei Avram Ferris’ Autopsie nur Stehplätze.
LaManche. Lisa, seine Autopsietechnikerin. Zwei uniformierte Beamte. Ein Detective der Sûreté du Québec, den ich nicht kannte. Ein großer Kerl, sommersprossig und blasser als Tofu.
Ein SQ-Detective, den ich kannte. O Mann. Andrew Ryan. Eins sechsundachtzig. Sandblonde Haare. Wikingerblaue Augen.
Wir nickten einander zu. Ryan der Bulle. Tempe die Anthropologin.
Als wären die offiziellen Teilnehmer nicht schon zahlreich genug, bildeten auch noch vier Laien hinter der Leiche eine Mauer der Missbilligung.
Ich musterte sie schnell. Lauter Männer. Zwei Mittfünfziger, die beiden anderen vermutlich Ende sechzig. Dunkle Haare. Brillen. Bärte.Yarmulken.
Die Wand betrachtete mich abschätzend. Acht Hände blieben hinter vier steifen Rücken gefaltet.
LaManche zog seine Atemmaske herunter und stellte mich dem Beobachterquartett vor.
»In Anbetracht des Zustandes von Mr. Ferris’ Leiche ist ein Anthropologe erforderlich.«
Vier verständnislose Blicke.
»Dr. Brennans Fachgebiet ist skelettale Anatomie.« LaManche sprach Englisch. »Sie ist, was Ihre speziellen Anforderungen angeht, vollständig im Bilde.«
Abgesehen von der sorgfältigen Aufbewahrung auch der geringsten Mengen von Blut und Gewebe, hatte ich keine Ahnung von den speziellen Anforderungen dieser Männer.
»Mein tief empfundenes Bedauern über Ihren Verlust«, sagte ich und drückte mir mein Klemmbrett an die Brust.
Vier Köpfe nickten melancholisch.
Ihr Verlust lag in der Bühnenmitte, mit einer Plastikplane zwischen Leiche und Edelstahl. Auf dem Boden unter und um den Tisch herum waren weitere Planen ausgebreitet. Leere Wannen, Gläser und Röhrchen standen auf einem Rollwagen bereit.
Die Leiche war ausgezogen und gewaschen, doch es war noch kein einziger Schnitt gesetzt worden. Zwei Papiertüten lagen platt gedrückt auf der Arbeitstheke. Ich nahm an, dass LaManche seine äußerliche Untersuchung bereits abgeschlossen hatte, darunter auch die Suche nach Schmauchspuren und anderen Indizien an Ferris’ Händen.
Acht Augen verfolgten mich, als ich zu dem Verstorbenen ging. Beobachter Nummer vier faltete nun seine Hände vor den Genitalien.
Avram Ferris sah nicht aus, als wäre er erst letzte Woche gestorben. Er sah aus, als wäre er während der Clinton-Ära gestorben. Seine Augen waren schwarz, die Zunge purpurn, die Haut oliv- und auberginefarben gesprenkelt. Sein Bauch war aufgebläht, sein Hodensack drall wie ein Wasserball.
Ich schaute Ryan fragend an.
»Die Temperatur in der Abstellkammer lag bei zweiundneunzig Fahrenheit«, sagte er.
»Warum so heiß?«
»Wir gehen davon aus, dass die Katzen ans Thermostat gekommen sind«, sagte Ryan.
Ich rechnete schnell nach. Zweiundneunzig Fahrenheit. Knapp fünfunddreißig Celsius. Kein Wunder, dass Ferris einen Rekord in Verwesung aufstellte.
Aber die Hitze war nur eins der Probleme dieses Herrn gewesen.
Wenn wir Hunger haben, reagieren auch die Friedlichsten unter uns gereizt. Wenn wir am Verhungern sind, reagieren wir verzweifelt. Das Es setzt sich über die Moral hinweg. Wir essen. Wir überleben. Dieser gemeinsame Instinkt treibt Herdentiere, Raubtiere, Bataillone und Fußballmannschaften an.
Da werden sogar Bello und Muschi zu Aasfressern.
Avram Ferris hatte den Fehler gemacht, sich eine Kugel einzufangen, während er mit zwei Kurzhaarhauskatzen und einer Siamesin in einem Raum eingesperrt war.
Und mit einem zu geringen Vorrat an Brekkies.
Ich ging langsam um den Tisch herum.
Das Schläfen- und das Scheitelbein auf Ferris’ linker Schädelseite waren merkwürdig nach außen gebogen. Obwohl ich das Hinterhauptsbein nicht sehen konnte, war es offensichtlich, dass er die Kugel in den Hinterkopf bekommen hatte.
Ich zog Gummihandschuhe über, schob zwei Finger unter den Schädel und tastete. Der Knochen gab nach wie Pudding. Nur die Schädelschwarte hielt den Hinterkopf noch zusammen.
Ich senkte den Kopf wieder ab und untersuchte das Gesicht.
Es war schwierig, sich vorzustellen, wie Ferris zu Lebzeiten ausgesehen hatte. Seine linke Wange war angenagt. Zahnspuren kerbten den darunter liegenden Knochen, Splitter schillerten in der grellroten Pampe.
Ferris’ rechte Gesichtshälfte war zwar aufgequollen und fleckig, ansonsten aber größtenteils intakt.
Ich richtete mich auf und dachte über das Verstümmelungsmuster nach. Trotz der Hitze und des Fäulnisgestanks hatten die Katzen sich nicht an die rechte Gesichtshälfte oder weiter unten an den Rest des Körpers gewagt.
Ich begriff jetzt, warum LaManche mich brauchte. »Gab es auf der linken Gesichtshälfte eine offene Wunde?«, fragte ich ihn.
»Oui. Und eine zweite am Hinterkopf. Verwesung und Fraßspuren machen es unmöglich, den Weg der Kugel zu bestimmen.«
»Ich brauche einen vollen Satz kranialer Röntgenaufnahmen«, sagte ich zu Lisa.
»Ausrichtung?«
»Alle Winkel. Und ich brauche den Schädel.«
»Unmöglich.« Beobachter Nummer vier erwachte plötzlich zum Leben. »Wir haben eine Vereinbarung.«
LaManche hob eine latexverhüllte Hand. »Ich habe die Pflicht, in dieser Sache die Wahrheit herauszufinden.«
»Sie haben uns Ihr Wort gegeben, dass keinerlei Proben einbehalten werden.« Obwohl der Mann eine Gesichtsfarbe wie Haferschleim hatte, zeigten sich auf seinen Wangen jetzt rosige Knospen.
»Außer wenn es absolut unvermeidbar ist.« LaManche war die Sachlichkeit in Person.
Beobachter Nummer vier wandte sich dem Mann auf seiner Linken zu. Beobachter Nummer drei hob das Kinn und schaute durch gesenkte Lider nach unten.
»Lassen Sie ihn sprechen.« Gelassen. Der Rabbi empfahl Geduld.
LaManche wandte sich mir zu.
»Dr. Brennan, fahren Sie mit Ihrer Untersuchung fort, wobei Sie jedoch den Schädel und alle nicht betroffenen Knochenpartien an Ort und Stelle belassen.«
»Dr. LaManche … «
»Wenn sich das als undurchführbar erweist, kehren Sie zur normalen Verfahrensweise zurück.«
Ich mag es nicht, wenn man mir vorschreibt, wie ich meine Arbeit tun soll. Ich mag es nicht, mit weniger als den maximal zu erreichenden Informationen zu arbeiten oder weniger als das optimale Verfahren anzuwenden.
Doch ich mag und respektiere Pierre LaManche. Er ist der beste Pathologe, den ich kenne.
Ich schaute meinen Chef an. Der alte Mann nickte unmerklich. Ziehen Sie das mit mir durch, signalisierte er mir.
Ich hob den Blick zu den Gesichtern über Avram Ferris. In jedem erkannte ich den uralten Kampf zwischen Dogma und Pragmatismus. Der Körper als Tempel. Der Körper als Gänge und Ganglien und Pisse und Galle.
In jedem sah ich Verlustschmerz.
Denselben Schmerz, den ich erst Minuten zuvor mitgehört hatte.
»Natürlich«, sagte ich leise. »Rufen Sie mich, bevor Sie die Schädelschwarte abziehen.«
Ich schaute Ryan an. Er zwinkerte. Ryan der Bulle, hinter dem Ryan der Geliebte hervorlugte.
Die Frau weinte noch immer, als ich den Autopsieflügel verließ. Ihre Begleiterin, oder ihre Begleiterinnen, waren jetzt still.
Ich zögerte, weil ich mich nicht in persönliche Trauer eindrängen wollte.
War es das? Oder war es nur eine Ausrede, weil ich nichts damit zu tun haben wollte?
Ich werde oft Zeuge von Kummer. Immer und immer wieder bin ich an vorderster Front mit dabei, wenn Überlebende sich der plötzlichen Erkenntnis stellen müssen, dass ihr Leben sich radikal verändert hat. Mahlzeiten, die man nie mehr gemeinsam einnehmen wird. Gespräche, die nie geführt werden. Kinderbücher, die nie mehr laut vorgelesen werden.
Ich sehe den Schmerz, aber ich kann keine Hilfe anbieten. Ich bin ein Außenstehender, ein Voyeur, der nach dem Unfall, nach dem Feuer, nach der Schießerei gafft. Ich gehöre zum Heulen der Sirenen, zum Spannen der Absperrbänder, zum Zuziehen des Leichensacks.
Ich kann überwältigenden Kummer nicht lindern. Ich hasse meine Machtlosigkeit.
Ich kam mir vor wie ein Feigling. Dennoch betrat ich das Familienzimmer.
Zwei Frauen saßen nebeneinander, dicht zusammen, doch ohne sich zu berühren. Die jüngere hätte dreißig, aber auch fünfzig sein können. Sie hatte blasse Haut, dichte Augenbrauen und lockige, dunkle, im Nacken zusammengefasste Haare. Sie trug einen schwarzen Rock und einen langen, schwarzen Pullover mit hoch angesetzter Kapuze, die ihren Unterkiefer berührte.
Die ältere Frau war so runzlig, dass sie mich an die Puppen aus getrockneten Äpfeln erinnerte, die in den Bergen von Carolina gebastelt werden. Sie trug ein knöchellanges Kleid, dessen Farbe irgendwo zwischen Schwarz und Purpur lag. Lose Fäden baumelten, wo eigentlich die oberen drei Knöpfe hätten sein sollen.
Ich räusperte mich.
Apfel-Oma hob den Kopf, und ich sah Tränen auf dem Gesicht der zehntausend Falten glänzen.
»Mrs. Ferris?«
Die knotigen Finger knüllten ein Taschentuch.
»Ich bin Temperance Brennan. Ich assistiere bei Mr. Ferris’ Autopsie.«
Der Kopf der alten Frau kippte nach rechts, und ihre Perücke verrutschte.
»Mein aufrichtiges Beileid. Ich weiß, wie schwierig das für Sie ist.«
Die Jüngere hob zwei atemberaubend fliederfarbene Augen.
»Wirklich?«
Gute Frage.
Ein Verlust ist schwer zu verstehen. Ich weiß das. Mein Verständnis von Verlust ist unvollständig. Auch das weiß ich.
Mein Bruder starb an Leukämie, als er gerade mal drei Jahre alt war. Meine Großmutter war bereits über neunzig, als ich sie verlor. Jedes Mal war die Trauer wie ein lebendiges Wesen, das in meinen Körper eindrang und sich tief im Mark und in den Nervenenden einnistete.
Kevin war kaum mehr als ein Baby gewesen. Oma lebte in Erinnerungen, in denen ich nicht vorkam. Ich liebte sie beide. Aber sie waren nicht das ausschließliche Zentrum meines Lebens, und beide Todesfälle kamen nicht unerwartet.
Wie geht man mit dem plötzlichen Tod eines Partners um? Eines Kindes?
Ich wollte es mir gar nicht vorstellen.
Die jüngere Frau machte weiter, wo sie aufgehört hätte. »Wie können Sie sich anmaßen, den Kummer zu verstehen, den wir empfinden?«
Unnötig aggressiv, dachte ich. Auch linkische Beileidsbezeugungen sind Beileidsbezeugungen.
»Natürlich kann ich das nicht«, sagte ich und schaute zwischen ihr und ihrer Begleiterin hin und her. »Das war wohl wirklich etwas anmaßend.«
Keine der beiden Frauen sagte etwas.
»Ich bedaure Ihren Verlust sehr.«
Die junge Frau wartete so lange, dass ich schon glaubte, sie würde gar nicht mehr antworten.
»Ich bin Miriam Ferris. Avram ist … war mein Ehemann.« Miriam hob die Hand und zögerte dann, als wüsste sie nicht mehr so recht, was sie damit machen wollte. »Dora ist Avrams Mutter.«
Die Hand flatterte kurz in Doras Richtung und sank dann wieder zu ihrem Gegenstück.
»Ich nehme an, unsere Anwesenheit bei der Autopsie ist gegen die Vorschriften. Wir können ja nichts tun.« Miriams Stimme klang heiser vor Trauer. »Das ist alles so …« Sie ließ den Satz unvollständig, nahm aber den Blick nicht von mir.
Ich suchte nach etwas Tröstendem oder Aufmunterndem oder wenigstens Beruhigendem, das ich den beiden hätte sagen können. Aber mir fiel nichts ein. Also griff ich wieder zu einem Klischee.
»Ich weiß wirklich, was für ein Schmerz es ist, eine geliebte Person zu verlieren.«
Doras rechte Wange zuckte. Sie ließ die Schultern hängen und senkte den Kopf.
Ich ging zu ihr, kauerte mich hin und legte meine Hand auf ihre.
»Warum Avram?« Tränenerstickt. »Warum mein einziger Sohn? Es sollte nicht sein, dass eine Mutter ihren Sohn begräbt.«
Miriam sagte etwas auf Hebräisch oder Jiddisch.
»Wer ist dieser Gott? Warum tut er uns das an?«
Miriam sagte noch etwas, diesmal mit leisem Tadel in der Stimme.
Dora schaute zu mir hoch. »Warum hat er mich nicht genommen? Ich bin alt. Ich bin bereit.« Die runzligen Lippen zitterten.
»Das kann ich Ihnen nicht sagen, Ma’am.« Jetzt klang auch meine Stimme heiser.
Eine Träne tropfte von Doras Kinn auf meinen Daumen.
Ich schaute diesen einzelnen Tropfen an.
Ich schluckte.
»Kann ich Ihnen einen Tee bringen, Mrs. Ferris?«
»Wir kommen schon zurecht«, sagte Miriam. »Vielen Dank.«
Ich drückte Dora die Hand. Die Haut fühlte sich trocken, der Knochen spröde an.
Da ich mir nutzlos vorkam, stand ich auf und gab Miriam meine Karte. »In den nächsten paar Stunden bin ich dort oben. Wenn ich irgendetwas für Sie tun kann, zögern Sie nicht, mich anzurufen.«
Beim Verlassen des Familienzimmers fiel mir einer der bärtigen Beobachter auf, der auf der anderen Seite des Gangs stand und zu mir herüberschaute.
Als ich an ihm vorbeigehen wollte, stellte sich mir der Mann in den Weg.
»Das war sehr freundlich.« Seine Stimme hatte etwas Krächzendes, er klang ein wenig wie Kenny Rogers, wenn er »Lucille« sang.
»Eine Frau hat ihren Sohn verloren. Eine zweite ihren Ehemann.«
»Ich habe sie da drinnen gesehen. Offensichtlich sind Sie ein Mensch des Mitgefühls. Ein Mensch der Ehre.«
Worauf wollte er hinaus?
Der Mann zögerte, als wäre er unschlüssig in Bezug auf seinen nächsten Schritt. Dann griff er in die Tasche, zog einen Umschlag heraus und gab ihn mir.
»Das ist der Grund, warum Avram Ferris tot ist.«
2
Der Umschlag enthielt ein einzelnes Schwarz-Weiß-Foto. Abgebildet war ein auf dem Rücken liegendes Skelett, den Schädel zur Seite gedreht, den Unterkiefer heruntergeklappt wie in einem stummen Schrei.
Ich drehte das Foto um. Auf der Rückseite stand ein Datum, Oktober 1963, und eine verschmierte Abkürzung. H de 1 H. Vielleicht.
Ich schaute den bärtigen Herrn, der mir den Weg versperrte, fragend an. Er machte keine Anstalten zu einer Erklärung.
»Mr. – ?«
»Kessler.«
»Warum zeigen Sie mir das?«
»Ich glaube, das ist der Grund, warum Avram Ferris tot ist.«
»Das haben Sie bereits gesagt.«
Kessler verschränkte die Arme. Löste sie wieder voneinander. Rieb sich die Handflächen an der Hose.
Ich wartete.
»Er sagte, er wäre in Gefahr.« Kessler deutete mit vier Fingern auf das Foto. »Meinte, wenn ihm irgendwas zustoßen sollte, dann deswegen.«
»Hat Mr. Ferris Ihnen das gegeben?«
»Ja.« Kessler schaute sich um.
»Warum?«
Kessler antwortete mit einem Achselzucken.
Ich senkte den Blick wieder zu dem Foto. Das Skelett war ganz ausgestreckt, der rechte Arm und die Hüfte zum Teil von einem Felsbrocken oder einer -kante verdeckt. Neben seinem linken Knie lag ein Objekt im Sand. Ein vertrautes Objekt.
»Woher kommt das Foto?« Ich hob den Kopf. Kessler schaute sich schon wieder um.
»Aus Israel.«
»Mr. Ferris hatte Angst um sein Leben?«
»Eine Heidenangst. Er meinte, wenn das Fotos ans Licht käme, würde es ein Chaos geben.«
»Was für eine Art von Chaos?«
»Das weiß ich nicht.« Kessler hob die Handflächen. »Schauen Sie, ich habe keine Ahnung, was für ein Foto das ist. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Ich habe mich nur einverstanden erklärt, es an mich zu nehmen. Das ist alles. Das ist meine Rolle.«
»Was für eine Verbindung hatten Sie zu Mr. Ferris?«
»Wir waren Geschäftspartner.«
Ich streckte ihm das Foto wieder hin. Kessler ließ die Hände sinken.
»Erzählen Sie Detective Ryan, was Sie mir eben erzählt haben«, sagte ich.
Kessler trat einen Schritt zurück. »Sie wissen, was ich weiß.«
In diesem Augenblick läutete mein Handy. Ich zog es vom Gürtel.
Pelletier.
»Habe noch einen Anruf wegen Bellemare bekommen.«
Kessler ging um mich herum und auf das Familienzimmer zu.
Ich wedelte mit dem Foto. Kessler schüttelte den Kopf und eilte den Gang hinunter.
»Sind Sie soweit, dass Sie den Cowboy freigeben können?«
»Ich bin auf dem Weg nach oben.«
»Bon. Die Schwester macht sich schon in die Hose wegen der Beerdigung.«
Als ich abgeschaltet und mich umgedreht hatte, war der Gang leer. Na gut. Ich würde Ryan das Foto geben. Wir hatten ja eine Liste mit den Namen der Beobachter. Wenn er die Sache weiterverfolgen wollte, konnte er sich dort die nötigen Informationen über Kessler beschaffen.
Ich drückte auf den Aufzugsknopf.
Bis Mittag hatte ich meinen Bericht über Charles Bellemare fertig. Ich kam zu dem Schluss, dass der letzte Ritt des Cowboys, wie merkwürdig die Umstände auch sein mochten, Resultat seiner eigenen Verrücktheit war. Antörnen. Aufdrehen. Aussteigen. Oder, in Bellemares Fall, raufsteigen und runterfallen. Was hatte er da oben nur gewollt?
Beim Mittagessen informierte mich LaManche, dass es schwierig werden dürfte, Ferris’ Kopfverletzungen in situ, also ohne Abtrennen des Kopfes, zu untersuchen. Die Röntgenaufnahmen zeigten nur ein Kugelfragment und deuteten darauf hin, dass der hintere Teil des Schädels und die linke Gesichtshälfte zertrümmert waren. Außerdem sagte er mir, dass meine Analyse von grundlegender Bedeutung sein würde, da die Verstümmelung durch die Katzen das auf den Röntgenaufnahmen erkennbare Muster der metallischen Spuren verändert habe.
Darüber hinaus war Ferris so gefallen, dass seine Hände unter ihm zu liegen kamen. Die Verwesung hatte einen Nachweis von Schmauchspuren unmöglich gemacht.
Um 13 Uhr 30 fuhr ich wieder in die Leichenhalle hinunter. Ferris’ Torso war inzwischen von der Kehle bis zum Schambein geöffnet, und seine Organe schwammen in geschlossenen Behältern. Der Gestank im Raum war in den roten Bereich geklettert.
Anwesend waren Ryan und der Fotograf sowie zwei der vier Beobachter vom Vormittag. LaManche wartete fünf Minuten und nickte dann seiner Autopsietechnikerin zu.
Lisa setzte Schnitte hinter Ferris’ Ohren und quer über das Schädeldach. Dann löste sie mit Skalpell und Fingern die Schädelschwarte von oben her in Richtung Hinterkopf ab, wobei sie immer wieder innehielt, um das Kärtchen mit der Fallnummer für die Fotos neu zu platzieren. Während so langsam die Fragmente freigelegt wurden, traten LaManche und ich näher heran, betrachteten, skizzierten und legten sie in Behälter.
Nachdem wir mit dem oberen und hinteren Teil von Ferris’ Kopf fertig waren, löste Lisa die Haut von seinem Gesicht, und LaManche und ich wiederholten die Prozedur, wir untersuchten, skizzierten und traten dann zurück, damit Fotos gemacht werden konnten. Langsam extrahierten wir schließlich die Trümmer, die Ferris’ Oberkieferknochen, Wangen-, Nasen- und Schläfenbeine gewesen waren.
Um vier waren die Überreste von Ferris’ Gesicht wieder an Ort und Stelle, und eine y-förmige Naht hielt Brust und Bauch wieder zusammen. Der Fotograf hatte fünf Filmrollen. LaManche hatte einen ganzen Stapel von Skizzen und Notizen. Ich hatte vier Behälter mit blutigen Knochentrümmern.
Ich säuberte eben Knochenfragmente, als Ryan im Gang vor meinem Labor auftauchte. Ich sah ihn durch das Fenster über dem Waschbecken.
Zerfurchtes Gesicht, Augen zu blau, als dass es ihm gut täte.
Oder mir.
Als Ryan mich sah, drückte er Handflächen und Nase ans Glas. Ich spritzte ihm Wasser entgegen.
Er wich zurück und deutete zu meiner Tür. Ich formte mit den Lippen »offen« und winkte ihn herein. Ein dümmliches Grinsen breitete sich auf meinem Gesicht aus.
Okay. Vielleicht war Ryan doch nicht so schlecht für mich.
Aber zu diesem Schluss war ich erst vor kurzem gekommen.
Fast ein Jahrzehnt lang hatten Ryan und ich uns in einer mal vorhandenen, mal nicht vorhandenen Beziehung aneinander gerieben. Aufwärts-abwärts. Ja-nein. Heiß-kalt.
Heiß-heiß.
Von Anfang an hatte ich mich von Ryan angezogen gefühlt, doch einem dementsprechenden Verhalten standen mehr Hindernisse im Weg, als die Unabhängigkeitserklärung Unterzeichner hatte.
Ich glaube an die Trennung von Beruf und Vergnügen. Keine Kaffeeautomaten-Romanze für diese Señorita. Auf gar keinen Fall.
Ryan arbeitet im Morddezernat. Ich arbeite in der Leichenhalle. Hier gilt die berufliche Fernhaltungsklausel. Hindernis eins.
Dann war da noch Ryan selbst. Jeder kannte seine Biografie. Geboren in Nova Scotia als Sohn irischer Eltern, landete der junge Andrew schließlich am falschen Ende der zerbrochenen Budweiser-Flasche eines Bikers. Darauf verließ der Bursche die dunkle Seite und ging zu den guten Jungs, wo er bis in den Rang eines Lieutenant-détective der Provinzpolizei aufstieg. Der erwachsene Andrew ist freundlich, intelligent und, was seine Arbeit betrifft, ein grundsolider Kerl.
Aber allgemein auch als der Schwerenöter des Bereitschaftssaals bekannt. Hier gilt die Sexprotz-Fernhaltungsklausel. Hindernis zwei.
Aber Ryan machte mir mit beharrlichen Schmeicheleien die Schlupflöcher schmackhaft, und schließlich schlüpfte ich hindurch. Und plötzlich stand, natürlich an Weihnachten, Hindernis drei vor mir.
Lily. Eine neunzehnjährige Tochter, samt iPod, Nabelpiercing und bahamischer Mutter, ein Souvenir aus Fleisch und Blut aus seiner wilden Zeit.
Obwohl verwirrt und etwas erschrocken, nahm Ryan das Produkt seiner Vergangenheit an und traf einige Entscheidungen in Bezug auf seine Zukunft. Nach den Weihnachtsfeiertagen beschloss er, die Pflichten einer Vaterschaft auf Distanz zu übernehmen. In derselben Woche fragte er mich, ob ich bei ihm einziehen wolle.
Mach mal halblang, Freundchen. Ich legte ein Veto ein.
Obwohl ich noch immer mit meinem Kater Birdie zusammenlebe, tanzen Ryan und ich um die vorläufige Fassung eines für uns beide praktikablen Arrangements herum.
Bis jetzt war der Tanz gut.
Aber nur in den eigenen vier Wänden. Wir behalten die Sache für uns.
»Wie geht’s meiner Süßen?«, fragte Ryan, als er zur Tür hereinkam.
»Gut.« Ich legte ein weiteres Fragment zu denen, die auf der Korkplatte trockneten.
»Ist das die Leiche aus dem Kamin?« Ryan beäugte den Karton mit Charles Bellemare.
»Der letzte Ritt für den Cowboy.«
»Hat der Kerl was abbekommen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Wie’s aussieht, hat er sich zurückgelehnt, als er sich hätte vorbeugen müssen. Keine Ahnung, warum er auf einem Kaminsims saß.« Ich zog die Gummihandschuhe aus und drückte mir Seife auf die Hände. »Wer ist der Blonde da unten?«
»Birch. Er wird mit mir den Ferris-Fall bearbeiten.«
»Neuer Partner?«
Ryan schüttelte den Kopf. »Von einer anderen Abteilung ausgeliehen. Glaubst du, dass Ferris sich selber umgebracht hat?«
Ich drehte mich um und warf Ryan einen vernichtenden Blick zu.
Ryan schaute mich an wie ein unschuldiger Chorknabe. »Ich will dich nicht drängen.«
Ich riss ein Papiertaschentuch aus dem Spender und sagte: »Erzähl mir was über ihn.«
Ryan schob Bellemare auf die Seite und hockte sich mit einem Schenkel auf den Arbeitstisch.
»Die Familie ist orthodox.«
»Echt?« Gespielte Überraschung.
»Die Fabelhaften Vier waren anwesend, um eine koschere Autopsie zu gewährleisten.«
»Wer waren die eigentlich?« Ich zerknüllte das Papiertuch und warf es in den Mülleimer.
»Ein Rabbi, Mitglieder der Gemeinde, ein Bruder. Willst du die Namen?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Ferris war ein bisschen weltlicher als seine Verwandtschaft. Betrieb ein Importgeschäft in einem Lagerhaus in der Nähe des Mirabel-Flughafens. Sagte der Frau, er sei am Donnerstag und Freitag nicht in der Stadt. Laut…« Ryan zog seinen Spiralblock heraus und warf einen kurzen Blick darauf.
»Miriam«, ergänzte ich.
»Genau.« Ryan schaute mich verwundert an. »Laut Miriams Angaben versuchte Ferris, das Geschäft zu expandieren. Er rief am Mittwoch um vier an, sagte, er fahre jetzt weg und komme am späten Freitagabend wieder zurück. Als er bei Sonnenuntergang noch nicht da war, vermutete Miriam, er habe sich verspätet und wolle am shabbat lieber nicht fahren.«
»Ist das schon öfters passiert?«
Ryan nickte. »Ferris war kein großer Freund von Telefonaten nach Hause. Als er am Samstagabend noch immer nicht da war, startete Miriam einen Rundruf. Keiner aus der Familie hatte ihn gesehen. Und seine Sekretärin auch nicht. Da Miriam nicht wusste, wen er alles treffen wollte, beschloss sie, erst einmal nichts zu tun. Am Sonntagmorgen fuhr sie zu dem Lagerhaus. Am Nachmittag meldete sie ihn bei der Polizei als vermisst. Die Beamten sagten, sie würden anfangen zu ermitteln, wenn er bis Montagmorgen noch nicht aufgetaucht sei.«
»Ein erwachsener Mann, der eine Geschäftsreise ein bisschen verlängert?«
Ryan zuckte die Achseln. »Kommt schon mal vor.«
»Ferris hat Montreal nie verlassen?«
»LaManche glaubt, dass er bereits kurz nach seinem Anruf bei Miriam starb.«
»Miriams Geschichte ist also stimmig?«
»Bis jetzt schon.«
»Die Leiche wurde in einer Kammer gefunden?«
Ryan nickte. »Blut und Hirn überall an den Wänden.«
»Was für eine Art Kammer?«
»Kleine Abstellkammer hinter einem Büro im ersten Stock.«
»Wie kamen die Katzen da zu ihm rein?«
»Die Tür hat so eine kleine, beidseitig schwenkbare Klappe. Ferris bewahrte dort drinnen Futter und Katzenstreu auf.«
»Er holte seine Katzen zu sich, um sich zu erschießen?«
»Vielleicht waren sie schon drinnen, als er die Kugel abbekam, vielleicht sind sie erst später hineingeschlüpft. Es kann sein, dass Ferris auf einem Hocker saß, als er starb, und dann herunterfiel. Irgendwie haben sich seine Füße in der Katzenklappe verklemmt.«
Ich dachte darüber nach.
»Miriam schaute nicht in dieser Abstellkammer nach, als sie am Sonntag dorthin fuhr?«
»Nein.«
»Sie hat auch kein Kratzen oder Miauen gehört?«
»Madam ist keine Katzenliebhaberin. Deshalb hatte Ferris sie ja in der Arbeit.«
»Geruch hat sie auch keinen bemerkt?«
»Offensichtlich war Ferris nicht gerade ein Pedant, was Katzenhygiene betraf. Miriam meinte, wenn sie etwas gerochen hätte, dann hätte sie sich wahrscheinlich gedacht, dass es dreckiges Katzenstreu ist.«
»Sie fand das Gebäude auch nicht übermäßig warm?«
»Nein. Aber wenn eine der Katzen erst nach ihrem Besuch an den Thermostat gekommen wäre, dann hätte Ferris immer noch von Sonntag bis Dienstag geschmort.«
»Hatte Ferris andere Angestellte außer seiner Sekretärin?«
»Nein.« Ryan schaute kurz in seine Notizen auf dem Spiralblock. »Courtney Purviance. Miriam nennt sie Sekretärin. Purviance zieht die Bezeichnung ›Geschäftspartnerin‹ vor.«
»Setzt die Ehefrau sie herab oder sie sich selber herauf?«
»Eher Ersteres. Wie’s aussieht, spielte Purviance in dem Geschäft eine ziemlich wichtige Rolle.«
»Wo war Purviance am Mittwoch?«
»Ging früh nach Hause. Verstopfte Nebenhöhlen.«
»Warum hat Purviance Ferris am Montag nicht gefunden?«
»Montag war irgendein jüdischer Feiertag. Purviance hat sich den Tag freigenommen, um Bäume zu pflanzen.«
»Tu B’Shvat.«
»Et tu, Brute.«
»Das Fest der Bäume. Fehlte irgendwas?«
»Purviance meint, dass es in dem Laden nichts gibt, was das Stehlen lohnt. Der Computer ist alt. Das Radio noch älter. Das Inventar ist nicht wertvoll. Aber sie sieht noch mal genau nach.«
»Wie lange hat sie für Ferris gearbeitet?«
»Seit achtundneunzig.«
»Irgendwas Verdächtiges in Ferris’ Geschichte? Bekannte Geschäftspartner? Feinde? Spielschulden? Sitzengelassene Freundin? Oder Freund?«
Ryan schüttelte den Kopf.
»Deutet irgendwas auf eine Selbstmordneigung hin?«
»Ich bin noch am Wühlen, aber bis jetzt ist da nichts. Stabile Ehe. Ist mit seiner Frau im Januar nach Boca Raton gefahren. Das Geschäft war nicht gerade ein Knüller, lieferte aber ein solides Einkommen. Vor allem, seit Purviance eingestiegen ist, eine Tatsache, mit der sie nicht hinterm Berg hält. Nach Angaben der Familie gab es keine Anzeichen für Depressionen, aber Purviance meinte, er sei in den letzten Wochen ungewöhnlich launisch gewesen.«
Ich erinnerte mich an Kessler und zog das Foto aus der Tasche meines Labormantels.
»Ein Geschenk von einem der Fabelhaften Vier.« Ich hielt es ihm hin. »Er glaubt, das ist der Grund für Ferris’ Tod.«
»Soll heißen?«
»Er glaubt, das ist der Grund für Ferris’ Tod.«
»Du kannst einem wirklich auf die Nerven gehen, Brennan.«
»Ich arbeite daran.«
Ryan betrachtete das Foto.
»Welcher von den Fabelhaften Vier?«
»Kessler?«
Ryan hob eine Augenbraue, legte das Foto weg und blätterte in seinem Spiralblock.
»Bist du sicher?«
»Den Namen hat er mir zumindest genannt.«
Als Ryan den Kopf hob, war die Braue wieder an ihrer gewohnten Stelle.
»Bei der Autopsie war keiner mit dem Namen Kessler zugelassen.«
3
»Ich bin mir sicher, dass Kessler der Name war, den er mir genannt hat.«
»Er war ein befugter Beobachter?«
»Im Gegensatz zu den Unmengen von hasidim, die in diesen Hallen umgehen?«
Ryan ignorierte meinen Sarkasmus.
»Hat Kessler gesagt, warum er hier war?«
»Nein.« Aus irgendeinem Grund ärgerte mich Ryans Frage.
»Hast du Kessler davor im Autopsiesaal gesehen?«
Ich war besorgt gewesen wegen Miriam und Dora und dann abgelenkt von Pelletiers Anruf. Kessler hatte eine Brille, einen Bart und einen schwarzen Anzug. Mein Verstand hatte sich mit einem kulturellen Klischee zufrieden gegeben.
»Das habe ich einfach angenommen.«
»Gehen wir es doch mal von Anfang an durch.«
Ich schilderte Ryan die Begegnung auf dem Gang unten im Keller.
»Kessler war also im Gang, als du aus dem Familienzimmer gekommen bist?«
»Ja.«
»Hast du gesehen, woher er kam?«
»Nein.«
»Wohin er ging?«
»Ich dachte, er würde zu Dora und Miriam gehen.«
»Hast du gesehen, dass er das Familienzimmer betreten hat?«
»Ich hatte eben Pelletier am Apparat.« Es klang schärfer, als ich beabsichtigt hatte.
»Sei doch nicht so abwehrend.«
»Das war nicht abwehrend«, sagte ich abwehrend und riss die Druckknöpfe meines Labormantels mit beiden Händen auf. »Nur Detailgenauigkeit.«
Ryan nahm Kesslers Foto zur Hand.
»Was sehe ich da?«
»Ein Skelett.«
Ryan verdrehte die Augen.
»Kessler –« Ich hielt inne. »Der mysteriöse bärtige Fremde hat mir gesagt, es komme aus Israel.«
»Kommt das Foto aus Israel, oder wurde es dort aufgenommen?«
Noch ein Versäumnis meinerseits.
»Das Foto ist über vierzig Jahre alt. Es ist wahrscheinlich bedeutungslos.«
»Wenn jemand sagt, dass es einen Tod verursacht hat, dann ist es nicht bedeutungslos.«
Ich wurde rot.
Ryan drehte das Foto um, wie ich es getan hatte. »Was heißt M de 1 H?«
»Du hältst das für ein M?«
Ryan ignorierte meine Frage.
»Was war im Oktober dreiundsechzig los?«, fragte er mehr sich selbst als mich.
»Oswalds Gedanken waren bei JFK.«
»Brennan, du kannst einem wirklich…«
»Das hatten wir bereits.«
Ich stellte mich neben Ryan, drehte das Foto wieder um und deutete auf das Objekt links der Beinknochen.
»Siehst du das?«
»Das ist ein Pinsel.«
»Es ist ein provisorischer Richtungspfeil.«
»Soll heißen?«
»Ein alter Archäologentrick. Wenn man keinen offiziellen Marker hat, um Größenverhältnisse und Ausrichtung zu kennzeichnen, legt man irgendwas hin und richtet es nach Norden aus.«
»Du glaubst also, das Foto wurde von einem Archäologen aufgenommen?«
»Ja.«
»Auf was für einer Ausgrabungsstätte?«
»Einer mit Gräbern.«
»Langsam machen wir Fortschritte.«
»Schau, dieser Kessler ist wahrscheinlich ein Spinner. Stöbere ihn auf und quetsch ihn aus. Oder rede mit Miriam.« Ich deutete auf das Foto. »Vielleicht weiß sie, warum dieses Ding ihren Mann so aus der Fassung brachte.« Ich zog den Labormantel aus. »Falls es ihn tatsächlich aus der Fassung brachte.«
Ryan betrachtete das Foto eine ganze Minute lang. Dann hob er den Kopf und sagte: »Hast du die Tap Pants gekauft?«
Meine Wangen brannten. »Nein.«
»Roter Satin. Verdammt sexy.«
Ich kniff die Augen zusammen, um ihm anzudeuten: Nicht hier. »Ich mache Schluss für heute.«
Ich ging zum Schrank, hängte den Labormantel hinein und leerte die Taschen. Leerte meine Libido.
Als ich mich wieder umdrehte, stand Ryan bereits, starrte aber immer noch Kesslers Foto an.
»Glaubst du, dass einer deiner Paläo-Kumpels das Ding identifizieren kann?«
»Ich kann ja mal ein paar anrufen.«
»Könnte nicht schaden.«
An der Tür drehte Ryan sich um und hob die Augenbrauen. »Bis später?«
»Mittwoch ist mein Tai-Chi-Abend.«
»Morgen?«
»Okay.«
Ryan deutete mit dem Finger auf mich und zwinkerte. »Tap Pants.«
Meine Eigentumswohnung in Montreal befindet sich im Erdgeschoss eines u-förmigen Flachbaus. Ein Schlafzimmer, Arbeitszimmer, zwei Bäder, Wohn- und Esszimmer und eine Durchgangsküche, die so schmal ist, dass man an der Spüle steht und sich nur umzudrehen braucht, um den Kühlschrank zu öffnen.
Durch eine der Bogentüren in der Küche erreicht man über einen kurzen Gang eine gläserne Doppeltür, die auf einen zentralen Innenhof hinausführt. Durch die andere Küchentür kommt man ins Wohnzimmer, von dem aus eine weitere Doppeltür in einen winzigen, umschlossenen Garten führt.
Gemauerter, offener Kamin. Hübsche Holzarbeiten. Genügend Wandschränke. Parkhaus im Keller.
Nichts Ausgefallenes. Das wichtigste Verkaufsargument des Gebäudes ist seine zentrale Lage. Mitten im Centre-ville. Alles, was ich brauche, befindet sich im Umkreis von zwei Blocks von meinem Bett aus.
Birdie ließ sich nicht blicken, als ich mit dem Schlüssel klimperte.
»Hey, Bird.«
Keine Katze.
»Tschirp.«
»Hey, Charlie.«
»Tschirp. Tschirp.«
»Birdie?«
»Tschirp. Tschirp. Tschirp. Tschirp. Tschirp.« Ein bewundernder Pfiff.
Ich hängte meinen Mantel in den Schrank, brachte den Laptop ins Arbeitszimmer, stellte meine mitgebrachte Lasagne in der Küche ab und ging weiter ins Wohnzimmer.
Bird saß in seiner Sphinx-Pose da, die Hinterläufe unter dem Körper, den Kopf erhoben, die Vorderpfoten nach innen gedreht. Als ich mich zu ihm auf den Zweisitzer setzte, schaute er kurz hoch und konzentrierte sich dann wieder auf den Käfig rechts von ihm.
Charlie legte den Kopf schief und beäugte mich durch die Gitterstangen.
»Wie geht’s meinen Jungs?«, fragte ich.
Birdie ignorierte mich.
Charlie hoppelte zu seiner Futterschüssel, pfiff noch einmal bewundernd und ließ dann sein Tschirpen hören.
»Wie mein Tag war? Anstrengend, aber ohne größere Katastrophen.« Von Kessler sagte ich nichts.
Charlie drehte den Kopf und begutachtete mich mit seinem linken Auge.
Nichts von der Katze.
»Freut mich, dass ihr zwei euch so gut versteht.«
Und das taten sie auch.
Der Sittich war Ryans letztjähriges Weihnachtsgeschenk. In Anbetracht meines Pendlerlebens hielt sich meine Begeisterung zwar in Grenzen, doch Birdie war vom ersten Augenblick an hingerissen.
Nachdem ich Ryans Vorschlag der gemeinsamen Wohnung abgelehnt hatte, hatte er gemeinsames Sorgerecht angeregt. Wenn ich in Montreal war, behielt ich Charlie. Wenn ich in Charlotte war, nahm Ryan ihn auf. Birdie reiste normalerweise mit mir.
Dieses Arrangement funktionierte, und Katze und Vogel waren ein Herz und eine Seele.
Ich ging in die Küche.
»Ausflug«, krächzte Charlie. »Vergiss den Vogel nicht.«
Beim Tai-Chi an diesem Abend war ich eine ziemliche Niete, aber danach schlief ich wie ein Stein. Okay, Lasagne ist nicht gerade die beste Vorbereitung für »Packe den Spatzenflügel« oder »Weißer Kranich breitet die Flügel aus«, aber für »Innere Stille« ist sie nicht schlecht.
Am nächsten Morgen stand ich um sieben auf und war um acht im Labor.
Die erste Stunde brachte ich damit zu, die Knochenfragmente aus Avram Ferris’ Schädel zu identifizieren, zu markieren und zu inventarisieren. Es war noch keine sehr eingehende Untersuchung, aber mir fielen bereits Details auf, und langsam entstand ein Bild. Ein verwirrendes Bild.
Die Morgenbesprechung präsentierte das übliche Repertoire des Hirnlosen, des Brutalen und des traurig Banalen.
Ein siebenundzwanzigjähriger Mann war an einem elektrischen Schlag gestorben, weil er in der Metrostation Lucien-L’Allier in den Gleisschacht uriniert hatte.
Ein Schreiner in Boisbriand prügelte seine Frau, mit der er dreißig Jahre lang verheiratet gewesen war, zu Tode, nachdem sie sich gestritten hatten, wer hinausgehen und Feuerholz holen sollte.
Ein neunundfünfzigjähriger Crack-Süchtiger starb in einer billigen Absteige am Tor zu Chinatown an einer Überdosis.
Nichts für die Anthropologin.
Um zwanzig nach neun kehrte ich in mein Büro zurück und rief Jacob Drum an, einen Kollegen am UNC-Charlotte. Sein Anrufbeantworter meldete sich. Ich hinterließ ihm die Nachricht, dass er mich zurückrufen sollte.
Ich hatte bereits wieder eine Stunde Fragmentsichtung hinter mir, als das Telefon klingelte.
»Hey, Tempe.«
Beim Grüßen sagen wir aus dem Süden »hey«, nicht »hi«. Um zu warnen, Aufmerksamkeit zu erregen oder Missfallen auszudrücken, sagen wie ebenfalls »hey«, dabei wird aber die Luft ausgestoßen und das Ende gekappt. Das war ein luftloses, sehr langes »hey.«
»Hey, Jake.«
»Hier in Charlotte haben wir heute über zehn Grad. Ist es bei euch da oben recht kalt?«
Im Winter machen sich die aus dem Süden immer einen Spaß daraus, nach dem Wetter in Kanada zu fragen. Im Sommer lässt das Interesse etwas nach.
»Es ist kalt.« Die vorausgesagte Höchsttemperatur lag im Minusbereich.
»Ich gehe jetzt dorthin, wo das Wetter zu meinen Klamotten passt.«
»Zu einer Ausgrabung?« Jake war biblischer Archäologe, der im Mittleren Osten seit fast dreißig Jahren Ausgrabungen unternahm.
»Ja, Ma’am. Eine Synagoge aus dem ersten Jahrhundert. Ich plane das schon seit Monaten. Das Team habe ich bereits beisammen. In Israel habe ich meine Stammbesetzung, und am Samstag treffe ich mich noch mit einem Grabungskoordinator in Toronto. Schließe jetzt gerade noch meine eigenen Reisevorbereitungen ab. Kann einem ganz schön auf die Nüsse gehen. Hast du eine Ahnung, wie selten diese Dinger sind?«
Nüsse?
»Synagogen aus dem ersten Jahrhundert gibt es in Masada und Gamla. Und das war’s dann so ziemlich.«
»Klingt nach einer klasse Chance. Hör mal, ich bin froh, dass ich dich erwischt habe. Muss dich um einen Gefallen bitten.«
»Schieß los.«
Ich beschrieb ihm Kesslers Foto, ohne darauf einzugehen, wie ich es bekommen hatte.
»Das Foto wurde in Israel aufgenommen?«
»Man hat mir gesagt, es komme aus Israel.«
»Aus den Sechzigern?«
»Auf der Rückseite steht Oktober 63. Und eine Abkürzung. Vielleicht eine Adresse.«
»Ziemlich vage.«
»Ja.«
»Ich schaue mir das gern mal an.«
»Ich scanne das Foto ein und schick’s dir per E-Mail.«
»Sehr optimistisch bin ich allerdings nicht.«
»Ich bin dir sehr dankbar, dass du’s dir wenigstens anschauen willst.«
Ich wusste, was jetzt kam. Jack wiederholte seinen altbekannten Spruch wie eine schlechte Bierwerbung.
»Du solltest mit uns kommen, Tempe. Zu deinen archäologischen Wurzeln zurückkehren.«
»Es gibt nichts, was ich lieber tun würde, aber im Augenblick bin ich hier unabkömmlich.«
»Irgendwann einmal.«
»Irgendwann einmal.«
Gleich nach dem Anruf eilte ich in die Bild-Abteilung, scannte das Foto ein und schickte die jpg-Datei an den Computer in meinem Büro. Dann eilte ich zurück, ging online und schickte das Bild an Jakes Mailbox im UNCC.
Und wieder zurück zu Ferris’ zertrümmertem Schädel.
Frakturen des Schädels zeigen erstaunliche Varianz, was das Bruchmuster angeht. Die erfolgreiche Interpretation eines vorliegenden Musters basiert auf dem Verständnis der biomechanischen Eigenschaften des Knochens in Kombination mit dem Wissen über die an der Erzeugung des Bruchs beteiligten inneren und äußeren Faktoren.
Ganz einfach, nicht? Wie Quantenphysik.
Obwohl ein Knochen ziemlich starr erscheint, weist er doch eine gewisse Elastizität auf. Unter Belastung gibt ein Knochen nach und verändert die Form. Wenn die Grenzen der Deformationselastizität überschritten werden, geht der Knochen kaputt, er bricht.
Das ist der biomechanische Teil.
Am Schädel verfolgen Brüche die Pfade des geringsten Widerstands. Diese Pfade werden bestimmt von Dingen wie Gewölbekrümmung, Knochenvorsprüngen und Nähten, den gewundenen Verbindungsstellen zwischen den verschiedenen Knochen.
Das sind die inneren Faktoren.
Zu den äußeren Faktoren gehören Größe, Geschwindigkeit und Winkel des aufprallenden Objekts.
Stellen Sie es sich so vor. Der Schädel ist eine Kugel mit Höckern und Kurven und Lücken. Man kann die Art und Weise vorhersagen, wie diese Kugel bricht, wenn ein aufprallendes Objekt Ärger macht. Sowohl eine 22er-Kugel wie ein Zwei-Zoll-Rohr sind aufprallende Objekte. Nur bewegt die Kugel sich viel schneller und trifft eine kleinere Fläche.
Jetzt wissen Sie ungefähr, worum es geht.
Trotz der massiven Schäden wusste ich, dass ich an Ferris’ Schädel ein atypisches Muster sah. Je genauer ich hinschaute, desto mulmiger wurde mir.
Ich legte eben ein Fragment des Hinterhauptsbeins unter das Mikroskop, als das Telefon klingelte. Es war Jake Drum. Diesmal gab es kein entspanntes »hey«.
»Wo, hast du gesagt, hast du das Foto her?«
»Das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich …«
»Wer hat es dir gegeben?«
»Ein Mann namens Kessler. Aber …«
»Hast du es noch?«
»Ja.«
»Wie lange bist du noch in Montreal?«
»Ich fliege am Sonntag für ein paar Tage in die Staaten, aber … «
»Wenn ich morgen einen Abstecher nach Toronto mache, kannst du mir dann das Original zeigen?«
»Ja. Jake …«
»Ich muss die Fluggesellschaft anrufen.« Seine Stimme war so angespannt, als wäre die Queen Mary daran vertäut. »Bis dahin, versteck das Foto.«
Die Leitung war tot.
4
Ich starrte das Telefon an.
Was konnte so wichtig sein, dass Jake Pläne änderte, an denen er bereits seit Monaten arbeitete?
Ich legte Kesslers Foto in die Mitte meiner Schreibunterlage.
Wenn ich mit dem Pinsel Recht hatte, lag das Skelett in Nord-Süd-Richtung. Die Handgelenke waren auf dem Bauch überkreuzt. Die Beine waren voll gestreckt.
Bis auf eine leichte Verschiebung der Becken- und Fußknochen sah alles anatomisch korrekt aus.
Zu korrekt.
Die Patellas lagen perfekt platziert am Ende jedes Oberschenkelknochens. Es ist unmöglich, dass Kniescheiben so gut in Position bleiben.
Und noch etwas anderes stimmte nicht. Das rechte Wadenbein lag innerhalb des rechten Schienbeines. Es hätte auf der anderen Seite liegen müssen.
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Cross Bones« bei Scribner, New York.
3. Auflage Taschenbuchausgabe September 2007 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © der Originalausgabe 2005 by Temperance Brennan, L. P.
Published by arrangement with the original publisher, Scribner, an imprint of Simon & Schuster, Inc. Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2005 by Karl Blessing Verlag, GmbH, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlaggestaltung: HildenDesign, München nach einem Umschlagdesign von Hauptmann & Kompanie, München, Zürich, unter Verwendung einer Fotografie von © Corbis MD · Herstellung: HN Satz: Uhl + Massopust, Aalen
eISBN 978-3-641-13828-8V003
www.blanvalet.de
www.randomhouse.de