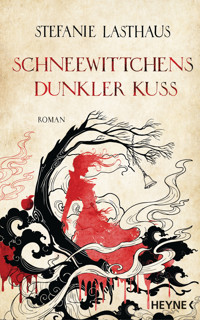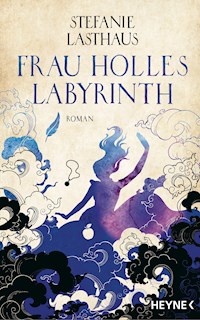Touch of Ink, Band 1: Die Sage der Wandler (Fesselnde Gestaltwandler-Romantasy) E-Book
Stefanie Lasthaus
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Verlag GmbH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Touch of Ink
- Sprache: Deutsch
Destiny is written on your skin. Seit Quinn denken kann, trägt sie ein Tattoo im Nacken. Ein wunderschönes, verschlungenes Muster – doch weder Quinn noch ihre Adoptiveltern wissen, woher sie es hat. Bis Quinn im ersten Semester an der Vancouver Island University auf Nathan trifft. Nathan, der ihr einen heiß ersehnten Job vor der Nase wegschnappt. Dessen funkelnde Augen und fast raubtierhafte Geschmeidigkeit Quinn unweigerlich faszinieren. Instinktiv spürt sie, dass hinter der Fassade des Vorzeigestudenten etwas Unbezähmbares lauert. Doch sie ahnt nicht, dass Nathans Geheimnis etwas mit den unheimlichen Visionen zu tun hat, die sie seit Monaten verfolgen. * Eine Szene aus "Touch of Ink" * Ich drehte mich zu Nathan um und legte meine Hand an seine Hüfte. Nathan biss sich auf die Lippe, dann beugte er sich vor und küsste meine Stirn. Ich fasste sein Shirt, zog es über seinen Kopf und ließ es achtlos fallen. Mein Blick wurde wie magisch von seinem Tattoo angezogen. Ich strich darüber und lächelte leicht, als er eine Gänsehaut bekam. Er fing meine Hand ein und küsste die Fingerspitzen. "Du machst es mir nicht leicht, Quinn." Ich legte beide Hände auf seinen Rücken und ließ sie dann an den Seiten nach unten wandern. "Es sind nur du und ich." Keine Verbote. Keine Konsequenzen. Nathan streichelte meine Arme, und als er mich erneut küsste, war es egal, was wir waren und welche Probleme damit einhergingen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 640
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Originalausgabe Als Ravensburger E-Book erschienen 2021 Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg © 2021 Ravensburger Verlag GmbH Text © 2021 Stefanie Lasthaus Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literaturagentur Langenbuch & Weiß, Hamburg. Umschlaggestaltung: Zero Werbeagentur, München, unter Verwendung eines Fotos von © Gribanessa/Shutterstock Tattoo-Illustrationen: © Sarah Schwarz und © Giuliana Villeggiante Lektorat: Franziska Jaekel Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-473-47108-9
www.ravensburger.de
FÜR ALLE, DIE TIEF IM HERZEN ETWAS ANDERS SIND.
Kapitel 1
QUINN
Kein Wind, keine Menschen, nicht die geringste Bewegung. Und trotzdem war da plötzlich dieses Schaben hinter mir, so als würde sich etwas sehr, sehr langsam bewegen.
Etwas oder … jemand.
Ich fuhr herum und spähte in die schmale Gasse, sofern das bei diesem Dämmerlicht möglich war. Nichts zu sehen, dennoch prickelte meine Haut im Nacken und auf den Unterarmen. Kein gutes Zeichen. Innerhalb weniger Sekunden hatte sich die Atmosphäre verändert. Zuvor hatte mir der Spaziergang durch diesen wie ausgestorben wirkenden Straßenzug von Nanaimo ein Stück der Ruhe geschenkt, nach der ich so verzweifelt gesucht hatte, bevor mein erstes Semester an der Vancouver Island University startete. Jetzt wirkte alles nur noch bedrohlich.
Ich lief weiter und versuchte, mich zu orientieren. Gar nicht mal so leicht, denn ich war erst zum zweiten Mal hier unterwegs. Aber wenn ich dort vorn abbog und dann noch einmal, ohne dabei eine Sackgasse zu erwischen, müsste ich auf eine der größeren Straßen stoßen, wo noch immer Verkehr herrschte und Menschen unterwegs waren.
Links von mir bewegte sich etwas in den Schatten. Ich wandte rasch den Kopf, war aber zu langsam, um zu erkennen, was es war. Auf jeden Fall war das Ding zu groß gewesen, um eine streunende Katze zu sein. Vielleicht ein Hund? Nein, es war … anders. Ich konnte es mir selbst nicht erklären, aber irgendetwas sagte mir, dass ich vorsichtig sein musste. Mit angehaltenem Atem bog ich nach rechts ab. Eine Sackgasse. Verdammter Mist.
Ich presste mich an die Mauer, zitterte, während die Kälte auf mich überging, und lauschte, sofern mein rasender Herzschlag es zuließ. Meine Sinne redeten mir ein, dass ich mich nur verrückt machte, weil da einfach nichts war. Meine Instinkte sagten jedoch das genaue Gegenteil.
Hör auf zu grübeln und verschwinde.
Ich holte tief Luft und rannte – vorbei an der Stelle, an der ich zuvor die Bewegung bemerkt hatte. Mein Magen ballte sich so sehr zusammen, dass mir übel wurde. Immer wieder warf ich einen Blick über die Schulter. Um nichts in der Welt wollte ich der Gegend hinter mir völlig den Rücken zuwenden.
Dieses Mal war der Schatten deutlich zu sehen. Er huschte vor mir von einer Wand zur anderen und verschwand hinter ein paar Mülltonnen. Größer als ein Hund, ungefähr halb so groß wie ich. Aber kein Mensch. Ein Schwarzbär konnte es auch nicht sein – wobei ich nicht glaubte, dass die sich ins Stadtzentrum verirrten. Aber das war mir nun egal. Ich blieb so abrupt stehen, dass ich ein Stück über den Boden schlitterte, warf mich herum und rannte zurück.
Hinter mir schepperte es, erst weiter entfernt, dann ein ganzes Stück näher. Was auch immer hier mit mir in der Gasse war, jagte mich. Ein Fiepen zog durch meine Ohren. Ich legte all meine Kraft in meine Beine. Das Kribbeln wurde zu einem Brennen, und ich konnte den Gedanken nicht mehr beiseiteschieben, jeden Moment von hinten angesprungen und zu Boden gerissen zu werden.
Ich keuchte, biss die Zähne zusammen und holte auch den letzten Rest aus meinem Körper heraus. Mit einer Schulter schrammte ich an der Mauer entlang – ich hatte die Enge der Gasse unterschätzt und war im mangelnden Licht zu weit nach rechts geraten. Es brannte, aber das spielte im Moment keine Rolle. Hier und jetzt war ich nicht mehr Quinn Shields, sondern nur ein namenloses Opfer, von jemandem oder etwas gehetzt. Ein schrecklicher Gedanke. Als hätte mein Verfolger ihn gelesen, erklang hinter mir ein Grollen. Tief und vor allem drohend, eindeutig von einem Tier. Und viel zu nah! Ich nutzte den letzten verbliebenen Atem und schrie um Hilfe. Doch es war, als hätten sich die Mauern gegen mich verschworen und hielten jedes Geräusch ab.
Zu meiner Rechten tauchte eine Abzweigung auf. Ohne groß zu überlegen, bog ich ab. Eine weitere Gasse, ebenfalls schlecht beleuchtet, aber der Mond schimmerte irgendwo über mir und sorgte zumindest im hinteren Teil für etwas mehr Licht. An einer Seite reihten sich riesige Müllcontainer. Es roch übel, nach Küchenabfällen, Moder, abgestandenem Rauch und Urin.
Ich stolperte, fing mich wieder und lief weiter. In meinem Kopf herrschte Chaos, aber ich musste irgendetwas tun. Vielleicht irgendwo hineinklettern oder …
Mein Blick fiel auf den Hals einer Glasflasche, die aus einem Container ragte. Ich griff im Vorbeirennen danach und hatte Glück, dass ich sie trotz meiner Hektik zu fassen bekam und herausziehen konnte. Am nächsten Container schlug ich sie kräftig gegen die Seitenwand. Wie erhofft zerbrach sie. Ich blieb stehen, drehte mich um und fragte mich, ob ich gerade vollkommen den Verstand verloren hatte. Aber eine andere Idee hatte ich einfach nicht. Ich war zwar recht fit, doch diesem Tier konnte ich nicht davonrennen.
Der Flaschenhals in meiner Hand zitterte in der trüben Beleuchtung, vor mir ballten sich die Schatten. Ich blinzelte, während ich versuchte, etwas darin zu erkennen.
Das Grollen ertönte ein zweites Mal. Ja, das Tier war da, und es hatte es offensichtlich nicht mehr eilig. Was irgendwie logisch war. Es hatte mich gestellt, und ich war ihm unterlegen. Mittlerweile nahm ich in all dem Gestank einen weiteren Geruch wahr. Ich konnte ihn nicht beschreiben, aber er passte ganz und gar nicht hierher.
Meine Kehle war trocken, und ich atmete so abgehackt, dass sich mein Körper ganz taub anfühlte, als würde mein Blut nicht mehr jede Zelle versorgen. Mein Arm zitterte immer stärker, aber ich hielt die halbe Flasche mit aller Kraft vor meine Brust.
Eine Bewegung ließ mich zusammenzucken. Nicht so nah, wie ich befürchtet hatte, aber das machte die Sache nicht besser. Viel konnte ich nicht erkennen. Was auch immer dort auf mich lauerte, bewegte sich absolut lautlos.
»Verschwinde«, krächzte ich. »Hörst du? Hau ab!«
Ohne hinzusehen, streckte ich die Hand aus und griff nach dem nächstbesten Gegenstand im Müllcontainer, um ihn auf meinen Verfolger zu schleudern. Meine provisorische Waffe wollte ich nicht hergeben. Ich fand eine Dose und warf sie nach vorn.
»Hau ab!«
Der Aufprall wurde von einem weiteren Grollen begleitet. Bewegung kam in die Schatten, etwas schälte sich heraus, sprang vor und zog sich augenblicklich wieder zurück. Krallen, ich hatte ganz eindeutig Krallen gesehen. Ich brüllte weiter, rief dem Vieh zu, dass es verschwinden sollte, nutzte sämtliche Flüche, die mir einfielen, schrie um Hilfe. Lärm, ich musste möglichst viel Lärm machen! Gleichzeitig griff ich wieder und wieder in den Container, zog mit einer Hand hervor, was auch immer ich in die Finger bekam, und schleuderte alles von mir: Dosen, halb aufgeweichte Pappstücke, einen abgebrochenen Kleiderbügel.
Es funktionierte. Etwas funkelte schwach, bewegte sich, dann schepperte es ein gutes Stück von mir entfernt. Das Biest zog sich zurück! Ich hielt die Luft an und lauschte. Mein Brustkorb drohte jeden Augenblick zu bersten, so sehr raste mein Herz. Mein Unterkiefer zitterte, ich schaffte es einfach nicht, ihn ruhig zu halten. Unter Tränen starrte ich in die Gasse.
Aber da war nichts mehr. Was auch immer mich gejagt hatte, es war verschwunden.
»Quinn, bist du das?« Annabelles Stimme passte perfekt zu der Wärme ihrer Wohnung und der leisen Musik, die aus dem Wohnzimmer bis in den Flur drang.
Es kam mir vor, als würde ich von einer Welt in eine andere treten – und nicht nur von der Straße in mein neues Zuhause in der Chestnut Street, das sich noch nicht vertraut anfühlte. Trotzdem, lauernde Schatten und unbekannte Bedrohungen hatten keine Chance gegen die hier herrschende Normalität.
»Ja, ich bin spät dran, sorry«, rief ich und war froh, dass ich wieder halbwegs normal klang. Seitdem ich die Tür hinter mir ins Schloss gezogen und den Schlüssel zweimal rumgedreht hatte, atmete ich wieder ruhiger. Endlich schaffte ich es, die Bilder aus der Gasse in den Hintergrund zu drängen. Mit ungelenken Bewegungen zerrte ich mir Jacke und Sneaker vom Körper – meine Hände zitterten noch immer – und betrachtete den Dreck auf meiner Haut sowie die Schnittwunde zwischen Daumen und Zeigefinger. Ich musste mich an der Flasche verletzt haben, ohne es zu merken. Das Blut war verschmiert und bereits getrocknet. Ich wischte es an meiner Hose ab und biss die Zähne zusammen, als ein scharfer Schmerz durch meine Hand zog.
Rasch warf ich einen Blick in den Flurspiegel, brachte meine Haare in Ordnung und kniff mir in die Wangen, um nicht mehr einem Gespenst zu ähneln. Ich sah ziemlich bleich aus und noch immer verschreckt, die einzigen Farbflecken waren meine Haare, meine Augen und die rosa Stellen, die sich nun unter meinen Wangenknochen ausbreiteten. Ich atmete zweimal tief ein und aus. Das musste genügen.
Belle saß in dem massiven Ohrensessel im Wohnzimmer und hielt einen Bildband auf dem Schoß. Es brannten mindestens zehn Kerzen. Nicht zum ersten Mal wunderte ich mich, wie viel wir gemeinsam hatten, obwohl wir lediglich Adoptivschwestern waren. Dafür hätten wir optisch nicht unterschiedlicher sein können: Belle wirkte mütterlich und beeindruckend zugleich mit ihren nussbraunen Haaren, den warmen, braunen Augen und weichen Gesichtszügen bei einer Größe von über ein Meter achtzig. Ich dagegen war ein gutes Stück kleiner als sie und rotblond, mit mehr Kanten als Rundungen an Kinn und Wangenknochen. Meine Augenfarbe changierte zwischen Grau und Grün. Mum hatte stets gesagt, dass Belle ein Herbsttyp war, während ich zum frühen, kühlen Frühling gehörte.
Meine Schwester hob den Kopf und lächelte. Ich sah aber auch Wachsamkeit, wie so oft, seitdem ich nach Nanaimo gezogen war. Sie hatte lange mit ihrer Partnerin zusammengelebt, bis Ria sie vor knapp einem Jahr wegen einer anderen verlassen hatte. Sosehr mir die Trennung für sie auch leidgetan hatte – obwohl sie behauptete, mittlerweile alles verarbeitet zu haben –, so froh war ich über die Möglichkeit gewesen, Rias altes Arbeitszimmer übernehmen zu können. Bei meiner Studienplatzsuche hatte Nanaimo schließlich ganz oben auf der Liste gestanden. Die Uni hatte einen guten Ruf, achtete auf überschaubare Teilnehmerzahlen in den Kursen, und ich mochte die hier auf Vancouver Island allgegenwärtige Kultur der First Nations, vor allem den Kunststil mit den traditionellen Motiven. Ich hatte in den vergangenen Jahren viel darüber gelesen und noch mehr gezeichnet. Die Darstellungen erinnerten mich an mein Tattoo mit den ineinander verschlungenen Formen. Mit etwas Glück würde ich in meinen Grafikdesignkursen mehr über die mythologischen Symbole lernen, die sich in vielen Kunstwerken der First Nations wiederfanden.
Zudem war Nanaimo weit genug weg von meinen Eltern und unserem Zuhause in Smithers, um als Neuanfang durchzugehen, und den brauchte ich dringend. Die Lebensunterhaltskosten waren deutlich geringer als in Vancouver oder Victoria – auch nicht zu verachten. Dass ich bei Belle wohnen konnte, trug seinen Teil dazu bei.
Allerdings merkte ich deutlich, dass meine große Schwester sich zu sehr um mich sorgte. Nicht, dass sie mir hinterhertelefonierte oder abends wartete, bis ich nach Hause kam – zum Glück! Aber ich las oft die Frage in ihrem Blick, ob sie alles richtig machte oder noch einen Gang hochdrehen sollte. Da brachten auch sämtliche Beteuerungen nichts, dass ich mit achtzehn Jahren alt genug war, um auf mich selbst aufzupassen. Wahrscheinlich forderte Mum hinter meinem Rücken regelmäßige Berichte von ihr. Es würde mich nicht wundern, schließlich hatte sie es in der Vergangenheit nicht immer leicht mit mir gehabt.
Ich ebenso wenig.
»War der Spaziergang schön?« Belle legte das Buch beiseite und griff nach der Tasse neben sich. Wahrscheinlich irgendein Kräutertee – sie sammelte und hortete das Zeug. Beim ersten Blick in ihre Küche hatte ich befürchtet, das Teeregal würde jeden Augenblick zusammenbrechen. Ich hatte keinen Schimmer, was sie an aromatisiertem Wasser fand. Mir zuliebe hatte sie sich eine Espressomaschine mit Milchaufschäumer gekauft.
Ich zuckte die Schultern und verbarg meine Hände hinter dem Rücken. »Es war ganz okay«, sagte ich und versuchte, dieses unheimliche Grollen aus dem Kopf zu bekommen.
Nachdem was auch immer verschwunden war, hatte ich eine Weile gewartet, um dann, so schnell ich konnte, loszurennen. Wenig später war ich aus dem Gassengewirr auf eine belebtere Straße und beinahe in die Arme eines Pärchens gestürzt, das mit Fingern und Lippen aneinanderklebte. Der Typ hatte mir irgendetwas Ätzendes hinterhergerufen, aber ich hätte ihn dennoch umarmen können. Einfach, weil er Teil einer Welt war, die ich kannte, einschätzen konnte und die mich nicht bedrohte.
»Richtig abschalten konnte ich aber trotzdem nicht.«
Dafür hätte ich mehr gebraucht als einen kurzen Spaziergang in der Stadt: Bäume, Wind, die Geräusche der Natur. Nur wenn ich im Wald unterwegs war, weit weg von Städten und allem, was damit zu tun hatte, kamen meine Gedanken wirklich zur Ruhe, als würden sie sich auf die Essenz des Lebens besinnen und sich mit dem verbinden, was bereits vor vielen Hundert Jahren da gewesen war.
Belle trank einen Schluck und verzog leicht das Gesicht. »Du kannst ja morgen nach der Uni in den Arrowsmith Park fahren, wenn du möchtest, ich brauche den Wagen nicht. Nur heute war es mir etwas zu spät dafür, Süße.«
»Ich wäre in einer knappen Stunde dort gewesen.«
»Ja, im Dunkeln! Das vergiss ganz schnell mal, ich werde dich wohl kaum in der Nacht durch den Wald rennen lassen.« Belle lachte, stand auf und strich ihr Kleid glatt. Es schimmerte für mich irgendwo zwischen Türkis und Grau, genauer konnte ich es nicht sagen. Wahrscheinlich war es mitternachtsblau, eine der Lieblingsfarben meiner Schwester, aber das würde ich wohl nur herausfinden, wenn ich sie fragte.
Ich litt unter Tritanomalie, Blausehschwäche, wobei der Begriff leiden für mich nicht ganz passte. Immerhin bereitete es mir weder Schmerzen noch größere Probleme. Zumindest noch nicht. Manche Berufe waren für mich ein No-Go – ich würde nie in einem Chemielabor oder bei der Polizei arbeiten können –, und ich war gespannt, wie es sich im Studium niederschlagen würde. In den Kunstkursen an der Schule hatte ich bisher schlicht andere Schwerpunkte gewählt. Mich auf Formen statt Farben konzentriert. Wahrscheinlich war ich verrückt, ausgerechnet Grafikdesign studieren zu wollen. Oder auch ein klitzeklein wenig trotzig. Aber wer sagte, dass man gleich die Verbotskarte ziehen musste, nur weil die Photorezeptoren für das Blausehen auf der Netzhaut nicht richtig ausgebildet waren? Ich würde das Studium schon schaffen. Zudem hoffte ich insgeheim, dass mein neues Leben mich genug fordern würde, um die Probleme meines alten zu vergessen.
Ich riss meine Gedanken zurück in die Gegenwart. Was hatte Belle gesagt – sie würde mich nicht im Dunkeln durch den Wald rennen lassen? Ich entschied, das zu ignorieren. Schließlich hatte ich nicht vor, mich bei Einbruch der Dunkelheit stets im Haus aufzuhalten.
»Dann gehe ich mal hoch«, sagte ich und drehte mich um.
»Quinn.« Allein mein Name klang wie eine Entschuldigung, und als ich mich wieder umwandte, blickte ich in Belles zerknirschtes Gesicht. »Tut mir leid, wenn ich es übertreibe. Gib mir noch eine Chance, okay? Am besten gleich ein Dutzend. Ich bin es nicht gewohnt, meine kleine Schwester bei mir zu haben, wir haben uns in den letzten Jahren so selten gesehen.«
Wie konnte ich ihr da böse sein? »Schon okay. Mach dir einfach nur eine gedankliche Notiz, dass ich zwar hier wohne, du aber nicht auf mich aufpassen musst. Vielleicht kannst du mich als WG-Partnerin sehen? Ich bin in den vergangenen Jahren gewachsen und achtzehn geworden.« Meine Handbewegung umfasste meine stattlichen ein Meter fünfundsechzig.
Sie lachte und winkte mich zu sich. »Das habe ich gemerkt. Na komm schon her.«
Ich ließ mich in ihre Umarmung ziehen und erlaubte mir, für ein paar Sekunden die Augen zu schließen. Es fühlte sich ungewohnt an, aber gleichzeitig auch schön. Seit Monaten – oder waren es schon Jahre? – wagte ich es nicht, die Kontrolle komplett abzugeben und mich auch mal fallen zu lassen. Diese seltsame Sehnsucht, die tief in mir nagte und die ich mir nicht erklären konnte, war schon schlimm genug. Aber die Bilder, die immer wieder durch meinen Kopf schossen, machten mich unruhig, denn ich wusste nicht, woher sie stammten. Ich sah Orte, an denen ich noch nie gewesen war, und hatte schon überlegt, zu einem Arzt zu gehen, da ich Angst hatte, verrückt zu werden. Doch ich hatte es immer wieder aufgeschoben, und jetzt gab es mit meinem Umzug von Smithers nach Nanaimo und dem Start des Semesters am Montag genug zu tun.
Belle seufzte leise, drückte mich noch einen Hauch fester und ließ mich wieder los. »Also«, sagte sie und strich meine Haare glatt. »Bereit für deinen ersten Tag an der Uni?«
»Ich denke schon. Morgen steht ja noch nicht viel an. Ich sehe mich ein wenig auf dem Campus um und habe das Vorstellungsgespräch bei Ms Weller.«
»Ich bin sicher, du bekommst den Job. Zumindest drück ich dir beide Daumen! Warum sollte sie dich auch nicht nehmen? Du bist bestimmt die perfekte studentische Hilfskraft.«
Belle mit ihrem unerschütterlichen Optimismus.
»Wir werden sehen. Bis morgen, Sis.«
»Schlaf gut, Süße. Und falls wir uns in der Früh nicht mehr sehen sollten: Viel Glück!«
»Danke.« Ich zwinkerte ihr zu und machte mich auf den Weg nach oben.
Belle wohnte in einer Haushälfte, die zwar klein war, aber durch die Aufteilung in zwei Etagen genug Platz bot, um sich auch mal aus dem Weg zu gehen. Wenn ich in meinem Zimmer Musik hörte, verzog sie sich manchmal in die Küche, und wenn sie zu schräg unter der Dusche sang, schnappte ich mir meine Zeichenutensilien und machte es mir im Wohnzimmer bequem. Für ihren Job als selbstständige Gartenplanerin zog sie sich oft zurück, um sich in Ruhe ihren Entwürfen zu widmen und Pflanzenkataloge durchzublättern, oder sie war zu Kunden unterwegs. Die perfekte Mitbewohnerin.
Im Obergeschoss befand sich neben meinem nur Belles Zimmer und das kleine Bad. Ich öffnete die Tür am Ende des Flurs und betrat ein Reich, das ich noch nicht wirklich als meins bezeichnete. Bisher hatte ich weder Zeit noch Lust gehabt, mich mit der Einrichtung zu befassen, sodass sich die persönliche Note auf meine Koffer, einen Stapel Klamotten auf dem Sessel in der Ecke und meine Zeichenkiste beschränkte, die aufgeklappt neben dem Bett stand. Mein Block lag mit einer Handvoll Bleistiften auf dem Kopfkissen. Irgendwann würden die Geräusche im Haus und von der Straße Alltag werden. Wie in Smithers würde ich mit geschlossenen Augen durch diese vier Wände laufen können, ohne irgendwo anzustoßen.
Ich legte meine Tasche ab, ließ mich auf das Bett fallen und schnappte mir den Block. Eigentlich hatte ich geplant, alles für morgen noch einmal durchzugehen, aber da ich schon auf meinen Spaziergang im Wald hatte verzichten müssen, wollte ich lieber zeichnen. Mich durch den Anblick der Muster und Symbole mit meinem neuen Leben in Einklang bringen.
Ich betrachtete die Motive, an denen ich in der vergangenen Woche gearbeitet hatte: verschlungene Linien, halb ausschraffierte Flächen, Formen, die entfernt an Blumen oder Tierköpfe erinnerten. Im Laufe der Jahre hatte ich immer mehr Stile miteinander verbunden, bis sich mein eigener ergeben hatte.
Mit der freien Hand tastete ich über meinen Nacken. Die Haut war glatt, aber ich wusste genau, wo die Farbe verlief, wo sich dunkle Flächen oder Linien befanden. Mein Tattoo hätte ich jederzeit mit geschlossenen Augen zeichnen können – zwei mit Ornamenten und weichen, geometrischen Formen ausgeschmückte Hälften, die an einer Seite abgerundet waren, an der anderen spitz zuliefen und sich spiegelverkehrt gegenüberlagen. Ähnlich wie das Yin-und-Yang-Zeichen. Im oberen Teil waren tropfenartige Formen zu sehen, die ähnlich einer Blüte angeordnet waren, sowie drei gebogene, parallel verlaufende Linien, die mich an eine Kralle erinnerten. Im unteren Bereich fassten Ovale und weitere Tropfenformen dunkle Linien und Spitzen ein. An beiden Enden wurden je drei Punkte zwischen den Hälften eingeschlossen. Ich mochte das Motiv, obwohl ich es nicht selbst ausgesucht hatte. Es war bereits auf meiner Haut gewesen, als man mich als Fünfjährige vor dem SOS Kinderdorf in Vancouver ausgesetzt hatte. Bis heute fragte ich mich, wer auf die Idee kam, ein kleines Kind tätowieren zu lassen.
Energisch lenkte ich meine Gedanken in die Gegenwart zurück. Mir stand ein Neuanfang bevor, und ich hatte ihn selbst gewählt. Aber tief in meinem Inneren spürte ich, dass ich nur neu beginnen konnte, wenn ich wusste, woher ich kam. Vermutlich zweifelte ich deshalb so sehr daran, dass es mir gelang.
Kapitel 2
QUINN
Obwohl das Semester erst in drei Tagen begann, hallten die Gänge der Vancouver Island University wider vor Stimmen, Schritten und zuschlagenden Türen. Ich verlagerte mein Gewicht auf dem Plastikstuhl, versuchte, eine halbwegs bequeme Position zu finden, und starrte auf die Tür, hinter der ich vor wenigen Minuten gesessen und mich vorgestellt hatte. Als könnte ich sie beschwören, sich wieder zu öffnen. Irgendwo kreischte ein Mädchen und verstummte, als tiefes Gelächter einsetzte. Sicherlich ein Pärchen oder zumindest zwei Menschen, die sich voneinander angezogen fühlten und kräftig flirteten.
Mein Blick wanderte über das helle Holz der Wand bis zur Decke, wo ein dunkler Fleck schimmerte. Ich hatte geglaubt, mich in Ruhe umsehen zu können, wenn ich mich heute bei Ms Weller als studentische Hilfskraft an der Fakultät für Design und darstellende Kunst vorstellte. Doch ich hatte mich gründlich verschätzt. Schon bei meiner Ankunft war ich einigen Studenten begegnet, aber während ich im Büro ein lockeres Gespräch geführt und bereits nach kurzer Zeit nicht mehr nervös gewesen war, hatte sich die Anzahl mindestens verdreifacht. Kaum hatte ich den Raum verlassen, war die nächste Studentin eingetreten. Ich hoffte, dass die Konkurrenz nicht allzu groß war. Ich brauchte einen Job, und ich wollte diesen. Was konnte mir Besseres passieren, als Arbeit und Studium zu verbinden?
Die Anzeige hatte ich entdeckt und meine Bewerbung eingereicht, noch ehe ich in Nanaimo angekommen war. Die Sache wäre doppelt perfekt, da Ms Weller auch den Einsteigerkurs für die Berufspraxis hielt, in dem es um den Designprozess und kreatives Denken ging. Mein erster Eindruck von ihr war gut – sie war noch recht jung und offen für Ideen und Diskussionen. Wir hatten uns über meine Zeichnungen unterhalten, und ich hatte ihr sogar von meiner Tritanomalie erzählt. Sie war weder besonders erstaunt gewesen, noch hatte sie skeptisch reagiert, weil ich dennoch Grafikdesign studieren wollte. Vielmehr hatte sie interessiert gewirkt, sodass ich mich mit jeder Minute wohler fühlte in ihrem winzigen Büro, das überquoll von Skizzen und Schwarz-Weiß-Drucken.
Ich war eine der letzten Bewerberinnen, und sie hatte mir vorgeschlagen, einfach im Anschluss zu warten. »Es bringt mir nichts, wenn ich lange nachgrübele. Die besten Entscheidungen treffe ich immer spontan.«
Also hockte ich hier und dachte darüber nach, wie sehr ich mit Ms Weller übereinstimmte. Ich mochte es ebenso wenig, Entscheidungen zu lange mit mir herumzuschleppen. Das sorgte lediglich dafür, dass sich die Gedanken immer wieder darum drehten und man sich irgendwann selbst in den Wahnsinn trieb.
»Wartest du auf M. Weller?«
Ich hob den Kopf und betrachtete den Jungen, der sich so schwungvoll auf dem Stuhl neben mir niederließ, dass er gegen meinen stieß. Er lächelte mich an. Vielleicht als Entschuldigung für die Rempelei, vielleicht war er aber auch einfach nur gut gelaunt. Er schien vor Energie zu vibrieren und trug ein weißes Shirt mit dem Aufdruck Music is liquid Architecture. Architecture is frozen Music.
Ich sah zur Tür, dann wieder zu ihm. »M. Weller?«
»Ja, das hat sich so eingespielt. Sie hat sich im letzten Semester beschwert, dass sie sich alt fühlt, wenn man sie Miss nennt, also haben wir es abgekürzt. Ihr zuliebe.«
Etwas flackerte in seinen Augen auf und machte es fast unmöglich, sich von seiner guten Laune nicht anstecken zu lassen. Es waren interessante Augen, braun mit einem Goldschimmer, der sich aber stets nur für den Bruchteil einer Sekunde zeigte, als ob jemand ein winziges Feuer entzündet hätte. Die Brauen darüber waren ebenso dunkel und dicht wie sein Haar.
»Hast du dich für den Job bei ihr beworben?«
Ich nickte, während mein Hirn seine Frage analysierte und ich begriff, dass meine Chancen soeben schwanden. Natürlich saß er nicht hier, weil er einfach nur mit mir plaudern wollte. Das bedeutete, er war ebenso scharf auf den Job wie ich, und er kannte M. schon mindestens ein Semester lang. Wenn sie ihn mochte, lag es nahe, dass sie ihn vorzog. Schließlich war der Mensch ein Gewohnheitstier, das galt sicher auch bei der Auswahl einer studentischen Hilfskraft.
Ich räusperte mich. »Ja. Ich bin im Internet darüber gestolpert und der Job klingt … ideal.«
»Fängst du gerade an? Erstes Semester?«
Er schaffte es, mich von oben bis unten zu mustern, ohne mir das Gefühl zu geben, dass ich gerade bewertet oder in eine Schublade gesteckt wurde. Ich strich mir das Haar zurück. Wie so oft, wenn ich es mit einer neuen Situation oder Umgebung zu tun hatte, trug ich es offen. Zwar sah man das Tattoo auch dann nicht, wenn ich mir einen Zopf band, aber so fühlte ich mich sicherer und lief nicht in Gefahr, neugierige Fragen beantworten zu müssen.
Ich nickte. »Ab übermorgen, ja.«
»Welcher Studiengang?«
Die Frage überraschte mich. »Grafikdesign. Ich dachte, das wäre klar?« Ich deutete zur Tür. Schließlich bewarben wir uns auf dieselbe HiWi-Stelle, was demnach bedeuten musste, dass wir auch das Gleiche studierten.
»Fast. M. Weller hält Einführungskurse in Kunst- und Designgeschichte, da sitzen Leute aus mehreren Fachrichtungen. Ich komme beispielsweise aus der Architektur.«
»Oh, ja klar.« So weit hatte ich gar nicht gedacht.
»Na dann, herzlich willkommen. Ich bin Nathan.« Er streckte mir eine Hand entgegen und grinste. »Das kommt gerade förmlicher rüber, als es soll.«
»Ist schon okay«, sagte ich, erwiderte sein Grinsen und ergriff seine Hand. Seine Finger waren warm, aber der Herbst beschenkte einen großen Teil von British Columbia auch mit Sommertemperaturen. »Ich heiße Quinn.«
Sein Händedruck war fest, aber nicht von der Machosorte, bei der Jungs beweisen wollten, was in ihnen steckt. Ich betrachtete den Kontrast meiner Haut zu seiner deutlich dunkleren, dann ließ er mich auch schon wieder los.
»Nur neu an der Uni oder neu in Nanaimo?« Er lehnte sich zurück, blickte von mir zur Tür und wirkte interessiert, aber nicht übermäßig neugierig. Trotzdem fühlte ich mich ertappt. Was Unsinn war, schließlich konnte Nathan mir nicht an der Nasenspitze ansehen, dass ich erst seit einigen Tagen hier lebte.
»Wie kommst du darauf?«
Schulterzucken. »Viele ziehen wegen des Studiums her.«
»Erwischt. Ich habe bis vor Kurzem in Smithers gelebt.«
Jetzt runzelte er die Stirn. »Ich glaube, da war ich irgendwann mal für einen Zwischenstopp, aber ich erinnere mich nicht an die Stadt.«
Kein Wunder, über mein altes Zuhause im Tal des Bulkley River gab es auch nicht allzu viel zu erzählen. Eine typische kanadische Kleinstadt mit allen Läden, die man benötigte, aber keinen besonderen Attraktionen.
»Es ist hübsch dort«, sagte ich möglichst neutral.
Wenn ich ehrlich war, hatte ich Smithers als Kind geliebt, und von unserem Haus aus war man in Sekundenschnelle im Grünen. Es war erst vor einigen Jahren problematisch geworden, als zunächst meine Stimmungsschwankungen und dann die Visionen begonnen hatten. Die mieseste Zeit meines Lebens. Nach und nach verscherzte ich es mir mit fast all meinen Freunden, weil ich so oft wegen Banalitäten sauer oder aggressiv wurde. Es war, als würden plötzlich sämtliche Hormone in meinem Körper durchdrehen. Anfangs tolerierten die anderen meine Aussetzer noch, irgendwann wurden sie unsicher, und nach dem fünften oder sechsten Mal hatten sie keine Lust mehr, sich das länger anzutun. Ich konnte sie verstehen und zog mich immer mehr zurück. Sogar von Mum und Dad, als schließlich die Visionen einsetzten – Bilder von Wäldern oder in irrer Geschwindigkeit vorbeiziehenden Bäumen, die urplötzlich in meinem Kopf auftauchten und mich seltsam unruhig machten. Sie wirkten so … echt. Immerhin nahmen die Wutausbrüche ab, je häufiger die Visionen auftraten. Zum Glück hatte ich irgendwann so viel mit den Abschlussprüfungen und der Studienplatzsuche zu tun, dass mir keine Zeit blieb, weiter darüber nachzudenken. Zudem hatte mein Plan, durch ein Studium in einer anderen Stadt ein wenig mehr auf eigenen Füßen zu stehen, plötzlich einen weiteren Pluspunkt erhalten: Ich konnte einen Neuanfang wagen.
Ich schob die Erinnerungen beiseite und lächelte Nathan an. »In Smithers gibt es einen Skiberg und ein cooles Freeride-Gebiet.«
Er wollte etwas erwidern, doch in diesem Moment öffnete sich die Tür vor uns. Ms Weller trat heraus und schien überrascht, dass ich nicht mehr allein wartete. Das Mädchen, das zuletzt hineingegangen war, trat an ihr vorbei, nickte uns knapp zu und verschwand dann zwischen den anderen Studenten. Allzu glücklich hatte es nicht ausgesehen.
»Nathan«, sagte Ms Weller und sah von mir zu ihm. »Kann ich etwas für dich tun?«
Er warf mir einen Seitenblick zu, und auf einmal wirkte er nicht mehr ganz so fröhlich – als täte es ihm leid, dass er auch hier saß. »Ich weiß, ich habe gesagt, dass es in diesem Semester zeitlich für mich eng wird. Aber ich bin noch einmal durch meine Kursliste gegangen und …« Er hob die Arme und ließ sie wieder fallen. »Nun, wenn es nicht zu spät ist, wollte ich mich doch noch bewerben.«
Ms Weller zog die Brauen hoch. Ich sah förmlich, wie es hinter ihrer Stirn arbeitete.
»Das kommt nun etwas unerwartet.«
»Tut mir leid. Ich verstehe völlig, wenn ich einfach zu spät dran bin.«
Sie rieb sich die Nasenwurzel mit Daumen und Zeigefinger, dann nickte sie. »Spät schon, aber ich bin trotzdem froh, dass du es dir noch einmal überlegt hast. Es ist einfach die beste Lösung.« Sie sah mich an und lächelte. »Quinn, ich habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Aber unter diesen Umständen entscheide ich mich für Nathan. Er hat schon im vergangenen Semester für mich gearbeitet, und bei den Massen an Unterlagen«, sie deutete über ihre Schulter in Richtung ihres Büros, »spare ich mir viel Arbeit, wenn ich niemanden einlernen muss. Das hat also nichts mit dir zu tun, im Gegenteil, du hast mich im Gespräch sehr überzeugt. Danke für deine Zeit und dein Interesse. Wir sehen uns ja am Montag.«
Wow, sie hatte wirklich nicht übertrieben, als sie sagte, sie würde sich spontan entscheiden!
Ich versuchte, mir die Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. »Danke für die Chance«, sagte ich und stand auf, um Ms Weller die Hand zu reichen. Ich brachte es sogar fertig, locker und völlig normal zu klingen.
Natürlich war es utopisch, sofort den ersten Job zu bekommen, für den ich mich bewarb, nur hatte am Telefon und vorhin im Gespräch alles so vielversprechend geklungen. Meine Mappe hatte Eindruck gemacht, die Fakultät war nur klein, und Ms Weller schien wirklich in Ordnung zu sein.
Sie wandte sich an Nathan. »Dich erwarte ich dann morgen um drei.«
»Geht klar«, sagte er und schüttelte ihr ebenfalls die Hand. Nachdem sie wieder in ihrem Büro verschwunden war, sah er mich entschuldigend an.
Ich nickte ihm zu. Erst jetzt fiel mir auf, wie groß er war. Er überragte mich um mindestens einen Kopf.
»Glückwunsch! Wir laufen uns wahrscheinlich irgendwann wieder über den Weg.« Damit drehte ich mich um.
Welcher Gang führte noch mal nach draußen?
»Hey, warte kurz!« Nathan tauchte neben mir auf und passte sich meinem Tempo an. »Tut mir leid, dass ich dir den Job weggeschnappt habe.« Schuldbewusst fuhr er sich durch die Haare, die daraufhin wirr von seinem Kopf abstanden.
»Schon okay.«
»Kann ich dich dennoch als Entschädigung zu einem Kaffee einladen? Oder etwas anderem? Ich will nicht, dass du deinen ersten Besuch an der Vancouver Island als totalen Reinfall wertest.«
Was bei anderen vielleicht einen Hauch zu selbstbewusst rübergekommen wäre, klang bei ihm völlig locker. Ich hatte den Mund bereits geöffnet, um höflich abzulehnen, aber etwas hielt mich zurück. Vielleicht weil er so ehrlich wirkte oder weil ich nicht wusste, was ich sonst mit dem Tag anfangen wollte. Vielleicht ahnte ich aber auch, dass es nichts brachte, wenn ich mich hier ebenso zurückzog wie in Smithers.
»Okay, warum nicht. Es kann ja nicht schaden, zu wissen, wo es hier guten Kaffee gibt.«
»Super.« Er deutete nach links, und wir bogen in den entsprechenden Gang ab. »In der Nähe des Campus ist ein großartiges Café, wir laufen höchstens zehn Minuten. Oder kennst du das Nez vielleicht schon?«
»Nein.« Ich schüttelte den Kopf. »Ich kenne nur zwei Cafés in der Stadt, und die liegen in Brechin Hill.«
»Wohnst du da?«
Ich nickte. Es gab kaum Läden oder Orte in Nanaimo, die ich bereits kannte, ganz zu schweigen vom Rest von Vancouver Island – und es gab eine Menge zu entdecken bei vierhundertfünfzig Kilometern von der Nord- bis zur Südspitze. Mein Sightseeing mit Belle als Fremdenführerin hatte sich auf den Supermarkt und die nächstgelegene Tankstelle beschränkt. Alles Weitere musste warten, da sie bis vorgestern für einen wichtigen Auftrag gearbeitet und ich mich auf den Semesterstart vorbereitet hatte. Und auf den Job, den ich nun doch nicht bekommen hatte. Aber ich freute mich auf das Wochenende, an dem wir gemeinsam zum Hafen fahren wollten.
Nathan hob eine Augenbraue. »Nur zwei? Das müssen wir dringend ändern.«
»Copeland!«
Der Ruf, vielmehr das Gebrüll, kam vom anderen Ende des Gangs. Zuerst achtete ich nicht weiter darauf, merkte dann aber, dass sich mehrere Studenten zu uns umdrehten und Nathan musterten. Der runzelte die Stirn und murmelte etwas. Ich hätte schwören können, dass er vor sich hin fluchte.
Wie von Zauberhand lockerte sich das Menschengewirr in der Mitte des Flurs und gab den Blick auf einen großen, blonden Kerl frei. Er stand aufrecht und doch angespannt da wie ein Sportler, der auf das Signal wartete, das ihn in den Wettkampf schickte. Auf seinem Gesicht spiegelte sich etwas, das ich zunächst für Spott hielt, aber dann erkannte ich die Herausforderung dahinter. Wer auch immer der Typ war, er hatte nichts, aber auch gar nichts für meinen Begleiter übrig.
Nathan rührte sich nicht. Er wirkte längst nicht mehr so locker und gut gelaunt wie zuvor. Die Wärme in seinen Augen war einem harten Blick gewichen. Die Luft heizte sich in einer unangenehmen Weise auf, die früher oder später zu einer Explosion führen musste.
Der Blonde setzte sich in Bewegung, und er war nicht allein. Ich hatte zuerst gedacht, dass die drei Typen neben ihm zufällig stehen geblieben waren, möglicherweise ebenso erstaunt wie ich über den scharfen Tonfall. Jetzt folgten sie ihm. Es war ein Bild wie aus einem Film: der hochgewachsene Blonde, der seine Gefolgschaft von der Highschool mit an die Uni genommen hatte und hier noch immer den Ton angab. Oder es zumindest glaubte.
Sie blieben eine Armlänge vor uns stehen und musterten erst Nathan verächtlich, dann mich von oben bis unten. Es fühlte sich an, als wäre ich zwischen die Fronten eines Krieges geraten.
»Blaise«, sagte Nathan. Waswillstdu musste er nicht mehr nachschieben, sein Tonfall verriet genug. Er überragte sein Gegenüber um zwei, drei Zentimeter, aber seine Gelassenheit ließ den Unterschied noch größer wirken.
Der Blonde hob einen Mundwinkel. Jetzt sah er nicht nur drohend aus, sondern auch spöttisch. Er und Nathan starrten sich an, als gäbe es den Rest – die anderen Studenten, die Umgebung, mich – nicht mehr. Die Luft zwischen ihnen schien sich aufzuladen, und ich wusste nicht, ob ich loslachen sollte. Das hier war absurd, weil es so ein Klischee war, aber trotzdem war nicht zu übersehen, dass beide den anderen abgrundtief hassten und es vollkommen ernst meinten.
Nathan hob die Arme und ließ sie wieder fallen. Allein diese Bewegung sorgte dafür, dass einer von Blaises Buddys sich anspannte. Die Muskeln seiner nackten Oberarme bewegten sich deutlich.
»War es das?«, schob Nathan hinterher. »Wolltest du mich nur begrüßen, oder gibt’s noch was anderes?«
Ich sah mich um. Einige Studenten beobachteten unsere kleine Gruppe, und ich trat einen Schritt zurück. Das hier musste ich mir nicht antun. Ich gehörte nicht dazu, war nicht Teil dieses Streits, also musste ich auch meine Zeit nicht damit verschwenden.
Der Typ namens Blaise wurde auf mich aufmerksam und sah mich so eindringlich an, dass ich widerwillig stehen blieb. Etwas huschte über sein Gesicht. Erstaunen? Er musterte mich eingehender, als hätte er mich hier nicht erwartet, dabei kannte er mich gar nicht.
»Schlaues Mädchen. Du solltest nicht mit Copeland oder seinen … Leuten abhängen.«
Mich ärgerte sein Kommentar. Dieser Kerl hatte mir garantiert nicht zu sagen, mit wem ich abhängen sollte.
Nathan schüttelte leicht den Kopf. »Sorry«, murmelte er mir zu. »So war das nicht geplant.«
»Ich denke, ich gehe besser«, antwortete ich, sah aber dabei den Blonden an, der ein unnatürlich breites Lächeln aufgesetzt hatte. Seine Zahnreihen waren so weiß und ebenmäßig, dass er gut in eine Vorabendserie gepasst hätte.
»Schade, aber ich verstehe dich. Ich weiß, es ist schwer, sich Freunde zu suchen, wenn man irgendwo neu ist, aber deine erste Wahl war einfach die falsche.« Er deutete auf Nathan.
»Das kann ich ganz gut selbst beurteilen.« Ich verzichtete darauf, ihm zu sagen, dass sein offenbarer Erzfeind und ich keineswegs Freunde waren, sondern uns gerade erst kennengelernt hatten, und ging an der kleinen Gruppe vorbei. »Bis dann mal, Nathan.«
»Tut mir leid. Wir holen das mit dem Kaffee nach, versprochen.«
Seine ruhige Stimme stand in starkem Gegensatz zu seiner angespannten Körperhaltung. Er hatte sogar die Hände zu Fäusten geballt, und eine Sekunde lang glaubte ich, dass die beiden aufeinander losgehen würden, kaum dass ich ihnen den Rücken zuwandte.
»Schon okay«, sagte ich und machte, dass ich wegkam. Ich wollte nichts mit irgendwelchen Territoriumskämpfen zu tun haben, die vor meiner Zeit hier begonnen hatten.
In der Eile stieß ich jemanden mit der Schulter an und murmelte eine Entschuldigung. Er beachtete mich jedoch nicht weiter und lief auf die Gruppe zu. Als ich mich umdrehte, sah ich, dass auch Nathan Verstärkung bekommen hatte: Rechts von ihm stand der Typ, mit dem ich zusammengestoßen war, links ein weiterer. Beide waren ebenso groß wie Nathan.
Ich schob mich zwischen einigen Studentinnen hindurch, die das Ganze aus sicherer Entfernung beobachteten und sich gegenseitig etwas ins Ohr flüsterten. Endlich sah ich den Ausgang und hielt darauf zu. Als ich draußen war und mir die Sonne ins Gesicht schien, blieb ich stehen. Was war das gerade gewesen? Der traditionelle Krieg zweier … ja was, rivalisierender Gangs? Ich beschloss, mir nicht weiter den Kopf darüber zu zerbrechen, immerhin hatte ich genügend andere Probleme – unter anderem die Suche nach einem Nebenjob. Aber jetzt wollte ich erst mal in den Arrowsmith Park, meine Sportklamotten lagen im Auto. Mit einem Seufzen machte ich mich auf den Weg zum Parkplatz, wo Belles Klapperkiste auf mich wartete.
Die Sonne tupfte Flecken auf die Blätter und Baumstämme und ließ das an mir vorbeiziehende Grün und Braun im Augenwinkel flirren. Ich lief ruhig und gleichmäßig, der Waldboden federte unter meinen Sportschuhen. Die Stimmen der anderen Besucher hatte ich bereits vor einigen Minuten hinter mir gelassen, als ich von dem gut ausgebauten auf einen schmalen Pfad gewechselt war, der irgendwo in der Wildnis vor mir verschwand. Hier war niemand außer mir, den Bäumen, hin und wieder einem Schmetterling und dem Geruch nach feuchter Erde.
Der Mount Arrowsmith National Park lag ungefähr eine Stunde vom Campus entfernt etwas weiter im Landesinneren. Ich mochte, dass es hier keine Cafés, plötzlichen Riesenspielplätze oder Museen gab – oder was man heutzutage noch so in Wandergebieten fand. Wer hierherkam, der wollte laufen, klettern oder im Winter Ski fahren. Mitten in dem ganzen Grün erhob sich der Mount Arrowsmith knapp zweitausend Meter in die Höhe. Belle hatte mir erzählt, dass die Ureinwohner der Gegend ihn Kuth-Kah-Chulth nannten, was angeblich so viel bedeutete wie »scharfes, spitzes Gesicht«. Ich hatte ihn von Weitem gesehen, aber nichts Scharfes entdeckt. Im Gegenteil, mit seinen schneebedeckten Höhenzügen wirkte er eher weich und kuschelig.
Ich sprang über eine Baumwurzel und blieb an einer Gabelung stehen. Der Weg sah in beide Richtungen gleich aus, also bog ich nach links ab, da ich glaubte, mich so weiter vom Parkplatz zu entfernen. Ich hatte wenig Lust, einen Bogen zu schlagen und meine Runde demnächst schon zu beenden. Mein Körper verlangte nach Bewegung, und wenn ich ehrlich war, tat die meinen Gedanken ganz gut.
Im Nachhinein war ich doch etwas sauer, dass Nathan mir den Job an der Uni im letzten Augenblick weggeschnappt hatte. Und dann war ich seinetwegen auch noch mitten in einen Streit geraten, der mich nichts anging und den ich so albern fand, dass ich ganz sicher nichts damit zu tun haben wollte. Alles in allem war der Tag also reichlich mies gelaufen. Die Haut auf meinem Rücken und im Nacken kribbelte, und ein Gefühl stieg in mir auf, das ich mittlerweile nur allzu gut kannte. Gewöhnen würde ich mich allerdings nie daran. Ich biss die Zähne zusammen, lief schneller und bog erneut ab. Dabei nahm ich die Kurve zu eng, und ein Ast schabte über meinen nackten Arm. Es tat weh.
»Verdammter Mist!« Meine Stimme schnitt durch die feuchtwarme Luft und scheuchte irgendeinen Vogel auf. Blödes Vieh! Ich riss im Lauf einen dünnen Ast ab und zerbrach ihn zwischen den Fingern. Die Stücke schleuderte ich in das Moos zu meiner Linken und erwartete beinahe, einen weiteren Vogel auffliegen zu sehen. Mein Blut pulsierte durch meine Adern, und ich hätte am liebsten geschrien, weil ich auf einmal so unglaublich wütend war.
Okay Quinn, stopp!
Ich blieb stehen, beugte mich vor und stützte beide Hände auf meine Knie. Mein Atem ging schnell, aber das kam nicht vom Laufen, sondern von der Wut, durch die ich gerade beinahe die Kontrolle über mich verloren hätte. Das war nicht normal. Diese Attacken überfielen mich nie, wenn ich im Wald war. Im Gegenteil, sobald ich unruhig wurde und diese Anspannung in mir wuchs, war ich rausgefahren. Allein und von der Natur umgeben hatte ich mich stets beruhigen können.
Wenn meine Gefühle so Amok liefen, kündigten sie in den meisten Fällen einen kurzen Schwindelanfall, ein Kribbeln auf der Haut und seit einigen Monaten diese … Bilder an. Fast so, als würde jemand sie in meinen Kopf projizieren, während mein Körper sich dagegen wehrte. Immer öfter blieben die Wutanfälle jedoch aus, und die Bilder kamen ohne große Vorwarnung, als hätte ich die nächste Stufe einer seltsamen Krankheit erreicht. Und jetzt half es mir nicht einmal mehr, mich im Wald zu verausgaben.
Was also hatte sich verändert?
Ich konzentrierte mich, zählte bis fünf – einatmen –, dann bis drei – Luft anhalten – und dann noch einmal bis fünf – ausatmen. Nach einer Weile wurde ich ruhiger. Schließlich lockerte ich meine Schultern und sah mich um, da setzte der Schwindel ein. Ich tastete nach einem Baumstamm, lehnte mich dagegen, schloss die Augen und versuchte, alles an mir vorüberziehen zu lassen. Die Bilder ließen nicht lange auf sich warten. Es waren nur wenige, und wie immer konnte ich nichts deutlich erkennen. Das lag nicht daran, dass sie verschwommen waren, sondern weil die Umgebung unglaublich schnell an mir vorbeizog. Mit einer solchen Geschwindigkeit würde ich niemals laufen können, und wenn ich noch so viel trainierte. Aber ich sah einen Wald, ähnlich wie diesen. Im Grunde hätte es sogar der Arrowsmith Park sein können, auch wenn ich in der Ferne einen hellen Schimmer zu sehen glaubte. Meine Schläfen schmerzten verhalten, dann war es auch schon vorbei. Ich wartete noch eine Weile, bevor ich die Augen öffnete, und starrte in das raschelnde, grüne Dach über mir.
Die letzte Attacke – ich weigerte mich, es Anfall zu nennen, da mich das an eine Krankheit erinnerte, während man sich gegen eine Attacke zumindest wehren konnte – hatte ich in Smithers erlebt.
Es hatte vor knapp vier Jahren angefangen. Damals waren die Attacken nur selten aufgetreten, höchstens alle paar Monate einmal, doch im vergangenen Jahr hatten sie sich gehäuft. Zuerst hatte ich damit nicht umgehen können und verbal um mich gebissen, wenn jemand in der Nähe gewesen war. Wenn ich jetzt daran zurückdachte, wie oft ich Mum Dinge an den Kopf geworfen hatte, für die ich mich noch immer schämte … nein, es war auch für sie gut, dass ich hier war, mit genügend Abstand zwischen uns. Ich hatte gehofft, dass sich die Attacken legen würden, wenn ich mich auf die Uni konzentrieren musste. Wenn alles anders war.
Falsch gedacht. Sogar ganz falsch, denn anstatt meine Batterien für die kommenden Tage aufzuladen, waren sie nun vollkommen leer. Bedeutete das, die Attacken wurden wieder schlimmer?
Ich strich ein paar Haarsträhnen zurück und spürte den Schweiß auf meiner Stirn. Besser, ich ging zurück zum Wagen, fuhr nach Hause und nahm ein langes, heißes Bad. Zwischen Schaum und mit einem Cappuccino und Schokokeksen konnte ich immer noch entscheiden, ob ich das alles einem Arzt erzählen sollte.
Kapitel 3
NATHAN
»Ich wusste nicht, dass die Uni heutzutage so gefährlich ist.«
Überrascht drehte ich mich um und starrte M. Weller an. Sie war vor wenigen Minuten angekommen und hatte seitdem in den Unterlagenstapeln gewühlt, die den hinteren Teil des Büros überfluteten. Jetzt trat sie neben mich und deutete auf meinen Unterarm.
»Ach das.« Ich musterte die Schramme, die sich von meiner Armbeuge bis fast zum Handgelenk zog. Rui und ich waren gestern spätabends im Wald unterwegs gewesen und hatten es bei einem Wettrennen ein wenig übertrieben. Der Riss hatte höllisch geblutet, heilte aber wie immer extrem schnell ab.
»Das ist nichts. Ich war nur mit Freunden unterwegs.«
M. seufzte. »Wenn das deine Freunde waren, möchte ich nicht wissen, wer deine Feinde sind, Nathan.«
Das war an der Vancouver Island vermutlich kein Geheimnis, aber ich entschied, besser das Thema zu wechseln, und deutete auf den Monitor. »Die Power Point ist fertig. Wollen Sie noch einen Blick darauf werfen, bevor ich gehe?«
Sie schüttelte den Kopf und war schon wieder halb in ein Schreiben vertieft. »Nicht mehr heute, ich muss mich erst um die Organisation der Fördergelder kümmern. Aber danke, Nathan, ich bin sicher, dass es gut geworden ist. Du hast ein Händchen dafür.«
M. hasste es, ihre Präsentationen selbst zu erstellen, weil sie mit dem Programm auf Kriegsfuß stand. Im vergangenen Semester hatte ich einige ihrer Selbstversuche gesehen, nachdem ich meinen Job angetreten hatte, und ihr geholfen, damit sie sich in ihren Vorlesungen nicht blamierte. Mir machte das nichts aus, im Gegenteil. Ich mochte übersichtliche Dinge. Vermutlich bevorzugte ich deshalb auch in meinen Studienprojekten klare Formen und Konzepte.
Ich sah auf mein Handy und stand auf. So pünktlich kam ich selten hier raus, die anderen würden nicht allzu lange auf mich warten müssen.
»Alles klar, ich habe die Datei unter dem heutigen Datum auf dem Desktop gespeichert. Dann bis bald und noch viel Spaß.«
Sie seufzte lediglich und schenkte mir einen Blick, der verriet, dass sie den ganz sicher nicht haben würde. »Sag deinen Freunden, sie sollen vorsichtiger mit dir sein. Tschüs, Nathan.«
»Mach ich.« Ich nickte ihr zu und trat auf den Gang.
Es war verhältnismäßig still, schließlich begann das Semester erst am Montag, und nur einzelne Studenten waren unterwegs – Streber, die nicht auf den offiziellen Startschuss warten konnten, Freunde, die sich auf dem Gelände trafen, weil sie in der Nähe wohnten, und Leute wie ich, die bereits ihre Termine hatten.
Ich machte mich auf den Weg zum Ausgang und dachte an Quinn. Ob sie sauer war, dass ich ihr den Job weggeschnappt hatte? Vermutlich, ich wäre es an ihrer Stelle jedenfalls. Es tat mir auch ehrlich leid, vor allem, da ich sie wirklich sympathisch fand. Normalerweise quatschte ich niemanden einfach so an, sondern war froh, wenn ich meine Ruhe hatte. Gerade wenn in meinem Leben einiges los war, so wie seit ein paar Wochen. Aber ihre Gegenwart und das Gespräch mit ihr hatten sich gut angefühlt. Beruhigend.
»Nathan!« Caleb wartete am Eingang, lehnte an einer Säule und trug so grellbunte Sportklamotten, dass ich kurz die Augen zusammenkniff. »Wir dachten schon, du lässt uns hängen und versackst lieber am Computer.«
»Wenn ich dich so sehe, wäre das wohl auch die bessere Entscheidung gewesen, Mann. Warum trägst du so was?« Ich deutete auf seine Shorts und schlug meine Faust kurz gegen seine.
Caleb zuckte die Schultern und fuhr sich über seinen fast kahl rasierten Schädel. »Von jemandem wie mir erwartet man Fröhlichkeit und vollendetes Modebewusstsein. Los, die anderen sind draußen.«
Ich folgte ihm in den Sonnenschein und streckte mich, als die Strahlen meine Haut wärmten. Zwar liebte ich die Nacht mehr als den Tag, aber wer hatte schon etwas gegen ein paar Stunden in der Sonne einzuwenden?
Debbie und Rui lungerten vor dem Eingang herum. Debbie hatte den Kopf in den Nacken gelegt und genoss das Wetter ebenso wie ich, während Rui einen Basketball auf seinem Zeigefinger kreisen ließ. Er begrüßte mich mit einem Nicken und warf mir den Ball zu.
»Hey«, rief ich und fing ihn auf.
»Hey, Nathan«, sagte Deb. »Ich hatte gehofft, du musst länger machen, damit ich das hier noch ein wenig genießen kann.« Sie streckte sich und sah höchst zufrieden aus.
Caleb verdrehte die Augen. »Apropos genießen – stammt der von Blaise?« Er deutete auf den Kratzer, und allmählich bedauerte ich, kein langärmliges Shirt angezogen zu haben.
»Nein, der stammt von Rui. Wir haben gestern im Wald ein kleines Rennen veranstaltet. Nichts Wildes«, sagte ich und warf Caleb den Ball mit voller Wucht zu.
Er fing ihn mühelos. »Schade. Ich hatte auf was Wildes gehofft. Irgendeine nette Story, in der du Gabriel windelweich geprügelt hast, nachdem der Vollidiot dir vorgestern blöd gekommen ist.« In seinen Augen blitzte es, er meinte es absolut ernst.
Caleb liebte Auseinandersetzungen mit Blaise und seinen Jungs. Wenn man ihn lassen würde, wäre er öfter der Mittelpunkt einer Schlägerei. Vorgestern war ich echt froh gewesen, dass er nicht auf dem Gang aufgetaucht war, weil es sonst vermutlich hässlich geworden wäre. Gabriel Blaise hatte mich lediglich reizen wollen, obwohl er eigentlich wissen müsste, dass ich nicht darauf ansprang. Es sah ganz so aus, als stünde er momentan unter Stress und wollte sich an mir abreagieren – so machte man das schließlich, wenn zwei Familien seit langer Zeit verfeindet waren.
»Da muss ich dich enttäuschen«, sagte ich knapp. So gern Caleb nach dem kurzen Vorfall auf Blaise und seine Gefolgschaft losgegangen wäre, so froh war ich, dass ich sie seitdem nicht mehr gesehen hatte. Es gab niemanden, den ich lieber aus meinem Leben gestrichen hätte als Gabriel, aber man konnte nun mal nicht alles haben, und leider besuchte er dieselbe Uni. Zum Glück studierte er Wirtschaftsmanagement – etwas anderes kam für das Söhnchen von Edmund Blaise natürlich nicht infrage –, also liefen wir uns nicht allzu oft über den Weg.
»Wie steht’s mit den Vorbereitungen für die Jubiläumsfeier?«, mischte sich Debbie ein.
Ich war dankbar, dass sie unser Gespräch auf ein anderes Thema lenkte.
»Ist dein Dad sehr beschäftigt?«
Die Antwort lautete eindeutig ja. Dad war angespannt, weil er wollte, dass unsere große Jubiläumsfeier reibungslos über die Bühne ging, und das hing von verdammt vielen Faktoren ab. Momentan verbrachte er viel Zeit oben in Winter Harbour, um alles zu organisieren, aber mir war das ganz recht. Trotzdem würde er niemals zugeben, im Stress zu sein, und er würde mich lynchen, wenn ich das von ihm behauptete.
»Es läuft alles glatt, ist eben wie immer viel zu tun«, wich ich der Frage aus. Ich gab den anderen ein Zeichen, und wir liefen los in Richtung Basketballplatz.
Mein Handy klingelte, und als ich es aus der Tasche zog, unterdrückte ich ein Seufzen. Als hätte er geahnt, dass wir gerade über ihn geredet hatten. Ich wandte mich kurz ab und nahm den Anruf an.
»Hey, Dad.«
»Nathan.« Er klang ungeduldig, fast schon wütend. »Sag mir bitte, dass du weißt, wo dein Nichtsnutz von Cousin steckt.«
»Ich habe keine Ahnung«, sagte ich verwundert. Zachary war alt genug, ich musste nicht seinen Babysitter spielen. Allerdings fiel mir jetzt auf, dass ich ihn seit zwei Tagen nicht gesehen hatte. Auch auf meine letzte Nachricht hatte er nicht geantwortet.
»Ganz großartig«, knurrte Dad. »Aber ich hätte es mir denken können. Es war falsch, ihm Verantwortung zu übertragen. Man kann sich nicht auf ihn verlassen.«
»Mach mal halblang, Dad.« Ich hatte das Gefühl, Zach verteidigen zu müssen. Immerhin hatte er niemanden mehr außer uns.
»Ich habe dir gesagt, dass es ein Fehler war, Zachary bei uns aufzunehmen, Nathan. Der Junge bringt nichts als Ärger. Schon immer.«
In seine Stimme hatte sich dieser Unterton geschlichen, den ich nicht mochte, weil er Zach für mehr verantwortlich machte als für das aktuelle Problem. Ich schluckte die Bemerkung herunter, die mir auf der Zunge lag, denn Streit half jetzt niemandem, am allerwenigsten Zach. Ja, mein Cousin war in vielen Belangen einfach mehr als ich. Er feierte länger und öfter, er trank mehr, trainierte härter, er redete sogar lauter. Und zugegeben, er geriet auch häufiger in Schwierigkeiten. Das hatte sich schon an den Schlägereien damals an der Highschool gezeigt. Dabei war Zach nicht immer selbst schuld. Er prügelte sich nicht einmal gern, ließ sich dafür aber verdammt leicht provozieren. Trotzdem war er ein guter Freund. Zach würde alles für mich tun.
»Er kann nichts dafür, dass Mum tot ist, Dad«, sagte ich leise. »Zach hat nicht am Steuer gesessen, sondern Tante Laura.«
Gefährliches Terrain. Der Unfall, bei dem Mum sowie Zachs Mutter gestorben waren, lag fünf Jahre zurück. Manchmal glaubte ich, sie würden trotzdem jeden Moment durch die Tür treten, lachend und durcheinanderredend und schwer bepackt von ihrer Shoppingtour in Vancouver. Ich war sicher, dass Dad ähnlich fühlte, aber im Gegensatz zu mir hatte er in seiner Trauer beschlossen, nicht nur Tante Laura, sondern auch Zach als den Schuldigen abzustempeln. Es wunderte mich, dass er ihn damals bei uns aufgenommen und nicht einfach sich selbst überlassen hatte.
»Ich wüsste nicht, was diese Sache mit dem heutigen Fehlverhalten deines Cousins zu tun hat«, sagte Dad kühl und so sachlich, als redete er über eine Möbelanschaffung. Im Bruchteil einer Sekunde hatte er sich weit von mir entfernt.
»Hast du ihn mal angerufen?«
Blöde Frage, natürlich hatte er das.
»Mehrmals seit heute früh. Er hätte längst mit den neuen Schnitzereien für das Versammlungshaus hier sein müssen. Außerdem hat er zugesagt, beim Aufbau der Bühne zu helfen. Diese Feier ist wichtig, und zwar für alle Tribes. Wie stehe ich da, wenn ausgerechnet jemand aus meinem Tribe den Anschein erweckt, alles auf die leichte Schulter zu nehmen? Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass er uns im Stich lässt.«
Das stimmte leider, daher fiel mir auch kein Gegenargument ein. Wenn Zach feierte, vergaß er schon mal, dass es noch andere Dinge im Leben gab als Party. Ich verstand ihn zum Teil. Jeder ging mit dem Tod eines Elternteils anders um. Zach betäubte sich und lenkte sich ab, ich stürzte mich in Termine und Pläne. Aber ich hatte immerhin noch Dad.
»Vielleicht ist er ja schon unterwegs zu euch.«
»Er reagiert seit heute Morgen nicht auf meine Anrufe, Nathan. Tu mir einen Gefallen. Wenn du ihn siehst, sag ihm, dass er seinen Hintern schleunigst herbewegen soll, ansonsten kann er sich eine neue Bleibe suchen.« Er legte auf.
Ich starrte auf das Telefon, während meine Gedanken heiß liefen. Ja, Zach war alles andere als zuverlässig. Aber die Jubiläumsfeier in Winter Harbour war für ihn ebenso wichtig wie für uns alle.
»Nate?«
Ich wandte mich um. »Geht schon mal vor, ich muss noch kurz etwas regeln.«
Caleb verdrehte die Augen. »Typisch Copeland.«
Er fing sich einen Fausthieb von Debbie ein, rieb sich grinsend die Schulter, zwinkerte mir zu und machte sich mit den anderen beiden auf den Weg.
Ich wählte Zachs Nummer und hielt das Handy ans Ohr.
»Dieses Mal hast du kein Glück, aber nicht aufgeben! Du erwischst mich schon noch.«
Der Piepton nach der Ansage auf der Mailbox klang beim dritten Versuch nervig höhnisch. Ich fluchte und hielt mich gerade noch zurück, das Handy auf den Boden zu feuern. Stattdessen öffnete ich WhatsApp, aber dort hatte er meine Nachricht noch nicht einmal gelesen. Ich schrieb ihm eine weitere, dass er sich dringend bei mir und bei Dad melden sollte. Dabei fiel mir ein, dass er gestern sogar das Mittagessen hatte sausen lassen, obwohl Mrs MacGowan ihre Spezialpizza gebacken hatte. Seitdem Zach bei mir und Dad wohnte, verschwanden Lebensmittel schneller, als wir einkaufen konnten. Ich kannte niemanden, der Riesenportionen so inhalierte wie mein Cousin, und er wusste genau, dass unsere Haushälterin mindestens einmal pro Woche etwas auf den Tisch brachte, das auf unserer Liste weit oben stand.
Ein Versuch blieb mir noch, also wählte ich Sams Nummer. Wenigstens hatte ich bei ihm Glück, es klingelte nur zweimal.
»Hey, Nate!« Sam klang wie immer gut gelaunt, dann hustete er.
»Störe ich?«
Mehr Husterei. »Einen Moment.«
Ich hörte, wie er das Telefon zur Seite legte, dann war Stille. Etwas polterte. »Sorry, ich bin gerade in der Werkstatt. Der Kulturrat von Duncan hat eine Adlerskulptur für das Rathaus bestellt, und ich sitze seit heute früh an den ersten Ausarbeitungen.«
»Das ist ziemlich cool, Sam!«
Das war es wirklich. Duncan nannte sich schließlich selbst die Stadt der Totems und legte großen Wert darauf, die Kultur der First Nations auf Plätzen oder in Parks in das Alltagsbild zu integrieren. In dem Ort standen unter anderem einige der größten Totempfähle Kanadas. Vor allem die Kunst der Cowichan war stark vertreten, und von ihnen stammte Sam schließlich ab.
»Ja, es war schon eine Ehre, als sie ausgerechnet mich gefragt haben.«
»Ich finde, das war einfach nur schlau von ihnen.«
Er lachte. »Rufst du aus einem bestimmten Grund an? Ich will dich nicht abwürgen, aber ich bin voller Holzstaub.«
Sam war einfach zu höflich, um mir zu sagen, dass er weiterarbeiten wollte und daher wenig Lust auf Small Talk hatte. Das war okay, ich wollte auch nicht plaudern.
»Ja, sag mal, war Zach bei dir und hat die Skulpturen für Winter Harbour abgeholt?«
»Nein, die stehen hier noch alle, aber gut, dass du nachfragst. Ich dachte, er müsste schon längst auf dem Weg sein. Wann will er denn vorbeikommen?«
Wenn ich das mal wüsste.
»Gute Frage«, sagte ich und verfluchte Zach innerlich. »Ich sprech ihn darauf an, wenn ich ihn sehe. Jetzt lass ich dich mal wieder in Ruhe. Und schluck nicht so viel Staub.«
Sam lachte. »Ich denk dran. Mach’s gut, Nate.«
»Du auch.« Ich legte auf, steckte das Handy wieder in meine Hosentasche und starrte in die Ferne.
Allmählich übertrieb Zach es wirklich. Sollte er das hier vermasseln, wusste ich nicht, ob ich ihn noch in Schutz nehmen konnte. Wenn Dad seine Drohung wahrmachte und ihn rausschmiss, würde er ein Problem haben so ganz ohne Job, nachdem er im Elektrogeschäft wegen seines angeblich zu herrischen Chefs gekündigt hatte. Klar konnte er vorübergehend bei irgendeinem Kumpel unterkommen, aber auf lange Sicht?
»Verdammt, Zach«, murmelte ich und machte mich auf den Weg zum Basketballplatz. Warum musste ich mich eigentlich immer um meinen Cousin sorgen? Immerhin war er der Ältere von uns beiden.
Schon von Weitem sah ich, wie Debbie und Rui ein paar ruhige Körbe warfen, während Caleb neben ihnen Liegestütze mit einer Hand absolvierte – vermutlich wegen der Mädchen, die in einiger Entfernung auf einer Bank saßen, ihn beobachteten und kicherten. Caleb war manchmal echt ein Idiot.
Ich schlenderte auf die drei zu und blieb neben ihm stehen. »Was ist, spielen wir oder willst du weiterhin rumposen?«
Er sprang so schnell auf, dass er sogar mich überraschte. »Ich mach dich lieber beim Basketball fertig, Copeland.«
Ich hob die Brauen. »Das will ich sehen.«
Caleb grinste, rannte los und versuchte, Rui den Ball abzunehmen. Natürlich erfolglos. Rui machte nie viele Worte, aber er war der beste Spieler, den ich kannte.
Ich legte mein Handy zu den anderen Sachen am Rand des Spielfeldes und joggte zum Korb. Ich freute mich auf unser kleines Match – und noch mehr darauf, dass mit dem offiziellen Semesterstart auch das Basketballtraining endlich beginnen würde. Ich konnte jede Ablenkung gut gebrauchen.
Probleme hatte ich schließlich genug.
Kapitel 4
QUINN
Es gab Orte, an denen man sich heimisch fühlte, wenn man dort auf unzählige andere Menschen traf – und solche, wo man in einer namenlosen Masse aus Stimmen, Hektik und drängelnden Körpern so schnell unterging, dass man sich vollkommen allein fühlte. Die Vancouver Island University zählte definitiv zur zweiten Kategorie. Vielleicht, weil es den Anschein hatte, als wüssten alle außer mir, wo sie hinwollten, und jeder eine Menge anderer Leute kannte. Die Gänge waren so voll, dass ich unweigerlich mitgeschoben wurde. Also ließ ich mich treiben, bis ich den Ausgang des Hauptgebäudes erreicht hatte, und versuchte dann, möglichst schnell an den Rand des Weges zu kommen.