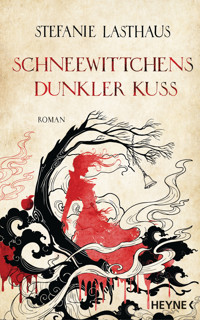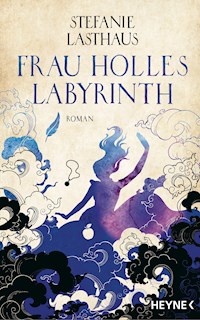Touch of Ink, Band 2: Im Bann der Verbotenen (Fesselnde Gestaltwandler-Romantasy) E-Book
Stefanie Lasthaus
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Verlag GmbH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Touch of Ink
- Sprache: Deutsch
Destiny is written on your skin. Der Angriff auf Winter Harbour konnte abgewehrt werden – zu einem hohen Preis: Nathan wurde gefangen genommen. Lediglich bruchstückhafte Visionen lassen Quinn hoffen, dass er noch am Leben ist. Obwohl der Rat der Wandler ihr als eine Verbotene misstraut, bilden sie einen gemeinsamen Suchtrupp. Doch plötzlich gerät Quinn selbst in Gefahr und muss feststellen, dass ihr Schicksal und das ihrer größten Feindin aufs Engste miteinander verknüpft sind. Der einzige Weg, um Nathan noch zu retten – und vielleicht sogar die Tribes zu vereinen – ist, ihr eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Das Finale des knisternden Zweiteilers! ***Eine Szene aus "Touch of Ink", Band 2*** "Bist du bereit?" War ich bereit? Das war die falsche Frage. Ich wusste nicht, ob man für diese Sache je bereit sein konnte, aber ich war entschlossen und wir hatten die Tattoozeichnung bestmöglich angefertigt. "Fangen wir an." Nathan trat für einen Moment ganz nah an mich heran und legte eine Hand behutsam an meinen Hinterkopf. Ich lauschte seinem Herzschlag, der mir mittlerweile fast so vertraut war wie mein eigener. Er war die ganze Zeit über an meiner Seite gewesen, und das würde er auch weiterhin sein. Wir gehörten auf eine spezielle, unerklärliche Weise zusammen. Aber ich brauchte dafür auch keine Erklärung. Manche Dinge existierten einfach. Wie ein Wunder, das sich unbemerkt in das Leben geschlichen hatte und ohne das man auf einmal nicht mehr sein wollte. Oder konnte. Ich schloss meine Augen ebenfalls, tastete nach seinen Händen und schmiegte mich in diese Vertrautheit. "Also dann", murmelte er, und seine Lippen streiften mein Ohr. Ich erschauerte. "Also dann." Langsam ließ ich ihn los und fasste meine Haare zu einem Knoten zusammen. "Bereit."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 719
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Originalausgabe Als Ravensburger E-Book erschienen 2021 Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg © 2021 Ravensburger Verlag GmbH Text © 2021 Stefanie Lasthaus Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literaturagentur Langenbuch & Weiß, Hamburg. Covergestaltung: Zero Werbeagentur, München, unter Verwendung eines Fotos von © Gribanessa/Shutterstock Tattoo-Illustrationen: © Sarah Schwarz Lektorat: Franziska Jaekel Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-473-47143-0
www.ravensburger.de
FÜR ALLE, DIE NACH DEN GEHEIMNISSEN DIESER WELT SUCHEN.
Kapitel 1
NATHAN
Seit ich denken konnte, war ich morgens direkt nach dem Aufwachen aus dem Bett gesprungen. Ich mochte den ersten Blick in den neuen Tag, die Momente, wenn mein Körper losfeuerte, weil Temperatur und Cortisolspiegel stiegen und ich wieder die Kontrolle übernahm, nachdem ich sie so viele Stunden abgegeben hatte. Bei den meisten Wandlern war das so. Es hing wahrscheinlich mit unserem leistungsfähigeren Organismus zusammen, und wer beschwerte sich schon, weil er fitter war als ein durchschnittlicher Mensch?
Jetzt wünschte ich mir zum ersten Mal, wieder zurück in den Schlaf driften zu können. Das Aufwachen war … klebrig. Als müsste ich einen Kokon zerreißen, der in Fetzen überall an mir hängen blieb. Der Geschmack in meinem Mund war ekelhaft. So ungefähr musste es sein, wenn man nächtelang durchfeierte und sich nicht die Zähne putzte. Meine Lider waren schwer, meine Arme und Beine noch schwerer, und die Gewichte an meinen Schläfen warnten mich vor allzu abrupten Bewegungen. Es nervte. Es machte mich sauer.
Ich biss die Zähne zusammen, bis mein Kiefer schmerzte. Immerhin lenkte das vom Pochen an einigen Stellen meines Körpers und der Taubheit an anderen ab. Lautlos fluchend blinzelte ich und sah mich um. Ich lag auf einem Schlafsack, der auf platt getrampelter Erde ausgebreitet war. In der Nähe fiel Licht durch einen Spalt. Es waberte und flackerte, musste also von einem offenen Feuer stammen. War ich in einem Zelt?
Normalerweise war es eine meiner leichtesten Übungen, die Hände auf den Boden zu stemmen und mich hochzudrücken, aber jetzt brauchte ich drei Anläufe. Das war kein Anfängerstatus mehr, das war erbärmlich. Anschließend hockte ich auf Knien und Händen und wartete darauf, dass die Umgebung aufhörte, Karussell zu spielen. Ich wagte noch nicht, ganz aufzustehen, also kroch ich auf allen vieren auf den Spalt zu – das hier war wirklich ein Zelt – und lauschte. Da waren Stimmen und Gelächter, dazu kam der Geruch von Rauch, Fleisch und Schweiß. Ich blinzelte in den Feuerschein, aber das machte es nicht besser, und ich presste beide Hände vor die Augen. Vielleicht hatten sie mir irgendetwas verabreicht.
Du Held.
Okay, der Reihe nach. Was war passiert, und wie war ich hierhergekommen? Woran erinnerte ich mich?
Winter Harbour. Wir hatten uns verwandelt. Und gekämpft.
Ein Schwarzbär neben mir. Mit seiner hässlichen Pranke schleudert er einen Berglöwen zur Seite wie eine harmlose Hauskatze. Ich greifedasBiestan,schlageihmmeineKrallenindieFlanke.Nässe in meinem Fell. Der Bär fährt herum und reißt sein Maul auf. Fäden ziehen sich zwischen Zähnen, die so viel größer sind als meine, Verwesungsgestank schlägt mir zusammen mit dem Geruch nach Blut entgegen.
Der Berglöwe hatte es nicht geschafft, aber ich hatte den Bären getötet – nicht allein, doch sein Blut war über meine Zunge und durch meine Kehle gelaufen. Bei dem Gedanken schmerzte mein Kiefer ein wenig mehr. Ich schluckte, und kurz schmeckte ich etwas Metallisches. Bildfetzen brachen in einem Wirbel aus Sorge und Entsetzen über mich herein. Wir hatten uns gegen diese wahnsinnige Irre und ihre Schwarzbären gestellt.
Ich stöhnte auf und ballte die Hände zu Fäusten, als ich an Sam dachte. Und an Quinn. An ihr Gesicht, in dem einzelne Haarsträhnen klebten. Kupfer auf Schneeweiß. Quinn hatte den Bären Widerstand geleistet – mit einer Macht, die ich niemals in ihr vermutet hatte. Womit jetzt so ziemlich jeder Wandler in Winter Harbour wusste, was sie war. Sie hatte alles riskiert und ihre wahre Natur offenbart, um den Angriff aufzuhalten. Wie Dad und die anderen Ratsmitglieder darauf reagiert hatten, wusste ich nicht. Nur, dass ich nicht da war, um ihr zu helfen. Ich konnte lediglich auf Tohmah setzen und dass ihm genügend Argumente einfielen, um Quinn vor meinen Leuten zu schützen. Aber ich musste mir nichts vormachen. Arcands Stellung war nicht besonders gut, vor allem, da er sich bis vor Kurzem geweigert hatte, ein Sänger zu sein. Anders als Sam.
»Sam«, murmelte ich und spürte brennende Hitze unter meinen Lidern, aber gleichzeitig auch diese Leere in mir, die nie wieder verschwinden würde. Dort, wo die Verbindung mit ihm gewesen war oder das Wissen, mich stets auf ihn verlassen zu können – und er auf mich. Ich rieb mir über die Augen, als etwas anderes aufblitzte. Die Erinnerung an gedämpfte Motorengeräusche, an Stimmen und fremde Gerüche. Und an Bilder. Vorbeiziehende Bäume, Straßenschilder. Eine Radkappe im Straßengraben. Ein … Holzkreuz? Hatte ich das geträumt?
Mit einem Knurren presste ich beide Hände gegen die Schläfen. Ich wollte weder Träume noch miese Erinnerungen, die mich nach unten zogen, obwohl ich dort bereits angekommen war.
»Sieht aus, als störe ich gerade.«
Die Stimme erwischte mich mitten in diesem Augenblick, der niemandem außer mir gehörte. Schnell blinzelte ich und hob den Kopf. Ein Fehler, da mir schwindelig wurde, aber ich ignorierte es und starrte nach vorn, wobei ich mehrere Sekunden lang lediglich grelle Blitze sah. Dann kristallisierte sich Oonas Gesicht heraus.
Interessant, wie sehr man jemanden hassen konnte, und das in jederlei Hinsicht. Ich hasste ihre überhebliche Mimik, ihre hässlichen Tattoos an Schläfe, Kinn, Armen sowie Fingern und nicht zuletzt ihr lächerliches Mad-Max-Outfit mit den geflochtenen Zöpfen und … was sollte das sein, ein Lederrock über einer Lederhose?
Ich räusperte mich möglichst lautlos. »Können wir das Vorgeplänkel lassen und du sagst mir gleich, wo ich bin und was das hier soll?«
»Ich weiß noch nicht.« Sie zog einen Schmollmund und lehnte sich an die Plane, was ungemütlich aussah, da das Zelt nach oben schmaler wurde und sie das Kinn an die Brust drücken musste. »Vielleicht brauchst du noch eine Weile. Du weißt schon, ein paar Tränen verdrücken und ein wenig klarer werden. Hier.« Sie tippte sich an die Stirn.
Ich überlegte, ob ich es schaffen würde, sie niederzuschlagen. Oder zu erwürgen. Die Antwort lautete so schlicht wie demütigend: nein. Ich würde nicht einmal ungestraft in ihre Nähe kommen, und das wusste sie.
»Ja, du hast recht. Ich brauche noch eine Weile. So zwei bis fünf Jahre. Wir sehen uns dann.« Ich konnte ihren Gesichtsausdruck nicht mehr erkennen, da sie jetzt nah am Eingang stand und das hereinfallende Licht zu sehr blendete.
»Süß«, sagte sie und kam näher. »Aber gib dir keine Mühe.« Ein leises Lachen folgte. »Dich wird hier niemand finden. Dein Sänger hat dieser Welt den Rücken gekehrt, und Winter Harbour ist weit weg.« Sie breitete die Arme aus. »Wir sind schon eine Weile unterwegs, über Wasser und Erde, über befahrene Straßen und Wege, die niemand kennt.«
Ich wollte lachen, aber es kam nicht mehr als ein Keuchen heraus. »Wow. Ich hatte schon vorher den Eindruck, dass du nicht mehr ganz dicht bist, aber jetzt bin ich mir sicher.«
Die Worte ließen etwas gefrieren, vielleicht die Luft, vielleicht auch Oonas Stimmung. Mit einem Ruck richtete sie sich auf.
»Wichtig ist, dass du tust, was ich sage. Und das wirst du, Nathan Copeland.« Sie berührte meinen Oberarm und strich langsam daran hinab. Ich schlug ihre Hand weg, leider nicht so energisch, wie ich es gern getan hätte. Oona lachte. »Ruh dich aus, schwarzer Panther. Wir brauchen dich noch.«
Eine ihrer Haarsträhnen streifte meine Wange, als sie sich umdrehte und aus dem Zelt stiefelte. Der Spalt verschwand, von außen zusammengezurrt. Vermutlich wollte Oona sichergehen, dass ich auf keinen Fall beobachtete, was dort vor sich ging.
Ich ließ mich auf den Boden sinken und überlegte, was das alles zu bedeuten hatte. Von hier zu verschwinden, war wohl keine Option, erst recht nicht in meinem Zustand. War Oona aufgetaucht, um sich über mich lustig zu machen? Nein, trotz ihrer durchgeknallten Art tat sie garantiert nichts ohne Grund. Wahrscheinlicher war, dass sie testen wollte, wie fit ich war. Mittlerweile war ich sicher, dass sie mir etwas verabreicht hatten, um mich auszuknocken.
Ich biss erneut die Zähne zusammen, aber nicht mehr rechtzeitig. Während ich die Fäuste auf den Boden presste, schrie ich, auch wenn es mich meine letzte Kraft kostete. Ich schrie, bis alles um mich herum schwarz wurde.
Draußen war mehr los, als ich wieder aufwachte. Lachen, Grölen, hektische Geräusche. Manche waren recht nah – jemand musste vor dem Zelt stehen und Wache schieben. Langsam zog ich die Beine an, drehte mich auf die Seite und stemmte mich in die Höhe. Kein Schwindel, keine Schwäche. Nur der ekelhafte Geschmack im Mund war noch da, und meine Zunge klebte am Gaumen. Ich wollte schlucken, aber es gelang mir erst nach mehreren Versuchen.
Endlich war ich auf den Beinen und lief durch das halbe Zelt, als ich den Teller mit kaltem Grillfleisch und Brot bemerkte. Der war vorhin nicht da gewesen. Ich nahm ihn und roch daran. Auf der Matratze lagen ein Apfel und eine Flasche Wasser. Der Verschluss war intakt, sie war noch nicht geöffnet worden. Das holte ich rasch nach und leerte sie in einem Zug fast zur Hälfte. Ich musste mich zwingen, nicht auch noch den Rest hinunterzustürzen, aber dann hätte ich wahrscheinlich alles wieder im hohen Bogen ausgekotzt. Ich wartete einen Moment ab, dann aß ich etwas von dem Fleisch und dem Brot. Es wäre auch schwachsinnig, wenn Oona mich verschleppen ließ, nur um mich dann zu vergiften. Außerdem war ich halb verhungert. Nachdem ich zum Schluss den Apfel verschlungen hatte, fühlte ich mich deutlich besser. Ich streckte mich auf dem Schlafsack aus, schloss die Augen und war froh, dass diese seltsame Schwäche verschwunden war. Ein Anfang. Aber was war mit dem Rest? Mit Quinn und unserer Verbindung, die in den vergangenen Tagen ein so wichtiger Teil meines Lebens geworden war? Das Band zwischen uns hatte sich anders angefühlt als bei Sam, der Grund dafür lag wohl auf der Hand.
»Es tut mir so leid, Kumpel«, murmelte ich und schluckte gegen die Enge in meiner Kehle an. Oona und ihre Leute würden für Sams Tod büßen. Ich hatte nie zuvor darüber nachgedacht, wie es wäre, seinen Sänger für immer zu verlieren, aber ich hätte nicht mit diesem Gefühl der Einsamkeit gerechnet, die ich selbst in meiner Menschengestalt spürte. Obwohl es wehtat, verdrängte ich Sam aus meinen Gedanken und konzentrierte mich auf Quinn.
»Du lebst noch«, flüsterte ich und schloss die Augen, als würde es wahr werden, wenn ich es nur aussprach.
Etwas blitzte in meinem Kopf auf – die Bilder aus meinem Traum. Falls es ein Traum gewesen war. Auf einmal erinnerte ich mich daran, dass ich mich kaum hatte bewegen können, während all die Eindrücke an mir vorbeigezogen waren. Draußen auf dem Highway. Lediglich meine Lider hatten mir gehorcht, obwohl sie so unglaublich schwer gewesen waren. Ich runzelte die Stirn und versuchte, die einzelnen Bilder zu isolieren. Vielleicht erinnerte ich mich dann an eine Streckenangabe. Oder ein Ortsschild. Aber alles, was hochkam, war dieses verdammte Holzkreuz. Jemand hatte ein Pappschild daneben aufgestellt, mit Herzen und Buchstaben und einer schlecht gemalten Kerze darauf. Ich kniff die Augen zusammen und konzentrierte mich stärker.
Katie.
Ja, den Namen hatte ich gelesen, und eine Zahl. Ein Sterbedatum? Vielleicht eine Unfallstelle?
Katie. Wir werden dich niemals vergessen.
Darunter ein Name. Nein, doch ein Datum. Meine Kieferknochen knackten, als ich mich weiter anspannte, und endlich glaubte ich, mich auch an die letzte Zeile zu erinnern.
HoD 2011.
Ich konzentrierte mich auf die Buchstabenabfolge, weil sie mir so falsch erschien. Sollte es eher HDL heißen? Aber nein, ich war mir ziemlich sicher. Nur leider ergab das absolut keinen Sinn und half mir nicht weiter. Aber vielleicht konnten andere damit etwas anfangen?
Vielleicht.
Langsam ging ich in die Knie und tastete über den Boden. Dann drückte ich meine Fingernägel hinein und ritzte in eckiger Schrift Katie sowie HoD2011 in den Untergrund.
Ich setzte mich wieder auf und warf einen Blick zum Ausgang. Die winzigen Öffnungen an der Eingangsschnürung verrieten mir, dass es draußen dunkel war. Meine Chancen, hier abzuhauen, sahen übel aus, aber das bedeutete nicht, dass ich keine hatte. Ich musste versuchen, Quinn zu erreichen, auf diese seltsame, einzigartige, wunderschöne Weise, die es eigentlich nicht geben durfte. Hoffentlich ließ sich Oona nicht gerade jetzt blicken.
Ich stand auf und zupfte an dem Shirt. Es gehörte nicht mir, irgendjemand musste es mir übergezogen haben, während ich bewusstlos gewesen war. Ich ließ es zu Boden fallen, dann stieg ich aus Jeans – auch nicht meine – und Shorts. Ich brauchte eine Weile, bis ich das vertraute Kribbeln auf meiner Haut spürte, den sanften Wind, der mich umwirbelte. Als die Welt endlich verschwamm, weicher und nachgiebiger wurde, um dann auf eine andere Weise wiederaufzutauchen, atmete ich auf.
Alles wirkte einfacher, aber auch eindringlicher. Augenblicklich fühlte ich die Kraft, die ich zuvor vermisst hatte, wurde wütend und musste mich zusammenreißen, um nicht loszustürmen und demjenigen, der vor dem Zelt Wache schob, die Kehle herauszureißen. Ich streckte meinen Körper mit aller Vorsicht, dann lief ich los, strich lautlos von einer Seite auf die andere und nahm die Gerüche von draußen auf. Meine Nackenhaare sträubten sich, und ich öffnete das Maul. Zwei Männer waren ganz in der Nähe, sie stanken nach Bier und etwas anderem – Bärenwandler. Da waren noch weitere, aber ich hörte sie nicht. Vielleicht schliefen sie. Meine Instinkte brüllten mir zu, es trotzdem zu versuchen, ihren Gestank mit Blut zu überdecken, aber ich gab nicht nach. Es war zu gefährlich.
Ich blieb eine Weile in meiner Tiergestalt, streifte durch das Zelt, nahm alles in Augenschein, besonders die Schrift im Boden, und verwandelte mich wieder. Selten zuvor war es mir so schwergefallen, den Panther mit all seiner Kraft und Stärke zurückzulassen. Während ich in meine Klamotten stieg, dachte ich nach.
Ich war nicht sicher, ob ich eine Verbindung zu Quinn gespürt hatte, und mein Magen rumorte bei dieser Erkenntnis. Es musste einfach an den Nachwirkungen des Mittels liegen, mit dem sie mich betäubt hatten – oder war ich als Panther angesichts all der Bärenwandler dort draußen zu ruhelos gewesen, um mich richtig zu konzentrieren? Quinn durfte nicht tot sein, nicht durch die Hand des Rates, der nach dem Angriff die Gegenwart einer Verbotenen wahrscheinlich noch weniger tolerierte als ohnehin schon. Aber Tohmah und die anderen Sänger hätten bestimmt nicht zugelassen, dass ihr etwas geschah.
Weiter. Was hatte ich noch wahrgenommen? Wir befanden uns irgendwo mitten in der Wildnis. Vielleicht hatte ich doch eine Chance auf Flucht? Als Panther war ich schneller als die Bären, aber es war ein Risiko. Zum einen kannte ich das Gelände nicht, zum anderen brauchte nur einer von ihnen mich zufällig erwischen. Nein, ich musste erst wieder vollends zu Kräften kommen und herausfinden, was die durchgeknallte Verbotene vorhatte.
Schlagartig wurde mir noch etwas klar: Ich hatte nicht nur die Witterung der Bären bemerkt. Es waren noch andere Raubkatzen in der Nähe. Weiter kam ich nicht, denn die Geräusche vor dem Zelt wurden lauter, dann wurde die Plane beiseitegeschlagen. Feuerschein flackerte herein, verdeckt von zwei Silhouetten.
»Pantherjunge«, knurrte ein schwerer Typ, der offenbar auf Ärger aus war. Oder vielmehr hoffte, dass ich welchen machte. »Deine große Stunde ist gekommen.«
Die Männer packten mich von beiden Seiten und schleiften mich nach draußen. Da ich es derzeit nicht mit zwei großen, bärtigen Fleischbergen aufnehmen konnte, ließ ich mich hängen und nutzte die Gelegenheit, um mir Einzelheiten einzuprägen.
Die Wahnsinnige campte mit ihrem Gefolge mitten im Nirgendwo. Ich zählte mindestens zehn Zelte, die in unregelmäßigen Abständen errichtet worden waren. Sie bildeten einen Halbkreis um eine große Feuerstelle. Es gab ein weiteres, kleineres Lagerfeuer, von dem mir der Geruch nach Fleisch und gegrilltem Brot entgegenschlug. Ich entdeckte jede Menge Bierkästen und sogar ein paar Sitzgelegenheiten. Offenbar hatten die Bären ihr Lager für längere Zeit errichtet. Drei standen am Feuer und wandten sich zu uns um. Schwere Jungs, mit denen ich nicht freiwillig in einen Kampf geraten wollte, und ein paar Jahre älter als ich. Einen von ihnen glaubte ich vom Angriff auf Winter Harbour wiederzuerkennen. Keine Spur von Oona, Monique Arcand, Zach oder den anderen, die entführt worden waren.
Bei dem Gedanken an Zach zog sich mein Magen zusammen. Ich erinnerte mich an Isras Stimme, die bei seinem Anblick so voller Hoffnung gewesen war. Ihr waren nur Sekundenbruchteile der Panik geblieben, ehe er ihr die Kehle zerfetzte. Aber ich hatte gesehen, wie wenig er das alles begreifen konnte, wie verstört er nach seiner Rückverwandlung gewesen war. Nicht er hatte Isra auf dem Gewissen, sondern Oona. Und ich würde dafür sorgen, dass sie für alles büßte, was sie meinem Tribe und den anderen angetan hatte.
Vor uns grölte jemand. Wir hielten auf ein Areal auf der anderen Seite des großen Feuers zu. Ich erkannte Bewegungen und Lichter. Fackeln?
Eine Gestalt trat hinter einem Baum hervor. Noch ein Typ, den ich nicht kannte. Eine Gesichtshälfte wurde von den Flammen beleuchtet, was ihn nicht gerade hübscher machte. Er hatte seine Haare im Nacken zusammengebunden und trug einen Bart, der sein Kinn in ein Schlachtfeld verwandelte, das bereits mehrere Schlachten erlebt hatte.
»Ah, das Söhnchen eines der Ratsmitglieder.« Er schlug mir auf die Schulter, als wären wir beste Kumpel. »Wir werden viel Spaß haben.«
Wenn ich dir die Kehle herausreiße, ja.
»Sprache verschlagen?« Hölle, er hatte definitiv nicht nur Bier getrunken.
»Wohl eher den Atem.« Ich schenkte ihm mein liebenswürdigstes Lächeln.
»Den solltest du dir lieber sparen, Kleiner. Für nachher.« Er nickte den beiden anderen zu. »Ich übernehme hier.«
Er stieß mich vorwärts, aber erst, als er mich zwischen zwei Hecken hindurchschob, erkannte ich einen mit Baumstämmen und dicken Ästen abgeteilten Platz. Rundherum standen und saßen weitere Bärenwandler, manche hielten eine Flasche in der Hand. Die Szenerie wurde von Fackeln erhellt, aber das Adrenalin und die Spannung in der Luft verrieten mehr. Es gab verdammt viel von beidem, und ich war nicht sonderlich erstaunt, als ich begriff, dass ich vor einem Kampfplatz stand. Natürlich. Diese Typen lagerten hier draußen, wohnten vielleicht sogar dauerhaft hier, und mussten sich irgendwie bei Laune halten. Trinken, dumme Sprüche schieben und Leute entführen war keine Vollzeitbeschäftigung, also hatten sie sich etwas Neues gesucht – sich gegenseitig das Hirn aus dem Schädel zu prügeln.
»Nett«, sagte ich.
»Nicht wahr?« Der Bärtige schob mich zur Seite, wo zwei Zelte standen. Eines wirkte eher bescheiden, das andere war größer und komfortabler. »Keine Sorge, musst auch nicht lange warten. Sie dürfte gleich so weit sein.«
Mir war klar, von wem er sprach, und es dauerte wirklich nicht lange, bis Oona aus dem kleinen Zelt trat. Die dunkle Linie des Tattoos von ihrer Unterlippe bis zum Kinn ließ ihr Gesicht bei den Lichtverhältnissen seltsam geteilt erscheinen. Sie hob die Arme und trat näher. Die Irre tat wirklich alles für den Showeffekt, auch wenn es lächerlich aussah. Sie erreichte den Rand der abgeteilten Fläche, und die Gespräche verstummten. Es war albern. Und erschreckend. All diese Bärenwandler, die mir selbst in ihrer Menschengestalt vermutlich das Genick mit einer Hand brechen konnten, ordneten sich dieser Frau unter. Wie alt war sie, höchstens Mitte zwanzig? Sie war eine Verbotene, okay, und ich wusste nicht, wie stark ihre Macht war. Im schlimmsten Fall konnte sie diese Männer beeinflussen – aber doch nur, wenn sie sich verwandelten, oder? Also warum folgten sie ihr? Waren diese Typen einfach so blöd, dass die Leder-und-Gesichtstattoo-Nummer ausreichte, um sie zu beeindrucken?
Oona ließ die Arme sinken. »Auf uns wartet ein weiterer Abend für unsere Gemeinschaft. Ein Abend, der euch unterhalten wird, aber vor allem eines zeigt: Stärke!« Sie ballte eine Hand zur Faust, und die Anwesenden brachen erneut in Gegröle aus. »Stärke ist das, was uns zusammengeführt hat und nach vorn bringt, und wir festigen sie. Wir tun das für uns. Für unsere Gruppe, die nichts mit den Tribes gemein hat, die sich von Politik, Einschränkungen und ihrer Angst vor den Menschen dirigieren lassen. Und damit von ihrer Schwäche!«
Dieses Mal war der Jubel noch lauter und rauschte in meinen Ohren. Auch die Letzten, die noch auf ihren Kisten hockten, standen nun auf, und fast schien es, als wäre die Luft ein paar Grad wärmer geworden.
Was sollte all dieses Gerede über Schwäche und andere Tribes? Das hier konnte doch unmöglich der Tribe der Schwarzbären sein. Von Dad hatte ich nie viel über sie erfahren, aber ich wusste, dass sie irgendwo in Alberta lebten, und zwar recht zurückgezogen. Aber kein Tribe ließ sich von einer Verbotenen führen, so einfach war die Sache.
Oona wedelte mit einer Hand, und die Horde verstummte. »Unsere Stärke beruht auf euch und mir. Und bevor wir testen, ob sie sich vergrößern lässt, werden wir noch einmal Zeuge dessen, was wir bisher erreicht haben.« Sie sah in die Runde und zog die Lippen auseinander. Diese Frau war wirklich irre. Joker-gegen-Batman-irre. Sie klatschte in die Hände, und eine weitere Person trat aus dem Zelt.
Etwas in mir zog sich zusammen. »Zach!«
Ich wollte zu ihm, wurde jedoch so energisch an der Schulter zurückgerissen, dass ich keuchte. Jetzt war ich richtig sauer, und beinahe hätte ich den Bären hinter mir angegriffen. Im letzten Moment hielt ich mich zurück, denn das wäre dumm gewesen. Hier und jetzt konnte ich nichts ausrichten.
Es war so schwer, Zach zu sehen. Ihn so zu sehen. Weil er nicht wirkte wie ein Gefangener. Als Tier hatte er sich Oonas Macht nicht entziehen können und es bitter bereut, aber jetzt war er ein Mensch. Nicht gefesselt, nicht bedroht, und trotzdem trat er zu ihr, als gehörte er genau dorthin. Er wirkte angespannt, sein Gesichtsausdruck verschlossen und ernst, als würde er sich auf etwas vorbereiten.
»Zach!«
Er sah mich an. Doch da war nichts, keine Freude, keine Bestürzung. Absolut gar nichts. Bisher hatte ich alles weggesteckt, aber jetzt schlug mir das Entsetzen hart in den Magen. Zach war vieles, aber kein Schauspieler. Während ich gelernt hatte, mich zurückzuhalten, war er schon immer zu impulsiv gewesen. Zum ersten Mal fühlte ich so etwas wie Hoffnungslosigkeit. Vielleicht auch Panik. Wie sollte ich hier rauskommen? Wie sollte ich Zach mitnehmen, wenn er offenbar gar nicht daran interessiert war zu fliehen? Und vor allem: Warum war er an ihrer Seite?
Er wechselte ein paar Worte mit Oona, trat ein Stück zurück und zog sein Shirt über den Kopf.
Was zur Hölle …
Der Bärtige hinter mir lachte. »Scheint so, als hätte dein Freund Besseres zu tun, als mit dir zu plaudern.«
Oona gab einem der Typen ein Zeichen. Er stand auf, riss sich die Baseballkappe vom Kopf und schälte sich aus seiner Lederweste.
Ich drehte mich zu dem Bärtigen um, der mich nur noch locker festhielt. Mittlerweile war uns beiden klar, dass ich auf keinen Fall abhauen würde. »Was soll das hier?«
»Wonach sieht’s denn aus?«
Ich wusste es, aber ich konnte es einfach nicht glauben. Alles kam mir vor wie ein Film, den ich nicht sehen wollte: Zach und der Typ verwandelten sich, schritten langsam über den Platz und blieben an den entgegengesetzten Enden stehen. Der Schwarzbär war massig und wog sicher um die dreihundertfünfzig Pfund, seine Krallen waren ebenso eindrucksvoll wie sein Umfang. Bis auf den Bereich rund um die Schnauze war sein Fell ebenso dunkel wie Zachs, der von einer Seite auf die andere lief, vielleicht nervös, vielleicht ungeduldig. Früher hätte ich das sagen können, aber im Moment wusste ich nicht, ob ich meinen Cousin überhaupt noch kannte.
Oona schnappte sich eine Fackel und trat in die Mitte des Platzes. In die Kampfarena. Zach legte die Ohren an und fauchte, griff sie aber nicht an. Der Bär dagegen wartete einfach nur ab.
»Zachary hat sich bisher als wertvoll erwiesen«, rief Oona, »aber heute haben wir einen besonderen Zuschauer, der seine Loyalität vielleicht infrage stellen könnte.«
Sämtliche Blicke wandten sich mir zu, als Oona auf mich deutete. Was würde ich dafür geben, ihr die Hand zu brechen! Besser noch den ganzen Arm.
Oona ging zurück zum Rand der Arena und ließ die Fackel fallen. Sie hatte kaum den Boden berührt, da schossen Zach und der Bär aufeinander zu. Ich ballte die Fäuste und musste mit ansehen, wie der Panther zur Seite geschleudert wurde. In mir brodelte es. Ich hatte eine Scheißangst um Zach. Aber ich konnte nichts tun. Oona musste nur mit den Fingern schnipsen, und ich läge bewegungsunfähig auf dem Rücken.
Die Anwesenden drängten sich am Rand der Arena und brüllten. Ich hielt die Luft an, als der Bär ausholte, aber er war zu langsam – gut, denn der Hieb wäre böse für Zach ausgegangen. Der sprang den Bären von hinten an und krallte sich in dessen Schulter. Gebrüll dröhnte durch die Dämmerung, mehr Aggression als Schmerz. Zach war so schlau, von seinem Gegner abzulassen und sich aus dessen Reichweite zu bringen, während er die nächste Attacke plante. Zumindest sein Kampfstil hatte sich nicht verändert. Er erwischte den Bären zweimal, bevor der seinerseits einen Treffer landete. Zum Glück war Zach schnell. Er legte die Ohren an, duckte sich und wich in eine Ecke zurück.
Auch der Bär blieb stehen, erhob sich auf seine Hinterbeine und ließ sich dann fallen, als hätte er das Interesse verloren. Er streckte die Schnauze in die Luft und brüllte. Zach sprang aus dem Ring und lief in Richtung Zelt.
Es dauerte einen Atemzug, bis ich begriff, dass Oona ihre Kräfte spielen ließ.
»Faszinierend, oder?«
Ich hatte nicht bemerkt, dass der Kerl mit dem Bart neben mich getreten war.
»Ich würde es eher als krank bezeichnen.«
Er lachte, dann schlug er mir hart auf die Schulter. »Genug geglotzt, jetzt geht’s an die Arbeit. Los, beweg dich.« Er stieß mich vorwärts. Ich ließ Zach nicht aus den Augen, aber er beachtete mich noch immer nicht, sondern trottete in aller Seelenruhe zum Zelteingang.
Oona trat zu uns, und der Kerl packte meine Arme. »Nathan. Ich hoffe, du hast alles genau beobachtet.«
»Ich habe schon Besseres gesehen«, sagte ich knapp.
»Das tut mir leid, aber ich kann nicht auf jeden Rücksicht nehmen. Du wirst uns in der Arena zeigen, was du kannst.«
»Was, ich soll gegen deinen Bären kämpfen?«
Sie streckte einen Arm aus. Einer der Typen kam näher und drückte ihr etwas in die Hand. Es flirrte silbrig, dann richtete Oona eine Waffe auf mich. »Überleg es dir gut, Ratssöhnchen. Entweder du tust, was ich sage, oder du hast eine Kugel im Kopf. Ich habe dich nur mitgenommen, weil ich noch eine Raubkatze wollte. Zach macht sich ganz gut, aber das genügt mir nicht. Wenn du nicht das zeigst, was ich sehen will, nehme ich den anderen.« Ein winziger Schwenk, und der Lauf der Pistole zeigte über meine Schulter in Richtung Camp.
Den anderen.
Jetzt erinnerte ich mich wieder. Sie hatten nicht nur mich, sondern auch Travis von den Berglöwen entführt. Und was war mit Maya, Nolan und ihren Sängern? Ich hatte sie über meine Trauer um Sam und meine Sorge um Quinn völlig vergessen.
Ich behielt die Pistole im Auge und rührte mich nicht, während mein Herz in der Brust donnerte. Oona traute ich alles zu, sie war unberechenbar.
Ihr Lächeln erinnerte mich an eine Hyäne. »Du bist der Nächste. Mach dich bereit.«
Kapitel 2
QUINN
»So kurzfristig? Du hast vorher nichts davon erwähnt!«
Ich wusste, dass Belle mit verschränkten Armen und diesem verwirrten Gesichtsausdruck hinter mir stand. Daher durfte ich mich auch jetzt nicht umdrehen, da sie mir sonst leidgetan hätte. Dann wäre ich weich geworden und hätte versucht, mich zu rechtfertigen oder – schlimmer noch – ihr alles genauer zu erklären. Je mehr ich ihr jedoch erzählte, desto größer wurde die Chance, dass ich mich in einem Detail verplapperte oder ihr eine Ungereimtheit auffiel. Oder dass mein schlechtes Gewissen und ich unter all den Lügen zusammenbrachen und Belle mir an der Nasenspitze ansah, dass etwas nicht stimmte.
»Ja, ich weiß. Ich hätte nie gedacht, dass man mich gleich im ersten Semester für eine Exkursion auswählt. Aber es sind zwei Leute ausgefallen, und sie haben alle angerufen, die auf der Nachrückliste standen. Und …« Ich kreuzte in Gedanken die Finger, zauberte mein breitestes Grinsen auf die Lippen und drehte mich um. »Was soll ich sagen? Jackpot.« Ja, auf eine höchst unschöne Weise. »Ich denke, es wird megainteressant.« Das ist vermutlich die Untertreibung des Jahres. »Die Native Art in Alberta unterscheidet sich von der hier in British Columbia, und wir werden den einen oder anderen Künstler vor Ort treffen.« Wandler. Wir werden den einen oder anderen Wandler vor Ort treffen.
Belle hatte ihr Haar zu einem unordentlichen Dutt gebunden und trug das Shirt mit dem Elsa-is-my-Spirit-Guide-Aufdruck, das ich ihr zu Weihnachten geschenkt hatte. Auf eine schräge Weise unterstrich es ihre Sorge nur noch. Sie beachtete mein gespieltes Strahlen erst gar nicht, dafür klebte ihr Blick nachdenklich an der Stelle über meinem Auge.
»Bist du wirklich sicher, dass du fahren solltest? Erst der Wanderunfall und nun gleich für ein paar Tage auf Tour, ohne dich zu erholen? Du solltest das besser erst mal untersuchen lassen.«
Ich verdrängte die Gedanken an den Schrecken in Winter Harbour und nahm ihre Hände in meine. »Es ist nur ein Kratzer. Und Belle, überleg mal! Würdest du einen Uni-Trip mit deinem Professor ausschlagen, um zum Arzt zu gehen? Hm?«
Sie sah von meinem Gesicht zu ihren Händen und wieder zurück. »Wohl nur, wenn es etwas Schlimmes wäre. Oder ich den Verdacht hätte, schwanger zu sein«, gab sie zu, verzog den Mund und beäugte mich so genau, dass ich ihr beinahe beteuert hätte, ganz sicher kein Kind zu erwarten. »Also gut, Quinn, du hast gewonnen. Es ist nur … ich bekomme dich kaum noch zu Gesicht in letzter Zeit. Es ist fast wieder so, als würde ich allein wohnen.«
»Och, Süße.« Ich trat vor, umarmte meine Schwester, die schon wieder nach einem ihrer heiß geliebten Kräutertees roch, und wünschte mir einen flüchtigen Moment lang, dass noch alles so wäre wie in meiner Anfangszeit in Nanaimo: fremd und unsicher, aber dafür ohne echte Gefahren oder die Befürchtung, dass nicht nur meine beste Freundin in Schwierigkeiten war, sondern auch der Mensch, für den ich jeden Tag mehr empfand. »Ich bin ja in einer Woche wieder da.«
Zumindest hoffte ich, dass unser Ausflug nach Alberta nicht länger dauern würde. Wir würden mit dem Tribe der Schwarzbären reden, der laut eigener Aussage nicht an dem Angriff auf Winter Harbour beteiligt gewesen war und auch keinen Kontakt zu Oona und ihren Leuten hatte. Danach wollten wir sie aufspüren, um Nathan und die anderen zu befreien. Zumindest war das der lockere Plan. Was genau wir tun würden, wenn wir Oona gefunden hatten, wusste ich nicht. Aber das war auch nicht mein Problem. Ich – und das hatte mir der Rat deutlich klargemacht – war nur dazu da, Nathan zu finden. Aus allem anderen sollte ich mich heraushalten. Ich war quasi der Scout, aber das war mir auch ganz recht. Vor allem war ich froh, überhaupt eine Aufgabe bekommen zu haben und nicht ausschließlich als Problem eingestuft worden zu sein – oder als Feind.
Nach dem Angriff auf Winter Harbour und dem Gespräch mit dem Rat hatte ich mich vor Angst in eine Ecke des winzigen Raums gekauert, in dem ich eingesperrt gewesen war. Ich fürchtete, dass die Ratsleute mich beseitigen wollten, um jede Beeinflussung durch eine Sdáng im Keim zu ersticken. Auch wenn ich ihnen gesagt hatte, dass ich mit etwas Glück Nathan und damit Oona aufspüren konnte, war ich mir nicht sicher, ob sie mir glaubten – ganz zu schweigen davon, ob sie das Risiko eingingen, mich am Leben zu lassen. Zumindest Gabriels Vater traute mir nicht. Bei Nathans Dad war ich mir nicht sicher.
Der Raum besaß keine Fenster, wie eine Gefängniszelle, und ich hockte die ganze Zeit einfach nur zitternd auf dem Boden. Es hatte sich wie Tage angefühlt, obwohl es laut Tohmah nur knapp zwei Stunden gewesen waren. Bis dahin hatte ich lediglich gewusst, was Langeweile mit der Zeit anstellen konnte. Wie sehr sie die Minuten dehnte und verzerrte. Aber seitdem wusste ich auch, welche Macht Todesangst besaß, und ich würde mich nie wieder beschweren, wenn ich eine Stunde oder länger auf jemanden oder etwas warten musste.
Als die Tür endlich geöffnet wurde und Tohmah eintrat, konnte ich mich nicht einmal bewegen. Er hatte mir aufgeholfen und mir ins Ohr geflüstert, dass ich in Sicherheit war, immer und immer wieder, bis ich ihm endlich glauben konnte. Erst dann hatte ich geweint.
Energisch verdrängte ich die Erinnerung. Ich war in Sicherheit, zumindest vorläufig. Nun musste ich den Tribes beweisen, dass ich auch von Nutzen war. Ich werde Nathan finden. Ihn und Maya.
Belle schob mich von sich, strich mir das Haar über die Schulter zurück und seufzte. »Also gut, Quinn. Lass deine arme Schwester allein ihren Wein bei irgendeiner Netflix-Serie trinken.«
Ich gab ihr einen Kuss auf die Wange und machte mich daran, meine restlichen Sachen in den Rucksack zu stopfen. »Wenn ich zurückkomme, zeigst du mir deine neuen Lieblingsserien, und ich schwöre, ich werde mich nicht beschweren, auch wenn Ärzte oder Anwälte darin vorkommen und alles superlangweilig ist. Aber war da nicht was mit einem Date?« Ich angelte nach meinem Zeichenblock. Es konnte nicht schaden, meine Skizzen und Aufzeichnungen zu den alten Motiven der Wandler mitzunehmen. »Mit dieser Rosanna?«
»Okay, schuldig«, sagte Belle und winkte mich weg. »Ich wünsch dir viel Spaß. Und viel Erfolg. Zeig deinem Prof, dass du seine beste Studentin bist! Und meld dich mal, ja? Und pass auf dich auf! Und fahr kein Auto, wenn du müde bist. Und … musst du überhaupt fahren, oder übernimmt das jemand?« Sie verzog das Gesicht, als ich eine Hand in die Hüfte stemmte und sie einfach nur anstarrte. »Ich tue es schon wieder, oder? Mich in die Überschwester verwandeln?«
Trotz der Sorgen, die durch meinen Kopf tobten und mein Herz schwer machten, musste ich grinsen. »Ja.«
Sie lachte und gab mir einen Kuss auf die Wange. »Dann noch einmal die Kurzfassung: Pass auf dich auf und hab Spaß.«
»Wird gemacht.«
Nun wurde ich doch nervös. Es war so weit. Gleich würde ich in Tohmahs Wagen steigen, um kurz darauf in Gesellschaft von Wandlern und Sängern Vancouver Island zu verlassen. Diese Reise war vermutlich gefährlich, auch weil ich noch immer nicht einschätzen konnte, wo ich stand. Für die Ratsmitglieder war ich nur interessant, solange sie mir glaubten, dass ich wirklich eine Verbindung zu Nathan besaß. Zudem wusste niemand, was uns bei den Schwarzbären erwartete. Es hieß zwar, dass Oona und ihre Leute nichts mit dem Tribe zu tun hatten, aber auch das konnte eine Lüge sein. Oder sogar eine Falle. Trotzdem mussten wir es versuchen.
Vor dem Haus erklangen Motorengeräusche. Hastig schulterte ich den Rucksack. »Ich muss los, Belle.«
Wir umarmten uns noch einmal fest. In der Diele schnappte ich mir meine Jacke, riss die Tür auf … und blieb wie angewurzelt stehen. Vor mir parkte ein Porsche in Pastellgelb. Ich hätte mich nicht mal gewundert, wenn sich die Türen geöffnet hätten und Abertausende, flauschige Küken herausgehüpft wären. Eines konnte ich mit Sicherheit sagen: Das war nicht Tohmah.
Verwundert blickte ich die Straße hinab, als eine junge Frau filmstarreif ausstieg. Ich unterdrückte ein Stöhnen. Was wollte Joanna Blaise hier?
Die Queen meiner Uni – und feige Berglöwenwandlerin – stöckelte auf mich zu, als hätte es den Vorfall in Winter Harbour niemals gegeben. Sie sah so perfekt aus wie immer. Keine Wunden, nicht einmal ein Kratzer oder ein falsch gestyltes, blondes Haar. Was nicht verwunderlich war, schließlich hatte sie sich gleich zu Beginn der Kämpfe verzogen und auch danach nicht mehr blicken lassen.
Joanna blieb vor mir stehen und überragte mich dank ihrer Körpergröße und der mörderischen Heels um mehr als einen Kopf. Ihre langen, blonden Haare verströmten ein fruchtiges Aroma und wehten bei der kleinsten Brise auf wie Seide. Sie lächelte so süß, dass ich ihr am liebsten vorgeschlagen hätte, für eine wohltätige Organisation Spenden zu sammeln – das wäre ein riesiger Erfolg geworden. Dann aber fielen ihre Mundwinkel so abrupt nach unten, als hätte jemand die Fäden einer Marionette durchtrennt.
»Was auch immer du geplant hast, um Copeland zu retten, lass meinen Bruder da raus!«, zischte sie.
Ich drehte mich kurz um, dann packte ich Joanna an der Schulter und schob sie zurück auf die Straße. Belle durfte von alldem nichts mitbekommen.
»Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Wenn du Fragen hast, warum wendest du dich nicht an euren Vater?« Ich bemühte mich, sie anzulächeln, nur für den Fall, dass man uns beobachtete.
Doch sie dachte nicht daran, die Scharade mitzuspielen, und riss sich los. »Mein Vater! Mein Vater ist auf dem Weg zur Fähre und überlegt, wie er unsere Leute am besten schützen kann, während er Copeland senior und dich auf einen netten Ausflug begleitet, um Nathan zu retten.«
Ich verzichtete zunächst darauf, ihr zu sagen, dass Nathan nicht als Einziger entführt worden war, zuckte die Schultern und gab mich lässiger, als ich war. »Wär wohl nicht so sinnvoll, wenn die Ratsmitglieder sich nicht um solche Belange kümmern würden, oder? So habe ich ihre Funktion verstanden, aber korrigier mich gern, wenn ich falschliege. Zudem ist dir womöglich entgangen, dass Oona auch jemanden aus eurem Tribe mitgenommen hat?«
Ihre Lippen zitterten, als wäre sie nicht ganz sicher, ob sie mir eine Grimasse schneiden oder die Zähne fletschen sollte. »Ich lasse mich von einer Verbotenen wohl kaum über Angelegenheiten der Tribes belehren!«
Wie immer versetzte mir die Bezeichnung einen scharfen Stich. »Also gut, Joanna, was willst du dann? Warum bist du mit deinem schicken Auto hergekommen?«
Sie hob das Kinn, ihre Augen blitzten. »Ich weiß nicht, was du meinem Bruder gesagt oder wie du ihn um den Finger gewickelt hast, und es ist mir auch egal. Allerdings wirst du dafür sorgen, dass er seine Entscheidung rückgängig macht. Gabriel wird nicht mit euch nach Alberta fahren. Oder habt ihr etwa alle vergessen, was passiert ist?«
»Nein«, murmelte ich. »Ganz sicher nicht. Aber vielleicht hast du etwas nicht richtig mitbekommen.«
Wandler waren getötet und andere verschleppt worden. Sam war gestorben. Genau wie Isra. Der Rat hatte entschieden, mich als notwendiges Übel zu betrachten und in einer kleinen Gruppe nach Alberta zu fahren, um erst einmal herauszufinden, ob der Tribe der Schwarzbären wirklich die Wahrheit sagte oder Informationen besaß, die auf den ersten Blick irrelevant erschienen, aber dennoch wichtig sein könnten. Ja, ich war überrascht gewesen, als Gabriel sich freiwillig gemeldet hatte. Allerdings hatte er sich auch im Vorfeld schon vernünftig verhalten und den Kampf gegen die Bären nicht gescheut.
»Und seit wann glaubst du überhaupt, dass ich einem Wandler sagen kann, was er zu tun und zu lassen hat? Denkst du, Gabriel wird hierbleiben, wenn ich ihn darum bitte? Was ist los mit dir?«
Ihre perfekt geschminkte Unterlippe zitterte nur kurz, dann hatte sich Joanna wieder unter Kontrolle. »Mir ist es egal, wie du es anstellst. Bisher hast du ja durchaus Talent darin gezeigt, dich bei den Tribes einzuschleimen. Erst Maya, dann die Copelands und nun sogar mein Bruder.«
»Du spinnst, Joanna.«
Sie zischte, als wäre ich es nicht wert, in ihrer Gegenwart die Stimme zu erheben, und auf einmal kehrte ein allzu bekanntes Funkeln in ihre Augen zurück. Mit diesem Blick hatte sie mich durchbohrt, als ich ihr an der Uni widersprochen hatte, um Maya in Schutz zu nehmen, und als sie herausgefunden hatte, was ich war. Er verband Wachsamkeit und Überheblichkeit auf eine Weise miteinander, die für ihr Gegenüber nur böse ausgehen konnte.
»Überleg es dir genau, Quinn, ob du dich wirklich einmischen willst. Glaub ja nicht, dass du für die Tribes etwas Besonderes bist, weil du uns beeinflussen kannst.« Sie bleckte die Zähne, und von der Uni-Königin war keine Spur mehr zu sehen. Jetzt war Joanna ganz Berglöwin – und im Angriffsmodus.
»Ich glaube ganz sicher nicht, dass …«
»Ich kenne dich besser, als du ahnst.«
Ihr Unterton ließ mich innehalten.
»Du denkst, du weißt, wer du bist, nur weil du dich plötzlich in einen armseligen Rotluchs verwandeln kannst? Da liegst du falsch. Man weiß niemals alles über sich, wenn man seine Eltern nicht kennt.« Das Funkeln in ihren Augen schien zu pulsieren und ließ ihr Lächeln bitter erscheinen. Bitter und gefährlich. »Die Tribes zeichnen alle Geburten auf, weißt du? Die Unterlagen lagern bei uns zu Hause. Bisher hat sich niemand die Mühe gemacht, darin zu suchen. Niemand außer mir.«
Ich schluckte hart, als ich begriff, worauf sie hinauswollte. »Du weißt, wer meine Eltern waren? Wie sie hießen?« Das konnte einfach nicht wahr sein. So lange hatte ich nach Informationen gesucht, und ausgerechnet Joanna fand ein Puzzlestück? Ich dachte an den Mann aus meinen Visionen – nein, aus meinen Erinnerungen, in denen auch Monique vorkam. Einerseits kannte ich ihn nicht, andererseits war da eine Sehnsucht tief in mir, die auf ihn abzielte.
Joanna schnaubte. »Ich bin die Einzige, die das weiß, und das bleibe ich vorläufig auch. Der Deal ist also simpel, selbst du solltest ihn begreifen. Wenn meinem Bruder irgendetwas geschieht, wirst du nie erfahren, wer dich ausgesetzt hat oder ob irgendwo noch Verwandte von dir leben. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so schlimm. Vielleicht entscheiden mein Vater und die anderen Ratsmitglieder nach eurem kleinen Ausflug, dass du doch eine Gefahr für uns bist. Damit gäbe es ein Problem weniger. Außerdem … wer will schon die Namen derjenigen wissen, denen man nichts bedeutet hat?« Die Maske kehrte zurück; das strahlende Lächeln einer blonden Beauty-Queen.
Ich war von Joanna einiges gewohnt, trotzdem dauerte es, bis die Worte bei mir ankamen. Sie schlugen genauso heftig ein, wie sie es sich vermutlich gewünscht hatte, und ich grübelte, warum mich das Ganze so mitnahm. Was würden mir zwei fremde Namen schon verraten? Sicher nicht, wer ich wirklich war.
Zumindest glaubte ich Joanna. Sie war zwar eine intrigante Egoistin, aber das alles hatte sie sich nicht nur aus den Fingern gesogen. Dabei schockierte mich weniger, dass sie die Zukunft mit der Vergangenheit erpressen wollte. So lief das in ihrer Welt: Die Blaises befahlen, und wenn sie nicht bekamen, was sie sich wünschten, griffen sie zu anderen Maßnahmen. Aber während Joanna noch immer ihr gewohntes Spiel trieb, umgeben von ihren alten Sorgen und Gedanken, musste ich mich auf das konzentrieren, was vor uns lag. Was wichtig war. Das gab mir die nötige Ruhe, um ihr in die Augen zu sehen, bis sie blinzelte.
»Joanna, ich habe meine biologischen Eltern zwar nie kennengelernt, aber ich wurde von liebevollen Menschen aufgezogen, die für mich Mum und Dad sind. Ich habe sogar eine großartige Schwester. Wenn man etwas nicht kennt, vermisst man es nicht. Wenn du mich also erpressen willst, musst du etwas anderes finden.«
Sie verengte die Augen so sehr, dass sich ihre langen Wimpern ineinander verfingen.
Ich schüttelte den Kopf. »Ja, sie haben mich zurückgelassen, aber ich werde diesen Fehler nicht machen. Ich werde Nathan, Maya und die anderen finden, und anschließend können wir gern darüber reden, ob du weiterhin so sein willst.«
Sie trat näher, und ich erkannte, dass ich mich zuvor geirrt hatte: Joanna scheute nicht jeden Kampf; den aus Worten liebte sie. »Du bist Abschaum, Quinn«, zischte sie. »Und vermutlich lebst du sowieso nicht mehr lange, wenn mein Vater tut, was er nun einmal tun muss, und dich verschwinden lässt.«
Ein Wagen bog um die Ecke, und dieses Mal war es wirklich Tohmah. Er hielt mit laufendem Motor am gegenüberliegenden Straßenrand.
»Ich muss gehen«, sagte ich. »Bist du eigentlich schon einmal auf die Idee gekommen, dass Gabriel uns freiwillig begleitet?«
Unter all den Hochmut und Zorn mischte sich ein Hauch Unsicherheit. »Du hast gut reden, nicht wahr? Wenn Copeland stirbt, hast du noch immer das hier.« Sie deutete über meine Schulter.
Ich runzelte die Stirn. Was meinte sie, mein Leben bei den Menschen, die von nichts wussten? Belle?
»Wenn Gabriel nicht zurückkommt, habe ich niemanden mehr. Welch eine Freude für dich und Nathan, nicht wahr?«
»Du hast noch einen Vater, wenn ich mich richtig erinnere. Und ein schönes großes Haus. Und Freundinnen, die dir jeden Tag nur das erzählen, was du hören willst.«
Sie riss das Kinn nach oben, um noch besser auf mich herabblicken zu können. »Du hast wirklich keine Ahnung, wie es ist, ein Ratsmitglied zum Vater zu haben, Mischling.« Mit diesen Worten strich sie über ihre glänzende Mähne, drehte sich um und ging mit energischen Schritten zu ihrem Porsche zurück.
Ich folgte ihr, überquerte die Straße, verfrachtete meinen Rucksack auf der Rückbank von Tohmahs Wagen und ließ mich kurz darauf in den Beifahrersitz fallen.
»Was war das denn?«, fragte Tohmah und wendete. Er hatte sein kinnlanges Haar zu einem Zopf gebunden. Es war noch feucht und hatte dunkle Flecken auf seinem Shirt hinterlassen. Er sah aus, als hätte er ein entspanntes Wochenende hinter sich und nicht nur ein paar Stunden geschlafen, um Energie zu sammeln.
Ich starrte zum Porsche. Joanna machte keine Anstalten loszufahren, und kurz befürchtete ich, sie würde warten, bis wir um die Ecke gebogen waren, um Belle alles zu erzählen. Aber das wäre Unsinn. Sämtliche Wandler achteten schließlich darauf, dass ihre Existenz nicht bekannt wurde.
»Ich habe keine Ahnung«, sagte ich langsam. »Sie glaubt, dass ich Gabriel irgendwie dazu gebracht habe, uns zu begleiten, und hat verlangt, ihm das wieder auszureden.«
»Sie ist nicht die Einzige, die sich über seinen Entschluss wundert.« Tohmah zuckte die Schultern.
»Sie sagt, sie habe Informationen über meine wahren Eltern.«
»Die hat der Rat.«
»Wohl eher Mr Blaise.«
Tohmah nickte nur. Er zeigte sich selten erstaunt, stattdessen sammelte und speicherte er Informationen mit einer Ruhe, die ich auch nach langer Übung nicht erreichen würde.
»Besagte Infos befinden sich wohl nun in ihrem Besitz, und sie will sie erst herausrücken, wenn ihr Bruderherz wieder auf der Matte steht.«
Er warf mir einen Blick zu. »Hältst du so lange durch?«
»Ehrlich gesagt habe ich momentan keinen Kopf, um mich mit meinen biologischen Eltern zu befassen.«
Dafür lauschte ein Teil von mir permanent auf dieses Sirren, die Verbindung zu Nathan, die nur dann eintreten konnte, wenn er sich in einen Panther verwandelt hatte.
Damit war die Sache für Tohmah erledigt. Ich betrachtete ihn von der Seite, während er auf den Highway abbog. Es fühlte sich noch immer seltsam an, dass er mein Sänger war. Obwohl ich ihn erst seit Kurzem kannte, verließ ich mich so sehr auf ihn, dass ich ihm die Kontrolle über einen Teil meines Lebens als Rotluchs anvertraute. Aber ich wusste, er würde dieses Vertrauen niemals missbrauchen, und das war ein ziemlich gutes Gefühl.
Nach dem Angriff hatte niemand mehr einen Gedanken an die Jahresfeier verschwendet, die so viele Wochen lang vorbereitet worden war. Ein Teil der Wandler war in Winter Harbour geblieben, um Dinge zu regeln und Vorkehrungen zu treffen oder weil sie ohnehin das ganze Jahr über dort lebten. Andere waren zurück in ihre Heimatorte gefahren. Ich beneidete diejenigen, die zumindest ihren Verwandten gegenüber keine Geheimnisse hegen mussten.
»Wie geht’s nun weiter?«, fragte ich und rutschte tiefer in den Sitz.
»Wir treffen die anderen an der Fähre, setzen über nach Vancouver und sehen, wie weit wir heute noch kommen. Bill und Patricia haben sich bei den Sängern in Alberta rückversichert, dass die Schwarzbären einem Besuch freundlich gegenüberstehen.«
»Freundlich?« Es fiel mir schwer, das Wort mit den Bären, die ich gesehen hatte, in Einklang zu bringen. Muskulöse, massige Männer, die an der Seite einer Wahnsinnigen dabei zusahen, wie ein manipulierter Panther seine Sängerin tötete, waren ganz sicher nicht freundlich. »Ich habe … shit!«
Das Bild tauchte schlagartig in meinem Kopf auf. Schwach nur, aber auffällig genug. Ich beugte mich vor und hielt mich mit einer Hand am Armaturenbrett fest. Tohmah sagte etwas, aber ich ignorierte es. Ich musste mich konzentrieren. Tief in mir setzte eine Art Summen ein. Ich schloss die Augen, nahm aber nicht mehr wahr als verhaltene Bewegungen hinter einer Wand aus Schatten. Sie kristallisierten sich leicht heraus, um dann wieder zu verschwinden, aber ich war sicher, etwas auf unebenem Boden gesehen zu haben – eine Decke oder einen Schlafsack? – sowie eine Art Plane darüber. Vielleicht ein Zelt. Das Bild wurde durchsichtiger, und das Summen nahm ab.
»Nein«, murmelte ich. »Nicht.« Ich versuchte, mich zu entspannen und die Eindrücke gleichzeitig festzuhalten. Sie veränderten sich und zeigten eine Abfolge von Buchstaben und Zahlen, wie hinter einem dunklen Schleier verborgen. Ich wollte sie entziffern, doch als wäre ich einem Geheimnis zu nah gekommen, verschwammen die Konturen und lösten sich schließlich in nichts auf. Verzweifelt presste ich die Hände vor die Augen in der Hoffnung, noch einmal etwas zu empfangen, doch nach einer Weile gab ich auf.
»Das war Nathan«, sagte ich, ließ die Hände sinken und stellte fest, dass wir am Straßenrand parkten. Energie flutete meinen Körper, bis es in mir brodelte. Er lebte! Auf einmal fühlte ich mich leichter, trotz allem, was uns noch bevorstand. Erst jetzt begriff ich, dass ich insgeheim befürchtet hatte, ihn nie wiederzusehen. Jede einzelne Sekunde, seitdem Oona ihn in Winter Harbour mitgenommen hatte.
»Was hast du gesehen?« Tohmahs Stimme war leise.
Ich leckte mir über die Lippen. »Einen dunklen Boden wie … Erde. Und eine Decke oder einen Schlafsack oder vielleicht auch nur eine Jacke. In einer Art Zelt oder Unterstand. Etwas war in den Boden geritzt. Ein Name, Kate oder Katie. Darunter standen die Buchstaben H, O und D.« Das ergab absolut keinen Sinn. »Und noch Zahlen, aber …« Ich überlegte, doch so sehr ich mich auch anstrengte, ich konnte keine Erinnerungen hervorzaubern, die nicht da waren. »Das war alles.«
»Das bedeutet immerhin, dass Nathan noch lebt. Sagt dir der Name Katie etwas? Oder die anderen Buchstaben?«
»Nein. Weder noch.« Ich wusste nicht einmal, ob ich alles richtig entziffert hatte. »Und es war seltsam. Als wäre die Verbindung zu ihm nicht mehr so stark wie vorher. Denkst du, das hat etwas mit der Entfernung zu tun?«
»Möglich. Wobei … denk an Zach. Er schien völlig neben sich zu stehen.«
Bei dem Gedanken an Nathans Cousin Zachary schauderte ich. Dass Nathan mich angreifen würde, auch wenn er unter Oonas Einfluss stand, konnte ich mir nicht vorstellen. Aber bis vor einigen Tagen hatte es noch vieles gegeben, was ich mir nicht vorstellen konnte und das dennoch existierte.
»Fahren wir weiter«, flüsterte ich und angelte nach meinem Zeichenblock, um die wenigen Eindrücke zu skizzieren.
Jeder Gedanke an Nathan tat weh. Immer wieder erinnerte ich mich an den Moment, als er mich zum ersten Mal geküsst hatte. An unsere gemeinsame Nacht und unseren Streifzug durch den Wald, Schulter an Schulter, Panther neben Rotluchs. Beides war noch so neu für mich, aber gleichzeitig so unendlich wichtig. Wie eine Kostbarkeit, die permanent zu zerbrechen drohte. Und jetzt kam die Sorge dazu, dass Oona ihn verletzen könnte oder Schlimmeres. Er hatte mir erzählt, wie sehr er stets darum kämpfte, die Kontrolle zu behalten, um niemandem zu schaden, und nun war da diese Macht, die ihm jede Kontrolle so leicht entreißen konnte.
Eine Sdáng wie ich.
Ich lehnte mich zurück, starrte ins Nichts und schickte ihm die stumme Bitte, zu seinem Tribe und seiner Familie zurückzukehren. Und zu mir.
Am Anleger stauten sich die Fahrzeuge, und ich wurde ganz hibbelig, da die riesige Fähre bereits am Dock lag, Tohmah aber abbog und einen Parkplatz ansteuerte.
»Sollten wir uns nicht einreihen?«, fragte ich.
»Wir müssen zuerst die anderen finden. Ruhig, Quinn, wir haben noch Zeit. Und es ist nicht sehr voll.«
Ich sah das nicht ganz so locker. Andererseits wusste ich, wie viele Fahrzeuge in den riesigen Bauch der Fähre passten, und so ein Andrang herrschte tatsächlich nicht. Also beugte ich mich vor und sah mich um. Nathans Dad entdeckte ich zuerst. Er lehnte am Kotflügel seines schwarzen Jeeps und hatte die dichten Augenbrauen zusammengezogen. Wenn er es darauf anlegte, wurde er ganz sicher niemals nach dem Weg, einer Auskunft oder etwas Kleingeld gefragt. Je nach Stimmung strahlte James Copeland eine Autorität aus, die einen einschüchterte oder sogar bedrohlich wirken konnte. Fast so, als ließe er seine zweite, tierische Natur manchmal mehr, manchmal weniger stark durchschimmern. Jetzt wirkte er vor allem nachdenklich. Ich kannte ihn zu wenig, um zu sagen, ob er an Nathan dachte, aber ich wusste instinktiv, dass es besser war, mich ihm nicht zu nähern. Ich war den Wandlern trotz allem ein Dorn im Auge.
Tohmah schlug das Lenkrad ein und parkte neben Mr Copeland, ohne mit der Wimper zu zucken. Wir sahen uns kurz an und stiegen aus. Nathans Vater starrte zu uns herüber und senkte dann den Blick, aber ich hatte das Blitzen in seinen Augen bemerkt. Misstrauen oder Verachtung? Es war schwer zu sagen. Erst jetzt sah ich die beiden Männer hinter seinem Wagen, die alles genau im Auge behielten. Beide hatten kurze Haare und trugen schwarze Langarmshirts zu dunklen Hosen sowie Sonnenbrillen. Besser und vor allem auffälliger hätte ich das Klischee nicht zeichnen können.
»Bodyguards?«, fragte ich Tohmah. Ich musste gar nicht erst versuchen zu flüstern, die Wandler hätten mich ohnehin gehört. Erst jetzt fiel mir auf, dass mir einer der beiden Typen bekannt vorkam. Er hatte Nathan vor der Jahresfeier von der Uni abgeholt.
»Natürlich«, sagte jemand hinter mir. »Oder denkt ihr, Ratsmitglieder würden in Zeiten wie diesen ohne Schutz zu einem fremden Tribe reisen?«
Gabriel Blaise.
Ich zwang ein Lächeln auf meine Lippen, wandte mich langsam um und fragte mich nicht zum ersten Mal, was seit Winter Harbour mit ihm los war. Diese Freundlichkeit oder vielmehr Umgänglichkeit war neu. Noch traute ich dem Frieden nicht. Gabriel selbst noch weniger.
»Hey«, sagte ich höflich. Es klang dennoch ironisch. »Hat Joanna dich noch erreicht?«
Er zog die Brauen zusammen und schob sich die hellen Haare aus der Stirn. »Joanna? Warum sollte sie?«
»Weil sie sich die Mühe gemacht hat, vor meiner Tür aufzukreuzen. Sie wollte sichergehen, dass ich meine Überredungskünste nutze, damit du hierbleibst.« Alles andere verschwieg ich vorläufig. Nicht jetzt und hier.
Gabriel sah überrascht aus, aber vielleicht spielte er das auch nur. »Sorry. Dad wollte eigentlich zusammen mit Francis in Winter Harbour bleiben, um alles am Laufen zu halten. Deshalb hatte ich vorgeschlagen, die Gruppe an seiner Stelle zu begleiten. Erst im letzten Augenblick hat er es sich anders überlegt, aber da stand meine Entscheidung schon fest.«
Natürlich. Edmund Blaise arbeitete zwar eng mit seinen Ratskollegen zusammen, ertrug es aber nicht, wenn die Berglöwen – und besonders er – nicht überall die Finger im Spiel hatten. Meine Gedanken blieben kurz bei dem zweiten Namen hängen. Ein wenig bedauerte ich es, dass Francis Marlatt uns nicht begleitete. Schließlich war er als Anführer der Rotluchse das Ratsmitglied meines Tribes, auch wenn ich nicht wusste, ob man mich dort jemals akzeptieren würde. Es war ja nicht einmal sicher, wie der Rat nach dieser ganzen Sache in meinem Fall entscheiden würde.
Energisch riss ich mich von dieser Gedankenspirale los und konzentrierte mich wieder auf Gabriels Worte. Zum Glück war von seinem Vater weit und breit noch nichts zu sehen.
»Und was hat das alles mit Joanna zu tun?«, fragte ich.
Sein Blick veränderte sich. Wo hatte er plötzlich gelernt, halbwegs zerknirscht zu wirken? Vermutlich hat er sich ein YouTube-Tutorial angesehen.
»Dad hat sie zurück nach Nanaimo geschickt, und ich vermute, dass sie allein in dem großen Haus durchdreht.«
»Ich dachte, es wäre bewacht. Und habt ihr nicht auch eine Köchin?«
Er hob eine Augenbraue. »Joanna neigt nicht gerade dazu, sich Angestellten anzuvertrauen.«
Ich fragte mich, warum er mir das so offen erzählte, war aber nicht wirklich scharf auf eine Erklärung. »Soweit ich weiß, hat sie auch Freundinnen. Und sicher auch eine Dauerkarte im Spa. Tut mir leid, dass es ihr momentan so schlecht geht. Wir sehen uns.« Ich drehte mich um und ließ ihn stehen. Normalerweise war ich nicht so, aber um meine Nerven stand es nicht gut. Besser, ich ließ Gabriel einfach Gabriel sein.
»Quinn, warte.«
Überrascht hielt ich an. Dieser fast vorsichtige Tonfall war neu.
Gabriel schien unsicher. »Wir hatten einen beschissenen Start, okay? Aber ich denke, ich war fair.« Seine Hand berührte eher beiläufig eine Stelle in seinem Nacken, und mir wurde kalt. Ich wusste genau, was er mir damit sagen wollte. Er hatte mein Geheimnis gekannt, bevor ich nach Winter Harbour gekommen war, aber er hatte es bewahrt und mir damit ein Zeitfenster geschenkt.
»Jetzt sitzen wir in einem Boot«, fuhr er fort. »Vielleicht klappt das ohne Schwierigkeiten, bis wir zurückkommen.«
Wenn wir zurückkommen.
Ich nickte. »Das muss es wohl.«
»Gut.«
Wir schüttelten uns nicht die Hände, aber das war auch nicht nötig. Letztlich hatte Gabriel durch sein Stillschweigen über mein Tattoo bewiesen, dass ich ihm vertrauen konnte.
Eine seltsame Vorstellung.
Ich sah mich nach Tohmah um und fand ihn nach kurzer Suche ein Stück entfernt im Gespräch mit Patricia Naganash. Ich erkannte die zweithöchste Sängerin sofort. Kurz bedauerte ich, dass Bill Edenshaw uns nicht begleitete. Zu dem Obersten der Sänger hatte ich in Winter Harbour das meiste Vertrauen gefasst. Er besaß diese wachen Augen, die schon viel gesehen hatten, und machte den Eindruck, auf meiner Seite zu sein. Ich hoffte, dass zumindest die Sänger die Sdáng neutral betrachteten.
Plötzlich spürte ich, dass mich jemand anstarrte. Ich wandte mich um und zuckte zusammen, als ich Edmund Blaise entdeckte. Gabriels und Joannas Dad schloss soeben die Wagentür und musterte mich wie eine Feindin. Wie Oona.
Wie eine Verbotene.
Auf meiner Haut kribbelte es unangenehm, und ich kämpfte mit aller Kraft dagegen an, mich abzuwenden. Ich hatte mir nichts zuschulden kommen lassen, im Gegenteil: Ich hatte mein Leben riskiert, um für die Wandler zu kämpfen. Ein Teil von mir war wütend, weil sie sich weigerten, das zu sehen.
»Damit ist unsere Gruppe dann wohl vollzählig«, sagte Gabriel leise hinter mir, während ein weiterer Wagen hielt, aus dem eine Frau auf der Beifahrerseite stieg: Dorothy Brossard, Ratsoberste der Polarfüchse. Tohmah war zum Glück alle wichtigen Namen mit mir durchgegangen, bis ich sie mir hatte merken können. Dorothy wirkte schmal und zart in ihrem beigefarbenen Kostüm und mit den hochgesteckten, hellen Haaren, und ich fragte mich, warum ausgerechnet sie uns begleitete. Soviel ich wusste, drängten die Polarfüchse nicht in die vordersten Reihen, wenn es um Konflikte ging, aber vielleicht war ja gerade das bei den Gesprächen mit den Bären eine gute Taktik. Empathie statt Machtbekundungen. Ich dachte an Maya, und wie so oft in den vergangenen Tagen schickte ich ihr in Gedanken eine Nachricht.
Halt durch. Wir sind unterwegs. Nicht mehr lange, und wir holen dich da raus. Dann ziehst du erst mal zu Belle und mir, weil sich deine Mutter einen Dreck um dich kümmert.
Da waren wir also. Ein Panther-, zwei Berglöwen- sowie ein Polarfuchswandler, zwei Bodyguards, deren Tribezugehörigkeit ich nicht kannte, zwei Sänger und ich. Wunderbar. Wenn wir es schafften, bis Alberta zu kommen, ohne uns gegenseitig wegen unterschiedlicher Ansichten an die Kehle zu gehen, war das erste Ziel schon einmal erreicht.
Ich atmete tief durch und sah Gabriel an. Wenn das hier funktionieren sollte, durfte ich mich nicht einschüchtern lassen. »Also gut. Ich denke, ich sollte mit allen reden.«
»Was? Warum?«
»Ich glaube, ich hatte eine kurze Verbindung zu Nathan.«
Kapitel 3
QUINN
Ich war nicht verwöhnt, was Betten betraf, aber als ich an diesem Morgen in der Hinton-Pension aufwachte, schmerzte mein gesamter Rücken. Die halbe Nacht lang hatte ich mich nicht bewegt, nachdem ich endlich eine Stelle zwischen den Sprungfedern gefunden hatte, die halbwegs erträglich war. Tohmah hatte sich am Vorabend zwei Decken auf dem Boden ausgebreitet und mir versichert, dass ihm so etwas nichts ausmachte. Wahrscheinlich hatte er bequemer gelegen als ich.
Gestern am späten Abend hatten wir entschieden, dass es nichts brachte, übermüdet in Janvier anzukommen, wo der Tribe der Schwarzbären lebte. Zum einen hätten uns dann eventuell wichtige Hinweise entgehen können, zum anderen wollte niemand die leicht angespannte Beziehung zwischen den Wandlern von Vancouver Island und den Bärenwandlern durch ein Auftauchen in der Nacht strapazieren. Während die Panther und Jaguare, Berglöwen, Rotluchse und Polarfüchse sich auf Vancouver Island zusammengeschlossen hatten, um ihr Überleben zu sichern, war die Beziehung zu den Bärenwandlern nie besonders eng gewesen und im Laufe der Jahre immer schwächer geworden. Vielleicht hatte sich das allgemeine Misstrauen, das viele Wandler mit sich herumschleppten, auf die fremden Tribes übertragen, vielleicht waren Bären und Raubkatzen sowie Polarfüchse aber auch einfach nicht die besten Freunde. Letzteres war meine Vermutung, aber ich hütete mich, einen der Wandler darauf anzusprechen.