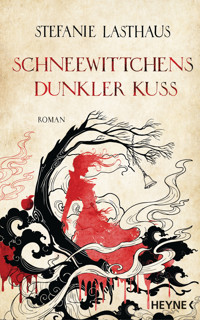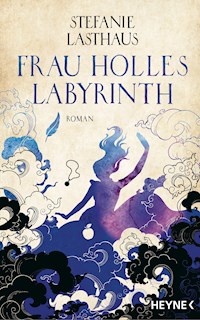
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Als Mary zum einundzwanzigsten Geburtstag ihrer jüngeren Schwester Moira nach Hause aufs Land fahren muss, ist sie nicht gerade begeistert. Nach dem Tod der Eltern sind die beiden Schwestern bei ihrer strengen Tante aufgewachsen, die Moira immer bevorzugt hat. Als diese zum Geburtstag nun auch noch die Kette ihrer verstorbenen Mutter bekommt, ist Mary zutiefst verletzt. Die Schwestern geraten in einen Streit, bei dem das Amulett in den Brunnen im Garten ihrer Tante fällt. Mary bleibt nichts anderes übrig, als hinterherzuklettern. Doch als sie unten ankommt, ist sie nicht mehr in ihrer Welt, sondern in Frau Holles Labyrinth – einem düsteren, gnadenlosen Reich, in dem die Menschen keine Erinnerungen mehr an das haben, was ihnen einst lieb war. Für Mary beginnt ein brutaler Kampf ums Überleben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Als Mary zum einundzwanzigsten Geburtstag ihrer jüngeren Schwester Moira nach Hause aufs Land fahren muss, ist sie nicht gerade begeistert. Nach dem Tod der Eltern sind die beiden Schwestern bei ihrer strengen Tante aufgewachsen, die Moira immer bevorzugt hat. Als diese zum Geburtstag nun auch noch die Kette ihrer verstorbenen Mutter bekommt, ist Mary zutiefst verletzt. Die Schwestern geraten in einen heftigen Streit, bei dem das Amulett in den Brunnen im Garten ihrer Tante fällt. Mary bleibt nichts anderes übrig, als hinterherzuklettern. Doch als sie unten ankommt, ist sie nicht mehr in ihrer Welt, sondern in Frau Holles Labyrinth – einem düsteren, gnadenlosen Reich, in dem die Menschen keine Erinnerungen mehr an das haben, was ihnen einst lieb war. Für Mary wird der Kampf gegen Frau Holle nicht nur zum Kampf um das eigene Überleben, sie kommt auch einem erschütternden Geheimnis auf die Spur …
Die Autorin
Stefanie Lasthaus wuchs im Ruhrgebiet auf. Nach dem Studium zog es sie nach Australien, England sowie in die Schweiz. Zurück in Deutschland, widmete sie sich zunächst dem Dokumentationsfilm und schließlich ganz dem Schreiben – ob für Zeitungen, Zeitschriften, Onlinespiele, im PR-Bereich oder als Autorin ihrer Romane. Da sie nur noch temporär durch die Welt reisen kann, besucht sie in ihren Büchern Gegenden, die sie faszinieren. Stefanie Lasthaus lebt in Essen.
Stefanie Lasthaus
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 12/2022 Redaktion: Catherine Beck Copyright © 2022 by Stefanie Lasthaus Copyright © 2022 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Umschlaggestaltung: Das Illustrat GbR, München Satz- und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-29564-6V001
www.heyne.de
Für meine Freunde – weil ihr die Geschwister seid, die ich mir immer gewünscht habe.
1: Das fünfte Rad
1
Das fünfte Rad
Der Pontiac wackelte, als ein Truck über die Landstraße donnerte und Mary aus ihren Gedanken riss. Mit gerunzelter Stirn betrachtete sie die dreckige Windschutzscheibe, auf die sie Schnörkel um ein großes Fragezeichen gemalt hatte, ohne es zu merken. Das fasste die Situation perfekt zusammen. War es eine gute Idee gewesen, herzukommen?
Sie seufzte, als es auf dem Beifahrersitz brummte – wie eine Mahnung, doch endlich auszusteigen. Auf dem Weg aus der Stadt hierher war ein Polizeiwagen an ihr vorbeigezogen, mit blinkenden roten und blauen Lichtern auf dem Dach. Sie hatte den Eindruck gehabt, dass die Officers abbremsten, um einen Blick durch ihr Fenster zu werfen, und damit gerechnet, angehalten und abgeführt zu werden. In Handschellen vor einen mies gelaunten Sheriff mit Stetson gezerrt zu werden, der stoisch seinen Donut in den Kaffee tunkte, während er ihr Fragen stellte. Aber der Wagen war weitergefahren, vermutlich zu einer Schießerei in einem der Vororte.
Neben ihr brummte es erneut. Sie hatte ihr Handy auf Vibrationsalarm gestellt, da sie geahnt hatte, dass Jonah versuchen würde, sie zu erreichen. Und sie hatte recht behalten: zehnmal auf der Fahrt und dreimal, seit sie geparkt hatte. Während sie den Blick starr in den Himmel gerichtet hielt, zählte sie mit. Sie wusste, dass sie Mist gebaut und die Absprache mit ihm gebrochen hatte.
Ich stelle dich ein, wenn du deine Fähigkeit nicht für private Zwecke missbrauchst.
Das war lange Zeit gut gegangen. Doch nachdem die Auftragslage mies war, auf ihrem Konto seit Monaten Ebbe herrschte und ihr niemand mehr eingefallen war, von dem sie sich gefahrlos Geld leihen konnte, hatte sie ihr Versprechen beiseitegeschoben und ihr spezielles Talent auch ohne einen Auftrag von Locking Bird genutzt – Jonahs Schlüsseldienst. Es war so einfach, und vor allem ging es schnell. Sie musste die Finger lediglich auf das Schloss legen, sich kurz konzentrieren, und schon sprang es auf.
Sie war alles andere als stolz. Vielmehr schämte sie sich für ihren ersten Einbruch – den einzigen in ihrem Leben. Noch einmal würde sie eine solche Dummheit nicht begehen. Es war ein Fehler gewesen, und wie es aussah, musste sie demnächst dafür büßen. Die Polizei sämtlicher Bundesstaaten besaß eine Liste mit Leuten wie ihr: Personen, die über ein entsprechendes Talent verfügten und in öffentlichen Dienstleistungen tätig waren. Jonah hatte sie bei ihrer Einstellung melden müssen, als Absicherung, falls sie irgendwann mehr als die gebuchten Schlösser zur gebuchten Zeit öffnete. Ihre magische Fähigkeit war nützlich, machte sie aber auch schnell verdächtig.
Nachdem der Einbruch zur Anzeige gebracht worden war, hatte sich die State Police offenbar schnell bei Jonah gemeldet und ihm gedroht, und er gab das nun an sie weiter. Es war sein gutes Recht. Irgendwann musste sie das mit ihm klären, das war ihr klar. Aber nicht jetzt. Erst einmal wollte sie sich für eine Weile zurückziehen. Untertauchen und mit niemandem über das Problem reden, so, wie sie es am liebsten tat. Mary rieb über ein Loch in ihrer Jeans, spürte die ausgefransten Ränder unter ihren Fingern. Egal, wohin sie sich drehte, aus jeder Richtung zeigte das Leben ihr den Mittelfinger.
Ihr Handy vibrierte zweimal kurz. Eine Textnachricht. Mary gab sich geschlagen und las sie.
Glaub nicht, dass ich weniger sauer bin, wenn du Zeit schindest. Im Gegenteil, je öfter ich darüber nachdenke, desto wütender bin ich, Marybeth. Mit anderen Worten: Ich bin stocksauer. Schwing deinen Arsch in mein Büro.
Sie wusste genau, wie er jetzt aussah. Jonahs Gesicht wurde puterrot, wenn er sich aufregte, und mit geballten Fäusten und seinen blondierten Haaren erinnerte er an ein wütendes Kind, was aber vor allem an seiner Körpergröße lag. Ihr Auftraggeber war gerade einmal einen Meter dreiundsechzig – ein weiterer Grund, der ihn oft wütend machte –, aber andererseits eben auch ihr Boss. Er konnte sie jederzeit feuern, und sie vermutete, dass er ebenfalls dafür sorgen konnte, dass sie in seinem Metier keinen Fuß mehr auf den Boden bekam. Zumindest in diesem Bundesstaat. Falls die Polizei sich nicht bereits darum kümmerte.
Es war völlig okay, wenn er sich aufregte, aber sie durfte ihn sich nicht zum Feind machen. Was bedeutete: Sie musste ihm zumindest eine kurze Antwort schicken. Ihn nur ein wenig besänftigen, ohne sich in lange Diskussionen zu stürzen. Sie überlegte eine Weile und starrte auf ihre Finger, während sie im Kopf etwas möglichst Diplomatisches vorformulierte.
Hey, Jonah. Du hast recht, wir müssen dringend reden, und dann kann ich dir alles erklären. Aber übers Telefon ist das etwas unglücklich, und ich bin gerade nicht in der Stadt. Dringende Familienangelegenheiten, die ich nicht aufschieben kann, so gern ich es auch tun würde. Bin am Montag zurück und komme dann als Erstes bei dir vorbei, versprochen. Grüße, Marybeth.
Das war nicht mal gelogen, auch wenn sie noch bis gestern Nachmittag nicht im Traum daran gedacht hatte, zum Einundzwanzigsten ihrer Schwester aufzutauchen. Unter anderen Umständen hätte sie wie sonst eine kurze Nachricht geschickt oder allerhöchstens angerufen, weil mehr auch nicht gewünscht war. Aber die Sache mit dem Einbruch hatte Moiras Geburtstag in ein anderes Licht gerückt. Plötzlich war es eine großartige Idee gewesen, die Kleine nach all den Jahren zu drücken – obwohl Mary sich damals geschworen hatte, nie wieder einen Fuß auf Tante Eves Grundstück und in ihr Haus zu setzen, wo Moira noch immer lebte.
Aber man konnte nicht jeden Schwur halten. Ohnehin war es dämlich, überhaupt zu schwören, da man nie wusste, welche Spielchen die Zukunft bereithielt. Und niemand konnte verlangen, dass man den Kopf in der Schlinge ließ, nur weil man irgendwann ein paar unbedachte Worte ausgesprochen und dabei eine Hand auf sein Herz gelegt hatte.
Jonahs Antwort kam fast sofort, und Mary drückte sie weg. Ein Problem nach dem anderen. Erst einmal musste sie sich damit herumschlagen, wieder zurück in ihrem alten Zuhause zu sein. Es war ein seltsames Gefühl. Als hätte sie einen Kampf verloren, der so lange angedauert hatte, dass sie nicht mehr wusste, wie man Dinge begrub. Vielleicht sollte sie Tagebuch führen, um ihre verqueren Gedanken irgendwo zu sammeln.
Haha.
»Nicht fair«, murmelte sie. Sieben Jahre hatte sie keinen Fuß hierhergesetzt und geglaubt, dass die Vergangenheit auf dem Land in ihren Erinnerungen verblasst war. Nun stellte sie fest, dass es nur wenige Augenblicke gebraucht hatte, und alles war wieder da. So als wäre sie nie weggezogen.
Sie fluchte, um sich zu vergewissern, dass ihre Stimme anders klang als früher und sich nicht in die der jüngeren Mary verwandelt hatte. Seufzend klappte sie die Blende herunter und musterte sich in dem kleinen Spiegel. Ja, das war eindeutig sie, nicht mehr ihr sechzehnjähriges Ich mit Haaren bis zum Hintern und irgendeiner grellen Lippenstiftfarbe, die sie damals so gern ausprobiert hatte. Heute trug sie ihr Haar schulterlang, dunkelblond statt aufgehellt, und verzichtete in den meisten Fällen ganz auf Make-up. Vielleicht wirkten ihre Augen deshalb so dunkel, mehr schiefergrau als braun, und auch ein wenig müde. »Das schaffst du«, murmelte sie und rieb über ihren Nasenrücken, als könnte sie die wenigen Sommersprossen dort auslöschen und jemand anderes werden.
Ein Miauen von der Rückbank des Wagens riss sie aus ihren Gedanken. Mary drehte sich um und musterte Miss Kraski, die einzige ihr bekannte Katze, die nach jedem Nickerchen mit Bad Hair aufwachte. Ihr niedliches Gesicht sah momentan aus wie eine schwarz-weiße Sonne, der ein paar Strahlen abhandengekommen waren.
»Ja, wir sind da, meine Süße. Zurück in der Löwenhöhle, die du ja noch gar nicht kennst, hm?« Sie streckte sich und strich ihrer Katze zärtlich über den Rücken, tastete die Narbe der Hüft-Operation unter dem Fell entlang. Das Tier gähnte, schmiegte sich kurz an ihre Hand und wandte ihr dann das Hinterteil zu. Mary konnte es Miss Kraski nicht verdenken. Sie brauchte nach dem Aufwachen immer eine Weile, bis man sie ansprechen durfte. In der Hinsicht waren sie Schwestern im Geiste. Außerdem war es besser, wenn ihre fellige Freundin ausgeruht und entsprechend lieb und anschmiegsam war. So konnte sie tun, was Katzen nun einmal taten – für Entzücken sorgen sowie dafür, dass die Stimmung zwischen Mary, Moira und Tante Eve halbwegs erträglich blieb. Denn genau das bereitete ihr Kopfzerbrechen. Es würde schwer werden. Wenn sie Glück hatte. Wenn nicht … Nun. Mit schwer konnte sie umgehen. Mit unerträglich nicht, und die Grenze zwischen beidem konnte bei Tante Eve innerhalb von Sekundenbruchteilen und ohne Warnung überschritten werden.
So war es schon damals gewesen. Bei ihr, nicht bei Moira. Tante Eve hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie ihre ältere Nichte als Last empfand und am liebsten hinausgeworfen hätte. Es wäre vielleicht einfacher für Mary gewesen, den Grund zu erfahren, aber Tante Eve hatte nie darüber geredet – und sie sich nicht getraut, zu fragen. Stattdessen hatte sie sich daran gewöhnt, in einem Haus, in dem sie zu dritt wohnten, völlig allein zu sein. Im Grunde hatte es sie perfekt für das Leben vorbereitet: Man war am sichersten, wenn man sich an niemanden band und sich auf niemanden verließ außer auf sich selbst. Und vielleicht eine Winzigkeit auf Miss Kraski, bei der sie immerhin wusste, dass sie ab und zu eine Pfote ins Gesicht bekam, einfach weil der Katze danach war.
»Also dann«, seufzte sie, klappte den Spiegel wieder hoch, öffnete die Tür und stieg in dem Moment aus, als die Sonne durch die Wolken brach. Sofort musste sie blinzeln und überlegte kurz, im Handschuhfach nach ihrer Sonnenbrille zu suchen, verzichtete aber dann darauf.
Die Landstraße war verlassen. Mary sah in beide Richtungen und entdeckte in der Ferne Fahrzeuge, die am Horizont entlangkrochen. Bis auf ein Rauschen und hin und wieder Vogelgesang war es still. Nur wenige Häuser standen auf einer Seite der Straße, während sich auf der anderen eine Einöde aus Staub und harten Gräsern ausbreitete, in der hier und da Papp- und Styroporverpackungen lagen, die jemand im Vorbeifahren aus dem Fenster geworfen hatte.
Tante Eves Haus stand halb verdeckt von einem Farbenmeer aus pinken, hellblauen und rosa Hortensien und Rhododendren. An den Backsteinmauern zogen sich Ranken empor, die mit Blüten in sämtlichen Farben von Gelb bis Dunkelrot gesprenkelt waren, dazwischen schimmerte es violett. Neben dem Haus war ein Rosenbeet angelegt, das bis zum rückwärtigen Garten reichte. Auf dem Grünstreifen drängten sich Gartenzwerge, Glassteine und andere Dinge, die man manchmal auf Wühltischen auf dem Farmers Market fand. Alles sah aus wie früher, allerhöchstens die Blumen wuchsen noch höher und üppiger, und kurz stellte sich Mary vor, dass sie in einer Zeitschleife gefangen war. Vielleicht hatte sie die vergangenen Jahre in der Stadt nur geträumt: ihre kleine Wohnung und die Typen für eine Nacht, die morgens ohne ein Wort aus ihrem Bett verschwanden. Gleich würde sie Eves Haustür öffnen und sich anhören, dass sie zu spät kam und sich mit dem Kartoffelschälen beeilen sollte, während Moira fast den ganzen Tag mit Videospielen oder TV-Serien verbracht hatte und nun in der Badewanne lag.
Sie atmete tief durch und blickte sich um. Nachbarn gab es keine; das umliegende Land war unbebaut. Mary hatte fest damit gerechnet, dass es verkauft sein würde und von Menschen bewohnt, die sich nach jener Ruhe sehnten, von der sie hier draußen schon bald die Nase voll haben würden. Aber der Blick ging noch immer bis zum Wald, der in einiger Entfernung hinter dem Haus begann, und zu beiden Seiten des Gartens wuchsen Hecken und Stauden in die Höhe. Die Felder daneben hatten einst einem Bauern gehört, aber nach seinem Tod waren die Erben in Streit geraten. Mary hatte keine Ahnung, wie lange so etwas dauerte oder ob man sich mittlerweile geeinigt hatte. Vielleicht war das Land hier auch einfach vergessen worden, wie so viele Dinge, die man in eine Ecke seines Gedächtnisses schob, in der Hoffnung, sie nie wieder ausbuddeln zu müssen.
»Das hätte ich auch gern gemacht«, sagte sie zu Miss Kraski, nachdem sie ihr die Autotür geöffnet hatte. »All das hier vergessen. Aber dir wird es vermutlich gefallen. Zumindest kannst du Mäuse jagen, davon gibt’s ne Menge.«
Sie klatschte leise in die Hände, als ihre pelzige Begleiterin keine Anstalten machte, sich zu rühren. »Also dann, stellen wir uns den Bluthunden.« Miss Kraski trat an den Rand der Sitzbank, warf einen Blick nach draußen und maunzte.
»Na los«, sagte Mary grinsend, hob sie auf ihre Arme und stapfte auf die Haustür zu, während sie versuchte, den abenteuerlustig peitschenden Schwanz nicht ins Gesicht zu bekommen. Mit jedem Schritt nahm der Blumenduft zu, süßlich und voll. Auf jeder der drei Stufen vor dem Eingang lag eine kitschige Gummimatte, bedruckt mit Blüten und Schmetterlingen. Mary starrte auf die Abdrücke aus Erde und kleinen Steinen, die ihre Schuhe hinterließen, ehe sie klingelte.
Es dauerte nicht lange, bis sie das Knarren der Dielen und dann Schritte hörte.
Tante Eve öffnete. Im Gegensatz zur Umgebung hatte sie sich verändert. Sie trug alte Jeans, einen Pullover und darüber einen Kittel mit Blumenmuster. Ihr Haar war schon damals von grauen Strähnen durchzogen gewesen, aber jetzt war der Ansatz komplett hell, was besonders auffiel, da Eve ihren wangenknochenkurzen Schopf noch immer schwarz färbte. Nur wohl nicht regelmäßig. Sie war älter geworden, runzeliger, schmallippiger, vor allem kam sie Mary so viel kleiner vor. Und trotzdem war da diese Wand, die sich zwischen ihnen in die Höhe mauerte.
Tante Eve musterte sie von oben bis unten, dann die Katze auf ihrem Arm, und beugte sich leicht zur Seite, um einen Blick über Marys Schulter zu werfen. Da sie so dürr war, sah sie dabei aus, als würde sie jeden Moment umfallen. »Ach«, sagte sie und wischte ihre Hände an ihrem Kittel ab, so als genügte allein Marys Anblick, um sich schmutzig zu fühlen. »Damit hätten wir ja nicht gerechnet.«
»Ich hatte angerufen.«
»Trotzdem.« Tante Eve zuckte die Schultern und sagte damit, dass man sich auf das Wort ihrer Nichte ohnehin nicht verlassen konnte.
Es brachte etwas in Mary zum Brodeln, von dem sie glaubte, es längst begraben zu haben. Schließlich war es Eve, die keine Stütze gewesen war. Für Moira, ja. Aber für Moira taten auch alle, was sie sich wünschte.
»Nun, jetzt bin ich ja hier. Wo steckt sie?« Es war sinnlos, weiter vorzugeben, so etwas wie ein Gespräch führen zu können.
»Im Garten. Ich hoffe, das Vieh soll kein Geschenk sein?« Tante Eve verengte die Augen und musterte Miss Kraski mit Abscheu.
»Nein, keine Sorge, sie ist mit mir hier, und sie wird auch mit mir zurückfahren.« Damit setzte sie Miss Kraski auf den Boden, die mit schlafwandlerischer Sicherheit zwischen Tante Eves Beinen hindurchhuschte und den Weg in Richtung Küche einschlug, ohne sich um deren Protest zu scheren. Mary wandte sich ab und schlenderte zurück zum Wagen, um Moiras Geschenk zu holen. Dabei versuchte sie, Tante Eves Gemecker zu ignorieren, das sich in Verwünschungen verwandelte und leiser wurde, als sie die Tür zuschlug, um auf Katzenjagd zu gehen. Ein sinnloser Plan. Wenn Miss Kraski nicht gefangen werden wollte, ließ sie das ihr Gegenüber deutlich spüren.
Mary nahm die Pralinenschachtel von der Rückbank, die sie in gelbes Papier eingeschlagen hatte. Etwas anderes war ihr nicht eingefallen – durch den sporadischen Kontakt wusste sie nicht, was ihre Schwester mochte und was nicht. Pralinen passten immer, und wenn Moira mittlerweile auf Diät oder Veganerin war, konnte sie die Dinger weiterverschenken.
Mary sah sie schon von Weitem, als sie ums Haus herumgegangen war und den Garten betrat. Moira stand am Ende der riesigen Wiese und trug ein schimmerndes blaues Kleid mit einer riesigen Schleife an der Taille und kurzen Ärmeln, obwohl es dazu eigentlich noch zu kühl war. Aber sie zählte zu der Sorte Mensch, die an speziellen Tagen besondere Klamotten aus dem Schrank kramten. Dass sie nur ungern feierte, spielte dabei keine Rolle – sie nutzte jeden Anlass, um sich schick zu machen. Ihr helles Haar fiel offen über ihren Rücken, reichte ihr mittlerweile bis fast zur Taille und leuchtete inmitten des Grüns. Was trieb sie dort hinten? Vor allem: Wo wollte sie hin? Sie hatte die Rosen- und Gemüsebeete passiert, ebenso den Bereich, wo sich die Obstbäume drängten. Dahinter lag …
Die kleine Wiese mit dem Brunnen.
Mary blieb stehen und schüttelte sich, als sie eine Gänsehaut bekam. Früher hatte der Brunnen ihnen beiden Angst gemacht. Nicht nur, weil er in der hintersten Ecke des Gartens so unheimlich wirkte, besonders bei Nebel, sondern vor allem, weil Tante Eve ihnen strengstens verboten hatte, sich ihm zu nähern. »Ich will euch dort nicht sehen, und wenn ich doch eine von euch erwische, dann habt ihr keine Freude mehr im Leben, Mädchen! Hast du verstanden, Marybeth? Und Moira, nimm dir doch noch einen Schokokeks, Liebes.«
Mary war acht Jahre alt gewesen, als Tante Eve ihnen diesen Vortrag zum ersten Mal gehalten und mit energischen Gesten untermalt hatte – nur wenige Tage, nachdem ihre Mutter verschwunden war. Eve war ihre Schwester; sie hatte die Mädchen aufgenommen und dabei von einer vorübergehenden Regelung geredet. »Bis Natalie zurückkommt, ich kann schließlich nicht ewig zu Hause bleiben.«
Tante Eve verdiente ihr Geld, indem sie sich um die Gärten reicher Stadtbewohner kümmerte, ein Job, den sie mit einer Hand erledigte und den sie selbst für Moira nicht hatte aufgeben wollen. Doch irgendwann wurde Natalie Breen für tot erklärt, und aus vorübergehend war für lange Zeit geworden. Einen Vater hatte es ohnehin nie gegeben, zumindest kannten die Schwestern ihn nicht. Also waren sie hier gestrandet, auf dem Land mit einer Tante, die eins der beiden Mädchen liebte und das andere so gut es ging ertrug, sowie einem unheimlichen Brunnen, den Mary von ihrem Zimmer aus sehen konnte und der ihr zahlreiche schlaflose Nächte bereitete.
Schon kurz nach ihrem Umzug hatten sie und Moira begonnen, sich Schauergeschichten über ihn auszudenken. Und irgendwann hatten sie ein Alter erreicht, in dem sie als Mutprobe Dinge hineinriefen oder Steinchen in die Schwärze fallen ließen, um zu lauschen, wann sie auftrafen. Oder ob sie das überhaupt taten – was nur manchmal der Fall gewesen war. Heute war der Brunnen nur noch ein Brunnen, aber Erinnerungen waren mächtig, gerade wenn man sie lange nicht hervorgekramt hatte und sie beinahe neu wirkten.
Daher gefiel es einem Teil von Mary nicht, dass Moira jetzt auf das dumme Ding zuschlenderte. »Hey!«
Ihre Schwester wandte sich um und musterte sie von oben bis unten, als müsste sie erst überlegen, wie sie auf den Besuch reagieren wollte. Ihr Gesicht war noch immer schmal, die strahlend blauen Augen groß, der Blick herausfordernd.
Auf einmal kam sich Mary in ihren Lieblingsjeans, der kurzen Jacke und dem Shirt mit dem Roadrunner-Aufdruck vor, als hätte sie das Motto eines wichtigen Anlasses ignoriert.
»Ach, du.« Moira klang gelangweilt. »Ich dachte, es wär ein Scherz, als du meintest, du kommst vorbei. Warum tauchst du auf einmal zu meinem Geburtstag auf?« Was sie eigentlich sagen wollte, war: Ich schmeiße generell keine Party, und jetzt erscheinst du hier, um diesen Tag zu etwas Möchtegern-Besonderem werden zu lassen? Wie kannst du es wagen?
Moira hasste es, ihren Geburtstag zu feiern, weil ihr magisches Talent ihr dabei – ihrer Meinung nach – auf schräge Weise einen Strich durch die Rechnung machte. Denn sie becircte Menschen, ob sie es wollte oder nicht. Die Sache war erschreckend einfach: Egal, wie mürrisch oder abweisend sich Moira gab, jeder mochte sie. Im ersten Moment klang das nicht nach einem Problem, hatte aber seine Schattenseiten.
»Die Hälfte von euch würde nicht kommen, wenn ich ein anderes Talent hätte«, hatte Moira an ihrem zwölften Geburtstag ihren Gästen voller Wut entgegengeschleudert. Was – wie zu erwarten – jedoch niemanden dazu gebracht hatte zu gehen. Als Mary ihre Schwester nach ihrem Wutanfall in der Küche aufgespürt hatte, hatte sie sich schon wieder gefangen – war aber immer noch zerknirscht. »Wenn ich Schlösser öffnen könnte wie du oder Blumen wachsen lassen wie Tante Eve, wäre mein Leben viel einfacher! So finde ich niemals heraus, ob die anderen mich wirklich mögen. Meine Welt ist nicht echt! Als ob alle um mich herum nur schauspielern.«
Marys Mitleid hatte sich in Grenzen gehalten. So wie Moiras Freude, sie heute zu sehen.
»Hier, fang.« Mary schwenkte die Pralinenschachtel und warf sie ihrer Schwester in einem eleganten Bogen zu.
Moira bewegte sich keinen Zentimeter und beobachtete mit ausdruckslosem Gesicht, wie das Päckchen leise klappernd auf der Wiese landete. »Was ist das?«
Mary zuckte die Schultern. »Alles Gute zum Einundzwanzigsten.«
Moira betrachtete sie mit dem typisch-mürrischen Gesichtsausdruck. »Du bist doch nicht wirklich hier, um mir ein Geschenk vorbeizubringen, oder? Das hättest du auch per Post schicken können. Oder mich einfach anrufen wie sonst. Eine Textnachricht hätte auch genügt.«
Der Vorwurf war nicht zu überhören. Und obwohl Moira sich selbst nie meldete – zu ihren vergangenen beiden Geburtstagen hatte Mary weder von ihrer Schwester noch von ihrer Tante gehört –, nahm sie ihr die Bemerkung nicht krumm.
»Ich musste mal raus aus der Stadt.«
Moira stemmte die Hände in die Hüften und richtete sich weiter auf; ihr Kleid raschelte leise. »Du musstest? Nicht du wolltest?«
»Schon, ja. Es gibt Ärger im Job.«
»Beim Schlüsseldienst? Was hast du gemacht, bist du unerlaubt in irgendeine Wohnung eingestiegen?« Mary fuhr zusammen, und Moira riss die Augen auf. »Was, echt?« Zum ersten Mal seit der Ankunft ihrer Schwester wirkte sie interessiert. »Du bist irgendwo eingebrochen? Mensch, Mary! Ich dachte immer, du wärst einigermaßen schlau.«
Mary zuckte die Schultern. Schon wieder ärgerte sie sich über die ganze Geschichte. Es hätte sie lediglich ein paar Telefonate gekostet, einige Fragen, und schon hätte sie gewusst, dass sie diesen Typen namens Abs – »weil ich meine Bauchmuskeln mehr pflege als alles andere in meinem Leben« – ganz schnell hätte stehen lassen sollen. Aber sie war an dem Tag, an dem sie ihm begegnet war, schon seit Monaten knapp bei Kasse gewesen, da Jonah Konkurrenz bekommen und weniger Aufträge zu vergeben hatte. Dazu die Tierarztrechnungen für Miss Kraski und die Medikamente, die ihre Katze nun regelmäßig benötigte. Also hatte Mary ihr gesundes Misstrauen ignoriert, ihr magisches Talent eingesetzt und ohne offiziellen Auftrag von Locking Bird das Schloss einer Wohnung geöffnet. Für einen Typen, der sie in einer Bar angequatscht und genau gewusst hatte, wo Mary arbeitete und daher auch, wozu sie fähig war.
»Die Wohnung gehört meiner Ex«, hatte Abs gesäuselt. »Ich will nur meinen Kram zurück und vielleicht ein Andenken mitnehmen, als kleine Rache, weißt du? Einen Ring oder ein paar Fotos. Sie hat mich verlassen, für einen anderen, und ich brauche das einfach. Ich will das letzte Wort in der ganzen Sache haben, und du, meine Schlüssel-Zauberfee, bekommst dafür diesen hübschen Batzen Scheine. Also, was sagst du? Wir gehen rein, wir gehen raus, niemand bekommt etwas mit. Nur meine Ex-Schlampe irgendwann, und sie wird nichts beweisen können, weil sie megaverpeilt ist und alle ihre Freunde denken werden, dass sie das Zeug nur verlegt hat.«
Die kleine Rache war eskaliert, da Abs und zwei seiner Kollegen die Wohnung ausgiebig verwüstet und damit die Polizei auf den Plan gerufen hatten. Der Streifenwagen war in dem Moment eingetroffen, als der Fernseher durch das geschlossene Wohnzimmerfenster flog.
Mary zog eine Grimasse. »Es war dumm, ja. Mein Boss ist ein bisschen sauer, aber ich rede Montag mit ihm und wollte die Zeit nutzen und vorbeikommen. So kann ich dir gratulieren und warten, bis er sich abreagiert hat. Zwei Fliegen, eine Klappe.«
»Hm.« Moira musterte sie noch einen Moment, dann hob sie das Geschenk auf – das Zeichen dafür, dass sie mit der Erklärung halbwegs zufrieden war. »Pralinen«, sagte sie, nachdem sie das Papier aufgerissen hatte. »Wow. Danke.«
Es klang nicht begeistert, und auf einmal tat es Mary leid, dass sie nicht nachgefragt hatte, womit sie Moira eine Freude machen konnte.
»Ich weiß nicht, worauf du so stehst.« Es tat ihr noch mehr leid, weil es so lapidar klang. Aber so war es nun einmal zwischen ihnen.
»Ist schon okay. Tante Eve hat eh den Vogel abgeschossen mit ihrem Geschenk.« Moira schlenderte zum Brunnen, ließ sich auf dem Rand nieder und warf die Geschenkpapierkugel hinein. Dann deutete sie auf den Steinrand ihr gegenüber.
Mary folgte ihr und setzte sich. Der Stein war eiskalt. »Was ist es denn?« Natürlich hatte sich Eve besonders viel Mühe gegeben. Wie immer, wenn es um die jüngere Breen-Schwester ging.
Moira lächelte, ehe sie an ihrem Kragen nestelte und einen Anhänger hervorzog. Etwas Dunkles blitzte auf. Zunächst hielt Mary es für ein Modeschmuck-Halsband – eines, das man am Wochenende zu engen, schwarzen Lackkleidern und dunklem Lippenstift trug –, aber dann erkannte sie, dass der Stein nicht schwarz schimmerte, sondern dunkelrot. Und wie vertraut die Silberornamente waren, die ihn einfassten.
Ihr Körper verzichtete auf den nächsten Atemzug und fror ein. Eine bessere Beschreibung gab es nicht; sie konnte sich weder rühren noch einen Ton herausbringen. Der Anblick des Anhängers hatte sie erstarren lassen, lediglich ihr Herz pochte wild und heiß in ihrem Brustkorb.
Moira lächelte. Der Triumph in ihren Augen war nicht zu übersehen. Sie langweilte sich so sehr hier draußen, dass sie jede Gelegenheit für einen Wettstreit nutzte. Schließlich gewann sie fast immer.
Sie spielte mit dem Anhänger, zog die Kette über ihren Kopf und ließ sie hin und her baumeln. »Ich hätte nicht gedacht, dass sie den irgendwann rausrückt. Aber jetzt gehört er mir.«
Es war schwer, sich die Verletzung nicht anmerken zu lassen – und Mary wollte um keinen Preis zugeben, wie sehr die Sache sie traf. Der Anhänger war das Einzige, was ihnen von ihrer Mutter geblieben war, und hatte sich im Laufe ihrer Kindheit in eine Art Reliquie verwandelt. Sicher auch, weil Tante Eve ihn stets unter Verschluss gehalten, den Mädchen nur hin und wieder gezeigt und anschließend wieder in ihre Nachttischschublade gesperrt hatte. Anfassen durften sie ihn nie. Nicht einmal, als Mary weinend aus einem Albtraum aufgeschreckt war und ihre Mutter so heftig vermisste, dass sie sich kaum noch beruhigen konnte. In jener Nacht hätte sie alles darum gegeben, das Schmuckstück in den Händen zu halten, quasi als einzige Verbindung zu einem Menschen, der ihr viel zu früh gestohlen worden war. Tante Eve hatte damit gedroht, dass sie es niemals mehr sehen durfte, wenn sie nicht aufhörte zu weinen.
Aber das war lange her, und bei all ihren Fehlern war Moira nicht Tante Eve.
»Mams Anhänger«, sagte sie bemüht ruhig. »Cool. Lass mal sehen.«
Moiras Augen leuchteten, als sie einen Finger an die Lippen legte und vorgab zu überlegen. »Na gut«, sagte sie dann und streckte den Arm aus.
Mary bemerkte die Bewegung im Gras in dem Moment, als sie sich vorbeugte und nach der Kette angelte, doch es war zu spät: Miss Kraski nahm Anlauf und sprang mit einem für ihr Alter beeindruckenden Satz auf den Brunnenrand. Sie musste sich im Haus gelangweilt haben – oder Tante Eve hatte sie so lange verfolgt, bis sie einfach zu genervt gewesen war, um diesen seltsamen Menschen noch länger zu ertragen.
Moira schrie auf und zuckte zurück, zu abrupt – und zu schnell. Mary sah, wie die Silberkette ihr aus den Fingern rutschte. Sie fluchte und versuchte, sich noch etwas weiter zu strecken, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Eine flüchtige, bittersüße Sekunde lang berührte sie das Metall, doch es war zu spät. Als sie ihre Hand darum schließen wollte, drehte es sich um sich selbst, blitzte noch einmal silbrig auf und war im nächsten Moment verschwunden. Sie starrte in die Dunkelheit, spürte die aus der Tiefe aufsteigende Kälte und erschauerte.
»Dämliches Mistvieh!«
Halb erschrocken, halb bestürzt richtete sich Mary wieder auf, ihr Blick flackerte zwischen der Schwärze, Moira und Miss Kraski hin und her. Die Katze beobachtete die beiden ungerührt, hob eine Pfote und hielt dann aber inne, als überlegte sie, ob sie sich in dieser Gesellschaft wirklich putzen wollte, stand auf und sprang wieder zu Boden. Ihr Hinterteil wackelte, als sie in den Büschen verschwand.
Marys Herz raste, während sie nach unten starrte. Das mulmige Gefühl von früher kehrte schlagartig zurück, und kurz fragte sie sich, was wohl aus dem Brunnen kommen würde, um sie zu holen. Erst dann begriff sie, was ihre Schwester gesagt hatte.
»Das hat sie nicht mit Absicht getan.« Ihre Stimme zitterte leicht.
Moira schnaubte, in ihren Augen blitzte es. »Ist das etwa deine Katze?«, schrie sie, während sie eine Hand zur Faust ballte.
»Ja, ich …«
»Warum musstest du sie mit herbringen? Ich bitte dich, Mary, eine Katze? Und dann noch so eine hässliche?«
Mary schüttelte lediglich den Kopf. »Es tut mir leid.«
»Dein Vieh ist schuld, dass die Kette jetzt da unten ist!« Auf Moiras Wangen zeichneten sich rötliche Flecken ab. »Oder ist dir das etwa ganz recht, weil du ohnehin neidisch warst?«
»Das ist doch Unsinn«, murmelte Mary und atmete tief durch. Sie musste jetzt die Nerven behalten. Wenn sie ebenfalls laut wurde, würde sich Moira nur noch mehr hineinsteigern.
Was sie ohnehin tat. Tränen der Wut schimmerten in ihren Augen. »Ist es das wirklich? Sei ehrlich, du hast mir die Kette nicht gegönnt, Marybeth!« In der Ferne bellte ein Hund, wohl als Antwort auf ihre nun wieder lautere Stimme. »Vielleicht freust du dich ja, dass deine Katze aufgetaucht ist und dafür gesorgt hat, dass die Kette im Brunnen landet. Dann sorg du jetzt dafür, dass sie da wieder rauskommt.«
Mary starrte sie an. »Du spinnst, Moira. Ich klettere doch da nicht runter.«
»Ach nein?« Ihre Schwester sprang auf, stemmte die Hände in die Hüften und funkelte sie an, so wie früher, wenn sie etwas wollte und nicht bekommen hatte. Es tat ihr nicht gut, in ihrem Alter bei Tante Eve zu leben. Manchmal verhielt sie sich, als wäre sie noch immer ein junges Mädchen.
»Was ist denn hier los?« Tante Eves Stimme schreckte Mary auf. Das Geschrei musste sie aus dem Haus gelockt haben, und nun stapfte sie mit tief in den Taschen ihres Kittels vergrabenen Händen auf den Brunnen zu.
Moira nahm ihr Auftauchen zum Anlass, um endlich die Tränen hervorzupressen, die vor lauter Wut in ihren Augen schimmerten. »Der Anhänger! Ich wollte ihn Mary zeigen, aber da ist ihre schreckliche Katze aufgetaucht und hat mich erschreckt, und er ist in den Brunnen gefallen. Mary weigert sich, ihn wieder rauszuholen, dabei ist es ihre Schuld! Sie hat das Biest schließlich hergebracht!« Ein Schluchzer folgte, dann starrte Moira Eve an, als würde sie ihr Urteil erwarten. Viele Schauspieler wären in diesem Moment neidisch gewesen.
Mary fragte sich, wie ihre Tante reagieren würde, besäße ihre Schwester ein anderes Talent. Wie viel Gegenwind Moira wohl erfahren hätte in ihrem Leben, könnte sie Menschen nicht auf magische Weise um den kleinen Finger wickeln? Vielleicht war Moira in Wahrheit wütend auf sie, weil sie die Einzige war, die sich nicht alles von ihr gefallen ließ. Gemeinsam aufzuwachsen, schien Mary mit einer Art Schutzwall ausgestattet zu haben. Sie würde vieles für ihre Schwester tun, doch es gab Grenzen, und sie sah das, was andere nicht sehen konnten: dass diese für ihr Leben gern manipulierte. Was nicht bedeutete, dass sie Moira nicht liebte, denn das tat sie. Hatte sie schon immer. Nur sagen würde sie ihr das niemals.
»Marybeth!« Tante Eves Wut war eine andere als Moiras: düster, erdig, drohend. »Ich habe mir schon gedacht, dass nichts Gutes dabei herumkommt, wenn du uns besuchst. Deshalb habe ich deiner Schwester auch geraten, dir ihr Geschenk nicht zu zeigen.« Ihre Augen waren so dunkel wie ihre Ausstrahlung. Das änderte sich schlagartig, als sie sich an Moira wandte und ihr mit großer Zärtlichkeit eine Haarsträhne von der Wange pflückte. »Die ersten Gäste sind eingetroffen, Liebes. Du solltest ins Haus gehen. Wir bekommen deinen Anhänger schon zurück, mach dir keine Sorgen.«
»Das will ich auch hoffen«, murmelte Moira, drehte sich in einem Wirbel aus Blau und Gaze um und verschwand.
Mary war mindestens ebenso wütend wie Moira, doch ihr würde man kein Ventil zum Dampfablassen auf einem Goldteller präsentieren.
Tante Eve verschränkte die Arme vor der Brust und starrte Mary an. »Also?«
Mary ließ sich vom Brunnenrand auf den Boden gleiten. Wenn sie sitzen blieb, würde sie sich vor ihrer Tante wie ein Kind fühlen. »Also was?«, fragte sie und klopfte sich den Schmutz von der Jeans.
»Also, wie gedenkst du, Moiras Geburtstagsgeschenk wiederzubeschaffen?«
Beide blickten zeitgleich zum Brunnen. Dann trat Mary einen Schritt zurück und schüttelte den Kopf. »O nein. Ich werde da sicher nicht reinklettern. Wir wissen doch nicht einmal, wie tief das Ding ist!« Aber ein Teil von ihr grübelte. Früher hatten sie ab und zu mit einer Taschenlampe hineingeleuchtet und den Boden nicht sehen können. Vielleicht war das heutzutage anders? Schließlich kamen einem viele Dinge als Kind größer und sicher auch tiefer vor. Unter Tante Eves missbilligendem Blick nahm sie ihr Handy, schaltete die Taschenlampe ein und leuchtete in den Brunnenschacht. Der Lichtstrahl kämpfte über eine ganze Strecke tapfer gegen das Schwarz an, löste sich aber weiter unten darin auf. »Ich kann nicht einmal den Grund sehen.«
Tante Eves Schnauben verriet, dass Mary einer der schlechtesten Menschen der Welt war. »Wenn du meinst, dass du so mit dem Andenken eurer Mutter umgehen musst, dann ist das schade. Aber ich habe es nicht anders erwartet.« Damit wandte sie sich um und eilte zum Haus zurück.
Mary fühlte sich taub, während sie ihr hinterherstarrte. Es tat weh. Alles. Dass Moira das Amulett bekommen hatte. Dass ihre Tante und Schwester wie immer eine Front gegen sie bildeten, die sie niemals würde durchbrechen können. Aber vor allem, dass die einzige Erinnerung an ihre Mutter für immer verloren war.
Niemand hatte an diesem Tag noch gute Laune. Nachdem Mary mit dem Gedanken gespielt hatte, zurück in die Stadt zu fahren und sich doch lieber Jonahs Wut zu stellen statt den vereinten Vorwürfen hier, hatte sie sich letztlich dagegen entschieden und war mit Miss Kraski und einer Flasche Wein, die sie aus Tante Eves Küche geklaut hatte, in den Garten umgezogen. Jetzt saß sie auf der Decke aus ihrem Auto und starrte in den sternenklaren Himmel, während sie ihre Begleiterin mit Thunfischstücken aus der Dose fütterte und der Musik lauschte, die aus dem Haus herüberdrang. Sie wusste nicht, wie Tante Eve – die Moira sonst jeden Wunsch von den Augen ablas – auf die Idee gekommen war, eine Party zu organisieren. Obwohl lediglich zwei Freundinnen, eine davon mit Begleitung, sowie drei Bekannte aus der entfernten Nachbarschaft aufgetaucht waren, hatte Moira gezickt. Aber auch diesmal konnte ihr niemand richtig böse sein.
Mittlerweile bereute Mary den Streit und die Sache mit der Kette. Es tat ihr leid, dass sie in den Brunnen gefallen war, aber es würde auch nichts bringen, wenn sie sich entschuldigte, da weder Moira noch Tante Eve auf eine Entschuldigung aus waren. Moira wollte die Kette zurück und Dramakönigin sein, und Eve … was die sich wünschte, wusste Mary nicht genau. Ein Teil von ihr glaubte, dass ihre Tante sie schlicht loswerden wollte. Ein anderer wisperte ihr zu, dass Eve Spaß daran hatte, ihr wehzutun.
»Tja«, sagte sie und betrachtete, wie Miss Kraski an der für den Katzengeschmack viel zu kleinen Dose schnüffelte. »Ich weiß schon, warum ich meine Wohnung nur mit dir teile. Dann fällt mir immerhin niemand in den Rücken. Das heute ist ein Kandidat für die zehn miesesten Tage meines Lebens, meinst du nicht auch? Und nein, ich bin dir nicht böse. Es war ein dummer Zufall.« Sie griff nach der Weinflasche und prostete ihr zu. Die Katze schien sie streng anzusehen, aber das lag an den zwei dunklen Flecken über ihren Augen. »Jetzt fang du nicht auch noch an«, murmelte Mary und nahm einen Schluck. »Ich wüsste nicht, wie ich das noch rumreißen könnte. Es war eine blöde Idee, hier zu übernachten, aber jetzt will ich auch nicht mehr zurückfahren. Du verstehst.« Sie deutete auf die Flasche. »Wollen wir zwei es uns im Auto gemütlich machen?«
Eine überflüssige Frage. Miss Kraski würde sich niemals mit dem Wagen zufriedengeben, nachdem sie herausgefunden hatte, wo Tante Eve die besten Leckerbissen aufbewahrte und wie weich das Sofa war. Irgendwann würden die Gäste verschwinden, und dann gehörte es ihr. Vermutlich hatten ihre Krallen schon Markierungen an den Holzfüßen hinterlassen.
Mary massierte sich den Nacken und bildete sich ein, dass der Wein wirkte und ihren Kopf leicht werden ließ. Was er nicht wirklich tat. Ihr Kopf war noch immer der alte, und momentan kreiste der Gedanke darin, dass sie nicht hierhergehörte. »Das berühmte fünfte Rad am Wagen«, sagte sie, stand auf und streckte die Beine. Zwar kannte sie zwei der Gäste von früher, Matt und Silja aus Moiras ehemaliger Schulklasse, aber sie war noch immer die Ältere. Damals waren drei Jahre ein Riesenunterschied gewesen, und da sie nicht erwünscht war, würde es noch immer so sein. Außerdem hatte sie keine Lust, im Beisein von anderen noch mal heruntergeputzt zu werden.
Sie rieb sich die Nasenwurzel und schlenderte zum Brunnen. Jetzt kam er ihr nicht mehr so kühl und gefahrvoll vor wie am Tag, vermutlich weil die Temperaturen gesunken waren und sich ihm angepasst hatten. Die abnehmende Mondsichel hing fast genau über der Öffnung und beschien einen Teil der Wände.
»Tut mir leid, Mams«, murmelte sie. Auf einmal stand ihr der letzte Ausflug mit ihrer Mutter so deutlich vor Augen, als würde sie einen Film sehen. Auch damals hatte der Mond geschienen und Moira auf der Rückbank des Autos geschlafen. Sie hatten einen Outdoor-Park besucht und waren auf dem Nachhauseweg in einen Stau geraten. Nach einer Stunde hatte ihre Mutter den Wagen auf den Seitenstreifen gelenkt, war an allen anderen vorbeigezogen und dann abgefahren. »Es ist ein Abenteuer, Süße«, hatte sie gesagt und Mary angelächelt, die auf dem Beifahrersitz hockte und versuchte, ein Auge ihres Stoffhunds wieder anzukleben. »Auf dem wir nur noch ein einziges Mal anhalten, um Donuts zu kaufen.« Das hatten sie getan, und dann waren sie, drei Verbündete, durch die dunklen Straßen gegondelt, während sich Mary blaue Zuckerstreusel von den Fingern leckte.
Jetzt war das alles weiter weg als je zuvor, und sie wünschte sich, den Anhänger heute niemals gesehen zu haben. Die Vorstellung, dass er dort unten lag und mit der Zeit von Regen, Laub und Vogelscheiße bedeckt wurde, war schrecklich. Sie atmete tief durch und warf Miss Kraski einen Blick zu. Die schmiegte ihr Köpfchen an den Brunnen, als hätte sie ihn lieber als alles andere auf der Welt.
»Ach verdammt«, murmelte Mary und machte sich auf den Weg zum Schuppen hinten im Garten, an dem natürlich unzählige Blüten emporrankten. Beinahe schien es, als leuchteten sie in der Nacht. Die Tür knarrte fürchterlich, aber dann empfing Mary der Geruch von Moder, altem Holz und feuchter Erde. Sie tastete nach dem Drehschalter an der Wand, fand ihn und erweckte die Glühbirne zum Leben.
Hätte man sie zuvor gefragt, was Tante Eve alles in ihrem Schuppen lagerte, hätte sie keine Antwort gewusst, aber nach nur einem kurzen Rundumblick kehrte die Erinnerung zurück. Sie ging zu der Plastikkiste in der Ecke und klappte den Deckel hoch. Hier bewahrte ihre Tante alles möglich auf, von kleinen Werkzeugen über Segeltuchstoff bis hin zu …
»Ha!« Mary nahm das Seil heraus und brauchte eine Weile, bis sie es entknotet hatte. Es war lang, aber ob es reichen würde? »Eine blöde Idee, aber egal«, sagte sie zu Miss Kraski, die sich gegen ihr Bein drückte. »Die Party hier draußen wird auf jeden Fall besser als die dort drinnen. Sorgen wir für ein wenig Action, okay?« Sie würde den Anhänger ihrer Mutter zurückholen – das Letzte, was ihr von ihrer echten Familie geblieben war, zu der Tante Eve nun einmal nicht zählte. Morgen früh würde sie ihn Moira zurückgeben und dann nach Hause fahren. Zu allen zukünftigen Geburtstagen würde sie wie früher auch Nachrichten schicken und das tun, was für sie am besten war: allein klarkommen. »Nur wir zwei, meine Süße.« Sie kitzelte Miss Kraski mit dem Seilende am Kopf, bis die mit der Pfote danach schlug.
Nach weiterer kurzer Suche fand sie eine kleine Taschenlampe mit einer Schlaufe, die sie sich ums Handgelenk binden konnte. Sie zog den Reißverschluss ihrer Jacke bis zum Kinn hoch, strich sich die Haare hinter die Ohren, ging zurück zum Brunnen und blickte sich um. Sie wählte den schmalen Birnenbaum links von sich, der jedes Jahr so viele Früchte trug, dass er beinahe unter der Last zusammenbrach. In Marys Kindheit war einmal genau das mit dem Mirabellenbaum am Rand des Grundstücks passiert, und seitdem achtete Tante Eve darauf, mit ihrem Talent hauszuhalten und das Wachstum der Pflanzen nicht übermäßig zu beeinflussen.
Mary schlang das Seil um den Stamm und überlegte. Sie hatte keine Ahnung von diesen Knoten, die jedes Gewicht hielten, aber durch einen sanften Zug wie durch Zauberhand gelöst werden konnten. Also machte sie mehrere normale und zerrte nach jedem so fest sie konnte am Seil, indem sie sich mit ihrem gesamtem Gewicht nach hinten lehnte. Es knarrte jedes Mal, schien aber zu halten. Nachdem sie die Knotenreihe verlängert hatte, befestigte sie es um ihre Taille und kletterte schließlich auf den Brunnenrand.
Miss Kraski beäugte sie. Vermutlich fragte sie sich, warum sie nicht einfach wieder zurück ins Haus gingen, um eine neue Dose Thunfisch zu holen, oder warum Menschen immer verrücktspielen mussten.
Mary atmete tief durch, knibbelte an dem Loch in ihrer Jeans und warf einen Blick nach unten. Sie steckte ihr Handy in die Jackentasche, schaltete die Taschenlampe ein und schob sie über ihr Handgelenk. Ihr Herz schlug schneller bei dem Gedanken, sich einfach fallen zu lassen, und auf einmal zitterte sie vor Kälte. Das hier war eine hirnrissige Idee. Aber wie tief konnte so ein Brunnen schon sein? Das Seil war lang, und sicher würde sie es auch schaffen, hinterher wieder nach oben zu klettern. Sie war keine Zehnkämpferin, aber auch nicht völlig untrainiert.
»Also gut. Das wird ein Kinderspiel.« Die Selbstmotivation funktionierte nicht. Das Aufgeben von festem Untergrund war eine riesige Überwindung. Wenn sie erst einmal an der Brunneninnenwand hing, würde sie auch nach unten klettern können. Aber dieser erste verdammte Schritt war der schwerste.
Sie schloss die Augen und dachte an Moiras zickige Art, an Tante Eves Missbilligung und daran, dass sie vor Kurzem ohne Auftrag die Tür einer fremden Wohnung geöffnet hatte. Vorübergehend abzutauchen war im Grunde nicht die schlechteste Idee.
Abzutauchen, haha.
Sie drehte sich und kniete sich hin. Während sie sich am Seil festklammerte, streckte sie erst ein Bein aus, dann das andere. Der Ruck, mit dem sie vollends in den Brunnen sackte, erschreckte sie so sehr, dass sie aufschrie. Rasch packte sie das dämliche Seil fester und scheuerte sich die Handflächen auf. Es zog sich zusammen, und sie hatte es dem festen Stoff der Jacke zu verdanken, dass es ihr nicht die Luft abschnürte. Blind tastete sie nach einem Widerstand und versuchte, dabei nicht allzu sehr zu zappeln, während das Licht der Lampe wild durch die Gegend tanzte. Endlich trafen ihre Füße auf Stein und fingen einen Teil ihres Gewichts ab. Mary biss die Zähne zusammen, schob ihre Füße Zentimeter für Zentimeter nach oben und lehnte ihren Oberkörper mit wild klopfendem Herzen weiter zurück, damit sie die Sohlen gegen die Brunnenwand pressen konnte. Ihre Finger taten weh, so sehr umklammerten sie das Seil, und als sie einen nach dem anderen lockerte, stellte sie fest, dass ihre Handflächen feucht waren vor Schweiß.
Jetzt nur nicht an den Absturz denken!
Natürlich ging dieser Vorsatz schief. Auch wenn alles in ihr danach schrie, sofort wieder hochzuklettern, zwang sie sich, Seil nachzugeben. Die Fasern rissen an ihrer Haut. Mist, sie hätte sich Handschuhe suchen sollen. Kein gutes Gefühl, dass ihr Kopf nun fast schon tiefer hing als ihr Hintern. Hastig schob sie die Füße nach unten und gab sich kurz Zeit, um zu verschnaufen – sie war außer Atem, dabei hatte sie erst ein winziges Stück geschafft.
Der nächste Schritt funktionierte besser, auch wenn ihre Beine zitterten. Nach und nach bekam sie den Bogen raus. Sie suchte nach einem Song, der zum Takt ihrer Bewegungen passte, und fand den einer uralten Grunge-Band, deren Namen sie bereits vergessen hatte. Als Mary ihn in Dauerschleife summte, klappte es besser. Irgendwann warf sie einen Blick nach oben, stellte fest, dass der Rand ein eindrucksvolles Stück über ihr lag, und fragte sich erneut, wie tief der Brunnen war. Als sie nach hinten sah und mit der Lampe leuchtete, kam sie leicht ins Schwanken, erkannte aber noch immer nichts. Der Lichtstrahl verlor sich. Rasch starrte sie wieder nach oben und wartete, bis die Schwingungen abebbten. Sie musste weiter. Wenn sie lange untätig herumhing, würde sie nur ihre Kraft vergeuden.
Drei Schritte später spürte sie eine Unregelmäßigkeit unter ihrem Fuß. Sie beleuchtete die Wand: Vor ihr ragten Metallgriffe aus dem Stein. Rostig und massiv, von der Sorte, die man an hohen Gebäuden fand, damit todesmutige Fachleute daran emporklettern konnten. Mary prüfte eine und trat probehalber dagegen, doch sie schien stabil zu sein. Mit einem erleichterten Seufzer kletterte sie noch ein Stück, griff danach und fand weitere unter ihr. Offenbar verliefen sie in regelmäßigen Abständen. Nur warum hier unten und nicht weiter oben? Damit der Weg vom Boden bis zum Rand nicht mehr so lang war? Ergab das irgendeinen Sinn? Schlussendlich war es egal, jetzt und hier waren die Streben ideal, um Marys Muskeln zu entlasten. Sie erlaubte sich eine Verschnaufpause, ehe sie weiterkletterte.
Zwei, drei Sprossen später spannte sich das Seil um ihre Taille. »Verdammt!« Sie hob den Kopf, doch sie sah nicht einmal mehr den Rand. »Miss Kraski?« Sie lauschte, hörte aber nichts. Unruhig drehte sie sich um und leuchtete noch einmal in den Brunnen.
Dieses Mal bemerkte sie etwas. Unter ihr glitzerte es. Das musste der Anhänger sein! Zudem erkannte sie Stein. Weitere Sprossen gab es nicht, aber da war fester Boden, nah genug, um zu springen. Also kletterte sie ein Stück nach oben, damit sich das Seil wieder lockerte, und fluchte ununterbrochen bei dem Versuch, es zu lösen. Ehe sie noch mal so eine dämliche Aktion startete, würde sie einen Kurs in nautischen Knoten machen. Nachdem die Haut an ihren Fingerkuppen brannte, baumelte das Seil endlich lose neben ihr. Mary kletterte auf die unterste Sprosse, zählte bis drei – und sprang.
Ihr blieb Zeit, um Hände und Füße auszustrecken und sich für den Aufprall zu wappnen. Und sich zu überlegen, ob sie sich besser zusammenrollen sollte. Das war seltsam. So weit war der Boden doch gar nicht entfernt gewesen! Etwas brodelte in ihrem Bauch, ein ungutes Gefühl, als müsste sie sich übergeben. Sie spürte deutlich, dass sie fiel, und zwar nicht sehr langsam. Das Brodeln wurde zu einem Druck, und sie schnappte nach Luft. Konnte sie sich so sehr getäuscht haben? Sie würde nie wieder zurück nach oben kommen!
Sie fiel noch immer. »Hilfe!« Ihre Stimme war dünn wie die eines Kindes. Zu rufen, war außerdem vollkommener Unsinn. Wer sollte sie denn hören, geschweige denn etwas tun? Trotzdem versuchte sie es noch einmal. »Hilfe! Verdammt, ich bin hier …« In all der Schwärze wurde ihr schwindelig. Ihre Haut kribbelte, und sie glaubte, nicht nur in den Brunnen zu fallen, sondern auch aus ihrem Körper zu driften. Sie schloss die Augen und sperrte die Welt aus.
Und die Welt reagierte und zog sich zurück.
2: Der Brunnen
2
Der Brunnen
Das Bild war verschwommen, aber am Lachen erkannte sie ihre Mutter. Es schien oft ein bisschen zu voll und dunkel für eine so schlanke Frau, und manchmal klang es, als rasselten kleine Steine durch ihre Kehle, aber es war derart mitreißend, dass man darüber hinwegsah. Vor allem war es so selten, dass Mary jedem Ton lauschte, als wäre er der schönste auf der Welt. Sie blinzelte, dann rieb sie sich die Augen, da sie das Gesicht ihrer Mutter nicht deutlich sah. Vielleicht befand es sich hinter einem Schleier oder einer Wasserwand.
»Marybeth, was meinst du? Zuerst das Labyrinth oder ins Eiscafé?«
Sie erinnerte sich an diesen Tag! Es war Hochsommer gewesen und so heiß, dass sie glaubte, ihre Haut würde sich nie wieder abkühlen. Sie waren zu einem Maislabyrinth gefahren, das ein Bauer in sein Feld gepflügt hatte. Es sah nicht hübsch aus; Staub hing in einer großen Wolke darüber, und viele Pflanzen waren durch die wochenlange Hitze braun und vertrocknet. Wann immer ein Besucher hineinging, wirbelte noch mehr Staub auf, und es raschelte, was Mary unheimlich fand.
Sie hatte Moira betrachtet, die wie so oft auf der Rückbank des Wagens schlief, die Augen geschlossen und das Mündchen geöffnet. Ein Speichelfaden lief an ihrem Kinn hinab, und kurzzeitig hatte Mary Angst bekommen, ihre kleine Schwester würde vertrocknen wie der Mais. Sie hatte sich für das Eiscafé entschieden.
Später hatten die Pflanzen im Labyrinth an ihrer Haut gerissen und feine, rasiermesserscharfe Schnitte hinterlassen. Es hatte wehgetan.
Es tat auch jetzt weh. Mary zuckte zusammen, und für endlose Augenblicke hing sie zwischen Bildern, Gefühlen und Worten fest. Ihr wurde bewusst, dass sie im Schlaf geredet hatte. Der Schmerz nahm zu, konzentrierte sich auf ihre Wade und verscheuchte das lächelnde Gesicht ihrer Mutter. Es war nur ein Traum gewesen. Mit einem Stöhnen kehrte sie in die Gegenwart zurück. Sie lag irgendwo in der Dunkelheit, unter ihr befand sich kühler, fester Boden, und ihr Bein …
»Mist.« Sie wollte es bewegen, es anwinkeln, aber es ging nicht. Es klemmte fest. Oder, schlimmer, etwas hatte sich hineingebohrt. War es gebrochen? Da hörte sie die Geräusche. Eine Mischung aus Knurren und Schmatzen.
Sie drehte sich ein Stück und tastete nach ihrer Taschenlampe, fand sie aber nicht. Also zog sie ihr Handy aus der Jackentasche und schaltete es ein. Der Lichtstrahl erfasste etwas. Ein Tier? Ja, es war ein Tier von der Größe eines Hunds, und es nagte verdammt noch mal an ihrer Wade! Bei dem Anblick spürte sie das Reißen und Zerren doppelt so stark, und der Schmerz schickte eine kleine Explosion durch ihre Nerven. Das Entsetzen verlieh ihr die nötige Energie, um sich weiter aufzurichten. »Hey!« Sie trat mit dem unverletzten Bein nach dem Vieh und zog das andere aus seiner Reichweite. Allein die Bewegung tat höllisch weh, und das saugende, feuchte Geräusch verursachte ihr Übelkeit.
Das Tier fauchte und grollte. Es klang, als wäre seine Kehle nicht dafür geschaffen, Töne hervorzubringen. Als wären seine Stimmbänder verkümmert. Der Lichtstrahl streifte einen Körper, um den farblose Stofffetzen geschlungen waren, und blieb an einem Gesicht hängen.
Mary erstarrte und fragte sich, ob sie wirklich sah, was sie glaubte. Das Tier – war es überhaupt eines? – hatte sich zusammengekauert und richtete sich jetzt auf. Kein Hund. Nichts in der Art, sondern etwas … mit Armen und zwei Beinen, die in nackte Füße übergingen, auf denen das Ding aufrecht stand. Es war höchstens halb so groß wie sie. Riesige schwarze Augen schimmerten in dem grauen Gesicht. Das Wesen riss den Mund auf und entblößte zwei Reihen nadelspitzer Zähne, von denen es tropfte. Kein Speichel, sondern Blut.
Mary schrie. Der Laut verhallte irgendwo über ihr. Ein Fauchen antwortete ihr, dann fuhr eine Klauenhand so dicht an ihrer Wange vorbei, dass sie den Luftzug spürte.
»Mist! Verschwinde! Hau ab, du Drecksbiest!« Sie rutschte zurück, wobei ihre Handflächen über unebenen Boden schrammten und sie ihr verletztes Bein wie Ballast hinter sich herzog. Ihr Herz stockte, obwohl es gerade eben noch gerast war, und sie hatte verdammt noch mal Angst. Endlich berührten ihre Finger etwas – einen Stein. Mit einem weiteren Schrei holte sie aus, schleuderte ihn so fest sie konnte und traf das Wesen an der Brust. Es gab einen dumpfen Laut von sich, taumelte, wirbelte in einer Wolke aus Stoff herum und verschwand im Nichts, wobei es gebückt lief und die Hände über den Boden schleifen ließ.
Mary keuchte, tastete hektisch ihre Umgebung ab und fand ihr Handy. Der Lichtstrahl tanzte und zitterte eine ganze Weile, bis sie es schaffte, es halbwegs ruhig zu halten. Einmal noch sah sie die Bewegungen des Wesens in der Dunkelheit ein Stück entfernt, dann war sie allein. Sie hielt die Luft an, um zu lauschen, auch wenn ihr Brustkorb zu platzen drohte, aber sie hörte nichts. Als sie ausatmete, kamen aus ihrem Mund kurze, japsende Geräusche. Es klang wie ein Schluchzen, aber auch ein wenig, als würde sie versuchen, nach Hilfe zu rufen. Sie schluckte mehrmals und glaubte, sich übergeben zu müssen.
Was war das gerade gewesen? Es gab keine Tiere, die sich in Stoff hüllten und aussahen wie ausgemergelte, schreckliche Miniversionen eines Menschen. Diese graue Haut, die riesigen, toten Augen und dann der Mund voller Reißzähne hinter dünnen, schwarzen Lippen …
Vorsichtig beleuchtete sie ihr Bein. Die Übelkeit wurde stärker. Hastig beugte sie sich zur Seite und würgte. Ihr Körper krampfte sich zusammen, gab aber nichts von sich. Mary spuckte mehrmals aus, um den ekelhaften Geschmack loszuwerden. Sie wischte sich über den Mund und atmete tief durch.
Ihre Jeans war an der Wade zerfetzt und blutdurchtränkt. Es brannte und stach. Zum Glück schien die Wunde nicht allzu tief zu sein, auch wenn die Biss- und Nagespuren deutlich zu erkennen waren.
»Das kann alles einfach nicht sein.« Sie zog ihre Jacke aus, das Shirt und das dünne Top darunter, ehe sie Shirt und Jacke wieder überzog. Mit dem Top tupfte sie das Blut weg und knotete es anschließend um ihre Wade. Sie verkrampfte sich, als der Schmerz bis zum Oberschenkel peitschte. Zögernd stand sie auf und versuchte, das verletzte Bein zu belasten. Es tat weh, aber sie würde laufen können.
Hastig betastete sie Stirn, Kopf und Nacken. Nichts, weder Wunde noch Beule noch Schmerz. Das war gut, aber keine Erklärung für all das hier. Sie war in den Brunnen gefallen, das wusste sie noch. Aber in einem Brunnen lebten keine seltsamen Wesen, und erst recht gab es nicht so viel Platz. Sie drehte sich mit dem Licht in der Hand einmal um sich selbst: An einer Stelle ragte eine gewölbte, unregelmäßige Steinwand nach oben, wo sie sich in der Dunkelheit verlor, und es sah ganz danach aus, als wäre sie Teil einer halb offenen Höhle.
War der Brunnen etwa mit einer Art Geheimgang unter der Erde verbunden? Aber warum sollte so etwas unter Tante Eves Grundstück liegen? Vielleicht war sie doch ohnmächtig und das alles nur ein Traum. Sie zwickte sich in den Arm, dann in die Wange, den Hintern und zuletzt in ihr Bein, nur eine Handbreit oberhalb der Verletzung. Es tat verdammt weh, aber ansonsten blieb alles, wie es war.
Mary rieb sich über das Gesicht, legte den Kopf in den Nacken und starrte in die Dunkelheit. »Hallo?« Das Echo verhallte über ihr.
Sie wischte sich die blutigen Finger an der Jeans ab, rief das Verzeichnis ihres Handys auf und wählte Tante Eves Nummer. Es gab zwar einige Menschen, von denen sie sich lieber helfen lassen wollte, aber da würde sie ihren Stolz zurückstellen. Wenn sie Glück hatte, reichte der Empfang bis hier.
Das Handy blieb stumm. Kein Signal, keine Ansage, lediglich ein entferntes Rauschen. Sie fluchte, checkte den Akku – dreiundsechzig Prozent – und den Rest der Anzeige. Alles sah normal aus, also wählte sie noch einmal. Anschließend versuchte sie es mit Moiras Nummer, dann mit der ihrer alten Freundin Sim. Schließlich überwand sie sich und versuchte es bei Jonah. Stets empfing sie diese statische Stille. Sie atmete mehrmals durch, verdrängte das Bild des grauen Wesens, das sich immer wieder in ihren Kopf schleichen wollte, und rief willkürlich gespeicherte Nummern auf: einen alten Auftraggeber, die Service-Hotline ihrer Bank, einen Pizza-Lieferdienst, den Tierarzt. Den Ersatztierarzt. Zuletzt wählte sie sogar den Notruf, doch selbst dort tat sich nichts.
Mary versuchte zu ignorieren, wie sehr sie mittlerweile zitterte, und leuchtete nach der Taschenlampe, fand aber nichts. Sie richtete den Lichtstrahl des Handys in die Dunkelheit, aus der Höhle heraus, ehe sie sich auf die Füße quälte. Er streifte eine Silhouette, und sie erschrak. Doch es war nur ein Baum, schmal und nicht sehr hoch, die wenigen Äste erinnerten an Säbel, so krumm waren sie.
Hier unten? Im Brunnen?
Stirnrunzelnd zog sie den Kopf ein, trat aus der Höhle und schwenkte den Lichtkegel nach oben, am Stamm entlang. Tatsache, ein Baum. Das Licht verschmolz ein Stück über seiner Krone mit der Schwärze. Als gäbe es dort nichts. Mary legte eine Hand auf die Rinde. Sie war kühl und rau, so wie sich ein Baumstamm eben anfühlte.
Ich werde verrückt. Vielleicht habe ich mir doch den Kopf angestoßen. Ich bin weggetreten, liege irgendwo herum und träume das alles nur.
Sie belastete probeweise ihr verletztes Bein und ging weiter. Das Licht ihres Handys reichte nur ein paar Meter. Es war, als würde sie durch ein schwarzes Bild laufen, in dem sich nur ab und zu etwas zeigte. Der Boden bestand aus harter Erde, hier und dort wuchsen Grasbüschel. Neben dem Baum fand sie einen zweiten, dann noch einen, dann eine Hecke, die ihr bis zu den Schultern reichte und wild vor sich hin wucherte, aber dabei irgendwie kränklich wirkte. Mary blieb stehen und lauschte, hörte aber nichts. Einer Eingebung folgend schaltete sie das Handy aus und legte den Kopf in den Nacken, aber da waren keine Sterne über ihr, ganz zu schweigen vom Mond. Dennoch gewöhnten sich ihre Augen allmählich an die Lichtverhältnisse, und sie erkannte mehr und mehr Umrisse.
Aber welchen Himmel suchte sie da eigentlich gerade ab? Sie war in einen gottverdammten Brunnen gestürzt, und nun gab es hier unten Bäume und Sträucher? Hatten Moira und Tante Eve sie gefunden und irgendwo in der Umgebung abgeladen wie einen Müllsack? Ihrer Tante traute sie das zu, aber Moira … nein, trotz allem wäre das nicht ihr Stil. Außerdem würde sie dann irgendetwas hören. Verkehr in der Ferne, einen Hund oder auch nur ein paar Zikaden.
Sie ging noch einmal zurück in die Höhle und leuchtete nach oben. Wie bereits viel zu oft verlor sich der Lichtstrahl in der Dunkelheit.
»Hallo?«, brüllte sie und lauschte auf das Echo. Zumindest das war noch da, und es klang weit fröhlicher als sie. »Moira?« Nichts.
Mary wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte, aber das dumpfe, panische Brodeln in ihrer Brust gefiel ihr nicht. Sie musste etwas tun, ehe sie komplett durchdrehte. Also berührte sie erneut den Baumstamm, als sie an ihm vorbeiging, dann die Hecke mit ihren Dornen. Nach zwei weiteren Schritten fand sie … einen Weg.
»Ein Weg unten im Brunnen«, murmelte sie und fand, dass sie leicht hysterisch klang. Er bestand aus festgestampfter Erde, und es war wohl nicht die schlechteste Idee, ihm zu folgen. Anfangs drehte sie sich immer wieder um, begriff aber schnell, dass es nichts brachte. Bei den Lichtverhältnissen war es zu unübersichtlich und das Handy ihre einzige Lichtquelle. Wenn das graue Wesen es darauf anlegte, würde es sich an sie heranschleichen können.