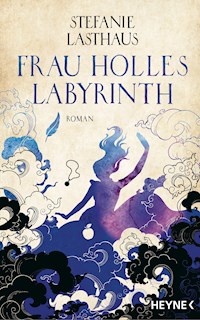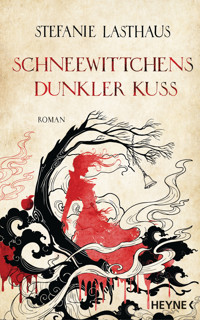
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Viele Legenden ranken sich um das sogenannte Dunkelvolk, das einst sein Unwesen trieb und den Lebenden ihre Herzen nahm. Inzwischen ist das Dunkelvolk verschwunden, doch die wenigen Menschen, die über eine magische Gabe verfügen, werden immer noch mit den düsteren Wesen in Verbindung gebracht. Die 23-jährige Cyntha ist die Tochter einer Magiebegabten, und auch ihr begegnet man im Dorf mit Misstrauen. Als der Earl von Falstone um ihre Hand anhält, bleibt ihr nichts anderes übrig, als seinen Antrag anzunehmen. Auf dem Gut ihres Zukünftigen angekommen, lernt Cyntha ihre Stieftochter Snow kennen – eine junge Frau von betörender Schönheit. Dann werden die Ländereien des Earl immer häufiger von einem eigenartigen Nebel heimgesucht, Menschen verschwinden spurlos, man findet Tote, denen das Herz herausgerissen wurde. Ist das Dunkelvolk zurückgekehrt? Und warum verhält sich Snow so eigenartig? Cyntha muss sich auf ihr eigenes magisches Erbe besinnen, um das Böse, das in ihre Mitte getreten ist, aufzuhalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch
Viele Legenden ranken sich um das sogenannte Dunkelvolk, das einst sein Unwesen trieb und den Lebenden ihre Herzen nahm. Inzwischen ist das Dunkelvolk verschwunden, doch die wenigen Menschen, die über eine magische Gabe verfügen, werden immer noch mit den düsteren Wesen in Verbindung gebracht. Die dreiundzwanzigjährige Cyntha ist die Tochter einer Magiebegabten, und auch ihr begegnet man im Dorf mit Misstrauen. Als der Earl von Falstone um ihre Hand anhält, bleibt ihr nichts anderes übrig, als seinen Antrag anzunehmen. Auf dem Gut ihres Zukünftigen angekommen, lernt Cyntha ihre Stieftochter Snow kennen – eine junge Frau von betörender Schönheit. Dann werden die Ländereien des Earl immer häufiger von einem eigenartigen Nebel heimgesucht, Menschen verschwinden spurlos, man findet Tote, denen das Herz herausgerissen wurde. Ist das Dunkelvolk etwa zurückgekehrt? Und warum verhält sich Snow so eigenartig? Cyntha muss sich auf ihr eigenes magisches Erbe besinnen, um das Böse, das in ihre Mitte getreten ist, aufzuhalten.
Die Autorin
Stefanie Lasthaus wuchs im Ruhrgebiet auf. Nach dem Studium zog es sie nach Australien, England sowie in die Schweiz. Zurück in Deutschland, widmete sie sich zunächst dem Dokumentationsfilm und schließlich ganz dem Schreiben – ob für Zeitungen, Zeitschriften, Onlinespiele, dem PR-Bereich oder als Autorin ihrer Romane. Da sie nur noch temporär durch die Welt reisen kann, besucht sie in ihren Büchern Gegenden, die sie faszinieren. Stefanie Lasthaus lebt in Essen.
Stefanie Lasthaus
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Redaktion: Catherine Beck
Copyright © 2023 by Stefanie Lasthaus
Copyright © 2023 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat GbR, München, unter Verwendung mehrerer Motive von Shutterstock
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-31131-5V001
www.heyne.de
Für meine Freunde –
weil ihr magisch seid.
Und für alle, die für andere Magie in diese Welt bringen.
1
Ranken und Stein
In den leeren Fenstern der Ruine, wo um diese Zeit nichts als Schwärze herrschen sollte, flackerte Feuer.
Cyntha hielt den Atem an, lief aber weiter, wobei sie sich nicht die Mühe machte, Ästen oder Unterholz vollends auszuweichen. Es raschelte, unter ihren Schuhen knackte ein Zweig, und wie zur Antwort ertönte vor ihr Gelächter, gedämpft von halb verfallenen Mauern aus Stein.
Sie biss die Zähne zusammen und beugte sich hinab, um einen der dicken Zweige an sich zu nehmen, die der Sturm vor ein paar Tagen von den Bäumen geholt hatte. Als sie ihre Fingernägel in die Rinde krallte, merkte sie, wie wütend sie war – und mit jedem Schritt steigerte sich dieses Gefühl. Obwohl die Hütte am Rande der Buford-Ländereien längst nicht mehr ihr Zuhause war und die Hecken, Schlingpflanzen und Tiere des Waldes sie allmählich für sich eroberten, war es noch immer so, als gehörte sie zu ihr. Zu ihr und ihrem Vater, wenn er nach seinen Reisen für kurze Zeit ins Dorf zurückkehrte. Dort waren so viele Erinnerungen entstanden, die sie noch immer im Herzen trug. Ihre Mutter war ein Teil davon. Hier draußen waren sie glücklich gewesen, sie alle drei, und hatten sich nicht daran gestört, was die Dörfler von ihnen dachten oder welche Geschichten man hinter vorgehaltenen Händen flüsterte – Cyntha, weil sie noch zu klein gewesen war, um sie zu verstehen, und ihre Eltern, weil sie sich geliebt hatten und wussten, dass die meisten dieser Geschichten zwar einen wahren Kern besaßen, aber oft aus Ängsten und Befürchtungen geboren waren, die nichts mit der Realität gemein hatten.
Jelissa Hirde ist eine Hexe.
Als Kind hatte Cyntha das für eine ganz normale Aussage gehalten. Für eine Tatsache, die jemand ihr ebenso mitteilte, wie dass das Wetter zu schlecht war, um draußen zu spielen. Erst Jahre später hatte sie begriffen, wie sehr diese Worte urteilten. Dass sie ihre Mutter bewerteten und innerhalb des Dorfes zur Außenseiterin machten.
Die Hütte war einst ihre ganze kleine Welt gewesen, und es hatte ihr das Herz gebrochen, dass sie nach dem Brand auf dem Gutshof und im vorderen Wald zu stark beschädigt worden war, um sie zu reparieren. Seitdem verfiel sie mit jedem Tag weiter. Die Jugendlichen aus dem Dorf nutzten sie für dämliche Mutproben und weil sie glaubten, hier draußen unbeobachtet zu sein und alles tun zu können, für das ihre Eltern ihnen etwas über die Schädel ziehen würden.
Mittlerweile hörte Cyntha Gelächter und sah Schemen, die sich gegen das Feuer abhoben, das jemand dort entzündet hatte, wo einst die Wohnstube gewesen war. Goldenes Haar blitzte auf, lang und etwas dunkler als ihr eigenes – vermutlich Arly, die Tochter des Gerbers. Sie war nicht böse, das war niemand von ihnen. Aber wenn sich Menschen zusammenschlossen, um sich gemeinsam in Hirngespinste hineinzusteigern, kam nie etwas Gutes dabei heraus.
Ein Mädchen kreischte, begleitet von Gelächter.
»Wenn du wie eine Hexe tanzt, bringst du die Hexe vielleicht von den Toten zurück!«
Das war eindeutig die Stimme von Bran Wallens, der zwei Hütten neben Cyntha und ihrem Vater wohnte und immer höflich zu ihnen war. Seine Worte trieben ihr Tränen in die Augen, und sie dachte nicht mehr daran, sich zurückzuhalten. Mit einem Schrei überwand sie die letzten Schritte bis zu der Öffnung, wo einst eine Holztür gewesen war, und hob den Ast über den Kopf.
»Verschwindet!«
Vier Gesichter blickten sie mit vor Schreck geweiteten Augen an, von den Flammen rötlich beleuchtet, als hätte jemand einen Eimer Blut über sie ausgeleert.
»Nehmt euren Kram mit und denkt nicht einmal daran, euch noch ein einziges Mal hier blicken zu lassen!« Ihre Stimme kratzte und dämpfte die Klarheit, die sonst darin lag.
Alle vier sprangen auf – es waren wirklich Arly, Bran sowie seine besten Freunde Ethna und Ross –, rührten sich aber nicht. Zwischen ihnen flackerte das Feuer; sie hatten Brot auf Stöcke gespießt und einen Trinkschlauch zwischen sich auf einen Ast gelegt. Arly war aus ihren Schuhen geschlüpft, da sie offenbar aus irgendeinem Grund zu glauben schien, dass Hexen barfuß ums Feuer tanzten. Ihre Füße waren klein und schmutzig, und aus unerfindlichen Gründen machte der Anblick Cyntha noch wütender. »Ich sagte, ihr sollt verschwinden!«, brüllte sie, holte aus und ließ den Ast so fest sie konnte gegen Brans Schulter krachen.
»He!« Er taumelte, und einen flüchtigen Moment lang wünschte sich Cyntha, er würde ins Feuer treten. Nicht, um zu verbrennen, sondern um einen Teil der Schmerzen zu spüren, die gerade in ihr wüteten.
Die anderen wichen ebenfalls zurück. Sie alle wirkten erschrocken, lediglich Arly hatte den Anstand, Cyntha einen schuldbewussten Blick zuzuwerfen.
»Cyn, wir haben …«
Aber sie wollte keine Worte. Sie wollte, dass ihr altes Zuhause wieder so aussah, wie sie es verlassen hatte. »Weg!«, schrie sie und holte ein zweites Mal aus. Obwohl sie niemanden traf und der Ast nur einen lächerlich kleinen Kreis beschrieb, der sie beinahe selbst von den Füßen riss, brachte es Bewegung in die anderen: Sie klaubten ihre Sachen zusammen und stürmten davon. Lediglich Arly kehrte noch einmal zurück und schnappte sich ihre Schuhe, die sie in der Hektik vergessen hatte. Ihre Schritte entfernten sich, und sie riefen einander Dinge zu – vermutlich, dass Cyntha verrückt war und sie sich beim Dorfvorsteher oder sogar bei Lord und Lady Buford über sie beschweren würden, aber das interessierte sie nicht.
Plötzlich fühlte sie sich so leer wie die Hütte. Der Ast polterte am Rand des Feuers zu Boden und ließ Funken aufstieben. Manche davon trafen Cynthas nackten Unterarm. Obwohl sie darauf starrte und sah, dass sich ihre Haut rötete, spürte sie es nicht. Dafür brannten sich die Tränen den Weg über ihre Wangen, und sie wischte sie ärgerlich weg, ehe sie sich umblickte und die Erinnerungen von sich schob, die sich aus sämtlichen Ecken und Schatten anschleichen wollten. Wenn sie sich darin verlor, würde es ihr lediglich flüchtige Glücksmomente bringen, mit einer Traurigkeit im Schlepptau, die sie für eine zu lange Zeit verschlingen würde. Es war besser, wenn sie in der Gegenwart blieb. Was brachte es, sich in Vergangenem zu verlieren? Sie hatte das bereits zu oft getan, und es hatte ihr nicht weitergeholfen.
»Verdammt«, murmelte sie, schob die glühenden Holzstücke mit einem Fuß zusammen und musterte die Ranken an der Wand vor sich. Ihre Mutter hatte sie kurz nach Cynthas Geburt gemalt. Über die Jahre waren sie verblasst, und jetzt, da das Dach fehlte, teils vom Regen ausgewaschen worden. Cyntha hob eine Hand, zögerte und strich behutsam mit den Fingerspitzen darüber.
Die Ranken erwachten zum Leben.
Manche lösten sich von der Steinmauer und streckten sich durch die Luft in den Raum hinein, andere spreizten ihre Blätter und leuchteten auf, als würde nicht die Nacht, sondern der Tag bevorstehen. Zwischen ihren Ansätzen erschienen kleine, helle Blüten. Eine Pflanze legte sich um Cynthas Handgelenk, um sich dann bis zu ihrem Ellenbogen zu schlängeln und dabei die winzigen Brandwunden zu kühlen.
Ihre Mutter war gegangen, hatte aber ihre Magie zurückgelassen, sodass sich dieser kleine Teil von ihr noch immer um ihre Tochter kümmerte. Cyntha versuchte ein Lächeln, um auch das Brennen in ihrem Bauch zu mindern, aber es funktionierte nicht. Vielleicht, weil ihre Mundwinkel nicht aufhören wollten zu zittern.
»Ich habe mir schon gedacht, dass die anderen vor dir geflüchtet sind.«
Sie fuhr herum, obwohl sie die Stimme bereits erkannt hatte, aber dennoch ärgerte sie sich. Trotz der Trauer hätte sie die Umgebung nicht außer Acht lassen dürfen. Augenblicklich zogen sich die Schlingpflanzen zurück und wurden wieder zu dem, was sie für die meisten Menschen waren: Zeichnungen auf unbewohnten Mauern.
»Was beim Abgrund tust du hier?«, fragte sie ruppiger, als sie wollte.
Brooke hob beide Hände und gab sich Mühe, erschrocken auszusehen, scheiterte aber kläglich. Sie kannte Cyntha zu gut, um sich wirklich von ihr Angst machen zu lassen. »Ich beruhige die wilde Frau, ehe sie einen Tobsuchtsanfall bekommt und wie eine Irre auf der Suche nach Opfern durch den Wald rennt.«
Cyntha blinzelte. »Bitte was?«
Schulterzucken. »Ich denke, damit habe ich ungefähr zusammengefasst, was mir Bran, Arly und die anderen zugerufen haben, als ich ihnen gerade begegnet bin.« Brooke ließ sich zu Boden sinken, lehnte sich an die Wand, um die langen Beine auszustrecken, und zupfte an ihrem dunklen Haar. Es war kaum fingerlang, da sie es vor ein paar Wochen abgeschnitten hatte, um die Läuse auf ihrem Kopf zu bekämpfen. Zumindest erzählte sie das jedem, wobei Cyntha glaubte, dass Brooke einfach eine gute Ausrede gefunden hatte, um wieder etwas auszuprobieren, über das sich andere die Mäuler zerrissen. »Was hast du mit ihnen angestellt, Cyn?«
»Sie lediglich überrascht und mit einem Stock vertrieben.«
Brooke nickte. »Gut so, das ist das Mindeste. Demnächst nimm eine Schleuder, die werden die Bufords nicht als Waffe gegen dich auslegen. Aber ein Treffer kann verdammt wehtun.« Sie zwinkerte.
Brooke war die Einzige, die nicht um den heißen Brei herumredete oder Cyntha behandelte, als würde die ihr früher oder später in die Hand beißen – Brookes Worte, aber sie trafen das Ganze ziemlich gut. Die Dörfler begegneten Cyntha nicht mit so viel Ablehnung, wie sie es bei ihrer Mutter getan hatten, aber sie trauten ihr nicht. Manchmal flüsterten sie hinter ihrem Rücken, und wenn sie bei einem Fest auf dem Marktplatz erschien, hielten manche deutlichen Abstand zu ihr. Dabei war das Unsinn. Ihre Mutter hatte Magie besessen – nicht sie –, und sie hatte niemals jemandem damit geschadet. Im Gegenteil. Wie konnte man Ranken, Blumen oder zarte Blüten aus Licht für etwas Böses halten?
Die Dörfler sahen das anders und munkelten alte Geschichten vor sich hin, laut denen Magiebegabte von den grausamen Dunkelwesen abstammten, die vor den Menschen in der Welt gelebt hatten und vergangen waren, als sich das Licht seinen Platz neben der Dunkelheit behauptete.
Cyntha atmete aus und fühlte sich, als hätte sie die Luft angehalten, seit sie die Hütte betreten hatte. »Allmählich sollte ich mich daran gewöhnt haben, nicht wahr?«, fragte sie bitter und ließ sich Brooke gegenüber auf den Boden fallen. »All die Jahre war ich immer nur die Tochter einer Magiebegabten. Nachdem wir Mutter beerdigt hatten, war ich fest davon überzeugt, dass sich das ändern würde. Aber das hat es nicht, und das wird es nie. Dabei kennen mich all diese Leute schon mein ganzes Leben lang.« Sie trat gegen ein Holzstück, sodass ein Teil des Feuers in sich zusammenfiel.
Brooke lachte kurz auf. »Ich finde es süß, dass du glaubst, in Buford könnten sich Dinge ändern. Vielleicht für den Lord und die Lady, aber das Dorf wird immer dasselbe sein. Wo kämen wir denn hin, wenn nicht alles so wäre wie schon zu Zeiten der Großeltern? Panik würde ausbrechen, vielleicht sogar Tumulte und Prügeleien, und der eine oder andere würde die Gegend für immer verlassen.«
Cyntha versuchte sich an einem kläglichen Lächeln. Es funktionierte, und der Druck in ihrem Bauch wurde schwächer. »Eine schreckliche Vorstellung. Was wäre der Marktplatz ohne all den Tratsch?«
»Oder die Taverne ohne Mallemon, den man bereits riecht, noch ehe man ihn sieht«, sagte Brooke und seufzte. »Sie werden sich niemals ändern, Cyn, das weißt du so gut wie ich. Daher verstehe ich nicht, dass du deine Hoffnungen an sie verschwendest. Du wirst immer die Tochter einer magisch begabten Frau sein, die man nicht in die eigenen vier Wände lassen wollte. Ich glaube nicht mal, dass sie dir wirklich misstrauten, wenn sie sich die Zeit nehmen würden, genauer darüber nachzudenken. Aber dazu haben die wenigsten Lust, weil ihr Kopf schon voll ist mit Plänen für das Essen, das Füttern der Tiere oder mögliche Heiratskandidaten für ihre Kinder.« Sie zog eine Grimasse. »Also verhalten sie sich so, weil sie es schon getan haben, als deine Mutter noch lebte und man … keine Ahnung, glaubte, dass sie ihre Magie auf dich übertragen könnte, wenn sie dich zu oft umarmt.«
»Magie ist keine Krankheit«, sagte Cyntha leise und wünschte sich, die Ranken noch einmal auf ihrer Haut zu spüren. Aber auch wenn Brooke kein Problem mit ihr hatte, wollte sie ihre einzige Freundin nicht in Verlegenheit bringen, also verschränkte sie die Hände in ihrem Schoß. »Und sie hat auch nichts mit uralten, bluttrinkenden Wesen zu tun. Sie steckt nur in den Steinen dieses Hauses, weil meine Mutter sie für mich zurückgelassen hat.«
Brooke lachte leise. »Wenn sie ansteckend wäre, hätten wir das Dorf vermutlich für uns. Oder sogar das Gutshaus.«
Cyntha schüttelte den Kopf. »Lady Buford hat keine Probleme mit mir. Beim Lord bin ich mir nicht sicher, aber er lässt mich immerhin noch für sich arbeiten. Und eines Tages«, sie hob das Gesicht zum Himmel und suchte in dem stetig dunkler werdenden Blau nach Lichtpunkten, »werde ich genug Geld verdienen, um diese Hütte wieder aufzubauen. Mein Vater wird hier alt werden und nicht mehr quer durchs Land fahren müssen, um Essen kaufen zu können.«
Sie träumte schon lange davon. Ihr Vater hatte keine Probleme im Dorf; man begegnete ihm sogar mit Anerkennung, seit er damals in die brennenden Ställe der Bufords gerannt war, um die Rinder zu retten. Seine Verletzungen waren zu stark gewesen, um weiterhin als Hirte zu arbeiten, und seither zog er mit dem Trödelwagen durch das Land. Aber es war kein Leben, das ihn glücklich machte; mit der Zeit würde erst sein Körper aufgeben und dann sein Geist. Er war nicht für die Straße gemacht, sondern gehörte hierher. »Ich bleibe bei ihm, und mir wird egal sein, was man über mich redet.«
»Das klingt gut. Habt ihr vielleicht noch ein Zimmer für mich frei? Ich vermute nämlich stark, dass das Dorf bald über mich reden wird.«
»Weil du Braxton Horders Antrag abgelehnt hast, obwohl er weder arm noch hässlich ist? Ja, ich denke, das wird durchaus für Gesprächsstoff sorgen.«
Brooke hob die Brauen, sprang auf und streckte Cyntha eine Hand entgegen. »Er ist langweilig und interessiert mich wenig. Aber du solltest mir dankbar sein, dass ich mein Bestes gebe, um die Aufmerksamkeit der werten Nachbarn auf diese Weise von dir wegzulenken.«
Cyntha ließ sich hochhelfen. »Ich weiß deine Bemühungen sehr zu schätzen«, sagte sie mit todernster Miene. Sie zögerte, schlang die Arme um Brooke und drückte sie an sich. »Danke.«
Brooke klopfte ihr auf den Rücken, hielt dann aber still. Eine Weile schwiegen sie beide, und Cyntha lauschte dem Wind, der sich in den Ecken verfing und nur unter pfeifendem Protest wieder befreite. Die Umgebung war ruhig, und sie wünschte sich nicht zum ersten Mal, dass sich dieser Frieden für immer in ihr festsetzte. Leider hielt das nie lange.
Behutsam löste sich Brooke von ihr. Die Dämmerung wich allmählich der Nacht, vor allem, da die Glut des Feuers schwächer wurde. »Na los, gehen wir zurück. Es wird kühl, ich habe Hunger, und Bailor und Tanner verprügeln mich, wenn sie wegen mir mit dem Essen warten müssen.«
Cyntha sparte sich einen Kommentar. Jeder im Dorf wusste, dass es Brooke war, die ihre älteren Brüder herumkommandierte, und nicht umgekehrt. Zwar lebten die beiden Jungs nicht mehr im Haus ihrer Eltern – im Gegensatz zu Brooke, die bislang noch jedem Versuch, sie zu verheiraten, entkommen war –, kehrten aber an den meisten Abenden mit ihren Frauen zur gemeinsamen Mahlzeit dorthin zurück. Es war stets eine fröhliche Runde, die sich in die Hütte der Woods quetschte, und manchmal schloss sich Cyntha ihnen an. Allerdings achtete sie darauf, nicht allen Einladungen zu folgen, da sie Brookes Eltern nicht in Verruf bringen wollte. Lediglich Lady Buford konnte sich erlauben, täglich mit ihr gesehen zu werden, ohne dass man über sie redete – und wenn, würde es ihr Leben ohnehin nicht beeinflussen.
Schweigend stapften sie nebeneinander durch den Wald in Richtung der Lichter, die sich mehr und mehr vor ihnen aus der Dunkelheit schälten. Cyntha war froh, dass die neue Hütte, die sie und ihr Vater nach dem Brand bezogen hatten, am Dorfrand lag. So würde sie nur wenigen Menschen begegnen und noch weniger Fragen beantworten müssten. Besser, sie sah noch einmal in den Stallungen auf Gut Buford nach dem Rechten, weil sie genau wusste, dass Robson seine Pflichten gerade am Abend gern vernachlässigte und früh zu Bett ging, um morgens vor Sonnenaufgang aus dem Haus zu sein. Sie verstand bis heute nicht, warum er der Nachfolger ihres Vaters geworden war. Er wusste zwar, was ein Hirte zu tun hatte, war aber nie mit dem Herzen bei der Sache.
Sie stutzte, als sie den Blick hob, und wäre beinahe über eine Wurzel gestolpert, hätte Brooke nicht einen Arm ausgestreckt.
»Was ist los, bist du um diese Zeit etwa schon müde?«
Cyntha blinzelte, als würde sich das Bild vor ihr dadurch ändern. »Es brennt Licht.«
Brooke blickte von ihr zu den Hütten am Dorfrand, dann wieder zurück, und musterte sie, als wäre sie auf den Kopf gefallen. »Ja, Cyn. Es brennen Lichter. Es wird Abend, und die Leute zünden Laternen und Kerzen an. Noch etwas, das du gern erklärt haben würdest?«
Cyntha schlug ihr ohne hinzusehen gegen den Arm. »In unserer Hütte brennt Licht! Dabei kommt Vater doch erst in drei Tagen zurück.«
Brooke machte einen langen Hals. »Tja, das war es dann wohl mit deiner Ruhe. Sein Karren steht dort hinten, und er spannt gerade euer Pferd ab.«
Cynthas Haut kribbelte auf eine Art, die sich nicht gut anfühlte. Natürlich gab es zahlreiche Gründe, warum er seine Fahrt durch das Land verfrüht beendet hatte. Aber seit sie nur noch zu zweit waren, machte sie sich Sorgen, und zwar jedes Mal, wenn er zu einer Reise aufbrach, um alte Sachen zu kaufen und möglichst gewinnbringend wieder loszuwerden. Er war nicht mehr der Jüngste und konnte seinen linken Arm seit der schrecklichen Gewitternacht nur unter Schmerzen benutzen. Außerdem zog er das Bein auf derselben Seite nach und kam ihr oft so hilflos vor. So dünn und angreifbar. Dass er nicht mehr als Hirte arbeiten konnte, nagte zudem an seinem Gemüt – Cyntha war sicher, dass die nach vorn gezogenen Schultern damit zusammenhingen.
Rasch umarmte sie Brooke und lief dann schneller. »Vater?« Sie stieß den Atem aus, als er sich hinter dem Karren aufrichtete und ihr wie gewohnt zuwinkte. Sein dunkles Haar war feucht, aber noch immer so dicht, dass einzelne Tropfen darauf zu schweben schienen. Er hatte einiges an Cyntha vererbt, aber äußerlich schlug sie nach ihrer Mutter mit ihren hellen Strähnen, die zu glatt waren für komplizierte Flechtfrisuren. »Was tust du hier? Ich habe dich erst in drei Tagen zurückerwartet.«
Er zuckte mit den Schultern und tätschelte die Flanke des alten Pferdes, das den Kopf gesenkt hatte und nur darauf wartete, ausgeschirrt und in den Stall geführt zu werden. Die Stute war ein Geschenk der Bufords gewesen, damals, als sie Elwin Hirde aus ihren Diensten hatten entlassen müssen. So kannst du dir deinen Lebensunterhalt sichern, hatten sie gesagt, und das tat er seitdem. Zwar brachte das Dasein als fahrender Trödler nicht genug, um sie beide zu ernähren, aber durch Cynthas Arbeit als Aushilfe in den Ställen kamen sie über die Runden.
Ihr Vater ließ die Leine sinken, hinkte auf sie zu und legte ihr eine Hand auf die Schulter. Eine liebevolle Geste, und auch das Braun seiner Augen war voller Wärme. »Wo hast du dich rumgetrieben, hm?« Sein Blick ging in die Ferne, und sie schwieg, da er die Antwort ohnehin kannte. Stattdessen musterte sie ihn und entdeckte das zuckende Lid auf der mit Brandnarben überzogenen Gesichtshälfte. Als er irgendwann nicht mehr ignorieren konnte, dass sie ihn anstarrte, hob er die Schultern und machte sich wieder an die Arbeit. »Mein Bein wollte nicht so wie ich.« Seine Stimme war gedämpft, weil er sich hinter dem breiten Hals der Alten versteckte.
Cyntha tätschelte das Tier, woraufhin es ihr warme Luft entgegenschnaubte, schlüpfte blitzschnell neben ihren Vater und legte eine Hand auf seine. Helle Finger auf dunklen, rissigen, roten. »Wie schlimm ist es?«
Er sah sie nicht an, und das war Antwort genug. Der Karren war noch voll beladen, aber auf den ersten Blick entdeckte Cyntha viele Gegenstände, mit denen er losgezogen war. Vermutlich war ihre Haushaltskasse leer, aber das war nicht seine Schuld. Er gab sein Bestes, und sie wusste, dass es ihm jedes Jahr schwerer fiel. Sie brauchten eine Lösung, aber so oft sie auch darüber grübelte, ihr fiel keine ein.
Als sich seine Finger endlich bewegten, sackten seine Schultern herab. »Bei der nächsten Fahrt wird es besser.« Die Hoffnung in seinen Worten war zu deutlich, um echt zu sein.
Cyntha fasste ihn an den Schultern und zog ihn zu sich herum. »Du gehst ins Haus und machst uns Wasser für einen Tee, ja? Ich kümmere mich um die Alte, bringe sie in den Stall und reib sie ab. Ich wollte eh nach den Rindern sehen.«
»Heute noch?« Er runzelte die Stirn, strich über seine Augen und verwischte den Schmutz, der sich darunter festgesetzt hatte.
Sie nickte, und auf einmal kribbelte etwas in ihrer Brust. Aufregung, Stolz, gemischt mit einem Hauch Nervosität. »Wenn man es so betrachtet, bist du genau zur rechten Zeit zurückgekommen. Lord und Lady Buford haben hohen Besuch …«
»Wen?«
Cyntha winkte ab. »Irgendeinen Earl.« Lady Buford hatte ihr den Namen genannt, aber sie hatte ihn sich nicht gemerkt. Er war nicht wichtig, im Gegensatz zu anderen Dingen: zum Beispiel, dass Bufords Rinder und einige Schafe aus der neuen Zucht preisgekrönt waren und der Lord sie seitdem gern seinen Gästen präsentierte. Oder dass Robson bis gestern nicht in der Lage gewesen war, die Tiere angemessen zu führen. »Lord Buford will ihm morgen sein Vieh zeigen. Und ich werde alles dafür tun, dass es eine gute Vorführung wird.«
»Cyntha.« Sein Vater nahm ihre Hände in seine, und einen flüchtigen Moment lang fühlte sie sich wieder wie das kleine Mädchen, das von seinen Eltern beschützt wurde. Aber sie war schon längst kein kleines Mädchen mehr und wusste, dass die Welt ihre Grausamkeit in unendlich vielen Facetten zeigen konnte und nur sehr dumme Menschen darauf hofften, für immer in Sicherheit zu sein. »Du kannst Robson nicht seine Stellung abringen. Das wird Lord Buford nicht zulassen. Er hat ihn nach meinem Ausscheiden offiziell zum Hirten bestimmt.« Er wusste genau, was sie vorhatte.
Sie schüttelte den Kopf und machte sich los. »Die Zeiten haben sich geändert, Vater. Es ist nicht mehr wie früher, wo sich nur Männer um die Tiere der Herrschaften gekümmert haben. Lady Buford hat mir selbst gesagt, dass sie zufrieden ist mit meiner Arbeit, und sie weiß genau, dass Robson keinen wirklichen Bezug zum Vieh hat. Von den Hunden ganz zu schweigen.«
»Trotzdem.« Sein Blick flackerte. »Misch dich da besser nicht ein.«
Seine Bedenken kamen nicht von irgendwoher. Sie hatte es ohnehin schwer im Dorf, und er wollte nicht, dass sie Robson gegen sich aufbrachte und noch mehr Probleme bekam. Aber wenn sie den Kopf gesenkt hielt und sich möglichst unsichtbar machte, würde sich nie etwas ändern. Sie hatte es lange versucht, und es hatte sie kein Stück weitergebracht. Die Leute würden sie nie ganz akzeptieren. Ihr Vater dagegen hatte einen anderen Status; man sah es ihm nach, dass er ein Narr gewesen war und eine Frau heiratete, die er auf einem der Viehmärkte kennengelernt hatte. Die meisten glaubten, dass Cynthas Mutter ihn mit ihrer Magie verhext, einen Bann über ihn geworfen und seine Liebe erzwungen hatte.
Manchmal redete er darüber, dass Cyntha und er das Dorf verlassen und sich ein anderes Leben aufbauen sollten, wo niemand sie und ihre Vergangenheit kannte und seine Tochter früher oder später das tun würde, was Frauen in ihrem Alter nun einmal taten: sich einen Mann suchen, heiraten und eine eigene Familie gründen.
Aber sie wollte hier nicht weg. Ihre Mutter hatte ihr Magie in den Mauern der alten Hütte hinterlassen, und dieses Band war zu kostbar, um es aufzugeben. Und auch, wenn sie niemals direkt darüber redeten, wusste sie, dass es ihrem Vater ähnlich ging. Er hatte schon immer in Buford gelebt, und sie sah ihm vor jeder neuen Reise mit der Alten an, dass er am liebsten bleiben würde. Hier kannte er die Menschen und hatte sich glückliche Erinnerungen erschaffen.
»Mach dir keine Sorgen«, sagte sie, hauchte ihm einen Kuss auf die Wange und machte sich an Zugsträngen und Hintergeschirr der Alten zu schaffen, um anschließend die Schere vom Selett zu lösen. »Morgen werde ich Lord Buford und seinem hohen Gast zeigen, dass ich zu mehr tauge als nur zur Gehilfin, und danach werden sich Dinge ändern.«
2
Eine unerwartete Nachricht
Die Sonne brach durch die Wolken und blendete Cyntha in dem Augenblick, als Bufords preisgekrönte Schafe die Lücke im Zaun fanden, die Robson bislang nicht repariert hatte, und sich als wolliger Pulk von dannen machten. Fröhliches Mäh klang durch die Luft. Cyntha drehte sich um und gab vor, sich mit dem Verschluss der Stalltür zu beschäftigen, um ihr Lachen zu verbergen. Sie spürte nahezu, wie sich der Blick ihres Vaters in ihren Rücken brannte, aber er hatte sie schließlich gebeten, sich nicht einzumischen. Daher würde sie abwarten, zumindest, bis Robson die Nerven verlor. Der brüllte gerade hinter den Schafen her und hatte wohl vergessen, dass die Hunde lediglich auf sein Kommando warteten.
Vor dem Gutshaus saßen Lord und Lady Buford in pelzbesetzten Mänteln an einem Tisch, durch einen Überhang vor dem leichten Nieselregen geschützt, und beobachteten das Ganze so reglos, als hätte die Scham sie eingefroren. Den Ehrenplatz zwischen ihnen hatte der Earl von Falstone, aus Ländereien im Norden, von denen Cyntha noch niemals gehört hatte – im Gegensatz zu ihrem Vater, der auf seinen Trödelfahrten das gesamte Land bereiste.
Auf den ersten Blick wäre sie fast zurückgezuckt – nicht wegen der großen Narbe auf der linken Wange in Form eines Kreuzes, die halb über der Nase verlief und Mundwinkel sowie Augenlid berührte, sondern weil der Blick des Earls so durchdringend war. Dann aber begriff sie, dass er verloren wirkte, nicht zornig. Als würde dieser Mann etwas suchen, von dem er bereits wusste, dass er es niemals finden würde. Abgesehen davon war er das, was die Leute im Dorf so gern als stattlich bezeichneten: groß mit breiten Schultern, und der bei den hohen Herren oft gepflegte Bauch hielt sich in Grenzen. Sein dunkles Haar war an den Schläfen bereits grau und reichte ihm über die Wangenknochen. Er musste ungefähr so alt sein wie die Bufords und doppelte damit die Jahre, die Cyntha auf der Welt war.
Als Earl stand er im Rang über seinen Gastgebern, was nicht nur ihr Verhalten spiegelte, sondern auch sein reich bestickter Mantel. Fast wirkte er damit zu klein für den Stuhl mit der hohen Lehne und den massiven Armstützen, und der Saum hing bis auf den Boden.
Selbst auf die Entfernung glaubte Cyntha, seinen Blick zu spüren, als würde er auf etwas warten. Sie holte behutsam Luft, während Robson den Schafen nachsetzte und dabei Flüche ausstieß, und sah noch einmal zu ihrem Vater. Er hatte die schwarz-weiß gescheckten Hunde selbst ausgebildet. Sie zuckten mit den Ohren und warteten nur darauf, endlich ihre Arbeit tun zu dürfen.
Es lief genau so, wie Cyntha es sich erhofft hatte. Robson war ein durchschnittlicher Arbeiter, aber hilflos, sobald etwas Unvorhergesehenes passierte. Außerdem fehlte ihm das feine Gespür, um Daisy und Darla zu verstehen und zu führen. Cyntha dagegen war mit ihnen aufgewachsen, hatte sie bereits als Welpen im Arm gehalten, und als sie sich wieder umdrehte, war ihr, als würde Lady Buford ihr zunicken.
»Also dann«, murmelte sie, und die beiden spitzten die Ohren. Cyntha legte die Finger an die Lippen, stieß einen schrillen Pfiff aus, und die Tiere flitzten los, den Schafen hinterher, die mittlerweile in der Ferne zu einer weißen Masse verschmolzen waren. Daisy und Darla waren erfahren genug, um die Herde zu beiden Seiten mit genügend Abstand zu umrunden und sie vom Kopf her zurück zum Gatter zu treiben, durch das sie entkommen waren.
Cyntha setzte sich ebenfalls in Bewegung, ignorierte Robsons Verblüffung und den Zorn, der sich auf seinem Gesicht abzeichnete, und stieß das Gatter weiter auf.
Nachdem Daisy und Darla ihre Positionen erreicht hatten und auf das nächste Kommando warteten, waren die Schafe stehen geblieben. Cyntha pfiff zweimal kurz, dann ein drittes Mal, wobei sie den letzten Ton in die Länge zog, woraufhin die Hündinnen sich an die Arbeit machten: Darla trieb die Schafe vorwärts und zum Hof; Daisy kümmerte sich um Ausreißer und brachte sie zur Herde zurück.
Kurz darauf waren die wertvollen Tiere wieder dort, wo sie sein sollten, und liefen auf der Suche nach Futter von einer Seite auf die andere. Das Gewusel war nicht schön anzusehen, aber Cyntha hatte nicht umsonst immer dann heimlich für einen Tag wie diesen trainiert, wenn Robson sich bereits zur Taverne aufgemacht hatte: Auf ihr Kommando hin trieben die Hunde die Herde zurück – bis auf die drei preisgekrönten Widder, mit denen die Bufords bisher auf jedem Markt Eindruck hatten schinden können. Regungslos standen die Tiere im Hof und starrten die Menschen unbeeindruckt an.
Cyntha atmete auf. Zwar war der Ausbruch der Herde vor dieser kleinen Präsentation nicht geplant gewesen, aber umso besser. Mit Robsons Launen würde sie später schon zurechtkommen, immerhin hatte er sich das Ganze selbst zuzuschreiben.
Der Earl beugte sich zur Seite und sagte etwas zu Lord Buford. Vielleicht fragte er, wer sie war. Vielleicht empfahl er auch, ihr Robsons Posten zu überlassen und sie von der Gehilfin zur offiziellen Hirtin zu machen, auch wenn viele noch immer nicht akzeptieren wollten, dass Frauen diese Tätigkeit ebenso gut erledigten wie Männer. Vielleicht war der Earl ein fortschrittlich denkender Mensch und nicht so sehr mit Spinnenweben an die Vergangenheit gekettet wie die Leute aus dem Dorf. Auch für Robson wäre ein solcher Wechsel nicht die schlimmste Entscheidung. Seine Familie war groß und weit verzweigt; er würde ohne Mühen eine neue Anstellung finden. Womöglich sogar eine, die ihn mehr begeisterte als diese, die er lediglich bekleidete, um seinem Vater zu gefallen.
Auf Lady Bufords Lippen lag ein leises Lächeln, da war sich Cyntha sicher, und als die beiden Männer sich ihnen wieder zuwandten, deutete sie eine Verbeugung an und machte sich auf Robsons ärgerlichen Wink hin auf den Weg in den Stall, um die Rinder für die nächste Vorführung zu holen.
Das Wasser war kalt, da Cyntha keine Zeit gehabt hatte, das Feuer in ihrer Hütte neu zu entfachen. Also biss sie die Zähne zusammen, nachdem sie sich aus den Arbeitssachen geschält hatte, und wusch sich so rasch sie konnte. Anschließend schlüpfte sie in ihr gutes Kleid aus Baumwolle, das ihrer Mutter gehört hatte und ihr lediglich ein wenig zu groß war. Sie trug es nur zu besonderen Anlässen, und auch, wenn sie von den Bufords noch nichts gehört hatte, hoffte sie auf eine gute Nachricht. Sie löste den Zopf und bürstete sich die Haare aus, bis sie knisternd über ihren Rücken fielen, ehe sie die Schublade ihres Nachttischs aufzog und den Spiegel herausnahm.
Behutsam strich sie über das geschwungene Silber des Rahmens. Immer wenn sie ihn in der Hand hielt, bewunderte sie die Arbeit, den Glanz und die feine, glatte Oberfläche. Ihr Vater hatte ihn auf einer seiner ersten Trödelfahrten gefunden, als es ihn beinahe bis zur Küste ganz im Norden des Landes verschlagen hatte – da war die Alte noch ein kraftvolles Tier gewesen und hatte lange Strecken mit Leichtigkeit zurückgelegt. Cyntha begriff nicht, wie jemand eine solche Kostbarkeit verlieren konnte. Der Spiegel hatte in einer Felsspalte an den Klippen gesteckt, und ihr Vater hatte ihn nur bemerkt, weil ein Sonnenstrahl darauf gefallen war.
Er war ihr kostbarster Besitz, und auch, wenn sie sich wenig aus hübschen Kleidern oder bunten Bändern machte – denn welche Hirtin brauchte das schon? –, liebte sie ihn. Jetzt zeigte er ihr, wie gerötet ihre Wangen vor Aufregung waren und wie sehr sie ihrer Mutter ähnelte mit den hellen Haaren, den großen Augen, in denen sich Grau und Blau vermischten, und den gewölbten Brauen darüber, die stets wirkten, als hätte Cyntha eine Frage gestellt und würde auf die Antwort warten.
»Bitte, schenk mir eine gute Nachricht«, flüsterte sie und machte sich daran, ihren Zopf neu zu binden. Dann strich sie noch einmal über ihr Kleid, entdeckte ein Loch im rechten Ärmel, hatte aber keine Nerven übrig, um es jetzt zu flicken. Sie sah sich um und rückte den Kessel an der Kochstelle zurecht. Die Asche hatte sie bereits heute früh herausgetragen, ehe sie sich auf den Weg zu den Bufords gemacht hatte.
Eine Haarsträhne entwich ihrem Zopf, fiel ihr vor das Gesicht, und Cyntha blies sie ungeduldig zurück. Sie hasste Warten, vor allem, wenn sie nicht wirklich etwas tun konnte aus Angst, das Kleid zu beschmutzen oder ein weiteres Loch hineinzureißen. Der Stoff war an vielen Stellen schon dünn.
Sie lief von einer Wand zur anderen und spitzte dabei jedes Mal die Ohren, wenn sie draußen etwas hörte. Drei Schritte, umdrehen, drei weitere Schritte, so lange, bis sich die Umgebung drehte. Je länger sie das tat, desto größer wurden die Zweifel in ihrem Kopf, und das gefiel ihr ganz und gar nicht. Hatte sie eine Grenze überschritten, indem sie Robson so vorgeführt hatte? Oder war ihr keine andere Möglichkeit geblieben? Die Hunde hörten nicht gut auf ihn, weil er die Kommandosignale nur selten richtig hinbekam, und dann suchte er den Fehler bei den Tieren und schrie sie an.
Gerade als sie sich entschied, bei Brooke anzuklopfen, um sich abzulenken, wurde die Tür geöffnet.
»Cyntha.« Ihr Vater sah nicht so fröhlich aus, wie sie gehofft hatte. Genauer gesagt war er seltsam blass. Cyntha legte eine Hand auf ihren Bauch, weil sich das Grummeln dort in einen unangenehmen Druck verwandelte. »Du sollst zu den Herrschaften kommen.«
Sie nickte, schüttelte dann aber den Kopf und blieb stehen, obwohl sie am liebsten losgerannt wäre. »Etwas stimmt nicht, habe ich recht?«
Er wirkte müde in seinen guten Sachen, die er nur für den Besuch bei den Lordschaften aus der Truhe holte. »Sind sie … ungehalten? Hat sich Robson beschwert? Oder der Earl?« Womöglich war er genau das Gegenteil von dem, was sie sich erhofft hatte – ein Mann mit veraltetem Denken, der dem Lord vorgehalten hatte, dass sich unter anderem eine Frau um seine kostbaren Tiere kümmerte. Allein die Vorstellung sorgte dafür, dass sie die Hände zu Fäusten ballte. Sie war dreiundzwanzig Winter alt und würde unter anderen Umständen eine Familie gründen. Aber diese Möglichkeit bot sich ihr als Tochter einer Magiebegabten nun einmal nicht, also war es unfair, wenn sich jemand in ihren Weg stellte, während sie versuchte, sich ein Leben aufzubauen, das zu ihr passte! Eines, in dem sie niemand misstrauisch beäugte und hinter ihrem Rücken ein Zeichen gegen das Böse schlug, weil sich Tiere nun einmal nicht darum scherten, wer sie geboren hatte oder welche Gerüchte im Umlauf waren.
»Nein, nein. Mach dir keine Sorgen.« Ihr Vater griff nach ihren Händen. Seine waren eiskalt, manche Finger bereits gekrümmt, und sie strich sanft darüber. Er hatte nur noch sie, also musste sie für seinen Lebensabend sorgen. Wenn es nach ihr ging, schuldeten die Bufords ihm weit mehr als diese Hütte, Wohnrecht auf Lebenszeit, eine alte Stute und einen Karren.
Sie zog ihre Finger zurück. »Was ist es dann?«
»Das möchten die Herrschaften dir selbst sagen.« Er blickte an ihr vorbei hin zur Wand, was nie ein gutes Zeichen war.
»Vater …«
»Geh. Lass sie nicht warten.« Seine Stimme war brüchig. Aber da sie ihm glaubte, wenn er sagte, dass sie sich nicht sorgen musste, und weil sie ihre Grundherren nicht länger als nötig warten lassen durfte, raffte sie den Rock und hastete aus der Tür.
Der Regen hatte nicht nachgelassen und Pfützen gebildet. Cyntha versuchte, sie zu umrunden, ohne ihr Tempo zu verringern. Zunächst hatte ihr Herz noch im Takt ihrer Schritte geschlagen, aber nun raste es, kaum dass sie den Rand des Dorfs hinter sich gelassen hatte und vor ihr das Gutshaus in den Himmel wuchs, mit den langgestreckten Stallungen, die bei dem Wetter fast bedrohlich wirkten. Ein Omen?
Cyntha schnaubte ungehalten. Nun fing sie auch schon damit an.
»Das … ist … albern«, stieß sie zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und nahm die letzte Pfütze, ehe sie den Hof erreichte. Beinahe hätte sie aus Gewohnheit den Weg zum Dienstboteneingang eingeschlagen, aber die Bufords hatten sie offiziell hergebeten, und damit wurde sie vorn an der großen Tür erwartet.
Sie umrundete das Haus und blieb vor dem Eingang stehen, strich sich noch einmal über Haare und Kleid und ließ dann den Eisenring gegen das Holz prallen. Es wurde geöffnet, noch während das schwere Geräusch im Inneren nachhallte, was schlicht bedeutete, dass man auf sie wartete und Goddie, der Hausjunge, seinen Platz in der Halle nicht verlassen hatte. Mit seinen zur Seite gekämmten Haaren und dem Hausanzug in Grau und dunklem Grün sah er lächerlich aus. Aber vielleicht fand sie das auch nur, weil sie noch genau wusste, wie er sich neulich mit einem alten, halb blinden Wildschwein im Schlamm gewälzt hatte, um seinen Mut zu beweisen. Cyntha mochte ihn. Er war einer der wenigen, die sich in ihrer Gegenwart normal verhielten.
»Was ist los, Goddie?«, flüsterte sie und huschte an ihm vorbei ins Innere. »Mein Vater wollte nicht mit der Sprache rausrücken. Ist die Stimmung gut oder schlecht?«
Er brachte die Lippen nah an ihr Ohr. »Ich habe keine Ahnung.« Es klang ehrlich, und Goddie war niemand, der mit Menschen spielte oder log. »Aber sie werden dir schon nicht den Hintern versohlen. Na los, sie sind hier unten.« Er deutete zur Seite, wo ein Gang abzweigte, an dessen Ende das Zimmer lag, in dem die Herrschaften viele Besprechungen abhielten. Cyntha war schon zweimal dort gewesen, wenn Lady Buford in Abwesenheit ihres Mannes das Haus allein geführt und sich mit ihr über den Zustand der Herden hatte austauschen wollen.
Im Haus war es warm, ein so großer Unterschied zu ihrer Hütte, dass ihr der Schweiß ausbrach. Es roch nach Gebratenem; die Kandelaber und Ölleuchten an den Wänden verströmten Licht. Der Boden knarrte unter Cynthas Füßen, gedämpft durch den Teppich, der hier in der Halle bereits abgenutzt war und an manchen Stellen die Holzplanken durchschimmern ließ.
Cyntha passte den Atem ihren Schritten an, und endlich schlug ihr Herz wieder langsamer. Sie betrachtete das riesige Gemälde an der Wand, irgendein Vorfahr des Lords, der sie mit seinen Blicken zu verfolgen schien, und bog ab, wobei sie Goddie winkte. Er salutierte wild und verlor dabei fast das Gleichgewicht. Cyntha grinste und hoffte, dass er mit seinem kindlichen Gemüt noch viele Jahre bei den Herrschaften arbeiten konnte – die Welt dort draußen war nicht geschaffen für jemanden wie ihn.
Vor der Tür wartete sie, unsicher, ob man sie hereinrufen würde, aber als ihr die Zeit zu lang wurde, schlug sie mit den Fingerknöcheln behutsam gegen das Holz.
»Komm herein, Cyntha.« Lady Bufords Stimme verriet nicht das Geringste.
Cyntha drückte die Schultern durch und folgte der Aufforderung. Im Zimmer war es noch wärmer als in der Halle; im mannshohen Kamin prasselte ein Feuer. »Die Herrschaften«, sagte sie und senkte den Kopf, ehe sie die Tür hinter sich schloss und stehen blieb. Wenn sie weiter in die Mitte des Raums trat, würde er sie erdrücken mit all den samtbezogenen Möbeln, den Degen und Schwertern an den Wänden zwischen den Gemälden und der Masse an in dunkles Leder gebundenen Büchern. Mit einem Mal fühlte sich Cyntha in ihrem Kleid noch schmaler, als sie ohnehin war.
Lady Buford saß in einem Sessel, auf dem Tischchen neben ihr standen ein Teller mit Gebäck sowie ein Glas. Es war randvoll mit einer Flüssigkeit, die angesichts der Flammen schimmerte wie Bernstein. Cyntha versuchte, das Gesicht der Lady möglichst unauffällig zu mustern. Augenblicklich schien die Wärme zu verschwinden, denn sie fand nichts, was ihr Mut machte. Im Gegenteil, Lady Buford sah unzufrieden aus. Und irgendwie schuldbewusst.
Cyntha biss die Zähne zusammen und zwang sich zu einem höflichen Lächeln. Die beiden Männer standen an einem der Fenster, Gläser in den Händen, und musterten sie. Zwischen ihnen herrschte ein seltsamer Einklang, als wären sie nach langer Diskussion zu einem Entschluss gekommen.
Lord Buford strahlte dieselbe Distanz aus wie immer. Mit ihm war Cyntha nie richtig warm geworden, was auch daran lag, dass er den größten Teil des Jahres unterwegs war und sie ihm nur selten begegnete. Das Grau in seinem Bart war mehr geworden, seit er vor Wochen aufgebrochen war, um sich mit Geschäftspartnern an der Küste zu treffen. Sein Gesicht zeigte die berühmte Härte, auf die manche Dörfler sogar stolz waren, da es angeblich bewies, dass der Lord zu seinen – und damit auch ihren – Gunsten bis aufs Blut verhandelte.
Cyntha glaubte nicht, dass alles, was Buford tat, auch das Wohlergehen der Menschen betraf, für die er verantwortlich war. Niemand, der in einen gewissen Stand hineingeboren wurde, gab sich vollkommen selbstlos für andere hin – nicht einmal Lady Buford, die viel zugänglicher war als ihr Mann, aber ihre Gunst nach Sympathie verteilte.
Der Earl hatte seinen Mantel abgelegt, trug nun eine enge, dunkle Hose, ein goldgesäumtes Hemd in Weinfarben sowie hohe Stiefel und lehnte an der Wand, als würde alles hier ihm gehören – oder als gäbe es nichts, was sich seiner Reichweite entziehen könnte. Er wirkte nicht unsympathisch, strahlte aber diese Selbstverständlichkeit aus, mit der Menschen seines Stands der Welt begegneten. Er war schlanker, als sie erwartet hatte, fast schon drahtig. Unter anderen Umständen hätte sie sich in seiner Gegenwart entspannen können, wären da nicht seine Augen gewesen. Ihr Glanz war fiebrig und selbst auf die Entfernung zu intensiv. Er hatte die Mundwinkel nach unten gezogen, was seinen Kiefer hervortreten ließ, und erinnerte sie an ein Raubtier kurz vor dem Sprung. Cyntha verspürte den plötzlichen Wunsch, sich umzudrehen und zurück in die Halle zu gehen.
Sollte das hier ein Test sein? Wollte man sie prüfen, um festzustellen, dass sie nicht nur bei Rindern und Schafen die Nerven behielt, sondern auch in der Gegenwart von Menschen? Das könnte wichtig sein, wenn es darum ging, auf den großen Viehmärkten die Vorzüge der Buford-Tiere zu erläutern oder gar darüber zu diskutieren.
Der Gedanke war beruhigend, also hielt Cyntha ihn in dieser merkwürdigen Stille fest. Sie hob das Kinn ein winziges Stück, und als ihr Blick dem des Earls begegnete, sah sie nicht weg. Seine Augen weiteten sich ein wenig, als hätte er damit nicht gerechnet, dann nickte er Lord Buford zu.
Der nahm das zum Anlass, um sein Glas mit einem leisen Knall abzustellen. Seine Frau zuckte merklich zusammen, was Cyntha nicht gefiel. Lady Buford war nicht schreckhaft, im Gegenteil – sie behielt meist dann noch einen kühlen Kopf, wenn andere bereits in Panik gerieten. Damals, in der schrecklichen Nacht des Feuers, war sie bis zum Morgen auf den Beinen gewesen, um sicherzugehen, dass alle Tiere und Menschen den Flammen entkommen waren. Nicht ein einziges Mal hatte sie dabei etwas anderes gezeigt als ihre ruhige Gelassenheit, um die sie die Frauen des Dorfs beneideten.
»Cyntha«, sagte der Lord endlich. Seine Stimme war dunkel und distanziert, als würde er nicht mit ihr, sondern über sie sprechen. »Du hast uns heute bei der Vorführung beeindruckt. Vor allem unseren Gast.« Er machte eine Pause und nickte dem Earl zu, der sie noch immer anstarrte.
»Danke«, sagte sie nur, da ihre Gedanken rasten. Den Earl beeindruckt? Bedeutete das, er hatte erkannt, dass sie gute Arbeit leistete? Würde er … suchte er etwa jemanden, der sich auf seinem Besitz um das Vieh kümmerte? Und die Bufords hatten zugestimmt, sie in seine Dienste wechseln zu lassen? Es machte den Anschein, denn es war die einzige Erklärung für das Verhalten ihres Vaters und Lady Bufords. Damit würden die Lordschaften sich zukünftig allein auf Robson verlassen und mussten wissen, dass das nicht ausreichte, aber sie würden dem Earl niemals widersprechen, sollte er Cyntha einstellen wollen. Das hatte sie zwar mit ihrer kleinen Vorführung nicht bezweckt, aber alles war besser, als bald am Hungertuch zu nagen.
Rasch überschlug sie die Vor- und Nachteile. Es würde bedeuten, dass sie ihr Zuhause verlassen und Abschied nehmen musste von ihrer alten Hütte. Zumindest für eine Weile – so lange, bis sie sich einen Ruf erarbeitet hatte und zu den Bufords zurückkehren konnte. Aber sie würde genug Geld verdienen, um ihren Vater zu versorgen, und so oft zu Besuch kommen wie möglich. Es wäre nicht so gut, wie hier zu arbeiten, aber noch immer besser, als langsam, aber sicher zu verhungern. Dass ihr Vater eine Trödelreise hatte abbrechen müssen, war zwar zum ersten Mal vorgekommen, aber sie ahnten beide, dass sich das mit der Zeit häufen würde.
Cyntha merkte, dass sie ihre Schultern verkrampft hatte, und lockerte sie rasch.
Lord Buford hatte die Hände hinter dem Rücken verschränkt, schlenderte zu einer Vitrine und betrachtete den Inhalt. Erst als sich seine Frau räusperte, wandte er sich wieder um. »Falstone liegt zwei Tagesreisen nördlich von hier und besitzt mehr als doppelt so viel Land wie Buford. Der Earl lebt dort mit seiner Tochter sowie einigen Angestellten.«
Cyntha riss sich zusammen, um keine Ungeduld zu zeigen. Es interessierte sie nicht, wer alles in Haus Falstone wohnte! Viel wichtiger war ihr zu wissen, wie groß die Ställe waren und welche Sorte Vieh der Earl züchtete. Mit Rindern und Schafen kannte sie sich aus, bei Pferden würde sie noch dazulernen müssen. Aber genau das würde sie tun, sollte es notwendig sein. »Ich verstehe«, sagte sie und nickte, um zu zeigen, dass sie weiterhin aufmerksam war.
Über Lord Bufords Gesicht huschte ein Lächeln, so künstlich und gezwungen, dass es einen bitteren Geschmack in Cynthas Mund erzeugte. »Gut. Denn du wirst dorthin reisen.«
Wieder nickte sie, während ihr Herz in ihrem Brustkorb davonrasen wollte wie die Schafe zuvor. »Für eine Beratung, oder ist ein längerer Aufenthalt angedacht?«
Lord Buford stockte und runzelte die Stirn. »Sei nicht albern. Niemand wird eine junge Frau für eine Beratung oder gar Anstellung quer durch das Land berufen. Welch eine Vorstellung!« Er lachte, und Cyntha bemerkte im Augenwinkel, dass sich Lady Buford versteifte, nach ihrem Glas griff und daran nippte. »Du wirst nach Falstone gehen, weil der Earl wünscht, dich zur Frau zu nehmen.«
Seine Hand wedelte durch die Luft, als gäbe es nichts mehr dazu zu sagen. Cyntha starrte auf seine Lippen, felsenfest davon überzeugt, dass er loslachen würde, weil er ihr diesen Schock versetzt und damit einen Streich gespielt hatte. Dass dies lediglich ein grausames Spiel war, mit dem er und sein Gast sich vergnügten. Dann aber musterte sie wieder das Gesicht des Earls, diese fast schon fiebrigen Blicke, die sich einfach nicht von ihr abwenden wollten, und da wusste sie, dass hier heute niemandem nach Scherzen zumute war.
Aber das konnte nicht sein. Weil es vollkommen absurd klang. Weil nichts daran zusammenpasste. Und weil es einfach nicht sein durfte.
Auf einmal war der bittere Geschmack verschwunden. Sie schmeckte und spürte nichts mehr. Verzweifelt versuchte sie zu schlucken, aber auch das funktionierte nicht so recht. Was ging hier vor sich? Sie war eine junge Frau aus dem Dorf, noch dazu eine, deren Mutter Magie besessen hatte. Und Earls heirateten Damen, die ebenfalls von Adel waren, sich die Gesichter bemalten und den ganzen Tag überlegten, wie sie sich die Zeit vertreiben konnten.
»Mein … Zuhause ist hier, Herr«, brachte sie hervor und war selbst nicht sicher, an wen sie die Worte richtete. »Ich hatte gehofft, mit der Vorführung heute beeindruckt zu haben, und …«
Lord Buford gab eine Mischung aus Knurren und Zischen von sich. Ihm gefiel nicht, dass sie widersprach. Wahrscheinlich hatte er geglaubt, dass sie vor Freude keinen Ton herausbekommen oder noch an Ort und Stelle ohnmächtig werden würde. Denn das war schließlich der Traum eines jeden einfachen Mädchens, nicht wahr? Dass plötzlich ein reicher Mann auftauchte und sich Hals über Kopf verliebte.
Wobei von Liebe nicht einmal die Rede gewesen war. Verstohlen musterte sie den Earl. Was bezweckte er mit seinem Wunsch?
»Sonst hast du nichts zu sagen?«, fragte Lord Buford sie.
Verwirrt flackerte ihr Blick zur Lady, die sich aber eingehend mit ihrem Glas beschäftigte. Dann nahm sie all ihren Mut zusammen, auch wenn ihre Haut dabei unangenehm kribbelte. »Ich möchte Hirtin werden und in die Fußstapfen meines Vaters treten.«
Auf ihre Worte folgte tiefstes Schweigen. Dann schnaubte der Lord. »Hast du ihr diese Flausen in den Kopf gesetzt, Christdore?«
Lady Buford schürzte die Lippen. »Ich habe sie nicht entmutigt, da sie eindeutig besser geeignet ist als Robson, wie wir heute sehen konnten.« Sie strich ihr Kleid glatt und lehnte sich zurück.
Cyntha war ihr dankbar, und sie wusste, dass sie mit mehr Zuspruch nicht rechnen konnte. Womöglich genügte es ja. Es musste einfach.
»Unsinn«, sagte der Lord, ging zum Glaskabinett und holte eine Karaffe hervor. Mit einem leisen Knall löste er den Stopfen und schenkte sich und dem Earl nach. Wollte der denn gar nichts dazu sagen? Hatte dieser Mann keine eigene Stimme, oder war er es gewohnt, dass andere seine Angelegenheiten vertraten?
Cyntha räusperte sich, aber Lord Buford kam ihr zuvor. »Ich werde das nun abkürzen. Keine Frau wird sich je auf meinem Besitz oder dem des Earl von Falstone um das Vieh kümmern.«
Kälter hätte kein Wasser der Welt sein können. Nicht einmal das Eis im Winter ließ Cyntha innerlich so zittern wie diese Worte. Sie war stolz darauf, dass sie es nicht zeigte und noch immer aufrecht im Zimmer stand. Jemand, das begriff sie nun, der abgeschätzt und begafft wurde wie ein Preis, den man mit nach Hause nehmen konnte.
Was sah der Earl in ihr? Er war ein wohlhabender Mann, der ganz andere Frauen in sein Haus locken konnte! Allmählich schlug ihre Fassungslosigkeit in Ablehnung um.
Cyntha zählte innerlich bis drei und erwiderte dann seinen Blick. Er hob eine Augenbraue, wie eine Herausforderung, ihm mitzuteilen, was sie wirklich dachte. Wenn das sein Wunsch war, würde sie ihn erfüllen.
»Meine Mutter war magisch begabt, Herr«, sagte sie leise, aber deutlich. »Ich selbst besitze keine Magie, aber Ihr wisst sicherlich, wie es um mein Ansehen bestellt ist.« Es erschien ihr falsch, es zu erwähnen, beinahe schon schmerzhaft, aber andere Waffen waren ihr nicht geblieben.
Lord Buford fletschte die Zähne, und sie sah ihm deutlich an, dass er sie für diesen Einwand gern geschlagen hätte.
Der Earl nickte. »Es spielt keine Rolle.« Zum ersten Mal sprach er in ihrer Gegenwart, und es erstaunte sie so sehr, dass ihre Gedanken verstummten. Seine Stimme war so dunkel wie seine Augen, ruhig und voll. Es lagen weder Fragen noch Unsicherheit darin. Für den Earl von Falstone war die Sache bereits beschlossen.
»Doch«, flüsterte Cyntha. »Das tut es. Ich kann hier nicht weg, versteht Ihr? Mein Vater …«
»Es reicht!« Lord Buford fuhr so abrupt zu ihr herum, dass sie glaubte, er würde sie doch schlagen. »Hier wirst du nicht mehr arbeiten. Nicht als Hirtin. Auch nicht als Gehilfin. Ist das deutlich?«
Wo Cyntha zuvor geschwankt hatte, fiel sie nun, da er ihr den Boden unter den Füßen wegriss. »Aber warum? Was habe ich denn getan?«
»Mich verärgert! Und meinen Gast! Er ist gewillt, jemanden wie dich zur Frau zu nehmen, und du faselst hier von Anstellungen, Magie und der Möglichkeit, Hirtin zu werden! Dein Vater zeigte mehr Verständnis, als wir mit ihm geredet haben, Cyntha. Also sage ich es noch einmal deutlich, und dann gewähren wir dir Zeit bis morgen, um uns deine Antwort mitzuteilen: Entweder du nimmst das Angebot an und begleitest unseren guten Freund nach Falstone, um seine Frau zu werden, oder du und dein Vater müsst euch etwas anderes suchen. Denn ihr werdet weder hier arbeiten noch weiterhin in eurer Hütte wohnen.«
»Was? Ich … warum die Hütte?« Sie ärgerte sich darüber, dass sie stammelte, aber in seinen Worten hatte so viel Macht gelegen, dass sie glaubte, die Orientierung zu verlieren.
»Weil«, sagte er langsam, als würde er mit einem Kind sprechen, »die Hütte mir gehört, und ich damit machen kann, was ich will. Also. Morgen.« Er stellte sein Glas so energisch ab, dass Cyntha glaubte, es würde zerspringen, ging mit langen Schritten an ihr vorbei und verließ den Raum. Der Earl folgte ihm, ruhig und gelassen. Seine Schulter streifte ihre, so leicht, als wäre es nur ein Versehen, aber abgesehen davon beachtete er sie nicht mehr.
3
Gut verkauft
Cynthas Schrei hallte durch den Wald und wurde von aufflatternden Singvögeln und dem wütenden oder belustigten Gekrächze der Krähen beantwortet. Sie schrie noch einmal, die Hände zu Fäusten geballt und sämtliche Muskeln so angespannt, dass sie glaubte, in die Knie gehen zu müssen, weil ihre Beine sie nicht mehr tragen würden.
Der Boden der Steinhütte und die Reste des Feuers waren von nassem Laub bedeckt. An manchen Stellen tropfte Wasser und sammelte sich in der Mitte, weil der Boden nicht eben war. In einer Ecke lagen die Reste eines Vogels, einer Taube – viele Federn, ein Fuß und etwas, das nach einem halben Kopf aussah. Vermutlich das Werk eines Fuchses. Es roch modrig und, aber das bildete sie sich sicher nur ein, auch ein wenig nach Blut.
Tränen liefen über Cynthas Gesicht, als sie die Ranken an den Wänden betrachtete. Seit ihrem letzten Besuch schienen sie weiter verblasst zu sein. Irgendwann würden sie verschwinden, und sie würde es nicht bemerken, da sie in Falstone mit verkrampften Fingern auf einem Bett lag, während sich der Earl mit der kreuzförmigen Narbe auf ihr abmühte, um noch einen Sohn zu zeugen.
Sie nahm den Taubenfuß und schleuderte ihn durch das Loch, wo einst die Tür gewesen war. Dann schloss sie die Augen, streckte eine Hand aus und spürte kurz darauf Wärme auf ihrer Haut, als sich eine Ranke darumlegte, so zart, dass ihre Tränen stärker flossen. Es war, als würde etwas in ihr zerreißen, und sie suchte fieberhaft nach einer Möglichkeit, das zu verhindern.
»Ich hätte gedacht, meine Wut wäre bis heute verschwunden«, flüsterte sie. Der Moment, in dem Lord Buford ihr mitgeteilt hatte, dass sie und ihr Vater auf der Straße sitzen würden, wenn sie den Antrag des Earls nicht annahm, lag nun zwölf Tage zurück. Sie wusste das so genau, weil sie an jedem Morgen eine gezackte Linie in die Wand neben ihrer Schlafstätte geritzt hatte – Blitze, die etwas in Brand setzten, um es zu vernichten. Nur dass es dieses Mal keine Hütte, sondern ihr gesamtes Leben war.
Cyntha blinzelte vorsichtig, voller Angst, dass die Magie sich bereits vor ihr versteckte, um ihr den Abschied nicht allzu schwer machen, und seufzte vor Erleichterung auf, als sich in der Luft Konturen abzeichneten. Da war das helle Gesicht ihrer Mutter, so viel schmaler als ihr eigenes. Sie hob beide Arme, an denen das Grün Blüten gebildet hatte, um sie zu wärmen und zu trösten. Es kitzelte leicht, als sich Cynthas Finger mit denen ihrer Mutter verschlangen, behutsam, als könnte ein Windhauch die Berührung auseinanderreißen.
Hart schluckte sie gegen all das Salz in ihrer Kehle an, wo sich die Tränen sammelten. »Ich dachte, ich hätte mich bis heute damit abgefunden, aber das hat nicht funktioniert. Die Kutsche ist bereits eingetroffen, und gleich muss ich aufbrechen und werde dich hier zurücklassen. Was, wenn ich wiederkomme, und du bist nicht mehr da?« Das liebe, so vertraute Gesicht verschwamm vor ihren Augen.
Cyntha wusste nicht, wie die Magie ihrer Mutter funktionierte und sich in diesen Mauern hielt – für ihre Tochter, die damals noch so klein gewesen war, als Husten und Fieber Jelissa Hirde in den Tod gerissen hatten. »Ich werde immer bei dir sein«, hatte sie mit Lippen geflüstert, die so trocken waren, dass Blut aus den Rissen quoll. Es waren abgenutzte Worte, die immer und überall bei endgültigen Abschieden aufkamen, aber dieses Mal stimmten sie. Cynthas Mutter war geblieben, in den Wänden dieser Hütte. Wie konnte sie auf dieses Geschenk verzichten?
»Ich wünschte, ich könnte dich auch hören«, flüsterte sie. »Du hättest einen Rat für mich. Ich habe immer wieder nachgedacht, aber mir fällt keine Lösung ein. Wenn Vater nicht wäre, würde ich weggehen und irgendwo etwas Neues finden. Aber er ist so schwach in letzter Zeit, und ich glaube Lord Buford, wenn er sagt, dass er uns aus der Hütte wirft. Niemand würde es wagen, uns zu verteidigen, bis auf Brooke. Weil sie sich damit seinen Zorn zuziehen würden. Und Vater … ich glaube, dass er es nicht schafft, woanders neu zu beginnen. Wie auch? Er kann nicht mehr arbeiten, und wenn ich keine Anstellung fände, müssten wir betteln. Abgesehen davon reicht Lord Bufords Einfluss über die Dorfgrenzen hinaus, und ich traue ihm zu, dass er ihn geltend gemacht und verhindert hätte, dass ich eine neue Anstellung bekäme, wäre ich nicht auf diese absurde Anfrage eingegangen. Der Lord kann umgänglich sein, aber wenn er nicht bekommt, was er will, zeigt er ein anderes Gesicht.« Die Worte halfen ein wenig, zumindest minderten sie die Wut.
Natürlich antwortete ihre Mutter nicht, und Cyntha blieb, wo sie war. Früher hatte sie einige Male versucht, sie zu umarmen. Aber wo sie sich noch täuschen konnte, wenn sie nur die Hand der Verstorbenen hielt, brauchte es bei einer Umarmung einfach das Gefühl von warmer Haut. Von Nähe, Geborgenheit. Festigkeit. Also standen sie da, eine Armeslänge Abstand zwischen sich, und lächelten sich an. Doch ein Teil der Dunkelheit in Cyntha verschwand. Vielleicht legte er sich auch nur schlafen. »Danke«, flüsterte sie. »Bitte warte auf mich, ja? Es wird eine Weile dauern, bis ich zurückkomme. Aber ich werde dich wiedersehen.«
Ein Windhauch streichelte ihre Wange, und die Blumen an ihren Oberarmen streckten ihre Blüten erneut und leuchteten in tiefstem Violett. Sie schloss die Augen und riss sie wieder auf, als in der Ferne ein Pfeifen ertönte, gefolgt von Schritten, laut und plump. Derjenige wollte, dass man ihn hörte, und damit konnte es nur Brooke sein.
Cyntha hielt weiterhin ihre Mutter im Blick, als die schlanke Gestalt im Durchgang auftauchte. »Ich verabschiede mich von ihr, Brooke. Sie hat mir noch nie so große und leuchtende Blüten geschenkt.« Jetzt wandte sie den Kopf und sah ihre Freundin an.
Brooke hatte die Hände in die Taschen ihrer Hose geschoben, die sie vermutlich einem ihrer Brüder abgeluchst hatte, und warf einen kurzen Blick auf Cynthas Arme. Ihre Mutter ignorierte sie völlig, aber so war das mit Magie. Den meisten machte sie Angst, und die übrigen wollten nicht besonders viel damit zu tun haben. »Dein Vater schickt mich. Ich soll dich holen. Der Kutscher will los und den Earl nicht so lange warten lassen.«