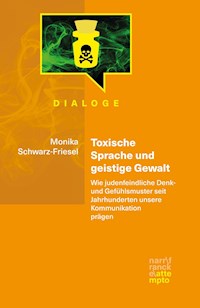
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Dialoge
- Sprache: Deutsch
Jüdinnen und Juden sind nicht nur mit physischer, sondern auch mit geistiger Gewalt konfrontiert: Diese äußert sich durch explizite Hassrede ebenso wie durch harmlos anmutende Muster der Alltagssprache. Judenfeindschaft und Sprache stehen seit zweitausend Jahren in einer untrennbaren Symbiose. Das Gift judenfeindlichen Denkens und Fühlens ist Teil unserer Kultur, und antisemitische Sprachgebrauchsmuster sind tief in unser kommunikatives Gedächtnis eingeschrieben. Auf diese Weise sorgen sprachliche Antisemitismen dafür, dass judenfeindliche Stereotype von Generation zu Generation weitergegeben werden. Der Band macht diesen Zusammenhang anhand authentischer Beispiele anschaulich und verständlich. Er deckt die toxischen Sprachstrukturen mit ihrer Wirkung auf das kollektive Bewusstsein auf und weist auf die dringende Notwendigkeit eines sensiblen und geschichtsbewussten Sprachgebrauchs hin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Monika Schwarz-Friesel
Toxische Sprache und geistige Gewalt
Wie judenfeindliche Denk- und Gefühlsmuster seit Jahrhunderten unsere Kommunikation prägen
Monika Schwarz-Friesel ist eine international führende Expertin auf dem Gebiet Antisemitismus und Sprache. Seit 2010 hat sie den Lehrstuhl für Linguistik am Institut für Sprache und Kommunikation der TU Berlin inne. Zu ihren Buchpublikationen gehören mehrere Standardwerke, u.a. Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert (mit Jehuda Reinharz, 2013, engl. Ausgabe 2017), Sprache und Emotion, Semantik (6. Auflage) und Judenhass im Internet. Sie ist Kuratoriumsvorsitzende der Leo-Trepp-Stiftung und Mitglied der Simon-Wiesenthal-Preis-Jury sowie des wissenschaftlichen Beirats der Antisemitism Studies (USA) und des Journal of Contemporary Antisemitism (UK).
Umschlagabbildung: Gestaltung des Verlags
DOI: https://doi.org/10.24053/9783893086665
© 2022 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 2626-0697
ISBN 978-3-89308-466-1 (Print)
ISBN 978-3-89308-018-2 (ePub)
Inhalt
1Von einem Gift, das die Köpfe vernebelt und die Seelen mit Hass verdunkelt
„… das Wort … ist doch ein mächtiges Instrument, es ist das Mittel, durch das wir einander unsere Gefühle kundgeben, der Weg, auf den anderen Einfluß zu nehmen. Worte können … fürchterliche Verletzungen zufügen“ (Sigmund FreudFreud, Sigmund)
Jeden Tag wird den Menschen in diesem Land und weltweit eine Dosis Gift verabreicht. Vor aller Augen. In der Öffentlichkeit. Ohne vehemente oder weitreichende Skandalisierung auf breiter Front. Es ist ein sehr altes Gift, dessen toxische Wucht und zerstörerische Wirkung hinreichend bekannt und von zahlreichen Experten1 weltweit schon lange in seinen chemischen Grundbausteinen analysiert ist. Denn dieses Gift ist seit Jahrhunderten Bestandteil der westlichen DNA, des europäischen Kultur-Genoms. Seine Farbe und sein Geschmack changieren, verändern sich je nach Umgebung und Situation, es kommen Quanten von Ingredienzen hinzu, doch seine Grundsubstanz bleibt stets die gleiche. Die jahrzehntelange Warnung aus Wissenschaft und Forschung vor der zerstörerischen Kraft des Giftes wird entweder ignoriert oder als Hysterie diskreditiert, als Übertreibung abgewehrt. Man lässt es also weiter tröpfeln und sich ausbreiten. Dieses Gift kommt heute oft mit einer süßlichen Ummantelung, damit der bittere Inhaltsstoff nicht sofort als solcher geschmeckt wird. Es schleicht sich daher in vielen Fällen unbemerkt ein, vergiftet aber durch fortgesetzte beständige Dosierung. Und durch den globalen digitalen Austausch weist seine massenhafte Ausbreitung ein noch nie gewesenes Ausmaß auf. Bislang gab es kein effektives Mittel gegen dieses Gift, weil nicht einmal ein damit vollzogener Massenmord an sechs Millionen Menschen zu einem tiefgreifenden Umdenken führte. Noch immer wird dieses Gift als eines unter vielen toxischen Stoffen oberflächlich betrachtet und falsch bewertet, statt seine Einzigartigkeit zu sehen. Aufgrund dieser Fehldiagnose laufen die Therapien seit Jahren ins Leere. Das Gift heißt Judenfeindschaft, das Mittel ist die Sprache und der Tatort der Verabreichung ist die tagtägliche Kommunikation. Wir haben es mit einer kulturellen Bewertungskategorie und einem kommunikativen Habitus zu tun, die beide seit zwei Jahrtausenden die Gedanken und Gefühle von Menschen vergiften, sie in bestimmte Bahnen lenken, Wahnvorstellungen aktivieren und eine unsichtbare, aber schmerzhafte und schädliche Grenze zwischen Juden und dem Rest der Welt ziehen. Eine entgiftende Heilung ist bislang nicht gelungen, unter anderem, weil das Übel nicht an der Wurzel, an seiner Quelle gepackt wird. Denn die toxische Struktur ist Teil der kulturellen Grundsubstanz unserer Gesellschaft, unseres kollektiven Bewusstseins, vor allem aber auch unseres kommunikativen Gedächtnisses, dem Speicherreservoir für verbal vermitteltes Wissen und Sprachmuster.
Warum ist es wichtig, notwendig, ja essenziell, dass man die Rolle der Sprache beim Antisemitismus in den Mittelpunkt der Aufklärung und Bekämpfung stellt? Weil Sprache Realität nicht nur abbildet, sondern sie auch maßgeblich erzeugt. Das judenfeindliche Ressentiment kam über die Köpfe der Menschen durch Sprache in die soziale, in die konkrete und reale Welt. Weil Sprache ein Gedankengeflecht, eine Vorstellungswelt und ein ganzes Glaubenssystem zum Konzept ‚Jude‘2 konstruierte. Eine Religionsgemeinschaft wurde dadurch zum Gegenprinzip der übrigen Welt, erhielt im mentalen Weltdeutungsmodell des Hasses den ontologischen Status des Bösen. Dieses geistige Konstrukt würde ohne verbale Strukturen gar nicht existieren, hätte ohne das generationen- und epochenübergreifende Weiterreichen an andere Menschen nicht seine stabile Existenz erhalten können. In dem kollektiven Gefühl der Judenfeindschaft verbinden sich Kognition, Emotion und Sprache zu einem für die Juden tödlichen und für die gesamte Gesellschaft destruktiven geistigen Gift. KlempererKlemperer, Victor sprach entsprechend schon in seiner Lingua Tertii Imperii davon, dass „Worte wie winzige Arsendosen“ sein können. Sie werden teilweise unbemerkt und quasi nebenbei verschluckt, entfalten aber langfristig ihre hoch toxische Wirkung.
Wie oft jedoch wird die Relevanz der Sprachmacht und -gewalt marginalisiert und bagatellisiert durch Sprüche wie „Es ist nur Sprache …“ oder „Solange es nicht in physische Gewalt umschlägt“ oder „Wenn es lediglich verbale Aggression ist“. Der juristische Gewaltbegriff erfasst im Wesentlichen die körperliche Gewalt (vgl. StGB § 240ff.). Nonverbale Formen der Gewalt werden zwar unter StGB § 130 zur Volksverhetzung aufgeführt, doch belegt die juristische Praxis, dass dieser Paragraf nicht ausreicht, um die Palette verbaler Gewalthandlungen zu erfassen und zu ahnden. Viele Gerichtsurteile der letzten Jahre haben gezeigt, dass oft nicht einmal explizite Hasssprache gegen Juden verurteilt wird, geschweige denn die zahlreichen, mittlerweile längst bekannten und frequent benutzten indirekten Verbal-Antisemitismen. Dass Sprache die wichtigste Instanz im menschlichen Leben und sozialen Miteinander ist, und als solche mit ihrem destruktiven Potenzial seit der Antike in der Wissenschaft anerkannt wird, wird oft ausgeblendet. Dass erst Sprache Menschen dauerhaft ausgrenzt, sie zu anderen Wesen macht, ihnen bestimmte Eigenschaften andichtet, ihnen die Existenzberechtigung abspricht. Lüge, Meineid, Verleumdung, Gerüchte sind sprachliche Handlungen, die geistige Parallelwelten entstehen lassen, es sind Fiktionen und Fantasien ohne Bezug zur Realität bzw. Substitute für die reale Welt. Sprache schafft geistige Welten (wie die Religion des Christentums, wie fiktive Realitäten und abstrakte Denkwelten), Sprache zerschlägt und entwertet Welten (wie die Welt des Judentums im Blick des Judenhasses) und kann bedrohliche Konsequenzen hinsichtlich der physischen Existenz haben.
Die kognitions- und neurowissenschaftliche Forschung belegt seit Jahrzehnten, was Philosophen schon hypothetisch in allen Jahrhunderten postulierten: Wahrheit ist die Wahrheit im Blick des Beobachters, im Blick des durch Sprache geleiteten Geistes in der mentalen Welt des Kopfes. Sprache ist Tor zur Welt und auch Straße in den Geist. Sie ist dabei zugleich Teil des Geistes, denn ihre Kategorien sind das formale Gerüst und das Geländer für abstrakte und komplexe Denkprozesse, die sonst nicht möglich wären. Sie lenkt den Blick auf die Welt. Sprachliche Strukturen erlauben uns Einblicke in die Einstellungen, Gefühle und Gedanken von Menschen, weil sie Spuren der kognitiven Aktivität sind. Aus sprach- und kognitionswissenschaftlicher Perspektive stellen wir daher nicht die Frage, ob jemand ein Antisemit ist oder nicht. Denn in die Köpfe von Menschen können wir auch als Wissenschaftler nicht direkt schauen, weil diese in der Black Box des Geistes nicht beobachtbar sind. Und seit 1945 gehören Abwehr- und Leugnungsäußerungen untrennbar zur antisemitischen Kommunikation: Viele Produzenten judenfeindlicher Äußerungen sind sich entweder nicht einmal im Klaren darüber, dass sie antisemitische Gedanken artikulieren, oder aber sie verteidigen ihre Antisemitismen als Kritik oder Meinungsfreiheit. Daher macht es auch wenig Sinn, nach der Intention hinter einer Äußerung oder der Identität des Sprechers/Schreibers zu fragen, wenn man entscheidet, ob eine Aussage antisemitisch ist oder nicht. Beides ist irrelevant für die Bewertung, da es bei der Sprachrezeption und -wirkung für das menschliche Gehirn keine Rolle spielt, warum und von wem der Inhalt kommuniziert wurde. Ausschlaggebend ist die Semantik der Äußerung, ihre argumentative Struktur und aktuelle Bedeutung. Wir fragen daher in Kognitions- und Sprachwissenschaft nicht, ob jemand ein Antisemit ist oder nicht, sondern ob die Äußerungen einer Person antisemitische Gedanken und Gefühle in die Gesellschaft tragen, ob diese Äußerungen judenfeindliche Konzepte und Argumente tradieren, ob jemand damit, direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst, judenfeindliche Stereotype vermittelt, ob dadurch ein kommunikativer Normalisierung- und Gewöhnungseffekt stabilisiert wird, ob die Zugänglichkeit und Verbreitung von antisemitischen Mustern erhöht wurde.
Und dabei sind nicht nur Varianten der expliziten Hass- und Ideologiesprache gemeint. Nicht nur Drohungen, Holocaust-Witze, Vernichtungsfantasien und grobe Beleidigungen sind toxisch. Auch und sogar besonders gefährlich, weil sie sich oft unbemerkt in den Kopf schleichen, sind die grammatischen, nicht mehr reflektierten Konstruktionen, die eine Differenz zwischen Juden und Nicht-Juden ausdrücken sowie die unbedachten Plattitüden und Floskeln der Alltagskommunikation, die Stereotype transportieren, aber auch die Zwischen-den-Zeilen-Botschaften, die durch Andeutungen oder Anspielungen antisemitische Gefühle aktivieren und die falschen Vergleiche, die Juden verletzen, die Shoah relativieren, das Leid der Opfer verhöhnen, die Judenhass als kulturelles Gift marginalisieren. Und auch die guten Ratschläge, die aus dem latenten Gefühl der Überlegenheit heraus entstehen und Juden durch Belehrungen entmündigen, sind vergiftend, denn sie tragen Jahrhunderte der Abwertung und Intoleranz in die Moderne. Die Alltagskommunikation weist alle diese Formen auf, daher wird sie im Mittelpunkt dieses Buches stehen.
Da ist der Medizinprofessor im Interview, der „den Juden bescheinigt, wie gut sie lernen und nun hätten sie bei den Impfungen gegen Corona in Israel das Böse gelernt“. Die Frau an der Supermarktkasse, die eine drängelnde und nörgelnde Kundin ermahnt, nicht eine „solch jüdische Hast“ zu verbreiten. Der Kommilitone, der auf die Frage nach dem Aussehen eines anderen Studierenden, sagt „der mit der jüdischen Nase“. Es ist die Ortsbeschreibung zum Pferdegestüt mit jüdischem Besitzer, wo es „Berger-Jud“ heißt. Es ist die Bemerkung am Busbahnhof „Wir sind hier nicht in Israel“ zu einem Kippa tragenden Mann. Der Mann, der von seinem Freund, dem „Halb-Juden“ erzählt. Da ist der sonst so freundliche und hilfsbereite Nachbar, der das Gesicht wie bei Zahnschmerzen verzieht, wenn die Rede auf Israel kommt und der nicht versteht, warum man in ein „solches Unrechtsregimeland“ fährt, der dann jedes Mal fragt, ob es schön „in der Heimat war“, wenn die deutschen Nachbarn vom Besuch bei der israelischen Familie zurückkommen. Da ist der Mitschüler, der den anderen ein Feuerzeug ans Ohr hält, Gas ausströmen lässt und fragt: „Weißt du was das ist? Originalton Auschwitz.“ Und dann gibt es die Protestantin, die im Gespräch über Luthers antisemitische Wutreden, vor allem nachdem er gemerkt hat, dass sich die Juden nicht von ihm missionieren ließen, anmerkt „Die sind aber auch so verstockt“. In der Diskussion mit einem Linken, der die Checkpoints in den palästinensischen Gebieten zu Israel mit der Selektionsrampe in Auschwitz vergleicht und vom „israelischen Regime“ und der „palästinensischen Regierung“ spricht. Der Bundeswehrsoldat, der erklärt „Die israelische Armee bewundert ja heute selbst noch Rommel, den Wüstenfuchs“. Es ist der Autofahrer, der einen Radfahrer in Berlin-Charlottenburg im Vorbeifahren als „Du Jude!“ beschimpft, die Teenager, die in der U-Bahn singen „… eine U-Bahn bauen wir, eine U-Bahn bis nach Auschwitz …“. Es ist der Postbote, der vom „jüdischen Geld-Klein-Klein“ eines Kollegen berichtet, der Pfarrer, der von der mildtätigen verzeihenden Ethik des Christentums spricht und wie diese den „alttestamentarischen Rachegedanken ablöste“. Der linke Bürgermeister, der bei jeder Demonstration gegen rechts vorne mitläuft, aber keine Zeit fand, in seiner Stadt an einem Symposium zum aktuellen Antisemitismus teilzunehmen und der Israel als „Besatzerstaat“ bezeichnet. Der Politiker, der in seiner Rede „auch bewusst die jüdischen Mitbürger“ anspricht. Die BDSBDS-Aktivisten an einer Berliner Universität, die Teilnehmer eines Workshops zu israelbezogenem Judenhass als „Zionistenpack“ und „Faschisten“ beschimpfen. Die alte Dame, die vom „scheußlichen Judenzopf“ ihrer Enkeltochter berichtet, einer „hässlichen verfitzten Spliss-Frisur“. Die Dozentin aus der Sozialwissenschaft an der HU Berlin, die zum Holocaust-Gedenktat postet „Der Völkermord der Juden an den Palästinensern läuft immer noch weiter“. Es ist der Chef eines privaten Kurierdienstes, der seinen als jüdisch bekannten Fahrer nach Dienstschluss anschnüffelt und ihm sagt „Du riechst streng. Könnt ihr das mit Euren großen Nasen nicht mal selbst merken?“ Der promovierte Gymnasiallehrer, der Verständnis für seine Schüler hat, dass diese „gelangweilt und es überdrüssig sind, immer wieder den Holocaust unter die Nase gerieben zu bekommen“. Und da gibt es die jüdische Professorin, die auf ihren Hinweis, dass die Kommissionssitzung doch bitte nicht am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur stattfinden soll, als Antwort erhält „Frau Kollegin, Sie sind hier aber in Deutschland!“
Es waren Sprachstrukturen, die über die Jahrhunderte hinweg von Generation zu Generation das Bild „der Juden“ prägen, die auch durch die Shoah nicht zerschlagen wurden. Ihre Macht und ihre Wirkung werden bis heute unterschätzt. Zudem gibt es mittlerweile zahlreiche süße Ummantelungen durch Begriffe wie „Meinungsfreiheit“, „Diskursvielfalt“, „offene Debattenkultur“ oder „Kritik“, die die toxische Semantik verschleiern. Das Phänomen abzutun mit „Es ist nur Sprache und keine reale Gewalt“ verkennt nicht nur die entscheidende, ja die konstitutive Rolle der Sprache bei der Entstehung, Weitergabe, Verbreitung und Speicherung judenfeindlichen Gedankenguts, sondern auch ihr Entzündungs- und Vorbereitungspotenzial für non-verbale Gewalt. Gewalt entsteht immer im Kopf. Gewalt ist die Realisierung von destruktiven Gedanken und negativen Gefühlen. Es ist die Bereitschaft, anderen Schaden zuzufügen, um das eigene Weltbild und die eigene Gefühlswelt aufrecht erhalten zu können. Allen Gewalthandlungen ist gemein, dass sie Leid verursachen, teils sofort erkennbar durch Verletzungen und Zerstörungen, teils durch die Einflüsterung oder Vermittlung destruktiver Ideen, deren Wirkungsradius unbegrenzt ist.
Deshalb müssen uns nicht nur die Attentäter, Bombenleger, Synagogenangreifer, Denkmal- und Friedhofsschänder, die Flaggenverbrenner sorgen, sondern eben auch und gerade die Sprachtäter und geistigen Brandstifter, die mittels antisemitischer Äußerungen das Gift immer wieder in die Welt tragen und es mit jeder judenfeindlichen Sprachhandlung konsolidieren und intensivieren. Es sind keineswegs nur die extremistischen Ränder der Gesellschaft, die uns Sorgen bereiten müssen. Denn sie sind nicht der Nährboden für judenfeindliche Gedanken und Gefühle. So oft auch diese Aussage anzutreffen ist, es macht sie nicht wahrer. Die lange Geschichte der Judenfeindschaft zeigt: Es waren und sind stets die Gebildeten aus der Mitte, die besonders einflussreich und nachhaltig als Vordenker und geistige Giftmischer agieren. Das antisemitische Ressentiment mit seinen Facetten der Abneigung, des Hasses und Erlösungs- oder Zerstörungswünschen, es wird erhalten und weiter gegeben durch die Sprachgebrauchsmuster der Mitte. Diese tragen es in die sozialen Ecken, diese bestätigen die Radikalen, geben ihnen die geistige Nahrung. Mit den theologischen Deutungsschriften kam die Abgrenzung, die Abwertung, die Verteufelung des Judentumes in die Welt. Das abstrakte Konzept ‚Jude‘, das die Basis aller Formen des Antisemitismus darstellt, konnte überhaupt erst durch den Sprachgebrauch entstehen. Denn alle nicht konkreten Erscheinungen in unserer Welt bedürfen der Sprache, um denkbar und mitteilbar zu sein. Alle abstrakten, nicht sinnlich erfahrbaren Objekte basieren auf verbalen Symbolen, also Wörtern und Sätzen. Ohne Sprache gäbe es in unserer Realität keine Konzepte wie Demokratie, Pluralismus, Toleranz – und keinen Antisemitismus. Auch ob ein Mensch oder eine Menschengruppe als Monster und Parasiten oder Götter und Führer akzeptiert werden, hängt von den Denkmustern und Bildern ab, die man ihnen geistig und verbal zuordnet.
Dass mit sprachlichen Äußerungen aktiv und bewusst Handlungen wie Beschimpfen, Lügen, Bedrohen vollzogen werden, ist also nur eine Dimension ihres Potenzials. Sprache hat auch Macht, weil sie ein Instrument der Beeinflussung und Lenkung unserer Gedanken und Gefühle ist, weil durch sie diese Manipulation ausgeübt werden kann, ohne dass sie bewusst wird. Die toxische Bedeutung von Wörtern schleicht sich oft unbemerkt in unseren Geist ein, sie hinterlässt aber Spuren, löst Assoziationen aus, prägt zum Teil langfristig Einstellungen und Gefühle. Das geistige Gift des judenfeindlichen Ressentiments kam vor 2.000 Jahren durch die Verdammungsrhetorik der frühen Kirchengelehrten in die Welt, breitete sich von dort aus, nahm zeitgemäße Elemente in seine Substanz auf und wurde über die Jahrhunderte hinweg fester Bestandteil des Denk- und Lebensraumes. Doch noch immer konzentriert man sich bei der Antisemitismusbekämpfung primär auf die zwölf Jahre NS-Zeit (und auf das 19. Jahrhundert mit seinem völkischen Rasse-Antisemitismus). Dass all dies nach über 18 Jahrhunderten nur die Spitze des religions-, kultur- und geistesgeschichtlichen Phänomens Judenhass ist, wird zu wenig thematisiert. Die Gleichförmigkeit aller historischen und aktuellen judenfeindlichen Äußerungen belegt den Erhalt und die Kontinuität uralter Deutungsmuster. Sprache benutzen ist immer Aktualisierung des Vergangenen (des bereits im Langzeitgedächtnis Gespeicherten), verwoben mit Gegenwärtigem (in aktuellen Kontexten). Mit der Sprache der Judenfeindschaft tragen wir Sedimente unserer Vergangenheit in unsere Gegenwart, reproduzieren Gefühlswerte und Denkstile längst vergangener Zeiten immer wieder aufs Neue und durchwirken somit nicht nur unsere tagtägliche Kommunikation, sondern legen auch die giftigen Bahnen für zukünftige Erzeugnisse des menschlichen Geistes und sich daraus ergebende Handlungsmöglichkeiten.
Sprache zu benutzen ist geistige Herrschaftshandlung. Entsprechend ist Sprachgebrauch Macht- und Gewaltausübung. Eine Sprache zu benutzen bedeutet, Geist in die Welt zu tragen. Dieser Geist, die Semantik von Wörtern, Sätzen und Texten, kann Welt abbilden oder Welt erschaffen, kann gravierende Auswirkungen auch für die physische Realität haben. Mit den Bedeutungen sprachlicher Ausdrücke geben wir Impulse in die Köpfe unserer Mitmenschen. Diese können positiv oder negativ, freundlich oder feindselig sein. Judenfeindliche Äußerungen sind geistiges Gift. Wir tragen dafür die Verantwortung. Wir entscheiden. Wir wählen die Wörter aus. Es gibt beim Judenhass keine unschuldige Sprache, es gibt keinen harmlosen Sprachgebrauch. Und nie ist es „nur Sprache“.
2Sprache als Weltenerschafferin und Menschenzerstörerin
Warum es ohne das verbale Symbolsystem kein Gerücht über die Juden geben würde
„Der Glaube, es gebe nur eine Wirklichkeit, ist die gefährlichste Selbsttäuschung.“ (Paul WatzlawickWatzlawick, Paul)
Um das langlebige und im Wesentlichen gleichbleibende Phänomen des Judenhasses verstehen zu können, müssen zwei besondere Funktionen der Sprache beachtet werden: Zum einen ihre Rolle als kognitive Weltenerschafferin, also die Möglichkeit, mittels verbaler Symbole eigenständige Realitäten entstehen zu lassen. Zum anderen ihre soziale Rolle als Kommunikations- und Machtinstrument, in der zwischenmenschlichen Interaktion weitreichenden Einfluss auf Gedanken und Gefühle nehmen zu können. In Konsequenz kann die geistige Gewaltanwendung auch die physische Existenz von Menschen tangieren – in diesem Sinne wirkt Sprache also als Menschenzerstörerin.
Wir Menschen sind Menschen, weil wir denken und fühlen, weil wir ein Bewusstsein haben, weil wir über Sprache verfügen. Sprache ermöglicht, über das Hier und Jetzt hinaus zu reflektieren, gibt Kategorien, mit denen wir sonst nicht Fassbares denkbar machen. Wie kommen abstrakte Einheiten und Sachverhalte in die Welt? Indem sie mittels Symbolen greifbar und an andere vermittelbar werden. Konzepte wie Güte, Gemeinschaft, Demokratie wären ohne sprachliche Zeichen nicht denkbar.
Die realitäts- und weltenkonstituierende Rolle der Sprache wird treffend in dem berühmten Zitat des wichtigsten Sprachphilosophen im 20. Jahrhundert, Ludwig WittgensteinWittgenstein, Ludwig, zusammengefasst: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ Man muss keinen Sprachdeterminismus oder eine sprachliche Relativitätstheorie vertreten, der zufolge unsere gesamte Wahrnehmung von der jeweiligen Sprache bestimmt wird, um zu dieser Ansicht zu gelangen. Menschen sind zwar im Denken keine Sklaven ihrer Sprache und können durch Umschreibungen sowie kritische Reflexionen ihren Sprachgebrauch erweitern, umgestalten und überdenken, doch die bewertende Perspektive auf die Welt ist immer sprachlich geprägt. Diese den Geist lenkende Rolle der Sprache sah auch der Philosoph Bacon vor über 400 Jahren sehr deutlich: „Die Menschen glauben nämlich, ihre Vernunft führe die Herrschaft über die Worte; allein nicht selten beherrschen gegentheils die Worte den Sinn …“ (Francis BaconBacon, Francis 1620).
Dann denkt es, dann spricht es geradezu im Bewusstsein von Menschen. Ein feindseliger Sprachgebrauch setzt feindselige Gedanken und Gefühle frei, verführt das Denken zu gewalttätigen Überlegungen. Da die Sprache durch ihre grammatischen und lexikalischen Kategorien vorgibt, was wir bewusst denken können, setzt sie tatsächlich das formale Gerüst für unseren Geist.
Sie trägt und prägt nicht nur alle komplexen mentalen Prozesse, sondern begrenzt oder erweitert die Möglichkeiten des bewussten und reflektierenden Verstandes. Und im Bereich der nicht sinnlich und konkret erfahrbaren Dinge und Sachverhalte sind wir auf die Kategorien und Strukturen des Kenntnissystems der Sprache angewiesen: Den Inhalt des Satzes „Ohne die Sprache gäbe es keinen Judenhass“ könnten wir ohne die Symbolkraft und das formale System der Sprache weder denken noch anderen mittteilen. Warum? Weil erst das Symbolsystem Sprache die judenfeindlichen Konzepte und Gefühle formulier- und übertragbar macht. Und weil wir keine Gedankenübertragung bei der menschlichen Informationsvermittlung benutzen, sondern wahrnehmbare Einheiten. Um etwas für andere auszudrücken, bedarf es immer eines spezifischen Modus operandi, der geistige Inhalte durch Formen ausdrückt. Der spezifische Satzinhalt konstituiert sich aus der Verbindung der abstrakten Kategorienkonzepte ‚die Sprache‘ und ‚Judenhass‘ mittels der grammatischen Elemente und Verknüpfungen. Konditionalität (gäbe) und Negation (ohne, keine) sind sprachabhängige Kategorien. Es gibt in der außersprachlichen Realität nichts Äquivalentes. Sie stellen geistige Beziehungen zwischen Sachverhalten dar, die sonst gar nicht in dieser Verbindung existieren würden. Die Negation ist prinzipiell ein Konzept, dass wir uns nicht vorstellen, sondern nur abstrakt denken können. Kein Bild, keine Skulptur, keine Musik, hätte je die Komplexität, Abstraktheit und zugleich die informationelle Eindeutigkeit, einen solchen Satzinhalt darstellen und übermitteln zu können.
Dass Sprache nicht nur Realität abbildet, sondern auch Realitäten erschafft, wussten schon die antiken Philosophen. Und die von PlatonPlaton skizzierte Hypothese, dass wir „die Welt“ (oder „das Ding an sich“, wie KantKant, Immanuel es Jahrhunderte später formulierte) nie direkt, sondern stets vermittelt über Ideen wahrnehmen, sieht sich heute durch die moderne Gehirnforschung empirisch bestätigt. Der Neurowissenschaftler Stephen MacknikMacknik, Stephen brachte es in einem Interview auf den Punkt: „Doch, es gibt die Welt da draußen. Aber Sie sind nie dort gewesen, nicht mal zu Besuch. Der einzige Ort, an dem Sie je waren, ist in Ihrem Kopf.“ Die Dinge, die wir sehen, hören und als unabhängige Tatsachen bewerten, sind Konstrukte unserer neuronalen Aktivitäten. Es ist das menschliche Gehirn, das durch die ausgetüftelte Koordination von chemischen und elektrophysischen Prozessen bei gleichzeitiger Aktivierung verschiedener Areale in Cortex (den Bereichen, die vor allem die kognitive Verarbeitung bewältigen) und limbischem System (die Gehirnstrukturen, die für emotionale Aktivierung verantwortlich sind), letztendlich „die Welt“ für uns konstruiert.
In den letzten Jahrzehnten wurde diese Erkenntnis in umfangreichen neuro- und kognitionswissenschaftlichen Studien belegt und gilt heute weitgehend unumstritten. Auch Sprachgebilde formen eigene Welten, geistige Welten, die jedoch von denjenigen, die an sie glauben, für wahr gehalten werden. Antisemiten glauben an das, was sie denken, fühlen und sagen. Judenfeindschaft kann man nicht ohne die Macht der Sprachgewalt erklären und bekämpfen. Sie wird jedoch oft als Nebenrolle gesehen, obgleich sie der Kern des Phänomens ist. Mit der Verschriftlichung der urchristlichen Ideen und seiner Rhetorik schuf die Sprache die neue Religion des Christentums und legte zugleich mit ihrer anti-judaistischen Verdammnis das Fundament für die Zerstörung einer gleichberechtigten und würdevollen Existenz des Judentums. Das „Gerücht über die Juden“, wie AdornoAdorno, Theodor W. das Phänomen des Antisemitismus nannte, hielt so Einzug in der Welt und wurde von Generation zu Generation weitergetragen, angereichert, wurde fantastischer und virulenter, verfestigte sich, hatte weitreichende physische, soziale und politische Auswirkungen. Dass die Einheiten dieses Gerüchts lediglich geistige Stellvertreter und Konstrukte einer völlig subjektiven Erlebniswelt waren, wurde am Ende nicht mehr reflektiert. Sie wurden zur antisemitischen Realität.
Wir Menschen leben allgemein in und agieren mit verschiedenen Welten: Dabei ist aus kognitionswissenschaftlicher Sicht ein Drei-Ebenen-Modell besonders plausibel. Die reale Welt der Sinne, der konkreten Perzeption, die für uns rechtsverbindlich ist, deren physische Objekte, Personen und Sachverhalte wir mit Kriterien wie Existenz, Wahrheit, Objektivität und Faktizität messen und beurteilen. In Karl PoppersPopper, Karl Weltmodell entspräche diese Realität der Welt 1. Wir erleben uns und andere aber auch in einer subjektiven Erlebenswelt, ähnlich Poppers Welt 2, in der jeder Mensch individuell Geschehnisse verarbeitet und je nach persönlicher Weltsicht und Einstellung geistig als mentale Modelle speichert. Diese Welt entspricht zum Teil dem episodischen Gedächtnis, so genannt, weil es subjektive Erlebnisepisoden eines Individuums sind, die repräsentiert werden; zu diesen kommen aber auch ausgedachte Wunsch-, Fantasie- und Glaubensinhalte. Schließlich werden wir maßgeblich von den abstrakten Konstrukten des Denkens beeinflusst. Dieses abstrakte Kenntnissystem, maßgeblich vom enzyklopädischen Gedächtnis mit seinen abstrakten Kenntniskategorien geprägt, enthält Theorien, Mythen, Fiktionen und entspricht zum Teil der Welt 3 in PoppersPopper, Karl Ontologie. Demgemäß sieht der Semiotiker Umberto EcoEco, Umberto Zeichen als grundlegende Bausteine der Kultur an. Hier spielt auch eine Rolle, was wir kollektives Bewusstsein, als die gemeinsame und geteilte Summe an Ideen einer Gesellschaft, nennen und kulturelles Gedächtnis, wie Maurice HalbwachsHalbwachs, Maurice das gemeinsame Wissen, auf das Menschengruppen zugreifen, nannte. Sprache und Kommunikation sind Teile der Kultur und angesichts der Relevanz unserer Schriftkultur ist aus gedächtnispsychologischer Sicht eine Trennung von mündlichen und schriftlichen Ereignissen wenig plausibel. Vielmehr werden diese in Netzen gemeinsam abgespeichert. Das kommunikative Gedächtnis beinhaltet also mündlich und schriftlich tradierte Sprachgebrauchsmuster sowie bekannte und oft reproduzierte Zitate, Floskeln, Sprichwörter, Phrasen und Ausdrücke, repräsentiert enzyklopädische wie auch episodische Gedächtnisinformationen. Sprache ist dabei nicht nur wichtigster Träger kulturell-kognitiver Kategorisierungen, sondern auch ein Erzeuger von ihnen. Mittels der Kommunikation treten Menschen aus der Ich-Existenz in eine Wir-Existenzform. „Der Mensch ist nur Mensch durch Sprache“ befand deshalb Wilhelm von HumboldtHumboldt, Wilhelm von. Und die Frage „Was ist Sprache?“ ist, wie der bekannte Wissenschaftler Sir John LyonsLyons, John es einmal ausgedrückt hat, „nicht weniger wichtig als die Frage Was ist Leben?“.
Wir können uns Dinge bildlich vorstellen, aber im Bereich der abstrakten Phänomene sind wir auf unsere Sprache angewiesen. Entsprechend betonte auch Hannah Arendt die konstitutive Rolle der Sprache für politische Erscheinungen:
„Und diese politischen Phänomene, im Unterschied zu den reinen Naturerscheinungen, bedürfen der Sprache und der sprachlichen Artikulation, um überhaupt in Erscheinung zu treten; sie sind als politische überhaupt erst existent, wenn sie den Bereich des nur sinnfällig Sichtbaren und Hörbaren überschritten haben.“ (Hannah ArendtArendt, Hannah 1963).
Auch den gesamten Bereich der fiktiven Literatur gäbe es nicht, denn er ist zwingend an die sprachliche Konstruktivität und die damit verbundene Schaffung rein geistiger Welten gebunden.
Über das kognitiv und kulturell geprägte Kenntnissystem Sprache vermitteln Menschen ihre Wahrnehmungen, Eindrücke und Urteile, ihre Ideen, Vorstellungen und Überzeugungen, ihre Wünsche, Erwartungen und Ziele. Die Sprache ist das bei allen individuellen Unterschieden und subjektiven Ausrichtungen menschlicher Existenzen in einer Gemeinschaft von allen geteilte und benutzte, überindividuell verstandene Kenntnissystem.
Die Contra-Judaeos-Texte mit ihrer judenfeindlichen Weltenteilung in richtig und falsch waren zunächst lediglich Resultate der subjektiven und religiös geprägten Vorstellungswelt 2 ihrer Verfasser, die im Laufe der Jahrhunderte aber eine überindividuelle Sphäre etablierten (vgl. Kap. 3). Auf der Ebene der abstrakten Geisteswelt entstand ein eigenständiges Glaubenssystem, das in Welt 3 den Status eines Weltdeutungssystems erlangte. Dieses hatte zwar mit der tatsächlichen physisch erfahrbaren Welt 1 nichts gemeinsam, denn das darin aufgebaute Modell von Juden und Judentum war ein reines Fantasiekonstrukt, das mit realen jüdischen Menschen nichts gemeinsam hatte, erhielt aber den Wahrheitswert „ist Tatsache“ zugeordnet.
Sprache ist Mittel zur Weltabbildung und -konstruktion. Sprache ist gleichzeitig das bedeutendste Medium individueller und sozialer Machtausübung. Mittels Sprache setzen wir unsere Wünsche durch, wir üben Einfluss auf andere aus, im positiven wie im negativen Sinne: Die „Macht des Wortes“ (wie Sigmund FreudFreud, Sigmund es nannte) zeigt sich in Sprachhandlungen, die erfreuen, beruhigen, schlichten, Frieden erklären, aber auch in seiner destruktiven Kraft beim Beleidigen, Beschimpfen, Diskriminieren. Und sie dient der Legitimation von Beziehungen organisierter Gewalt, wie HabermasHabermas, Jürgen es ausführte. Claude LanzmannLanzmann, Claude beschreibt in seinem Film Shoah (1986) eine Sprachregelung der Deutschen in den Konzentrationslagern, die mit direkter Gewalt verbunden war: „Wer das Wort ‚Toter‘ oder ‚Opfer‘ aussprach, bekam Schläge. Die Deutschen zwangen uns, von den Leichen zu sagen, daß es ‚Figuren‘ seien, das heißt […] Marionetten, Puppen oder ‚Schmattes‘ [Fetzen, Lumpen], das heißt Lappen.“
Durch spezifische Kategorisierungen erzeugt der Sprachgebrauch Konzeptualisierungen, die Ideologien oder Weltsichten prägen. Ein Wort wie Untermensch gibt durch das Präfix Unter- eine semantische Abwertung, Monster und Schwein, Bazillen und Parasiten dehumanisieren, Teufel und Satansbrut dämonisieren. Victor KlempererKlemperer, Victor beschrieb dies in seiner Lingua Tertii Imperii, einer Abhandlung zur NS-Rhetorik, wie sich durch die ständige Wiederholung toxischer NS-Vokabeln evaluierende Muster in den Köpfen festsetzen. Solche Bewertungen der Welten 2 und 3 führten dazu, dass Menschen wie Vieh in Waggons abtransportiert wurden, um sie zu ermorden, dass man sie wie bei dem Thema Schädlingsbekämpfung mit der nüchternen Wannsee-Protokoll-Rhetorik zum Tode verurteilte.
Hasssprache und die Macht von Textweltmodellen: Warum das antisemitische Konzept ‚Jude‘ den gleichen Status wie die Fiktionen Moriarty und Voldemort hat
„Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern was wir über die Dinge denken.“ (SenecaSeneca)
Hasssprache nenne ich alle Formen des Sprachgebrauchs, die gegenüber Personen oder Personengruppen verbale Gewalt kodieren. Verbale Gewalt ist eine mentale Aggressivität, die in verschiedenen direkten und indirekten Manifestationen zum Ausdruck kommen kann: u. a. als Beleidigung, Drohung und/oder Diskriminierung. Das Handlungsinstrument Sprache hat das Potenzial, Menschen kognitiv wie emotional zu verletzen und ihnen nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich Schaden zuzufügen. Sprachliche Äußerungen aktivieren und konstruieren Gedankengut, das die öffentliche Meinung und das kollektive Bewusstsein massiv und nachhaltig beeinflussen kann. Mit sprachlichen Äußerungen werden Menschen als Individuen und/oder als Mitglieder von Gruppen angegriffen, verhöhnt, stigmatisiert und diffamiert. Hassrede ist somit geistige Brandstiftung. Spielt bei einer verbalen Aggressivität der Bezug auf die Gruppe bzw. Gemeinschaft, der diese Person angehört, eine Rolle, handelt es sich um verbale Diskriminierung. Verbale Diskriminierung ist somit eine Form von Gewaltanwendung, die das Machtpotenzial von Sprache nutzt, um gesellschaftliche Gruppen (sei es aufgrund ihrer Ethnienzugehörigkeit, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Ausrichtung, ihrer Religion, ihres Alters oder ihrer Herkunft) von der (vom Aggressor als normal etablierten) Mehrheitsgesellschaft semantisch auszugrenzen und abzuwerten. Die gruppenbezogene Ausgrenzung basiert auf der fundamentalen sozialpsychologischen Unterscheidung von Eigen- und Fremdgruppe, die sich auf allen Ebenen menschlicher Sozialisierung zeigt. Die semantische Komponente ‚gruppenbezogen‘ ist dabei entscheidend, ob eine Sprachhandlung Kritik, Beleidigung oder Diskriminierung ist. Direkte Hasssprache beschimpft, diskreditiert, ängstigt oder entwürdigt über die Semantik der gewählten Ausdrücke andere Menschen, z. B. durch De-Humanisierungen mittels Tier- oder Unratsbezeichnungen wie Schwein, Dreck, Pack, Scheißjude. Die Diskriminierung erfolgt oft mit ethnischen Schimpfwörtern, die Rassismus kodieren wie bei Jüd oder ideologischen Paraphrasen wie Nicht-Arier. Zu offen kodierten Verwünschungen und Drohungen wie „Werft die Bombe auf den jüdischen SS-Staat“ (ein authentisches Beispiel aus dem Internet) gehören bspw. Tötungsfantasien und Gewaltaufrufe wie „Alle rassistischen Zionisten aufhängen!“ (aus einer E-Mail an die israelische Botschaft Berlin). Indirekt erfolgt Hassrede hingegen im Kontext der Äußerung als Anspielung oder in Form von Chiffren, die zwar nicht explizit eine Entwertung kodieren, jedoch für jedermann erkennbar bestimmte Aussagen und Bewertungen über Schlussfolgerungen vermitteln (vgl. Kap. 7). So gibt es beim Verbal-Antisemitismus zahlreiche, mittlerweile von der Forschung gut dokumentierte und dechiffrierte Versatzstücke in Form von Paraphrasen (Banker von der Ostküste), Verballhornungen von Namen und Buchstabensubstitutionen (Baron Totschild, eine Stelle in dem verschwörungsfantastischen Song Raus aus dem Reichstag von Xavier NaidooNaidoo, Xavier), intertextuellen Verweisen (wie Auge um Auge aus der hebräischen Bibel) und Metaphern. So sind bspw. Heuschrecken und Marionettenspieler gängige metaphorische Ausdrücke für den vermeintlichen Einfluss jüdischer Kreise. Dieser sogenannte strukturelle Antisemitismus geriert sich nach außen als Gesellschafts- und Kapitalismuskritik, kodiert aber klassische Stereotype des ‚raffenden jüdischen Kapitals‘ und der ‚zionistischen Dominanz‘. Hasssprache muss allerdings nicht affektiv und vulgär brachial kommuniziert werden. Es gibt neben dem affektiven Hass auch einen (pseudo-)rationalen Hass, der sich sprachlich in Texten niederschlägt. Die Nürnberger Rasse-Gesetze von 1935 und das Wannsee-Protokoll von 1940 sind historische Beispiele hierfür. Bürokratisch, emotional kalt, in Beamtendeutsch verfasst, aber inhaltlich ausgerichtet auf Entmenschlichung und Massenvernichtung. Heute sind in diesem Duktus vor allem die Umgestaltungsfantasien in Bezug auf den jüdischen Staat, kommuniziert als „besorgte Kritik“ oder „Kunst-Freiheit“. Antisemitismen – die Pluralverwendung bezieht sich auf alle Formen judenfeindlicher Kommunikation und Hasssprache – können explizit und aggressiv, aber auch implizit und sublim das Gift des judenfeindlichen Phantasmas vermitteln (vgl. Kap. 7).
So wie die sprachlichen Strukturen eigene Welten in fiktiven Erzählungen und Märchen erschaffen und damit allein durch die Kraft des Geistes Utopien und Alternativ-Realitäten erzeugen, so basiert auch das antisemitische Konzept ‚Jude‘ allein auf Glaubensinhalten, auf Fiktionen. Ob Mephistopheles, Dracula, Moriarty oder Voldemort: Ihre Existenz ist eine von Sprachstrukturen hervorgebrachte und in fiktiven Welten erhaltene. Doch in unseren Gedankenwelten sind sie als Schurken und Bösewichte höchst lebendig, begleiten uns ein Leben lang, gehören zu unserem Erfahrungsraum, als ob wir sie persönlich getroffen hätten. So ist es mit dem Judenhass: Dass Juden „Mörder, verstockte Dunkelmänner, rachsüchtige und geldgierige Verschwörer“ seien, kam über Sprachkonstruktionen in die Welt, dieses Phantasma erhielt jedoch im Laufe der Jahrhunderte den Status ‚real und wahr‘. Antisemitismus hält und legitimiert sich bis heute einzig durch die tradierten Sprach- und Denkstrukturen, in denen Juden und Judentum die Rolle des Weltenübels, des Bösen innehaben. Aus einer sprachkonstruierten Fiktion entwickelte sich das komplexe Glaubens- und Weltdeutungssystem der Judenfeindschaft. Es ist ein Glaubenssystem, aber in der Gefühlswelt von Antisemiten steht ihr Glaube für eine Tatsache, wird die subjektive Erlebensebene für real gehalten. Voldemort, eine fiktive Verkörperung des mächtigen, abgrundtief bösen Gegenspielers, ist damit sozusagen in der realen Welt angekommen, nur trägt er dort den Namen Jude.
Hirngespinste des Hasses
Man kann sich dies gut im Rahmen der kognitiven Textweltmodelltheorie vor Augen führen (s. Schwarz 32008: 197ff. sowie Schwarz-Friesel 22013: 33ff.) Textweltmodelle (TWM) sind geistige Deutungsschemata im Kopf, die sich beim Sprachverstehen automatisch aufbauen und eine eigenständige Welt-Sphäre entstehen





























