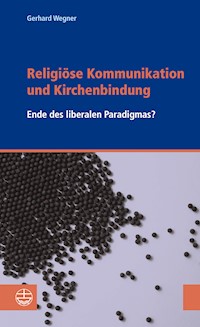Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Evangelische Verlagsanstalt
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Christliche Sozialethik muss ihre Grundsätze und Empfehlungen auch für religiös unmusikalische Menschen plausibel formulieren. Sie erwächst jedoch immer wieder neu aus christlich-kommunikativer Praxis, in der Gottes Vertrauensvorschuss – seine Verheißungen – in Wirtschafts- und Sozialpolitik artikuliert werden. So kultiviert sie die Kraft des Mythos in Distanz zu einer vermeintlich rationalen und pluralen Welt. Und liefert zugleich praktikable Orientierungen in den Dilemmata, die unsere Welt heute auszeichnen. Von daher behandelt der Autor Beiträge zu aktuellen Problembereichen wie Gerechtigkeit, Populismus, Gewalt, Familien, Unternehmen, Staat und Religion. [Transcendental Credit of Trust. Social Ethics in Process] Christian social ethics have to formulate their principles and recommendations in a way that is also plausible for religiously unmusical people. These ethics emerge always fresh from a communicate Christian practice in which God's credit of trust – his promises – is articulated in the field of economic and social policies. In this way Christian social ethics cultivate a power of the myth in distance to an alleged rational and plural world, at the same time giving practical orientations in regard to the conflicts of our world. From this perspective the author reflects on contributions to current problem areas like justice, populism, violence, families, corporations, state, and religion.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerhard Wegner
Transzendentaler Vertrauensvorschuss
Sozialethik im Entstehen
Herausgegeben vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD
Gerhard Wegner, Dr. theol., Jahrgang 1953, studierte Evangelische Theologie in Göttingen und Nairobi. Er ist Direktor des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD in Hannover und apl. Professor für Praktische Theologie an der Universität Marburg.
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2019 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH · Leipzig
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Cover: makena plangrafik, Leipzig
Coverbild: Kirchenruine auf den kapverdischen Inseln © Doris Wegner
Layout und Satz: Steffi Glauche, Leipzig
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2019
ISBN 978-3-374-05867-9
www.eva-leipzig.de
Inhalt
Cover
Titel
Über den Autor
Impressum
Transzendentaler Vertrauensvorschuss
Einleitung
Gerechtigkeit
Zum Sozialstaat
Vom Charisma zum Stigma
Armutsbewältigung und Diakonie aus christlicher Sicht
Arbeit – die Gabe der Generationen
Entweder Sozialstaat oder bedingungsloses Grundeinkommen – beides geht nicht!
Spiritualität des Wirtschaftens
»Spirituelles Kapital«
Führungskräfte und ihre Berufung
Gibt es eine »Theologie des Unternehmens«?
Einige Suchbewegungen
Komplexität in Kirche und Diakonie Was macht das Führen schwierig?
Populismus und Politik
Braucht der Staat Religion?
Populismus – gut oder böse?
Fiktionen der Fülle
Kraftfelder des Geistes
Zu Genese und Geltung christlicher Sozialethik
Kann Luthers Freiheitsverständnis die Barrieren zwischen Kulturen überwinden?
»Die gute altmodische brutale Gewalt.« (Rocky)
Soziotheologische Assoziationen zu einer alltäglichen Ressource
Weitere Bücher
Endnoten
Transzendentaler Vertrauensvorschuss
Einleitung
In diesem Buch sind eine Reihe von sozialethischen Aufsätzen versammelt, die sich auf soziale Probleme der letzten zehn Jahre beziehen. Ihnen gemeinsam ist die drängende Frage danach, was christliche Sozialethik unter heutigen gesellschaftlichen Bedingungen bewirken kann. Diese Frage ist nicht unabhängig davon zu beantworten, wie sich die christliche Sozialethik selbst begreift – und zwar im Verhältnis zu dem, woher sie kommt: zum christlichen Glauben und seiner Praxis als gelebter religiöser Kommunikation. Insofern ist die Frage nach der Entstehung christlicher Sozialethik an eben diese Praxis gebunden und sie teilt – zumindest in Mitteleuropa – mit ihr das Schicksal des Niedergangs. Zwar lassen sich im wissenschaftlichen Bereich nach wie vor imponierende sozialethische Studien finden. Die reale sozialethische Wirksamkeit der evangelischen Kirche fällt in ihrem tatsächlichen Einfluss auf Wirtschaft und Sozialgestaltung jedoch recht bescheiden aus. Zudem greift an dieser Stelle nicht selten ein bekanntes Paradoxon kirchlicher Wirksamkeit: Je weniger die Kirche ihre eigene religiöse Identität in den Vordergrund stellt, desto wirksamer kann sie agieren; je mehr sie dies tut, desto weniger wird sie wahrgenommen – bis hin zur Marginalisierung. In dieser Zwickmühle, ja in diesem Teufelskreis zu stecken, führt bei den Akteuren nicht selten zu Resignation.
Angesichts dieser Situation plädiere ich dafür, der Resignation nicht nachzugeben, sondern die sozialethisch konstitutive Bedeutung des christlichen Mythos als Fiktion umfassender Liebe (Agape) wieder stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Diese Fiktion besitzt eine gewaltige soziale Prägekraft. Die Agape bedarf keines Nachweises ihrer Wirksamkeit oder gar ihres funktionalen Nutzens zur Begründung von Sozialkapital. Sie lässt sich nicht als Rezept oder gar als nützliche Ressource von Fall zu Fall einführen. Mit ihr ist vielmehr eine eigene Wirklichkeit der christlich religiösen Kommunikation benannt, ein spezifisches Kraftfeld des Geistes, in das sich Menschen hineinziehen lassen und deswegen die Welt verändern können. Wo dies allerdings nicht mehr erfahren wird, ist auch christliche Sozialethik machtlos. Sie gewinnt ihre Prägekraft aus dem Bezug auf diese fiktive Wirklichkeit.
Die christliche Liebe ist darin eine äußerst wirksame Fiktion, dass sie die Realität der Liebe nicht erzeugen kann, sondern sie vielmehr stets voraussetzt. Diese Struktur ist in besonders faszinierender Weise von Sören Kierkegaard beschrieben worden: »Der Liebende setzt voraus, daß die Liebe in des andern Menschenherzen ist; und eben durch diese Voraussetzung baut er die Liebe in ihm auf/von Grund aus, sofern er sie ja liebend im Grunde voraussetzt.«1 Im Hintergrund steht bei Kierkegaard die Vorstellung einer triangulären Struktur der Liebe: »Die weltliche Weisheit meint, die Liebe sei ein Verhältnis zwischen Mensch und Mensch; das Christentum lehrt, daß die Liebe ein Verhältnis zwischen Mensch und Gott und Mensch ist; d. h. daß Gott die Zwischenbestimmung ist. […] Denn Gott lieben heißt, in Wahrheit sich selbst lieben; einem anderen Menschen behilflich sein, daß er Gott liebe, heißt ihn lieben; von einem anderen Menschen darin unterstützt werden, daß man Gott liebe, heißt geliebt werden.«2 Sicherlich sind dies unter den Bedingungen des heute herrschenden säkularen und auf Selbstwirksamkeit zielenden Common Senses durchaus erstaunliche und irritierende Beschreibungen. Aber man achte strikt auf die hier herausgearbeitete Struktur der Selbst-Beziehung des Menschen als einem exzentrischen Wesen, das sich selbst nur über den Umweg über eine dritte Instanz, Gott, seines Selbst gewiss werden kann. Um eine Einschreibung in dieses Verhältnis kommt die christliche Sozialethik aus meiner Sicht nicht herum, und auch nach »außen« gilt es, diese trianguläre Struktur stets durchzuhalten. Die »Leistungsfähigkeit« christlicher Sozialethik und ihr besonderer Beitrag zur allgemeinen ethischen Diskussion impliziert ein entsprechendes trianguläres Selbstverhältnis.
Etwas ›handlicher‹ formuliert, lässt sich die realfiktive Präsenz eben dieses christlichen Verständnisses der Liebe als »transzendentaler Vertrauensvorschuss« bezeichnen. Damit wird auf genau jene Struktur der bedingungslosen Voraussetzung von Liebe angespielt, wie sie bei Kierkegaard durchgespielt wird. Die Idee dazu, einen solchen Begriff zu formulieren, stammt aus einem spezifischen Kontext, nämlich der Diskussion um die Gestaltung von inklusiven Sozialräumen. Prägnant hat Frank Schulz-Nieswandt herausgearbeitet, dass Inklusion nicht die Anpassung der Minderheitskultur der homo patiens an die dominante Mehrheitskultur bedeuten kann, sondern eine radikale Arbeit an den Normalitätskonstruktionen des Lebens als solchen bedeutet.3 »Das ist schmerzlich, verletzt es doch die selektive Bedürftigkeit nach Eindeutigkeit und Abgrenzung des sich evolutionär selbstbehauptenden Individuums in der homogenen Gruppe. Das Fremde ist plötzlich das eigene; das Selbst verdankt sich dem Anderen. Die selbstverständlichen Strukturen der Welt erodieren.«4
Wichtig ist nun, dass es Schulz-Nieswandt an dieser Stelle nicht nur bei einer Forderung belässt, sondern nach der Möglichkeit entsprechender Konversionsprozesse fragt. Das hat zur Folge, dass der Begriff des Vertrauens an Bedeutung gewinnt. Damit reale Transformationsprozesse von Normalitätskonstruktionen in Gang kommen können, braucht es die Erfahrung bzw. die Unterstellung von umfassendem Vertrauen: Es braucht einen Vertrauensvorschuss. »Um den Kreislauf von Vertrauenskapitalbildung und Sozialkapitalgenerierung in Gang zu setzen, benötigt der Prozess somit in der Ausgangslage bereits personale Haltungen, die von einer gelebten positiven Anthropologie des Vertrauensvorschusses, der Geduld, der längeren Zeithorizonte, einer rechten Mischung aus Eifer und Gelassenheit, von Erwartungsanspruch und Vergabe-Bereitschaft im Fall von Scheiternsrisiken und Entwicklungskrisen gekennzeichnet ist.« Genau dies benennt Schulz-Nieswandt mit einer Formulierung von Georg Simmel als transzendental vorgängiges Humanstartkapital. Auf die Haltung kommt es an – so sein Fazit.5 An anderen Stellen seiner Schriften stellt Schulz-Nieswandt diese Zusammenhänge in ihrem Kontext der protestantischen Theologie dar, auch wenn er dabei strikt säkularisiert argumentiert.
Was Schulz-Nieswandt hier darlegt, beschreibt in sozialwissenschaftlicher Terminologie nichts anderes als die Funktionsweise christlicher Sozialgestaltung im Sinne von Nächsten- und Fremdenliebe. Seine Analyse greift über die »weltliche« Struktur dieser Sozialgestalt nicht hinaus – er treibt sie aber bis zu dem Punkt, an dem deutlich wird, dass es ohne einen triangulären Bezug auf eine dritte Dimension, eine Kraft, die ein entsprechendes Geschehen überhaupt erst in Gang setzt, nicht gehen kann. Und genau hier kann der christliche Mythos seine eigene »Leistungsfähigkeit« deutlich machen. In ihm wird einseitige soziale Selbstermächtigung ohne Rücksicht auf andere als »Sünde« gebrandmarkt.6 Das Versprechen solcher Ansätze besteht in der Regel darin, Beziehungsformen und Formen von Sozialgestaltung schaffen zu können, in denen ein vollkommen reziprokes Füreinander der Beteiligten in der Form möglich ist, dass alle Beteiligten ihre tatsächlichen Bedürfnisse und Interessen ungehindert artikulieren und realisieren könnten. In allen gesellschaftlichen Handlungsbereichen sei es möglich, Bedingungen eines zwanglosen Füreinander und damit sozialer Freiheit herzustellen.7 Die Hoffnung auf derartige soziale Verhältnisse findet sich auch in der christlichen Tradition und hat immer wieder zu gesellschaftlichen Innovationen geführt. Aber – und das ist entscheidend – diese christlich tradierte Hoffnung gewinnt ihre Kraft aus der Präsenz einer dritten Dimension, die letztlich nicht greifbar, geschweige denn bewältigbar ist. Damit wahrt die christliche Erfahrungswelt die fragile menschliche Kraft zu Lieben. Begreift man den Grundimpuls christlicher Sozialethik in dieser Richtung, dann obliegt auch ihr die von Kierkegaard gestellte Grundaufgabe des Christen, seine Liebe darin zu zeigen, dass sie sich bemüht, andere Menschen zur Liebe zu Gott zu befähigen. Eine den Impulsen der Agape folgende Sozialgestaltung ginge dann nicht mit der Selbstermächtigung der Menschen, sondern gerade umgekehrt mit der Liebe zu Gott als Absehung von sich selbst einher. Genauso folgte eine solche Sozialgestaltung der fiktiv realen Grundvoraussetzung von Vertrauen und Liebe.
Allgemeiner formuliert ist der Bezugspunkt der Sozialethik die Agape und damit die Fülle des Lebens. Darin ist sie funktional vergleichbar mit allen möglichen Repräsentationen von Fülle überhaupt. In dieser Hinsicht hat Ernesto Laclau sein politisches Schlüsselkonzept der Hegemonie mit der fiktiven Herstellung von Fülle in Zusammenhang gebracht: »Ich verstehe unter ›Hegemonie‹ ein Verhältnis, in dem ein partikularer Inhalt in einem bestimmten Kontext die Funktion übernimmt, eine abwesende Fülle zu inkarnieren.«8 Das kann z. B. die Nation, der Sozialismus oder die Vielfalt sein. Der christliche Glauben kann in ein Verhältnis zu diesen Größen gesetzt werden. Aber grundsätzlich gesehen geht es hier um einen konstitutiven Mangel, der alle funktionalen Äquivalente relativiert: die Erfahrung der Endlichkeit. »Endlichkeit beinhaltet die Erfahrung der Fülle, des Erhabenen, in Form eines radikalen Mangels – und in diesem Sinne ein notwendiges Jenseits. [. ..] Das Objekt, das ultimative Fülle erzeugen könnte, ist das Jenseits, von dem der Mystiker eine direkte Erfahrung zu haben behauptet.«9 Laclau selbst bestreitet die Triftigkeit dieser Erfahrung natürlich und damit den Kontakt zur Gottheit als notwendiger Voraussetzung ernsthaften moralischen Handelns. Was die »richtigen inkarnierenden Inhalte« anbetrifft, so seien wir mit Sicherheit völlig führungslos.10 Genau hier zweigt der Diskurs der christlichen Sozialethik ab.11
Die These der lebendigen, triangulären Beziehung bildet die Grundlage dieses Buches, auf welcher der Sinn der zusammengestellten Texte aufbaut. Dabei wird sie im Einzelnen nicht immer wieder expliziert. Vielmehr stellen die Texte in der hier vorgelegten Reihenfolge einen sozialethischen Entwicklungsgang dar, der seinen »Höhepunkt« in dem abgedruckten Text über die Fiktion eines Kraftfeldes des Geistes findet. Wer folglich schnell den Sinn des Ganzen identifizieren will, der mag mit diesem Text die Lektüre beginnen. Die Texte zum Sozialen, zur Wirtschaft und zur Politik sind umrahmt von einem Vortrag zur Frage, was denn heute unter Gerechtigkeit zu begreifen sei, und einer soziotheologischen Analyse zur Frage der Gewalt als einer alltäglichen Ressource. Sie beschreiben in der Gegenüberstellung das gewaltige Spannungsfeld, das sich sozialethisch immer wieder auftut. Keinesfalls sind sie Gegensätze!
Die Texte sind während meiner Tätigkeit als Direktor des sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD in Hannover entstanden und entstammen vielfältigen Diskussionen aus diesem Zusammenhang. Meist gehen sie auf konkrete Anlässe, wie bspw. auf Vortragsanfragen, zurück. Mein Dank gilt dementsprechend all denen, die mir Gelegenheit zur Darstellung meiner Gedanken gegeben haben, und dem Team des Instituts, das viele der Ideen diskutiert und verbessert hat.
Gerechtigkeit1
»Die Welt ist in ihrem Kern eine Gemeinschaft von Schöpfer und Erschaffenen. Und sie hat ihren Ursprung in Gott.« John Rawls 1942
Eine Verständigung über Gerechtigkeit steht am Beginn jedes gesellschaftlichen Zusammenlebens. In einer Demokratie befindet sich diese Verständigung permanent im Fluss. Nichts kann Menschen mehr erregen, als wenn sie das Gefühl haben, ungerecht behandelt zu werden. So waren die letzten Jahre und Jahrzehnte in Deutschland immer wieder von Gerechtigkeitsfragen bestimmt. Insbesondere das Thema »Armut als Beeinträchtigung von Gerechtigkeit« – bzw. allgemeiner: der Zusammenhang von sozialer Ungleichheit und Gerechtigkeit –, und die Frage der Zuwanderung von geflüchteten Menschen nach Deutschland haben uns alle umgetrieben und nicht zuletzt die Bundestagswahlen 2017 bestimmt. Zudem ist nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa das Phänomen des Rechtspopulismus prominent geworden, von dem her sich noch einmal neue und bisher unbekannte Gerechtigkeitsfragen stellen.
In diesem Zusammenhang lohnt es sich, nach den Grundlagen unseres Gerechtigkeitsverständnisses zu fragen. Dabei wird schnell deutlich, dass so etwas nicht im luftleeren Raum geschehen kann, sondern immer grundlegende weltanschauliche – und in unserem Fall konfessionelle bzw. religiös christliche – Grundentscheidungen impliziert. Deswegen geht es im Folgenden betont um ein christliches, ja in gewisser Hinsicht sogar um ein protestantisches Verständnis von Gerechtigkeit. Solch ein Verständnis muss der gesamten Gesellschaft, armen und reichen Menschen, ein möglichst plausibles Deutungsangebot ihrer Situation liefern. Dabei ist aber von vornherein davon auszugehen, dass nicht alle Menschen dieses Verständnis teilen werden, da sie von anderen Grundverständnissen ausgehen. Dennoch muss es so dargestellt werden, dass es in seinen Grundlagen und seinen Folgerungen nachvollziehbar ist. Das Ziel muss daher sein, dass auch Menschen, die mit dem christlichen Glauben oder mit Religion überhaupt nichts zu tun haben, prinzipiell verstehen können, worum es den Christen geht – damit sie gegebenenfalls mit ihnen zusammenarbeiten können. Dabei liegt von vornherein deutlich auf der Hand, dass in diesem Zusammenhang Armut ein ganz zentrales Thema ist, da Armut immer einen Verstoß gegen elementare Gerechtigkeitsmaximen darstellt. Aber Armut ist nicht das einzige Thema eines Gerechtigkeitsverständnisses.
Womit also beginnen? Nicht nur weil wir im Jahr 2017 500 Jahre Reformation gefeiert haben, sondern weil es sachlich angemessen ist, lässt sich sehr gut mit Aussagen von Martin Luther starten. Am Anfang seiner theologischen Wirkung steht die Entdeckung der Zurechnung der Gerechtigkeit Gottes auf den Menschen. Gott macht den Menschen gerecht – nicht die Menschen sich selbst. Von dieser Zurechnung her lebt der Mensch; er kann ihr nichts durch eigene Leistungen hinzufügen und bleibt deswegen ein Leben lang von Gottes Gnade und Vergebung zu seinem Heil und Wohl abhängig. Die letztendliche Gerechtigkeit kann folglich nur Gott selbst verwirklichen – Menschen können sie nicht schaffen und sollten dies auch gar nicht anstreben. Dennoch sind Menschen diejenigen, die eben damit beauftragt und gewürdigt sind, Zeichen der Liebe Gottes in der Welt zu setzen. Weil sie von Gott im Glauben von der Sorge um ihr eigenes Heil fundamental befreit sind, können Sie sich den anderen Menschen und der ganzen Schöpfung vorbehaltlos zuwenden. In dieser Zuwendung in Liebe zu den anderen Menschen sind Menschen, mit Luther gesprochen, gleichsam ein Gefäß, durch das die Liebe Gottes den Mitmenschen zufließt und der Mensch sozusagen zum Gott für andere wird. »Siehe, das sind dann recht gottförmige Menschen, welche von Gott empfangen alles, was er hat, in Christo, und wiederum sich auch, als wären sie der anderen Gott, Wohltaten erweisen.«2 Auf dieses Grundverständnis der menschlichen Existenz zu rekurrieren, ist deswegen wichtig, weil hieran deutlich wird, dass jeder Mensch in eben diesen christlichen Grunderkenntnissen eine göttliche Bestimmung hat. Und ausgesprochen spannend ist zu sehen, dass diese Bestimmung von Luther in der Dialektik von Berufung und Beruf bzw. in seinem Arbeitsverständnis weiter präzisiert wird.
Anders gesagt: Am Beginn eines christlichen Diskurses über das Thema Gerechtigkeit steht die Berufung des Einzelnen in einen Beruf bzw. die Berufung zur Arbeit und damit die von Gott her kommende Einweisung der Menschen in eine Rolle und einen Platz in der Gesellschaft. Gott beruft einen jeden und eine jede in den Dienst am Nächsten: Das ist der Kern einer gerechten Gesellschaft aus christlicher Sicht. Jeder und Jede gehört dazu; jeder kann etwas beitragen; keiner kann alles. Nun kann man an dieser Stelle lange weiter über Luthers Berufsverständnis nachdenken und ihm Engführungen in seiner Sakralisierung der damaligen Ständegesellschaft durch den Berufungsgedanken nachweisen. Interessanter ist es aber, diesen Gedanken von der Berufung eines jeden Einzelnen zum konstitutiven Ausgangspunkt der Gerechtigkeit zu machen. Wenn jeder Mensch eine transzendentale, von Gott herkommende Beauftragung hat, dann ist es die logische Aufgabe einer jeden Gesellschaft, dieser Beauftragung gerecht zu werden. Das bedeutet nun nichts anderes, als eine christliche Fundamentalanforderung an eine gerechte Gesellschaft formulieren zu können: Gerecht ist eine Gesellschaft (oder eine Gemeinschaft, eine Organisation oder welche Sozialform auch immer) immer dann, wenn in ihr jeder Mensch seiner Bestimmung gemäß leben kann oder anders gesagt: wo jeder gemäß seiner Berufung den anderen zum Christus werden kann. Genau in dieser Möglichkeit besteht christliche Freiheit. »Selbstverwirklichung« ist in dieser Sichtweise die Verwirklichung des Christus als meines Selbst in der Gesellschaft. Und andersherum und auch viel säkularer gesagt, ist damit auf einer ganz fundamentalen Ebene die freie Entfaltung aller in Teilhabe an der Gesellschaft als Grundelement von Gerechtigkeit definiert.
Überträgt man dieses Verständnis auf die grundlegenden Regelungen der deutschen Gesellschaft, so wird schnell deutlich, dass es der Art. 2 des Grundgesetzes ist, auf den es hier ganz besonders ankommt: Das Grundgesetz der Bundesrepublik garantiert die freie Entfaltung eines jeden Menschen, und genau daran muss ein christliches Gerechtigkeitsverständnis von der erwähnten Grundhaltung her ein elementares Interesse haben. Die Würde des Menschen aus Art.1 des Grundgesetzes realisiert sich fundamental in dieser freien Entfaltungsmöglichkeit. Wie ein jeder sich dann entfaltet, unterliegt seinen jeweiligen Entscheidungen bzw. seinen weltanschaulichen Bindungen und ist deswegen notwendigerweise plural. Aber dass die Chance bestehen muss, seiner eigenen Bestimmung zu folgen bzw. die einem selbst einleuchtende Berufung auch ausleben zu können, ist für ein christliches Gerechtigkeitsverständnis von schlichtweg entscheidender Bedeutung. (Und es wird bereits an dieser Stelle deutlich, dass Armut als Beeinträchtigung eigener Selbstentfaltung einen elementaren Störfaktor solcher Gerechtigkeit darstellt.) Ganz grundsätzlich gesagt, sind in der modernen Gesellschaft die Möglichkeiten, sich selbst zu entfalten, förmlich explodiert. Jede Einschränkung dieser Möglichkeiten wird deswegen zu Recht als Beeinträchtigung von Gerechtigkeit und damit als legitimationsbedürftig verstanden, und ein völliger Ausschluss aus der Gesellschaft gilt in jedem Fall als ungerecht und darf nicht sein. Als Voraussetzung dafür ist das Recht auf die Sicherung des Existenznotwendigen (wozu auch ein Anspruch auf Teilhabe gehört) in den modernen Staaten, insbesondere auch in Deutschland, fest verankert, wenn auch in der genauen Ausgestaltung immer wieder umkämpft.
In Hinsicht auf ein reformiertes Verständnis von Berufung erscheint die Engführung der deutschen Gerechtigkeitsdiskussion, nämlich das ganz schnelle Abheben auf die Beteiligung aller an bezahlter Erwerbsarbeit, problematisch. Denn es ist ja deutlich, dass die Entfaltung der eigenen Bestimmung und Berufung, auch dann, wenn man sie von vornherein als Dienst am Nächsten und damit prinzipiell gemeinwohlorientiert versteht, zunächst einmal im Miteinander der Gemeinschaftsformen des Lebens vollzogen wird. Sie realisiert sich ganz elementar in der Weitergabe des Lebens: in der Sorge für und in der Erziehung von Kindern sowie ebenso in der Pflege Anderer und insbesondere der Älteren. Also dort, wo der Mensch, wenn man so sagen kann, überhaupt erst einmal zum Menschen wird – und dann dort, wo seine Menschlichkeit besonders gefordert ist. So sehr also Berufung natürlich mit Beruf verknüpft bleibt, so stark muss doch immer wieder daran erinnert werden, dass sich die Gerechtigkeit einer Gesellschaft nicht in der Privilegierung von Tätigkeiten bezahlter Erwerbsarbeit und schon gar nicht von entsprechenden Tätigkeiten in der Sachgutproduktion realisiert, sondern in der dem allen vorgeordneten und das alles erst ermöglichenden prinzipiellen Koproduktion der Menschen miteinander. Und es liegt auf der Hand, dass an dieser Stelle, weit über die Reformatoren hinaus, auch die Koexistenz mit der Natur bzw. den natürlichen Lebensgrundlagen in der Schöpfung Gottes benannt werden muss. Meine Berufung erfolgt in der Schöpfung Gottes – nicht gegen sie.
Es muss aber auch betont werden, dass das Recht auf Selbstentfaltung, gerade im Sinne eines reformatorischen Berufungsverständnisses, nichts mit einem Recht auf Passivität zu tun hat. Es impliziert eine Pflicht zum Einbringen der eigenen Fähigkeiten in die gesellschaftliche Kooperation und nötigt jeden, seinen – wiewohl unterschiedlichen – Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Wer sich dem, ohne dazu gezwungen zu sein, entzieht, schließt sich selbst aus der Gesellschaft aus und verleugnet damit gleichzeitig seine Berufung. Selbstentfaltung ist nur dann produktiv, wenn sie in Reziprozität, in Gegenseitigkeit und Kooperation, erfolgt. Dem kann man sich nicht entziehen – und faktisch ist es diese, nicht immer bequeme Nötigung zur Gegenseitigkeit, die auch die Gesellschaft integriert. Das bedeutet, dass zum Leitbild einer gerechten Gesellschaft ein Menschenbild gehört, dass die beständige Sorge für die eigene Unterhaltung, bzw. für den Kreis der Anvertrauten beinhaltet. Anders gesagt: In der Erfahrung, für sich selbst durch den Dienst an anderen sorgen zu können, realisiert sich christliche Existenzerfahrung (und wird möglicherweise der Segen Gottes erfahren).
Im Hintergrund dieser Überlegung steht eine wichtige Neuinterpretation des Berufungsverständnisses. Niemand kann die reformatorisch noch vollzogene statische Verknüpfung von Berufung und Beruf heute noch ernsthaft vertreten. Berufung kann heute natürlich nicht mehr bedeuten, ein Leben lang in einem spezifischen Beruf arbeiten zu müssen. Es kann geradezu so sein, dass die Suche nach einem der eigenen Berufung kompatiblen Beruf einen ganzen Lebenslauf prägt. Deswegen lässt sich heute sinnvoll unter Berufung nur Berufung der je einzelnen Menschen als solchen verstehen. Dieses Verständnis entspricht ganz wunderbar dem wunderschönen Satz von Eberhard Jüngel: »Ich bin mit mir selbst beschenkt.«3 Und ich erlebe die Gesellschaft als umso gerechter, je mehr ich von diesem Geschenk meiner selbst an andere weitergeben kann. In einer gewissen Hinsicht ist schon an dieser Stelle die Vorstellung von einer in der Moderne vorhandenen Sakralisierung der Person impliziert.4 Die Gesellschaft soll sich in der Tat um die einzelnen Menschen drehen, die sich gegenseitig in ihrer Einzigartigkeit anerkennen.
Darin, in der Anerkenntnis ihrer je eigenen Berufung, sind sich alle Menschen gleich – auch wenn sie ansonsten völlig verschieden sind. Und das sind sie in der Tat! Gerecht ist es gerade nicht, alle Menschen gleich zu machen und sie gleich zu behandeln. Das wäre geradezu ungerecht, denn dann könnten sich die unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten der Menschen nicht zum Wohle aller entfalten. Vielmehr geht es darum, jedem Menschen das zukommen zu lassen, was er braucht, um sich zu entfalten. In diesem Rechtsanspruch sind alle gleich! Das kann beispielsweise bedeuten, Hochbegabte besonders zu fördern oder eben auch Menschen in benachteiligten Verhältnissen oder Menschen mit Behinderungen ganz besondere – überproportional große, kompensatorische – Förderungen zukommen zu lassen. Sonst kommt es zur Entwicklung von Armut – und zwar selbst dann, wenn es rein äußerlich-materiell vielleicht gar nicht zu merken ist. Denn Armut in einem christlich umfassenden Sinn besteht in der Beeinträchtigung, seine eigene Bestimmung realisieren zu können. Sie weist eine zutiefst geistliche Dimension auf. Sie liegt also nicht nur darin, zu wenig zum Leben zu haben, sondern sich nicht umfassend in die Gesellschaft einbringen zu können (bzw.: nicht anderen zum Christus werden zu können). Es geht folglich um eine »differenzierte Gleichheit« in der Gesellschaft, in der einige, denen viel gegeben ist, auch selbst befähigt werden, viel zu geben, damit allen Gerechtigkeit widerfahren kann. Das Maß der Ungleichheit in einer solchen Gesellschaft wäre dann i. S. von John Rawls tatsächlich die Lage der Armen:5 Solange Ungleichheit dazu nötig ist, gesellschaftlichen Reichtum zu schaffen, der dann über Transfers und Umverteilungen des gesellschaftlichen Vermögens die Situation der Armen verbessert, wäre sie gerechtfertigt. Damit ist ein Maßstab auch für die Beurteilung der Situation in Deutschland geschaffen, an dem gemessen manche Bereiche (z. B. die Vermögensverteilung oder auch die Besteuerung des Erbes) als ungerecht erscheinen.
Hier lässt sich nun sofort an Fragen der Gestaltung der Wirtschaft anknüpfen, die als grundlegende, strukturprägende Kraft einer jeden Gesellschaft von fundamentaler Bedeutung ist. Obwohl viele Debatten immer wieder dahin tendieren, kann sie in der Perspektive christlicher Berufungsgerechtigkeit nicht als ethikfreier Raum gesehen werden, denn sie stellt ja gerade ihren entscheidenden Verwirklichungsbereich dar: Im Beruf, auf der Arbeit verwirklicht sich meine Berufung. Und das erfahren ja auch die Menschen – im Positiven wie im Negativen – genau so. Bei allen gesundheitlichen Gefährdungen, die heute im Beruf auftreten können, gilt doch immer noch, dass die mit Abstand größte Gefährdung des eigenen Wohlbefindens der Verlust des Arbeitsplatzes ist. Das aber bedeutet, dass Ökonomik eine Disziplin praktischer Ethik darstellt – was zum Glück auch heute wieder häufiger so gesehen wird. Dem folgend gilt z. B., dass Eigentum, insbesondere an Unternehmen und damit letztlich die Unternehmen selbst, stets nur ethisch verantwortlich und d. h. eigentlich treuhänderisch für die Beschäftigten – man könnte sogar sagen: für Gott – genutzt werden darf. Gerade besonders große und die ganze Ökonomie dominierende Unternehmen unterliegen sozusagen einer Lizenz der Gesellschaft, die folglich auch entzogen werden kann. Die Möglichkeit der Entfaltung einer unternehmerischen Berufung, was für die wirtschaftliche Entwicklung einer jeden Gesellschaft von entscheidender Bedeutung ist, sollte nicht mit einem Recht auf willkürliche Reichtumsaneignung gleichgesetzt werden. In diesem Zusammenhang lässt sich auch etwas zum Thema des Wettbewerbs sagen. Wettbewerb kann Kooperation und damit die Entfaltung von Fähigkeiten beeinträchtigen – und das ist nicht gerade selten der Fall. Es kann aber auch sein, dass sich in einem fairen Wettbewerb herausstellt, welcher Mensch oder welches Unternehmen etwas am besten leisten kann. Dann liegt es nahe, dass dieser bzw. dieses auch jene Leistungen erbringt, da es am Besten für alle ist.
Aber nun gilt es natürlich, in den Überlegungen hinsichtlich einer gerechten Gesellschaft auch noch – sozusagen ordnungspolitisch – weiter zu gehen. Wie muss eine Gesellschaft aufgebaut sein, dass sie tatsächlich die freie Entfaltung der Menschen gewährleisten kann? Man kann in dieser Hinsicht ganz elementar lebenslaufbezogen argumentieren und zumindest vier, wenn nicht fünf Ebenen oder auch Sphären unterscheiden: (a) die Ebene der frühen Sozialisation der Menschen in der Familie, (b) die Ebene von Ausbildung und Bildung, (c) die Ebene der Teilhabe an Arbeit und Wirtschaft, (d) der Bereich des eigenen Engagements bzw. der Zivilgesellschaft, (e) und schließlich in gewisser Hinsicht alles übergreifend die Gewährleistung von Sicherheit. Jeder Mensch durchläuft in seinem Leben diese Ebenen und Sphären und erlebt in ihnen entweder positiv fördernde und herausfordernde Situationen, was die eigenen Fähigkeiten anbetrifft, oder aber einschränkende und hindernde Bedingungen. Wie müssen diese Bereiche gerecht gestaltet sein? Generell gesagt so, dass Menschen ihre Fähigkeiten entdecken, entwickeln und entfalten können – und genau so letztlich für sich selbst sorgen und zum Wohl des Ganzen beitragen können.
Das kann nun im Einzelnen – in aller Kürze zusammengefasst – Folgendes bedeuten:
a)Familie: In den ersten Lebensbezügen eines jeden Menschen – in der Familie, verstanden in einem weiten Sinne – werden entscheidende Weichen für seine Entwicklung gestellt. Bereits die früheste Entwicklung im Leben ist durch die Qualität der Begegnungen mit Eltern und anderen, durch Reziprozität und Responsitivität geprägt. Resilienz und Selbstwirksamkeit entwickeln sich hier. Die frühe Erfahrung von Fürsorge hat elementar mit der Ausbildung eigener Fähigkeiten zur Sorge für andere und zu Solidarität zu tun. Familie ist die Schule der Gemeinschaft. Oder, wie es Axel Honneth einmal ausgedrückt hat: Man hilft sich in einer Familie »reziprok darin, derjenige sein zu können, als der man sich aufgrund der eigenen Individualität in der Gesellschaft verwirklichen können möchte.«6 Sie ist der Ort der primären Entdeckung der eigenen Berufung. Und deutlich wird nun auch, wie durchschlagend ungerecht Armut an dieser Stelle ist. Sie verhindert nicht nur etwas am Rande, sondern zerstört ganze Lebenswege gleich zu Beginn. Kinderarmut ist deswegen die schlimmste Armut.
b)Bildung: Im weiteren Verlauf des Lebens hängt dann alles davon ab, ob die Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen in der Lage sind, den jungen Menschen zu helfen, ihre je eigenen Bestimmungen zu erkennen und entsprechende Fähigkeiten auszubilden. Dabei geht es nicht darum, alle über einen Leisten zu schlagen, sondern differenziert zu fördern, wie oben bereits gesagt. Eine solche Förderung muss allerdings auch wirklich allen zukommen können, was z. B. bedeutet, dass Kinder aus sozial schwächeren Kontexten (und natürlich Kinder mit Behinderungen) mehr Förderung bekommen als andere – was sicherlich nicht immer einfach zu realisieren ist. Wir wissen allerdings, dass genau dies im deutschen Bildungssystem nicht wirklich funktioniert. Es tendiert nach wie vor dahin, »gute« Voraussetzungen der Kinder noch einmal mit guten Schulabschlüssen zusätzlich zu legitimieren und umgekehrt. Kinderarmut kann so direkt zur Bildungsarmut führen. Nicht erst die Erfahrung von direkter Benachteiligung, sondern bereits von vorenthaltener Unterstützung in der Entwicklung eigener Fähigkeiten ist ein Problem.
c)Arbeit und Wirtschaft: Schließlich kennzeichnet eine gerechte Gesellschaft die Möglichkeit, seinen »Beruf« auch in der Welt von Wirtschaft und Arbeit realisieren zu können. Das bedeutet die Möglichkeit zu haben, sich selbst in die Welt der produktiven Kooperation einbringen zu können und dafür Anerkennung – in Form eines bezahlten Arbeitsplatzes – zu erhalten. Wohlgemerkt: Es geht um einen Beruf, nicht um irgendeine Arbeit. Nicht, dass alle irgendeine Arbeit haben, macht eine Gesellschaft letztlich gerecht (wiewohl das natürlich besser sein kann als hohe Arbeitslosigkeit), sondern dass Menschen über einen Beruf verfügen, in dem sie sich selbst einbringen. Dieses Kriterium gilt gerade und besonders für »einfache« Berufe (die meistens gar nicht so »einfach« sind). Straßenkehrer und Reinigungskräfte sind nicht weniger wertvoll als andere. Das muss Folgen haben für eine bessere Regulierung der Arbeitsbedingungen im Bereich des Niedriglohnes und prekärer Beschäftigung. Und schließlich hat dies auch mit einer sinnvollen Gestaltung von Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenbetreuung zu tun. Sie muss als ein Service von hoher fachlicher und menschlicher Qualität organisiert sein, dem man sich im Fall des Falles gerne anvertraut.
d)Zivilgesellschaft: Unter Zivilgesellschaft verstehen wir den Bereich des Engagements der Menschen – über Familie und Arbeit hinaus. Viele engagieren sich hier und tragen so zu einer Gesellschaft bei, die sich selbst steuert – über den privaten Bereich hinaus. Gerade im Bereich des zivilgesellschaftlichen Engagements verwirklichen sich viele Berufungen und deswegen sollte er auch vielen offen stehen. Eine Kultur der Teilhabe hat mit seiner Gestaltung elementar zu tun. Daher ist es problematisch, wenn Engagement stark von Einkommen und Bildung abhängt – und gerade von Armut bedrohte Menschen nur schwer den Zugang finden. Gerade an dieser Stelle sind Kirche und Diakonie besonders gefordert, nicht nur für Arme da zu sein, sondern mit ihnen.
e)Sicherheit: Es liegt auf der Hand, welch große Bedeutung die Gewährleistung von Sicherheit für Möglichkeiten der Selbstentfaltung hat. Wo Angst vor Sozialverlust oder vor Bedrohungen anderer Art (Kriminalität, Gewalt) regiert, können Menschen sich nicht wirklich entfalten – und sozial Schwächere schon gar nicht. Unsicherheit und mangelhafte »Ordnung« trifft deswegen vor allem Letztere – während sich Wohlhabendere irgendwie immer auf die sichere Seite bringen können. Von großer Bedeutung ist daher ein Sozialstaat, der differenziert auf Problemlagen eingehen kann, Menschen in der Not absichert und ihnen auch wieder aus der Not heraus verhilft; und daneben auch ein Rechtsstaat, der für Alltagssicherheit sorgt sowie symbolisch und real das Gefühl vermittelt, in sicheren Grenzen zu leben – angesichts einer vermeintlich immer unsichereren und gefährlicheren Umwelt.
Und was ist, wenn diese Umwelt plötzlich neben uns steht, wenn Flüchtlinge in großen Zahlen zu uns kommen? Dann zeigt sich, wie tragfähig die Gerechtigkeit eines Landes tatsächlich ist. Sie bemisst sich nicht daran, dass man möglichst viele Flüchtlinge aufnimmt, sondern daran, dass man vernünftig und in gegenseitiger Anerkennung darüber reden kann, wie viele es denn sein können, ohne das Land – und gerade dessen Schwächste – zu bedrohen. Das bedeutet, die Sorgen und Ängste der Menschen in solchen Situationen ebenso ernst zu nehmen, wie das große Engagement ganz vieler gegen Not und Elend in weltweiter Perspektive.
Was folgt aus alldem? Gerechtigkeit wird dort erfahren, wo Menschen sich entfalten können und in ihrer Unterschiedlichkeit miteinander kooperieren. Wo das möglich ist, kann – und wird auch – Wohlstand entstehen, da er letztlich aus eben diesen Potenzialen der Menschen erwächst. Damit ist nicht nur materieller Wohlstand gemeint, sondern so etwas wie eine Optimierung des Menschlichen als solchem. Deswegen ist eine gerechte Gesellschaft eine zutiefst menschliche Gesellschaft. Christlich-religiös ist es eine, in der Menschen ihre Berufung entdecken, entwickeln und einbringen können, und so – in der Sprache unseres Glaubens – einander zum Christus werden können.
All dies kommt in einem durchaus pathetischen, aber darin auch sehr leuchtenden Satz von Martin Luther King zum Ausdruck, mit dem ich enden will:
»Wenn Sie dazu berufen sind, Straßen zu kehren, dann kehren Sie sie, wie Michelangelo Bilder malte oder Beethoven Musik komponierte oder Shakespeare dichtete. Kehren Sie die Straße so gut, dass alle im Himmel und auf Erden sagen: ›Hier lebte ein großartiger Straßenkehrer, der seine Arbeit gut gemacht hat.‹«
Zum Sozialstaat
Vom Charisma zum Stigma
Armutsbewältigung und Diakonie aus christlicher Sicht1
Seit 2000 Jahren gehört die Auseinandersetzung mit der Armut zur Geschichte und zum Selbstverständnis des Christentums in all seinen Ausprägungen und Facetten elementar dazu.2 Es gibt keine christliche Konfession, die nicht ihre eigenen Wege zur Anerkennung der Armen, zur Armutsbewältigung oder gar zur Ausgestaltung von Wohlfahrtskulturen entwickelt hätte. Allerdings: Die Armut auszurotten, ist dem Christentum in seinen 2000 Jahren nicht gelungen und man muss zugestehen, dass dieses Ziel auch nur sehr begrenzt in einigen Teilbereichen des Christentums wirklich ernsthaft angestrebt worden ist. Man hat zu solchen radikalen Lösungen kaum eine Möglichkeit gesehen und sich deswegen in der einen oder anderen Weise auf ein Leben mit Armut und mit den Armen eingestellt.
Die Wege des Umgangs mit Armut sind ausgesprochen verschieden; sie können sogar gegenläufig sein. So finden sich z. B. auf der einen Seite eine ganze Reihe von symbolischen Anerkennungsformen der Armen im christlichen Kosmos – auf der anderen Seite aber ebenso viele reale Handlungsformen der Bekämpfung von Armut und der Hilfe für Arme in ihren schwierigen Lebenssituationen.3
Dabei hat es eine entscheidende historische Entwicklungsrichtung gegeben: und zwar von einer betonten charismatischen Anerkennung der Armut und der Armen, wie sie im Mittelalter und insbesondere durch die großen Heiligen, allen voran Franz von Assisi, gepflegt worden ist, hin zur negativen Stigmatisierung von Armut als etwas, was die Gesellschaft konkret belastet und was es deswegen eigentlich nicht geben sollte. Zwischen diesen beiden sehr unterschiedlichen, ja bisweilen gegenteiligen Optionen bewegen sich im Grunde alle christlichen Armutsoptionen.
Im Folgenden werden zwei Wege beschritten, um das Spektrum der christlichen Option in Richtung Armut zu entfalten:
–Zunächst werden einige historische Akzente gesetzt.
–Dann werden systematisch die verschiedenen Wohlfahrtskulturen und Wohlfahrtsregime im christlichen Bereich dargestellt.
Der historische Zugang4
Ein erster Höhepunkt der Auseinandersetzung mit der damals ständig wachsenden Zahl von Armen und der Armut allgemein findet sich im Christentum in den Zeiten des Hochmittelalters mit dem Auftritt des Franziskus von Assisi, der sich als Armer inszenierte und die Solidarität mit den Armen lebte. In ihm verdichtet sich exemplarisch die Gestalt der charismatischen Identifikation mit den Armen. Ihnen wird im mittelalterlichen Christentum ein positives Stigma zugerechnet; sie sind die von Gott eigentlich geliebten Menschen, und die Kirche ist eigentlich nichts weiter als der Schatz dieser Armen. Auf der symbolischen Ebene wird somit eine enorme Identifikation der herrschenden Institution der Kirche mit den Armen vollzogen. Entsprechend wird ihnen vielfach Respekt entgegengebracht und es wird vor allen Dingen eine umfangreiche und durchorganisierte Praxis der Almosen entwickelt, die mit Stiftungen, der Gründungen von Hospizen und vielem anderen in Befolgung der großen Barmherzigkeitsermahnungen der Bibel einhergeht.
In der Ikonografie des Mittelalters spielt das Gleichnis vom großen Weltgericht, Matthäus 25, mit den Werken der Barmherzigkeit eine ganz entscheidende Rolle. Nur wer sich der Armen annimmt und ihnen Almosen zukommen lässt, hat deswegen ein Anrecht auf (himmlische) Anerkennung und sollte daher auch unter den Menschen Anerkennung finden. Reichtum erscheint in der neutestamentlichen Tradition eher als problematisch. Die Reichen können ihre Seele nur durch Almosen für die Armen retten, die dann wiederum dazu angehalten werden, für die Seele der Reichen zu beten. Symbolisch und im Blick auf die Almosen, wird also die gesellschaftliche Hierarchie christlich religiös auf den Kopf gestellt.
Arme haben in dieser Hinsicht einen Platz, aber es gibt keinerlei Idee und auch kein aktives Bestreben, Armut insgesamt zu beseitigen. Ja, man kann sogar davon sprechen, dass die religiöse Gesellschaft des Mittelalters die Armen braucht, weil sie sozusagen die Basis der gesamten Barmherzigkeits- und Heilsordnung des Christentums darstellen. Überträgt man diese Situation etwas flapsig auf moderne Diskussionen, so ließe sich fast davon sprechen, dass in dieser mittelalterlich christlichen Tradition so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen für die Armen verwirklicht worden ist: Sie erhalten im Prinzip Almosen, ohne dafür etwas als Gegenleistung erbringen zu müssen.
Tatsächlich bedeutet dies natürlich nicht, dass sich die gesamte Gesellschaft nun auf das Almosengeben für die Armen ausgerichtet hätte. Vielmehr entwickeln sich im Mittelalter auch große Unternehmen und es kommt zur Geburt des Frühkapitalismus, dessen Akquisitionspraxis deutlich mit einer umfassenden Identifikation mit den Armen kollidiert. Entsprechende Konflikte lassen sich auch in der Geschichte des Franziskus von Assisi selbst nachvollziehen. Und die Kirche findet natürlich ihren Weg, auch die Reichen zu segnen. Insgesamt aber bilden die symbolische Anerkennung der Armen und die reale Praxis des Almosengebens ein insgesamt jahrhundertelang relativ stabiles Gefüge der Gesellschaft, bei einem ständig wachsenden Anteil der Armen. Die Almosenpraxis ist insgesamt ausgesprochen eindrucksvoll und wird in der großen Studie von Michel Mollat über Armut im Mittelalter breit dargestellt.5
Zum Einschnitt kommt es nach herkömmlicher Historiografie mit der Reformation: Nun kommt es in den protestantisch geprägten Ländern zu einer neuen Haltung gegenüber der Armut, die nicht mehr positiv stigmatisiert oder gar charismatisch eingerahmt wird, sondern im Prinzip nur noch negativ adressiert ist. Das Stigma kehrt sich um. Luther und Calvin und die anderen Reformatoren argumentieren deutlich antifranziskanisch, bis dahin, dass Luther selbst die sich für die Armen engagierenden Bruderschaften in Wittenberg auflöst.
Allerdings ist der Einschnitt nicht allein Anfang des 16. Jahrhunderts in den reformatorischen Aktionen zu verorten. Schon viel früher und umfangreicher kommt es zu Entwicklungen negativer Sichtweisen auf die Armen, vor allem in den großen florierenden Städten mit ihren unternehmerischen Aufbrüchen. Die humanistischen Bestrebungen im Vor- und Umfeld der Reformation artikulieren vielfach die Pflicht, zu arbeiten und sich selbst der gesellschaftlichen Kooperation nicht zu entziehen. In der Reformation artikuliert man diese Vorstellung dann in der lutherischen Umformung der Berufung, die ursprünglich nur den gesellschaftlichen Hierarchien bzw. den Geistlichen galt, auf grundsätzlich alle Tätigkeiten in der Gesellschaft. Die Menschen sollen ihre Berufung, d. h. ihre Einführung in einen gesellschaftlichen Stand, erkennen und sich entsprechend ihrer Arbeit in Kooperation mit anderen betätigen.
Als Beruf ist Arbeit die Betätigung für andere und aus diesen Gedanken erwächst ein Gesellschaftsmodell, das prinzipiell ohne Arme auskommen kann, denn jeder ist verpflichtet, sich mit seinen Fähigkeiten für andere einzusetzen. Ein Entzug aus dieser Kooperationsgemeinschaft gilt als Sünde und soll eigentlich nicht sein. Dementsprechend erfolgt nun ein sehr viel dringlicherer Zugriff auf die Armen, es entstehen Arbeitshäuser. Entsprechend eingeschränkt wird nun das Almosengeben betrachtet, da es nicht mehr als ein gutes Werk den eigenen Platz im Himmel sichert, sondern nur noch als eine Folge der eigenen Rechtfertigung und dem entsprechend als völlig freiwillige Gabe betrachtet werden kann. Armutsbekämpfung und Armutsversorgung wird so immer deutlicher eine Sache der Kommunen und des Staates bzw. der Staatskirche, die sich auf vielen Ebenen der Armen annimmt. Ob es den Armen nach der Reformation tatsächlich besser gegangen ist als vorher, lässt sich jedoch füglich bezweifeln. In dieser Hinsicht hat schon der große Chronograf der christlichen Diakonie Gerhard Uhlhorn Ende des 19. Jahrhunderts seine Skepsis angemeldet.6 Armut wird besser erfasst und besser verwaltet, aber das Niveau der Armutsversorgung wird nicht unbedingt angehoben.
Gleichwohl verbindet sich mit der Reformation trotz dieser belegbaren Brüche bis heute die Vorstellung einer veränderten Haltung der Menschen zur Arbeit und zum Beruf. Besonders prägnant ist dies von Hegel in seiner »Geschichte der Philosophie« mit folgenden Worten zusammengefasst worden: »Die Arbeitslosigkeit hat nun auch nicht mehr als ein Heiliges gegolten, sondern es wurde als das Höhere angesehen, daß der Mensch in der Abhängigkeit durch Tätigkeit und Verstand und Fleiß sich selber unabhängig macht. Es ist rechtschaffener, daß, wer Geld hat, kauft, wenn auch für überflüssige Bedürfnisse, statt es an Faulenzer und Bettler zu verschenken; denn er gibt es an eine gleiche Anzahl von Menschen, und die Bedingung ist wenigstens, daß sie tätig gearbeitet haben. Die Industrie, die Gewerbe sind nunmehr sittlich geworden, und die Hindernisse sind verschwunden, die ihnen von seiten der Kirche entgegengesetzt wurden.«7
Geht man in der Geschichte des Christentums weiter, so wird im Rückblick aus dem 20. oder auch dem späten 19. Jahrhundert deutlich, dass diese reformatorischen Entwicklungen der Beginn auf dem Weg zum modernen Sozialstaat gewesen sind, in dem die Verwaltung und Aktivierung der Armen immer deutlicher zur Sache des Staates erklärt wird. Und in genau dieser Hinsicht ist die Entwicklung in Deutschland, ausgehend von den staatspolitischen Lehren in der lutherischen Tradition bis hin zur Begründung des bismarckschen Sozialstaates Ende des 19. Jahrhunderts, eine exemplarische Entwicklungsgeschichte.
In ihren Reaktionen auf den aufstrebenden Kapitalismus und das mit ihm verbundene Elend der Proletarier gehen die Konfessionen im Umgang mit der Armut unterschiedliche Wege:
–Es entwickeln sich in Deutschland und dann später relativ schnell auch in Skandinavien, also in Ländern, die über eine staatskirchliche Tradition lutherischer Manier verfügen, – später ähnlich auch in Großbritannien – Ansätze zu einer umfassenden sozialstaatlichen Verantwortung. Die Motivationen und sozialen Ideen hierfür werden in Deutschland durch Lorenz von Stein, den Erfinder der Sozialpolitik, gelegt und in Bismarcks Staatssozialismus aufgenommen.8 Das protestantische Potenzial besteht hier darin, dem »Sozialpapst« in Rom den »Sozialkaiser« in Deutschland entgegenzusetzen. Protestanten verbünden sich in dieser Hinsicht mit dem immer weiter soziale Aufgaben übernehmenden Staatsapparat und treiben die Entwicklung relativ erfolgreich bis zum 1.Weltkrieg voran. Ebensolche Entwicklungen finden sich bei den Katholiken. Zugleich engagieren sich die Protestanten – parallel zu den Katholiken in Deutschland – in eigenen, wenn man so will, zivilgesellschaftlichen Assoziationen, den aufkommenden diakonischen Aktivitäten und der inneren Mission, deren Organisationen bis heute als Wohlfahrtsverbände in Deutschland eine enorme und weltweit einmalige Bedeutung haben. Der Sozialstaat, begründet als ein obrigkeitlich konservatives Projekt zur Eindämmung der revolutionären Energien der Arbeiterklasse, entwickelt sich über die Jahre immer mehr zu einer breit anerkannten Basis gesellschaftlicher und individueller Emanzipation und des Schutzes vor den Unsicherheiten des Lebens und der Natur, aber insbesondere dann auch gegenüber den Unsicherheiten des Kapitalismus.
–Ganz anders verlaufen in dieser Hinsicht die Entwicklungen in der reformierten Tradition, besonders in den USA.9 Hier kommt es nicht zur Entwicklung eines ausgebauten Sozialstaates. Dem bismarckschen Konzept ähnliche Initiativen entstehen in den USA erst in der Zeit des New Deals