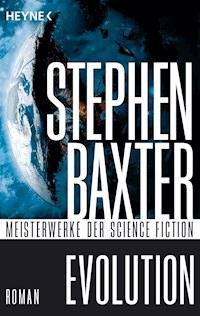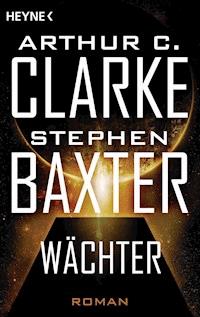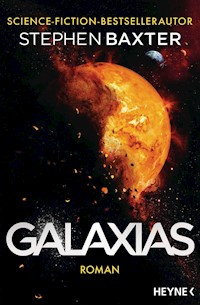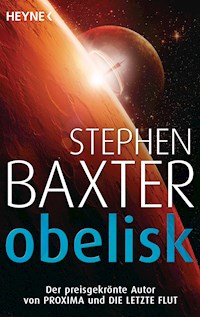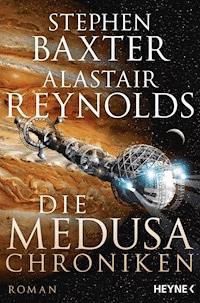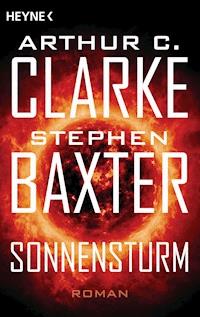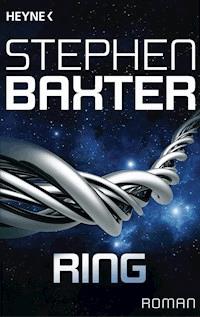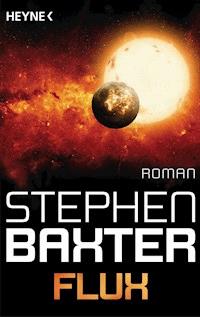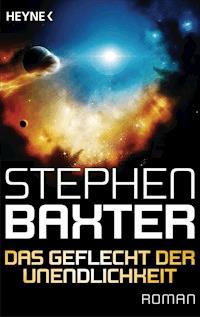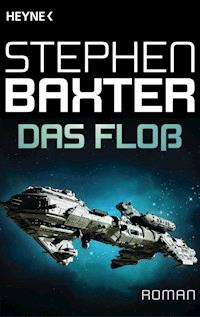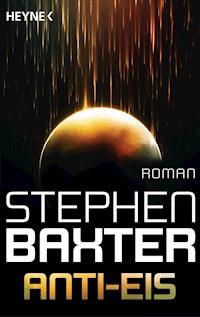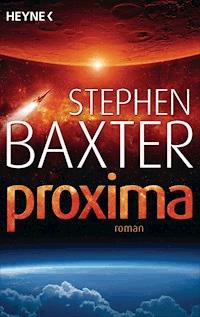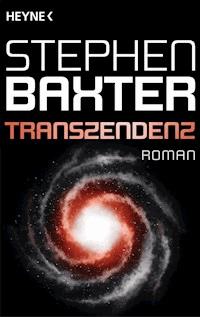
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wenn die Vergangenheit die Zukunft retten muss ...
Florida, Mitte des 21. Jahrhunderts: Die globale Erwärmung hat den Meeresspiegel ansteigen lassen, die Ressourcen werden knapp. An extravagante Themen wie bemannte Raumfahrt ist nicht mehr zu denken. Der Ingenieur Michael Poole befasst sich mit all diesen Problemen, doch er wird von seltsamen Visionen heimgesucht, in denen ihm seine verstorbene Frau erscheint. Nach und nach erkennt er, dass seine Visionen nicht aus der Vergangenheit kommen, sondern aus fernster Zukunft. Die junge Frau, die mit ihm Kontakt aufnimmt, ist Alia – und sie braucht seine Hilfe, denn ihr Universum ist voll von sterbenden Welten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 941
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Das Buch
Florida, Mitte des 21. Jahrhunderts: Weite Landstriche stehen unter Wasser, das Auto ist Vergangenheit, Cape Canaveral ein Themenpark. Wie alle Menschen weltweit kämpft auch der Ingenieur Michael Poole mit den Folgen der globalen Erwärmung und des Mangels an Ressourcen, doch er wird ebenso von inneren Dämonen verfolgt: Michael hat Erscheinungen, und er glaubt, in ihnen seine verstorbene Frau zu sehen. Da erreicht ihn die Nachricht, dass sein Sohn Opfer der Explosion eines Gashydratlagers geworden und nur knapp dem Tod entronnen ist. Michael erkennt die neue Gefahr für die Erde und initiiert ein gewaltiges Projekt zur Rettung des Planeten. Und noch immer suchen ihn die Geister heim. Aber es ist nicht die Vergangenheit, die ihm erscheint, sondern Alia, eine junge Frau aus einer fernen Zukunft – und sie braucht seine Hilfe. Denn der Himmel über ihr ist voller sterbender Welten, und die Macht liegt in den Händen der Transzendenten, Abkömmlingen der Koaleszenten, deren Ziel es ist, die Menschheit hinter sich zu lassen …
Mit »Transzendenz« setzt Stephen Baxter die atemberaubende Zukunftssaga fort, die mit »Der Orden« und »Sternenkinder« begann.
Der Autor
Der Engländer Stephen Baxter, geboren 1957, zählt zu den weltweit bedeutendsten Autoren naturwissenschaftlich-technisch orientierter Science Fiction. Aufgewachsen in Liverpool, studierte er Mathematik und Astronomie und widmete sich dann ganz dem Schreiben. Baxter lebt und arbeitet in Buckinghamshire.
Inhaltsverzeichnis
FürSir Arthur C. Clarke
ERSTER TEIL
1
Das Mädchen aus der Zukunft hat mir erzählt, der Himmel sei voller sterbender Welten.
Man kann sie aus weiter Ferne sehen, wenn man weiß, wonach man Ausschau halten muss. Wird ein Stern alt, so heizt er sich auf, die Meere seiner Planeten verdunsten, und man sieht die Wasserstoff- und Sauerstoffwolken, die sich langsam zerstreuen. Sterbende Welten, in die Überreste ihrer Meere gehüllt, wie faules Obst in den Spiralarmen der Galaxis hängend: Das werden die Menschen vorfinden, wenn sie irgendwann einmal von der Erde ins All aufbrechen. Ruinen, Museen, Mausoleen.
Wie seltsam. Wie traurig.
Mein Name ist Michael Poole.
Ich bin nach Florida heimgekehrt. Allerdings nicht ins Haus meiner Mutter, das zunehmend Gefahr läuft, ins Meer zu rutschen.
Ich habe eine kleine Wohnung in Miami bezogen. Ich bin gern unter Menschen, höre gern den Klang ihrer Stimmen. Manchmal vermisse ich den Verkehrslärm, das scharfe Kratzen der Flugzeuge am Himmel, die Geräusche meiner Vergangenheit. Aber das Lachen der Kinder entschädigt mich dafür.
Das Wasser steigt noch immer. Es gibt viel Elend in Florida, viele Umsiedlungen. Ich verstehe das. Aber irgendwie mag ich das Wasser, die allmähliche Auflösung des Staates in einen Archipel. Der langsame, jeden Tag, jede Woche unterschiedlich starke Anstieg des Wasserspiegels gemahnt mich daran, dass nichts so bleibt, wie es ist, dass die Zukunft kommt, ob es uns nun gefällt oder nicht.
Die Zukunft und die Vergangenheit begannen mein Leben im Frühling des Jahres 2047 zu komplizieren, als ich einen zornigen Anruf meines älteren Bruders John erhielt. Er war hier, in unserem Haus in Miami Beach. Ich solle »heimkommen«, wie er sich ausdrückte, und ihm helfen, »Mom zur Vernunft zu bringen«. Natürlich flog ich hin. 2047 war ich zweiundfünfzig Jahre alt.
Als Kind war ich glücklich in Florida, in meinem Elternhaus. Natürlich hatte ich meistens ein Buch oder ein Spiel vor der Nase oder tat so, als wäre ich »Ingenieur«, und bastelte unablässig an meinem Rad oder meinen Inline-Skates herum. Die Welt außerhalb meines eigenen Kopfes nahm ich kaum wahr. Vielleicht ist das auch heute noch so.
Aber ganz besonders liebte ich den Strand hinter dem Haus. Vergessen Sie nicht, dies waren die neunziger Jahre des zwanzigsten oder die ersten Jahre des einundzwanzigsten Jahrhunderts, als es in diesem Teil von Florida noch einen Strand gab. Ich weiß noch, wie ich immer von unserer Veranda mit ihren großen, ans Dach montierten Hängeschaukeln auf den Kiesweg zu den niedrigen Dünen trat und weiter zum Sandstrand hinunterging. Wenn man dort saß, konnte man Raumfähren und andere Wunder der Raketentechnik auf Cape Canaveral beobachten, die wie auffahrende Seelen in den Himmel stiegen.
Meistens sah ich mir diese Starts alleine an. Außer mir interessierte sich in meiner Familie niemand dafür. Aber einmal, ich glaube, so um das Jahr 2005 herum, besuchte uns mein Onkel George, der Bruder meiner Mutter aus England, und er kam mit mir hinaus, um sich einen nächtlichen Start anzusehen. Er wirkte so steif und alt, dass er kaum in der Lage schien, sich nieder ins struppige Dünengras zu setzen. Dabei war er damals wohl erst in den Vierzigern. George arbeitete in der Informationstechnologie; er war so eine Art Ingenieur, also eine verwandte Seele.
Natürlich ist das alles längst Vergangenheit. Die altehrwürdigen Startrampen, von denen sie zum Mond geflogen sind, wurden wegen der Klimaerwärmung, des ansteigenden Meeresspiegels, der unablässigen Stürme über dem Atlantik aufgegeben; Canaveral ist jetzt ein Themenpark hinter einem Deich. Ich glaube, ich hatte Glück, dass ich mir mit zehn Jahren solche Sachen anschauen konnte. Es war, als hätte sich die Zukunft in die Gegenwart zurückgefaltet.
Was hätte der zehnjährige Michael Poole wohl gedacht, wenn er gewusst hätte, was mir das Mädchen aus der Zukunft über all diese alten und sterbenden Welten dort draußen erzählt hat, die im All auf uns warten?
Und was hätte er wohl von der Transzendenz gehalten?
Irgendwie denke ich die ganze Zeit über diese seltsamen Ereignisse nach, über meinen Kontakt mit der Transzendenz. Es ist wie eine Sucht, etwas, dessen man sich ständig bewusst ist, das unmittelbar unter der Oberfläche vor sich hin brodelt, ganz gleich, auf welche Weise man sich abzulenken versucht.
Und doch kann ich mich nur noch an so wenig erinnern. Es ist so ähnlich, als jage man nach dem Erwachen einem Traum nach; je tiefer man sich auf ihn konzentriert, desto mehr schmilzt er dahin.
Mittlerweile habe ich mir Folgendes zusammengereimt:
Die Transzendenz ist unsere Zukunft – oder jedenfalls eine Zukunft. Eine ferne Zukunft. Die Transzendenten hatten sich zu etwas unvorstellbar Machtvollem entwickelt (oder werden es tun). Und nun standen sie auf der Schwelle, kurz vor dem Sprung zu etwas ganz und gar Neuem. Danach würden sie einen Zustand erreichen, den wir für Göttlichkeit halten würden – oder sie würden sich einem Feind geschlagen geben, von dem ich kaum auch nur einen flüchtigen Blick erhascht habe. So oder so würden sie nicht mehr menschlich sein.
Aber momentan, diesseits der Schwelle, waren sie noch menschlich. Und sie wurden von einer sehr menschlichen Trauer geplagt, einer Trauer, die überwunden werden musste, bevor sie ihre Menschlichkeit endgültig ablegten. In diesen seltsamen inneren Konflikt war ich hineingezogen worden.
Meine Arbeit zur Abwehr der Klimakatastrophe ist allgemein bekannt. Aber niemand weiß, dass ich mit etwas viel Größerem zu tun hatte: mit den Qualen eines im Entstehen begriffenen übermenschlichen Geistes der fernen Zukunft, der kulminierenden Logik unseres kollektiven Schicksals.
Die Zukunft, die sich in die Gegenwart zurückfaltet. Jener Zehnjährige am Strand hätte es wahrscheinlich toll gefunden, wenn er es gewusst hätte. Im Rückblick ängstigt es mich auch jetzt noch zu Tode.
Aber vermutlich war ich schon damals mit den Gedanken woanders gewesen. Denn ich hatte an jenem Strand etwas noch viel Bemerkenswerteres gesehen als ein startendes Raumschiff.
Die Frau, die manchmal zum Strand kam, war schlank und hoch gewachsen, mit langen, rotblonden Haaren. Sie winkte und lächelte mir immer zu, und manchmal rief sie etwas zu mir herüber, aber wegen des Wellenrauschens und des Möwengeschreis konnte ich ihre Worte nie verstehen. Sie schien sich immer am Rand des Wassers aufzuhalten, und die Sonne stand jedes Mal so tief, dass ihr Licht das Meer sprenkelte wie brennendes Öl und ich die Augen zusammenkneifen musste, um die Frau zu sehen – oder sie tauchte an einer anderen, gleichermaßen problematischen Stelle auf, verborgen vom Licht.
Als ich noch klein war, besuchte sie mich gelegentlich, nicht regelmäßig, vielleicht einmal im Monat. Ich hatte nie Angst vor ihr. Sie wirkte immer freundlich. Manchmal, wenn sie mir etwas zurief, winkte ich zurück, oder ich rief auch etwas, aber das Rauschen der Wellen war stets zu laut. Ein paar Mal lief ich ihr nach, aber es ist sehr anstrengend, in weichem, nassem Sand zu laufen, selbst wenn man erst zehn ist. Auch wenn ich noch so schnell rannte, ich schien nie näher an sie heranzukommen. Und sie zuckte die Achseln und trat zurück, und wenn ich den Blick abwandte, war sie fort.
Erst viel später fand ich heraus, wer sie war und wie wichtig sie einmal für mich sein würde.
Onkel George hat sie nicht gesehen, als er dieses eine, einzige Mal am Strand einen Raumschiffstart beobachtet hat. Ich wünschte, er hätte es getan. Ich hätte gern mit ihm darüber gesprochen. Mit zehn wusste ich nicht viel über Geister; jetzt weiß ich nur wenig mehr. George wusste vieles, und er war ein aufgeschlossener Mensch. Vielleicht hätte er mir eine simple Frage beantworten können: Kann man von Geistern verfolgt werden, die nicht aus der Vergangenheit kommen, sondern aus der Zukunft?
Die mysteriöse Frau am Strand, die während meiner gesamten Kindheit und Jugend in unregelmäßigen Abständen zu mir kam, war nämlich mein erster Besuch aus der Zukunft. Es war Morag, meine tote Frau.
Die Zukunft, die sich in die Gegenwart zurückfaltet.
2
Das Mädchen aus der Zukunft hieß Alia.
Sie war auf einem Sternenschiff geboren, fünfzehntausend Lichtjahre von der Erde entfernt. Sie lebte eine halbe Million Jahre nach Michael Pooles Tod. Und dennoch wuchs sie praktisch mit Michael und all seinen Angehörigen auf.
Sie hatte sein Leben beobachtet, fast seit ihre Mutter und ihr Vater sie aus den Geburtsbehältern heimgebracht hatten, als ihre Hände und Füße noch nichts anderes hatten greifen können als das Fell auf der Brust ihrer Mutter und die Welt ein undifferenzierter Ort aus hellen, leuchtenden Formen und lächelnden Gesichtern gewesen war. Michael Poole war schon damals für sie da gewesen, von Anfang an.
Doch nun war sie fünfunddreißig, fast alt genug, um als Erwachsene zu gelten. Michael Poole war ein Relikt aus der Kindheit, sein kleines Leben wie eine Lieblingsgeschichte, die sie sich wieder und wieder anhörte. Immer, wenn sie Trost suchte, wandte sie sich ihm zu. Aber er war ein kleiner, sentimentaler Teil ihrer Welt; seine Geschichte lag im Beobachtungstank versteckt und blieb manchmal tagelang unbeachtet.
Alias derzeitige Lieblingsbeschäftigung war das Skimmen.
Sie traf ihre Schwester im Maschinenraum, in den tiefsten Eingeweiden der Nord, wo ungeschlachte, anonyme Maschinen in stahlgrauem Licht aufragten. Die Schwestern standen sich gegenüber und lachten in freudiger Erwartung dessen, was gleich passieren würde.
Drea war nackt, ebenso wie Alia; so konnte man am besten skimmen. Dreas von goldenen Haaren bedeckter Körper war hübsch proportioniert; ihre Arme waren nicht viel kürzer als ihre Beine, und mit ihren nicht ganz fingerlangen Zehen konnte sie Dinge greifen und manipulieren. Es war natürlich ein Körper, der für die Schwerelosigkeit und das Hochvakuum geschaffen war, die natürliche Umgebung der Menschheit, aber man glaubte, dass dieser Körperbau weitgehend dem der ursprünglichen Menschen auf der alten Erde glich. Drea war zehn Jahre älter als Alia. Die Schwestern sahen sich sehr ähnlich, aber Drea wirkte gesetzter und Alia ein wenig lockerer. Während sich das Licht änderte, glitten Mehrfachlider über Dreas Augen.
Drea beugte sich vor, und Alia roch ihren frischen Atem. »Fertig?«
»Fertig.«
Drea fasste Alia an den Händen. »Drei, zwei, eins …«
Plötzlich befanden sie sich im Landwirtschaftsdeck der Nord.
Dies war eine hohe, dunstige Halle, durch deren Decke sich riesige Rohre und Leitungen herabschlängelten. Lampen warfen einen kühlen blauen Lichtschein, und grüne Pflanzen wuchsen in Hydrokulturtanks mit durchsichtigen Wänden. Die Nord war ein Sternenschiff, eine geschlossene Ökologie. Die großen Rohre beförderten Abwasser und verbrauchte Luft von den Wohndecks oben hierher und transportierten Nahrung, Luft und sauberes Wasser zurück.
Alia atmete tief ein und aus. Nach der kalten, statischen Kargheit des Maschinenraums war sie auf einmal von der lebensprühenden Wärme der »Farm« umgeben, wie sie diesen Raum nannten, und die gewaltigen Mengen an Flüssigkeit und Luft, die herein- und hinausgepumpt wurden, ließen die Bodenplatten dumpf vibrieren. Selbst die Schwerkraft fühlte sich hier auf subtile Weise anders an. Alia hatte nichts vom Skimmen gespürt: Während eines Skims verging keine Zeit, deshalb gab es auch keine Zeit für Sinneswahrnehmungen. Aber der Übergang selbst war sehr angenehm, ein Schwall neuer Empfindungen, als spränge man aus kalter Luft in ein Becken mit warmem Wasser.
Und das war erst der Anfang.
Dreas Augen glänzten. »Diesmal mit Sprung. Drei, zwei, eins …« Die Schwestern streckten die langen Zehen und segelten in die Luft hinauf, und am Scheitelpunkt ihres koordinierten Sprungs verschwanden sie abrupt.
Weiter eilten die Schwestern, zu all den vielen Decks der Nord; sie materialisierten flimmernd in Parks, Schulen, Museen, Sporthallen und Theatern. Überall blieben sie nur ein paar Sekunden, gerade lange genug, um sich in die Augen zu schauen, sich über ihre nächste Aktion zu verständigen und diese mit einem Sprung, einer Pirouette oder einem Purzelbaum einzuleiten. Es war tatsächlich eine Art Tanz; die Herausforderung bestand darin, die Genauigkeit jedes Skims und die spiegelbildliche Präzision ihrer Positionen und Bewegungen bei jedem Auftauchen zu kontrollieren.
Skimmen – willensgesteuerte Teleportation – war so leicht, dass kleine Kinder es lange vor dem Laufen lernten. Alias Körper bestand aus Atomen, die in Molekülen gebunden waren, aus elektrischen und Quantenunschärfe-Feldern. Alias Körper war sie. Aber ein Kohlenstoffatom war beispielsweise identisch mit einem anderen – absolut identisch in seiner Quantenbeschreibung – und konnte darum ausgetauscht werden, ohne dass sie etwas davon bemerkte. Sie war nur ein Ausdruck einer zeitweiligen Ansammlung von Materie und Energie, so wie Musik ein Ausdruck ihrer Partitur ist, ungeachtet des Mediums, in dem diese geschrieben ist. Für Alia spielte das allerdings überhaupt keine Rolle.
Und wenn man es einmal begriffen hatte, war leicht einzusehen, dass sie, Alia, ebenso gut von einem Haufen Atome dort drüben wie hier herüben ausgedrückt werden konnte. Es war im Grunde nur eine Frage des Willens, der bewussten Entscheidung, mit freundlicher Unterstützung der Nanomaschinen in ihren Knochen und ihrem Blut. Und nur sehr wenig, was Alia wollte, wurde ihr verweigert.
Die meisten Kinder skimmten, sobald sie herausfanden, dass sie es konnten. Erwachsenen fiel es schwerer, oder sie gaben es auf, wie sie das Laufen und Klettern aufgaben. Aber nur wenige gleich welcher Altersstufe skimmten so geschickt wie Alia und Drea. Überall, wo die Schwestern erschienen und erschrockene Vögel aufscheuchten, bedachten die Jüngeren sie mit neidischen Blicken, und die Älteren lächelten nachsichtig und versuchten ihr Bedauern zu verbergen, dass sie nie wieder so anmutig würden tanzen können.
Und jedes Mal hingen unmittelbar nach dem Verschwinden der Mädchen zwei silbrige Staubwolken, die noch immer die Umrisse der beiden Schwestern zeigten, bleich und durchsichtig in der Luft. Doch in den künstlichen Brisen des Schiffes lösten sich diese Chimären von unbewohnter Materie rasch auf.
In einem letzten, großen Skim sprangen die Mädchen ganz aus der Nord heraus.
Alia spürte die Spannung des Vakuums in ihrer Brust; die harte Strahlung brannte so herrlich in ihrem Gesicht wie eine Eiswasserdusche auf bloßer Haut. Da ihre Lungen fest verschlossen waren und der Dunst aus Biomolekülen und Nanomaschinen, der ihren Körper erfüllte, eifrig nach Schäden suchte, bestand keine Gefahr für sie.
Überall um die Schwestern herum waren Sterne, über ihnen, unter ihnen, zu allen Seiten; sie hingen im dreidimensionalen Raum. In einer Richtung bahnte sich ein grelleres, kräftigeres Licht seinen Weg durch den dicken Sternenschleier. Das war der Kern, das Zentrum der Galaxis. Die Nord war rund fünfzehntausend Lichtjahre vom Zentrum entfernt, ungefähr halb so weit wie Sol, die Sonne der Erde. Nur ausgefranste Staub- und Gaswolken lagen vor dieser aufgeblähten Lichtmasse, und wenn man genau hinsah, konnte man Schatten von tausend Lichtjahren Länge erkennen.
Alia schaute auf die Nord hinunter, ihre Heimat.
Das Schiff unter ihr war eine komplexe Skulptur aus Eis, Metall und Keramik, die sich langsam im fahlen Licht der Galaxis drehte. Man konnte die ursprüngliche Form des Raumfahrzeugs noch andeutungsweise erkennen, einen dicken Torus mit einem Durchmesser von ungefähr einem Kilometer. Aber diese Grundstruktur war überbaut, ausgehöhlt und erweitert worden, bis ihre Konturen unter einem Wald aus Parabolantennen, Manipulatorarmen und Sensorkapseln verschwunden waren. Eine Wolke grün und blau leuchtender, halbautonomer Behausungen schwamm träge ums Schiff: Es waren die Heimstätten der Reichen und Mächtigen, die der Nord wie ein Fischschwarm folgten.
Mit ineinander verschränkten Händen drehten sich die Schwestern langsam umeinander; ihr Restschwung drückte sich in einer langsamen Kreisbahn aus. Komplexes Sternenlicht spielte über Dreas lächelndes Gesicht, aber ihre Augen waren hinter den multiplen Membranen verborgen, die schützend über die feuchten Oberflächen glitten. Alia genoss den Augenblick. In jüngeren Jahren waren die Schwestern füreinander die wichtigsten Menschen an Bord der Nord gewesen. Doch nun wurde Alia allmählich erwachsen. Dies war ein Wendepunkt in ihrem Leben, eine Zeit der Veränderung – und der Gedanke, dass es vielleicht nicht mehr allzu viele solche Momente geben könnte, machte ihn umso schöner.
Doch Alia wurde von einer leisen Stimme abgelenkt, einem Flüstern in ihrem Ohr.
Ihre Mutter rief sie. Komm nach Hause. Du hast Besuch …
Besuch? Alia runzelte die Stirn. Wer von den Leuten, die sie besuchen würden, konnte so wichtig sein, dass ihre Mutter sie rief? Niemand von ihren Freundinnen und Freunden; die konnten alle warten. Aber ihre Mutter hatte irgendwie ernst geklungen. Etwas hatte sich während ihres Tanzes durch die Nord verändert, dachte Alia. Drea hielt ihre Hände fest; ihre Miene war komplex, besorgt. Sie wusste etwas, erkannte Alia und verspürte eine Aufwallung von Liebe zu ihrer Schwester, der Gefährtin ihrer Kindheit. Doch auf einmal gab es eine kaum wahrnehmbare Barriere zwischen ihnen.
Sie trieben aufeinander zu und skimmten ein letztes Mal. Wie ein Beckenschlag gingen ihre Körper ineinander über, die Atome und Elektronen, Felder und Quantenunschärfen verschmolzen. Natürlich wurde diese Verschmelzung missbilligt; sie war ein gefährliches Kunststück. Aber für Alia war es herrlich, vom innersten Wesen ihrer Schwester umfangen zu sein, sie unter dem Herzen zu tragen; alles an ihnen war zu einer einzigen wolkigen Masse vereint, alles bis auf eine reliktartige Spur der Getrenntheit in ihren Seelen. Es war noch intimer als Sex.
Aber es dauerte nur eine Sekunde. Nach Luft schnappend, skimmten sie auseinander und schwebten Seite an Seite. Und nun, wo dieser Moment ozeanischer Nähe vergangen war, kehrte Alias nagende Sorge zurück.
Komm, wir müssen heim, sagte Drea.
Die Schwestern trudelten zu den hellen, komplizierten Lichtern der Nord hinab.
3
Beim Anflug auf Miami – ich hatte der Aufforderung meines Bruders Folge geleistet – sah ich aus der Luft praktisch nur Wasser. Es war überall, das vordringende Meer an der Küste und glänzende Bänder im Landesinneren, die die Landschaft zerschnitten. Ein großer Teil der Innenstadt war natürlich geschützt, aber schon die nur ein paar Blocks entfernt liegenden Außenbezirke waren überschwemmt. Ich war ziemlich schockiert.
Doch die Stadt lebte noch. Eindrucksvolle Dämme verbanden die Inseln miteinander, und ich sah Kapselbusse in Ketten wie glänzende Perlen in dem neuen Archipel herumkurven, ganz ähnlich, wie man in meiner Kindheit die Keys von Largo bis West abfahren konnte.
Als pflichtbewusster, wenn auch widerstrebender Sohn kehrte ich also nach Florida zurück. Wie ich zu meiner Schande gestehen muss, war ich seit über zehn Jahren nicht mehr hier gewesen. Das ist heutzutage eine lange Zeit. Die Welt verändert sich rasch, und in einem solchen Zeitraum türmen sich die Veränderungen auf wie ein Wasserberg hinter einer Sandbank und brechen schließlich über einen herein.
Vom Flughafen nahm ich einen Kapselbus zur Calle Ocho, der achten Straße, und dann eine Fähre – ein schnelles, wendiges Luftboot, nicht viel mehr als eine von einem riesigen Ventilator angetriebene Kunststoffplatte. Meine Pilotin war vielleicht zwanzig Jahre alt und sprach kein Wort Englisch. Sie ließ das kleine Boot wie ein Skateboard über die Wellen gleiten; es war eine lustige Fahrt.
Auf dem Weg nach Little Havana hinein schlängelten wir uns durch Schwärme von Booten und Yachten. Leute fuhren mit Jet-Skis, alten Everglades-Sumpf-Buggies und sogar ramponierten Touristen-Tretbooten herum, die meist mit irgendwelchem Zeug beladen waren. Entlang der Calle Ocho hatten sich die Boote und Dschunken zu riesigen, bunten, schwimmenden Märkten zusammengerottet: Es gab Cafés und tabaqueros, in schwimmenden Läden konnte man billige Klamotten und sogar Brautkleider erstehen. Überall tanzten Schwärme von Fliegen und anderen Insekten, riesige Wolken, viel mehr als in meinen Kindheitserinnerungen. Aber im Maximo-Gomez-Park spielten alte Männer noch immer Domino, und auf dem von dicken Sandsackwällen geschützten Memorial Boulevard brannte nach wie vor die ewige Flamme zu Ehren der Schweinebucht-Konterrevolutionäre. All dies spielte sich zu Füßen der alten Häuser ab, von denen viele noch bewohnt waren, zumindest die oberen Etagen. Die alternden, mit Nano-Farbe beschichteten Gebäude glänzten silbern, als wären sie in Folie gewickelt. Unterhalb der Flutmarken konnte man sehen, wie das Wasser am Stein und am Beton nagte. Entenmuscheln an Wolkenkratzern, du großer Gott. Hier und dort gab es frei geräumte Schneisen, breite Trümmerstreifen, auf denen Kinder und Beutesucher herumwuselten. Wahrscheinlich Hurrikanbahnen, Lücken in der Stadtlandschaft, die nie mehr geschlossen werden würden. Eine Küste ist ein Ort der Erosion, hatte Onkel George immer zu mir gesagt, ein Ort, wo zwei feindliche Elemente, das Land und das Meer, unablässig Krieg gegeneinander führen, und am Ende trägt das Meer stets den Sieg davon. Eines Tages würden all diese imposanten alten Gebäude einfach im Ozean versinken, und ihr gesamter Inhalt würde sich in das geduldige Wasser ergießen und sich dort zu riesigen Müllhaufen sammeln.
Aber vorerst ging das Leben weiter. Meine Pilotin winkte Konkurrenten oder Freunden und rief ihnen Obszönitäten zu, wie es schien. Jeder wollte irgendwohin, so wie immer. Trotz des schmutzigen Wassers war es nach wie vor das Little Havana, an das ich mich erinnerte, ein Ort, den ich stets aufregend gefunden hatte.
Als wir die Küste erreichten, ließ ich mich von dem Boot an einem kleinen Fähranleger ein paar Kilometer vom Haus meiner Mutter absetzen. Ich hatte beschlossen, den Rest des Weges zu Fuß zu gehen, den Rucksack auf dem Rücken.
Es war mitten am Nachmittag. Die recht gut erhaltene Straße verlief in nordwestlicher Richtung und folgte der Küstenlinie; die Straßendecke war erst vor kurzem erneuert worden und wies nun einen hellen Mittelstreifen aus sich selbst erhaltender Silberdecke auf. Aber man sah, dass das Meer manchmal bis hierher kam: Im Rinnstein lagen getrocknete Tangbüschel, und die Telegrafenmasten waren am unteren Ende von Flutmarken gezeichnet. Der alte Gebäudebestand hatte sich verändert. Die in ihre zweitausend Quadratmeter großen Rasenflächen geschmiegten Holzhäuser, an die ich mich erinnerte, waren größtenteils verlassen und mit Brettern vernagelt; sie befanden sich in verschiedenen Stadien des Verfalls, oder sie waren – wie von Zauberhand in den Himmel gehoben – gänzlich von ihren nunmehr leeren Grundstücken verschwunden. Ein paar hatten gedrungenen Gussbeton-Blöcken mit kleinen Fenstern Platz gemacht: der moderne Stil, Festungen gegen Hurrikane, jede ein nahtloser, geschlossener Block, vom Dach bis zu den tief hinabreichenden Fundamenten. Nirgends sah man auch nur ein einziges Auto, und ich marschierte in tiefer Stille dahin. Auch dies ein krasser Unterschied zu meinen Kindheitserinnerungen: An einem vergleichbaren Dienstagnachmittag etwa des Jahres 2005 wären die Autos in einem endlosen Strom vorbeigeschnurrt.
Die Luft war hell und dunstig, und die feuchte Hitze legte sich wie eine Decke auf mich. Binnen kurzem schwitzte ich und bereute meine Entscheidung, zu Fuß zu gehen. Überdies lag ein unangenehmer Geruch in der Luft, ein Gestank von salziger Fäulnis, als ob ein riesiges Meerestier am Strand verweste. Aber daran konnte es natürlich nicht liegen; im Meer gab es keine Tiere.
Schließlich steuerte ich auf das Haus meiner Mutter, das Heim meiner Kindheit zu. Es gehörte zu den wenigen Häusern von früher, die noch standen. Aber es war von Haufen langsam zerfallender Sandsäcke umgeben. Überall im Garten schimmerten große elektrische Fliegengitter, die die Moskitos in Schach halten sollten, und auf dem Dach drehte sich träge eine wagenradförmige Hausturbine, die von der Brise kaum in Bewegung versetzt wurde.
Und da kam auch schon mein großer Bruder um die Ecke des Hauses, in voller Lebensgröße, den Malerpinsel in der Hand. »Michael! Hast du dich also doch herbequemt.« Schon gleich ein Vorwurf, aber was konnte ich erwarten? John wischte sich die Handfläche ostentativ an seinem Overall ab, wobei er einen silbrigen Streifen hinterließ, und streckte mir seine riesige Pranke hin.
Ich schüttelte sie vorsichtig. John ist ein großer, schwerer Mann, gebaut wie ein Football-Spieler. Schon immer hat er mich ein ganzes Stück überragt. Er ist ein paar Jahre älter als ich, und seine Haare lichten sich bereits; die braunen Augen in seinem breiten Gesicht sind hart. Ich komme, was das Gesicht betrifft, eher nach meiner Mutter, aber während sie ihr Leben lang hoch gewachsen und hübsch war, mit rauchgrauen Augen, bin ich klein und dunkelhaarig und habe einen Rundrücken. Die Leute finden manchmal, ich sei verbissen. In Wahrheit ähnele ich eher meinem Onkel George. Meine Mutter hat immer behauptet, ich erinnerte sie an England. Ich habe jedoch ihre grauen Augen geerbt, die in den schnell vergangenen Jahren, als ich beinahe attraktiv zu nennen war, gut aussahen.
John schlägt nach unserem Vater. Wie immer schüchterte er mich ein.
»Ich bin mit dem Flieger gekommen«, sagte ich lahm. »Ganz schöne Reise heutzutage.«
»Ja, nicht wahr? Und heiß ist es auch. Kein gutes Wetter zum Arbeiten.« Er klopfte mir auf den Rücken, wobei er weitere Nano-Farbe und Schweiß über mein Hemd verteilte und auf diese Weise meine Wäsche und mein Gewissen ruinierte. Er führte mich hinters Haus. »Mom ist drin. Ich glaube, sie macht Limonade. Obwohl es manchmal schwer ist, genau zu sagen, was sie macht«, erklärte er mit verschwörerisch finsterer Miene. »Sag den Kindern guten Tag. Sven? Claudia?«
Die beiden kamen ums Haus gelaufen. Sie hatten im Garten Fußball gespielt; ihr Ball rollte ihnen vorwurfsvoll hinterher und verlangte mit leisem Klingeln nach ihrer Aufmerksamkeit. Sie traten lächelnd vor mich hin, mit ausdruckslosem Blick. »Onkel Michael, hi.« – »Hallo.«
Sven und Claudia, beide vor nicht allzu langer Zeit ins Teenageralter gekommen, waren große, hübsche, wohlgenährte Kinder mit dem gleichen blonden Haarschopf. Sie entstammten Johns kürzlich geschiedener Ehe mit einer Deutschen namens Inge. Beide besaßen den Teint ihrer Mutter, hatten jedoch etwas von der wuchtigen Körperfülle ihres Vaters. Ich fand immer, dass sie wie Cro-Magnon-Jäger aussahen.
Ein paar Minuten lang versuchte ich, mit den Kindern über Fußball zu plaudern. Wie sich herausstellte, war Claudia ein wahrer Fußballfan; sie hatte demnächst sogar ein Probespiel bei ihrem örtlichen Profi-Verein. Aber die Unterhaltung war wie üblich angestrengt und höflich, eine Formalität, als wäre ich ein Schulinspektor.
Wir waren alle vorsichtig. Vor ein paar Jahren hatte ich mir zu Weihnachten einen Fauxpas geleistet, als ich ihnen Päckchen geschickt hatte, adressiert an Sven und Claudia Poole. Nach der Scheidung meiner Eltern hatte meine Mutter wieder ihren Mädchennamen angenommen, so wie ich. John jedoch hatte nach seinem Auszug wieder den Namen meines Vaters angenommen, Bazalget – ich hatte nie erfahren, warum, irgendein Streit mit meiner Mutter –, und darum waren die beiden offiziell Bazalgets. John hatte die Angewohnheit, mich bei familiären Anlässen wegen solcher Sachen anzublasen und damit den Tag zu ruinieren und allen die Stimmung zu verderben.
Ich hatte gelernt, Vorsicht walten zu lassen. Wir sind eine ungewöhnliche Familie. Oder vielleicht auch nicht.
Ich erinnerte mich daran, wie ich bei Onkel Georges Besuchen immer zu ihm gelaufen war. Aber George hatte uns ja auch immer Geschenke mitgebracht. Kluger Mann. Natürlich waren diese Kinder nicht deshalb so nichts sagend, weil sie in mir einen unsensiblen Onkel hatten. Es waren Glückskinder, und so waren Glückskinder nun mal. Ich hatte nie auch nur gewagt, Johns diesbezügliche Entscheidungen zu kritisieren.
John wedelte mit seinem Pinsel. »Ich muss weitermachen. Und du solltest jetzt mal zu Mom reinschauen«, sagte er, als hätte ich es hinausgeschoben.
Also ging ich wieder zur Vorderseite des Hauses, nahm meinen Rucksack und klopfte an die Tür.
Die Haustür war ausgebleicht von der gnadenlosen Sonne, und hier und dort schälten sich die Schindeln ab, die Nägel verrosteten und lösten sich. Das Haus war jedoch nicht in schlechtem Zustand. Die Nano-Farbe, die John so eifrig auftrug, war ein silbriger Firnis über cremefarbenen alten Glanzlackschichten.
Meine Mutter öffnete die Fliegentür. »Du bist es«, sagte sie, trat zurück und hielt mir die Tür auf, wobei sie den Blick abwandte und zu Boden schaute. Ich stieg über verfaulte Sandsäcke hinweg und lieferte pflichtgemäß den Kuss ab, den sie erwartete; ihre Haut war verschrumpelt, ledrig und warm wie geschmolzene Butter.
Sie bot mir an, mir eine Tasse Tee zu machen, und ging durch die Diele voran. Wir kamen an der alten Standuhr vorbei, die sie aus England mitgebracht hatte. Sie tickte noch immer mit imperialer Entschlossenheit vor sich hin, obwohl die Welt, der sie entstammte, so gut wie verschwunden war.
Meine Mutter war eine stockdürre Frau mit kerzengerader Haltung, steif und von einer fragilen Energie beseelt. Sie war immer noch schön, so weit man das von einer Neunzigjährigen überhaupt sagen kann. Sie hatte sich nie das Haar gefärbt, und es war allmählich weiß geworden, aber selbst jetzt wirkte ihr zurückgebundenes Haar glanzvoll, weich und lichterfüllt.
In der Küche hatte sie die Ingredienzien für frische Limonade auf den Arbeitsflächen ausgelegt. Sie machte mir Tee, heiß, stark und mit Milch, im englischen Stil, und setzte sich zu mir an den Frühstückstisch. Wir tranken unseren Tee in wachsamem Schweigen. Ich genoss den Tee natürlich, obwohl ich selbst ihn nur selten trank; er brachte meine Kindheit zurück.
Ich hatte meine Mutter nicht vernachlässigt. Aber ich hatte sie in der Regel nur bei ihren gelegentlichen, betont aufopferungsvollen Wallfahrten gesehen, wenn sie mich und Morag bei uns zu Hause besuchte, oder später, nach Morags Tod, in meiner kleinen Wohnung in New Jersey, oder aber in den Ferien in Johns Wohnung in dem Sandsteinhaus hinter den Deichen von Manhattan. Diese Reisen waren im Lauf der Jahre jedoch immer seltener geworden; Mutter pflegte zu sagen, sie wisse nicht genau, woran es liege – entweder werde sie alt oder die Welt oder beide.
Sie eröffnete die Feindseligkeiten. »Ich nehme an, John hat dich hergeholt.«
»Er hat sich Sorgen gemacht.«
»Du hättest nicht zu kommen brauchen«, sagte sie naserümpfend. »Und er auch nicht. Ich bin neunzig. Aber ich bin nicht alt. Ich bin nicht hilflos. Ich bin nicht verrückt. Und ich ziehe nicht aus.«
Ich verzog das Gesicht. »Du hast noch nie lange um den heißen Brei herumgeredet, Mom.«
Sie war weder verärgert noch geschmeichelt, und sie hatte nicht vor, sich ablenken zu lassen. »Das kannst du deinem Bruder ausrichten. Er ist genau wie euer Vater. Und mit diesem Haus ist alles in Ordnung.«
»Es braucht aber einen Nano-Anstrich. Du kannst die Kosten wieder reinholen, indem du Sonnenenergie ans Mikronetz verkaufst. Und du musst die KI-Gesetze einhalten; ein so altes Haus braucht mindestens ein IQ-Äquivalent von …«
»Ich kenne die verdammten Gesetze«, fuhr sie mich an. »Nur damit wir uns richtig verstehen. Ich ziehe nicht aus.«
Ich spreizte die Hände. »Soll mir recht sein.«
Sie beugte sich vor und musterte mich. Ich erwiderte ihren Blick. Ihr Gesicht war hart, nur Nase, Wangenknochen und eingesunkener Mund. Es schien, als wäre alles außer diesem innersten Kern weggeschmolzen und hätte nur noch ihren dominanten, zentralen Charakterzug übrig gelassen.
Aber was war das für ein Charakterzug? Energie, ja, Entschlossenheit, aber alles von einer Art Groll aufgeheizt, dachte ich. Sie war aus England hierher gekommen, erfüllt von einer Stinkwut auf ihre von Schwächen keineswegs freie Familie und alles, was ihr dort widerfahren war. Jedenfalls hegte sie einen Zorn auf meinen Dad und die Art, wie ihre Ehe in die Brüche gegangen war, ja sogar darauf, dass er gestorben war und es ihr überlassen hatte, mit diversen Komplikationen – nicht zuletzt ihren beiden Söhnen – fertig zu werden. Sie ärgerte sich über den allmählichen Klimawandel, der ihr hier im Heim der Familie zusetzte, wo sie zu sterben gehofft hatte. In ihrem Kopf lag sie im Kampf mit der ganzen Welt.
Ihre Augen, ihre schönen Augen straften die Härte ihrer Miene allerdings Lügen. Sie waren klar und immer noch von diesem verblüffenden Hellgrau. Und sie ließen eine überraschende Verwundbarkeit erkennen. Meine Mutter hatte ihr Leben lang eine Art Panzer um sich herum aufgebaut, aber ihre Augen waren ein Riss in diesem Panzer, durch den ich in sie hineinschauen konnte.
Nicht dass sie die Krallen nun eingezogen hätte. »Schau dich bloß mal an. Du hast einen Rundrücken, eine grässliche Frisur und Übergewicht. Du siehst beschissen aus.«
Ich musste lachen. »Danke, Mom.«
»Ich weiß, was mit dir los ist«, sagte sie. »Du bläst immer noch Trübsal.« Das war der einzige Ausdruck, den sie jemals für »Kummer« gebrauchte. »Wie lange ist das jetzt her? Siebzehn Jahre? Morag ist gestorben, dein kleiner Sohn ist gestorben, und es war schrecklich. Aber es liegt schon so viele Jahre zurück. Es war nicht das Ende deines Lebens. Wie geht’s Tom? Wie alt ist er jetzt?«
»Fünfundzwanzig. Er ist in Sibirien und arbeitet an einer genetischen Untersuchung der …«
»Sibirien!« Sie lachte. »Hätte er noch weiter weggehen können? Durch deine Trauer um deinen toten Sohn hast du den lebenden von dir gestoßen, verstehst du?«
Ich stand auf und schob meinen Stuhl zurück. »Und deine Amateurpsychoanalyse ist totaler Schwachsinn, so wie immer, Mom.«
Sie schloss einen Moment lang die Augen. »Schon gut, schon gut. Ich habe dir dein altes Zimmer fertig gemacht.«
»Danke.«
»Du könntest vielleicht ein paar Sandsäcke füllen. Wir haben gerade Ebbe.« Sie zeigte auf den Schrank, in dem sie leere Säcke aufbewahrte.
»Okay.«
»Es ist gar nicht so schlimm hier. Nicht mal jetzt. Wir haben noch immer Ärzte, Zahnklempner und die Polizei. South Beach ist noch keine Geisterstadt, Michael.« Zerstreut fuhr sie fort: »Was nicht heißen soll, dass wir nicht unsere Probleme hatten. Weißt du, was das Schrecklichste war, was hier passiert ist? An einer Stelle ist das Wasser so hoch gestiegen, dass ein Friedhof aufgebrochen ist. Särge und Knochen sind blubbernd aus dem Boden gestiegen. So etwas Groteskes hast du noch nie gesehen. Sie mussten alles mit Bulldozern wegräumen. Und ich vermisse das Vogelgezwitscher. Wohin man auch geht, nirgends scheint es mehr Vögel zu geben.«
Ich zuckte die Achseln. Vögel waren die Vorhut des Artensterbens gewesen. Im Jahr 2047 war ihr Verschwinden eine Banalität. »Mom«, sagte ich behutsam, »vielleicht solltest du doch daran denken, von hier wegzuziehen.«
Sie beäugte mich mit leiser Belustigung. »Willst du behaupten, dass es woanders auch nur andeutungsweise besser ist?«
»Eigentlich nicht, nein.«
»Dann hör auf, Zeit zu verschwenden.« Sie trank einen Schluck von ihrem Tee, und ich war entlassen.
Mein altes Zimmer war klein, aber es ging aufs Meer hinaus, und ich hatte es immer geliebt.
In Wahrheit war es jetzt natürlich nicht mehr meins, auch wenn es keinen exakten Zeitpunkt gab, an dem es aufgehört hatte, mir zu gehören. Ich hatte einfach immer seltener hier übernachtet. Irgendwann hatten meine Eltern dann eine Entscheidung treffen müssen, was sie damit machen wollten, und das hatten sie getan, ohne mich zu fragen.
Nun, sie hatten es völlig umgemodelt. Mein Dekor aus der Zeit der technischen Spielereien um die Jahrhundertwende war jenem pseudonaturalistischen Stil gewichen, der in den zwanziger Jahren des einundzwanzigsten Jahrhunderts so beliebt gewesen war, mit einer Wandverkleidung mit Bambus-Effekt und einem weichen grünen Kunstrasenteppich. Bevor ich angefangen hatte, an der kommerziellen Entwicklung der Higgs-Energie zu arbeiten, war ich technischer Berater in der Atomkraftindustrie gewesen und hatte in vielen Hotels gewohnt. Dieser Dekorationsstil war allgegenwärtig gewesen, endlose Tapetenbahnen mit tropischen Papageien und Bodenbeläge mit Krokodilledereffekt, die anonyme Betonblocks in Warschau, Vancouver oder Sydney zierten. Es kam mir so vor, als betrauerten wir den Verlust des Grüns, noch während das Artensterben es überall um uns herum rasant verschwinden ließ.
Ich warf meinen Rucksack aufs Bett und öffnete die Wandschränke auf der Suche nach einer Möglichkeit, meine paar Hemden aufzuhängen. Die Schränke waren jedoch bis obenhin voll. Den meisten Platz nahmen die Kleider meiner Mutter ein. Ihr Stoff fühlte sich brüchig an; die Sachen waren sehr alt und nur selten getragen worden.
Aber ich fand auch noch einiges übrig gebliebene alte Zeug von mir. Keine Kleidungsstücke: Die waren zweifellos im Schlund der Wohlfahrt verschwunden, und meine alten T-Shirts und Hosen schmückten jetzt vielleicht ein Flüchtlingskind aus dem überschwemmten Bangladesh oder dem von der Dürre heimgesuchten Ägypten; es war ein Zeitalter der Flüchtlinge, und es herrschte großer Bedarf an Kleidung. Aber da waren Computerspiele, Bücher und ein paar meiner schickeren Modelle, zum Beispiel das riesige Mobile der Internationalen Raumstation; früher hatte es über meinem Bett gehangen, jetzt war es fein säuberlich demontiert und in Blasenfolie eingepackt. Einige Spielsachen hatten überlebt, hauptsächlich Filmfiguren aus Plastik und Spritzgussmodelle, die sorgfältig in ihren Schachteln verstaut waren.
Aus meiner Sicht war es eine eklektische Mixtur; Eltern, die den Plunder ihrer Kinder sichten, sind ein willkürlicher Filter. Anscheinend hatte meine Mutter Gegenstände ausgewählt, die keinen sentimentalen Wert besaßen, sondern vielleicht irgendwann einmal Geld bringen würden; ein Spielzeug überstand die Auslese nur, wenn es in gutem Zustand war und sie die Verpackung finden konnte. Natürlich waren diese perfekt erhaltenen Auktionskandidaten aber genau die Spielsachen, mit denen ich am wenigsten Zeit verbracht hatte. Trotzdem, sie hatte ein gutes Auge dafür gehabt, was wertvoll war und was nicht. Viele der Computerspiele hätten gutes Geld gebracht; es gab eine ganze Industrie der Siliziumchip-Archäologie, und sie produzierte Interessenten für derlei Dinge, die etliche elektronische Generationen alt, aber für sentimentale Narren wie mich trotzdem wertvoll waren.
Ich stieß sogar auf ein Fossil, das der Selektion entronnen war, obwohl es keinen erkennbaren Wert besaß. Es war eine kleine Blechschachtel mit einem Schlitz, der sie zur Spardose umfunktionierte. Darin fand ich Zeitungsausschnitte, Sammelkarten und Internet-Printouts, die meist etwas mit dem Raumfahrtprogramm zu tun hatten, einen kleinen Lederbeutel voller Pennys aus dem Jahr 2000, lose Briefmarken, Fastfood-Aufkleber, Buttons von Werbekampagnen für Fernsehsendungen und ein winziges Reiseschach, mit dem ich meinem Bruder das Spiel beigebracht hatte, spät nachts, wenn wir eigentlich hatten schlafen sollen. All dieses Zeug war immer und immer wieder angefasst und gründlich studiert worden. Diese kleine Schachtel war eine Momentaufnahme meines zehn- oder elfjährigen Geistes, alles darin so klein und abgegriffen, dass es schon eine gewisse Ähnlichkeit mit fossilem Schmuck hatte. Aber es fühlte sich auch ein wenig unangenehm an, schmutzig von den vielen Berührungen. Ich hätte wahrscheinlich öfter an die frische Luft gehen sollen, dachte ich, schloss die Schachtel und stellte sie wieder auf ihr Bord.
Doch während ich das tat, wurde ich plötzlich von Traurigkeit überwältigt. Sie traf mich wie ein körperlicher Schlag, wie ein Fausthieb in den Nacken, und ich musste mich setzen. Es lag einfach daran, dass der Junge, der diese Schachtel gefüllt hatte, verschwunden war, als ob er nie existiert hätte; die ganze reichhaltige, komplizierte Textur seines Lebens hatte sich aufgelöst. Das Leben war so reichhaltig, aber auch so vergänglich: Das war es, was mich traurig machte.
Über diesem alten Zeug Trübsal zu blasen füllte jedoch keine Sandsäcke. Ich schloss den Schrank, schlüpfte in ein T-Shirt und Shorts, trug frische Sonnencreme und Mückenschutz auf und ging die Treppe hinunter.
Die Veranda mit den Hängeschaukeln war noch heil, obwohl ihr ein wenig liebevolle Zuwendung gut getan hätte. Ich lief über die freie Fläche hinterm Haus dorthin, wo noch immer Johns Kinder spielten. Früher war es eine Rasenfläche gewesen; jetzt war es nur noch eine Betonplatte. Die beiden schenkten mir ein höfliches Glückskinderlächeln, und ich winkte ihnen zu und ging mit einem Arm voll leerer Säcke für den Sand weiter.
Von der Gartenpforte führte der alte Kiesweg zur Küste hinunter, so wie immer. Doch bevor ich zu den Dünen kam, überquerte ich Dämme, Abzugskanäle und Entwässerungsgräben und stieg über die verrottenden Überreste vieler, vieler Sandsäcke hinweg. Ich stellte mir vor, wie meine Mutter hier schuftete, entschlossen und störrisch. Aber ihre hydrologischen Systeme hatten allesamt versagt, und als ich zurückschaute, sah ich, wie die Sandsacklinien immer weiter zum Haus zurückwichen. Man konnte einen Ozean nun einmal nicht durch einen fünf Zentimeter breiten Abzugskanal ableiten.
Ich ging durch die Dünen und gelangte ans Ufer. Hier gab es noch so etwas wie einen Strand, aber er fiel steil ab und verschwand bald unter dem rastlosen Meer. Die Erosion hatte erbarmungslos zugeschlagen. Selbst die Dünen schienen weggefressen worden zu sein. Da und dort sah ich Flecken von grauem Schlamm, wie ein Stück Meeresboden, gar nicht wie ein Strand. Überall lagen Treibholz und verstreuter Plastikmüll herum, und ich ging an großen Riffen aus totem Seetang vorbei, der von Stürmen ausgerissen und an den Strand geworfen worden war. Die Riffe waren die Quelle jenes salzigen Verwesungsgeruchs, den ich zuvor wahrgenommen hatte. Überall wimmelte es von Insekten; es waren nicht nur Moskitos, sondern auch andere winzige Mistviecher, die sich auf meine unbedeckte Haut stürzten. Insekten, die großen Gewinner der Jahre des Artenschwunds.
Das Meer sah schön aus, so wie immer, selbst wenn es, aufgewühlt von den unaufhörlichen Stürmen, nicht ganz so blau war wie früher. Es fiel mir schwer zu glauben, dass es so viel Schaden angerichtet hatte.
Ich fand eine Düne, die dem Zahn der Zeit mit Hilfe kompakter Grasbüschel widerstand. In ihrem Schutz war der Sand sauber und sogar einigermaßen trocken. Ich hockte mich hin und schaufelte ihn in meine Säcke. Mittlerweile war es später Nachmittag. Ich schaute in die Sonne, die im Südwesten unterging, zu meiner Rechten.
Da sah ich sie.
Es war nur etwas in meinem Augenwinkel, eine winzige Bewegung, die mich ablenkte. Ich dachte, es wäre vielleicht der seltene Anblick eines Meeresvogels oder das Spiel des Sonnenlichts auf den Wellen. Ich stand auf, um besser sehen zu können. Es war eine Frau. Sie stand ein ganzes Stück weiter unten am Strand, und das Licht, das vom Meer hinter ihr reflektiert wurde, war grell; blendende Glanzlichter stachen mir in die Augen.
Morag?
Diese Begegnungen oder Besuche jagten mir nie Angst ein. Aber sie waren immer von Mehrdeutigkeit, Unklarheit und Ungewissheit gekennzeichnet. Es hätte Morag sein können, meine vor langer Zeit gestorbene Frau, aber sicher war ich mir nicht.
Ich verspürte auch einen gewissen Ärger, ob Sie es glauben oder nicht. Ich hatte mein ganzes Leben lang solche Erscheinungen gesehen und war an sie gewöhnt. In den letzten Monaten hatte ihre Häufigkeit jedoch zugenommen. Diese Visionen, Spukbilder oder was auch immer verfolgten mich geradezu. Ihre Unvollständigkeit schmerzte mich; ich wollte Klarheit. Aber ich wollte nicht, dass sie aufhörten.
Ich trat einen Schritt vor, um besser sehen zu können. Doch ich hielt einen dreiviertelvollen Sandsack in der Hand, und der Sand rieselte heraus. Deshalb bückte ich mich und stellte ihn auf den Boden. Dann musste ich über das Loch hinwegsteigen, das ich gegraben hatte. Eines nach dem anderen, wie das bei mir so ist. Als ich wieder aufblickte, war sie noch da, in Licht getaucht, obwohl sie jetzt ein Stück weiter entfernt zu sein schien.
Sie winkte mir zu, ein weit ausholendes, herzliches Winken, mit dem Arm über dem Kopf. Mein Herz schmolz dahin. In dieser schlichten Geste lag mehr Wärme als in jeder Reaktion, die ich von John und seinen glücksmodifizierten Kindern geerntet hatte. Es war Morag, die vor siebzehn Jahren gestorben war; es konnte nur sie sein. Jetzt legte sie die gewölbten Hände an den Mund und rief mir etwas zu. Aber die Wellen rauschten, Echos eines weit entfernten Sturms über dem Atlantik, und nur ein Tonfetzen drang an meine Ohren. John, sagte sie. Oder vielleicht auch Bombe. Oder Tom.
»Was hast du gesagt? Etwas über Tom? Morag, warte …« Ich machte ein paar ungeschickte Schritte nach vorn. Aber vor der Dünenlinie wurde der Sand rasch schlammig, und bald waren meine Füße und Unterschenkel mit großen, schweren Stiefeln aus klebrigem Meeresgrundschleim überzogen. Dann kam ich zu einem dieser großen Tangriffe, die sich hoch auftürmten und zu einem stinkenden Brei zergingen. Ich lief hin und her und suchte nach einem Weg hindurch.
Als ich an den Haufen aus verrottendem Tang vorbeischaute, war sie bereits verschwunden.
Oben beim Haus waren die Kinder schon hineingegangen, um sich auf Grandmas riesigem, an der Wand angebrachtem Softscreen ein immersives virtuelles Drama anzusehen. Die steigende Flut hatte überall ums Haus herum Wasser aus dem Boden sprudeln lassen, bis es schließlich den Garten überschwemmte; dagegen war selbst ihr intelligenter Fußball machtlos.
Während die Sonne unterging, half ich John bei seiner geduldigen Malerarbeit.
Wir trugen die Farbe mühevoll auf. Es war ein schweres, klebriges Zeug voller Klumpen, und es war schwierig, es gleichmäßig aufzutragen. Mit seinem silbernen Farbton sah es auf den Schindelwänden meiner Mutter seltsam aus; das Haus wirkte damit wie eine Studiokulisse. Und als wir die Farbe aufspachtelten, fing sie an, uns mit einer Flüsterstimme zu danken, die von der Wand herbeiwehte: Danke, vielen Dank, dass Sie sich an alle örtlichen KI-Vorschriften halten, danke …
»Ach, leck mich doch«, sagte John.
Die dubiose Farbgebung war einer der Gründe, weshalb meine Mutter dieses Zeug hasste. Das Silber reflektierte jedoch einen großen Teil des Sonnenlichts und senkte dadurch die Kosten für die Klimaanlage, und die eingebetteten Fotovoltaik-Zellen machten das ganze Haus zu einer Sonnenenergiesenke.
Außerdem wimmelte es in der Farbe nur so von Prozessoren, Milliarden winziger, nanofabrizierter Computer von der Größe eines Staubkörnchens und ungefähr so intelligent wie eine Ameise. Während des Farbauftrags verkoppelten sich die kleinen Gehirne durch das leitende Medium der Farbe selbst miteinander, gruben sich ihren elektronischen Weg in die Systeme des Hauses und suchten Anschluss zu Steckdosen und Stellantriebssteuerungen. Künstliche Intelligenz aus der Dose: In meiner Kindheit wäre es mir wie ein Wunder erschienen. Heutzutage war künstliche Intelligenz ein Konsumartikel, und dies hier war nichts weiter als eine anstrengende Tätigkeit.
Eine Weile arbeiteten wir in gleichmütigem Schweigen, mein Bruder und ich. Das Licht sickerte aus dem Himmel, und die Verandalampen meiner Mutter, große, nüchternsachliche Glühlampen, erwachten abrupt zum Leben. Moskitos umschwärmten uns summend.
John machte Konversation. »Na, wie steht’s denn nun mit dem digitalen Jahrtausend, hm? Du bist der Ingenieur; sag mir, ob ich mir Sorgen machen muss.«
Ich zuckte die Achseln. »Wir werden’s überleben. Genauso wie die Zeitumstellung aufs dritte Jahrtausend. Wird schon nicht so schlimm werden. Sie haben probehalber ein paar Systemexkavationen durchgeführt, um es zu testen.«
John lachte über meine Wortwahl. Exkavationen.
Es war die neueste Horrorgeschichte, die über den gesamten Erdball hinwegrollte. Das Datum des nächsten Jahres, 2048, war eine Zweierpotenz, nämlich zwei hoch elf, und würde deshalb mit einer zusätzlichen binären Ziffer im Speicher der miteinander verbundenen Computersysteme der Welt dargestellt werden müssen. Niemand wusste so recht, was dabei mit den teils viele Jahrzehnte alten, von Verbesserungen und Verzierungen überkrusteten Legacy Suites geschehen würde, jenen überkommenen Programmpaketen, die immer noch im Kern vieler großer Systeme lagen; ein grässlicher alter Code, der im Computerspeicher vor sich hin rottete wie der Seetang am Strand meiner Mutter.
»Aha«, sagte John. »Also bloß ein weiteres Schauermärchen?«
»Wir leben in einer Zeit der Furcht und des Staunens.«
»Ein Zeitalter der Vernunft ist es jedenfalls nicht.« John seufzte, während die Farbe sich weiterhin bei ihm dafür bedankte, dass er sie auftrug. »Hör dir dieses verdammte Zeug an. Lethe, vielleicht ist es vernünftig, unvernünftig zu sein.«
Fasziniert fragte ich: »Wie denken denn deine Kinder über dieses Millennium?«
»Gar nicht, soweit ich weiß. Ich versuche sie dazu zu bringen, sich die Nachrichten anzusehen, aber da stehe ich auf verlorenem Posten. Andererseits schaut sich heute sowieso niemand mehr die Nachrichten an, stimmt’s, Michael?«
»Wenn du es sagst«, blaffte ich zurück.
Diese Unterhaltung – angespannt, am Rand eines Wortgefechts – war typisch für uns. Sie war die dünne Deckschicht über einem Antagonismus, der bis in unsere späten Jugendjahre zurückreichte, als wir die Welt allmählich zur Kenntnis genommen und unsere Haltungen zur Zukunft entwickelt hatten.
Mein Ziel war es gewesen, Ingenieur zu werden; ich wollte Dinge bauen. Und ich war fasziniert vom Weltraum. Schließlich hatte man die Kuiper-Anomalie entdeckt, als ich zehn gewesen war: ein wahrhaftiges außerirdisches Artefakt am Rand des Sonnensystems. Wer von uns sich für solche Dinge interessierte, dessen gesamte Perspektive im Universum hatte sich verändert. Aber wir waren in der Minderheit, die Welt drehte sich weiter, und ich verlor den Anschluss.
John hingegen wurde Anwalt und spezialisierte sich auf Entschädigungsklagen für Umweltschäden. Ich fand ihn zynisch, aber im Kielwasser der ungeheuren politischen und ökonomischen Umwälzungen im Gefolge des Patronats-Programms war er zweifelsohne erfolgreich. Er zapfte die gewaltigen Geldströme an, die in einer destabilisierten Welt hin und her schwappten, war dadurch ungeheuer reich geworden und hegte nun größere Ambitionen – während ich, ein Ingenieur, der Dinge baute, kaum meine Rechnungen bezahlen konnte. Das sagt Ihnen wahrscheinlich alles, was Sie über den Zustand der Welt in jener Zeit wissen müssen.
Für Brüder kamen wir wirklich erstaunlich schlecht miteinander klar. Oder vielleicht auch nicht. Aber trotzdem, er war mein Bruder, der einzige noch übrige Mensch, der mich mein Leben lang kannte und halbwegs bei Verstand war, mit allem gebührenden Respekt für meine Mutter.
Und ich sehnte mich danach, ihm von Morag am Strand zu erzählen.
Ich hatte noch nie jemandem davon erzählt. Nun hatte ich das Gefühl, dass ich es tun sollte. Und wem sollte ich es erzählen, wenn nicht meinem Bruder? Wer sonst sollte davon erfahren? Er würde sich natürlich darüber lustig machen, aber das gehörte bei ihm nun mal dazu. Während ich dort stand und gemeinsam mit ihm arbeitete, während die Lichter in der zunehmenden Dunkelheit heller wurden, nahm ich meinen Mut zusammen und öffnete den Mund.
Dann erloschen die Lichter zischend zu einem silbergrauen Nichts. Auf einmal war John eine Silhouette vor einem dunkler werdenden Himmel, mit einem nutzlosen Pinsel in der Hand. Wir hörten das enttäuschte Geschrei der Kinder im Haus.
»Verdammt«, fauchte John.
Das Haus, oder jedenfalls die Farbe, entschuldigte sich. Verzeihung. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.
Es war ein kooperativer partieller Stromausfall; die in den Nachbarhäusern, den Bars, Läden und Straßenlaternen, in den Wasserpumpen, Bussen und Booten verstreuten KIs reagierten auf Alarmsymptome aus dem lokalen Strom-Mikronetz – für gewöhnlich eine Spannungsspitze in der Netzfrequenz – und schalteten sich ab. Es sei besser so, besser als in der schlechten alten Zeit dummer Systeme und massiver totaler Stromausfälle, sagten alle. Aber es ging einem trotzdem mörderisch auf den Wecker.
Meine Mutter steckte den Kopf aus dem Fenster. »Noch so ein Grund, weshalb ich das Silberzeug nicht leiden kann.«
John lachte. »Wir müssen das morgen früh fertig machen, Ma. Tut mir Leid.«
»Kommt lieber rein. Jetzt, wo die elektrischen Fliegengitter abgeschaltet sind, werden die Moskitos jeden Moment über euch herfallen. Ich habe Hirnloshähnchenschnitzel, Kekse und Spielkarten, um die Kinder bei Laune zu halten.« Sie schloss das Fenster mit einem Knall.
Ich warf John einen Blick zu. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen, erspähte jedoch seine weißen Zähne. »Gin Rommee«, sagte er. »Ich hab das verdammte Gin Rommee immer gehasst.«
»Ich auch.« Wenigstens eines, das wir gemeinsam hatten.
Er klopfte mir auf den Rücken, etwas freundlicher als zuvor. Seite an Seite gingen wir ins Haus.
In diesem Moment kam ein Anruf. Ich hörte ihn so laut im Ohr, dass es wehtat. In Sibirien hatte es eine Explosion gegeben. Sie hatten den Kontakt zu Tom, meinem Sohn, verloren. Möglicherweise war er verletzt.
4
Während Alia herangewachsen war und begonnen hatte, ihre Welt bewusst wahrzunehmen, hatte sie stets gewusst, dass die Nord ein Schiff war, ein vollkommen künstliches Artefakt. Und das implizierte natürlich, dass es einen Zeitpunkt gab, an dem sie entstanden war, einen Zeitpunkt, vor dem sie nicht existiert hatte. Alia hatte eigentlich noch nie darüber nachgedacht. Was zählte, war die Gegenwart, nicht irgendeine Diskontinuität in der fernen Vergangenheit; ganz gleich, wo man aufwuchs, tief im Innersten ging man immer davon aus, dass die Welt um einen herum schon ewig bestand.
Trotzdem stimmte es. Dieses Schiff war einmal von menschlichen Händen gebaut, getauft und gestartet worden.
Einst war die Nord ein Generationenschiff gewesen. Sie war mit Unterlichtgeschwindigkeit dahingekrochen und hatte viele Jahrhunderte lang unterwegs sein sollen, bis sich die fernen Enkelkinder ihrer Erbauer schließlich auf den Boden einer neuen Welt ergießen würden. Man nahm an, dass sie im Sol-System selbst gestartet war, gebaut auf dem Eis eines fernen Mondes, vielleicht auf Port Sol – und vielleicht sogar von dem legendären Ingenieur Michael Poole, der dazu verurteilt gewesen war, in einer viel tristeren Zeit zu leben.
Wahrscheinlich war das jedoch bloß ein Märchen. In Wahrheit hatte man den Herkunftshafen der Nord längst vergessen, und niemand kannte ihr ursprüngliches Ziel oder wusste auch nur, wer ihre Erbauer gewesen waren und was sie gewollt hatten. Waren es Visionäre, Flüchtlinge oder sogar, wie hinter vorgehaltener Hand gemunkelt wurde, Verbrecher gewesen? Selbst der Name des Schiffs war Gegenstand hochgeistiger Diskussionen. Vielleicht hatte er sich aus Nautilus entwickelt, einem Wort von der alten Erde, das ein Tier bezeichnete, welches sein Leben in einer Schale verbrachte. Vielleicht gehörte er auch zu den Worten, mit denen ein Erdenwurm eine Richtung auf der Oberfläche eines Planeten bezeichnete.
Aber was immer ihr Ziel gewesen sein mochte, die Nord hatte es nicht erreicht. Schon lange vor dem Ende ihrer Reise war sie von einer Welle von Überlichtschiffen überholt worden, einer neuen Generation von Menschen, die von der Erde ausgeschwärmt waren und dieses Relikt ihrer eigenen Vergangenheit wieder entdeckt hatten. Der Schock, als die ersten Überlichtflitzer an jenem Tag längsseits gegangen waren, musste das Weltbild der Besatzung bis in die Grundfesten erschüttert haben.
Doch als diese Generation ausgestorben war, hatte die Besatzung ihren Platz an Bord eines überholten historischen Objekts akzeptiert. Sie hatte angefangen, mit den vorbeikommenden Schiffen Handel zu treiben – zuerst mit der aus Eis bestehenden Reaktionsmasse der Nord, von der sie immer noch Milliarden Tonnen übrig hatte, später mit Gastfreundschaft, kulturellen Artefakten, Theateraufführungen, Musik und kultivierter Prostitution. Im Grunde war die Nord kein Schiff mehr; sie war eine künstliche Insel, die zwischen den Sternen trieb, und sie hatte ihren festen Platz in einer komplexen interstellaren Handelswirtschaft. Heutzutage legte niemand an Bord noch irgendwelchen Wert darauf, dass die Reise endete.
Natürlich gab es gewisse Einschränkungen, wenn man in einem Raumschiff lebte. Der Innenraum der Nord würde immer begrenzt sein, und die Bevölkerung durfte nicht zu stark wachsen. Aber den meisten Leuten reichten zwei Kinder; tatsächlich begnügten sich fast alle mit weniger. Alia wusste, dass sie Glück hatte, in Drea eine Schwester zu haben; Geschwister waren selten. Ihre Eltern hatten jedoch nie einen Hehl daraus gemacht, welch große und ungewöhnliche Freude ihre Kinder für sie bedeuteten.
Abgesehen davon konnte man jederzeit die Flucht ergreifen, wenn es einem in diesem kleinen, dahinschwebenden Dorf nicht gefiel. Man konnte sich eine Passage an Bord eines der Überlichtbesucher der Nord kaufen, die in einem unaufhörlichen Strom vorbeizogen, und zu irgendeiner der Welten einer blühenden menschlichen Galaxis fliegen. Auf der anderen Seite entschieden sich auch manche Besucher, bezaubert von der Altertümlichkeit und dem Frieden der Nord, hier zu bleiben.
So war die Nord weitergeflogen, und die Besatzung hatte das Schiff immer wieder umgebaut, bis es die dichten Molekülwolken durchquert hatte, die den Kern der Galaxis vor den Blicken von der Erde abschirmte, und in ein neues, kaltes Licht hinausgetreten war.
Und eine halbe Million Jahre waren vergangen.
Das Zuhause der Schwestern war eine Ansammlung blasenförmiger Räume an der Unterseite der keramischen Hülle der Nord. In diese uralte Fläche waren Fenster geschnitten worden, sodass man von Alias Zimmer in den Weltraum hinausschauen konnte. Das Zimmer war klein, aber es war eine angenehme Zuflucht, die sie immer sehr geschätzt hatte.
Heute war jedoch ein Besucher da. Ein Eindringling.
Es war ein Mann, ein Fremder. Er stand schweigend mitten im Raum, die Hände auf dem Rücken. Ihre Mutter, Bel, stand händeringend neben dem Besucher.
Der Fremde war groß, so groß, dass er sich bücken musste, um nicht an die Decke zu stoßen. Er trug ein tristes, blassgraues Gewand, das trotz seiner Größe und seiner steifen Körperhaltung bis zum Boden reichte. Sein langes Gesicht bestand nur aus Flächen und scharfen Knochenkanten, als hätte er kein Gramm überschüssiges Fett unter der Haut. Die kurzen Arme waren zu steif zum Klettern; er war ein Planetenbewohner. Er hielt auf subtile Weise Abstand zu den Möbeln, zu Alias Bett, ihren Stühlen, ihrem Tisch und dem Beobachtungstank, die alle mit Kleidungsstücken und anderem Zeug übersät waren, und sah Alia mit freundlicher, beinahe belustigter Miene an. Aber Alia fand, dass er etwas Distanziertes an sich hatte, wie er sie betrachtete, so als wäre sie ein Labortier.
Es gefiel ihr nicht, dass dieser taxierende Fremde in ihrem Zimmer stand und sich ihre Sachen ansah. Groll loderte in ihr auf.
Das Gesicht ihrer Mutter war gerötet, und sie wirkte angespannt und aufgeregt. Es brauchte einiges, um eine Zweihundertjährige so sichtbar aus dem Häuschen zu bringen. »Alia, das ist Reath. Er ist von weit her gekommen, um dich zu besuchen. Er kommt vom Commonwealth.«
Der Mann, Reath, trat mit ausgebreiteten Armen vor. »Tut mir Leid, dass ich einfach so hier eindringe, Alia. Es ist schrecklich ungehörig. Und es wird sicher ein Schock für dich sein. Aber ich bin hier, um dir eine Chance zu bieten.«
Sie konnte nicht sagen, wie alt er war. Aber schließlich konnte man das bei niemandem sagen, der das Alter von etwa dreißig Jahren überschritten hatte. Er war jedoch anders, dachte sie. Er hatte etwas Regloses an sich, als hätte er gewichtigere Sorgen als die Menschen in seiner Umgebung.
»Was für eine Chance?«, fragte sie argwöhnisch. »Geht es um einen Job?«
»In gewissem Sinn …«
»Ich will keinen Job. Niemand arbeitet.«
»Manche schon. Sehr wenige«, sagte er. »Vielleicht wirst du zu ihnen gehören.« Seine Stimme war tief und unwiderstehlich, sein ganzes Gebaren wirkte hypnotisierend. Sie hatte das Gefühl, dass er sie auf einen Weg lenkte, den sie vielleicht gar nicht einschlagen wollte.
Dann merkte sie, dass ihre Mutter fort war. Sie war aus dem Zimmer geschlüpft, während Reath sie abgelenkt hatte.
Reath wandte sich ab und lief im Zimmer umher, die Hände immer noch hinter dem Rücken verschränkt. »Du hast Fenster. Die meisten Menschen würden sich lieber verstecken, sich in der Menschenwelt vergraben und vergessen, dass sie auf einem Sternenschiff sind. Aber du nicht, Alia.«
»Meine Eltern haben die Wohnung ausgesucht«, sagte sie. »Nicht ich.«
»Ja, mag schon sein.« Mit einem eleganten Finger fuhr er leichte Schatten an der Wand nach, ein wirres Linienmuster aus Rechtecken, Hexagonen, Ovalen und Kreisen. Im Laufe der sich verändernden Raumnutzungen auf der Nord waren dort Fenster ausgeschnitten, wieder verschlossen und erneut ausgeschnitten worden, und jede dieser Reparaturen hatte eine geisterhafte Spur hinterlassen. »Und diese Nutzungsnarben? Stören sie dich nicht?«
»Weshalb sollten sie?« Tatsächlich gefiel ihr die Geschichtsträchtigkeit, die ihr die kaum merklichen Narbenmuster vermittelten, die Vorstellung, dass sie nicht die Erste war, die hier lebte, die diese Luft atmete.
Er nickte. »Sie machen dir nichts aus. Obwohl diese einander überlagernden Narben dir das Gefühl geben müssen, dass alles vergänglich und flüchtig ist – die Jugend, die Liebe, selbst deine eigene Identität. Ich will nicht herablassend sein, Alia, aber du bist wohl noch zu jung, um zu wissen, wie selten das ist. So wie die meisten Menschen ihren Ort im Raum lieber vergäßen, denken sie auch nicht gern über ihre Position in der Zeit nach. Und an den Tod möchten sie schon gar nicht denken!«
Ihr wurde immer unbehaglicher zumute. »Und deshalb bist du hier? Weil ich zu viel nachdenke?«
»Niemand denkt zu viel nach. Und du kannst sowieso