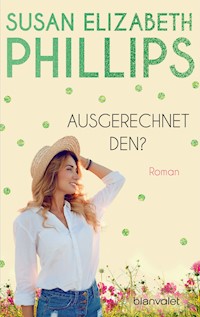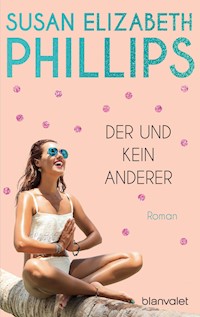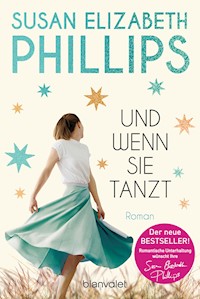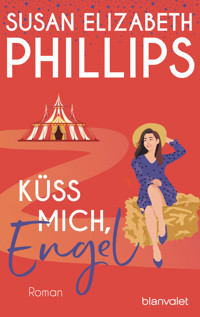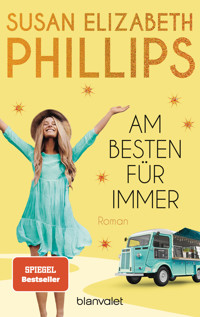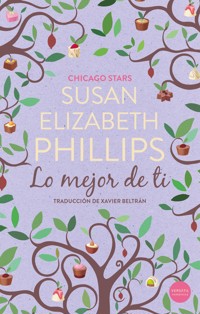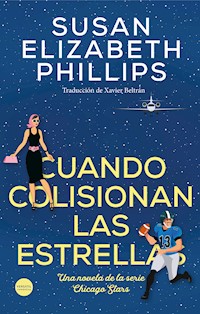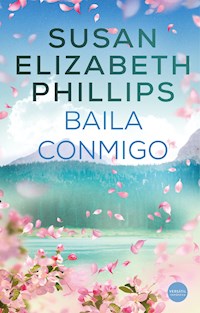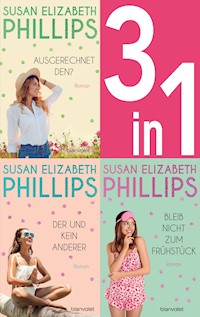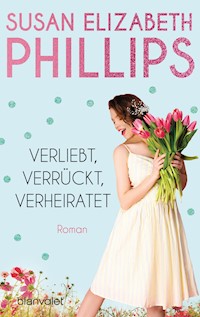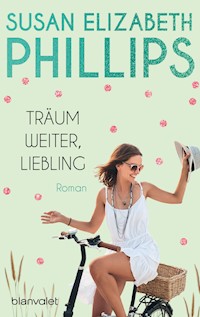
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Chicago-Stars-Romane
- Sprache: Deutsch
Typisch! Rachel Stones Auto gibt ausgerechnet in der Kleinstadt den Geist auf, wo ihr verstorbener Gatte sich nicht gerade beliebt gemacht hatte. Rachel hat einen kleinen Sohn, wenig Geld und keinen Job. Und so überredet sie Gabe Bonner, ihr Arbeit zu geben. Lange schon hat der wortkarge Mann vergessen, was Zärtlichkeit bedeutet. Bis das liebenswert-chaotische Gespann sein Leben völlig auf den Kopf stellt …
Die »Chicago Stars«-Reihe:
1. Ausgerechnet den?
2. Der und kein anderer
3. Bleib nicht zum Frühstück!
4. Träum weiter, Liebling
5. Verliebt, verrückt, verheiratet
6. Küss mich, wenn du kannst
7. Dieser Mann macht mich verrückt
8. Verliebt bis über alle Sterne
9. Und wenn du mich küsst
Alle Romane sind eigenständig lesbar.
Spice-Level: 2 von 5
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 658
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Rachel Stone hat einfach nur Pech! Ohne Geld, dafür mit einem Auto, das Rauch ausstößt, und einem kleinen Sohn, um den sie sich allein kümmern muss, sieht ihre Zukunft ziemlich schwarz aus. Aber die entschlossene junge Witwe mit der skandalösen Vergangenheit hat gelernt, eine Kämpferin zu sein. Und auf den Mund gefallen ist sie schon gar nicht! So überredet sie den wortkargen, aber verdammt attraktiven Gabe Bonner, ihr einen Job zu geben. Der möchte eigentlich einfach nur seine Ruhe, und die stört die junge Frau mit ihrem Talent für Ärger gewaltig. Doch gerade Rachels Temperament könnte perfekt sein, das Herz des sturen Mannes zu erweichen …
Autorin
Susan Elizabeth Phillips ist eine der meistgelesenen Autorinnen der Welt. Ihre Romane erobern jedes Mal auf Anhieb die Bestsellerlisten in Deutschland, England und den USA. Die Autorin hat zwei erwachsene Söhne und lebt mit ihrem Mann in der Nähe von Chicago.
Die erfolgreiche »Chicago Stars«-Reihe:
1. Ausgerechnet den?
2. Der und kein anderer
3. Bleib nicht zum Frühstück!
4. Träum weiter, Liebling
5. Verliebt, verrückt, verheiratet
6. Küss mich, wenn du kannst
7. Dieser Mann macht mich verrückt
8. Verliebt bis über alle Sterne
9. Und wenn du mich küsst
Alle Romane sind unabhängig voneinander lesbar.
Susan Elizabeth Phillips
TRÄUM WEITER, LIEBLING
ROMAN
Deutsch von Gertrud Wittich
Die Originalausgabe erschien 1998
unter dem Titel »Dream a Little Dream« bei Avon Books, an imprint of HaperCollinsPublishers, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 1998 by Susan Elizabeth Phillips
Copyright © 2024 der deutschsprachigen Ausgabe by Blanvalet, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: René Stein
Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
LH ∙ Herstellung: DiMo
ISBN 978-3-641-10752-9V006
www.blanvalet.de
Für Tillie und ihre Söhne,
und für Dad und Bob, zum Gedenken.
1
Das Glück ließ Rachel Stone endgültig im Stich, als sie gerade am »Pride of Carolina« vorbeikam, einem Autokino. Genau dort, auf der schmalen bergigen Asphaltstraße, die in der heißen Julisonne flimmerte, gab ihr altersschwacher Chevy Impala seinen letzten Atemzug von sich.
Sie schaffte es kaum, den Wagen an den Straßenrand zu lenken, als auch schon eine dicke, schwarze Rauchwolke aus dem Motor hervorquoll und ihr die Sicht nahm. Das Vehikel gab direkt unter dem großen sternenförmigen, gelblilafarbenen Eingangsschild des Autokinos seinen Geist auf.
Dieser letzte Schicksalsschlag war einfach zu viel. Sie legte die Hände aufs Lenkrad und ließ verzweifelt den Kopf darauf sinken. Sie konnte nicht mehr; seit drei langen Jahren kämpfte sie sich nun schon durch, doch nun konnte sie einfach nicht mehr. Hier, auf dieser kleinen Landstraße in North Carolina, kurz vor dem Städtchen, das ironischerweise auch noch Salvation hieß, war sie am Ende ihrer Kraft angelangt. Salvation – Rettung. Wo blieb ihre Rettung?
»Mommy?«
Sie wischte sich die Augen mit ihren Fingerknöcheln ab und hob den Kopf. »Ich dachte, du schläfst, mein Schatz.«
»Hab ich auch. Der komische Knall hat mich aufgeweckt.«
Sie drehte sich um und blickte ihren Sohn an, der vor Kurzem seinen fünften Geburtstag gefeiert hatte. Er saß auf dem Rücksitz inmitten schäbiger Schachteln und Kisten, in denen sich alles befand, was sie noch besaßen. Der Kofferraum des Impalas war leer, weil er vor Jahren einmal eingedrückt worden war und sich seither nicht mehr öffnen ließ.
Auf Edwards Wangen waren Abdrücke von der Kiste, auf der sein Kopf gelegen hatte, und eine hellbraune Haarsträhne stand an dieser Stelle in die Höhe. Er war klein für sein Alter, auch viel zu dünn und immer noch ziemlich blass von einer erst kürzlich überstandenen, lebensbedrohlichen Lungenentzündung. Sie liebte ihn über alles.
Seine ernsten braunen Augen blickten sie über den Kopf von Pferdchen an, seinem abgenuckelten Kuscheltierhasen, der von klein auf sein unentbehrlicher Begleiter war. »Is’ wieder was Schlimmes passiert?«
Mit steifen Lippen rang sie sich ein beruhigendes Lächeln ab. »Bloß eine kleine Autopanne, das ist alles.«
»Müssen wir jetzt sterb’n?«
»Nein, natürlich nicht, mein Schatz. Warum steigst du nicht aus und vertrittst dir ein wenig die Beine, während ich mir die Sache ansehe? Aber bleib von der Straße weg.«
Er nahm Pferdchens verschlissene Hasenohren zwischen die Zähne und kletterte über einen Wäschekorb voller Second-Hand-Kleidung und alter Handtücher. Er hatte erbärmlich dünne, blasse Streichholzbeinchen mit knochigen Knien, und auf seinem Nacken war ein kleiner Leberfleck, den sie besonders gern küsste. Sie reckte sich über die Sitzlehne zurück und half ihm beim Öffnen der Wagentür, die kaum besser funktionierte als der kaputte Kofferraumdeckel.
Müssen wir jetzt sterben? Wie oft hatte er ihr diese Frage in letzter Zeit gestellt? Edward war von Natur aus ein eher in sich gekehrtes Kind, und die letzten Monate hatten ihn noch scheuer und ängstlicher gemacht, viel zu ernst für sein Alter.
Sie vermutete, dass er Hunger hatte. Die letzte halbwegs anständige Mahlzeit lag schon vier Stunden zurück: eine vertrocknete Orange, eine Tüte Milch und ein Marmeladensandwich, das er an einem Picknicktisch auf einem Rastplatz in der Nähe von Winston-Salem vertilgt hatte. Was für eine Mutter war sie, dass sie ihrem Kind nichts Besseres bieten konnte?
Eine Mutter, die nur noch neun Dollar und etwas Kleingeld in der Tasche hatte.
Sie sah ihr Gesicht im Rückspiegel des Wagens und musste daran denken, dass sie früher einmal als ausgesprochen hübsch gegolten hatte. Jetzt wiesen ihre Mundwinkel Falten auf, die das harte Leben dort eingegraben hatte, ebenso wie in den Augenwinkeln. Groß sahen sie aus, ihre grünen Augen, so groß, als wollten sie ihr ganzes Gesicht verschlingen. Die sommersprossige Haut über ihren Wangenknochen war blass und so gespannt, dass es schien, als würde sie jeden Moment platzen. Sie hatte kein Geld für Schönheitssalons, und ihre wilde, kastanienrote Haarmähne umrahmte wirr ihr abgemagertes Gesicht. Das Einzige, was sie noch an Schminke besaß, war ein mokka-farbener Lippenstiftstummel, der ganz unten in ihrer Handtasche lag; doch seit Wochen hatte sie sich nicht mehr die Mühe gemacht, ihn zu benutzen. Wozu auch? Obwohl sie erst siebenundzwanzig war, fühlte sie sich wie eine alte Frau.
Sie warf einen Blick hinunter auf ihr ärmelloses Karokleid, das ihr von den knochigen Schultern hing. Der Stoff war schon ganz ausgebleicht und schlotterte ihr um den mageren Körper. Einer der sechs roten Knöpfe war abgeplatzt, und sie hatte ihn durch einen braunen ersetzen müssen. Edward hatte sie erklärt, dass das jetzt »in« war.
Die Tür des Impalas ließ sich nur unter einem protestierenden Quietschen aufdrücken, und sie stieg aus. Sofort spürte sie die Hitze des Asphaltbelags unter ihren dünnen, weißen Sandalen. Ein Riemchen war gerissen, und sie hatte es wieder zusammengeflickt, doch seitdem rieb ihr der so entstandene Knubbel die Außenseite ihrer großen Zehe auf. Ein kleines Ungemach verglichen mit dem weit größeren Problem: zu überleben.
Ein Pick-up sauste vorbei, ohne anzuhalten. Der Fahrtwind peitschte ihr ihre lockige Haarmähne ums Gesicht, und sie hob den Unterarm, um sich die Haare aus dem Gesicht zu streichen und auch, um ihre Augen vor dem Staub zu schützen, den der vorbeirasende Wagen aufwirbelte. Sie blickte hinüber zu Edward. Er stand neben einem Gebüsch, hatte sich Pferdchen unter die Achsel geklemmt und den Kopf weit in den Nacken geneigt, um zu der großen, gelblila Anzeigentafel über ihm hinaufstarren zu können, die wie eine explodierende Galaxis von Sternen dort schwebte. In bunten Glühbirnen standen dort die Worte Pride of Carolina, der Stolz von Carolina.
Mit einem Gefühl von grenzenloser Resignation öffnete sie die Motorhaube und wich dann vor der dicken, schwarzen Rauchwolke zurück, die darunter hervorquoll. Der Mechaniker in Norfolk hatte sie gewarnt, dass es der Motor nicht mehr lange machen würde, und sie wusste, dass dies nicht ein Problem war, das sich mit ein paar Ersatzteilen vom Schrottplatz lösen ließ. Sie ließ den Kopf hängen. Es war nicht nur so, dass sie damit ihr Auto verlor, sondern gleichzeitig auch ihr Zuhause, denn sie und Edward schliefen schon seit fast einer Woche im Wagen. Sie hatte Edward weisgemacht, dass sie Glückspilze wären, weil sie ihr Heim überallhin mitnehmen konnten wie Schildkröten.
Sie ging in die Hocke und versuchte, diesen neuerlichen Schicksalsschlag zu verdauen, einen Schlag, der nur das Ende einer langen Kette ähnlicher Schicksalsschläge bildete, die sie letztlich in dieses Städtchen zurückgeführt hatten, einen Ort, über den sie geschworen hatte, ihn nie wieder zu betreten.
»Verschwinde da, Junge.«
Die tiefe, bedrohliche Männerstimme riss sie aus ihrer Verzweiflung. Sie schoss so schnell in die Höhe, dass ihr einen Moment lang schwindlig wurde und sie sich an der Motorhaube festhalten musste, um nicht umzukippen. Als ihr Kopf wieder klar war, sah sie ihren Sohn wie erstarrt vor einem bedrohlich aussehenden Fremden in Jeans, einem alten blauen Arbeitshemd und einer gespiegelten Sonnenbrille stehen.
Sie hastete so rasch um das Auto herum, dass ihre Sandalen auf dem Kies abrutschten und sie beinahe hingefallen wäre. Edward war starr vor Schreck und konnte sich nicht rühren. Der Mann streckte den Arm nach ihm aus.
Früher einmal war sie ein sanftes, ausgesprochen höfliches, ja verträumtes Mädchen vom Lande gewesen, doch das Leben hatte sie hart gemacht, und sie fauchte den Mann an: »Rühren Sie ihn ja nicht an, Sie Bastard!«
Er ließ langsam den Arm sinken. »Ihr Kind?«
»Ja. Und unterstehen Sie sich, ihn anzufassen!«
»Er hat in meine Büsche gepinkelt.« Die raue, ausdruckslose Stimme des Fremden besaß die gedehnte Sprechweise der Bewohner der Südstaaten, ohne jedoch eine Spur von Emotion aufzuweisen. »Sehen Sie zu, dass er von dort verschwindet.«
Jetzt erst sah sie, dass Edwards Hosenschlitz offenstand, was ihren zarten kleinen Jungen noch verwundbarer aussehen ließ. Schreckerstarrt stand er da, Pferdchen unter die Achsel geklemmt, und starrte zu dem riesigen Mann hoch, der sich vor ihm auftürmte.
Der Fremde war schlank und hochgewachsen, hatte glattes, dunkles Haar und einen verbitterten Zug um den Mund. Sein Gesicht war lang und schmal, eigentlich gut aussehend, mit den deutlich hervortretenden Wangenknochen und den kantigen Zügen, für ihren Geschmack aber zu kalt und grausam. Sie war froh, dass er die Sonnenbrille trug, denn ein Gefühl sagte ihr, dass sie ihm lieber nicht in die Augen sehen wollte.
Sie packte Edward und zog ihn an sich. Schmerzliche Erfahrung hatte sie gelehrt, dass sie sich nicht herumschubsen lassen durfte, also meinte sie höhnisch: »Sind das Ihre ganz persönlichen Pinkelbüsche? Haben Sie die gepachtet? Sie wollten Sie selbst benutzen, oder was?«
Sein Mund bewegte sich kaum, als er antwortete. »Das ist mein Grundstück. Verschwinden Sie von hier.«
»Würd ich ja liebend gern, aber mein Auto hat etwas anderes vor.«
Der Besitzer des Autokinos blickte ohne Interesse auf den defekten Impala. »Da ist ’n Telefon im Ticketschalter und auch die Nummer von Dealy’s Autowerkstatt. Halten Sie sich von meinem Grundstück fern, während Sie auf den Abschleppdienst warten.«
Er wandte sich auf dem Absatz um und stapfte davon. Erst nachdem er hinter der riesigen Filmleinwand verschwunden war, ließ sie ihr Kind wieder los.
»Ist schon okay, mein Schatz. Kümmere dich nicht um den. Du hast nichts Falsches gemacht.«
Edwards Gesicht war bleich; seine Unterlippe zitterte. »D-der Mann hat mir Angst gemacht.«
Sie fuhr ihm mit den Fingern durchs Haar und kämmte die aufgerichtete Haarsträhne zurück. »Ja, das weiß ich, aber er ist bloß ein dummer Pisskopf, und ich war ja da, um dich zu beschützen.«
»Du hast doch gesagt, ich soll nich’ Pisskopf sagen.«
»Nun, hier handelt es sich um mildernde Umstände.«
»Was sind mildernde Umstände?«
»Das heißt, dass er wirklich ein Pisskopf ist.«
»Ach so.«
Sie blickte hinüber zu dem kleinen, hölzernen Ticketschalter, in dem sich das Telefon befand. Er war frisch gestrichen worden, in Senfgelb und Lila, denselben knalligen Tönen wie auf dem Schild, doch sie machte keine Anstalten, dorthin zugehen. Sie hatte weder fürs Abschleppen noch für die Reparatur Geld, und ihre Kreditkarten hatte man ihr schon vor langer Zeit weggenommen. Da sie Edward nicht einer zweiten Begegnung mit dem knurrigen Besitzer des Autokinos aussetzen wollte, zog sie ihn weiter, ein Stück die Straße entlang. »Meine Beine sind ganz steif vom langen Sitzen im Auto. Ich könnte einen kleinen Spaziergang vertragen. Was meinst du?«
»Okay.«
Er schlurfte zögernd den staubigen Straßenrand entlang, und da wusste sie, dass er noch immer verängstigt war. Ihr Zorn auf Pisskopf wuchs. Was für ein Arschloch benimmt sich so einem Kind gegenüber?
Sie griff durchs offene Wagenfenster und holte eine blaue Plastikflasche mit Wasser und die letzten paar schrumpeligen Orangen heraus, die sie von einem Obststand mit heruntergesetzten Waren ergattert hatte. Während sie ihr Kind zu einer kleinen Baumgruppe auf der anderen Seite der Landstraße dirigierte, machte sie sich erneut heftige Vorwürfe, weil sie gegenüber Clyde Rorsch nicht nachgegeben hatte, der bis vor sechs Tagen ihr Boss gewesen war. Sie hatte ihm eins über den Schädel gezogen, als er versuchte, sie zu vergewaltigen, dann hatte sie sich Edward geschnappt und Richmond für immer den Rücken gekehrt.
Jetzt wünschte sie, sie hätte nachgegeben. Wenn sie mit ihm geschlafen hätte, dann könnten sie und Edward jetzt mietfrei in einem Zimmer in Rorschs Motel wohnen, wo sie als Zimmermädchen gearbeitet hatte. Warum hatte sie nicht einfach die Augen zugemacht und ihn gewähren lassen? Skrupel waren ein Luxus, den man sich nicht leisten konnte, wenn das eigene Kind Hunger litt und man kein Dach über dem Kopf hatte.
Sie schaffte es bis Norfolk, als der Kühler ihres klapprigen Impalas den Geist aufgab, und die Reparatur verschlang einiges von ihren ohnehin mageren Geldreserven. Sie wusste, dass andere Frauen in ihrer Lage um finanzielle Unterstützung beim Staat ersucht hätten, doch das kam für sie nicht infrage. Vor zwei Jahren, als sie und Edward in Baltimore wohnten, war sie gezwungen gewesen, genau das zu tun. Die Dame vom Sozialamt hatte sie damals mit der Frage überrascht, ob sie denn überhaupt in der Lage wäre, für Edward zu sorgen, und meinte, es wäre kein Problem, den Jungen vorübergehend in eine Pflegefamilie zu geben, bis Rachel wieder auf die Füße gekommen war. Sie mochte es ja gut gemeint haben, doch Rachel war bei diesen Worten zu Tode erschrocken. Bis zu diesem Augenblick war es ihr nie in den Sinn gekommen, dass man versuchen könnte, ihr Edward wegzunehmen. Sie hatte noch am selben Tag Baltimore den Rücken gekehrt und sich geschworen, sich nie wieder an eine staatliche Stelle um Unterstützung zu wenden.
Seitdem ernährte sie sich und ihr Kind mit mehreren mies bezahlten Jobs, was ihr gerade genug zum Überleben einbrachte, aber nicht genug, um etwas beiseitezulegen, sodass sie wieder zur Schule gehen und einen ordentlichen Beruf lernen konnte. Ein weiteres, großes Problem war, eine passende Betreuung für Edward zu finden, während sie arbeitete. Dafür ging eine Menge von ihrem ohnehin mageren Lohn drauf, und es machte sie außerdem krank vor Sorge – eine Babysitterin beispielsweise hatte Edward den ganzen Tag vor den Fernseher gesetzt, während eine andere ihren Freund geschickt hatte und selbst einfach verschwunden war. Dann hatte Edward auch noch Lungenentzündung bekommen.
Als er das Krankenhaus schließlich wieder verlassen durfte, hatte sie ihren Job bei einer Fast-Food-Kette wegen zu häufigen Fehlens verloren. Die Krankenhauskosten hatten alles verschlungen, was sie besaß, einschließlich ihrer jämmerlich kleinen Ersparnisse, und sie saß obendrein auf einer Arztrechnung, die sie nie im Leben würde bezahlen können. Außerdem brauchte das Kind auch jetzt noch sorgfältige Pflege, um sich wieder ganz erholen zu können, und zu allem Übel hatte man ihr einen Räumungsbescheid wegen unterlassener Mietzahlungen für ihr heruntergekommenes, kleines Apartment zugestellt.
Sie hatte Clyde Rorsch angefleht, sie in einem der kleineren Motelzimmer mietfrei wohnen zu lassen, und versprochen, dafür ihre Arbeitszeit zu verdoppeln. Aber er wollte mehr als das – er wollte Sex auf Abruf. Als sie sich weigerte, wurde er grob, und sie musste ihm eins mit dem Bürotelefon überziehen, um ihn sich vom Leib zu halten.
Sie erinnerte sich daran, wie ihm das Blut über eine Gesichtsseite gelaufen war, und an seinen hasserfüllten Blick, als er ihr drohte, sie einsperren zu lassen. »Wollen doch mal sehen, wie du dich um dein Zuckerpüppchen kümmerst, wenn du im Knast sitzt!«
Wenn sie doch bloß stillgehalten und ihn hätte gewähren lassen. Was ihr noch vor einer Woche undenkbar erschienen war, kam ihr nun gar nicht mehr so abscheulich vor. Sie war hart im Nehmen. Sie hätte es überlebt. Seit es Menschen gibt, benutzten Frauen ihre Körper als Mittel zum Zweck, und auf einmal fiel es ihr schwer, sich vorzustellen, dass sie diese Frauen früher einmal verdammt hatte.
Sie setzte sich mit Edward unter einen Rosskastanienbaum, schraubte die Plastikflasche auf und reichte sie ihm. Als sie die Orange schälte, konnte sie der Versuchung nicht länger wiederstehen, den Blick zu den Bergen hinaufzurichten.
Die Sonne fiel glitzernd und gleißend auf einen beeindruckenden Glasbau, den Tempel von Salvation. Er stand also immer noch, obwohl sie gehört hatte, dass er nun eine Kartonfabrik beherbergte. Vor fünf Jahren war dies das Hauptquartier und die Übertragungsstation von G. Dwayne Snopes gewesen, einem der reichsten und bekanntesten Fernsehprediger des Landes. Rachel drängte die unerfreulichen Erinnerungen beiseite und reichte Edward einen Orangenschnitz nach dem anderen. Er saugte so entzückt daran, als wäre es ein Schokoriegel statt einer alten, vertrockneten Orange, die eigentlich in die Biotonne gehört hätte.
Während der letzte Schnitz in seinem Mund verschwand, wanderte ihr Blick wie zufällig zum Eingangstor des Autokinos.
WIRERÖFFNENINKÜRZE
AUSHILFEABSOFORTGESUCHT
Ein Ruck ging durch ihren Körper. Warum hatte sie das Schild nicht schon früher bemerkt? Ein Job! Vielleicht wendete sich das Blatt ja doch endlich zu ihren Gunsten.
Sie weigerte sich, an den groben Kerl zu denken, dem der Laden gehörte. Den Luxus, wählerisch zu sein, konnte sie sich schon seit Jahren nicht mehr leisten. Ohne den Blick von dem Schild abzuwenden, tätschelte sie Edward am Knie. Es war warm von der Sonne.
»Schatz, ich muss noch mal mit dem Mann reden.«
»Will ich nich’.«
Sie blickte in sein kleines, besorgtes Gesichtchen. »Er ist doch bloß ein Aufschneider. Hab keine Angst. Mit dem werd ich im Handumdrehen fertig.«
»Bleib da.«
»Ich kann nicht, Bärchen. Ich brauch ’nen Job.«
Er sagte nichts mehr, und sie fragte sich, was sie mit ihm tun sollte, während sie Pisskopf aufsuchte. Edward war ein braves und gehorsames Kind, und sie überlegte kurz, ob sie ihn nicht einfach ins Auto setzen sollte, doch der Wagen stand zu nah an der Straße. Nein, sie musste ihn schon mitnehmen.
Mit einem aufmunternden Lächeln zog sie ihn auf die Füße. Sie machten sich auf den Weg zur anderen Straßenseite, und während sie auf das Autokino zumarschierten, kam es ihr nicht in den Sinn, ein Stoßgebet gen Himmel zu schicken. Rachel hatte längst aufgehört zu beten. G. Dwayne Snopes hatte ihr den letzten Rest ihres Glaubens an Gott und die göttliche Gerechtigkeit genommen, und nicht einmal ein Saatkörnchen war übrig geblieben.
Das geflickte Riemchen an ihrer Sandale scheuerte ihr die Zehe noch mehr auf, während sie Edward über die staubige Auffahrt und am Ticketschalter vorbeiführte. Das Autokino musste schon vor mindestens zwanzig oder dreißig Jahren gebaut worden und wohl mindestens zehn Jahre lang nicht in Betrieb gewesen sein. Jetzt sah man am frisch gestrichenen Tickethäuschen und an dem neuen Drahtzaun, der sich um das große Grundstück spannte, dass offenbar Renovierungsarbeiten im Gang waren, dennoch hatte sie den Eindruck, dass noch jede Menge Arbeit zu erledigen war.
Die riesige Filmleinwand war repariert worden, aber die große freie Fläche mit den gleichmäßig angeordneten Reihen von Lautsprecheranschlusspfosten war von Unkraut überwuchert. In der Mitte des Platzes stand ein einstöckiges Betonhäuschen, das schon damals die Snackbar und den Projektionsraum beherbergt hatte. Die wohl früher einmal weiße Fassade war nun grau und verschmutzt. Aus der weitgeöffneten Doppeltür an der Seite des Gebäudes drang laut dröhnende Rockmusik.
Unter der Leinwand erspähte sie einen heruntergekommenen Spielplatz mit einem leeren Sandkasten und einem halben Dutzend Schaukeldelfinen. Sie vermutete, dass die Delfine früher einmal leuchtend hellblau gewesen sein mussten, doch war die Farbe über die Jahre zu einem unscheinbaren Graublau verblasst. Ein rostiges Klettergerüst, der Rahmen einer Schaukel, ein kaputtes Karussell und eine Betonschildkröte vervollständigten die erbärmliche Ansammlung.
»Geh auf den Spielplatz spielen, während ich mit dem Mann rede, Edward. Ich bleib nicht lange.«
Seine Augen flehten sie stumm an, ihn nicht allein zu lassen. Sie lächelte und gestikulierte in Richtung Spielplatz.
Andere Kinder mochten lauthals protestieren, wenn sie nicht ihren Willen bekamen, doch Edward hatte seinen natürlichen Widerspruchsgeist in den letzten paar Jahren Stück um Stück verloren. Er rieb mit den Zähnen über seine Unterlippe und ließ den Kopf hängen, ein Anblick, der ihr das Herz bluten ließ, sodass sie es nicht fertigbrachte, ihn fortzuschicken.
»Also gut, dann komm eben mit und setz dich vor die Tür.«
Seine kleine Hand umkrallte die ihre, als sie ihn in Richtung Betonbau mitzog. Sie spürte, wie ihr der Staub in die Lunge drang. Die Sonne brannte heiß auf ihren Kopf, und die Musik dröhnte in ihren Ohren.
An der Tür angekommen, ließ sie Edwards Hand los und beugte sich zu ihm hinunter, damit er sie über das schrille Kreischen der Elektrogitarren und das Scheppern des Schlagzeugs hören konnte. »Bleib hier, Bärchen.«
Er krallte sich an den Rock ihres Kleides. Mit einem beruhigenden Lächeln löste sie sanft seine Finger und trat in das Gebäude.
Die Snackbar mit den Automaten schien neu zu sein, doch an den schmutzigen Betonwänden hingen noch immer uralte Filmplakate und Flugblätter. Auf der neuen, schneeweißen Anrichte der Bar lag eine Sonnenbrille mit verspiegelten Gläsern, daneben eine noch ungeöffnete Tüte Kartoffelchips sowie ein in Frischhaltefolie gepacktes Sandwich und ein Radio, das die ohrenbetäubende Musik ausspuckte wie Gas, das in eine Todeszelle geleitet wird.
Der Inhaber des Autokinos stand auf einer Klappleiter und war gerade dabei, die Abdeckung einer Neonröhre an der Decke zu befestigen. Er wandte ihr den Rücken zu, was ihr die Gelegenheit gab, dieses neuerliche Hindernis zu begutachten, das ihr vom Leben in den Weg gestellt worden war.
Sie erblickte ein Paar farbbespritzter brauner Arbeitsschuhe und abgewetzte Jeans, in denen lange muskulöse Beine steckten. Die Hüften des Mannes waren schmal, und seine Rückenmuskeln spannten sich unter seinem Hemd, als er den Röhrenschirm mit der einen Hand an die Decke drückte und ihn mit dem Schraubenzieher in der anderen Hand festschraubte. Seine hochgerollten Hemdsärmel enthüllten tiefbraune Unterarme und kräftige Handgelenke sowie große Hände mit überraschend langen, eleganten Fingern. Sein ein wenig ungleich geschnittenes, dunkelbraunes Haar reichte über den Kragen seines Hemds. Es war glatt und wies ein paar graue Fäden auf, obwohl der Mann nicht älter als Anfang bis Mitte dreißig zu sein schien.
Sie schritt zum Radio und drehte die Lautstärke herunter. Ein Mensch mit weniger starkem Nervenkostüm hätte vielleicht vor Schreck den Schraubenzieher fallen lassen oder einen Überraschungslaut von sich gegeben, doch dieser Mann tat keines von beidem. Er wandte einfach nur den Kopf herum und starrte sie an.
Sie blickte in ein Paar silbergraue Augen und wünschte, er hätte die Sonnenbrille nicht abgesetzt. In seinen Augen war keine Spur von Leben. Sie waren hart und leer. Selbst jetzt, wo ihr das Wasser bis zum Hals stand, wollte sie nicht glauben, dass ihre Augen genauso aussahen – vollkommen gefühllos, bar jeder Hoffnung.
»Was wollen Sie?«
Beim Klang dieser flachen, emotionslosen Stimme lief ihr ein Schauder über den Rücken, doch sie zwang sich zu einem sorglosen Lächeln. »Freut mich auch, Sie kennenzulernen. Ich bin Rachel Stone. Der Fünfjährige, den Sie terrorisiert haben, ist mein Sohn Edward, und der Hase, den er mit sich rumschleppt, heißt Pferdchen. Nicht fragen.«
Falls sie gehofft hatte, ihm ein Lächeln zu entlocken, wurde sie enttäuscht. Es fiel ihr schwer, sich vorzustellen, dass dieser harte Mund jemals lächelte. »Ich dachte, ich hätte Ihnen gesagt, dass Sie sich von meinem Grundstück fernhalten sollen.«
Alles an ihm irritierte sie, was sie jedoch tapfer hinter einem unschuldigen Gesichtsausdruck zu verbergen wusste. »Tatsächlich? Muss mir wohl entfallen sein.«
»Hören Sie, Lady …«
»Rachel. Oder Mrs. Stone, falls es Ihnen formal lieber ist. Nun, wie es der Zufall so will, ist heute Ihr Glückstag, denn ich bin eine versöhnliche Natur und daher bereit, Ihre Macho-Allüren zu vergessen. Wo soll ich anfangen?«
»Wovon reden Sie?«
»Von dem Schild am Eingang. Ich bin ab sofort Ihre gesuchte Aushilfe. Meiner Meinung nach gehört als Erstes mal der Spielplatz gesäubert. Haben Sie eine Ahnung, was Sie sich zuschulden kommen lassen mit all den verrosteten Geräten?«
»Ich werde Sie nicht einstellen.«
»Aber sicher werden Sie.«
»Und wie kommen Sie darauf?«, fragte er ohne sonderliches Interesse.
»Weil Sie offensichtlich ein intelligenter Mensch sind, trotz Ihrer groben Umgangsformen, und jeder, der auch nur ein Körnchen Intelligenz hat, kann sehen, dass ich schuften kann wie ein Pferd.«
»Alles, was ich sehen kann, ist, dass ich einen Mann brauche.«
Sie lächelte zuckersüß. »Brauchen wir das nicht alle?«
Er war nicht amüsiert, doch schien ihn ihre schnoddrige Klappe auch nicht zu verärgern. Sein Gesicht blieb vollkommen ausdruckslos. »Ich stelle nur einen Mann ein.«
»Ich werd so tun, als ob ich das nicht gehört hätte, da Geschlechterdiskriminierung in diesem Lande illegal ist.«
»Dann verklagen Sie mich doch.«
Ein anderer mochte an diesem Punkt aufgegeben haben, aber Rachel hatte nur mehr knappe zehn Dollar in der Brieftasche, ein hungriges Kind und ein Auto, das nicht mehr funktionierte.
»Sie machen einen Riesenfehler. So ein Schnäppchen wie mich machen Sie nicht alle Tage.«
»Ich weiß nicht, wie ich’s noch deutlicher sagen soll, Lady. Ich werde Sie nicht einstellen.« Er legte den Schraubenzieher auf den Tresen, griff in seine Gesäßtasche und zog eine Brieftasche heraus, die sich seiner Körperform angepasst hatte. »Hier ist ’n Zwanziger. Nehmen Sie das Geld und ziehen Sie Leine.«
Sie brauchte die zwanzig Dollar, aber eine Arbeit brauchte sie noch dringender, und sie schüttelte den Kopf. »Behalten Sie Ihr Almosen, Mr. Rockefeller. Ich will ’nen festen Job.«
»Dann suchen Sie sich den woanders. Bei mir muss man harte körperliche Arbeit verrichten. Der Vorplatz muss gesäubert werden, der Bau hier braucht ’nen Anstrich, das Dach ein paar neue Schindeln. Nur ein Mann kann so ’ne Arbeit verrichten.«
»Ich bin viel kräftiger, als ich aussehe, und ich arbeite härter als jeder Mann, den Sie finden können. Und außerdem bin ich ziemlich gut, wenn es gilt, aus einem groben Klotz einen netten Menschen zu machen.«
Kaum waren die Worte heraus, hätte sie sich am liebsten auf die Zunge gebissen, denn seine Miene wurde noch ausdrucksloser.
Seine Lippen bewegten sich kaum, und sie musste bei seinem Anblick an einen Revolverhelden mit einem abgrundtiefen Hass auf das Leben denken. »Hat man Ihnen schon mal gesagt, dass Sie ein ausgesprochen freches Mundwerk haben?«
»Das kommt von meinem ausgesprochen scharfen Verstand.«
»Mommy?«
Der Inhaber des Autokinos erstarrte. Sie wandte sich um und sah Edward im Türrahmen stehen, Pferdchen in der Hand und tiefe Sorgenfalten im Gesicht. Er wandte den Blick nicht von dem Mann ab, als er sagte: »Mommy, ich muss dich was fragen.«
Sie ging zu ihm. »Was ist denn los?«
Er senkte seine Stimme zu einem lauten Flüstern ab, wie es Kinder taten, aber sie wusste, dass der Mann ihn deutlich hören konnte. »Bist du sicher, dass wir nich’ sterb’n müssen?«
Ihr Herz krampfte sich zusammen. »Da bin ich ganz sicher.«
Es war einfach verrückt von ihr hierherzukommen. Wie sollte sie sich und ihren Sohn über Wasser halten, bis sie fand, was sie suchte? Keiner, der sie kannte, würde ihr einen Job geben, was bedeutete, dass ihre einzige Chance darin bestand, jemanden zu finden, der erst kürzlich hierhergezogen war. Was sie wiederum zum Inhaber des Pride of Carolina zurückbrachte.
Der Mann stakste zu dem alten schwarzen Wandtelefon. Als sie sich umdrehte, um zu sehen, was er vorhatte, fiel ihr Blick auf ein altes lila Flugblatt. Die Eselsohren konnten das gut aussehende Antlitz von G. Dwayne Snopes, dem verstorbenen Fernsehprediger, nicht verbergen.
Schalten Sie ein und schließen Sie sich den Gläubigen im Tempel von Salvation an!
Wir bringen Gottes Botschaft in alle Winkel der Erde!
»Dealy, hier ist Gabe Bonner. Da ist eine Frau bei mir, die ’ne Autopanne hatte. Sie braucht ’nen Abschleppwagen.«
Zwei Dinge überfielen sie gleichzeitig – die Tatsache, dass sie keinen Abschleppwagen wollte, und der Name des Mannes, Gabriel Bonner. Was hatte ein Mitglied von Salvations prominentester Familie mit einem Autokino zu schaffen?
Soweit sie sich erinnerte, gab es drei Bonner-Brüder, aber nur der Jüngste, Reverend Ethan Bonner, hatte zu ihrer Zeit in Salvation gelebt. Cal, der Älteste, war professioneller Footballspieler gewesen. Obwohl sie wusste, dass er öfter herkam, hatte sie ihn nie persönlich kennengelernt, wusste aber von Fotos, wie er aussah. Der Vater der drei, Dr. Jim Bonner, war der am meisten geachtete Arzt im Landkreis, und die Mutter, Lynn, gab in der High Society des Städtchens den Ton an. Ihre Finger umkrampften Edwards Schultern, als ihr klar wurde, dass sie hier Feindesland betrat.
»… dann schicken Sie die Rechnung an mich. Und, Dealy, wenn Sie schon dabei sind, bringen Sie die Frau und ihren Sohn gleich zu Ethan. Sagen Sie ihm, dass er die beiden irgendwo für die Nacht unterbringen soll.«
Nach ein paar weiteren Worten hängte er auf und wandte sich wieder an Rachel. »Warten Sie beim Auto. Dealy schickt jemanden rüber, sobald seine Karre frei ist.«
Er ging zur Tür, wo er die Hand auf den Türknauf legte und sie anblickte. Was ihn betraf, war die Sache damit erledigt. Sie hasste alles an ihm: seine Arroganz, seine Gleichgültigkeit, und ganz besonders hasste sie seinen männlichen Körper, der ihm das Überleben auf so unfaire Weise erleichterte. Sie hatte nicht um Almosen gebeten. Alles, was sie wollte, war ein Job. Und seine Überheblichkeit, mit der er das Abschleppen ihres Wagens angeordnet hatte, bedrohte mehr als nur ihr Fortkommen. Der Impala war ihr Zuhause.
Sie schnappte sich das Sandwich und die Kartoffelchips vom Tresen und nahm Edward bei der Hand. »Danke für’s Mittagessen, Bonner.« Ohne ihn eines weiteren Blickes zu würdigen, rauschte sie an ihm vorbei hinaus.
Edward trottete neben ihr her die lange, staubige Anfahrt hinunter. Zum Überqueren der Straße nahm sie ihn bei der Hand. Als sie sich wieder unter den Rosskastanienbaum setzten, musste sie gegen eine plötzlich aufsteigende Welle der Verzweiflung ankämpfen. Nein, sie würde noch nicht aufgeben.
Sie hatten es sich kaum unter dem Baum gemütlich gemacht, als ein staubiger schwarzer Pick-up mit Gabriel Bonner am Steuer aus der Einfahrt schoss, auf die Straße einbog und dann verschwand. Sie wickelte das Sandwich aus und inspizierte den Inhalt für Edward: Truthahnbrust, Schweizer Käse und Senf. Er mochte Senf nicht, also wischte sie so viel davon ab, wie sie konnte, bevor sie es ihm reichte. Er begann, ohne zu zögern, zu essen. Er hatte viel zu viel Hunger, um Faxen zu machen.
Der Abschleppwagen tauchte auf, bevor er zu Ende gegessen hatte, und ein kurzgewachsener, untersetzter junger Mann stieg aus. Sie ließ Edward unter dem Baum zurück, überquerte die Straße und begrüßte ihn mit einem gut gelaunten Winken.
»Hat sich rausgestellt, dass ich doch keinen Abschleppwagen brauche. Helfen Sie mir bloß, den Wagen dort hinter die Bäume da zu ziehen, ja? Gabe möchte, dass ich ihn dort abstelle.«
Sie wies auf eine Baumgruppe nicht weit von der Stelle, an der Edward saß. Der junge Mann hatte offensichtlich Zweifel, was die Sache betraf, doch war er nicht gerade der Hellste, sodass sie nicht lange brauchte, um ihn dazu zu bringen, ihr zu helfen. Als er wieder fortfuhr, stand der Impala schön versteckt.
Im Moment war das das Beste, was sie tun konnte. Sie brauchten den Impala zum Übernachten, und das konnten sie nicht, wenn er auf einen Schrottplatz geschleppt wurde. Die Tatsache, dass ihr Wagen nicht mehr fahrtüchtig war, war ein Grund mehr, Gabe Bonner davon zu überzeugen, ihr einen Job zu geben. Aber wie? Ihr kam der Gedanke, dass jemand, dem es so offensichtlich an jeglichem Gefühl fehlte, am besten mit Resultaten zu überzeugen war.
Sie ging zu Edward zurück und zog ihn auf die Füße. »Schnapp dir die Chipstüte, Partner. Wir gehen zurück zum Autokino. Zeit für mich, an die Arbeit zu gehen.«
»Hast du den Job denn gekriegt?«
»Lass mich mal so sagen: Ich geh zum Probearbeiten.« Sie führte ihn zur Straße.
»Was heißt das?«
»Es heißt so was wie, dass ich erst mal zeige, was ich kann. Und während ich schufte, kannst du auf dem Spielplatz weiterfuttern, du Glückspilz.«
»Aber du musst auch was essen.«
»Ich hab im Moment keinen Hunger.« Das stimmte sogar beinahe. Es war so lange her, seit sie eine richtige Mahlzeit gegessen hatte, dass ihr Hungergefühl fast ganz verschwunden war.
Nachdem sie Edward bei der Betonschildkröte abgesetzt hatte, blickte sie sich erst einmal um und überlegte, was sie wohl machen könnte, das kein besonderes Werkzeug erforderte, aber dennoch einen unübersehbaren Eindruck hinterließ. Den überwachsenen Vorplatz ein wenig vom Unkraut zu befreien, erschien ihr als die beste Idee. Sie beschloss, in der Mitte anzufangen, wo man ihre Bemühungen am schnellsten bemerken würde.
Sie arbeitete, während die Sonne heiß auf sie niederbrannte. Ein paarmal wäre sie fast gestolpert, weil sich ihre Beine immer wieder im weiten Rock ihres blauen Karokleides verfingen. Die staubige Erde drang in ihre abgerissenen Sandalen und machte ihre Füße schmutzig. Dort, wo das zusammengeflickte Riemchen rieb, hatte sie mittlerweile eine wunde Stelle.
Sie wünschte, sie hätte ihre Jeans angezogen, aber sie besaß nur noch eine, und die war alt und abgewetzt und hatte ein großes Loch in einem Knie und ein kleineres im abgewetzten Hinterteil.
Rücken und Brust ihres Kleids waren bald schweißnass. Das Haar klebte ihr in Strähnen an den verschwitzten Wangen und am Hals. Sie stach sich an einer Distel, doch ihre Hände waren zu schmutzig, sodass sie nicht an der Wunde saugen konnte.
Als sie einen großen Haufen Unkraut zusammen hatte, stopfte sie alles in eine leere Mülltonne und zerrte diese dann zum Abfallhaufen hinter der Snackbar. Mit grimmiger Entschlossenheit machte sie sich danach wieder über das Unkraut her. Das Pride of Carolina war ihre letzte Chance, und sie musste Bonner beweisen, dass sie härter arbeiten konnte als ein Dutzend Männer.
Der Nachmittag verrann, und sie merkte, wie ihr allmählich immer schwindliger wurde, doch sie ließ sich davon nicht beirren. Sie zerrte eine weitere Ladung zum Abfallhaufen und machte sich erneut an die Arbeit. Silbrige Pünktchen flimmerten ihr vor den Augen, während sie Kreuzkraut und Goldrute aus der trockenen, staubigen Erde riss. Ihre Hände und Arme waren voll blutiger Kratzer, die sie sich beim Ausreißen von Brombeerbüschen zugezogen hatte. Der Schweiß lief ihr in Bächen den Rücken und zwischen den Brüsten hinunter.
Sie merkte, dass Edward ebenfalls angefangen hatte, Unkraut auszureißen, und wieder machte sie sich Vorwürfe, dass sie Clyde Rorsch nicht nachgegeben hatte. Ihr Kopf fühlte sich an wie ein Brandherd, und die silbrigen Pünktchen schwirrten immer wilder. Sie hätte sich hinsetzen und ein wenig ausruhen müssen, doch dafür war keine Zeit.
Die silbrigen Pünktchen explodierten wie ein Feuerwerk, und auf einmal geriet alles um sie herum ins Wanken. Der Boden begann sich zu wölben und ihr entgegenzukommen, ihre Sicht verschwamm und alles drehte sich um sie herum. Sie versuchte, nicht das Gleichgewicht zu verlieren, doch plötzlich war alles zu viel für sie. Ihr Kopf schwirrte, und ihre Knie sackten weg. Aus dem Feuerwerk wurde bodenlose Schwärze.
Als Gabe Bonner zehn Minuten später zum Autokino zurückkehrte, fand er zu seiner Überraschung den völlig aufgelösten Jungen am Boden kauernd vor, seinen kleinen Körper schützend über seine reglose Mutter gebeugt.
2
Aufwachen.«
Etwas Nasses spritzte Rachel ins Gesicht. Ihre Augen öffneten sich flackernd, und sie sah blau-weiße Lichtsäulen über sich. Sie versuchte, sie fortzublinzeln, und bekam dann Panik. »Edward?«
»Mommy?«
Ihr fiel schlagartig wieder alles ein: der Impala, das Autokino. Sie kniff angestrengt die Augen zusammen und versuchte, klarer zu sehen. Die Lichtsäulen stammten von den Neonröhren an der Decke. Sie lag auf dem nackten Betonboden der Snackbar.
Gabe Bonner hatte sich neben ihr auf ein Knie niedergelassen, und Edward stand gleich hinter ihm, mit einem alten, sorgenvollen Ausdruck auf dem kleinen Gesichtchen. »Ach, Schätzchen, es tut mir so leid …« Sie versuchte, sich aufzusetzen, doch ihr Magen rebellierte, und sie wusste, dass sie sich gleich übergeben würde.
Bonner drückte ihr einen Plastikbecher an die Lippen, und Wasser rann über ihre Zunge. Gegen ihre Übelkeit ankämpfend, versuchte sie, ihn abzuwehren, doch er ließ es nicht zu. Das Wasser spritzte ihr übers Kinn und lief ihr in den Nacken. Sie schluckte und merkte, wie sich ihr Magen sofort wieder ein wenig beruhigte. Sie trank noch ein, zwei Schlucke und stellte fest, dass das Wasser einen leichten Nachgeschmack nach abgestandenem Kaffee hatte.
Nur mit großer Mühe schaffte sie es, sich aufzusetzen, und ihre Hände zitterten, als sie versuchte, ihm den Plastikbecher aus der Hand zu nehmen. Er ließ ihn los, sobald sich ihre Finger berührten.
»Wie lang ist es her, seit Sie zuletzt was gegessen haben?« Er äußerte die Frage ohne merkliches Interesse und erhob sich dabei.
Nach ein paar Schlucken mehr und einigen tiefen Atemzügen war sie wieder so weit hergestellt, dass sie ihm eine freche Antwort geben konnte. »Prachtvolles Hüftsteak, erst gestern Abend.«
Wortlos drückte er ihr daraufhin eine Art Kuchen in die Hand, Schokoladenkuchen mit einer cremig weißen Füllung. Sie biss einmal davon ab und hielt das übrige dann automatisch Edward hin. »Iss auf, Schätzchen. Ich hab keinen Hunger.«
»Aufessen!« Das war ein Befehl, schroff, ausdruckslos, zwingend.
Sie hätte ihm den Kuchen am liebsten in sein ausdrucksloses Gesicht gedrückt, hatte aber nicht die Kraft dazu. Also zwang sie sich, ihn mit einigen Schlucken Wasser hinunterzuwürgen, und merkte, wie sie sich gleich besser fühlte. »Das wird mich lehren, nicht die ganze Nacht rauschende Partys zu feiern. Dieser letzte Tango war wohl zu viel.«
Er ließ sich von ihrem Gehabe keine Sekunde lang täuschen. »Warum sind Sie immer noch hier?«
Sie hasste es, zu ihm aufblicken zu müssen, und rappelte sich mühsam auf die Füße, nur um festzustellen, dass ihre Beine sie kaum tragen wollten. Also sank sie auf einen farbbespritzten Metallklappstuhl. »Ist Ihnen aufgefallen … wie viel ich draußen geschafft hab … bevor mir dieser unglückliche kleine Vorfall dazwischenkam?«
»Ist mir aufgefallen. Und ich hab Ihnen gesagt, dass ich Sie nicht einstelle.«
»Aber ich will hier arbeiten.«
»Zu schade.« Ohne erkennbare Hast riss er ein kleines Päckchen Tortilla-Chips auf und reichte sie ihr.
»Ich muss einfach hier arbeiten.«
»Das bezweifle ich.«
»Also, das ist nicht wahr. Ich bin eine Anhängerin von Joseph Campbell. Ich folge nur meinem Ruf.« Sie stopfte sich ärgerlich ein Tortilla-Chip in den Mund und zuckte zusammen, als das Salz in die blutigen Kratzer auf ihren Fingern drang.
Bonner entging nichts. Er packte ihre Handgelenke, drehte ihre erdverschmutzten Handflächen nach oben und sah, wie zerkratzt auch ihre Innenarme waren. Der Anblick schien ihm nicht viel auszumachen. »Es überrascht mich, dass eine Schlaubergerin wie Sie nicht genug Verstand besitzt, um Arbeitshandschuhe anzuziehen.«
»Hab sie in meinem Strandbungalow liegen lassen.« Sie erhob sich. »Ich verschwinde mal kurz auf der Damentoilette, um mich ein wenig frisch zu machen.«
Es überraschte sie nicht, dass er sie widerstandslos gehen ließ. Edward folgte ihr hinter das Häuschen, wo sie die Damentoilette verschlossen vorfand, die Herrentoilette aber offen. Die Armaturen waren alt und unansehnlich, aber sie erspähte einen Stapel Papierhandtücher und ein frisches Stück Seife.
Sie wusch sich, so gut sie konnte, und das kalte Wasser und auch der kleine Happen von vorhin trugen dazu bei, dass sie sich viel besser fühlte. Aber sie sah immer noch katastrophal aus. Ihr Kleid starrte vor Dreck, ihr Gesicht war aschfahl. Sie fuhr mit den Fingern durch die wild zerzausten Haare und kniff sich in die Wangen, während sie darüber nachdachte, wie sie sich von diesem neuerlichen Schlag erholen sollte. Der Impala fuhr keinen Meter mehr, und sie konnte es sich nicht leisten aufzugeben.
Als sie in die Snackbar zurückkehrte, war Bonner gerade damit fertig, die Neonröhre an der Decke festzumachen. Sie zwang sich zu einem strahlenden Lächeln, während sie zusah, wie er die Klappleiter an die Wand lehnte.
»Wie wär’s, wenn ich mit dem Abkratzen dieser Wände anfangen würde, damit Sie sie streichen können? Es wird hier gar nicht so schlecht aussehen, wenn ich fertig bin, glauben Sie mir.«
Ihr Herz rutschte ihr in die Hose, als er sich mit diesem emotionslosen Gesichtsausdruck zu ihr umwandte. »Geben Sie’s auf, Rachel. Ich werd Sie nicht einstellen. Da Sie nicht mit dem Abschleppwagen mitfahren wollten, hab ich jemand anderen angerufen, der Sie abholen kommt. Warten Sie bitte an der Straße.«
Gegen die aufsteigende Verzweiflung ankämpfend, warf sie den Kopf keck in den Nacken. »Unmöglich, Bonner. Sie vergessen, dass ich meinem Ruf folgen muss. Autokinos sind mein Schicksal.«
»Nicht dieses hier.«
Es war ihm egal, wie verzweifelt sie war. Er zeigte keine Spur von Menschlichkeit.
Edward stand neben ihr, die Hand in ihr Kleid verkrallt und diesen alten, sorgenvollen Ausdruck auf dem Gesicht. Etwas in ihr zerbrach bei diesem Anblick. Sie würde alles für dieses kleine Wesen tun, alles.
Ihre Stimme klang so alt und rostig wie ihr Impala. »Bitte, Bonner. Geben Sie mir ’ne Chance.« Sie hielt inne und hasste sich dafür, dass sie ihn anflehte. »Ich würde alles dafür tun.«
Er hob langsam den Kopf, und als seine kalten Silberaugen über sie hinwegglitten, wurde sie sich ihrer wilden Haarmähne und ihres schmutzigen Kleides überdeutlich bewusst. Und noch etwas wurde sie sich gewahr – seine geradezu überwältigende Maskulinität. Es kam ihr vor, als wäre es wieder genauso wie vor sechs Tagen im Dominion Motel.
Seine Stimme war beinahe unhörbar. »Das bezweifle ich ernsthaft.«
Er war ein Mann ohne jegliche Gefühlsregungen, doch da war etwas, etwas Heißes, Gefährliches, das die Atmosphäre im Raum zum Knistern brachte. Es lag keine Lüsternheit in seinem Blick; aber etwas, vielleicht ein primitiver Instinkt, sagte ihr, dass sie sich irrte. Er hatte Gefühle, zumindest was eine bestimmte Sache betraf.
Ein Gefühl der Unausweichlichkeit überkam sie, ein Gefühl, dass all die Kämpfe, die sie bis dahin ausgefochten hatte, unweigerlich zu diesem Moment geführt hatten. Ihr Herz hämmerte wie wild in ihrer Brust, und ihr Mund fühlte sich staubtrocken an. Sie hatte lange genug gegen das Schicksal angekämpft, und es war an der Zeit aufzugeben.
Sie fuhr sich mit der Zunge über die trockenen Lippen und hielt den Blick eisern auf Gabriel Bonner geheftet. »Edward, Schätzchen, ich muss kurz mit Mr. Bonner allein reden. Geh und spiel mit der Steinschildkröte.«
»Will aber nich’.«
»Keine Widerrede.« Sie wandte sich nur so lange von Bonner ab, um Edward zur Tür zu führen. Als er draußen war, schenkte sie ihm ein zittriges Lächeln. »Geh ruhig, Bärchen. Ich komm bald, um dich zu holen.«
Er machte sich zögernd auf den Weg. Ihre Augen brannten, doch sie ließ die Tränen nicht weiter aufsteigen. Keine Zeit. Kein Sinn.
Sie zog die Tür der Snackbar hinter sich zu und drehte den Schlüssel im Schloss herum, dann wandte sie sich mit hochgerecktem Kinn zu Bonner um. Stolz. Wild. Hochmütig. Er sollte wissen, dass sie kein hilfloses Opfer war. »Ich brauch ’ne feste Arbeit, und ich werd alles tun, um sie zu kriegen.«
Er stieß einen Laut aus, der sich fast wie ein Lachen anhörte, nur dass es völlig leblos klang. »Das meinen Sie nicht ernst.«
»O doch, das tue ich.« Ihre Stimme brach. »Pfadfinderehrenwort.«
Sie hob die Hände zu den Knöpfen am Ausschnitt ihres Kleids, obwohl sie nicht mehr darunter anhatte als einen dünnen blauen Nylonslip. Ihre kleinen Brüste lohnten die Ausgabe für einen BH nicht.
Einen nach dem anderen öffnete sie die Knöpfe, während er zusah.
Sie fragte sich, ob er wohl verheiratet war. Angesichts seines Alters und seiner überwältigenden Maskulinität war die Wahrscheinlichkeit groß. Sie konnte die unbekannte Frau nur stumm um Vergebung bitten.
Obwohl er gearbeitet hatte, waren keine schwarzen Ränder unter seinen Fingernägeln, keine dunklen Schweißflecke auf seinem Hemd, und sie versuchte, Dankbarkeit dafür zu empfinden, dass er wenigstens sauber war. Sein Atem würde nicht nach fettigen Zwiebeln und schlechten Zähnen riechen. Dennoch warnte sie eine Art innere Stimme davor, dass Clyde Rorsch wohl das geringere Risiko gewesen wäre.
Seine Lippen bewegten sich kaum. »Wo bleibt Ihr Stolz?«
»Ist mir gerade ausgegangen.« Der letzte Knopf öffnete sich. Sie schlüpfte aus dem weichen, abgetragenen blauen Karokleid. Mit einem sanften Rascheln landete es zu ihren Füßen.
Seine leeren Silberaugen glitten über ihre kleinen, hohen Brüste und die Rippen, die sich deutlich darunter abzeichneten. Ihr knappes Höschen konnte weder ihre scharf hervortretenden Hüftknochen noch die undeutlichen Schwangerschaftsstreifen verbergen, die sich über dem Bündchen abzeichneten.
»Ziehen Sie sich wieder an.«
Sie trat aus dem Kleid heraus und zwang sich, nur in Slip und Sandalen auf ihn zuzugehen. Den Kopf hielt sie dabei stolz hochgereckt, um ihm zu zeigen, dass ihre Würde ungebrochen war.
»Ich bin bereit, Doppelschichten zu arbeiten, Bonner. Tag und Nacht. Kein Mann, den Sie anheuern, würde das tun.« Mit grimmiger Entschlossenheit streckte sie den Arm aus und packte ihn am Bizeps.
»Fassen Sie mich nicht an!«
Er zuckte zusammen, als ob sie ihn geschlagen hätte, und seine Augen waren nicht länger leer. Es stand eine so tiefe Wut darin, dass sie rasch einen Schritt zurückwich.
Er raffte ihr Kleid vom Boden auf und schob es ihr schroff entgegen. »Ziehen Sie sich wieder an.«
Verzweiflung übermannte sie, und sie ließ die Schultern hängen. Sie hatte verloren. Als sich ihre Finger um den weichen Stoff schlossen, fiel ihr Blick auf das Foto von G. Dwayne Snopes, das ihr von dem roten Plakat an der Wand entgegenstarrte.
Sünderin! Hure!
Sie schlüpfte in ihr Kleid, während Bonner zur Tür ging und sie wieder aufschloss. Aber er stieß die Türflügel nicht auf. Stattdessen stemmte er die Hände in die Hüften und ließ den Kopf auf die Brust sinken. Seine Schultern hoben und senkten sich, als würde er nach Luft ringen.
»He, Gabe, ich hab deine Nachricht bekommen. Wo …« Reverend Ethan Bonner erstarrte, als er sie erblickte. Er war blond und sah umwerfend gut aus, mit fein geformten Gesichtszügen und sanften Augen; er war das vollkommene Gegenteil seines Bruders.
Sie sah genau den Moment, in dem er sie erkannte. Sein weicher Mund verdünnte sich zu einem Strich, und in seine sanften Augen trat ein Ausdruck tiefer Verachtung. »Na sieh sich das mal einer an. Wenn das nicht die Witwe Snopes ist, die uns da ein zweites Mal heimsucht.«
3
Gabe wandte sich bei Ethans Worten um. »Wovon zum Teufel redest du?«
Rachel spürte an der Art, wie Ethan seinen Bruder ansah, ein Bedürfnis, den Älteren zu beschützen. Er trat näher, als wolle er sich vor ihn stellen, was lächerlich war, denn Gabe war größer und auch viel kräftiger als Ethan.
»Hat sie dir denn nicht gesagt, wer sie ist?« Er musterte sie mit unverhohlener Verachtung. »Nun, ich denke die Snopes-Sippe war noch nie für ihre Ehrlichkeit bekannt.«
»Ich bin keine Snopes«, erwiderte Rachel hölzern.
»All die armen Trottel, die ihr Geld hergegeben haben, damit Sie in Paillettenkleidern rumlaufen können, würden überrascht sein, das zu hören.«
Gabes Blick wanderte von ihr zu seinem Bruder. »Sie sagt, ihr Name wäre Rachel Stone.«
»Glaub ja nicht, was sie sagt.« Ethan sprach in sanftem Ton mit seinem Bruder, ein Ton, den man gewöhnlich Kranken gegenüber anschlägt. »Sie ist die Witwe des verstorbenen, aber wohl kaum betrauerten G. Dwayne Snopes.«
»Was du nicht sagst.«
Ethan trat nun ganz in die Snackbar. Er trug ein sorgfältig gebügeltes, blaues Oxfordhemd, Kakihosen mit einer scharfen Bügelfalte und blitzblank polierte Lederschuhe. Sein blondes Haar, die blauen Augen und die regelmäßigen Gesichtszüge bildeten einen scharfen Gegensatz zu den kantigen, brutal gut aussehenden Zügen seines Bruders. Ethan hätte einer von Gottes auserwählten Engeln sein können, während Gabriel, trotz seines Namens, nur einem weniger himmlischen Königreich entstammen konnte.
»G. Dwayne ist vor etwa drei Jahren umgekommen«, erklärte Ethan in diesem besorgt-sanften Tonfall, die man Todkranken vorbehält. »Du hast damals in Georgia gelebt. Er war dabei, sich mit ein paar Millionen Dollar, die ihm nicht gehörten, aus dem Staub zu machen.«
»Ich erinnere mich, davon gehört zu haben.« Gabe schien eher aus Gewohnheit als aus wirklichem Interesse etwas zu sagen. Sie fragte sich, ob ihn überhaupt irgendetwas interessierte. Ihr Striptease jedenfalls nicht. Sie erschauderte und versuchte, nicht daran zu denken, was sie getan hatte.
»Sein Flugzeug ist über dem Meer abgestürzt. Seine Leiche hat man zwar gefunden, aber das Geld liegt wohl noch immer auf dem Grund des Atlantiks.«
Gabe lehnte sich an den Tresen und wandte ihr langsam den Kopf zu. Sie merkte, dass sie ihm nicht in die Augen sehen konnte.
»G. Dwayne war ein ziemlich ehrlicher Kerl, bis er sie geheiratet hat«, fuhr Ethan fort, »aber Mrs. Snopes liebt nun mal teure Autos und schicke Kleider. Er wurde gierig, um sie mit Samt und Seide auszustaffieren, und die Art, auf die er Geld sammelte, wurde so unverschämt, dass ihn das am Ende zu Fall brachte.«
»Nicht der erste Fernsehprediger, dem so was passiert«, bemerkte Gabe.
Ethan presste die Lippen zusammen. »Dwayne hat eine Wohlstandstheologie gepredigt. ›Gebt, damit euch gegeben wird.‹ Trennt euch von eurem Geld, selbst wenn’s euer letzter Dollar ist, und ihr bekommt hundert Dollar dafür zurück. Snopes hat Gott als allmächtigen Geldspucker hingestellt, und die Leute sind scharenweise darauf reingefallen. Er bekam Wohlfahrtsschecks und Geld, das eigentlich für die so notwendige Krankenversicherung bestimmt war. Eine Frau in South Carolina hat Dwayne sogar das Geld geschickt, das sie eigentlich für ihr Insulin gebraucht hätte, da sie Diabetikerin war. Statt es ihr zurückzuschicken, hat Dwayne den Brief laut in seiner Sendung vorgelesen, als Beispiel, dem alle folgen sollten. Es war ein goldener Moment in der Welt der Fernsehprediger.« Ethans Augen flackerten über Rachel hinweg, als wäre sie etwas, das in den Abfall gehört. »Die Kamera schwenkte auf Mrs. Snopes, die mit Glitterkleid und stark geschminktem Gesicht in der ersten Reihe des Tempels saß und Tränen der Dankbarkeit über ihr Rouge rinnen ließ. Später ist ein Reporter vom Charlotte Observer der Sache nachgegangen und hat herausgefunden, dass die Frau in ein diabetisches Koma verfiel und sich nie wieder davon erholt hat.«
Rachel senkte den Blick. Die Tränen damals hatte sie aus Scham und Hilflosigkeit vergossen, doch das wusste niemand. Bei jeder Sendung musste sie in der ersten Reihe sitzen, herausgeputzt wie eine Schnepfe, mit geföhnter und haarspraygepanzerter Hochfrisur, viel zu starkem Make-up und Glitzerkleidern – Dwaynes Inbegriff von weiblicher Schönheit. Am Anfang ihrer Ehe hatte sie sich seinen Wünschen gefügt, aber als ihr klar wurde, wie korrupt Dwayne war, wollte sie ausbrechen. Doch ihre Schwangerschaft hatte das unmöglich gemacht.
Als Dwaynes Unterschlagungen und zwielichtige Methoden publik wurden, versuchte er, mit einer Reihe von live übertragenen, tränenreichen Schuldbekenntnissen seine Haut zu retten. Immer wieder Vergleiche mit Eva und Delila ziehend, behauptete er, von seiner schwachen und sündigen Frau vom rechten Pfad abgebracht worden zu sein. Er war schlau genug, die Schuld auf sich selbst zu nehmen, doch seine Botschaft war unmissverständlich. Wenn seine Frau nicht so maßlos wäre, wäre das Ganze nie passiert.
Nicht alle kauften ihm seine Beteuerungen ab, aber die meisten schon, und sie wusste nicht mehr, wie oft sie in den letzten drei Jahren erkannt und öffentlich angegriffen worden war. Anfangs versuchte sie zu erklären, dass ihr extravaganter Lebensstil Dwaynes Wunsch gewesen war, doch niemand glaubte ihr, und sie lernte daraufhin, dass es besser war, gar nichts zu sagen.
Die Tür der Snackbar öffnete sich quietschend, gerade weit genug, um einen kleinen Jungen hereinzulassen, der an die Seite seiner Mutter flüchtete. Sie wollte nicht, dass Edward die Auseinandersetzung mitbekam, und meinte deshalb in unbewusst scharfem Ton: »Ich hab dir doch gesagt, du sollst draußen bleiben.«
Edward ließ den Kopf hängen und sprach so leise, dass sie ihn kaum verstehen konnte. »Da war dieser – dieser große Hund.«
Das bezweifelte sie, drückte ihm aber dennoch beruhigend die Schulter. Gleichzeitig funkelte sie Ethan mit all dem Zorn einer Mutter an, dass er es ja nicht wagen sollte, etwas Abfälliges vor ihrem Kind zu sagen.
Ethan starrte Edward an. »Ich hab ganz vergessen, dass Sie und Dwayne einen Sohn haben.«
»Das ist Edward«, sagte sie in einem Ton, als ob überhaupt nichts geschehen wäre. »Edward, sag Guten Tag zu Reverend Bonner.«
»Hi.« Er wandte die Augen nicht von seinen Schuhen ab. Dann flüsterte er ihr auf seine deutlich hörbare Art zu: »Is’ er auch ein Scharlotter?«
Sie begegnete Ethans fragendem Blick. »Er will wissen, ob Sie auch ein Scharlatan sind.« Ihre Stimme verhärtete sich. »Er hat gehört, wie man das über seinen Vater sagte …«
Einen Moment lang wirkte Ethan entsetzt, doch fing er sich rasch wieder. »Ich bin kein Scharlatan, Edward.«
»Reverend Bonner ist waschecht, Partner.« Sie sah Ethan direkt in die Augen. »Ein Mann ohne Vorurteile und voller Mitgefühl für die Benachteiligten unter uns.«
Wie sein Bruder gab auch er nicht so leicht nach, und ihr Versuch, ihn zu beschämen, schlug fehl. »Versuchen Sie gar nicht erst, sich wieder hier einzunisten, Mrs. Snopes. Sie sind hier unerwünscht.« Er wandte sich an Gabe. »Ich muss zu einer Konferenz in die Stadt zurück. Lass uns doch heute Abend zusammen essen.«
Bonner wies mit einer Kopfbewegung auf Rachel. »Was wirst du mit ihnen machen?«
Ethan zögerte. »Tut mir leid, Gabe. Du weißt, dass ich alles für dich tun würde, aber in dem Fall kann ich dir nicht helfen. Salvation kann gut auf Mrs. Snopes verzichten, und ich will ihr die Rückkehr auf keinen Fall auch noch erleichtern.« Er strich mitfühlend über den Arm seines Bruders und eilte dann zur Tür.
Gabe erstarrte, eilte hinter ihm her. »Ethan! Moment mal.«
Edward blickte zu ihr auf. »Keiner mag uns.«
Sie versuchte, den plötzlich aufsteigenden Kloß in ihrem Hals hinunterzuschlucken. »Wir sind die Besten, Lämmchen, und jeder, der das nicht merkt, ist es nicht wert, dass wir unsere Zeit mit ihm verschwenden.«
Sie hörte eine Verwünschung, und schon tauchte Gabe wieder auf, das Gesicht finster wie eine Gewitterwolke. Er stemmte die Hände in die Hüften und blickte wild funkelnd auf sie hinab. Da wurde sie sich zum ersten Mal seiner ungewöhnlichen Größe bewusst. Sie selbst war eins vierundsiebzig groß, also auch nicht gerade klein, doch in seiner Gegenwart kam sie sich winzig und wehrlos vor.
»In all den Jahren, in denen ich meinen Bruder kenne, hab ich noch nie erlebt, dass er jemandem seine Hilfe verweigert.«
»Ich hab die Erfahrung gemacht, Bonner, dass selbst der aufrechteste Christ eine Grenze hat. Und die scheine ich zu sein.«
»Ich will Sie hier nicht haben!«
»Erzählen Sie mir doch mal was Neues.«
Sein Gesichtsausdruck verfinsterte sich noch mehr. »Hier ist es nicht sicher genug für ein Kind. Er kann hier nicht bleiben.«
Gab er etwa nach? Hatte sie ihn weich gekocht? »Ich weiß schon, wo ich ihn unterbringen kann«, log sie schnell.
Edward drängte sich enger an sie.
»Wenn ich Sie anstelle, dann nur für ein paar Tage, bis ich jemand anderen gefunden hab.«
»Verstanden.« Sie versuchte, sich ihre freudige Erregung nicht anmerken zu lassen.
»Also gut«, fauchte er. »Morgen früh um acht Uhr. Und machen Sie sich auf einen knochenharten Arbeitstag gefasst.«
»Kein Problem.«
Wieder verfinsterte sich sein Gesicht um einige Grade. »Es ist nicht meine Sache, ’ne Unterkunft für Sie zu finden.«
»Ich hab eine Unterkunft.«
Er betrachtete sie misstrauisch. »So, wo denn?«
»Geht Sie nichts an. Ich bin nicht hilflos, Bonner. Ich brauch nur ’nen Job.«
Das Wandtelefon klingelte. Er ging hin und hob ab, und sie lauschte einer einseitigen Unterhaltung über ein Lieferproblem. »Ich komm rüber und kümmere mich um die Sache«, verkündete Mr. Charme schließlich.
Er hängte ein, schritt zur Tür und hielt sie auf. Das tat er nicht aus Höflichkeit, wie sie wusste, sondern um sie endlich loszuwerden.
»Ich muss in die Stadt fahren. Über eine Unterkunft reden wir, wenn ich wieder da bin.«
»Ich sagte doch schon, dass ich eine habe.«
»Darüber reden wir, wenn ich wieder da bin«, fuhr er sie an. »Warten Sie auf dem Spielplatz auf mich. Und suchen Sie gefälligst eine Beschäftigung für Ihr Kind!«
Damit stapfte er davon.
Sie hatte keineswegs die Absicht, hier herumzuhängen, bis er wieder auftauchte und womöglich herausfand, dass sie im Wagen übernachtete, also wartete sie, bis er davongefahren war und eilte dann zu ihrem Impala. Während Edward auf dem Rücksitz ein Mittagsschläfchen hielt, wusch sie sich in einem kleinen Zufluss des French Broad Rivers, der in der Nähe der Baumgruppe dahinfloss, und anschließend auch gleich noch ihre schmutzige Wäsche. Dann zog sie ihre abgerissene Jeans und ein altes, melonenfarbenes T-Shirt an. Edward erwachte, und sie sangen alberne Lieder und erzählten sich Witze, während sie ihre Wäsche auf ein paar niedrigen Zweigen in der Nähe des Autos aufhängten.
Die Nachmittagsschatten wurden länger. Sie hatte keine Lebensmittel mehr und wusste, dass sie den Gang in die Stadt nicht mehr hinausschieben konnte. Mit Edward an ihrer Seite ging sie die Landstraße entlang, bis sie das Autokino hinter sich gelassen hatten, dann streckte sie ihren Daumen raus, als sich ein alter Chevy näherte.
Darin saß ein pensioniertes Pärchen aus St. Petersburg, die den Sommer in Salvation verbrachten. Sie plauderten angeregt mit ihr und waren auch sehr nett zu Edward. Sie bat sie, sie am Ingles Grocery Store am Rande der Stadt rauszulassen, und sie winkten ihr noch nach, als sie davonfuhren, froh darüber, dass das Pärchen die berüchtigte Witwe Snopes nicht erkannt hatte.
Ihr Glück hielt jedoch nicht lange an. Sie war erst ein paar Augenblicke in dem Supermarkt, als sie merkte, wie ein Verkäufer am Gemüsestand sie anstarrte. Sie konzentrierte sich darauf, einen nicht allzu angeschlagenen Pfirsich vom Regal mit dem heruntergesetzten Obst auszuwählen. Aus dem Augenwinkel sah sie eine grauhaarige Dame mit ihrem Mann flüstern.
Rachel hatte sich so sehr verändert, dass sie mittlerweile nicht mehr so oft erkannt wurde wie kurz nach dem Skandal, aber sie befand sich hier in Salvation, und die Leute hatten sie persönlich gesehen, nicht nur auf dem Bildschirm eines Fernsehers. Selbst ohne aufgebauschte Föhnfrisur und zwölf Zentimeter hohen Pfennigabsätzen wussten sie, wer sie war. Rachel ging rasch weiter.
In der Brotabteilung legte eine ordentlich gekleidete Frau Mitte vierzig mit einer strengen, schwarz gefärbten Kurzfrisur eine Packung englischer Muffins beiseite und starrte Rachel an, als hätte sie den leibhaftigen Teufel vor sich.
»Sie.« Sie spuckte das Wort förmlich aus.
Rachel erkannte Carol Dennis sofort wieder. Sie hatte als freiwillige Helferin im Tempel angefangen und sich bis an die Spitze hinaufgearbeitet, wo sie schließlich zu dem kleinen Kader treuer Gefolgsleute von Dwayne, die als seine persönlichen Assistenten fungierten, gehört hatte. Carol war tiefreligiös und hatte Dwayne sowohl verehrt als auch heftig verteidigt.
Als seine Schwierigkeiten publik wurden, konnte Carol nie akzeptieren, dass ein Mensch, der Gottes Wort mit derartiger Inbrunst predigte wie G. Dwayne Snopes, ein korrupter Gauner sein sollte, also schob sie die Schuld für seinen Sturz auf Rachel.
Sie war beinahe unnatürlich dünn, hatte eine messerscharfe Nase und ein spitzes Kinn. Ihre Augen waren ebenso schwarz wie ihr gefärbtes Haar, ihre Haut makellos, aber bleich. »Ich kann nicht fassen, dass Sie zurückgekommen sind.«
»Ist schließlich ein freies Land, oder?«, parierte Rachel.
»Wie können Sie bloß Ihr Gesicht hier zeigen?«
Ihr Trotz verpuffte. Sie reichte Edward einen kleinen Laib Vollkornbrot. »Würdest du das für mich nehmen?« Dann machte sie Anstalten weiterzugehen.
Die Frau sah Edward, und ihr Gesichtsausdruck wurde ein wenig milder. Sie trat vor und beugte sich zu ihm nieder. »Ich hab dich nicht mehr gesehen, seit du ein Baby warst. Was für ein hübscher kleiner Mann du geworden bist. Ich wette, du vermisst deinen Daddy.«
Es war nicht das erste Mal, dass Edward von Fremden übermäßig vertraulich angesprochen wurde, und er mochte es nicht. Er duckte sich weg.
Rachel versuchte, an ihr vorbeizukommen, aber Carol schob rasch ihren Einkaufswagen in den Weg. »Der Herr sagt, wir sollen den Sünder lieben und die Sünde verabscheuen, aber bei Ihnen fällt mir das schwer.«
»Ich bin sicher, dass Sie es schaffen, Carol, eine aufrechte Christin wie Sie.«
»Sie wissen gar nicht, wie oft ich für Sie gebetet habe.«
»Heben Sie sich Ihre Gebete für jemanden auf, der sie haben will.«
»Sie sind hier nicht willkommen, Rachel. Viele von uns hatten dem Tempel ihr Leben geweiht. Wir glaubten, und wir haben auf eine Weise gelitten, die Sie niemals verstehen würden. Unsere Erinnerung währt lange, und falls Sie der Ansicht sind, dass wir dastehen und zusehen, wie Sie sich hier wieder einrichten, dann irren Sie sich.«
Rachel wusste, dass es ein Fehler war zu antworten, aber sie musste sich einfach verteidigen. »Ich habe auch geglaubt. Keiner von euch hat das je verstanden.«
»Sie haben an sich selbst geglaubt, an Ihre Bedürfnisse.«