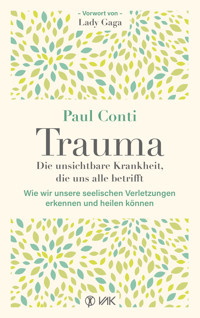
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VAK
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Trauma ist überall und betrifft uns alle, oft ohne, dass wir es wissen. Das liegt daran, dass viele falsche Vorstellungen von Trauma kursieren und wir es im Allgemeinen mit schrecklichen Ereignissen wie Krieg oder Gewalterfahrungen verbinden, die vermeintlich nur wenigen von uns widerfahren. Doch Trauma wirkt oft im Verborgenen und wir alle haben schon traumatische Erfahrungen gemacht, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Viele kleine Mikroaggressionen, tägliche Verletzungen oder Zurückweisungen setzen in uns bereits traumatische Prozesse in Gang, die Veränderungen in unserer Persönlichkeit auslösen und den Blick, mit dem wir uns selbst und die Welt sehen, negativ beeinflussen. Nach Auffassung des renommierten Psychiaters Paul Conti ist Trauma vergleichbar mit einer unsichtbaren Pandemie, die unmerklich unter Familien und Freunden und auch zwischen ganzen Generationen und breiteren Bevölkerungsgruppen weitergegeben wird. Studien belegen, dass Trauma ganz konkrete physiologische Veränderungen im Gehirn auslöst. Daraus entstehen seelische Belastungen, die uns unmerklich das Leben schwermachen und im schlimmsten Fall zu Konflikten und Gewalt gegen uns selbst und andere führen können, ohne dass wir die Hintergründe verstehen. Paul Conti hat es sich daher zum Ziel gesetzt, umfassend darüber aufzuklären, wodurch Trauma ausgelöst wird, wie es uns vereinnahmt und mit welchen Mechanismen es unsere Empfindungen und unsere Sicht auf die Welt und andere beeinflusst. Aufgrund seiner Erfahrung als praktizierender Psychiater hat er ein einzigartiges Set an Tools, praktischen Übungen und Ressourcen zusammengestellt, mit dem wir die Auswirkungen von Trauma in uns erkennen und uns davon befreien können. Mit seinem einfühlsamen und lebensbejahenden Ratgeber lädt er uns dazu ein, selbstwirksam traumatische Erfahrungen zu überwinden und uns positiv zu entfalten. Mit einem Vorwort von Lady Gaga!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Conti
TRAUMA:DIE UNSICHTBARE KRANKHEIT, DIE UNS ALLE BETRIFFT
Wie wir unsere seelischen Verletzungen erkennen und heilen können
Aus dem Englischen von Astrid Ogbeiwi
VAK Verlags GmbH Kirchzarten bei Freiburg
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
Trauma: The Invisible Epidemic
Copyright © 2021 Paul Conti. Vorwort © 2021 Ate My Heart.
Translation published by arrangement with Sounds True and by the agency of Agence Schweiger.
Published in the United States by Sounds True, Inc.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text die weibliche und die männliche Form gewählt; alle Angaben beziehen sich selbstverständlich auf Angehörige aller Geschlechter.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
VAK Verlags GmbH
Eschbachstraße 5
79199 Kirchzarten
Deutschland
www.vakverlag.de
© VAK Verlags GmbH, Kirchzarten bei Freiburg 2022
Übersetzung: Astrid Ogbeiwi
Lektorat: Irene Klasen
Layout & Satz: Ulrich Schmid, de·te·pe, Aalen
Cover: Richard Kiefer, VAK unter Verwendung des Originalcover-Designs von Jennifer Miles; Cover-Bild: © Oksancia – shutterstock.com Druck: Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg Printed in Germany
ISBN 978-3-86731-260-8 (Paperback)
ISBN 978-3-95484-452-4 (ePub)
ISBN 978-3-95484-453-1 (PDF)
Inhalt
Vorwort
Einführung
Warum ich dieses Buch geschrieben habe und was ich mir davon für Sie erhoffe
TEIL IWas Trauma ist und wie es wirkt
Kapitel 1: Wie wir über Trauma sprechen
Analogien zum Trauma
Ich muss Ihnen etwas erzählen
Vier kurze Erzählungen
Kapitel 2: Traumaarten und posttraumatische Syndrome
Akutes Trauma
Chronisches Trauma
Stellvertreter-Trauma oder indirekte Traumatisierung
Posttraumatische Syndrome
Kapitel 3: Scham und ihre Komplizen
Gesünderes Ich, gesünderes Wir
Scham wirkt am besten im Dunkeln
Die heimlichen Lektionen von Trauma
Die Erfahrungen mit Scham in meiner Familie
Kapitel 4: Ein Gespräch mit Stephanie zu Guttenberg
Kapitel 5: Mitgefühl, Gemeinschaft und Menschlichkeit
Trauma verändert die Landkarte
TEIL IIDer erweiterte Blick – Trauma-Soziologie
Kapitel 6: Die Probleme mit Trauma im Gesundheitswesen
Kapitel 7: Ein Gespräch mit Dr. Daryn Reicherter
Kapitel 8: Gesellschaftliche Krankheiten, gesellschaftliches Trauma
Drei Krisen
Trauma und der Angriff auf Mitgefühl, Gemeinschaft und Menschlichkeit
Kapitel 9: Gesellschaftliche Krankheiten, gesellschaftliche Lösungen
TEIL IIIEin Benutzerhandbuch für Ihr Gehirn
Kapitel 10: Was Trauma mit dem Denken macht
Logik, Emotion und Gedächtnis
Kognitive Scheuklappen
Viktimisierung und Opferhaltung
Mein eigener limbischer Flächenbrand
Kapitel 11: Das limbische System
Affekt, Gefühl und Emotion
Springen und Landen
Erinnerungen enthalten keinen Sinn
Feuern und Verbinden
Kapitel 12: Die verheerenden Auswirkungen von Trauma auf Körper und Psyche
Entzündungen und chronische Schmerzen
Autoimmunerkrankungen
Beschleunigte Alterung
Neue Normalitäten sind gar nicht so normal
TEIL IVWie wir Trauma besiegen können – gemeinsam
Kapitel 13: Der Weg nach Hause
Verbündete, Engel und Teufel
Kapitel 14: Führen mit Weisheit, Geduld und einer wahren Lebenserzählung
Führen mit Weisheit und Geduld
Klare Kommunikation
Die Wichtigkeit von Geschichten und einer wahren Lebenserzählung
Kapitel 15: Humanistisches gesellschaftliches Engagement
Unser Engagement
Fünf Grundlagen
Fünf Ziele
Abschließende Gedanken
Danksagungen
Literaturverzeichnis
Über den Autor
Für meine Töchter Colette und Amelie
Es sind dieselben Sterne und es ist derselbe Mond, die auf eure Brüder und Schwestern herabblicken und die sie sehen, wenn sie zu ihnen aufschauen, obwohl sie so weit von uns entfernt sind, und voneinander.
AUS OLIVE GILBERT (SOJOURNER TRUTH), NARRATIVE OF SOJOURNER TRUTH
Vorwort
Von Lady Gaga, Stefani Germanotta
Behutsam wurde ich in die Notaufnahme irgendeines privaten Krankenhauses in New York verfrachtet. Es war auf einer Welttournee und ich habe noch das Bild von einem Arzt und einer Krankenschwester vor Augen. Sie baten mich ganz ruhig, von 100 rückwärts zu zählen, während ich immer weiter schrie. Ich weiß noch, dass ich sagte: „Warum kriegt denn hier keiner Panik?“ Sie forderten mich auf, weiter von 100 rückwärts zu zählen, bis ich etwa bei 69 angekommen war … glaube ich. Da hörte ich auf zu zählen und erklärte: „Hallo, ich bin Stefani.“ Außerdem gestand ich, dass ich meinen Körper nicht spüren konnte, dass alles ganz taub war.
Ich sah zu, wie sie den Blick starr auf einen Herzmonitor gerichtet hielten, an den ich angeschlossen war, wie ich dann feststellte. Beide gaben sich große Mühe, ihre Sorgen wegen meiner hohen Herzfrequenz zu verbergen. Ich verstand ihre Besorgnis, aber mir fehlte in dem Moment einfach die Kraft, mich auch nur über einen einzigen weiteren Punkt aufzuregen. Ich befand mich in einem Zustand tiefer Dissoziation von der Realität, und später erfuhr ich, dass ich einen psychotischen Zusammenbruch hatte.
„Gleich kommt ein Arzt“, versicherten sie mir.
Ich bat um ein Medikament (ohne zu wissen, welches ich wollte) und dachte mir dabei, dass man mir sicher etwas Starkes verabreichen könnte. Ich war aufgebracht, dass man mir keine Medikamente geben wollte, bis dieser „Arzt“ da wäre.
Kurz darauf betrat jemand den Raum. Ich bemerkte sofort, dass es ein Mann war, und auch, dass er keinen weißen Kittel trug und dass kein Stethoskop zu sehen war.
„Hallo, ich bin Dr. Paul Conti“, sagte er. „Ich bin Psychiater.“
Ich sah die Krankenschwester an, die bei mir geblieben war, und hatte gar nicht mitbekommen, dass der andere Arzt den Raum schon vor einer ganzen Weile verlassen hatte.
„Warum haben Sie mir keinen richtigen Arzt geschickt?“, fragte ich sie. Paul antwortete: „Ich bin Italiener aus New Jersey“, und in dem Moment beschloss ich, dass ich mit ihm reden wollte. Mein Vater ist Italiener aus New Jersey, deshalb dachte ich, ich wüsste zumindest, womit ich es zu tun hatte.
In diesem Moment begann ich eine Reise, auf der ich bis heute bin. Eine Reise mit einem Mann, dem ich noch nie zuvor begegnet war, der es aber irgendwie zu einem Teil seines Lebenswerks machen sollte, mich zu verstehen und mir zu helfen. Erst nach zweijähriger Zusammenarbeit verriet er mir, dass er sechs Monate gebraucht hatte, um mich einzuschätzen und herauszufinden, ob ich „beweglich“ war, wenn ich mich erkennbar in einem Zustand traumatischer Lähmung befand.
Ich werde Ihnen nicht alles erzählen, was sich zwischen uns beiden abgespielt hat. Aber ich sage Ihnen Folgendes: Paul trug seinen weißen Kittel nur, wenn es nötig war. Um mich daran zu erinnern, dass er Arzt ist. Meistens hat sich Paul im gegenseitigen Einvernehmen mir gegenüber als Mitmensch und als ein Mann verhalten, bei dem ich mich sicher fühlen konnte. Wir haben einander kennengelernt, da wir einen Heilungsprozess für mich begonnen haben, den ich selbst für unmöglich gehalten habe. Ich kann jetzt mit Gewissheit sagen, dass dieser Mann mir das Leben gerettet hat. Er hat das Leben lebenswert gemacht. Vor allem aber hat er mir die Kraft gegeben, mich selbst wiederzufinden und zurückzugewinnen. Ganz egal, ob Paul mir das beigebracht hat oder ob wir es miteinander entwickelt haben, ich weiß mit Sicherheit, dass Frauen Männer nicht einfach deshalb brauchen, damit sie uns helfen – wir brauchen Männer (und auch Menschen, die keine Männer sind), die an uns glauben, damit unsere Traumata heilen können.
Dr. Paul Conti ist so ein Mann. Er glaubt an die Erzählungen von Frauen und an die Traumata, die sie mit sich tragen. Er weiß auch, dass Trauma nicht auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe beschränkt ist, dass es ein allgemein menschliches Problem ist. Und er glaubt an Heilung. Paul ist freundlich und wir könnten alle von seiner Freundlichkeit lernen. In dem Moment, in dem ich das in ihm erkennen konnte, wusste ich, dass Heilung möglich ist. Jetzt bin ich auf dieser Reise, und Sie auch.
Einführung
Wie Sie auch, habe ich einiges erlebt, seit ich auf die Welt gekommen bin (bei mir war das vor gut 50 Jahren im zweiten Stock des St. Francis Hospital in Trenton, New Jersey). Vieles war schön, aber einiges war auch schwierig und emotional schmerzhaft. Ich betrachte mich als ganz normalen Menschen, der ein paar tragische Erfahrungen gemacht, sie tief empfunden und viel darüber nachgedacht hat. Ich bin Arzt und praktizierender Psychiater mit Ausbildungen in Hirnbiologie und Psychologie und betreibe meinen Beruf von einem ganzheitlichen Standpunkt aus. Ich hatte das Privileg, unzählige Menschen zu begleiten, die intensive und oft lebensverändernde Situationen durchgemacht haben. Alle diese Beziehungen sind für mich etwas Persönliches, und durch diese Beziehungen sowie durch meine eigenen Erfahrungen bin ich zu meiner Auffassung über Trauma und seine verheerende Rolle in unserem Leben gekommen.
Bevor ich mich fürs Medizinstudium entschied, war ich in der Wirtschaft tätig. Bis dahin bestand meine Erfahrung mit dem Gesundheitswesen ausschließlich darin, ältere Verwandte im Krankenhaus zu besuchen – meist italienische Einwanderer der ersten und zweiten Generation, von denen einige unserem Land im Zweiten Weltkrieg gedient hatten (in Kapitel 5 erfahren Sie, wie das bei meinem Onkel Rango war). Mit zunehmendem Alter brauchten diese Verwandten eine intensivere Betreuung, als sie es von den vertrauten Ärzten vor Ort gewohnt waren, und die Umstellung auf Krankenhausbesuche fiel keinem von uns leicht. Die Ärzte und Pflegekräfte wirkten immer so beschäftigt und abgehoben und sprachen kaum mit uns. Und wenn doch, konnten wir oft kaum enträtseln, was sie meinten, und ich fühlte mich oft eingeschüchtert und verunsichert. Ich wusste, dass es Möglichkeiten geben musste, mit Menschen in solch schwierigen Situationen freundlicher und besser umzugehen, aber damals hätte ich nie gedacht, dass ich einmal einen so großen Teil meines Lebens darauf verwenden würde, Menschen Aufmerksamkeit zu schenken und mein Bestes zu tun, um ihnen zu helfen.
Mein Vater ist Unternehmer, also lag es nahe, dass ich das auch werde. Schließlich bekam ich einen Job in einer erstklassigen Beratungsfirma, aber nach einiger Zeit in dieser Branche hatte ich den Eindruck, auf der Stelle zu treten, und fühlte mich eingeengt. Es kam mir so vor, als ob alle meine Möglichkeiten ausgeschöpft wären und es von nun an nur noch bergab ginge. Ich wurde depressiv. Da war ich gerade einmal 25. Und dann nahm sich mein jüngster Bruder das Leben.
Jonathan war 20. Er erschoss sich in dem Haus, in dem wir aufgewachsen waren, mit einer Handfeuerwaffe, die mein Vater im Koreakrieg erhalten hatte. Meine Mutter fand seine Leiche.
Als der Schock allmählich nachließ, versuchten meine Familie und ich diese scheinbar so sinnlose Tragödie zu verstehen. Mein Bruder und seine Freundin hatten sich vor kurzem getrennt, und wir glaubten, dass er vielleicht mit Drogen experimentiert hatte, aber diese Probleme erklärten nicht Jonathans Entscheidung, sich das Leben zu nehmen. Im Nachhinein verstehe ich das viel besser.
Vier Jahre zuvor hatte eine seltene genetisch bedingte Erkrankung Jonathans gesamten Verdauungstrakt lahmgelegt. Bis dahin war er vollkommen gesund gewesen. Jetzt war er 16, in Lebensgefahr, musste immer wieder ins Kinderkrankenhaus in Philadelphia und einen schmerzhaften Eingriff nach dem anderen über sich ergehen lassen. Er konnte nicht essen. Er verlor unglaublich viel Gewicht und Kraft. Er hatte große Angst. Die ganze Tortur war für ihn furchtbar traumatisch. Leute, die Jonathan vor seiner Krankheit gekannt hatten, sprachen später darüber, wie sehr er sich verändert hätte.
Als ich auf dem College war, sah ich Jonathan nicht oft, aber selbst in den Jahren vor seinem Suizid hatte ich keine Ahnung, was mit ihm los war. Jonathan wollte, dass ich ihn stark und glücklich erlebe, also verbarg er sein Trauma vor mir (oder besser gesagt, er verbarg, was er von seinem Trauma verstand). Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich überhaupt viel gemerkt hätte. Wie gesagt, ich war damals depressiv. Ich war vollauf mit meiner Selbstberuhigungstaktik beschäftigt und weitgehend blind für mein eigenes Leid und Trauma.
Nach Jonathans Tod erfuhr ich allmählich von den psychischen Erkrankungen und Suiziden in meiner Familie. Ich verbrachte viel mehr Zeit mit meinen Eltern und meinem anderen (jetzt einzigen) Bruder und mir wurde einiges darüber klar, wie ich bisher gelebt hatte. Ich erkannte, dass ich nach einem langen Katalog von „Du sollst“-Vorschriften gelebt hatte, die aus lauter Angst entstanden waren – aus der Angst, dass ich keinen Erfolg haben würde, aus der Angst, dass ich es noch bedauern würde, einen guten Job aufgegeben zu haben, aus der Angst, dass ich nicht wüsste, was ich täte und es später bereuen würde. Nach dem Tod meines Bruders verblassten diese angstbedingten „Du sollst“-Regeln, die mein Leben bestimmten, und ich wusste gar nicht mehr, warum sie überhaupt einmal so wichtig gewesen waren. In dem Moment beschloss ich, meiner lang gehegten Begeisterung für den Arztberuf nachzugeben.
Das Medizinstudium war zwar manchmal anstrengend, aber insgesamt eine wunderbare Erfahrung. Ich wollte unbedingt alles lernen, was ich nicht wusste, als meine älteren Verwandten krank wurden – alles, was ich nicht wusste, als mein Bruder krank war. Und ich wollte dieses geheime Wissen nutzen, um endlich etwas bewirken zu können – bei einem Menschen nach dem anderen. Als ich im Rahmen der Famulaturen in den letzten beiden Jahren meines Medizinstudiums verschiedene Fachgebiete durchlief, war ich immer wieder fassungslos, wie sehr die innere Welt eines Menschen seine äußere Welt prägt. Ich beobachtete, wie sich unsere Lebensentscheidungen und -erfahrungen aus den Vorgängen in unserem Inneren entwickeln, und ich staunte über die Anzahl der Erkrankungen – einige davon mit tödlichem Ausgang –, die absolut vermeidbar wären. Das Medizinstudium hat mich gelehrt, wie erstaunlich komplex der Mensch ist, von Kopf bis Fuß, und wie vorhersehbar vieles Vermeidbare ist, das uns schadet oder uns umbringt – eine schlechte Ernährung zum Beispiel oder regelmäßiges Rauchen oder Verkehrsunfälle.
Je mehr ich über klinische Medizin lernte und je länger ich im Kontakt mit Patienten war, desto entsetzter war ich darüber, dass psychische Faktoren regelmäßig unberücksichtigt blieben, was sowohl zu psychischen als auch zu körperlichen Schmerzen und manchmal zum Tod führte. Ich sah, wie Menschen nicht nur an körperlichen Krankheiten litten und starben, sondern auch an den zugrunde liegenden psychischen Faktoren, die überhaupt erst zu ihren Problemen geführt hatten. Sehr häufig war klar, dass man medizinische Probleme – wie übrigens alle Probleme – besser angehen kann, wenn man sich um die Aspekte kümmert, die ihnen zugrunde liegen. In den meisten Fällen bedeutete dies, dass man sich mit Trauma befassen musste.
Psychiatrie interessierte mich, weil es mich reizte, Hirnbiologie, Medizin und Psychologie miteinander zu kombinieren, um Menschen zu verstehen und ihnen zu helfen. Psychiater müssen über medizinische und neurologische Erkrankungen nachdenken, die manchmal die Ursache dafür sind, dass Menschen Hilfe suchen oder zur Behandlung eingeliefert werden, und sie müssen sich auch damit beschäftigen, wie sich Geist und Körper ständig gegenseitig beeinflussen. So wirkte sich zum Beispiel das körperliche Leiden meines Bruders auf seine Psyche aus, und diese Veränderungen führten zu Verhaltensweisen, die sowohl seinen Körper als auch seine Psyche noch stärker beeinträchtigten. Ich habe mich entschieden, Psychiater zu werden, weil ich für Menschen wie meinen Bruder etwas tun wollte.
Warum ich dieses Buch geschrieben habe und was ich mir davon für Sie erhoffe
Die Vielfalt der menschlichen Probleme, die ich in meinem Leben und in meinem Beruf mitbekommen habe, ist nahezu unendlich. Doch für die überwiegende Mehrheit dieser Probleme sticht ein Grund besonders heraus – zugrunde liegt ein Trauma.
Das ist eine kühne Behauptung, und so soll es auch sein. Was ich hier über Trauma sagen möchte, sollte kühn sein, denn es soll Ihr Leben und das Leben anderer zum Besseren wenden. Ich glaube, es ist auch eine befreiende Behauptung. Stellen Sie sich einmal vor, wie es wäre, wenn in Ihrer Nachbarschaft alle Lichter ausgingen – wie mühsam es wäre, wenn sich das Problem nur dadurch lösen ließe, dass Sie in jedem einzelnen Haus auch noch die allerletzte Glühbirne auswechseln! Den Transformator zu reparieren mag zwar mühsam erscheinen, ist aber eine viel vernünftigere Lösung für das Problem, vor dem Sie stünden. Beim Trauma ist es dasselbe.
Ich habe dieses Buch geschrieben, um in Sachen Trauma Alarm zu schlagen. Trauma ist viel zu verbreitet, schädlich, ansteckend und oft unsichtbar – genau wie ein Virus. Und wenn wir das weiterhin ignorieren und zulassen, dass Trauma unsichtbar bleibt, würde ich nicht darauf wetten, dass wir es jemals besiegen können.
Natürlich wissen die meisten Menschen bereits etwas über Trauma. Dies ist mit Sicherheit nicht das erste Buch darüber, und wir hören oder lesen regelmäßig in den Nachrichten von Traumata. Ich denke jedoch, dass über Trauma meist so geredet wird, als würde man in ein Megaphon schreien – ein Megaphon erregt zwar unsere Aufmerksamkeit, aber es ist alarmistisch und nervtötend, und am Ende sind wir meist nur schockiert oder verwirrt. Das will ich hier nicht. In diesem Buch geht es darum, wirklich über Trauma zu sprechen, einen echten Dialog zu ermöglichen, nachdem Sie den Computer ausgeschaltet oder die Zeitung weggelegt haben. Ich lege das Megaphon weg, damit wir ein nachdenkliches Gespräch führen können.
Okay, genau genommen ist das hier kein Gespräch – ich habe dieses Buch geschrieben und jetzt lesen Sie es, es ist also nicht unbedingt ein gegenseitiger Gedankenaustausch. Dennoch möchte ich, dass es sich wie ein Dialog anfühlt, und in diesem Sinne biete ich die Übungen und Überlegungen in den folgenden Kapiteln an. Ich bin der Meinung, dass uns im Umgang mit Trauma zurzeit keine angemessenen Strategien an die Hand gegeben werden; noch wird uns das Verständnis und die Motivation vermittelt, die wir brauchen, um auf die notwendigen Veränderungen bei uns selbst, bei anderen und in der Welt hinzuarbeiten. In diesem Sinne möchte ich, dass Sie aus diesem Buch Folgendes mitnehmen können:
• Ein gründliches Verständnis von Trauma und Scham
• Die Fähigkeit, Trauma bei sich selbst, bei anderen und der Gesellschaft um Sie herum zu erkennen
• Wissen darüber, wie individuelles und kollektives Trauma auf gesellschaftlicher Ebene wirken
• Die Motivation, Trauma im Ansatz zu stoppen
• Viele praktische Werkzeuge, um sich selbst und anderen zu helfen
Dieses Buch ist nicht nur vollgepackt mit Geschichten aus meinem Leben und dem Leben meiner Patientinnen und Patienten, sondern auch mit Beschreibungen und Erklärungen, und das alles ist in vier Teile gegliedert. Teil Eins: Was Trauma ist und wie es wirkt definiert Trauma, untersucht die verschiedenen Trauma-Arten und legt dar, welche entscheidende Rolle Scham dabei spielt. Teil Zwei: Der erweiterte Blick – Trauma-Soziologie erweitert den Blickwinkel, um Ihnen zu zeigen, wie groß und allgegenwärtig das Trauma-Problem tatsächlich ist. Ich erörtere, wie schlecht das derzeitige Gesundheitswesen für die Bewältigung von Trauma gerüstet ist. Außerdem untersuche ich, wie gesellschaftliche Bedingungen wie die Covid- 19-Pandemie und Rassismus Trauma weiter begünstigen. In Teil Drei: Ein Benutzerhandbuch für Ihr Gehirn gehe ich auf die Rolle des limbischen Systems ein, insbesondere darauf, wie Trauma unsere Hirnbiologie, Emotionen, Erinnerungen und das körperliche Erleben von Krankheit und Schmerz verändert. Teil Vier: Wie wir Trauma besiegen können – gemeinsam ist ein Aufruf zum Handeln, um die schädlichen Auswirkungen von Trauma für uns alle zu verarbeiten, zu bereinigen und zu heilen.
TEIL I
WAS TRAUMA IST UND WIE ES WIRKT
Wenn Menschen leiden, egal wo, betrifft dies Männer und Frauen überall.
ELIE WIESEL, NOBELPREISREDE, 10. DEZEMBER 1986
KAPITEL 1
Wie wir über Trauma sprechen
Trauma, Substantiv, Neutrum, alles, was emotionalen oder körperlichen Schmerz auslöst und im weiteren Verlauf des Lebens eines Menschen seine Spuren hinterlässt
Ein Trauma wirkt sich auf alles aus. Ein alarmierend hoher Prozentsatz aller Menschen ist auf eine Art und Weise verletzt worden, die von außen nicht sichtbar ist. Damit meine ich nicht triviale Verletzungen, etwa wenn Ihnen jemand die falsche Eissorte gibt oder den letzten Keks wegisst. Mit Trauma meine ich die Form von emotionalem oder körperlichem Schmerz, der oft nicht erkannt wird, tatsächlich aber unsere Hirnbiologie und unsere Psychologie verändert. Und obwohl wir Menschen in der Regel ziemlich resilient sind, leiden viele von uns unter diesen traumatischen Veränderungen, und zwar vielfältiger und länger, als wir uns vorstellen können.
Analogien zum Trauma
Eine treffende Definition allein reicht manchmal einfach nicht. Deshalb verwende ich oft Analogien, um über Trauma zu sprechen, um zu veranschaulichen, wie es funktioniert, und um Möglichkeiten aufzuzeigen, was man dagegen tun kann. Im Folgenden einige meiner Lieblingsanalogien, aber Sie werden im Buch noch viele weitere finden.
Das Trauma-Virus
Diese Analogie verwende ich wahrscheinlich am häufigsten, und zu dem Zeitpunkt, da ich dieses Buch schreibe, ist sie mit Sicherheit treffend. Ich betrachte Trauma schon seit Jahren als Epidemie, aber in letzter Zeit hat die Covid-19-Pandemie überall zugeschlagen und inzwischen verstehe ich Trauma als eine Art Virus mit ebenfalls viel zu vielen Toten oder Menschen, die an seinen Nachwirkungen leiden. Wie bei Covid können Sie das Trauma selbst nicht sehen, Sie sehen nur, wie es wirkt – still und heimtückisch. Wenn es einen Menschen schädigt, repliziert es sich und springt auf einen anderen über; von dort breitet es sich auf weitere Personen aus und geht dann oft wieder zurück zum ersten. Leider gibt es keine Versuchsreihen für Trauma-Impfstoffe, und frühe Trauma-Tests werden schmerzlich vermisst. Solange wir nicht alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen und uns endlich der Bedrohung durch das Trauma-Virus stellen, sind nicht nur unser Glück und unser Wohlbefinden bedroht, sondern auch unser Überleben.
Covid hat die Art und Weise, wie wir die Welt erleben und wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, tiefgreifend verändert: Wir tragen Masken, wenn wir mit anderen zusammen sind, wir halten körperlich Abstand zu ihnen (in der Regel eineinhalb Meter oder mehr), wir fragen uns, ob sie ansteckend sein könnten, wir fassen uns in Gesprächen kurz und so weiter. Die Auswirkungen eines Traumas sind dem gar nicht so unähnlich: Da wir infolge eines Traumas unter Angst und Depressionen leiden, tragen wir im Umgang mit anderen metaphorische Masken (im antiken Rom nannte man Theatermasken Personae), wir wahren emotionale Distanz zu ihnen, wir meiden manchmal Menschen, die offenbar selbst unter Angst oder Depressionen leiden, und wir bleiben in Gesprächen mit ihnen kurz angebunden und oberflächlich.
Eine kluge Reaktion auf eine Viruspandemie besteht darin, sich eher zu verschließen, bis ein Impfstoff allgemein verfügbar ist. Eine kluge Reaktion auf eine Traumapandemie besteht darin, sich zu öffnen, sodass wir selbst zum Impfstoff werden.
Vor dem Ausbruch von Covid habe ich mir eine Pandemie immer als eine Zeit vorgestellt, in der die Menschen ihre Differenzen hintanstellen und sich zusammenschließen, um einen gemeinsamen Feind zu bekämpfen. Früher, so stellte ich mir vor, müssen die Menschen auf ihre Ärzte und Pflegekräfte gehört und die von den Behörden erlassenen Vorschriften befolgt haben, um sich um ihre Angehörigen und andere Menschen zu kümmern. Dies schreibe ich im Jahr 2020, und es war ein böses Erwachen.
Zu viele Menschen können mit dem Gedanken ans Gemeinwohl offenbar nichts anfangen. Ja, die Nachrichten sind voll von Leuten, die offenbar ungebremst auf ihren Vorlieben und Abneigungen bestehen, und dabei die tödliche Bedrohung ignorieren, die Tag für Tag wächst. Unsere Reaktion auf das Covid-Virus ist geprägt von Verleugnung, Streitereien und einer schockierenden Weigerung, sich unangenehmen Wahrheiten zu stellen. Unsere Regierung hat nicht vorausschauend gehandelt, noch nicht einmal, als sie gewarnt wurde. Und weil wir nicht bereit waren, unbequemen Wahrheiten ins Auge zu sehen, haben wir zahllose Gelegenheiten versäumt, vermeidbare Tragödien zu verhindern. Wir haben als Nation in jeder Hinsicht versagt, als es darum ging, uns selbst nicht im Weg zu stehen und das zu tun, was für unser Land und alle Menschen, die darin leben, richtig gewesen wäre.
Das bedrückt mich zutiefst. Aber es macht mich auch umso entschlossener, die Nachricht vom Trauma-Virus zu verbreiten. Es ist ebenfalls eine Pandemie, die auf der ganzen Welt unsagbar viel Elend und Verzweiflung hervorruft.
Trauma bekommt vielleicht nicht so viel Presse wie Covid im Moment, doch das macht es umso tödlicher. Wie Covid ist auch das Trauma-Virus unsichtbar. Wir können möglicherweise einige seiner Symptome erkennen, aber da Trauma tatsächlich unser Gehirn – unsere Gedanken und Erinnerungen und deren Bedeutungen – verändert, ist das Ausmaß des Schadens noch schwieriger zu fassen. Meist denken wir bei Trauma an etwas, das aus einem signifikanten, einmaligen Ereignis resultiert, aber dies ist nur die Spitze des Trauma-Eisbergs. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit Trauma befassen, sagen uns, dass es viel mehr gibt als das Offensichtliche, das wir sehen können, aber – wie die Covid-Pandemie gezeigt hat – hören wir nicht immer gern auf die Wissenschaft.
Eine Erkenntnis der Wissenschaft über das Trauma-Virus lautet: Es ist so schädlich, dass es sich sogar auf die Kinder der Zukunft auswirkt – auf Kinder, die noch nicht einmal in der Vorstellung existieren, geschweige denn geboren sind. Ein Trauma kann bestimmen, wie genetische Merkmale weitergegeben werden. Das bedeutet, dass Traumafolgen schon heute in unser künftiges Erbgut eingeschrieben werden. Trauma wirkt also wie eine Pandemie, die über den Tod eines Menschen hinausreicht. Wir haben es hier mit einem Virus zu tun, das die Überlebenskette unserer Spezies infiltriert und dessen Schaden sich von Generation zu Generation vergrößert.
Masken und Isolierung leisten uns bei einer Viruspandemie gute Dienste. Sie schützen uns, indem sie die Ausbreitung der Krankheit begrenzen, sodass wir überleben und uns weiterentwickeln können. Die Masken und die Isolierung, die uns durch ein Trauma auferlegt werden, wirken jedoch hauptsächlich im Inneren. Sie ersetzen gesunde Gefühle und Gedanken durch negative und projizieren unser Unbehagen und unsere Ängste auf die Welt. Nichts davon dient uns oder schützt uns. Vielmehr fördern die Masken und die Isolierung im Zusammenhang mit Trauma noch mehr Trauma, wodurch die Saat unseres Leidens aufgeht und sich ausbreitet. So pflanzt sich die Traumapandemie fort.
Eine kluge Reaktion auf eine Viruspandemie besteht darin, sich eher zu verschließen, bis ein Impfstoff allgemein verfügbar ist. Eine kluge Reaktion auf eine Traumapandemie besteht darin, sich zu öffnen, sodass wir selbst zum Impfstoff werden. Wenn wir uns dem Verständnis, dem Mitgefühl und der Veränderung öffnen, strömen das psychologische Sonnenlicht und die frische Luft herein, die wir zum Wachsen und Gedeihen brauchen.
Die Virus-Analogie beschreibt die Gefahr und die Schwere von Trauma zwar am treffendsten, manchmal verwende ich aber auch gerne zwei andere Vergleiche, um zu veranschaulichen, wie ernst die Bedrohung durch Trauma für uns alle ist.
Umweltverschmutzung
Ein Trauma ist wie die Luft, die wir atmen – sie ist überall, sie strömt ein und aus in unseren Häusern, in unserem Körper und im Körper unserer Lieben. Normalerweise denken wir nicht viel über die Atemluft nach, es sei denn, die Schadstoffbelastung steigt (zum Beispiel Smog in unseren Städten oder Rauch von Waldbränden in der Umgebung) und es wird ungesund, sie in unseren Körper aufzunehmen. Deshalb nutzen wir den Luftqualitätsindex, um die wichtigsten Schadstoffe wie bodennahes Ozon, Stickoxide, Feinstaub und so weiter zu messen. Davon abgesehen schenken wir der Luft, die wir zum Leben brauchen, meist kaum Beachtung. Ganz ähnlich verhält es sich bei unserem Umgang mit Trauma – wir nehmen es erst dann ernst, wenn die Symptome außer Kontrolle geraten. Ideal wäre eine Art ständiges Monitoring, mit dessen Hilfe wir die alltäglichen Auswirkungen von Trauma verstehen und den Schaden, den Trauma in unserem inneren und äußeren Umfeld anrichtet, minimieren können.
Selbstverständlich ist auch die Verschmutzung des Wassers ein großes Problem. Stellen Sie sich vor, Sie geben einen Tropfen Farbstoff in eine große Schüssel mit Wasser. In diesem Fall ist der Farbstoff giftig, und wenn Sie die Schüssel genau beobachten, können Sie sehen, wie sich das Gift im Wasser verteilt. Wenn der Farbstoff ins Wasser tropft, ist seine Farbe zunächst kräftig und leuchtend, aber sowie sich das Gift in der Schüssel verteilt, nimmt die Farbintensität ab. Es ist immer noch dieselbe Menge Gift im Wasser und nach wie vor fließt das Gift überall dorthin, wo auch das Wasser hinfließt, aber es wirkt weniger schlimm als zu Beginn – schließlich ist die Farbe nicht mehr so auffällig, wie sie einmal war.
Nur weil wir die Umweltverschmutzung nicht sofort wahrnehmen oder uns darüber Sorgen machen, heißt das nicht, dass sie keine Gefahr für unseren Planeten darstellt. Und nur weil wir dem Trauma keine Aufmerksamkeit schenken, heißt das nicht, dass es nicht unser Wohlbefinden untergräbt. Die Bedrohung ist real, und Trauma richtet jetzt, in diesem Moment, aktiv Schaden an.
Parasiten
Manchmal ist der Traumaparasit so schlimm, dass wir sogar die Grundregeln vergessen, wie wir uns schützen können.
Die dritte Analogie, über die ich sprechen möchte, ist Toxoplasma. Toxoplasma ist ein Parasit, der seine unterschiedlichen Entwicklungsstadien in verschiedenen Wirten durchläuft. Dadurch kann er leben und sich vermehren, indem er die Wirte, in die er eindringt, nutzt und so sein zukünftiges Überleben sichert. Wir können die Entwicklungsstadien des Parasiten – seinen Lebenszyklus – bestimmen und auch die Art und Weise, wie der Wirt in einem bestimmten Stadium benutzt wird, um den Parasiten in das nächste Stadium zu bringen. Toxoplasma ist faszinierend, weil sein Lebenszyklus nicht nur verschiedene Wirtsexemplare umfasst – der Parasit nutzt verschiedene Tierarten, um seine Verbreitung zu beschleunigen.
Toxoplasma hat sich so entwickelt, dass es von Mäusen auf Katzen (und manchmal sogar von Katzen auf Menschen) übertragen werden kann. Der Parasit hat das natürlich nicht bewusst geplant, aber er hat eine Möglichkeit entwickelt, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass eine Maus von einer Katze gefressen wird, indem er nämlich das Gehirn infizierter Mäuse so verändert, dass sie weniger Angst vor Katzen haben. Man kann nur staunen, wie raffiniert das ist – schließlich haben Mäuse instinktiv Angst vor Katzen. Doch eine mit Toxoplasma infizierte Maus verliert unbewusst diese Angst, sodass es vorkommen kann, dass sie einfach völlig unbekümmert an einer Katze vorbeischlendert.
Ich glaube, dass Trauma mit Menschen das anstellt, was Toxoplasma mit Mäusen macht. Es führt vielleicht nicht dazu, dass wir von einer Katze gefressen werden, aber Trauma verändert unser Gehirn in der Tat so, dass wir grundlegende Aspekte unserer Lebendigkeit vergessen – es sorgt dafür, dass wir unseren Wert, unsere Träume, unsere Begabungen und unsere Ziele aus den Augen verlieren. Manchmal ist der Traumaparasit so schlimm, dass wir sogar die Grundregeln vergessen, wie wir uns schützen können. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich es erlebt habe, dass eine Person, die in einer früheren Beziehung körperlich verletzt wurde (und Angst davor hat, wieder so misshandelt zu werden), eine neue Beziehung eingeht, in der es mit großer Sicherheit wieder zu körperlicher Misshandlung kommt.
Trauma verändert unser Gehirn in ganz ähnlicher Weise, wie Toxoplasma Mäuse dazu bringt, die offensichtliche Gefahr, die von Katzen ausgeht, nicht mehr wahrzunehmen. Anstatt auf die Warnsignale bei anderen zu achten, konzentrieren sich traumatisierte Menschen oft darauf, sich selbst zu ändern – etwas zu tun und „besser“ zu werden (wobei die Gesellschaft für sie auch in dieser Hinsicht wenig hilfreich ist). Dieses Denken erzeugt nur noch mehr Scham, Selbstvorwürfe und die Fantasievorstellung, dass eine neue Beziehung gesund und sicher gestaltet werden kann, was oft dazu führt, dass eine missbrauchte Person Warnsignale ignoriert, die förmlich knallrot blinken. Die Zeichen deuten unmissverständlich darauf hin, dass weitere Misshandlungen, Verzweiflung und Scham bevorstehen, aber ein Trauma führt dazu, dass die Betroffenen irrtümlich glauben, wenn sie sich selbst ändern, würden andere sich ihnen gegenüber anders verhalten.
Wie Toxoplasma tut auch Trauma dies alles nur um zu überleben. Es kann vielleicht nicht bewusst denken, aber das macht es nicht weniger gefährlich oder effektiv. Toxoplasma hat sich so entwickelt, dass es immer mehr Toxoplasma erzeugt, komme was da wolle. In gleicher Weise erzeugt Trauma weiteres Trauma, indem es sich von Mensch zu Mensch, von Menschen auf andere Lebewesen und den Planeten und wieder zurück auf den Menschen überträgt. So wird es immer weitergehen, bis wir es aufhalten.
VORBELASTUNGEN
Genau wie Viren, Umweltverschmutzung und Parasiten jeden Menschen anders treffen, verhält es sich auch mit Trauma. Trauma tritt in unterschiedlicher Form, Häufigkeit und Intensität auf, und es gibt zahlreiche Gründe, warum manche Menschen stärker betroffen sind als andere. Wenn wir Trauma besiegen wollen, müssen wir diese Faktoren erforschen und sie grundlegend verstehen. Die meisten Menschen sind gegen eine Art von Trauma besser gewappnet als gegen eine andere – sie können mit ihrer Lebenserfahrung den einen Feind gut bekämpfen, sind gegen einen anderen aber womöglich wehrlos.
Unsere Genetik und unsere Lebenserfahrungen sind wichtige Faktoren der so genannten Multiple-Hit-Hypothese. Diese Hypothese, die sich auf verschiedene reale Situationen anwenden lässt, besagt, dass unsere Bewältigungsstrategien durch mehrere aufeinanderfolgende traumatische Erfahrungen geschwächt werden – im Wesentlichen dadurch, wie viele „Schläge“ (englisch Hits, Anm. d. Verlags) wir einstecken mussten. Manche Menschen werden durch ihre erste traumatische Erfahrung stark beeinträchtigt, während andere bemerkenswert resilient wirken, nur um später durch eine scheinbar weniger gravierende Erfahrung schwer getroffen zu werden. Menschen, die unter ethnischen Vorurteilen oder systemischem Rassismus leiden, erleben zum Beispiel eine nicht enden wollende Flut von Stressoren, die ihre Anfälligkeit für weitere Traumata erhöhen. Wenn es ums „Einstecken“ geht, sind wir uns oft nicht bewusst, wie sehr sich die Schläge bei uns und anderen anhäufen.
Ich muss Ihnen etwas erzählen
Wie ich bereits in der Einleitung erwähnt habe, steckt dieses Buch voller Geschichten aus meinem eigenen Leben und aus dem Leben von Menschen, die ich kennenlernen durfte. Ebenso wie die gerade besprochenen Analogien verwende ich Geschichten, um zu veranschaulichen, wie Trauma funktioniert und wie Menschen damit kämpfen – und darüber triumphieren. Diese Geschichten sind kraftvoll, weil sie echt sind. Um die Vertraulichkeit zu wahren, habe ich einige Aspekte verändert, aber die Erfahrungen gebe ich genauso wieder, wie ich sie verstanden (und in einigen Fällen auch erlebt) habe. Wir alle haben Geschichten. Wir nutzen sie, um uns an die freudigen Ereignisse in unserem Leben, aber auch an die Herausforderungen, zu erinnern und sie anderen mitzuteilen. Geschichten über Trauma und wie Menschen mit Trauma leben, sind so alt wie der Mond. Trauma ist der Bösewicht, dem wir auf der Suche nach dem Glück begegnen. Trauma richtet den Schaden an, der uns verändert und die Ängste verstärkt, die wir in uns tragen. Oberflächlich betrachtet scheint dies negativ auf einer inneren Waage zu lasten, die wir wieder in Richtung Glück ausschlagen lassen wollen, aber das ist nur ein Teil der Geschichte.
Trauma kapert unsere Geschichten.
Der Teil der Traumageschichte, den wir allzu oft ignorieren, betrifft die Veränderungen in unserer Hirnbiologie und Psychologie. Diese Auswirkungen ignorieren wir deshalb, weil Trauma verhindert, dass wir die Veränderungen und ihre Folgen für unser Leben erkennen. Trauma nagt an unseren Träumen und beeinflusst unsere Entscheidungen, ohne dass wir es überhaupt merken. Auf diese Weise ist Trauma wie ein Bösewicht oder Feind, der sich in uns einnistet. Dieser Feind sät in uns Zweifel daran, wer wir sind, was wir erreichen können und was wir verdient haben. Er bringt unsere Ausgewogenheit komplett durcheinander – er gibt der negativen Seite des Lebens mehr Gewicht, betrügt uns um unser ureigenes Recht auf Sicherheit und Freude, und dies alles, ohne dass wir die leiseste Ahnung davon hätten. Trauma verändert unsere Emotionen und Erinnerungen, und veränderte Emotionen und Erinnerungen verändern unsere Entscheidungen sowie den Verlauf unseres Lebens.
Wenn Menschen, die ich betreue, gestorben sind, habe ich oft darüber nachgedacht, wie sich die oberflächliche Erklärung für ihren Tod zu dem verhält, was Trauma hinter den Kulissen mit ihnen gemacht hat. Nirgendwo wird das deutlicher als bei der sogenannten amtlichen Todesursache. Die offizielle Version könnte zum Beispiel lauten: Autounfall statt Vergewaltigung durch einen Kollegen, Suizid statt Wurde um seine Ersparnisse gebracht, oder Leberzirrhose statt Kindesmissbrauch durch einen alkoholkranken Elternteil. Trauma kapert unsere Geschichten im Leben und auch im Tod.
Vier kurze Erzählungen
Hier sind vier reale Geschichten über Trauma (zwei davon aus meinem eigenen Leben), um Traumafolgen zu veranschaulichen.
• Im Medizinstudium hatte ich eine Bauchspeicheldrüse seziert und kannte ihre Funktion, aber das Organ hatte keinerlei besondere Bedeutung für mich, bis bei meiner Mutter Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert wurde. Nach einer äußerst schwierigen Zeit für meine Familie starb meine Mutter. Bis zu ihrer Diagnose war sie gesund und aktiv, sie war eine begeisterte Leserin und hatte einen derart flotten Gang, dass ich nicht mit ihr mithalten konnte. Wenn ich jetzt das Wort Bauchspeicheldrüse höre, spannen sich meine Muskeln an, meine Atmung wird schneller und ich sehe Bilder von ihrer Beerdigung und dem Platz auf der Couch meiner Eltern vor mir, auf dem sie nicht mehr sitzt. Von außen sieht man es mir nicht an, aber ich merke es in meinem Inneren. In London wollte ich mich einmal nicht mit einem Freund am Bahnhof St. Pancras treffen, weil Pancras diesem schrecklichen Fachbegriff Pankreas





























