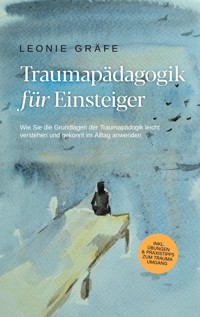
Traumapädagogik für Einsteiger: Wie Sie die Grundlagen der Traumapädagogik leicht verstehen und gekonnt im Alltag anwenden - inkl. Übungen & Praxistipps zum Trauma Umgang E-Book
Leonie Gräfe
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Seit über 10 Jahren bin ich in der stationären Jugendhilfe als innewohnende Pädagogin tätig. In meinem Beruf arbeite beziehungsweise lebe ich mit Kindern mit höchst traumatischen Erfahrungen zusammen. Um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, Verhaltensweisen zu verstehen und mich selbst in meinem Verhalten besser verstehen zu können, habe ich mehrfach an Weiterbildungen zum Thema Traumapädagogik teilgenommen. In diesem Buch werde ich auf verschiedene Themen eingehen. Ich spreche oft von traumatisierten Kindern und Jugendlichen in stationären Settings, jedoch sind die Aspekte der Traumapädagogik auch auf den normalen pädagogischen Alltag zu übertragen. In dem Buch gehe ich vielfältig auf den Umgang mit Mitarbeitern und Leitungskräften mit den Themen Trauma, Gefühle und Arbeitsbedingungen ein. Auch diese können aus der Traumapädagogik auf andere pädagogische Bereiche übertragen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 51
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags für jegliche Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
INHALT
Vorwort
Was ist ein Trauma?
Traumapädagogisches Konzept
Prinzip der korrigierenden Beziehungserfahrung
Prinzip des sicheren Ortes
Prinzip Versorgungskette und förderliche Leitungsstrukturen
Prinzip der traumapädagogischen Förderung und Psychoedukation
Resilienz und Resilienzförderung
Emotionen und Förderung der Emotionsregulation
Förderung der Emotionsregulation
Förderung der Achtsamkeit und Sinneswahrnehmung
Übertragung und Gegenübertragung
Praktische Umsetzung → der Notfallkoffer
Vorwort
Schön, dass Sie sich mit dem Thema der Traumapädagogik auseinandersetzen möchten. Ich bin seit über 10 Jahren in der stationären Jugendhilfe als innewohnende Pädagogin tätig. In meinem Beruf arbeite beziehungsweise lebe ich mit Kindern mit höchst traumatischen Erfahrungen zusammen.
Um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, Verhaltensweisen zu verstehen und mich selbst in meinem Verhalten besser verstehen zu können, habe ich mehrfach an Weiterbildungen zum Thema Traumapädagogik teilgenommen. In diesem Buch werde ich auf verschiedene Themen eingehen. Ich spreche oft von traumatisierten Kindern und Jugendlichen in stationären Settings, jedoch sind die Aspekte der Traumapädagogik auch auf den normalen pädagogischen Alltag zu übertragen. In dem Buch gehe ich vielfältig auf den Umgang mit Mitarbeitern und Leitungskräften mit den Themen Trauma, Gefühle und Arbeitsbedingungen ein. Auch diese können aus der Traumapädagogik auf andere pädagogische Bereiche übertragen werden.
Was ist ein Trauma?
Das Wort „Trauma“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet Verletzung. Ein traumatisches Erlebnis wird definiert als unmittelbare Gefahr für das Leben und die körperliche und seelische Unversehrtheit der eigenen oder das einer anderen Person, unabhängig davon, wie eng oder zufällig die Beziehung mit ihr ist. Hauptbestandteil der traumatischen Reaktion ist, dass diese mit einer extremen emotionalen Erregung einhergeht. Sie wird von einer körperlichen Stressreaktion begleitet, die die betroffene Person auf eine Kampf- und Fluchtreaktion vorbereitet. Eine belastende Situation wird erst zu einem traumatischen Ereignis, wenn alle Möglichkeiten zum Kampf oder zur Flucht ausgeschöpft sind. Die Stressbelastung steigt dabei weiterhin.
Der Körper möchte sich dennoch vor dieser Reiz- und Stressüberflutung schützen, somit muss die Psyche in dieser traumatischen Reaktion einen eigenen innerpsychischen Weg finden, mit dieser Situation und ihren dazugehörigen Facetten der Wahrnehmung, den belastenden Gefühlen (Angst, Wut, Ekel, Scham), den Schmerzen etc. umzugehen. Die innerpsychischen Bewältigungsstrategien werden durch biochemische Prozesse ausgelöst, zum Beispiel kann sich durch den Ausstoß von körpereigenen Endorphinen die Wahrnehmung der belastenden Situation verändern.
Das Opfer reduziert die Wahrnehmung der Außenwelt und des eigenen Körpers, dadurch werden Schmerzen und andere Emotionen unterdrückt und die kognitive Wahrnehmung der Situation wird eingeschränkt, wodurch eine detaillierte Wahrnehmung der Situation verhindert wird. Die innerpsychischen Prozesse dienen zum Schutz des Betroffenen. Dieser Schutzmechanismus wird in der Psychologie und Pädagogik „Freezing“ genannt und ist eine dissoziative Reaktion auf das Erlebte. Insbesondere, wenn eine Person wiederholt traumatische Erlebnisse durchleben muss, kann dieser Schutzmechanismus, das Dissoziieren, zu problematischen Anpassungsstörungen führen. Während des Prozesses wird die Wahrnehmung im emotionalen und körperlichen Bereich reduziert.
Gleichzeitig kommt es zu einer Abspaltung der kognitiven Wahrnehmung. Kinder berichten von dissoziativen Reaktionen, als ob sie neben sich treten oder das Geschehene von außen betrachten. Die dissoziative Reaktion wird erlernt, sodass gewisse Hinweisreize nach und nach immer schneller die dissoziative Reaktion auslösen können. Von daher sind Menschen, die zum Beispiel ritualisierte Traumata erlebt haben, besonders von einer chronischen Dissoziationsneigung bedroht sind. Nicht nur die Häufigkeit des Erlebens einer (lebens-)bedrohlichen Situation kann zu dieser Neigung führen, sondern auch, wenn das Opfer sehr nahe zum Täter stand und/oder dem Opfer nicht geglaubt wird. Insbesondere bei Kindern, deren Gehirn noch in der Entwicklung und Formbarkeit ist, haben wiederholende Traumatisierungen nachhaltige Auswirkungen auf die neurobiologischen und psychischen Lernprozesse.
Körperlich betrachtet, laufen während der traumatischen Situation zwei Prozesse gleichzeitig ab. Zum einen bereitet sich der Körper auf den Kampf vor, indem er eine große Wachheit und körperliche Erregung sowie innere Anspannung entwickelt. Zum anderen werden die Wachheit und Anspannung reduziert, die dissoziative Reaktion beginnt. Die chronische Überregung lässt sich besonders gut bei Kindern beobachten, indem sie ständig „auf der Hut sind“, sie sind überwach und reagieren auf jeden Reiz. Sie sind also extrem aufmerksam und können sich zum Beispiel nicht ihren kindlichen Bedürfnissen nach Spielen hingeben. Die chronische Anspannung führt dazu, dass sie weniger in der Lage sind, sich zu entspannen, andererseits steigt die Wahrscheinlichkeit von Fehlinterpretation und Kontrollverlust. Ein hohes Stressniveau bedeutet auch, dass Handlungsmöglichkeiten auf Dauer eingeschränkt werden. Sie befinden sich dauerhaft auf der Schwelle, die Kontrolle zu verlieren. Möglichkeiten zur Selbstregulation sind aufgrund des hohen Stresslevels schnell ausgeschöpft.
Durch die dissoziativen Reaktionen haben die Kinder gelernt, ihre Wahrnehmung im Bereich der Emotionen und Körperempfindungen stark einzuschränken. Im Rahmen der Psychoedukation ist es jedoch sinnvoll, emotionale Reaktionen immer wieder zu hinterfragen und ihnen Wörter zu verleihen.
Traumapädagogisches Konzept
Unter Traumapädagogik versteht man die sozialpädagogische Begleitung von Menschen mit Vernachlässigungs-, Misshandlungs- und Missbrauchserfahrungen. Das Ziel der Traumapädagogik ist, traumatisierten Kindern und Jugendlichen Hilfestellungen an die Hand zu geben, die zu einer Stabilisierung ihrer Situation dienen und sie sogleich in ihrer Entwicklung fördern. Hierbei greift sie auf verschiedene Prinzipien zurück:
Diese Prinzipien beziehungsweise der Leitfaden soll den pädagogischen Fachkräften sowohl Sicherheit und Selbstwirksamkeit im Umgang mit ihren Klienten als auch im Umgang mit sich geben. Die Traumapädagogik hat hierfür Strukturen und Notwendigkeiten geschaffen, um Handlungssicherheiten zu schaffen, indem pädagogische Begleiter ihr Interaktionshandeln mit Kindern und Jugendlichen reflektieren. Diese Prinzipien sind so ausgelegt, dass jede pädagogische Institution sich auf diese berufen kann, denn sie fördern auch die Entwicklung von nicht traumatisierten Menschen.





























