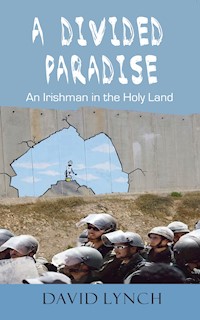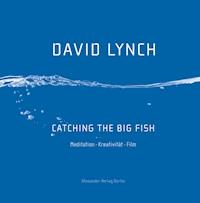19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein einzigartiger Einblick in das persönliche und kreative Leben des visionären Künstlers David Lynch, erzählt von ihm selbst und seinen engsten Kollegen, Freunden und Verwandten.
In einer faszinierenden Mischung aus Biografie und Memoire schreibt David Lynch erstmals über seine vielen Kämpfe und auch Niederlagen; wie kompliziert es oft war, seine zahlreichen unorthodoxen Projekte zu verwirklichen. Lynch kommentiert ungefiltert und auf sehr offene Art und Weise die biografischen Ausführungen seiner Co-Autorin Kristine McKenna, die für das Buch über hundert Interviews mit erstaunlich gesprächigen Ex-Frauen, Familienmitgliedern, Schauspielern, Agenten, Musikern und sonstigen Kollegen geführt hat.
Traumwelten ist ein besonderes Buch, das dem Leser eine tiefe Einsicht in das Leben und die Gedankenwelt eines der schillerndsten und originellsten Künstlers unserer Zeit gewährt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 979
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Ein einzigartiger Einblick in das persönliche und kreative Leben des visionären Künstlers David Lynch, erzählt von ihm selbst und seinen engsten Kollegen, Freunden und Verwandten
In einer faszinierenden Mischung aus Biografie und Memoire schreibt David Lynch erstmals über seine vielen Kämpfe und auch Niederlagen; wie kompliziert es oft war, seine zahlreichen unorthodoxen Projekte zu verwirklichen. Lynch kommentiert ungefiltert und auf sehr offene Art und Weise die biografischen Ausführungen seiner Co-Autorin Kristine McKenna, die für das Buch über hundert Interviews mit erstaunlich gesprächigen Ex-Frauen, Familienmitgliedern, Schauspielern, Agenten, Musikern und sonstigen Kollegen geführt hat.
Traumwelten ist ein besonderes Buch, das dem Leser eine tiefe Einsicht in das Leben und die Gedankenwelt eines der schillerndsten und originellsten Künstlers unserer Zeit gewährt.
Der Autor
DAVID LYNCH avancierte 1977 mit dem Film Eraserhead zu einem der international angesehensten Regisseure. Seither wurde er bei den Academy Awards für Der Elefantenmensch, Blue Velvet und Mulholland Drive dreimal für den Oscar für die Beste Regie nominiert, gewann mit Wild at Heart die Goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes, löste in den Neunzigern mit der bis heute stilprägenden TV-Serie Twin Peaks eine regelrechte Hysterie aus und hat sich auch sonst als vielseitiger Künstler auf diversen Tätigkeitsfeldern einen Namen gemacht. Er ist der Autor des Buchs Catching the Big Fish, in dem es um transzendentale Meditation geht.
KRISTINE MCKENNA ist eine Kritikerin und Journalistin, die von 1977 bis 1998 für die Los Angeles Times schrieb. Seit 1979 ist sie eine enge Freundin von David Lynch und hat ihn regelmäßig interviewt. Ihre Artikel erschienen in Artforum, The New York Times, ARTnews, Vanity Fair, The Washington Post und dem Rolling Stone. Sie hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht.
David Lynch und Kristine McKenna
Traumwelten
Ein Leben
Aus dem Amerikanischen von Robert Brack, Daniel Müller, Wulf Dorn und Stephan Glietsch
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel Room to Dream bei Random House, an imprint and division of Penguin Random House LLC, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Unter www.heyne-encore.de finden Sie das komplette Encore-Programm.
Weitere News unter www.heyne-encore.de/facebook
Copyright © 2018 by David Lynch and Kristine McKenna
Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Lars Zwieckies
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München unter Verwendung der Originalvorlage von David Lynch
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN: 978-3-641-20179-1V001
Für Seine Heiligkeit Maharishi Mahesh Yogi
und
die globale Familie
Inhalt
Einleitung
Amerikanisches Idyll
Künstlerleben
Lächelnde Leichensäcke
Spike
Der junge Amerikaner
Wie hypnotisiert
Eine Vorstadtromanze, nur anders
In Plastikfolie gewickelt
Wie man die Liebe in der Hölle findet
Leute steigen auf, und dann fallen sie wieder herunter
Tür an Tür mit der Dunkelheit
Blitzlichtgewitter und ein Mädchen
Eine Scheibe Irgendwas
Das glücklichste Happy End von allen
Im Studio
Mein Scheit verwandelt sich in Gold
Danksagung
Filmografie
Ausstellungen
Quellen
Anmerkungen
Fotonachweise und Bildunterschriften
Register
Über die Autoren
Einleitung
Als wir uns vor einigen Jahren dazu entschlossen, gemeinsam Traumwelten zu schreiben, wollten wir zwei Dinge erreichen. Das erste Ziel war, so dicht wie möglich an eine definitive Biografie heranzukommen; das bedeutete, dass alle Fakten, Personen und Daten korrekt wiedergegeben werden mussten und es sich um verlässliche Informanten handelte. Zweitens wollten wir, dass die Stimme der Person, um die es geht, eine besondere Rolle in der Erzählung spielt.
Um das zu erreichen, entschieden wir uns für eine Vorgehensweise, die manche seltsam finden mögen. Wir hoffen dennoch, dass der Leser einen bestimmten Rhythmus darin erkennen kann. Das Prinzip war, dass einer von uns (Kristine) zunächst ein Kapitel verfasste und dabei die üblichen Regeln des Schreibens einer Biografie beachtete. Das beinhaltete auch die Recherche und die Interviews mit über hundert Menschen – Familienmitgliedern, Freunden, Ex-Ehefrauen, Mitarbeitern, Schauspielern und Produzenten. Dann nahm der andere (David) sich dieses Kapitel vor, korrigierte Fehler und Unstimmigkeiten und schrieb sein eigenes Kommentarkapitel dazu. Dabei benutzte er die Erinnerungen der anderen, um seine eigenen zutage zu fördern. Was Sie hier also vor sich haben, ist vor allem ein Dialog zwischen einer Person und seiner eigenen Biografie.
Wir haben keine Grundregeln festgelegt, und nichts wurde zum Tabu erklärt, als wir uns an die Arbeit machten. Die vielen Menschen, die freundlicherweise bereit waren, sich interviewen zu lassen, konnten ihre Version der Geschehnisse so darstellen, wie sie es für richtig hielten. Das Buch soll keine Exegese der Filme oder Kunstwerke liefern, die ebenfalls Teil der Geschichte sind. Material hierzu ist an anderer Stelle reichlich vorhanden. Dieses Buch ist eine Chronik dessen, was passiert ist, und liefert keine Erklärungen dazu, was es bedeuten könnte.
Gegen Ende unserer Zusammenarbeit hatten wir beide den gleichen Gedanken: Das Buch kam uns sehr kurz vor und schien nur an der Oberfläche der Geschichte zu kratzen. Das menschliche Bewusstsein ist viel zu groß, um zwischen zwei Buchdeckeln Platz zu finden, und jedes Erlebnis hat viel zu viele Facetten, um allen gerecht zu werden. Wir wollten etwas Definitives abliefern, aber es ist doch nur ein flüchtiger Blick geworden.
– David Lynch & Kristine McKenna
Amerikanisches Idyll
David Lynchs Mutter war ein Stadtmensch. Sein Vater stammte vom Land. Das ist ein guter Ausgangspunkt für diese Geschichte, denn es ist eine Geschichte über Dualität. »Alles ist heikel und empfindlich, die ganze Menschheit, und die Welt ist unvollkommen«, hat Lynch festgestellt, und dies ist eine zentrale Erkenntnis in Bezug auf alles, was er geschaffen hat.1 Wir leben in einem Reich der Gegensätze, an einem Ort, wo Gut und Böse, Geist und Materie, Glaube und Vernunft, unschuldige Liebe und fleischliche Lust in einem unsicheren Waffenstillstand nebeneinander existieren. Lynchs Arbeit bewegt sich in jenem komplizierten Bereich, wo das Schöne und das Verkommene miteinander kollidieren.
Lynchs Mutter Edwina Sundholm entstammte einer Familie finnischer Einwanderer und wuchs in Brooklyn auf, mitten im Rauch und Schmutz der Großstadt, im Dunst von Öl und Benzin, wo die Natur längst überlistet und ausgemerzt worden war. Diese Dinge gehören als integrale Bestandteile zu Lynchs Persönlichkeit und seiner Weltsicht. Sein Urgroßvater väterlicherseits besaß ein Stück Land im Weizenanbaugebiet in der Nähe von Colfax im Staat Washington. Dessen Sohn Austin Lynch wurde dort im Jahr 1884 geboren. Holzmühlen und majestätische Bäume, der Geruch von frisch gemähtem Gras, nächtliche Sternenhimmel, wie sie nur außerhalb der großen Städte zu sehen sind – all das gehört ebenfalls zu Lynch.
David Lynchs Großvater baute Weizen an, genau wie sein Vater. Nachdem sie sich auf einer Beerdigung kennengelernt hatten, heirateten Austin und Maude Sullivan, ein Mädchen aus St. Maries, Idaho. »Maude war sehr gebildet und forderte unseren Vater ziemlich heraus«, sagt Lynchs Schwester Martha Levacy über ihre Großmutter, die als Lehrerin in einer Ein-Klassen-Schule arbeitete. Diese Schule stand auf einem Grundstück in Highwood, Montana, das ihr und ihrem Ehemann gehörte.2
Austin und Maude Lynch hatten drei Kinder: David Lynchs Vater Donald war das zweite und wurde am 4. Dezember 1915 in einem Haus ohne fließendes Wasser und Elektrizität geboren. »Er wohnte an einem trostlosen Ort und liebte Bäume, weil es in der Prärie keine Bäume gab«, erzählt Davids Bruder John. »Er war so sehr darauf erpicht, kein Farmer in der Prärie zu sein, dass er in die Forstwirtschaft ging.«3
Donald Lynch machte gerade seinen Abschluss in Insektenkunde an der Duke University in Durham, North Carolina, als er dort 1939 Edwina Sundholm kennenlernte. Sie studierte Deutsch und Englisch. Die beiden trafen sich zufällig auf einem Spaziergang durch den Wald, und sie war beeindruckt, weil er so höflich war, einen niedrigen Zweig hochzuhalten, damit sie darunter hindurchgehen konnte. Am 16. Januar 1945 heirateten sie in einer Marinekapelle auf Mare Island in Kalifornien, dreiundzwanzig Meilen nördlich von San Francisco. Kurz darauf bekam Donald einen Job als Forscher beim Department of Agriculture in Missoula, Montana. Nachdem sie sich dort niedergelassen hatten, gründeten sie eine Familie.
David Keith Lynch war ihr erstes Kind. Er wurde am 20. Januar 1946 in Missoula geboren und war zwei Monate alt, als die Familie nach Sandpoint, Idaho umzog. Dort verbrachten sie zwei Jahre, in denen Donald für das Department of Agriculture arbeitete. Sie wohnten noch in Sandpoint, als 1948 Davids jüngerer Bruder John geboren wurde. Doch auch er kam in Missoula zur Welt: Edwina Lynch – genannt Sunny – ging dorthin zurück, um ihr zweites Kind zu bekommen. Etwas später in diesem Jahr zog die Familie nach Spokane, Washington, wo 1949 Martha geboren wurde. Das Jahr 1954 verbrachte die Familie in Durham, während Donald sein Studium in Duke beendete. Kurz kehrten sie nach Spokane zurück und ließen sich dann 1955 in Boise, Idaho nieder, wo sie bis 1960 blieben. An diesem Ort verbrachte David Lynch die wichtigsten Jahre seiner Kindheit.
Die Phase nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war eine großartige Zeit für Kinder in den Vereinigten Staaten. Der Koreakrieg endete 1953, der farblose Präsident Dwight Eisenhower residierte für zwei Wahlperioden von 1953 bis 1961 im Weißen Haus, die Umwelt war noch intakt, und so wie es aussah, musste man sich allgemein nicht besonders viele Sorgen machen. Obwohl Boise die Hauptstadt des Staates Idaho war, glich sie damals eher einer Kleinstadt, und die Mittelstandskinder wuchsen mit einem Ausmaß an Freiheit auf, das heute unvorstellbar ist. Verabredungen zum Spielen gab es nicht, die Kids zogen einfach mit ihren Freunden durch die Straßen des Viertels und probierten sich aus. Das war die Kindheit von David Lynch.
»Die Kindheit war eine magische Zeit für uns, vor allem im Sommer. Meine einprägsamsten Erinnerungen an David stammen aus dem Sommer«, erzählt Mark Smith, der damals einer seiner engsten Freunde war. »Unsere Hintertür und die von Davids Familie waren knapp zehn Meter voneinander entfernt. Nach dem Frühstück rannten wir einfach nach draußen und spielten den ganzen Tag zusammen. In der Nachbarschaft gab es brachliegende Grundstücke. Wir nahmen die Schaufeln unserer Väter und bauten unterirdische Forts, um uns dann hineinzulegen. Wir waren damals in dem Alter, in dem Jungs gern Krieg spielen.«4
Lynchs Eltern hatten jeweils zwei Geschwister, die bis auf eins alle verheiratet waren und Kinder hatten. Die Familie bestand also aus vielen Tanten und Onkeln, Cousins und Cousinen, und alle kamen gelegentlich im Haus von Lynchs Großeltern mütterlicherseits in Brooklyn zusammen. »Tante Lily und Onkel Ed waren warmherzige, gesellige Menschen, und ihr Haus an der Fourteenth Street war unser Anlaufpunkt. Lily besaß einen riesigen Tisch, der den größten Teil der Küche einnahm, und dort saßen wir dann«, erinnert sich Lynchs Cousine Elena Zegarelli. »Wenn Edwina und Don mit den Kindern vorbeikamen, war das ein großes Ereignis, zu dem Lily ein großes Abendessen bereitete, um alle willkommen zu heißen.«5
Lynchs Eltern waren in jeder Hinsicht besondere Menschen. »Unsere Eltern ließen uns Dinge tun, die total verrückt waren und die man heutzutage nicht mehr zulassen würde«, sagt John Lynch. »Sie waren sehr tolerant und übten niemals Zwang auf uns aus.« David Lynchs erste Frau Peggy Reavey ergänzt: »Manches, was mir David über seine Eltern erzählt hat, klang sehr außergewöhnlich. Zum Beispiel, dass sie es immer sehr ernst nahmen, wenn eins ihrer Kinder eine Idee hatte, was es tun oder lernen wollte. Sie hatten eine kleine Werkstatt, wo sie alles Mögliche ausprobierten und ständig die Frage auftauchte: Wie kann das funktionieren? Sie dachten sich etwas aus und realisierten es in kürzester Zeit. Es war außergewöhnlich intensiv.«
»Davids Eltern unterstützten ihre Kinder dabei, die Menschen zu sein, die sie waren«, fügt Reavey hinzu. »Aber Davids Vater legte auch Wert auf gutes Benehmen. Man behandelte niemanden schlecht, und wenn man etwas Falsches tat, dann machte man es wieder gut – in dieser Hinsicht war er sehr streng. David hat sehr hohe Ansprüche, wenn es um Handwerkliches geht, und ich bin sicher, dass das auch etwas mit seinem Vater zu tun hat.«6
Lynchs Jugendfreund Gordon Templeton erinnert sich an Lynchs Mutter als »großartige Hausfrau, die die Kleider für ihre Kinder selbst nähte«.7 Lynchs Eltern waren sehr ineinander verliebt und zeigten es auch. »Sie umarmten und küssten sich zum Abschied«, sagt Martha Levacy. Lynchs Mutter unterschrieb ihre Briefe manchmal mit »Sunny« und malte eine Sonne neben ihren Namen. Neben den von Don malte sie einen Baum. Sie waren strenggläubige Presbyterianer. »Das war ein sehr wichtiger Teil unserer Jugend«, sagt John Lynch. »Wir gingen immer zur Sonntagsschule. Die Smiths von nebenan waren da völlig anders. An Sonntagen stiegen sie in ihr Thunderbird-Cabrio und machten einen Ausflug zum Skifahren, wobei Mr. Smith eine Zigarette rauchte. Unsere Familie hingegen setzte sich in den Pontiac und fuhr zur Kirche. David meinte, die Smiths seien cool und unsere Familie spießig.«
Davids Tochter Jennifer Lynch erinnert sich an ihre Großmutter als »streng und hochanständig und sehr aktiv in der Kirchengemeinde. Sunny hatte aber auch viel Sinn für Humor und liebte ihre Kinder. Ich hatte nie den Eindruck, dass David bevorzugt wurde, aber er war definitiv derjenige, um den sie sich die meisten Sorgen machte. Mein Vater liebte seine Eltern sehr, auch wenn er ihre Tugendhaftigkeit ablehnte, den weiß gestrichenen Gartenzaun und all das. Er hat romantische Erinnerungen daran, aber er hasste es auch, denn er wollte Zigaretten rauchen und das Leben eines Künstlers führen. Stattdessen gingen sie in die Kirche. Alles war perfekt und ruhig und gut. Das machte ihn wahnsinnig«.8
Die Lynchs wohnten in einer Sackgasse. In der direkten Nachbarschaft lebten mehrere gleichaltrige Jungs, die alle Freunde wurden. »Wir waren zu acht«, sagt Templeton. »Da waren Willard ›Winks‹ Burns, Gary Gans, Riley ›Riles‹ Cutler, ich, Mark und Randy Smith sowie David und John Lynch, und wir waren wie Brüder. Wir lasen begeistert Mad, fuhren viel Fahrrad, gingen im Sommer ins Schwimmbad und trafen die Mädchen, die wir kannten, und hörten Musik. Wir hatten viele Freiheiten – bis abends um zehn Uhr waren wir mit den Fahrrädern unterwegs, fuhren mit dem Bus in die Stadt und kümmerten uns umeinander. Alle mochten David. Er war freundlich, gesellig, unprätentiös, loyal und hilfsbereit.«
Lynch schien ein aufgeweckter Junge zu sein, der nach etwas ganz Besonderem lechzte, was im Boise der Fünfzigerjahre jedoch kaum zu kriegen war. Er sprach davon, sich als Kind danach gesehnt zu haben, »dass etwas Außergewöhnliches passieren würde«. Das Fernsehen brachte andere Welten in die Wohnzimmer der Amerikaner, wodurch auch der einzigartige Charakter der Dörfer und Städte im ganzen Land relativiert wurde. Man kann sich vorstellen, dass ein sensibler Junge wie David die grundlegenden Veränderungen gespürt haben muss, die das Land prägen sollten. Gleichzeitig war er aber ein typisches Kind seiner Zeit und als solches auch engagiertes Mitglied bei den Pfadfindern. Sogar als Erwachsener gab er gelegentlich noch mit seinem Rang als Eagle Scout an, dem höchsten, den ein Pfadfinder erreichen kann.
»Wir waren zusammen beim Troop 99«, erzählt Mark Smith. »Wir machten diese ganzen Aktivitäten mit – Schwimmen, Knoten binden –, und eine davon war ein nächtliches Survivalcamp, wo man uns erklärte, welche essbaren Dinge man im Wald finden kann. Wie man ein Eichhörnchen fängt und zubereitet und so weiter. Wir nahmen an einer ganzen Reihe von Unterrichtsstunden teil, um so etwas zu lernen, und dann gingen wir in die Berge, um zu überleben. Bevor wir losgingen, kauften wir so viele Süßigkeiten wie nur möglich. Nach einer Stunde hatten wir alles aufgegessen. Dann kamen wir an einen See und erhielten den Auftrag, Fische zu fangen – was keiner von uns konnte –, und bei Einbruch der Dunkelheit glaubten wir, wir müssten verhungern. Irgendwann bemerkten wir ein Flugzeug, das über uns kreiste und schließlich einen Fallschirm mit einer Kiste abwarf. Das war richtig dramatisch. Die Kiste war voll mit Sachen wie Eipulver. Wir haben alle überlebt.«
Lynch besaß von Kindheit an eine besondere Begabung zum Zeichnen, und sein künstlerisches Talent wurde schon früh erkannt. Seine Mutter weigerte sich, ihm Ausmalbücher zu geben, weil sie glaubte, die würden seine Fantasie einschränken. Sein Vater brachte jede Menge Zeichen- und Malpapier von der Arbeit mit, sodass Lynch genug Material hatte und ermuntert wurde, alles Mögliche auszuprobieren, wenn er sich zum Zeichnen hinsetzte. »Der Krieg war gerade zu Ende, und es gab eine Menge übrig gebliebene Armeeausrüstung, also zeichnete ich Schusswaffen und Messer«, erinnert sich Lynch. »Dann kamen Flugzeuge, Bomber und Kampfflugzeuge dazu, die ›Flying Tigers‹-Fliegerstaffel und wassergekühlte Maschinengewehre der Marke Browning.«9
Martha Levacy erinnert sich: »Die meisten trugen damals einfarbige T-Shirts, und David fing an, die Hemden nach den Wünschen seiner Kunden mit Magic Markers zu gestalten. Alle in der Nachbarschaft kauften welche. Ich erinnere mich noch, dass Mr. Smith, unser Nachbar, eins für einen Freund kaufte, der schon vierzig war. David beschrieb es mit dem Spruch ›Das Leben beginnt mit 40‹ und malte dazu das Bild eines Mannes, der eine hübsche Frau anstarrt.«
Lynch war ein begabter, charismatischer Junge, der »definitiv eine große Anziehungskraft auf andere hatte«, sagt Smith. »Er war beliebt, und ich kann mir lebhaft vorstellen, wie er die Dreharbeiten zu einem Film leitet – er war immer voller Tatendrang und hatte viele Freunde, weil er wusste, wie man die Leute zum Lachen bringt. Ich erinnere mich, wie wir damals in der fünften Klasse waren, am Bordstein saßen und uns Sachen aus Mad vorlasen. Als ich die erste Episode von Twin Peaks sah, erkannte ich genau diesen Sinn für Humor darin.« Lynchs Schwester stimmt dem zu: »Eine Menge Humor aus dieser Zeit findet sich in Davids Arbeiten.«
In der siebten Klasse war Lynch Klassensprecher und spielte Trompete in der Bigband der Schule. Wie alle gesunden Menschen in Boise fuhr er Ski und ging schwimmen. In beidem war er ziemlich gut, sagt seine Schwester. Außerdem spielte er Baseball in der Little League. Und er mochte das Kino. »Wenn er einen Film gesehen hatte, den er noch nicht kannte, kam er nach Hause und erzählte ihn mir bis ins kleinste Detail nach«, sagt John Lynch. »Ich erinnere mich an einen, den er besonders mochte: Der Mann, der Liberty Valance erschoss. Er konnte gar nicht mehr aufhören, darüber zu reden.« Der erste Film, an den Lynch sich erinnert, war Wait Till the Sun Shines, Nellie, ein düsteres Drama von Regisseur Henry King aus dem Jahr 1952. »Ich sah den Film zusammen mit meinen Eltern in einem Drive-in-Kino und erinnere mich noch gut an die Szene, in der ein Mann auf dem Friseurstuhl sitzend umgebracht wird, und an eine andere, in der ein kleines Mädchen mit einem Knopf spielt«, sagt Lynch. »Und plötzlich merken ihre Eltern, dass er ihr im Hals stecken geblieben ist. Ich weiß noch, dass mir das damals große Angst gemacht hat.«
Angesichts der Arbeiten, die Lynch später produzieren sollte, überrascht es nicht, dass seine Kindheitserinnerungen von einer Mischung aus Dunkelheit und Licht geprägt sind. Vielleicht hat die Arbeit seines Vaters mit kranken Bäumen auf ihn abgefärbt und ihm eine besondere Sensibilität für das verliehen, was er einmal als »den unbändigen Schmerz und Zerfall« bezeichnet hat, der unter der Oberfläche der meisten Dinge lauert. Lynch war stets fasziniert von dem unmittelbaren Verfall, der allem Neuen von Anfang an innewohnt. Und er fand es zutiefst beunruhigend. Auch die Reisen zu den Verwandten in New York machten ihm Angst, weil vieles, was ihm dort begegnete, ihn grundlegend verunsicherte. »Die Dinge, die mich aufregten, waren nichts im Vergleich zu den Gefühlen, die sie bei mir auslösten«, sagt er. »Ich glaube, die Menschen können Angst empfinden, auch wenn sie nicht wissen, wovor sie sich konkret fürchten. Manchmal geht man in ein Zimmer und spürt sofort, dass etwas nicht stimmt. Wenn ich nach New York kam, legte sich dieses Gefühl über mich wie eine Decke. Ist man in der Natur unterwegs, hat man eine andere Art von Angst, aber auch da gibt es die Angst. Auf dem Land können schlimme Dinge passieren.«
Ein Bild mit dem Titel Boise, Idaho, das Lynch 1988 malte, beschäftigt sich mit diesen Erinnerungen. Im unteren rechten Viertel eines schwarzen Feldes sind die Umrisse des Staates zu sehen, die von kleinen Buchstaben gebildet werden, welche den Namen des Bildes ergeben. Vier senkrechte Linien durchstechen das schwarze Feld, und ein bedrohlicher Tornado nähert sich vom linken Bildrand her der Staatsgrenze. Es ist ein höchst verstörendes Bild.
Ganz offensichtlich blieben Lynchs düstere Gedankengänge seinen Spielkameraden in Boise verborgen. Smith sagt: »Wenn dieses schwarze Auto in Mulholland Drive den Berg hinauffährt, dann weiß man, dass etwas Schreckliches passieren wird. Aber das hat nichts mit dem David zu tun, den wir als Kind kannten. Diese Düsternis in seinen Werken überrascht mich, und ich weiß nicht, woher sie kommt.«
1960, als Lynch vierzehn Jahre alt war, wurde sein Vater nach Alexandria, Virginia versetzt. Die Familie zog ein weiteres Mal um. Smith erinnert sich: »Als Davids Familie wegzog, war es, als würde jemand die Glühbirne in der Straßenlaterne ausdrehen. Davids Familie besaß einen Pontiac, und das Symbol der Marke war der Kopf eines Indianers, der als Figur auf der Motorhaube thronte. Die Nase ihrer Indianerfigur war abgebrochen, weshalb wir den Wagen ›Häuptling Gebrochene Nase‹ nannten. Vor ihrer Abreise verkauften sie das Auto an meine Eltern.« Gordon Templeton erinnert sich noch an den Tag, an dem die Lynchs wegzogen: »Sie reisten mit dem Zug, und wir fuhren alle mit den Fahrrädern zum Bahnhof, um uns zu verabschieden. Es war ein trauriger Tag.«
Obwohl Lynch die Zeit auf der Highschool in Alexandria durchaus genoss, sind ihm die Erinnerungen an seine Kindheit in Boise noch immer eine Herzensangelegenheit. »Denke ich an Boise, dann sehe ich diesen typischen chromglänzenden Optimismus der Fünfzigerjahre«, sagt er. Nachdem die Lynchs fortgezogen waren, verließen auch andere die Stadt. John Lynch erinnert sich noch daran, wie David einmal sagte: »Das war der Moment, als die Musik aufhörte zu spielen.«
Kurz zuvor hatte für Lynch das Ende der Kindheit begonnen. Er erinnert sich noch, wie verzweifelt er war, als er erfuhr, dass er Elvis’ ersten Auftritt in der Ed Sullivan Show verpasst hatte, und wie er sich immer ernsthafter für Mädchen interessierte. »David fing an, mit einem sehr hübschen Mädchen auszugehen«, sagt Smith. »Sie waren total verliebt.« Lynchs Schwester erinnert sich, dass David »immer eine Freundin hatte, schon als er noch ziemlich jung war. Auf der Junior Highschool erzählte er mir mal, dass er auf einem Ausflug in der siebten Klasse mit jedem einzelnen Mädchen geknutscht hatte«.
Lynch kehrte nach Boise zurück, nachdem er die neunte Klasse in Virginia beendet hatte, und verbrachte im Sommer einige Wochen bei verschiedenen Freunden. »Als er zurückkam, hatte er sich verändert«, erinnert sich Smith. »Er war erwachsener geworden und zog sich anders an. Er hatte einen ganz speziellen Kleidungsstil, mit schwarzer Hose und schwarzem Hemd, was bei uns absolut unüblich war. Er war sehr selbstbewusst, und als er uns Geschichten über seine Erlebnisse in Washington, D.C. erzählte, waren wir schwer beeindruckt. Er hatte sich eine Weltläufigkeit angeeignet, die mir sagte, dass mein Freund mich hinter sich gelassen hatte.«
»Nach der Zeit an der Highschool kehrte David nicht wieder nach Boise zurück, und der Kontakt brach ab«, fährt Smith fort. »Meine jüngste Tochter ist Fotografin und lebt in L.A. 2010 arbeitete sie als Assistentin für einen Fotografen, der ihr eines Tages mitteilte: ›Heute fotografieren wir David Lynch.‹ In einer Pause zwischen den Aufnahmen ging sie zu ihm und sagte: ›Mr. Lynch, ich glaube, Sie kennen meinen Vater, Mark Smith aus Boise.‹ Und David sagte: ›Im Ernst?‹ Das nächste Mal, als ich zu meiner Tochter fuhr, besuchte ich ihn zu Hause. Ich hatte ihn seit der Highschool nicht mehr gesehen. Er umarmte mich, und als er mich den Leuten in seinem Büro vorstellte, sagte er: ›Das hier ist Mark, mein Bruder.‹ David ist sehr loyal und hält den Kontakt zu meiner Tochter. Für mich als Vater ist es toll, dass er dort ist. Ich wünschte, er würde immer noch in meiner Nachbarschaft wohnen.«
Die Fünfzigerjahre haben Lynch nie losgelassen. Mütter in Hemdblusenkleidern aus Baumwolle, die lächelnd den frisch gebackenen Kuchen aus dem Ofen ziehen; breitschultrige Väter in Sporthemden beim Grillen im Garten oder in Anzügen auf dem Weg ins Büro; die allgegenwärtigen Zigaretten – in den Fünfzigern rauchte jeder; der klassische Rock’n’Roll; Kellnerinnen im Diner mit kleinen Häubchen auf dem Kopf; Mädchen mit Kniestrümpfen und Schnallenschuhen, Pullovern und karierten Faltenröcken – all das gehört zum ästhetischen Vokabular von Lynch. Das wichtigste Merkmal dieser Epoche aber, das er sich erhalten hat, ist der Geist der Zeit: Die glänzende Fassade von Unschuld und Tugend, die dunklen Kräfte, die darunter lauern, und die verdeckte Laszivität, die diese Jahre erfüllte – all das sind die Eckpunkte seiner Kunst.
»Die Gegend, in der Blue Velvet gedreht wurde, sieht unserem Viertel in Boise sehr ähnlich. Einen halben Straßenzug entfernt von unserem Haus stand auch so ein grässliches Mietshaus wie das im Film«, sagt John Lynch. Die Eröffnungssequenz von Blue Velvet mit den typischen Vignetten einer amerikanischen Idylle stammt aus Good Times on Our Street, einem Kinderbuch, das David nie vergessen hat. »Die Spritztour mit dem gestohlenen Auto in Blue Velvet basiert ebenfalls auf einer wahren Boise-Begebenheit. David und ein paar seiner Freunde landeten eines Tages im Auto eines älteren Jungen, der damit angab, er würde mit hundert Sachen den Capitol Boulevard entlangbrettern. Ich denke, das war ganz schön beängstigend, mit diesem verrückten älteren Jungen in einem gestohlenen Auto so gefährlich schnell zu fahren. Eine solche Erinnerung vergisst man nicht. David lässt viele seiner Jugenderlebnisse in seine Werke einfließen.«
Tatsächlich bezieht sich Lynch in seiner Arbeit auf seine Kindheit. Aber was ihn als Künstler antreibt, lässt sich nicht auf eine so simple Gleichung reduzieren. Man kann die Kindheit eines Menschen sezieren, um den Schlüssel zu der Person zu finden, zu der er herangewachsen ist, aber zumeist gibt es kein entscheidendes Erlebnis, kein »Rosebud«. Wir entwickeln etwas, das in uns angelegt ist. Lynch besaß von Anfang an diese ungewöhnliche Fähigkeit, sich sehr für etwas zu begeistern, und das Bedürfnis, verzaubert zu werden. Schon immer war er selbstbewusst und kreativ. Er war keiner von den Jungs, die ein T-Shirt mit einem nichtssagenden Aufdruck kauften. Er war der Junge, der es anfertigte. »David war der geborene Anführer«, sagt sein Bruder John.
Es ist nett von meinem Bruder, mich als geborenen Anführer zu bezeichnen, aber ich war bloß ein ganz normaler Junge. Ich hatte tolle Freunde und machte mir keine Gedanken darüber, ob ich beliebt war oder nicht. Ich hatte auch nie das Gefühl, anders zu sein.
Man kann meinen Großvater mütterlicherseits, Großvater Sundholm, als einen Mann der Arbeiterklasse bezeichnen. In seiner Holzwerkstatt im Keller hatte er fantastische Werkzeuge und extra für seine Zwecke angefertigte Holzkisten mit eingebauten Verschlusssystemen. Unter meinen New Yorker Verwandten gab es sehr talentierte Schreiner, die in ihren Geschäften an der Fifth Avenue Möbel anfertigten. Als kleiner Junge bin ich zusammen mit meiner Mutter im Zug dorthin gefahren, um meine Großeltern zu besuchen. Ich erinnere mich daran, wie mein Großvater mich einmal im Winter herumführte und ich offenbar eine Menge redete. Ich unterhielt mich auch mit dem Mann, der den Zeitungskiosk im Prospect Park hatte, und ich glaube, ich konnte auch pfeifen. Ich war ein glückliches Kind.
Kurz nach meiner Geburt zogen wir nach Sandport, Idaho. Ich erinnere mich nur noch daran, wie ich dort mit dem kleinen Dicky Smith in unserer Schlammkuhle hockte. Es war eine kleine Grube unter einem Baum, das Wasser kam aus dem Gartenschlauch. Ich erinnere mich, dass ich mit Schlammbrocken spielte und mich wie im siebten Himmel fühlte. Die wichtigsten Dinge in meiner Kindheit geschahen in Boise, aber ich mochte Spokane, Washington auch gern. Spokane hatte einen unglaublich blauen Himmel. In der Nähe muss es einen Stützpunkt der Air Force gegeben haben, denn es flogen ständig große Flugzeuge durch den weiten Himmel, ganz langsam, denn es waren Propellerflugzeuge. Ich liebte es, Sachen zu basteln. Am Anfang habe ich vor allem Holzgewehre hergestellt. Ich sägte sie aus einem Stück Holz, und sie waren noch ziemlich grobschlächtig. Zeichnen mochte ich auch gerne.
In Spokane hatte ich einen Freund namens Bobby, der in einem Haus am Ende des Blocks wohnte, wo auch ein großes Mietshaus stand. Einmal, im Winter, bin ich in meinem Schneeanzug zu ihm gegangen. Wahrscheinlich war ich noch im Kindergartenalter. Ich trug einen Schneeanzug, und mein Freund Bobby hatte auch einen an, und wir liefen draußen in der klirrenden Kälte herum. Das Mietshaus lag etwas zurückgesetzt von der Straße. Ein Korridor führte zu den Wohnungstüren. Wir sahen, dass eine der Eingangstüren offen stand. Wir gingen rein und stellten fest, dass niemand zu Hause war. Irgendwie kamen wir auf die Idee, Schneebälle zu machen und sie in die Schubladen zu legen – in alle Schubladen, die wir finden konnten. Besonders große Schneebälle, die ungefähr einen halben Meter dick waren, legten wir aufs Bett. Auch in die anderen Zimmer trugen wir Schneebälle. Dann holten wir Handtücher aus dem Badezimmer und breiteten sie auf der Straße aus. Die vorbeifahrenden Autos wurden zuerst langsamer, aber dann sagten sich die Fahrer wahrscheinlich »Scheiß drauf« und fuhren darüber. Wir schauten mehreren Autos dabei zu und machten noch mehr Schneebälle. Irgendwann gingen wir nach Hause. Später saß ich im Esszimmer, und das Telefon klingelte. Ich dachte mir nichts dabei. Damals klingelten Telefone nur selten, aber ich ahnte trotzdem nichts Böses. Wahrscheinlich ging meine Mutter ran und übergab meinem Vater den Hörer. Als ich ihn auf eine bestimmte Art reden hörte, bekam ich langsam ein ungutes Gefühl. Ich glaube, mein armer Vater musste eine Menge für den entstandenen Schaden bezahlen. Warum wir das taten? Gute Frage …
Von Spokane aus ging es dann für ein Jahr nach North Carolina, wo mein Vater sein Studium beendete. Ich war noch klein, und als ich den Song »Three Coins in the Fountain« hörte, schaute ich auf und sah plötzlich dieses monumentale Gebäude der Duke University mit dem Brunnen davor. Es war 1954, die Sonne schien, und der Anblick des Brunnens, untermalt von diesem Lied, war unglaublich.
Meine Großeltern Sundholm wohnten in einem hübschen Sandsteingebäude an der 14th Street. Mein Großvater kümmerte sich außerdem noch um ein Haus an der Seventh Avenue. Ich glaube, im Erdgeschoss befanden sich Geschäfte, aber es war auch ein Wohnhaus. Den Bewohnern war es untersagt zu kochen. Als ich einmal mit meinem Großvater durch das Gebäude ging, stand eine Tür offen, und wir sahen, wie ein Mann sich ein Ei auf dem Bügeleisen briet. Not macht erfinderisch. Als ich älter wurde, fuhr ich nicht mehr so gern nach New York. Alles dort machte mir Angst. Die U-Bahnen fand ich total unwirklich. Unter die Erde zu steigen, wo es so eigenartig roch und der Tunnelwind die Züge ankündigte, der Lärm – es gab einiges an New York, das mir große Angst machte.
Die Eltern meines Vaters, Austin und Maude Lynch, lebten in Highwood, Montana und bauten Weizen an. Mein Großvater war ein richtiger Cowboy. Ich schaute ihm gern beim Rauchen zu. Ich wollte auch rauchen, und sein Beispiel verstärkte den Drang noch. Mein Vater rauchte Pfeife, als ich klein war, aber dann bekam er eine Lungenentzündung und hörte damit auf. Seine Pfeifen lagen immer noch herum, und ich nahm sie mir und tat so, als würde ich rauchen. Meine Eltern wickelten Klebeband um die Mundstücke, weil sie Angst hatten, sie könnten giftig sein. Aber ich durfte die Pfeifen benutzen. Manche waren geschwungen, manche gerade, und ich fand sie großartig. Mit dem richtigen Rauchen fing ich sehr früh an.
Meine Großeltern hatten also eine Ranch. Die nächstliegende größere Stadt war Fort Benton. Irgendwann in den Fünfzigern zogen sie nach Hamilton, Montana, wo sie eine Farm mit einem Bauernhaus und ziemlich viel Land übernahmen. Das war echtes Landleben. Sie hatten ein Pferd namens Pinkeye, auf dem ich reiten durfte. Ich erinnere mich noch, wie Pinkeye am Fluss den Kopf senkte, um zu trinken, und ich mich festklammern musste, damit ich nicht über den Hals ins Wasser rutschte. Man konnte aus dem Haus treten und mit dem Gewehr herumballern, ohne Angst haben zu müssen, man könnte jemanden treffen. Als ich klein war, mochte ich Bäume und fühlte mich der Natur sehr verbunden. Das war meine Welt. Wenn wir mit der Familie übers Land fuhren, hielten wir oft irgendwo an, mein Vater baute das Zelt auf, und wir kampierten dort. Wir stiegen nie in Motels ab. Damals gab es überall am Straßenrand solche Lagerplätze, aber das ist längst vorbei. Auf der Ranch musste man alles selbst reparieren, weshalb es Werkzeuge für jeden Zweck gab. Auch mein Vater hatte eine eigene Werkstatt. Er war Handwerker und reparierte Musikinstrumente. Er hat sogar zehn oder elf Geigen gebaut.
Projekte! Das Wort »Projekt« bedeutete für alle in der Familie etwas Aufregendes. Wenn man eine Idee für ein Projekt hatte, suchte man sich die entsprechenden Werkzeuge zusammen. Werkzeuge waren das Tollste! Dass es Leute gab, die Geräte erfanden, um andere Geräte zu perfektionieren, war einfach großartig! Es stimmt, was Peggy sagt: Meine Eltern nahmen es immer sehr ernst, wenn ich etwas bauen wollte.
Mom und Dad waren sehr lieb und warmherzig, genau wie ihre eigenen Eltern. Alle mochten sie, denn sie waren immer sehr fair. Das ist etwas, worüber man nicht weiter nachdenkt, aber wenn man Erzählungen von anderen hört, merkt man plötzlich, wie viel Glück man selber hatte. Mein Vater war ein echtes Original. Wenn er gekonnt hätte, wäre er wahrscheinlich für immer im Wald verschwunden. Einmal bin ich mit ihm auf die Hirschjagd gegangen. Jagen war ein natürlicher Bestandteil der Welt, in der mein Vater aufgewachsen war. Alle hatten Gewehre und gingen auf die Jagd. Aber er war kein bedenkenloser Jäger. Wenn er ein Tier erlegte, dann aßen wir es auch. Wir hatten eine gemietete Tiefkühltruhe im Keller, und ab und zu gingen wir runter und holten ein Stück Fleisch heraus. Zum Abendessen gab es oft Hirschfleisch, was ich überhaupt nicht mochte. Ich habe nie einen Hirsch geschossen, und ich bin froh darüber.
Einmal, als ich ungefähr zehn Jahre alt war, gingen wir Hirsche jagen. Wir fuhren aus Boise hinaus und erreichten einen zweispurigen Highway. Das einzige Licht kam von den Scheinwerfern der Autos, ansonsten war es stockdunkel. Das kann man sich heutzutage kaum noch vorstellen, weil es fast gar keine Straßen mehr ohne Beleuchtung gibt. Jedenfalls nicht in Amerika. Aber diese Straße war stockfinster. Wir fuhren über eine kurvige Strecke in die Berge, als ein Stachelschwein die Straße überquerte. Mein Vater hasste Stachelschweine, weil sie die Spitzen der Bäume abfressen, die dann absterben. Er versuchte es zu überfahren, aber das Tier gelangte auf die andere Seite. Er bremste scharf, und der Wagen kam quietschend zum Stehen. Er öffnete das Handschuhfach, holte seine .32er heraus und sagte: »Los komm, Dave!« Wir rannten über die Straße und folgten dem Tier den steinigen Berghang hinauf. Wegen des Gerölls rutschen wir ständig ab. Oben auf dem Kamm standen drei Bäume, und das Stachelschwein kletterte auf einen von ihnen. Wir warfen Steine in die Bäume, um herauszufinden, auf welchem es saß. Dann kletterte mein Vater den Baum hoch und rief: »Dave! Wirf einen Stein, damit es sich bewegt. Ich kann’s nicht sehen.« Also warf ich einen Stein, und er schrie: »Nein! Nicht auf mich!« Ich warf weitere Steine, er hörte, wo es entlanglief und – Peng! Peng! Peng! – schon fiel es herunter. Wir stiegen wieder ins Auto und gingen auf Hirschjagd. Auf dem Rückweg hielten wir erneut dort an und stellten fest, dass das Stachelschwein mit Fliegen bedeckt war. Ich nahm ein paar seiner Stacheln mit.
Ich ging in die zweite Klasse in Durham, North Carolina, und meine Lehrerin war Mrs. Crabtree. Mein Vater studierte in Durham für seinen Doktortitel in Forstwirtschaft, weshalb er jeden Abend am Küchentisch saß und lernte. Ich saß bei ihm und lernte ebenfalls. Ich war der einzige Schüler, der in allen Fächern die Bestnote A hatte. Meine Freundin Alice Bauer hatte ein paar Bs und war damit auf dem zweiten Platz. Eines Abends saß ich mit meinem Vater am Küchentisch und lernte, als ich hörte, wie er mit meiner Mutter über eine Maus sprach, die sich in der Küche befand. Am Sonntag ging meine Mutter mit meinem Bruder und meiner Schwester in die Kirche, während mein Vater zu Hause blieb, um die Maus loszuwerden. Als ich ihm half, den Herd zu verschieben, schoss die kleine Maus darunter hervor, flitzte durchs Wohnzimmer und sprang schließlich in einen Kleiderschrank. Mein Vater nahm einen Baseballschläger und schlug auf die Klamotten ein, bis die kleine blutige Maus herausfiel.
Idaho City war einmal der größte Ort im Staat Idaho gewesen. Aber zu der Zeit, als wir nach Boise zogen, lebten dort im Sommer noch ungefähr hundert, im Winter fünfzig Personen. In Boise befand sich das Forschungszentrum mit dem schönen Namen Boise Basin Experimental Forest. Mein Vater war der Leiter des Instituts. Der Begriff »experimental« ist wirklich wunderschön. Ich liebe ihn einfach. Sie führten dort Versuche zu Erosion, Insekten oder Krankheiten durch und erforschten, wie man Bäume widerstandsfähiger machen könnte. Alle Gebäude waren weiß und hatten eine grüne Holzverkleidung. Im Innenhof gab es Pfosten, auf denen sich kleine Holzhäuschen befanden. Sie sahen aus wie Vogelhäuschen und hatten kleine Türen. Dahinter steckten Apparaturen zur Messung der Luftfeuchtigkeit oder der Temperatur. Sie waren sehr hübsch und ebenfalls grün verkleidet wie die großen Gebäude. In den Büros standen Schränke mit flachen Schubladen, in denen Insekten auf Nadeln aufgespießt waren. Außerdem gab es Treibhäuser, in denen Pflanzen gezogen wurden. Im Wald wiederum waren Bäume mit Anhängern gekennzeichnet, weil mit ihnen spezielle Experimente durchgeführt wurden.
Damals habe ich Backenhörnchen geschossen. Mein Vater fuhr mich oft mit dem Pick-up der Forschungsstation in den Wald. Ich liebte diese Fahrzeuge, sie waren grün und fuhren wunderbar ruhig. Ich ließ mich irgendwo absetzen und nahm meine Flinte Kaliber .22 und ein bisschen Proviant mit. Am Abend holte er mich an der gleichen Stelle wieder ab. Ich durfte so viele Backenhörnchen schießen, wie ich wollte, weil es viel zu viele von ihnen gab. Vögel hingegen durfte ich nicht schießen. Einmal allerdings flatterte ein Vogel aus einer Baumkrone, und ich legte an und schoss. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn treffen würde, aber ich muss ihn wohl ziemlich gut erwischt haben. Die Federn flogen in alle Richtungen, er fiel in den Bach und trieb davon.
In Boise wohnten wir am Circle Drive direkt neben den Smiths. Die Familie bestand aus Mr. und Mrs. Smith, den vier Jungs Mark, Randy, Denny und Greg, und der Großmutter, die sie Nana nannten. Sie kümmerte sich um den Garten. Wenn sie draußen war, hörte man das leise Klimpern von Eiswürfeln im Glas. Sie trug immer Gartenhandschuhe, den Drink in der einen und den kleinen Spaten in der anderen Hand. Sie bekam den Pontiac, den meine Eltern den Smiths verkauften. Sie war nicht völlig taub, aber so schwerhörig, dass sie beim Anlassen immer Vollgas gab, um zu hören, ob der Motor lief. Wenn es nebenan in der Garage laut dröhnte, wussten wir, dass Nana losfuhr. Am Sonntag gingen die Leute in Boise zum Gottesdienst. Die Smiths fuhren in ihrem Ford Kombi zur Episkopalkirche, und Mr. und Mrs. Smith hatten auf dem Vordersitz immer eine Stange Zigaretten in Griffweite. Nicht bloß ein paar Packungen. Eine ganze Stange.
Kinder genossen damals viele Freiheiten. Wir waren ständig unterwegs und verbrachten keinen Tag im Haus. Stattdessen stromerten wir umher und machten, was uns gerade einfiel, es war großartig. Es ist wirklich schade, dass Kinder heutzutage nicht mehr so frei aufwachsen. Wie konnten wir das bloß zulassen? Einen Fernsehapparat bekamen wir erst, als ich schon in der dritten Klasse war. Als Kind sah ich ein bisschen fern, aber nicht sehr viel. Die einzige Sendung, die ich wirklich mochte, war Perry Mason. Das Fernsehen bewirkte damals schon, was das Internet heute noch verstärkt: Es machte alles gleich.
Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft der Fünfziger, die niemals wiederkehren wird: Die Orte unterschieden sich voneinander. In Boise zogen sich Männer und Frauen auf eine ganz bestimmte Art an, und wenn man nach Virginia ging, kleideten sich die Menschen dort ganz anders. In New York City war der Kleidungsstil wieder ein anderer, und dort hörte man auch nicht dieselbe Musik. In Queens sahen die Mädchen aus, wie man es noch nie zuvor gesehen hatte! Und in Brooklyn war alles schon wieder völlig anders! Es gibt da dieses berühmte Foto von Diane Arbus. Darauf ist ein Paar mit einem Baby abgebildet, und die Frau trägt eine spezielle, üppige Frisur. So etwas hätte es in Boise oder Virginia nie gegeben. Und dann die Musik. Die Musik eines Ortes, das Aussehen der Mädchen und die Art, wie sie redeten – das alles fügte sich zu einem bestimmten Bild zusammen. Ihre jeweilige Welt war einzigartig und lud dazu ein, mehr über sie herausfinden zu wollen. Diese Unterschiede sind heute weitgehend verschwunden. Zwar gibt es noch kleinere Abweichungen, zum Beispiel bei den Hipstern, aber die Hipster in einer anderen Stadt sehen genauso aus wie die in deiner eigenen.
Ich hatte schon sehr früh Freundinnen, und sie alle waren toll. Bereits im Kindergarten tauschte ich mit einem Mädchen die Decke. So was machte man damals im Kindergarten, wenn man eine Freundin hatte. In der vierten Klasse hatte ich eine Freundin namens Carol Cluff, die in der fünften Klasse die Freundin meines Kumpels Riley Cutler wurde. Sie sind noch immer miteinander verheiratet. Mein Sohn Riley wurde nach ihm benannt. In der fünften und sechsten Klasse war ich mit Judy Puttman zusammen, und danach hatte ich alle zwei Wochen eine neue Freundin. Ich habe immer noch ein Foto, auf dem ich mit Jane Johnson zu sehen bin, während wir uns bei einer Kellerparty in Boise küssen. Ihr Vater war Arzt, und wir haben uns zusammen medizinische Bücher angesehen.
An einen Kuss kann ich mich noch besonders gut erinnern. Eines Tages zog der Chef meines Vaters, Mr. Packard, mit seiner Familie nach Boise. Sie wohnten in der Forschungsstation. Eine Tochter von ihm hieß Sue. Sie war wunderschön und in meinem Alter. Sie brachte ihren Freund mit. Die beiden hatten Sex miteinander. Ich war weit davon entfernt, Sex zu haben, und völlig sprachlos, als sie mir ganz arglos davon berichteten. Eines Tages schnappte ich mir Sue ohne ihren Freund, und wir ließen die Stadt hinter uns. Im Ponderosa Pine Forest liegen die Kiefernnadeln ungefähr zwei Fuß hoch auf dem Boden, der deshalb unglaublich weich ist. Wir rannten zwischen den Bäumen herum, warfen uns auf den Boden und küssten uns lange. Es war traumhaft. Das war eine Art Kuss, der immer tiefer und tiefer geht, und er fachte etwas in mir an.
Ich erinnere mich vor allem an die Sommer, denn im Winter mussten wir zur Schule gehen. Menschen verdrängen die Schulzeit, weil sie grässlich ist. Ich erinnere mich kaum an meine Klassenzimmer, und schon gar nicht an den Unterricht, bis auf die Kunststunden. Obwohl ich einen sehr konservativen Lehrer hatte, begann ich eines Tages mich für Kunst zu begeistern. Trotzdem gefiel es mir draußen in der freien Natur viel besser.
Zum Skifahren fuhren wir über kurvige Straßen ins achtzehn Meilen entfernte Bogus Basin. Dort gab es richtig guten Schnee, viel besseren als in Sun Valley. Das Skigebiet war recht klein, aber als Kind kommt einem alles viel größer vor. Im Sommer konnte man sich dort eine Dauerkarte für den Winter verdienen, indem man mit anpackte und Buschwerk beseitigte oder Ähnliches. Einmal fanden wir dort im Sommer eine tote aufgedunsene Kuh am Ufer eines Flusses. Wir hatten Spitzhacken dabei und dachten, wir könnten sie damit zum Explodieren bringen. Die Hacke hatte eine Art Klinge und auf der anderen Seite eine Spitze. Wir wollten die Spitze in die Kuh schlagen, aber als wir es versuchten, flog die ganze Hacke weg – was ziemlich gefährlich war. Die Kuh furzte, wenn man ganz fest zuschlug, und verbreitete einen fauligen Gestank, weil sie schon verwest war, aber wir schafften es nicht, sie zum Explodieren zu bringen. Irgendwann gaben wir auf. Ich weiß nicht, warum wir sie unbedingt explodieren lassen wollten. Na ja, Kinder probieren halt gerne mal was aus.
Auf der Piste gab es keinen Sessellift, sondern einen Schlepplift, mit dem man zur Bergspitze gezogen wurde. Im Sommer, wenn der Schnee geschmolzen war, konnte man an der Stelle, wo die Leute für den Lift Schlange standen, interessante Dinge finden. Kleingeld, Fünf-Dollar-Scheine – Geld zu finden war wunderbar. Einmal fand ich auf dem Weg zum Ski-Bus im fünfzehn Zentimeter hohen Schnee ein dickes blaues Portemonnaie. Darin steckte eine ganze Rolle kanadisches Geld, mit dem man auch in den USA bezahlen konnte. Ich gab an diesem Tag während des Skifahrens einiges davon aus. In der Hütte auf dem Gipfel gab es Plundergebäck. Wahrscheinlich habe ich meinen Freunden welches gekauft. Den Rest des Geldes nahm ich mit nach Hause, und mein Vater ließ mich eine Anzeige in die Zeitung setzen, um den Besitzer zu finden. Da sich niemand meldete, konnte ich es behalten.
Eine meiner Lehrerinnen in der vierten Klasse hieß Mrs. Fordyce, und wir nannten sie Mrs. Four-Eyes. Mein Platz war in der dritten oder vierten Reihe. Hinter mir saß ein Mädchen, das ein Armband trug und an sich herumrieb. Sie konnte einfach nicht damit aufhören. Ich ahnte irgendwie, was sie da machte, wusste aber nichts Genaues. Solche Dinge kriegt man in diesem Alter erst nach und nach heraus. Judy Puttnam, meine Freundin in der sechsten Klasse, hatte eine Freundin namens Tina Schwartz. Eines Tages mussten die Mädchen alle in einen gesonderten Raum treten. Als sie wieder herauskamen, war ich sehr neugierig. Was ging hier vor? Am Nachmittag besuchte ich Judy, und wir gingen zu Tina. Die sagte dann: »Ich zeig euch, was sie uns beigebracht haben.« Dann holte sie einen Tampon hervor, hockte sich hin und erklärte mir, was man damit machte. Das war ein großes Ereignis.
Die Pubertät begann damals viel später. In der sechsten Klasse gab es Gerüchte über einen Jungen, der sich schon rasierte und größer war als die anderen. Man erzählte sich, er würde auf der Toilette was mit seinem Penis machen und dann würde eine weiße Flüssigkeit herauskommen. Ich dachte: Wie bitte, das gibt’s doch gar nicht. Aber irgendwas sagte mir, dass es stimmte. Ich vergleiche das gern mit dem Transzendentalen in der Meditation. Du glaubst nicht an Erleuchtung, aber irgendwas sagt dir, dass es sie doch gibt. Hier war es so ähnlich. Ich nahm mir vor, es am Abend selbst auszuprobieren. Es dauerte ewig. Zuerst passierte gar nichts. Und dann war da plötzlich dieses Gefühl, und ich dachte: Wo kommt denn das auf einmal her? Wahnsinn! Die Geschichte stimmte also. Es war unglaublich. Ich fühlte mich, als hätte ich das Feuer entdeckt. Es war wie Meditation. Man lernt eine bestimmte Technik, und siehe da, alles verändert sich, und etwas ganz Neues tut sich auf. Es ist real.
Ich erinnere mich auch noch, wie ich den Rock’n’Roll entdeckte. Musik bringt einen zum Träumen und erzeugt bestimmte Gefühle. Als ich ihn das erste Mal hörte, war das eine kraftvolle Erfahrung. Die Musik hat sich seit der Geburt des Rock’n’Roll verändert. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem Moment, als der Rock’n’Roll in die Welt kam, denn so etwas hatte es vorher noch nie gegeben. Diese Musik schien aus dem Nichts zu kommen. Es gab schon den Rhythm and Blues, aber den hörten wir uns nicht an, auch keinen Jazz, außer Brubeck. 1959 veröffentlichte das Dave Brubeck Quartet »Blue Rondo à la Turk«, und ich drehte total durch. Mr. Smith hatte das Album, und ich hörte es mir immer wieder bei ihnen an und verfiel dieser Musik.
Film war kein großes Thema im Boise der Fünfziger. Ich weiß noch, wie ich Vom Winde verweht im Sommer in einem Open-Air-Kino gesehen habe – das war schön. Ich erinnere mich nicht, ob ich mich mit meinem Bruder über Filme unterhielt. Und ich erinnere mich auch nicht an das erste Mal, als ich Der Zauberer von Oz sah, aber der Film hat mich sehr beeindruckt. Da bin ich natürlich nicht allein. Er hat viele Leute beeindruckt.
Das Kleinstadtleben in den Fünfzigern, das war etwas ganz Eigenes, und es ist wichtig, diese Stimmung einzufangen. Sie war irgendwie träumerisch. Die Atmosphäre damals war natürlich nicht durchweg positiv. Ich wusste immer, dass hinter der Fassade einiges vor sich ging. Wenn ich nach Einbruch der Dunkelheit mit meinem Fahrrad herumfuhr, waren viele Fenster hell erleuchtet und verbreiteten einen warmen Glanz. Die meisten Leute, die dort wohnten, kannte ich. In anderen Häusern war das Licht eher schwach, in manchen sogar kaum zu sehen. Die Leute, die dort wohnten, kannte ich nicht. Mein Gefühl sagte mir, dass in diesen Häusern etwas vor sich ging, das nichts mit Glück zu tun hatte. Ich machte mir nicht besonders viele Gedanken darüber, aber ich wusste, dass hinter den Türen und Fenstern Dinge passierten.
Eines Abends war ich mit meinem Bruder unterwegs. Wir kamen ans Ende der Straße. Heutzutage ist abends alles hell erleuchtet, aber in den Fünfzigern waren die Laternen in Kleinstädten wie Boise viel schwächer. Alles war dunkler, und das verlieh den Nächten etwas Magisches. Als wir am Ende der Straße ankamen, geschah etwas Unglaubliches: Eine nackte Frau mit weißer Haut erschien vor uns. Vielleicht lag es am Licht und der Art und Weise, wie sie aus der Dunkelheit auftauchte, aber es sah aus, als hätte ihre Haut die Farbe von Milch. Und ihr Mund war blutig. Sie wankte merklich, war in ziemlich schlechter Verfassung und splitternackt. Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Sie kam auf uns zu, schien uns aber gar nicht zu bemerken. Mein Bruder fing an zu weinen, während sie sich auf den Bordstein setzte. Ich wollte ihr helfen, aber ich war noch jung und wusste nicht, was ich tun sollte. Vielleicht habe ich sie ja etwas gefragt: Geht es Ihnen gut? Stimmt etwas nicht? Doch sie sagte nichts. Sie war verängstigt, weil jemand sie verprügelt hatte. Aber obwohl sie völlig traumatisiert war, sah sie wunderschön aus.
Ich traf mich nicht immer mit meinen Freunden, wenn ich das Haus am Parke Circle Drive verließ. Einmal, an einem recht trüben Tag, lief ich nach draußen, vermutlich war es noch ziemlich frühmorgens. Das Haus neben den Smiths gehörte der Familie Yontz. Ihre Rasenstücke gingen ineinander über, und zwischen den beiden Häusern war nur wenig Platz. Auf der einen Seite wurden die Grundstücke von Sträuchern, auf der anderen von einem Zaun abgegrenzt, und es gab ein Tor, das in eine Sackgasse führte. Auf der uns zugewandten Seite des Tors saß ein Junge, den ich noch nie vorher gesehen hatte, und weinte. Ich ging zu ihm und fragte: »Ist alles okay?« Aber er antwortete nicht. Also trat ich näher an ihn heran und fragte ihn, was denn passiert sei. Er sagte: »Mein Vater ist gestorben.« Er weinte so sehr, dass er die Worte kaum herausbrachte. Es machte mich unendlich traurig. Ich setzte mich für eine Weile zu ihm, merkte aber, dass ich ihm nicht helfen konnte. Für ein Kind ist der Tod weit weg und etwas sehr Abstraktes. Wenn man jung ist, denkt man nicht viel darüber nach, aber ich spürte genau, dass diesem Jungen etwas Schreckliches widerfahren war.
Weiter oben an der Vista Avenue gab es viele kleine Läden, die allerlei Krimskrams und Haushaltswaren verkauften. Dort besorgten wir uns verschiedene Sachen, um eine Bombe zu basteln. Wir hatten herausgefunden, wie man Rohrbomben konstruiert. In Riley Cutlers Keller bauten wir dann drei davon. Sie waren sehr stark. Riley zündete eine von ihnen ganz allein am Bewässerungskanal und erzählte uns, es sei unglaublich gewesen. Die zweite warf ich vor die Tür von Willard Burns’ Haus. Wir spielten alle Baseball und waren gut trainiert. Ich warf das Ding in hohem Bogen, und es fiel auf den Boden, explodierte aber nicht. Also warf ich es erneut, und dieses Mal krachte es gewaltig. Das Rohr zerbarst in tausend Stücke und riss eine Latte von Gordy Templetons Zaun am Nachbargrundstück ab. Gordy war gerade auf dem Klo und kam rausgerannt, ohne die Hose richtig hochgezogen zu haben. In der Hand hielt er die Klopapierrolle. Jetzt wurde uns klar, wie gefährlich es war, und dass wir jemand anderen oder uns selbst hätten umbringen können. Also warfen wir die letzte Bombe in einen leeren Swimmingpool, wo sie explodieren konnte, ohne jemanden zu verletzen.
Es gab einen Riesenknall, als sie detonierte, und wir machten uns aus dem Staub. Gordy und ich liefen in die eine, die Übrigen in die andere Richtung. Ich begleitete Gordy nach Hause. Das Wohnzimmer der Templetons hatte ein breites Panoramafenster zur Straße. Wir saßen auf dem Sofa, und Mrs. Templeton machte Thunfischsandwiches und Pommes frites, was ich zu Hause nie bekam. Auch keine Süßigkeiten, bis auf Haferkekse mit Rosinen. Alles musste gesund sein. Wie auch immer, wir aßen gerade unsere Sandwiches, als wir sahen, wie draußen ein riesiger Polizist in schwarzer Uniform mit Goldtressen auf einem gigantischen Motorrad vorbeiglitt. Er hielt an, klemmte sich den Helm unter den Arm, ging zur Tür und klingelte. Wir mussten mit aufs Revier. Ich war damals Klassensprecher der siebten Klasse und wurde dazu verdonnert, einen Aufsatz für die Polizei zu schreiben. Thema: »Aufgaben und Pflichten von Anführern«.
Ich geriet auch wegen anderer Dinge in Schwierigkeiten. Meine Schwester Martha war noch in der Grundschule, als ich in die Junior High kam. Auf dem Weg zum Unterricht kam sie an unserer Schule vorbei. Ich redete ihr ein, sie solle im Vorbeigehen den Mittelfinger ausstrecken, denn das sei ein freundlicher Gruß. Ich weiß nicht, ob sie es jemals getan hat, aber sie fragte meinen Vater danach, der sehr wütend wurde. Ein anderes Mal klaute ein Junge seinem Vater ein paar Patronen vom Kaliber .22 und gab mir einige davon. Diese Patronen haben ein hübsches Gewicht und sehen aus wie kleine Schmuckstücke. Ich bewahrte sie eine Weile auf, bis mir der Gedanke kam, ich könnte vielleicht deswegen Ärger kriegen. Also wickelte ich sie in Zeitungspapier, steckte sie in eine Tüte und warf sie in den Müll. Im Winter verbrannte meine Mutter manchmal Abfall im Kamin. Sie zündete die Tüte an, und kurz darauf flogen die Kugeln durchs Wohnzimmer. Das brachte mir neuen Ärger ein.
Einmal, als wir ein Badminton-Turnier hinter dem Haus der Smiths veranstalteten, hörten wir eine gigantische Explosion und rannten zur Straße. An deren Ende sahen wir Rauch aufsteigen. Wir gingen hin und trafen dort auf einen älteren Jungen namens Jody Masters. Er hatte aus einem Rohr eine Rakete gebaut und sie versehentlich gezündet. Die Explosion hatte ihm den Fuß abgerissen. Seine Mutter, die gerade schwanger war, kam heraus und sah ihren Ältesten auf dem Boden liegen. Er versuchte aufzustehen, aber sein Fuß hing nur noch an den Sehnen und war von einer Pfütze aus Blut und abgebrannten Streichholzköpfen umgeben. Der Fuß konnte angenäht werden und kam wieder in Ordnung. Damals wurden in Boise wirklich verdammt viele Bomben gebaut.
Als ich die achte Klasse beendet hatte, zogen wir von Boise nach Alexandria, Virginia. Ich war unendlich traurig deswegen, es war das Ende einer Ära für mich. Mein Bruder hat recht: Es war der Moment, als die Musik aufhörte zu spielen. In den Sommerferien nach der neunten Klasse fuhr ich dann mit meiner Mutter, meiner Schwester und meinem Bruder im Zug zu Besuch nach Boise.
In diesem Sommer starb mein Großvater Lynch, und ich war der Letzte, der ihn lebend sah. Sein Bein war amputiert worden und nie richtig verheilt, weil die Arterien sich verhärtet hatten. Er wohnte in einem normalen Haus zusammen mit fünf oder sechs anderen Patienten, die betreut werden mussten. Meine Mutter und meine Großmutter besuchten ihn täglich, aber an diesem einen Tag hatten sie keine Zeit und baten mich, nach ihm zu sehen. Ich verbrachte den Tag im Schwimmbad, und irgendwann fiel mir ein, dass ich ihn ja besuchen sollte. Also lieh ich mir von einem Jungen ein Fahrrad und radelte zur Shoshone Street. Er saß in seinem Rollstuhl im Vorgarten, um frische Luft zu schnappen. Ich setzte mich zu ihm, und wir unterhielten uns richtig gut. Ich weiß nicht mehr, worüber. Kann sein, dass ich ihn über die alten Zeiten ausfragte. Manchmal saßen wir auch eine Weile schweigend da. Ich fand es schön, so bei ihm zu sitzen. Dann sagte er: »Na, Dave, dann geh ich jetzt wohl mal wieder rein.« Und ich sagte: »Okay, Großvater«, schwang mich aufs Fahrrad und fuhr davon. Im Wegfahren sah ich noch, wie die Schwester rauskam, um ihn zu holen, dann wurde mir die Sicht von einer grünen Garagenwand genommen.
Ich fuhr zu Carol Robinson. Ihr Cousin Jim Baratt hatte eine Bombe gebaut, so groß wie ein Basketball, die er jetzt in die Luft jagen wollte. Er setzte die Bombe auf den frisch gemähten Rasen im Garten. Das Gras roch wunderbar. Ich habe so was schon lange nicht mehr gerochen und frage mich, ob hier in L.A. überhaupt irgendwo Rasen gemäht wird. Wie auch immer, Jim nahm eine Waschschüssel aus Porzellan, die ungefähr fünfundvierzig Zentimeter Durchmesser hatte, und setzte sie auf die Bombe. Dann zündete er das Ding, worauf die Schüssel mehr als sechzig Meter weit durch die Luft flog. Dreck spritzte in alle Richtungen. Rauch stieg ein paar Meter hoch auf. Es sah großartig aus.
Nach einer Weile hörte ich Sirenen und bekam Angst vor der Polizei. Also fuhr ich schnell zum Schwimmbad, um dem Jungen das geliehene Fahrrad zurückzugeben. Als ich kurz darauf vor dem Haus meiner Großeltern ankam, stand meine Mutter vor der Tür. Sie lief aufs Auto zu, sah mich und gestikulierte. Ich rannte zu ihr und fragte, was los sei. Sie antwortete: »Dein Großvater.« Ich fuhr sie in Windeseile zum Krankenhaus, in das sie ihn gebracht hatten, parkte in der zweiten Reihe, und meine Mutter ging rein. Eine Viertelstunde später kam sie wieder heraus. Ich wusste sofort, dass etwas passiert war. Sie stieg ein und sagte: »Dein Großvater ist tot.«
Fünfzehn Minuten bevor es passierte, war ich noch bei ihm gewesen. Als er sagte: »Na, Dave, dann geh ich jetzt wohl mal wieder rein«, hatte er anscheinend gemerkt, dass etwas mit ihm nicht stimmte, aber er wollte es mir gegenüber nicht zugeben. Am Abend saß ich bei meiner Großmutter, und sie wollte ganz genau wissen, worüber wir gesprochen hatten. Später, als ich zwei und zwei zusammenzählte, wurde mir klar, dass die Sirenen nichts mit der Bombe zu tun gehabt hatten, sondern dass es der Krankenwagen für meinen Großvater gewesen war. Ich mochte meine Großeltern sehr gern, alle vier, und er war der erste von ihnen, den ich verlor. Sein Tod hat mich schwer getroffen.
Viel später, 1992, kehrte ich noch mal nach Boise zurück, um Nachforschungen über ein Mädchen anzustellen, das in den Siebzigern Selbstmord begangen hatte. Allerdings fing die Geschichte schon viel früher an. Als ich nach der achten Klasse aus Boise wegzog, war ich mit Jane Johnson zusammen. Die neunte Klasse war meine schlimmste Zeit, also schrieb ich ihr oft, und die Beziehung blieb intakt. Als wir dann im darauffolgenden Sommer nach Boise zurückkehrten, trennten wir uns schon nach zwei Wochen. Während meines Aufenthalts fing ich was mit einem anderen Mädchen an, und als ich wieder in Alexandria war, schrieb ich ihr. Wir schrieben uns jahrelang, und damals waren Briefe wirklich umfangreich.
Im Sommer nach meinem Highschool-Abschluss fuhr ich mit dem Greyhound-Bus zu meiner Oma. Der Bus hatte einen starken Motor, der viel Lärm machte, und der Fahrer fuhr mit siebzig bis achtzig Meilen über die zweispurigen Landstraßen. Der größte Teil der Strecke führte durch Steppengebiet. Ich erinnere mich an einen Mann im Bus, der wie ein Cowboy aussah. Er hatte einen Cowboyhut auf, jede Menge Schweißflecken, und sein ledriges Gesicht war von tiefen Furchen durchzogen. Er hatte stahlblaue Augen und schaute die ganze Fahrt über aus dem Fenster. Ein Cowboy vom alten Schlag. In Boise angekommen, ging ich zum Haus meiner Großmutter, die jetzt mit Mrs. Foudray zusammenwohnte. Die alten Damen waren ganz vernarrt in mich, weil ich so hübsch war. Es war toll.