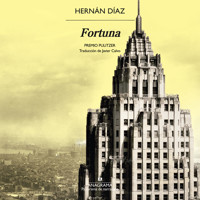Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hernan Diaz‘ vielschichtiger Roman dekonstruiert den amerikanischen Mythos von Männern, Macht und Reichtum und gipfelt in einer provokanten Geschichte der Emanzipation. Ausgezeichnet mit dem Pulitzer-Preis 2023 Am Anfang steht das Geld. Und ein Mann, der es zu vermehren versteht wie kein Zweiter. In der schillernden New Yorker Finanzwelt der 20er-Jahre wächst Benjamin Rasks Vermögen ins Unermessliche. Aber erst seine Ehe mit der geheimnisvollen Helen gibt seinem Leben Sinn. Bald vibriert die ganze Stadt vor Gerüchten um das enigmatische Paar, und mit der Zeit beginnen die vielen Erzählungen die Wahrheit über die Eheleute zu verschleiern. Bis sich eine unerwartete Stimme in dem Gewirr Gehör verschafft. "Treue" ist ein fulminantes Spiel mit dem Leser, eine vierteilige Matroschka, deren Kern den großen amerikanischen Mythos des Kapitals für immer verändert. Was als klassischer Roman über Macht und Männer beginnt, gipfelt in einer provokanten und hochmodernen Geschichte der Emanzipation.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Am Anfang steht das Geld. Und ein Mann, der es zu vermehren versteht wie kein Zweiter. In der schillernden New Yorker Finanzwelt der 20er-Jahre wächst Benjamin Rasks Vermögen ins Unermessliche. Aber erst seine Ehe mit der geheimnisvollen Helen gibt seinem Leben Sinn. Bald vibriert die ganze Stadt vor Gerüchten um das enigmatische Paar, und mit der Zeit beginnen die vielen Erzählungen die Wahrheit über die Eheleute zu verschleiern. Bis sich eine unerwartete Stimme in dem Gewirr Gehör verschafft.»Treue« ist ein fulminantes Spiel mit dem Leser, eine vierteilige Matroschka, deren Kern den großen amerikanischen Mythos des Kapitals für immer verändert. Was als klassischer Roman über Macht und Männer beginnt, gipfelt in einer provokanten und hochmodernen Geschichte der Emanzipation.
Hernan Diaz
Treue
Roman
Aus dem Englischen von Hannes Meyer
Hanser Berlin
Für Anne, Elsa, Marina und Ana
Verpflichtungen
Ein Roman
von
Harold Vanner
EINS
Da er von Geburt an annähernd jeden erdenklichen Vorteil genossen hatte, blieb Benjamin Rask als eines von wenigen das Privileg eines heldenhaften Aufstieges versagt: Seine Geschichte war keine zäher Hartnäckigkeit, keine Chronik eines unbezwinglichen Willens, der sich aus wenig mehr als altem Blech ein goldenes Schicksal schmiedete. Den letzten Seiten der Rask’schen Hausbibel zufolge waren die Ahnen seines Vaters im Jahre 1662 von Kopenhagen nach Glasgow übergesiedelt, wo sie den Handel mit Tabak aus den Kolonien aufnahmen. Im Laufe des nächsten Jahrhunderts gedieh und expandierte das Geschäft in solchem Maße, dass ein Teil der Familie nach Amerika zog, von wo aus man die Lieferanten besser kontrollieren und jeden einzelnen Schritt der Produktion beaufsichtigen konnte. Drei Generationen später kaufte Benjamins Vater Solomon all seine Verwandten und externen Investoren aus. Unter seiner alleinigen Führung entwickelte sich das Unternehmen weiter prächtig, und es dauerte nicht lang, bis er einer der namhaftesten Tabakhändler der Ostküste war. Gewiss erwarb er seine Bestände von den erlesensten Produzenten des Kontinents, doch mehr noch als in der Qualität seiner Waren lag der Schlüssel zu Solomons Erfolg in dessen Talent, Nutzen aus einer allzu offensichtlichen Tatsache zu ziehen: Natürlich hat der Tabakgenuss seine sinnliche Seite, doch rauchen die meisten Männer, weil sie dabei mit anderen Männern reden können. So sorgte Solomon Rask also nicht nur für die besten Zigarren, Zigarillos und Pfeifenmischungen, sondern auch (und vor allem) für vorzügliche Unterhaltungen und politische Verbindungen. Er erreichte und sicherte sich einen festen Platz auf den höchsten Höhen der Branche — alles dank seiner Geselligkeit und der Freundschaften, die er im Herrenzimmer pflegte, wo er oft eine seiner Figurados mit seinen distinguiertesten Kunden rauchte, zu denen Persönlichkeiten wie Grover Cleveland, William Zachary Irving und John Pierpont Morgan zählten.
Auf dem Gipfel seines Erfolges ließ Solomon sich ein Stadthaus an der West 17th Street bauen, das gerade rechtzeitig zu Benjamins Geburt vollendet wurde. Und doch war Solomon nur selten in der New Yorker Familienresidenz zu sehen. Seine Arbeit führte ihn von Plantage zu Plantage, er hatte Rollsäle zu kontrollieren und Geschäftspartner in Virginia, North Carolina und in der Karibik zu besuchen. Er besaß gar eine kleine Hacienda in Kuba, wo er den Großteil eines jeden Winters weilte. Gerüchte über sein Leben auf der Insel brachten ihm den Ruf eines Abenteurers mit Hang zum Exotischen ein, was in seinem Geschäft durchaus von Vorteil war.
Mrs Wilhelmina Rask setzte nie einen Fuß auf das kubanische Anwesen ihres Gatten. Auch sie verließ New York oft und lang, denn sie reiste stets ab, sobald Solomon zurückkehrte, und verbrachte ganze Saisons in den Sommerhäusern ihrer Freunde am Ostufer des Hudson oder in deren Cottages in Newport. Augenscheinlich teilte sie allein Solomons Leidenschaft für Zigarren, die sie eifrig rauchte. Da dies für eine Dame ein höchst ungewöhnliches Vergnügen war, frönte sie ihm nur privat, in Gesellschaft ihrer Freundinnen. Was allerdings kein Hindernis darstellte, da sie ohnehin jederzeit von diesen umgeben war. Willie, wie ihr engster Kreis sie nannte, war Teil einer eingeschworenen Gruppe Frauen, die scheinbar eine Art Nomadenstamm bildeten. Sie kamen nicht nur aus New York, sondern auch aus Washington, Philadelphia, Providence, Boston und sogar aus dem fernen Chicago. Sie reisten im Rudel, besuchten einander je nach Jahreszeit daheim oder in ihren jeweiligen Ferienhäusern — ab Ende September, wenn Solomon auf seine Hacienda fuhr, wurde die West 17th Street für ein paar Monate zur Bleibe der Clique. Doch in welchem Teil des Landes die Damen sich auch aufhielten, sie blieben jederzeit strikt unter sich.
Da Benjamins Leben sich zunächst weitgehend auf sein Zimmer und jene seiner Kindermädchen beschränkte, hatte er nur eine vage Vorstellung vom Rest des Hauses, in dem er aufwuchs. Wenn seine Mutter und ihre Freundinnen da waren, hielt man ihn von den Räumen fern, wo sie bis spät in die Nacht rauchten, Karten spielten und Sauternes tranken; waren sie fort, boten die Hauptgeschosse bloß eine dämmrige Abfolge geschlossener Fensterläden, abgedeckter Möbel und mit bauschenden Stoffen verhängter Kronleuchter. All seine Kindermädchen und Gouvernanten waren sich einig, dass er ein vorbildliches Kind war, und all seine Lehrer bestätigten es. Manieren, Intelligenz und Gehorsam hätten sich niemals zuvor so harmonisch zusammengefügt wie bei diesem friedfertigen Kind. Als einzigen möglichen Makel konnten einige seiner frühen Mentoren nach langer Suche nur Benjamins Zurückhaltung gegenüber anderen Kindern benennen. Als einer seiner Lehrer die Freundlosigkeit seines Schülers einer etwaigen Angst zuschrieb, wies Solomon derartige Bedenken ab und sagte, der Junge werde eben sein eigener Herr.
Seine einsame Kindheit hatte ihn nicht auf das Internat vorbereitet. Im ersten Halbjahr wurde er zum Ziel täglicher Erniedrigungen und kleinerer Grausamkeiten. Mit der Zeit erkannten seine Klassenkameraden allerdings, dass er aufgrund seines Gleichmutes ein unbefriedigendes Opfer war, also ließen sie ihn fortan in Ruhe. Er blieb für sich und erzielte ohne besondere Leidenschaft in jedem Schulfach hervorragende Leistungen. Nachdem seine Lehrer ihn am Ende jedes Schuljahres mit jeglichen verfügbaren Ehren und Auszeichnungen überhäuft hatten, erinnerten sie ihn stets daran, dass er der Akademie dereinst großen Ruhm einbringen werde.
In seinem letzten Schuljahr starb sein Vater an Herzversagen. Bei der Beerdigung in New York waren Verwandte wie Bekannte beeindruckt von Benjamins Fassung, doch in Wahrheit hatte die Trauer seinem Naturell lediglich einen gesellschaftlich anerkannten Ausdruck geboten. In einem Anflug großer Frühreife, der die Anwälte und Bankiers seines Vaters erstaunte, verlangte der Junge, das Testament und die damit verbundenen Vermögensaufstellungen zu prüfen. Mr Rask war ein gewissenhafter, ordentlicher Mann gewesen, und sein Sohn fand keinen Mangel an den Dokumenten. Als er diese Angelegenheit erledigt hatte und nun wusste, was ihn erwartete, wenn er volljährig wurde und ihm sein Erbe zukam, kehrte er nach New Hampshire zurück, um die Schule abzuschließen.
Seine Mutter verbrachte ihre kurze Witwenschaft bei ihren Freundinnen in Rhode Island. Sie fuhr im Mai, kurz vor Benjamins Abschluss, und war vor Ende des Sommers an einem Emphysem gestorben. Bei dieser zweiten, deutlich kleineren Beerdigung wussten Freunde und Verwandte kaum, wie sie mit dem innerhalb weniger Monate verwaisten jungen Mann reden sollten. Glücklicherweise gab es viele praktische Fragen zu besprechen — Treuhänder, Testamentsvollstrecker und die juristischen Herausforderungen der Nachlassverwaltung.
Benjamins Studentenleben war ein verstärktes Echo seiner Schulzeit. Seine Unzulänglichkeiten und Begabungen waren dieselben geblieben, doch nun hatte er eine kühle Affinität für Erstere und eine bescheidene Geringschätzung für Letztere entwickelt. Einige der bezeichnenderen Züge seiner Abstammungslinie hatten in ihm anscheinend ein Ende gefunden. Er hätte seinem Vater nicht unähnlicher sein können, der sogleich jeden Raum beherrschte, den er betrat, und um den alsbald ein jeder kreiste, und auch mit seiner Mutter hatte Benjamin nichts gemein, die wahrscheinlich keinen Tag ihres Lebens allein verbracht hatte. Nach seinem Universitätsabschluss stellten sich diese Unterschiede noch einmal klarer heraus. Er zog aus New England zurück in die Stadt und scheiterte, wo die meisten seiner Bekanntschaften reüssierten — er war ein ungeschickter Sportler, ein teilnahmsloses Clubmitglied, ein lustloser Trinker, ein gleichgültiger Spieler, ein lauer Liebhaber. Er, der seinen Reichtum dem Tabak verdankte, rauchte nicht einmal. Wer ihn aber der übertriebenen Sparsamkeit bezichtigte, verstand nicht, dass er in Wahrheit keinerlei Gelüste zu unterdrücken hatte.
*
DAS TABAKGESCHÄFT hätte Benjamin nicht weniger interessieren können. Ihm gefiel weder das Produkt — das primitive Gesauge und Geschmauche, die unzivilisierte Faszination des Rauches, der bittersüße Gestank verrotteter Blätter — noch die damit verbundene Geselligkeit, die sein Vater so sehr genossen und so erfolgreich ausgeschöpft hatte. Nichts widerte ihn mehr an als die dunstige Verschworenheit des Herrenzimmers. Seinen ehrlichen Bemühungen zum Trotze konnte er nicht ansatzweise mit der gebotenen Leidenschaft die Vorzüge einer Lonsdale vor einer Diadema loben, und ebenso wenig konnte er mit dem Nachdruck, den nur die eigene Erfahrung verleiht, die Robustos von seinen Ländereien auf der Vuelta Abajo anpreisen. Plantagen, Trockenschuppen und Zigarrenfabriken gehörten einer fernen Welt an, die ihn nicht weiter reizte. Er hätte bereitwillig zugegeben, was für ein katastrophaler Botschafter er für das Unternehmen war, weshalb er das Tagesgeschäft dem Direktor übertrug, der unter seinem Vater bereits zwei Jahrzehnte lang treu gedient hatte. Gegen den Rat ebendieses Direktors verkaufte Benjamin unter Wert und durch Mittelsmänner, die er nie persönlich kennenlernte, die kubanische Hacienda seines Vaters und alles, was dazugehörte, ohne auch nur eine Bestandsaufnahme zu machen. Das Geld investierte sein Bankier gemeinsam mit seinem übrigen Vermögen in den Aktienmarkt.
Einige träge Jahre vergingen, in denen er halbherzig diverse Sammlungen begann (Münzen, Porzellan, Freunde), mit der Hypochondrie liebäugelte, keine rechte Begeisterung für Pferde entwickeln konnte und sich ebenso erfolglos als Dandy versuchte.
Der Müßiggang wurde ihm zur Qual.
Entgegen seinen eigentlichen Neigungen begann er mit der Planung einer Europareise. Dabei wusste er aus Büchern bereits alles, was ihn am alten Kontinent interessierte; die persönliche Erfahrung dieser Dinge und Orte reizte ihn nicht. Er freute sich auch nicht darauf, tagelang mit Fremden auf einem Schiff gefangen zu sein. Dennoch sagte er sich, sollte er jemals reisen, dann war nun der richtige Augenblick: In New York war die allgemeine Stimmung recht niedergeschlagen, weil eine Rezession infolge mehrerer Finanzkrisen das Land nun seit zwei Jahren im Griff hielt. Da dieser Abschwung ihn nicht unmittelbar betraf, war Benjamin sich dessen Ursachen nur in groben Zügen bewusst — seiner Kenntnis nach, hatte es mit dem Platzen der Eisenbahn-Blase begonnen, die auf irgendeine Weise mit dem bald darauf folgenden Absturz des Silbers zusammenhing, der wiederum zu einem Ansturm aufs Gold geführt hatte, welcher schlussendlich die zahlreichen Bankenpleiten auslöste, die als »Panik von 1893« bekannt wurden. Wie genau die Ereigniskette auch ausgesehen haben mochte, er machte sich keine Sorgen. Er hatte die allgemeine Vorstellung, dass die Märkte nun einmal hin- und herpendelten, und er war zuversichtlich, dass die Verluste von heute die Gewinne von morgen waren. Anstatt ihn von seiner Exkursion nach Europa abzubringen, war die Finanzkrise — die schlimmste seit der Langen Depression zwei Jahrzehnte zuvor — für ihn eine der stärksten Ermutigungen, aufzubrechen.
Als er gerade ein Datum für seine Abreise festlegen wollte, unterrichtete ihn sein Bankier, dass er durch gewisse »Beziehungen« Anleihen hatte zeichnen können, die ausgegeben worden waren, um die Goldreserven des Landes wiederherzustellen, deren Erschöpfung so viele Banken in die Insolvenz getrieben hatte. Die gesamte Emission war innerhalb einer halben Stunde ausverkauft gewesen, und innerhalb einer Woche hatte er einen ansehnlichen Gewinn zu verbuchen. So hatte unerwartetes Glück in Form günstiger politischer Verschiebungen und Marktfluktuationen zu einem plötzlichen und scheinbar spontanen Wachstum Benjamins respektabler Erbschaft geführt, um deren Vergrößerung er sich bisher nicht bemüht hatte. Doch nun, da dies der Zufall für ihn getan hatte, entdeckte er in seinem Herzen einen Hunger, von dem er nichts geahnt hatte, bevor diesen nicht ein ausreichend großer Köder zum Leben erweckt hatte. Europa würde warten müssen.
Rasks Vermögen wurde konservativ verwaltet von J. S. Winslow & Co., dem Haus, das seit jeher die Familiengeschäfte geregelt hatte. Das von einem Freund seines Vaters gegründete Institut befand sich nun in den Händen von John S. Winslow jr., der vergeblich versucht hatte, Benjamin als Freund zu gewinnen. Aus diesem Grunde war die Beziehung der beiden jungen Männer etwas angespannt. Dennoch arbeiteten sie eng miteinander zusammen — wenn auch nur durch Boten oder per Telefon, zwei Optionen, die Benjamin den überflüssigen und bemüht herzlichen persönlichen Treffen vorzog.
Bald hatte Benjamin gelernt, den Börsenticker zu lesen, Muster zu erkennen, sie zu überlagern und verborgene Kausalzusammenhänge zwischen scheinbar voneinander unabhängigen Entwicklungen zu entdecken. Winslow, der merkte, was für ein begabter Lehrling sein Kunde war, ließ alles mysteriöser erscheinen, als es wirklich war, und tat Benjamins Vorhersagen als nichtig ab. Dessen ungeachtet begann Rask, eigene Entscheidungen zu treffen, meist gegen den Rat des Instituts. Er fühlte sich zu kurzfristigen Anlagen hingezogen und wies Winslow an, hochriskante Geschäfte mit Optionen, Termingeschäften und anderen spekulativen Instrumenten einzugehen. Winslow mahnte stets zur Vorsicht und protestierte gegen solch waghalsige Unterfangen: Er weigerte sich, Benjamin sein ganzes Kapital bei einem Vabanquespiel riskieren zu lassen. Aber mehr noch als um das Vermögen seines Kunden sorgte Winslow sich wohl um sein Ansehen, denn er stellte gern eine gewisse finanzielle Etikette zur Schau — schließlich sei er, wie er einmal mit einem verhaltenen Lachen über sein eigenes Bonmot sagte, eher Buchhalter als Buchmacher, Direktor einer Bank, keiner Spielbank. Von seinem Vater hatte er eine Reputation für sichere Anlagen geerbt, und dieser wollte er gerecht werden. Und dennoch, am Ende folgte er stets Rasks Anweisungen und strich seine Gebühr ein.
Nach kaum einem Jahr beschloss Rask, des Dünkels und der Schwerblütigkeit seines Beraters überdrüssig, auf eigene Faust zu handeln, und entließ Winslow. Das Kappen jeglicher Verbindungen mit der Familie, die der seinen über zwei Generationen so nahe gewesen war, verstärkte noch das Gefühl echten Erfolgs, das Rask zum ersten Mal im Leben spürte, als er seine Geschäfte selbst in die Hand nahm.
*
DIE ZWEI UNTEREN GESCHOSSE seines Stadthauses wurden zu einem provisorischen Büro. Diese Wandlung war nicht etwa das Ergebnis eines durchdachten Planes, sondern sie vollzog sich Schritt für Schritt, während ein unvorhergesehenes Bedürfnis nach dem anderen erfüllt wurde, bis auf einmal ein Arbeitsbereich voller Angestellter geschaffen war. Es fing mit einem Boten an, den Benjamin mit Aktienzertifikaten, Anleihen und anderen Dokumenten durch die ganze Stadt laufen ließ. Nach einigen Tagen erklärte der Junge ihm, dass er Hilfe brauche. Gemeinsam mit dem neuen Boten stellte Benjamin eine Telefonistin und einen Schreiber ein, der ihn ebenfalls bald wissen ließ, dass er die Arbeit allein nicht schaffe. Das Anleiten seines Personals kostete ihn wertvolle Zeit für seine Geschäfte, also stellte er einen Assistenten ein. Auch die Buchführung verschlang Stunde um Stunde, also engagierte er einen Buchhalter. Als schließlich sein Assistent einen Assistenten bekam, verlor Rask den Überblick über die Neuanstellungen und gab es auf, sich irgendjemandes Gesicht oder Namen zu merken.
Die Möbel, die jahrelang verhüllt und unberührt geblieben waren, wurden nun ehrfurchtslos von Sekretärinnen und Botenjungen benutzt. Auf dem Walnusstischchen hatte man einen Börsenticker aufgestellt; Kurstafeln bedeckten einen Großteil der goldgeprägten Laubtapete; Zeitungsstapel hatten den strohgelben Samt einer Polsterbank verfärbt; eine Schreibmaschine hatte Dellen in einen Satinholz-Sekretär getrieben; schwarze und rote Tinte befleckte die bestickten Polster von Diwanen und Sofas; Zigaretten hatten die geschwungenen Kanten eines Mahagoni-Schreibtisches versengt; hastende Schuhe hatten eichene Pratzenfüße verschrammt und persische Läufer auf ewig verschmutzt. Die Räume seiner Eltern blieben intakt. Er schlief im Obergeschoss, das er als Kind nicht einmal besucht hatte.
Es war nicht schwer, einen Käufer für das Unternehmen seines Vaters zu finden. Benjamin ermutigte einen Fabrikanten aus Virginia und eine Handelskompanie aus Großbritannien, einander zu überbieten. Und da er sich nur zu gern von diesem Teil seiner Vergangenheit distanzieren wollte, freute er sich über den Sieg der Briten, nach dem die Tabakfirma wieder dahin zurückkehren konnte, woher sie gekommen war. Aber vor allem verschaffte es ihm Befriedigung, dass er mit dem Erlös des Verkaufs nun auf einer höheren Ebene arbeiten, eine neue Risikostufe bewältigen und langfristigere Transaktionen finanzieren konnte, die er vorher nicht hätte in Erwägung ziehen können. Sein Umfeld nahm mit Verwirrung wahr, dass seine Besitztümer im direkten Verhältnis zu seinem Reichtum weniger wurden. Er verkaufte alle verbleibenden Immobilien der Familie, selbst das Stadthaus an der West 17th Street, und alles, was darin war. Seine Kleider und Unterlagen passten in zwei Koffer, die man ins Wagstaff Hotel schickte, wo er sich eine Suite anmietete.
Die Verrenkungen des Geldes faszinierten ihn immer mehr — es ließ sich so im Kreis biegen, dass man es mit seinem eigenen Körper mästen konnte. Die isolierte, selbstgenügsame Natur der Spekulation entsprach Benjamins Charakter, war für ihn Quell des Staunens und allein Zweck genug, ungeachtet all dessen, was seine Einkünfte bedeuteten oder ihm ermöglichten. Jeglicher Luxus war eine vulgäre Bürde. Sein einsiedlerischer Geist sehnte sich nicht nach Zugang zu neuen Erfahrungen. Politik und Machtstreben spielten in seinem ungeselligen Denken keine Rolle. Strategiespiele wie Schach oder Bridge hatten ihn nie interessiert. Hätte man ihn gefragt, wäre es Benjamin wohl schwergefallen zu erklären, was ihn zur Finanzwelt hingezogen hatte. Die Komplexität, gewiss, aber auch die Tatsache, dass er Kapital als antiseptisch lebendes Wesen sah. Es bewegt sich, es frisst, wächst, pflanzt sich fort, erkrankt und kann sterben. Aber es ist sauber. Das wurde ihm mit der Zeit immer klarer. Je größer die Operation, desto größer auch seine Distanz zu den konkreten Einzelheiten. Er brauchte keine einzige Banknote anzurühren oder sich den Dingen und Leuten zu widmen, auf die sich seine Transaktionen auswirkten. Er musste nur denken, sprechen und hin und wieder schreiben. Schon setzte sich das Lebewesen in Bewegung und zeichnete wunderschöne Muster auf seinem Weg in Reiche zunehmender Abstraktion, wobei es manchmal eigenen Gelüsten folgte, die Benjamin niemals auch nur hätte erahnen können — und gerade das bereitete ihm besondere Freude, wie das Wesen suchte, seinen freien Willen auszuüben. Er bewunderte es und verstand es, selbst wenn es ihn einmal enttäuschte.
Benjamin kannte Downtown Manhattan kaum — gerade genug, um seine Canyons aus Bürogebäuden zu verachten, seine schmutzigen, schmalen Straßen voller stolzierender Geschäftsmänner, die stets damit beschäftigt waren, ihre Geschäftigkeit zur Schau zu stellen. Doch er erkannte, wie praktisch es war, sich im Financial District niederzulassen, also verlegte er sein Büro in die Broad Street. Während sich seine Interessen ausweiteten, erhielt er kurz darauf einen Sitz am New York Stock Exchange. Seine Angestellten merkten schnell, dass er jeglichem Drama ebenso abgeneigt war wie Freudenausbrüchen. Die aufs Essentielle heruntergebrochenen Gespräche wurden flüsternd geführt. Verstummten einmal die Schreibmaschinen, konnte man vom anderen Ende des Raumes einen Ledersessel knarzen oder einen Seidenärmel übers Papier streichen hören. Und dennoch störten jederzeit geräuschlose Wellen die ruhige Luft. Allen war bewusst, dass sie die Ausläufer von Rasks Willen waren und dass ihre Pflicht darin bestand, seine Bedürfnisse zu befriedigen und sogar vorwegzunehmen, ihn aber niemals mit den ihren zu behelligen. Hatten sie keine entscheidenden Neuigkeiten für ihn, warteten sie, bis er sie ansprach. Für Rask zu arbeiten wurde zum Ziel vieler junger Händler, doch wenn sie erst wieder ihrer eigenen Wege gingen, im Glauben, alles aufgesogen zu haben, was es zu lernen gab, konnte keiner von ihnen so recht an den Erfolg des ehemaligen Arbeitgebers anknüpfen.
Es war ihm eher unangenehm, als man seinen Namen in Finanzkreisen bald mit ehrfürchtigem Staunen sprach. Einige alte Freunde seines Vaters unterbreiteten ihm Geschäftsangebote, die er manchmal annahm, oder aber Tipps und Vorschläge, die er stets ignorierte. Er handelte mit Gold und Guano, mit Devisen und Dollar, mit Anleihen und Ananas. Seine Interessen beschränkten sich schon bald nicht mehr auf die Vereinigten Staaten. England, Europa, Südamerika und Asien verschmolzen vor seinen Augen zu einem großen Ganzen. Er überschaute die Welt von seinem Büro aus, auf der Suche nach wagemutigen, hochverzinslichen Darlehen und Staatspapieren zahlreicher Länder, deren Schicksale sich infolge seiner Geschäfte unentwirrbar miteinander verflochten. Manchmal gelang es ihm, ganze Anleiheemissionen für sich allein zu zeichnen. Auf seine wenigen Niederlagen folgten große Triumphe. Wer auf seiner Seite der Geschäfte stand, der wurde reich.
In dieser Welt, die gegen seinen Willen immer mehr die seine wurde, gab es nichts Auffälligeres als Anonymität. Auch wenn ihn das Geschwätz nie selbst erreichte, wusste Rask — mit seinem penibel diskreten Äußeren, seinen asketischen Gewohnheiten und seinem mönchischen Leben im Hotel —, dass man ihn wahrscheinlich als etwas »eigentümlich« betrachtete. Da ihn allein der Gedanke, jemand könnte ihn als Exzentriker sehen, vor Scham beinahe im Boden versinken ließ, beschloss er, sich den an einen Mann in seiner Lage gestellten Erwartungen anzupassen.
Er baute sich eine Beaux-Arts-Villa aus Kalkstein an der Fifth Avenue, Ecke 62nd Street, und ließ sie von Ogden Codman einrichten, dessen dekorative Leistungen gewiss auf allen Gesellschaftsseiten hoch gelobt werden würden. Als das Haus vollendet war, wollte er einen Ball ausrichten, konnte es schlussendlich aber nicht — er gab auf, als er bei der Arbeit an der Gästeliste mit einer Sekretärin erkannte, dass sich gesellschaftliche Verpflichtungen exponentiell multiplizieren. Er trat mehreren Clubs, Ausschüssen, Stiftungen und Vereinen bei, in denen man ihn jedoch nur selten sah. All dies tat er zwar mit einigem Widerwillen. Aber noch schlimmer wäre es gewesen, hätte man ihn als »Original« betrachtet. Schließlich wurde er ein reicher Mann, der die Rolle eines reichen Mannes spielte. Dass seine Umstände mit dem Kostüm übereinstimmten, war ihm nur ein schwacher Trost.
*
NEW YORK schwoll an vor dem lautstarken Optimismus derer, die glaubten, sie hätten die Zukunft überholt. Natürlich profitierte Rask von diesem halsbrecherischen Wachstum, doch für ihn war es ein rein numerisches Ereignis. Er verspürte keinen Drang, mit den jüngst eingeweihten U-Bahn-Linien zu fahren. Er hatte einige der vielen Wolkenkratzer besucht, die man überall in der Stadt baute, aber er wäre nicht auf die Idee gekommen, sein Büro in einen solchen zu verlegen. Automobile waren ihm ein Ärgernis, auf der Straße wie im Gespräch (sie waren unter seinen Angestellten und Bekannten zum allgegenwärtigen und für ihn furchtbar ermüdenden Gesprächsthema geworden). Wenn irgend möglich vermied er die neuen Brücken, die die Stadtteile miteinander verbanden, und er hatte nichts mit den Scharen von Einwanderern zu tun, die jeden Tag auf Ellis Island ankamen. Was in New York geschah, erfuhr er größtenteils aus der Zeitung — und vor allem von den Zahlen aus dem Börsenticker. Und trotz dieses recht speziellen (manche würden sagen, eingeschränkten) Blickes auf die Stadt erkannte selbst er, dass Fusionen und Konsolidierungen zwar zu einer Konzentration des Vermögens auf eine Handvoll Konzerne von unerhörter Größe geführt hatten, ironischerweise aber eine kollektive Erfolgsstimmung herrschte. Die Ausmaße dieser neuen Monopolisten, von denen manche mehr wert waren als das gesamte Staatsbudget, bewiesen, wie ungleich die Gewinne verteilt waren. Doch ungeachtet ihrer Umstände glaubten die meisten Menschen, Teil eines wirtschaftlichen Höhenfluges zu sein — oder rechneten zumindest damit, es in Bälde zu werden.
Doch dann verschwor sich 1907 Charles Barney, der Präsident der Knickerbocker Trust Co., mit anderen dazu, den Kupfermarkt aufzukaufen. Der Versuch scheiterte und ruinierte eine Mine, zwei Maklergesellschaften sowie eine Bank. Bald darauf gab man bekannt, dass Wechsel von der Knickerbocker Co. nicht mehr angenommen wurden. Die nächsten Tage honorierte die National Bank of Commerce noch die Anfragen der Kontoinhaber, bis Barney keinen Ausweg mehr sah, als die Türen zu schließen und sich etwa einen Monat später in die Brust zu schießen. Der Konkurs der Knickerbocker Co. ließ Wellen der Panik durch die Märkte branden. Ein Bankensturm löste allgemeine Zahlungsunfähigkeit aus, die Börsenkurse stürzten ab, Darlehen wurden zurückgefordert, Maklergesellschaften meldeten Bankrott an, Trust Companys konnten Schulden nicht mehr begleichen, Handelsbanken gingen in Konkurs. Sämtliche Verkäufe wurden eingestellt. Die Leute strömten zur Wall Street und verlangten ihre Einlagen zurück. Schwadronen berittener Polizisten sicherten die öffentliche Ordnung. Da es an Bargeld fehlte, schoss der Tagesgeldsatz innerhalb weniger Tage auf über 150 Prozent. Gewaltige Mengen an Goldbarren wurden aus Europa angefordert, doch selbst die Millionen, die über den Atlantik flossen, konnten die Krise nicht beruhigen. Während der Kredit in seinen Grundfesten erschüttert wurde, machte sich Rask mit seinen soliden Geldreserven die Liquiditätskrise zunutze. Er wusste, welche von der Panik gebeutelten Unternehmen robust genug waren, diese zu überstehen, und kaufte absurd unterbewertete Posten auf. Mit seinen Einschätzungen war er den Männern von J. P. Morgan oftmals einen Schritt voraus, die gern direkt nach Rask zuschlugen und die jeweilige Aktie wieder nach oben trieben. Inmitten des Sturmes erhielt er gar eine Mitteilung von Morgan selbst, der seinen Vater erwähnte (»Solomons Maduros waren die besten, die ich jemals habe genießen dürfen«) und ihn in seine Bibliothek einlud, um dort mit einigen seiner engsten Vertrauten zu konferieren, »um einen Beitrag zum Schutze der Interessen unseres Landes zu leisten«. Rask lehnte ohne Angabe von Gründen ab.
Rask brauchte eine Weile, um sich auf den neuen Höhen zurechtzufinden, die er infolge der Krise erklommen hatte. Eine knisternde Aura umfing ihn, wohin er auch ging. Er konnte sie jederzeit zwischen sich und der Welt spüren. Und er merkte, dass auch andere sie wahrnahmen. Äußerlich war sein Alltag derselbe — die meiste Zeit verbrachte er in seinem einsamen Zuhause an der Fifth Avenue, von wo aus er die Illusion eines regen Gesellschaftslebens pflegte, das sich in Wahrheit auf einige wenige Anlässe beschränkte, bei denen er sich von seinem geisterhaften Erscheinen die größte Wirkung ausrechnete. Aber sein Coup während der Panik hatte einen anderen Menschen aus ihm gemacht. Es überraschte ihn selbst außerordentlich, dass er nun bei jeder Begegnung mit anderen nach Zeichen der Anerkennung suchte. Er gierte danach, bestätigt zu wissen, dass den Leuten das Knistern um ihn auffiel, das Beben, eben jene Sache, die ihn von ihnen trennte. Doch so paradox es auch scheinen mochte, war dieser Wunsch, sich der Distanz zwischen ihm und anderen zu versichern, gleichsam eine Form der Zusammenkunft mit ihnen. Und dieses Gefühl war ihm neu.
Da es ihm mittlerweile unmöglich war, jede Geschäftsentscheidung selbst zu treffen, sah Rask sich gezwungen, eine engere Beziehung zu einem der jungen Männer in seinem Büro aufzubauen. Sheldon Lloyd, der rasch zu seinem vertrautesten Assistenten aufgestiegen war, ging täglich die Angelegenheiten durch, die Rasks Aufmerksamkeit bedurften, und ließ nur die allerwichtigsten davon bis zum Schreibtisch seines Chefs durch. Außerdem übernahm Lloyd mehrere der täglichen Konferenzen — sein Arbeitgeber kam nur noch dazu, wenn eine Machtdemonstration vonnöten war. In mehr als einer Hinsicht verkörperte Sheldon Lloyd jene Aspekte der Finanzwelt, die Benjamin ein Gräuel waren. Für Sheldon wie für die meisten Menschen war Geld ein Mittel zum Zweck. Er gab es aus. Kaufte Sachen. Häuser, Fahrzeuge, Tiere, Gemälde. Sprach laut darüber. Reiste und gab Partys. Trug seinen Reichtum am Körper — seine Haut roch jeden Tag anders; seine Hemden waren nicht gebügelt, sondern neu; seine Mäntel schimmerten fast so sehr wie seine Haare. Er schäumte über von jener konventionellsten und peinlichsten aller Tugenden — dem »Geschmack«. Wenn Rask ihn ansah, kam ihm oft der Gedanke, dass nur ein Angestellter das Geld, das jemand anders ihm gegeben hatte, auf diese Art und Weise verprassen würde: im Streben nach Erquickung und Freiheit.
Doch gerade wegen Sheldon Lloyds Frivolität fand Benjamin ihn nützlich. Sein Assistent war ein gerissener Händler, auch das, aber Rask erkannte vor allem, dass er das Cliché dessen verkörperte, was viele seiner Kunden und flüchtigen Bekanntschaften für »Erfolg« hielten. Sheldon Lloyd war das perfekte Sprachrohr für sein Unternehmen — in vielen Situationen eine weitaus wirkungsvollere Gegenwart als sein Arbeitgeber. Da Sheldon alle Erwartungen an den Auftritt eines Financiers so getreu erfüllte, verließ sich Benjamin bald auch in Dingen auf ihn, die über seine offiziellen Pflichten hinausgingen. Er bat ihn, Dinners und Partys zu organisieren, und Sheldon kam der Bitte gerne nach; er füllte Rasks Zuhause mit Freunden und sorgte für die zuvorkommende Bewirtung von Vorstandsmitgliedern und Investoren. Der eigentliche Gastgeber zog sich stets zu früher Stunde zurück, aber die Fiktion, er führe ein reges Gesellschaftsleben, war damit etabliert.
1914 musste Sheldon Lloyd nach Europa reisen, um ein Geschäft mit der Deutschen Bank und einem pharmazeutischen Unternehmen aus Berlin abzuschließen sowie um in weiteren Angelegenheiten in der Schweiz als Vertreter seines Arbeitgebers zu fungieren. Der Große Krieg überrumpelte Sheldon in Zürich, wohin Rask ihn geschickt hatte, um in einige der höchst erfolgreichen jungen Banken vor Ort zu investieren.
Diesseits des Atlantiks widmete Benjamin seine Aufmerksamkeit den greifbaren Grundlagen seines Reichtums — Dingen und Menschen, die der Konflikt zu einer einzigen Maschinerie verschmolzen hatte. Er investierte in kriegsrelevante Sektoren vom Bergbau und der Stahlerzeugung bis hin zu Munitionsherstellung und Schiffsbau. Er entwickelte ein Interesse an der Luftfahrt und erkannte das kommerzielle Potential der Flugzeuge selbst in Friedenszeiten. Fasziniert von den technologischen Fortschritten, die jene Jahre definierten, finanzierte er Chemiefirmen und Konstruktionsprojekte und patentierte somit viele der unsichtbaren Bauteile und Flüssigkeiten der neuartigen Motoren, welche die Weltwirtschaft antrieben. Durch seine Mittelsmänner in Europa handelte er Anleihen aus, die von jeder am Krieg teilnehmenden Nation ausgegeben wurden. Doch so eindrucksvoll sein Reichtum auch geworden war, er befand sich erst am Fuße seines wahren Aufstieges.
Mit seiner Reichweite wuchs seine Verschlossenheit. Je weiter und tiefer sich seine Investitionen in die Gesellschaft erstreckten, desto mehr zog er sich aus ihr zurück. Wie es schien, hatten die quasi endlosen Vermittlungen, die ein Vermögen ausmachen — Aktien und Anleihen, die von Unternehmen abhängen, die von Land, Ausrüstung und arbeitenden Massen abhängen, die wiederum von der Arbeit anderer Massen behaust, ernährt und bekleidet werden, die man in Währungen bezahlt, deren Wert selbst Handels- und Spekulationsobjekt ist und vom Schicksal wieder anderer Volkswirtschaften abhängt, das schlussendlich von Unternehmen abhängt, die von Aktien und Anleihen abhängen —, unmittelbare Beziehungen für ihn irrelevant werden lassen. Als er jedoch die mutmaßliche Mitte seines Lebens erreichte und überschritt, ließen ihn ein trübes Gefühl genealogischer Verantwortung sowie eine noch vagere Anstandsvorstellung eine Ehe in Betracht ziehen.
ZWEI
Die Brevoorts waren eine alte Familie aus Albany, deren Vermögen nicht mit ihrem Namen Schritt gehalten hatte. Nach drei Generationen gescheiterter Politiker und Romanciers hatten sie einen Zustand würdevoller Prekarität erreicht. Ihr Haus an der Pearl Street, eines der ersten der Stadt überhaupt, verkörperte diese Würde vorzüglich, und Leopold und Catherine Brevoorts Existenz drehte sich zum Großteil um dessen Instandhaltung. Als Helen zur Welt kam, hatten sie die oberen Stockwerke bereits abgesperrt, damit sie den unteren, in denen sie Gäste empfingen, ihre volle Aufmerksamkeit widmen konnten. Ihr Salon war einer der Mittelpunkte des Gesellschaftslebens von Albany, und die schwindenden Mittel der Brevoorts hinderten sie nicht daran, Schermerhorns, Livingstons und Van Rensselaers bei sich zu empfangen. Der große Erfolg ihrer Soireen lag gewiss daran, dass sie ein selten gesehenes Gleichgewicht fanden zwischen Leichtigkeit (Catherine hatte die Gabe, anderen das Gefühl zu geben, sie seien überaus geistreiche Gesprächspartner) und Gravitas (Leopold war gemeinhin als eine der örtlichen intellektuellen wie moralischen Autoritäten anerkannt).
In ihrem Kreise sah man jegliche politische Betätigung als eher unrühmlich an, und der Literatur maß man einen Beigeschmack von Bohème bei. Mr Brevoort aber verband die unfeine Neigung seiner Ahnen zum Dienst an der Öffentlichkeit und zum geschriebenen Wort, als er zwei Bände über Staatsphilosophie verfasste. Verbittert von der vollkommenen Stille, die seinem Werk entgegenschlug, wandte er sich seiner jungen Tochter zu und nahm ihre Bildung selbst in die Hand. Seit Helens Geburt war Mr Brevoort stets zu beschäftigt mit seinen scheiternden Vorhaben gewesen, um ihr echte Aufmerksamkeit zu schenken, aber nun, da er sich ihrer Erziehung angenommen hatte, zeigte er sich entzückt von jeder Facette ihrer Persönlichkeit. Mit fünf Jahren war sie bereits eine eifrige Leserin und zur Überraschung ihres Vaters auch eine frühreife Gesprächspartnerin. Sie machten lange Spaziergänge am Hudson River, manchmal bis in den Abend hinein, und unterhielten sich über die Naturphänomene um sie herum — über Kaulquappen und Konstellationen, über fallende Blätter und die Winde, die sie trugen, über den Hof des Mondes und das Geweih des Hirsches. Nie zuvor hatte Leopold eine solche Freude empfunden.
Die verfügbaren Schulbücher erschienen ihm allesamt unzureichend; er stellte ihren Inhalt ebenso infrage wie ihren pädagogischen Ansatz. Deshalb schrieb Mr Brevoort nun selbst Lehrbücher und entwarf Übungshefte für seine Tochter, wann immer er nicht lehrte oder den gesellschaftlichen Verpflichtungen nachkam, die seine Gattin unaufhörlich schuf. Diese Hefte enthielten lehrreiche Spiele, Rätsel und Denkaufgaben, die Helen genoss und beinahe immer löste. Neben der Naturwissenschaft wurde auch die Literatur ausgiebig behandelt. Sie lasen amerikanische Transzendentalisten, französische Moralisten, irische Satiriker und deutsche Aphoristen. Mithilfe veralteter Wörterbücher versuchten sie sich an der Übersetzung von Geschichten und Fabeln aus Skandinavien sowie dem alten Rom und Griechenland. Von den völlig absurden Ergebnissen ihrer Bemühungen ermutigt (hatte Mrs Brevoort Gäste, musste sie oft in die kleine Bibliothek stürzen und die beiden ermahnen, nicht so laut zu »wiehern«), begannen sie eine Sammlung haarsträubender ausgedachter Mythen. Die ersten zwei, drei Jahre von Helens Unterweisung bei ihrem Vater sollten die glücklichsten ihres Lebens sein, und selbst wenn die Details und Konturen dieser Erinnerungen mit der Zeit schwanden, blieb ihr dieses grundsätzliche Gefühl begeisterter Erfüllung so klar und lebhaft in Erinnerung wie eh und je.
In seinen Bemühungen, den Lehrplan zu erweitern, führten Mr Brevoorts eigenwillige Recherchemethoden ihn zu überholten naturwissenschaftlichen Theorien, verfallenen Gedankengebäuden, wirren psychologischen Doktrinen und unfrommen theologischen Dogmen. Beim Versuch, Religion und Wissenschaft zu vermählen, verlor er sich in den Lehren Emanuel Swedenborgs. Dies war ein Wendepunkt in seinem Leben — und in seiner Beziehung zu seiner Tochter. Er ließ sich von Swedenborgs Anschauung überzeugen, nicht etwa Buße und Ehrfurcht, sondern die Vernunft sei der Weg zu Tugend und möglicherweise zum Göttlichen selbst. Nur noch die Heilige Schrift hatte Vorrang vor mathematischen Abhandlungen, und Mr Brevoort erfreute sich an der eleganten Leichtigkeit, mit der die sieben- oder achtjährige Helen kryptische Algebra-Aufgaben löste und detaillierte Exegesen verschiedener Bibelpassagen vorlegte. Er bat sie außerdem, ausführliche Traumtagebücher zu führen, die sie beide mit numerologischem Eifer nach verschlüsselten Botschaften der Engel durchforsteten.
Im Schatten seiner neu gefundenen Leidenschaft für die Theologie war ein Teil seiner vormaligen Freude verwelkt. Doch so lange sie konnte, versuchte Helen, den gutgelaunten Geist der vergangenen gemeinsamen Jahre aufrechtzuerhalten. Um die zunehmend zähere Langeweile beim täglichen Unterricht leichter zu ertragen, begann Helen, ihrem immer distanzierteren Vater Streiche zu spielen. Zwar gefielen ihr viele Teile des weitgehend improvisierten Curriculums, und diesen widmete sie sich fleißig — Arithmetik, Optik, Trigonometrie, Chemie, Astronomie —, doch die mystischeren Seiten von Mr Brevoorts Lehrplan schläferten sie ein, bis sie herausfand, wie sie diese zu ihrem eigenen Vergnügen verdrehen und zurechtbiegen konnte. Sie dachte sich Anagramme mit biblischen Prophezeiungen aus, welche die Zukunft ihrer Familie vorhersagen sollten; sie entwarf ihre eigenen kabbalistischen Interpretationen von Passagen des Alten Testaments, unterfüttert von esoterischen mathematischen Argumenten, die ihren Vater stets beeindruckten, ob er sie nun verstand oder nicht; die Seiten ihres Traumtagebuches füllte sie mit schockierenden Einträgen, die häufig ans Unsittliche grenzten. Leopold hatte von ihr kompromisslos ehrliche Traumschilderungen gefordert, und Helen hatte ihren Spaß daran, wenn sie sein Kinn mit schlecht verhohlenem Schrecken beben sah, während er ihre schlüpfrig angehauchten Lügenmärchen las.
Hatten ihre ersponnenen Träume noch als Schabernack angefangen, wurden sie bald zur Notwendigkeit. Um ihren neunten Geburtstag dehnte die Schlaflosigkeit ihre Nächte aus und beraubte sie nicht nur ihrer Träume, sondern auch ihres Friedens. Eisige Sporen der Sorge siedelten sich in ihrem Bewusstsein an und verwandelten es in eine Brache der Angst. Ihr Blut schien ihr zu dünn und zu schnell durch die Adern zu rauschen. Manchmal glaubte sie, ihr Herz keuchen zu hören. Solche von Grauen erfüllten Nachtwachen wurden immer häufiger, und die Tage danach lagen im Nebel. Es wurde ihr beinahe unmöglich, ihren Teil zur Erhaltung der Wirklichkeit beizutragen. Und doch bevorzugten ihre Eltern diese gedämpfte Version ihrer selbst — ihr Vater verfolgte ihre uninspirierte Arbeit mit großer Faszination; ihre Mutter fand sie nahbarer.
Bald verstand Helen, dass sie nicht nur die Schülerin ihres Vaters, sondern auch sein Forschungsgegenstand geworden war. Ihn interessierten offenbar die konkreten Folgen seiner Lehre, und er versuchte zu ermessen, wie diese den Verstand und die Moralvorstellungen seiner Tochter formte. Wenn er sie begutachtete, war es Helen oft, als blickte jemand anders hinter seinen Augen hervor. Erst im Nachhinein verstand sie, dass die andauernde Prüfung ihr notwendigerweise einen bescheidenen, leisen Charakter beschert hatte, eine Rolle, die sie vor ihren Eltern und deren Freunden mit perfekter Konsequenz spielte — unauffällig höflich, ohne je zu sprechen, wenn nicht dazu gezwungen, wenn möglich reagierte sie einsilbig oder mit einem Nicken, wich den Blicken der anderen aus und vermied um jeden Preis die Gesellschaft Erwachsener. Da sie diese Maske nie ablegte, fragte sie sich später im Leben, ob sie in Wahrheit immer schon so gewesen sei, oder ob sich ihr Geist nicht vielmehr mit den Jahren der Maske angepasst hatte.
Dass die Zusammenkünfte an der Pearl Street den schwindenden Mitteln der Familie zum Trotze gut besucht blieben, lag an Mrs Brevoorts Charme und Geschick. Weder die sinkende Qualität des Tees noch mehrere fahnenflüchtige Hausangestellte vermochten ihre Besucher fernzuhalten. Nicht einmal ihr Gatte, dessen Verhalten so unberechenbar geworden war, wie seine Worte kryptisch, hatte die Gäste vergraulen können. Mit der puren Macht ihres Charmes — und einigen geschickten politischen Kniffen — sorgte sie dafür, dass ihr Salon das Herz des gesellschaftlichen wie auch intellektuellen Lebens von Albany blieb. Doch irgendwann war es so weit, dass sie die oberen Geschosse wieder öffnen und so gut wie möglich möblieren mussten, um Mieter aufzunehmen. Selbst die Schande, Regierungsmitarbeiter ihr Treppenhaus rauf- und runterpoltern zu lassen, hätte Mrs Brevoort überspielen können, doch ihre Stammgäste hielten es für taktvoller, um ihretwillen die Zusammenkünfte an einen anderen Ort zu verlegen. Etwa zu dieser Zeit beschlossen die Brevoorts, Albany sei ihnen zu provinziell geworden.
Bevor sie sich nach Europa einschifften, verbrachten sie einen Monat in New York City bei einer Freundin Mrs Brevoorts an der East 84th Street, Ecke Madison Avenue, nur wenige Blocks von der Villa entfernt, von der niemand ahnte, dass sie einmal Helens Zuhause werden sollte. Jahre später erinnerte sie sich oft an jenen Aufenthalt in New York und fragte sich, ob sie damals mit elf Jahren womöglich bei einem der Spaziergänge mit ihrer Mutter nicht vielleicht den bereits erfolgreichen Geschäftsmann erblickt hatte, der später ihr Ehemann werden sollte. Hatten das Mädchen und der Mann einander je gesehen? Gewiss verbrachte sie als Kind zahlreiche langweilige Stunden in der Gesellschaft vieler der Leute, die später, als sie verheiratet war, um ihre Aufmerksamkeit und Freundschaft buhlten. Tagsüber nahm ihre Mutter sie zu jeder Veranstaltung mit, die sie innerhalb jenes Monats besuchen konnte — zu Mittagessen, Lesungen, Tees und Konzerten. Was sie dort lerne, sei für ihre Bildung wichtiger, sagte Mrs Brevoort häufig, als jede Botanik- oder Griechischlektion, die sie von ihrem Vater erhalte. Wie gewohnt blieb Helen bei diesen Anlässen stets stumm — sie beobachtete und hörte zu, ohne eine Ahnung, dass sie etwa ein Jahrzehnt später viele der Gesichter wiedererkennen würde, und ohne eine Vorstellung davon, wie nützlich ihr als Erwachsener das Wissen darüber sein würde, wer vorgab, sich an sie zu erinnern oder sie vergessen zu haben.
*
OHNE MRS BREVOORT wäre ihr Leben in Europa unmöglich gewesen. Als sie nach Frankreich kamen, nahmen sie sich bescheidene Zimmer in Saint-Cloud, aber Catherine merkte schnell, dass sie zu weit von der Pariser Innenstadt entfernt waren. Da sie viel zu erledigen hatte, besuchte sie zunächst allein einige Tage die Lowells auf der Île Saint-Louis. Von dort aus reiste sie bequem zu ihren Bekanntschaften oder zu anderen Amerikanern, die man sie zu besuchen gebeten hatte, und überbrachte Neuigkeiten, Briefe und vertrauliche Nachrichten aus New York. Noch vor Ablauf der ersten Woche hatte man sie und ihre Familie eingeladen, doch bei Margaret Pullman an der Place des Vosges zu logieren. Dieses Szenario wiederholte sich fast überall: Die Brevoorts kamen in Biarritz an, in Montreux, in Rom und bezogen schlichte Räume in einer Pension oder einem albergo in einem zwar nicht erstklassigen, aber durchaus respektablen Stadtteil. Dann besuchte Mrs Brevoort etwa eine Woche lang Freundinnen, überbrachte Nachrichten und lernte andere Auslandsamerikaner kennen, woraufhin einer von diesen sie und ihre Familie als Hausgäste zu sich einlud. Mit der Zeit jedoch kehrten sich die Rollen um: Hatte sich Mrs Brevoort zunächst auf die Liebenswürdigkeit ihrer wohlhabenderen Landsleute verlassen müssen, war die Nachfrage nach ihrer Gesellschaft ein Jahr später so gestiegen, dass sie Einladungen ausschlagen musste, wodurch sie nur noch begehrter wurde. Wohin es ihre Familie auch zog, sie wurde dort zum Dreh- und Angelpunkt für alle nomadischen Amerikaner, die es sich zu kennen lohnte.
Dabei war es eigentlich nicht unüblich, dass Amerikaner ihresgleichen im Ausland mieden. Und zwar nicht nur, weil es der unausgesprochenen Etikette entsprach, sondern auch, weil niemand den Eindruck erwecken wollte, er habe in Europa keine Freunde und sei auf Bekanntschaften von zu Hause angewiesen. Mrs Brevoort war sich dieses Kodex natürlich bewusst und machte ihn sich zunutze, indem sie sich diesen eremitenhaften Ausländern als Botin andiente, was jene bereitwillig annahmen, da sie so ihren Schein unnahbarer Selbstgenügsamkeit aufrechterhalten konnten. An Mrs Brevoort wandte man sich, wenn man darauf brannte, jemandem vorgestellt zu werden, was in anderen Händen eine allzu peinliche Angelegenheit geworden wäre; sie flickte gerissene Bande und wob neue; sie konnte Menschen in ausgewählte Kreise einführen und dabei, dies ist ausschlaggebend, den Eindruck wahren, der Kreis bliebe geschlossen; sie war eine Meisterin der Anekdote und eine begnadete Kupplerin, darüber waren sich alle einig.
Die Brevoorts reisten (je nach Jahreszeit) entlang der Berge, des Meeres oder durch die Städte, rasteten, verweilten oder eilten (je nach Behagen) und zeichneten so die Karte ihrer eigentümlichen Grand Tour. Mr Brevoort widmete den Großteil seiner Zeit der Unterweisung seiner Tochter sowie dem Aufsuchen verschiedener mystischer Zirkel — Spiritismus, Alchemie, Mesmerismus, Nekromantie und andere Formen des Okkultismus hatten alle anderen Interessen verdrängt. Helen war das Herz bereits schwer, da sie an ihrem Vater einen Freund und ihren einzigen Gefährten in Europa verloren hatte, doch etwa zu dieser Zeit sank ihr das Gemüt in neue Tiefen: Sie war nun alt, belesen und gebildet genug, um zu verstehen, dass Leopold immer mehr Humbug hortete. Dogmen und Glaubenssätze liefen ihr den Rang ab, über die sie sich wenige Jahre zuvor noch gemeinsam lustig gemacht hätten, um sie dann als Inspiration für ihre absurden Geschichten zu verwenden. Es war traurig genug, mitanzusehen, wie ihr Vater von ihr forttrieb, doch die Erkenntnis, dass mit ihm auch ihr Respekt vor seinem Intellekt dahinschwand, war niederschmetternd.
Die Talente seiner Tochter nahm Mr Brevoort derweil durchaus noch wahr. Einige Jahre nach Beginn ihrer gemeinsamen Reisen musste er sich eingestehen, dass Helens Begabung für Sprachen, Zahlen, Bibelhermeneutik und ihre mystische Intuition, wie er es nannte, seinen Fähigkeiten entwachsen waren, und so plante er von nun an einen Teil der Reiseroute entlang der Aufenthaltsorte verschiedener Gelehrter, die Helens Bildung fortsetzen konnten. Dies führte sie in bescheidene Herbergen in kleinen Bauerndörfern oder in Pensionen in den Vororten von Universitätssitzen, wo Mutter, Vater und Tochter nur einander als Gesellschaft hatten. Isoliert und fehl am Platze wurden Mr und Mrs Brevoort streitsüchtig und gemein. Helen zog sich noch weiter zurück, und ihre Stille bot einen neuen Schauplatz für die immer schärferen Auseinandersetzungen der Eltern. Doch war es endlich Zeit für das Gespräch mit dem illustren Professor oder der Autorität in okkulten Dingen, vollzog sich in Helen stets eine Wandlung. In ihr kristallisierte sich das Selbstvertrauen — etwas erhärtete, schärfte sich und strahlte.
Ob mitten in Jena, an den Rändern von Toulouse oder in den Vororten Bolognas, die Routine blieb größtenteils dieselbe. Sie mieteten Räume in einer Herberge, wo Mrs Brevoort eine Unpässlichkeit vorschützte, die Bettruhe erfordere, während Mr Brevoort seine Tochter zu dem großen Mann brachte, der sie hergeführt hatte. Leopold Brevoorts langwierige und größtenteils unverständliche Einführung löste bei ihren Gastgebern jedes Mal einen enttäuschten, ja, bedauernden Blick auf ihn und seine Tochter aus. Zum einen waren Leopolds Glaubenslehren nämlich mittlerweile recht obskur geworden, und zum anderen trug er sie in einem wirren Mischmasch aus hauptsächlich fiktionalem Französisch, Deutsch und Italienisch vor. Manche dieser Akademiker und Mystiker waren beeindruckt von Helens detaillierten Kenntnissen der Heiligen Schrift, von ihren intellektuellen Leistungen und ihrer Vertrautheit mit verschiedenen esoterischen Dogmen. Sobald er ihr Interesse bemerkte, versuchte Mr Brevoort meist etwas zu sagen, aber eine erhobene Hand ließ ihn verstummen, bevor man ihn den Rest des Gespräches über ignorierte. Einige dieser Lehrer baten ihn, den Raum zu verlassen. Und manche legten Helen dann mit pädagogischer Wärme eine Hand auf das Knie, zogen sie aber verängstigt von ihrer tödlichen Ungerührtheit und der Härte ihres Blickes bald wieder zurück.
*
HELEN HATTE ihre Kindheit in Albany zurückgelassen. Da sie immer wieder weiterzog, lernte sie kaum Mädchen in ihrem Alter kennen, und diese flüchtigen Bekanntschaften hatten nie genügend Zeit, zu wahren Freundschaften zu erblühen. Um sich die Zeit zu vertreiben, brachte sie sich mithilfe von Büchern, die sie zwischen verschiedenen Häusern und Hotels wandern ließ, Sprachen bei — aus einem Regal in Nizza nahm sie sich eine Ausgabe von La Princesse de Clèves mit und sortierte sie in eine Bibliothek in Siena ein, nachdem sie I viaggi di Gulliver entnommen hatte, mit denen sie wiederum in München die Lücke des entliehenen Rot und Schwarz füllte. Noch immer raffte die Schlaflosigkeit ihre Nächte dahin, und sie nutzte die Bücher als Schilde gegen den Ansturm ihrer abstrakten Schrecken. Reichten die Bücher nicht mehr aus, widmete sie sich ihrem Tagebuch. Die Traumjournale, die sie unter der Anleitung ihres Vaters einige Jahre lang geführt hatte, hatten es ihr zur Gewohnheit gemacht, täglich ihre Gedanken niederzuschreiben. Als er ihre Einträge irgendwann nicht mehr las, ließ sie von ihren Träumen ab und wandte sich ihren Überlegungen zu gelesenen Büchern zu, ihren Eindrücken der besuchten Städte und, während ihrer durchwachten Nächte, ihren tiefsten Ängsten und Sehnsüchten.
In ihrer frühen Jugend fand ein leises, aber entscheidendes Ereignis statt. Sie und ihre Eltern logierten in Mrs Osgoods Villa in Lucca. Helen war auf dem Anwesen spazieren gegangen, und dann, benommen von der Hitze, im leeren Haus. Sie waren die einzigen Gäste. Die Bediensteten entschwanden hastig, wenn sie ihre Schritte hörten. Ein auf dem kühlen Terrakottaboden ausgestreckter Hund hatte die halboffenen Augen in den Schädel hinaufgedreht und träumte zuckend. Helen warf einen Blick in den Salon: Ihr Vater und Mr Osgood waren auf ihren Sesseln eingeschlafen. Helen wurde von sanfter Grausamkeit ergriffen, besessen von der vagen Begierde, Schaden anzurichten. Sie wurde sich bewusst, dass sie auf den Grund der Langeweile gesunken war. Darunter lag Gewalt. Sie machte auf dem Absatz kehrt und ging zurück in den Garten. Als sie an dem schattigen Plätzchen ankam, an dem ihre Mutter und ihre Gastgeberin Limonade tranken, verkündete sie einfach, sie werde nun eine Promenade in die Stadt unternehmen. Vielleicht weil ihr Ton so entschlossen war, vielleicht weil ihre Mutter sich gerade mitten in einem voller Nachdruck geflüsterten Gespräch mit Mrs Osgood befand oder vielleicht weil das haselnuss- und kupferfarbene Lucca an diesem Nachmittag so wohlwollend schimmerte, gab es keinen Widerspruch — nur einen kurzen seitlichen Blick von Mrs Brevoort, die ihrer Tochter viel Freude bei ihrer passeggiata wünschte und sie ermahnte, nicht zu weit fortzugehen. Und so begann unbemerkt von allen anderen ein neues Kapitel für Helen. Zum ersten Mal in ihrem Leben war sie allein unterwegs.
Verloren in ihrem wahr gewordenen Unabhängigkeitstraum beachtete sie weder die Landstraße noch ihre Umgebung, doch sobald sie die Stadt betrat, weckte deren stuckierte Stille sie mit einem Mal auf. In den leeren Straßen hörte sie nichts als das trockene Echo ihrer Schuhe auf dem Pflaster. Alle paar Schritte ließ sie einen Fuß etwas schleifen, nur weil das Flüstern des Leders auf Stein ein herrliches Kribbeln in ihrem Nacken auslöste. Mit jedem Häuserblock wurde die kleine Stadt lebendiger. Um die Euphorie zu verlängern, die sie in der anfänglichen Stille gefunden hatte, ging sie mit beschwingter Sicherheit weiter, fort von den Stimmen, die an fernen Kreuzungen ineinanderkrachten, fort von dem kaufmännischen Geschepper, das vom Platz herüberschallte, fort von dem Hufgeklapper, das um die Ecke floss, fort von den Frauen, die einander beim Abhängen der Wäsche von Fenster zu Fenster zuschrien, und hinein in Gassen mit vor der Hitze geschlossenen Fensterläden, wo sie wieder ihre einsamen Schritte hören konnte. Da wusste sie, dass diese erhabene Freude, so rein, weil sie keinen Gegenstand hatte, so zuverlässig, weil sie niemand anderen brauchte, der Zustand war, nach dem sie fortan streben würde.
Abseits vom Trubel der Piazza, auf dem irgendein Gedenktag oder eine religiöse festa stattfand, kam Helen auf eine Straße mit einigen Läden. Einer davon stellte einen doppelten Anachronismus dar. Ein Photographiestudio war unweigerlich fehl am Platz in dieser kleinen Stadt mit ihrer etruskischen Vergangenheit, die selbst mittelalterliche Kirchen neu wirken ließ. Doch auf den zweiten Blick entpuppte sich diese dissonante Erscheinung aus der Zukunft als historisch. Die Portraits im Fenster, die ausgestellten Kameras, die angebotenen Dienstleistungen — entstammten allesamt den frühen Tagen der Photographie. Und aus irgendeinem Grunde wirkten diese dreißig bis fünfzig Jahre, die der Laden veraltet war, intensiver auf Helen als die zwanzig Jahrhunderte, die seit der Stadtgründung vergangen waren. Sie trat ein.
Der Laden, im Inneren milchig weiß vom Tageslicht, das durch die unauffällig schmutzigen Fensterscheiben hereinströmte, offenbarte eine gewisse Unentschlossenheit. Zunächst glaubte Helen, die Bechergläser, Pipetten und seltsam geformten Glasapparaturen zwischen etikettierten Fläschchen und Gläsern seien Teil der großen Requisitensammlung, die im Raum verstreut lag — Fahrräder und römische Schuppenpanzer, Sonnenschirme und präparierte Tiere, Puppen und Schiffsausrüstung. Aber langsam verstand sie, dass das Geschäft irgendwo zwischen den Reichen der Wissenschaft und der Kunst festhing. War es ein Drogistenlabor oder ein Maleratelier? Dem Anschein nach hatten beide Seiten schon vor längerer Zeit aufgegeben und den Konflikt ungelöst ruhen lassen.
Im hinteren Teil des Ladens kam ein kleiner Mann mit freundlichen oder erschöpften Zügen hinter einem Vorhang heraus. Er freute sich sehr darüber, wie gut diese junge Ausländerin Italienisch sprach. Nach einer kurzen Unterhaltung holte er ein Album mit Kabinettkarten von der altmodischen Sorte hervor, wie sie Helens Mutter als Kind gesammelt hatte. Sie erkannte viele der Gegenstände wieder, welche die Legionäre, Jäger und Seeleute auf den Photographien trugen. Der Mann sagte, Helen würde eine beeindruckende Minerva abgeben. Er zog einen Hintergrund des Parthenon auf, platzierte Helen davor und durchwühlte die Requisiten nach einem Helm, einem Speer und einer ausgestopften Eule. Helen lehnte ab. Doch bevor die Enttäuschung im Gesicht des Photographen einziehen konnte, sagte sie, sie wolle sehr gern ein Bild von sich aufnehmen lassen. Aber ohne Kostüm. Ohne Hintergrund. Nur sie, wie sie hier im Laden stand. Und so hielt der ebenso erfreute wie erstaunte Photograph den ersten Tag von Helens neuem Leben fest.
*
ALS FÜR DIE BREVOORTS das vierte Jahr auf dem Kontinent anbrach, hatten sie alle bei den amerikanischen Reisenden beliebten Hauptstädte und Urlaubsorte besucht und in der Absicht, Helens Bildung zu erweitern, eine recht wirre Spur auf der europäischen Landkarte gezeichnet. Und da sie in ihrem gesellschaftlichen wie akademischen Streben so weit und so lang gereist waren, war Helen — ihrer reservierten Veranlagung zum Trotze und hauptsächlich wegen der unermüdlichen Bemühungen ihrer Mutter, die Triumphe ihrer Familie zur Schau zu stellen — zu einer Art Sensation geworden. Wann immer Leopold auf einer seiner Partien war, um einen Salon von besonderem Interesse zu besuchen, einer Séance beizuwohnen, an einem Treffen der Theosophischen Gesellschaft teilzunehmen oder einen seiner sogenannten Kollegen zu beehren, nahm Mrs Brevoort ihre Tochter mit zu ihren Terminen und erklärte, sie sei nun alt genug, zu lernen, wie die Welt wirklich laufe. Dabei war Helen den Gepflogenheiten nach natürlich noch zu jung für Gesellschaftsabende. Also brachte Mrs Brevoort sie nicht als Gast mit, sondern als unterhaltsame Einlage.
Von Mrs Brevoort angeregt ließen skeptisch ihren Cognac schwenkende Herren und heiter an ihrem Sherry nippende Damen Helen Passagen aus zwei zufällig gewählten Büchern vorlesen, manchmal in unterschiedlichen Sprachen, die sie sogleich auswendig lernte und als Divertissement nach dem Dinner Wort für Wort wiedergab. Das fanden die zerstreuten Gäste durchaus charmant. Aber wenn Mrs Brevoort ihre Tochter nach dieser ersten Demonstration bat, abwechselnd Sätze aus beiden Büchern aufzusagen und schließlich in derselben Weise noch einmal vom Ende anzufangen, erschlaffte unweigerlich jedes süffisante Grinsen zu offenem Staunen. Und dies war nur die erste Nummer in ihrem Programm, das eine Vielfalt geistiger Kunststücke enthielt und immer in raunendem Beifall endete. Bald forderte man Helens Anwesenheit. Sie wurde zu einem »Ereignis«. Mrs Brevoort brauchte ihrer Tochter nicht zu sagen, dass sie diese Darbietungen, die dem Ansehen der Familie so halfen, vor ihrem Vater geheim zu halten hatte.
Doch diskreten Ruhm gibt es nicht, und während die Familie bei den Edgecombs in Paris logierte, erfuhr Mr Brevoort schließlich zu seiner großen Empörung, dass seine Frau die Talente seiner Tochter für billige Tricks missbraucht hatte. In den vergangenen ein, zwei Jahren hatten sich ihre Interessen so weit voneinander entfernt, dass auch ihre Ehe entsprechenden Schaden nahm, also gingen Catherine und Leopold Brevoort einander wann immer möglich aus dem Wege, um die Zwistigkeiten zu vermeiden, zu denen die meisten ihrer Gespräche führten. Doch als die Wahrheit über Helens Auftritte ans Licht kam, ging die in massiven Schichten des Grolls verhärtete und sedimentierte Wut in einem Erdrutsch nieder. Mrs Brevoort hatte die Nase voll von dem egozentrischen Geschwafel ihres Gatten, von seiner zweifelhaften Wissenschaft und all dem himmlischen Humbug, der ihm mehr galt als die zutiefst irdischen Bedürfnisse seiner Familie. Dass es überhaupt so weit gekommen sei, dass sie auf die Großzügigkeit immer fernerer Freunde angewiesen seien, deren Gastfreundlichkeit sie nur dank ihres Geschickes und ihrer harten Arbeit genössen (dem Wort Arbeit verlieh Mrs Brevoort besonderen Nachdruck, indem sie sich dabei auf die eigene Brust zeigte), und dass sie auf Helens Talente zurückgreifen müsse, um diese Freundschaften zu erhalten und auszuweiten, liege allein daran, dass sie sich nicht auf ihn verlassen konnten, für das Wohl seiner Familie zu sorgen. Dies hatte Mrs Brevoort giftig gezischt, da sie nicht vorhatte, sich im Gästezimmer der Edgecombs zu einem lautstarken Wortgefecht hinreißen zu lassen. Doch Mr Brevoort hatte keine solchen Skrupel. Die Gabe, die Gott ihrer Tochter verliehen habe, mit Ihm zu sprechen, brüllte er, dürfe keine frevelhafte Zirkusnummer werden. Seine Tochter werde nicht in den frivolen Morast gezogen, in dem seine Frau sich so bereitwillig suhle. Seine Tochter stehe für solche intellektuelle Hurerei nicht zur Verfügung.
Helen starrte während des Streits auf ihre Schuhe. Sie ertrug den Anblick ihres Vaters nicht; sie wollte seinen Mund nicht diese sinnlosen Worte formen sehen. Denn das hätte bestätigt, dass nun jemand anders durch ihn sprach. So aber war da nur eine wütende Stimme — ein körperloses Gebrüll, das nichts mit ihrem Vater zu tun hatte. Noch unheimlicher als den bedrohlichen Ton fand sie die Zusammenhangslosigkeit der Tirade, denn für Helen gab es keine schlimmere Gewalt als die gegen den Verstand.
Nach dem Streit (es würde Mrs Brevoort ein verlegenes Gespräch mit Mrs Edgecomb am nächsten Morgen sowie eine mehrwöchige taktvolle Anti-Tratsch-Kampagne in ganz Paris kosten, um den Schaden des Abends einigermaßen zu begrenzen) entfalteten sich Helens Talente allen Widrigkeiten zum Trotze unter strengster Überwachung weiter. Denn wenngleich ihr die strenge und ausschweifende Bevormundung durch ihren Vater missfiel, fand sie dessen scharfe Kritik auch nicht erdrückender als die Geselligkeit ihrer Mutter.
*
EINER DER WENIGEN ZÜGE,