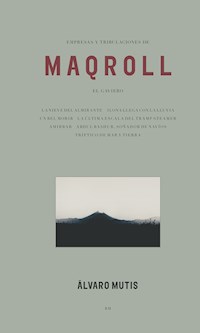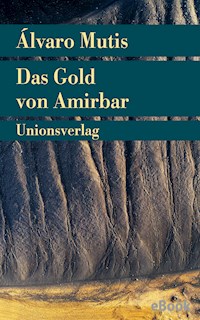8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gaviero Maqroll blickt zurück auf etliche Seereisen, verschlungene Wege, Abenteuer und Weggefährten, die ihre Spuren in seinem Leben hinterlassen haben. Seine größte Herausforderung begegnet ihm jedoch nicht auf den Planken eines Schiffes, sondern in einem französischen Dorf in der Gestalt eines Kindes. Als sein langjähriger Freund und Schicksalsgenosse Abdul Bashur tödlich verunglückt, muss er plötzlich als Vaterersatz für dessen fünfjährigen Sohn einspringen. Die Gesellschaft des unschuldigen Kindes eröffnet ihm eine ganz neue Sicht auf eine Welt, die er doch so gut zu kennen glaubte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch
Gaviero Maqroll blickt zurück auf etliche Abenteuer und Weggefährten, die ihre Spuren in seinem Leben hinterlassen haben. Als sein langjähriger Freund tödlich verunglückt, muss er als Vaterersatz für dessen Sohn einspringen. Die Gesellschaft des Kindes eröffnet ihm eine ganz neue Sicht auf eine Welt, die er doch so gut zu kennen glaubte.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Álvaro Mutis (1923–2013) verbrachte einen Teil seiner Kindheit in Brüssel, kehrte jedoch jedes Jahr nach Kolumbien zurück. Das Land ist die Inspirationsquelle seines Schreibens. Seit 1956 lebte der Autor in Mexiko. 2001 wurde er mit dem Premio Cervantes geehrt, 2002 mit dem Neustadt-Literaturpreis.
Zur Webseite von Álvaro Mutis.
Peter Schwaar (*1947) studierte Germanistik und Musikwissenschaft, war Redakteur und ist seit 1987 freiberuflich tätig als Übersetzer u. a. von Tomás Eloy Martínez, Carlos Ruiz Zafón, Zoé Valdés und Adolfo Bioy Casares.
Zur Webseite von Peter Schwaar.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Álvaro Mutis
Triptychon von Wasser und Land
Roman
Aus dem Spanischen von Peter Schwaar
Die Abenteuer und Irrfahrten des Gaviero Maqroll
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 1993 bei Editorial Norma, Kolumbien.
Die Übersetzung aus dem Spanischen wurde unterstützt durch die Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V. in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung PRO HELVETIA.
Ein Band im Zyklus der Maqroll-Romane: Der Schnee des Admirals, Ilona kommt mit dem Regen, Ein schönes Sterben, Die letzte Fahrt des Tramp Steamer, Das Gold von Amirbar, Abdul Bashur und die Schiffe seiner Träume, Triptychon von Wasser und Land.
Originaltitel: Tríptico de mar y tierra
© by Álvaro Mutis 1997 und seinen Erben
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: NASA (Unsplash)
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-31069-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 23.06.2024, 22:42h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
TRIPTYCHON VON WASSER UND LAND
Treffen in BergenWahrheitsgetreuer Bericht von den Begegnungen und Gleichklängen zwischen Maqroll dem Gaviero und dem Maler Alejandro ObregónHamilMehr über dieses Buch
Über Álvaro Mutis
Mutis über Mutis
Georg Sütterlin: Unheldische Helden
Über Peter Schwaar
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Álvaro Mutis
Zum Thema Kindheit
Zum Thema Kolumbien
Zum Thema Frankreich
Hier sind drei Erfahrungen im Leben Maqrolls des Gaviero vereint, die ihm, jede auf ihre Art und zu ihrer Zeit, bis dahin unbekannte Bereiche seiner Seele gezeigt haben, deren Entdeckung ihn bis ans Ende seiner Tage prägte. Er pflegte nicht oft darüber zu sprechen, und wenn er es tat, dann auf behutsame Art, um sich nicht noch einmal gänzlich auf die Schwierigkeiten einlassen zu müssen, die er im entsprechenden Moment zu überwinden hatte. Er spielte mit kryptischen Sätzen auf sie an, deren häufigster lautete: »Ich habe mich am Rand von Abgründen bewegt, gegen die der Tod ein Marionettenspaziergang ist.« Nur mit viel Mühe haben wir aus dem Mund unseres Freundes oder von Leuten, die er gern hatte, erfahren, worin diese Ecken bestanden, um die zu biegen ihn das Schicksal gezwungen hat.
Treffen in Bergen
Günlük işlerdenmiş gibi ölüm.
[Als wäre der Tod etwas Alltägliches.]
Ilhan Berk
Dass mir das gerade in Brighton passieren musste, hätte jeder, der das populäre Seebad in Sussex kennt, für natürlich und vorhersehbar gehalten. Brighton, dieser Ort, wo die Londoner mitten in einer düsteren Ansammlung viktorianischer und edwardianischer Bauten, die alle Fieberfantasien übertreffen, unbeirrt das Meer genießen; der Ort, wo es selbst das bescheidenste aller Pubs fertig bringt, uns genau den Whisky vorzusetzen, den wir nicht wollten, und wo uns die Frauen in den Straßen und auf der trostlosen Mole, an die das eisig-graue Meer brandet, eine lange Liste von Zärtlichkeiten feilhalten, die in der Stunde der Wahrheit zur homöopathisch beschleunigten Version dessen werden, was ein Anglikaner unter Lust versteht; kurzum, in Brighton, wo wir eigentlich schon bei der Ankunft wissen, dass wir hier nichts verloren haben, in Brighton also musste ich in einer schäbigen Pension drei Tage das Bett hüten. Bei all dem Durchfall und Ekel hätte ich beinahe den Geist aufgegeben.
Ich war hergekommen, um mich mit Sverre Jensen zu treffen, meinem alten Freund und Partner auf den Fischzügen in Alaska und vor der Küste Britisch-Kolumbiens. Er wiederum war hier mit einem Reeder verabredet, der wegen eines schweren Herzleidens in den Ruhestand getreten war und uns ab und zu beim Chartern eines Fischkutters für unsere Arbeit entgegenkam. In dem Moment, als ich in London den Zug bestieg, wurde mir klar, dass einige Bissen des Seeigelgerichts, das ich kurz zuvor in einem thailändischen Restaurant unweit des Strand verzehrt hatte, ihre Frische zu einem guten Teil eingebüßt haben mussten. In meiner Ungewissheit bestellte ich als kaum sehr probates Gegengift eine Flasche portugiesischen Weißwein, der sich als ebenso dubios erwies wie die Seeigel. Die ersten Krämpfe machten sich noch vor der Ankunft in Brighton bemerkbar. Ich ermannte mich und ging zum Haus unseres Reeders, doch auf mein Klingeln antwortete niemand. Das Haus schien verlassen zu sein. Sämtliche Gelenke schmerzten mich, und mein Kopf war zu einer Art Glocke geworden, wo in unerbittlichem Rhythmus Hammerschläge dröhnten, die mich beinahe blendeten und mir den Atem benahmen. Ein Taxi brachte mich zu der Pension, die mir Jensen empfohlen hatte. Sie lag in einem dunklen Gässchen mit dem wenig ermutigenden Namen Monkeyhead Lane. Die Besitzerin, eine füllige Italienerin mit einem Schatten von beginnendem Schnurrbart, legte mir das Anmeldeformular zum Ausfüllen vor und gab mir dann den Schlüssel zu einem Zimmer im vierten Stock des Hauses. Jede Stufe wurde mir zur nicht enden wollenden Qual. Kurz darauf brachte mir die Matrone einen bitteren Aufguss mit dem schillernden Glanz eines Öls herauf, das ich nicht zu identifizieren versuchte. Die Autorität der Frau, der ich bereits von meiner Vergiftung mit den Londoner Seeigeln erzählt hatte, ließ keine Widerrede zu, sodass ich das Gesöff schluckte, so gut ich eben konnte. Die Behandlung dauerte drei Tage, in denen ich die teuflische Medizin als einzige Nahrung zu mir nahm. Als ich wieder aufstehen und ein wenig herumgehen konnte, war ich bereits geheilt, fühlte mich indessen wie ein Neunzigjähriger, der die letzten Monate seines Lebens noch zu nutzen versucht.
In Brighton kannte ich niemanden. Vor Jahren waren wir in einer dieser Ilona-Anwandlungen, die sie ›l’appel de mon sang slave‹ zu nennen pflegte, in Brighton gelandet, um hier einige Sommerwochen zu verbringen. Ich weiß nicht, welche Vorstellung sich meine früh verstorbene Freundin von den Wundern dieses Orts gemacht hatte – jedenfalls beschlossen wir, nachdem wir uns zwei Wochen lang in einem unerträglich nach englischer Küche stinkenden Zimmer geliebt hatten, nach Triest zu fahren und uns bei einer Kusine von Ilona einzuquartieren, die uns empfing, als kämen wir eben vom unwirtlichsten Ort der Erde. Als ich unserer Gastgeberin von dem Gestank erzählte, dem unser Brightoner Zimmer ausgesetzt gewesen war, bemerkte Ilona: »Das mit der englischen Küche ist eine Behauptung des Gaviero. Dort roch es nach dem, was die Pikten aßen, und vermutlich haben ihre Nachfahren keine großen Fortschritte gemacht.«
Das war meine einzige Erinnerung an das berühmte englische Seebad und auch meine einzige, keineswegs angenehme Erfahrung dort.
Als ich noch am ganzen Körper das Gefühl hatte, gnadenlos zusammengeschlagen worden zu sein, beschloss ich, zu dem walisischen Reeder zurückzugehen, der auf den Namen Glanmor Conway hörte. Diesmal öffnete mir ein einstudiert schüchtern aussehendes junges Mädchen, eine der typischen Engländerinnen mit durchsichtiger Haut und von etwas kraftloser Erscheinung, die in ihrem Innern jedoch über eine grenzenlose Energie und das vollständigste Arsenal von Listen verfügen, um sich im Leben durchzuschlagen. All das, ich wiederhole es, geschützt durch einen naiven Ausdruck, der denjenigen leicht täuscht, der mit dieser Spezies nicht vertraut ist. Ich nannte ihr meinen Namen und erklärte dann, ich hätte eine Verabredung mit Mister Conway. Das junge Mädchen bat mich herein und führte mich in einen Raum, der das Büro des Hausherrn sein musste. Sie deutete auf einen Stuhl und bat mich, Platz zu nehmen, während sie sich in dem Sessel niederließ, der hinter dem Schreibtisch stand und offensichtlich zum ausschließlichen Gebrauch des Reeders bestimmt war. Ich musste angesichts der mir seltsam erscheinenden Dreistigkeit ein überraschtes Gesicht machen, denn Cathy – so hatte sie sich mir vorgestellt, als ich ihr meinen Namen nannte – erklärte, während sie mit ihren kaum wahrnehmbar blauen Augen in eine den geborenen Simulanten eigene Ferne starrte: »Glanmor ist ein Onkel zweiten Grades meiner Mutter, und nach ihrem Tod brachte er mich hierher, damit ich bei ihm leben konnte. Ich habe keine weiteren Angehörigen. Mein Vater ist beim Schiffbruch der Lady Ann umgekommen, an den Sie sich sicherlich erinnern.«
Dunkel entsann ich mich noch des Untergangs dieses alten Trampschiffs, das Conway gehört und Schiffbruch erlitten hatte, als es bei der Einfahrt in den Hafen des dänischen Århus auf eine Mine auffuhr. Das war, nebenbei bemerkt, fast zwanzig Jahre her.
Dann teilte mir Cathy mit, die Anweisung, die sie von Glanmor habe, sei die, sowohl Sverre Jensen als auch mich bis zu seiner Rückkehr in seinem Haus aufzunehmen. Er habe einige Tage wegfahren müssen, um in Bristol eine geschäftliche Angelegenheit zu regeln. Ich kannte Conway von früher, und trotz seiner sprichwörtlichen Herzlichkeit erschien mir das Angebot, in seinem Haus zu wohnen, etwas ungewöhnlich. Aber ich beschloss, es anzunehmen, denn meine Mittel waren ziemlich erschöpft, und die Italienerin mit dem Damenbart wirkte nicht wie jemand, der Verzüge bei der Bezahlung der Zimmermiete langmütig hinnahm. Ich fragte Cathy, ob sie etwas von meinem norwegischen Freund gehört habe, und sie verneinte, doch Glanmor habe ihr gesagt, er werde etwa gleichzeitig mit mir eintreffen. Ich erklärte ihr, ich nähme die Einladung ihres Onkels gerne an und sei in Kürze mit meinen Siebensachen zurück. Sie lächelte halb sittsam, halb verschlagen, was mich mit einer unbestimmten Unruhe erfüllte.
Als ich, meinen Seesack über der Schulter, von der Pension zurückkam, führte mich Cathy in eine Mansarde, zu der man über einige steile Stiegen gelangte, die mich außer Atem brachten. Wir betraten ein geräumiges Zimmer mit zwei Betten, jedes unter einem Dachfenster, einem großen Schrank und einem Haufen Ferngläser, Kompasse und unmöglich zu bestimmender nautischer Gegenstände, die einem bei jedem Schritt im Weg standen. Das Badezimmer befand sich am Ende des schmalen Korridors, der den ganzen Dachboden durchmaß. Cathy zeigte mir ebenfalls ihr Schlafzimmer, das neben dem Bad lag. Sie tat dies ohne besonderen Ausdruck, als handle es sich um eine Routineinformation. Dass die Nichte zuoberst im Haus wohnte und gleichzeitig den Schreibtischsessel ihres Onkels benutzte, um sich mit Unbekannten zu unterhalten, konnte ich im ersten Augenblick nicht in Einklang bringen. Ich ging wieder in meine Mansarde, legte die drei, vier Bücher, die ich immer bei mir habe, auf den Nachttisch und verwahrte den Sack mit den Kleidern in dem großen Schrank, der ächzte wie ein müdes Tier. Cathy verschwand wortlos, und ich hörte sie auch nicht die Treppe hinuntergehen. Nun war mir klar, warum mir beim ersten Mal niemand geöffnet hatte. Das junge Mädchen musste in ihrem Zimmer gewesen sein, und dort hörte man die Türklingel sicher nicht. Alles erschien mir ungewöhnlich, aber da ich wusste, dass uns bei Engländern nichts überraschen darf, beschloss ich, mich aufs Bett zu legen und eine Weile auszuruhen. Die Strapazen des Umzugs hatten mich erschöpft, und es zeigte sich, dass die Rekonvaleszenz nach meiner Vergiftung länger dauerte als vorausgesehen.
Den restlichen Tag verbrachte ich in meinem Zimmer. Zweimal kam Cathy mit einer Tasse Tee und Toasts herauf. Das war das Einzige, was ich schlucken konnte, ohne dass die Übelkeit zurückkam, die nur langsam verschwinden wollte. So bekam ich einige Einblicke in Glanmor Conways Leben, nicht alle erbaulich übrigens und einige eher düster. Als Cathy zu ihrem entfernten Verwandten kam, war sie noch nicht einmal ein Teenager. Conway beschäftigte sie als Dienstmädchen für einfache Verrichtungen, die eine alte Magd aus Wales überwachte, welche kaum Englisch sprach. Als Cathy zur Frau heranwuchs, schickte der Mann die Alte in ihr in den Bergen von Radnor verlorenes Kaff zurück und holte das junge Mädchen zu sich ins Bett, während er ihr zugleich sämtliche Obliegenheiten im Haus aufbürdete. Er war schon über siebzig und zutiefst misstrauisch. Nie ließ er Cathy aus dem Haus, außer zum Einkaufen im Lebensmittelladen an der Ecke, und die Zeit, die sie für solche Besorgungen brauchte, kontrollierte er peinlich genau. Anscheinend hatte er dann nach und nach seine Beziehung zu ihr aufgegeben, und jetzt beschäftigte er sie nur noch als Dienstmädchen.
Zwei Tage nach meiner Ankunft im Haus des Reeders erschien eines Abends Cathy in ein Laken gehüllt, schlüpfte neben mich und überschüttete mich mit Liebkosungen. Wir verbrachten die Nacht zusammen, und das junge Mädchen erwies sich als sehr viel naiver, als ich angenommen hatte, obwohl sie bei jeder Umarmung in eine Art Trance geriet, bei der kaum zu erkennen war, ob sie sie nur vortäuschte oder wirklich erlebte. Mir war vollkommen klar, dass ich auf diese Weise meine an sich schon heikle Lage noch komplizierter machte. Sowie Sverre Jensen eintraf, fühlte ich mich sehr erleichtert. Ich erzählte ihm alles, was vorgefallen war, und er schaute mich mit dem Ausdruck größten Befremdens an. Als ich mit meiner Geschichte zu Ende war, sagte er in seiner sprichwörtlichen Kürze nur: »Bei alledem passt irgendetwas nicht zu dem, was ich von Conway weiß. Wenn er zurückkommt, werden wir ja sehen, wie sich das klärt. Wichtig ist, dass er uns bald das Schiff zur Verfügung stellt – in einigen Wochen beginnt die Thunfischsaison. Im Moment würde ich Ihnen nur raten, Maqroll, die Finger von dieser Cathy zu lassen.«
Bevor ich fortfahre, ist es wohl angebracht, den Leser darüber zu unterrichten, wer mein guter Freund Sverre Jensen denn war, dieser alte Seebär, mit dem ich im Nordpazifik auf Fischfang war und dessen Herzensgüte mit einer übergroßen Scham einherging, mit der er sie zu verstecken wusste. Wir hatten uns im Gefängnis von Kitimat in Britisch-Kolumbien kennen gelernt, in dem ich gelandet war, weil man mich des Ehebruchs mit einer jungen Indianerin angeklagt hatte, die mit einem besessenen Polen zusammenlebte, welcher zu meinem Ankläger wurde und mich umzubringen drohte. Jensen wiederum war da, weil er bei einer Wirtshauskeilerei eingegriffen hatte, bei der zwei Portugiesen erstochen wurden, von denen keiner wusste, woher sie kamen. Das Messer, mit dem sie erdolcht wurden, gehörte Sverre, doch der versicherte, es sei ihm zu Beginn des Streits aus der Scheide an seinem Gürtel gezogen worden. Zwei Monate teilten wir dieselbe Zelle und trotzten einer Kälte, die uns frühmorgens erstarren und beinahe zu Eiszapfen gefrieren ließ. Während dieser Zeit hatten wir Gelegenheit, unsere Erlebnisse auszutauschen, und bei vielen deckten sich Orte und Umstände so merkwürdig, dass wir uns oft erstaunt fragten, warum wir uns nicht schon eher begegnet waren. Sverres Unschuld konnte dank der unbedachten Äußerung eines Schwarzen aus South Carolina bewiesen werden, der im Vollrausch in einer Kneipe ausposaunte, wie er die Portugiesen umgebracht hatte, die einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und mit Schwarzen gehandelt hätten, welche sie unter falschen Versprechungen eines Jobs in Amerika aus Angola herausgeschafft hätten. Danach entdeckte man, dass der Mann nicht richtig im Kopf war und die Morde in einem Anfall geistiger Umnachtung begangen hatte. Ich kam mehr oder weniger in denselben Tagen frei, nachdem der gekränkte Warschauer seine Klage zurückgezogen hatte. Jensen und ich taten uns zusammen. Zuerst wurden wir auf verschiedenen Fischdampfern als einfache Netzeinholer angeheuert, und danach waren wir die Herren unseres eigenen Zweimasters, den wir dank einer bescheidenen Erbschaft anschaffen konnten, die Sverre nach dem Tod eines allein stehenden Bruders, Friedensrichter in Bergen, zufiel. Ich ergänzte die fehlende Summe mit dem, was ich in der Netzeinholerzeit auf die hohe Kante gelegt hatte, Ersparnisse, zu denen Jensen mich genötigt hatte, da er wusste, dass ich kaum oder gar nicht an die Zukunft dachte. Doch das ist nicht der Augenblick, zu erzählen, was Sverre und ich in den gemeinsam verbrachten Jahren durchmachten, in denen wir uns auf das riskante Unterfangen einließen, vom Fischfang zu leben. Die Gelegenheit wird kommen, das nachzuholen.
Sverre hatte sich kein bisschen verändert, obwohl so viele Jahre vergangen waren. Er gehörte zu der Art Skandinavier, die von der Lebensmitte an bei einer Statur verharren, die sie bis zum letzten Tag begleitet. Sein korpulenter, kräftiger Riesenleib schien aus Teilen anderer Körper derselben Rasse, aber unterschiedlicher Proportionen zusammengesetzt. Auch das lange, knochige Gesicht zeigte diese Disharmonie, die nur die stets lächelnden Augen und ein in keinem seiner einzelnen Züge zu findender gütiger Ausdruck vergessen ließen. Wortkarg im täglichen Umgang, war er auch zu rabiaten, Furcht erregenden Stimmungswechseln fähig. Nicht ein handfester Grund entfesselte solchen Zorn, sondern eher eine gewisse willkürliche Ungerechtigkeit vonseiten seiner Mitmenschen. Einmal sah ich ihn mit einem Fausthieb einen Tisch zertrümmern, als wäre er aus Papier, nachdem ein Kneipenwirt in Antwerpen eine der Kellnerinnen verprügelt hatte, weil sie ein Tablett mit Bierkrügen hatte fallen lassen. Sieben Riesen der Hafenpolizei brachten ihn nach einem Kampf, in dem er drei von ihnen spitalreif schlug, endlich unter Kontrolle.
Als ich Jensen von dem Empfang erzählte, den mir Cathy bereitet hatte, reagierte mein Freund misstrauisch und warnte mich, wie bereits gesagt, vor der Nichte des Walisers. Als dieser nach mehreren Tagen noch immer kein Lebenszeichen gegeben hatte, beschlossen wir, bei Cathy zu bohren, wo sich der Reeder wirklich befand. Ihre Antworten waren beunruhigend vage, sodass Jensen auf eigene Faust nachzuforschen beschloss. Um die Dinge vollends zu komplizieren, versuchte das junge Mädchen eines Abends, bei Jensen ebenso unbefangen ins Bett zu schlüpfen wie zuvor bei mir. Er warf sie hochkant hinaus. Allmählich begann er ihre Absichten zu durchschauen. Die Tage verstrichen, und unser Geld ging zur Neige, als Jensen durch einen unerhörten Zufall zwischen den Seiten einer Bibel, in der er als guter Protestant ab und zu las, einen mit Bleistift beschriebenen Zettel fand. Es handelte sich um eine fast unleserliche Adresse in Portsmouth und eine fünfstellige Zahl, in der man eine Telefonnummer dieser Stadt vermuten durfte. Wir beschlossen, von dem Pub aus, das wir täglich aufsuchten, anzurufen, und es antwortete Glanmor Conway höchstpersönlich. Unsere Überraschung hielt sich in Grenzen, da wir hinter dem uns von Cathy aufgetischten Märchen von Bristol so etwas vermutet hatten. Was wir von Conway erfuhren, zeigte uns endgültig, welch verrückter Lüge wir aufgesessen waren, zunächst ich und ohne jede mögliche Entschuldigung. Das Haus in Brighton war zum Verkauf ausgeschrieben, und Conway hatte seine angebliche Verwandte dort gelassen, um den Leuten des Maklerbüros bei den Besichtigungen zu helfen. Er hatte bei Cathy für uns die Nachricht hinterlassen, wir sollten uns mit ihm in Verbindung setzen, da er sein Geschäft endgültig aufzulösen beschlossen und die noch auf seinen Namen eingetragenen Schiffe verkauft hatte. In keinem Moment hatte er die Anweisung gegeben, uns in seinem Haus unterzubringen, dessen Benutzung und Verwaltung selbstverständlich Sache des Immobilienmaklerbüros war. Es tat ihm sehr Leid, dass wir diesem Streich zum Opfer gefallen waren, und er warnte uns eindringlichst vor Cathys Betrügereien. Natürlich mussten wir sofort von dort weg, wenn wir keine Schwierigkeiten mit den Grundstücksmaklern wollten, die unsere Anwesenheit als Hausfriedensbruch verstehen würden.
Bevor wir zu Conways Haus zurückgingen, beschlossen wir, dort auf der Stelle auszuziehen, ohne Cathy irgendwelche Erklärungen abzugeben. Das junge Mädchen sah uns unsere Sachen zusammenpacken, machte aber keinerlei Bemerkung dazu. Erst als wir die Treppe hinunterstiegen, rief sie mit hysterischem Lachen vom Dachboden: »Was für zwei Schwachköpfe! Hier hättet ihr so lange wohnen können, wir ihr wollt, ohne einen Penny zu zahlen! Ihr habt nichts kapiert.«
Wir gingen wieder in die Pension der Italienerin, die bereit war, Sverre auf dem ausrangierten Sofa in dem Zimmer schlafen zu lassen, das ich vorher bewohnt hatte, und uns dafür nur ein paar Shilling zusätzlich verrechnete. Ihr einziger Kommentar lautete: »Ich bezweifle, dass er dort Platz hat. Einen so großen Menschen hab ich noch nie gesehen.«
Jensen schaute mich wieder an, als fragte er sich, ob plötzlich alle Frauen, die uns derzeit über den Weg liefen, nicht mehr ganz richtig im Kopf waren. Ich zuckte die Schultern und schlug ihm vor, unser Kapital abzuschätzen, da ich befürchtete, beide zusammen hätten wir nicht genügend Geld, um uns noch lange über Wasser zu halten. Die Bilanz war zutreffend. Wenn wir einmal am Tag aßen und auf den gräulichen Scotch der Brightoner Pubs verzichteten, reichte unser Geld höchstens noch für zwei Wochen. Da das bei mir immer so gewesen ist, seit ich denken kann, machte ich mir keine allzu großen Sorgen. Jensen, gemäßigter, ernsthafter Nordländer, geriet in eine Panik, die er umsonst zu verbergen versuchte.
»Und was nun, Maqroll? Vom alten Conway hätten wir das Schiff chartern können, und er hätte uns etwas Geld vorgestreckt. Damit habe ich gerechnet, um weiterzukommen. Ich muss gestehen, ich habe keine Idee.« Seine Stimme war schleppend und spiegelte eine Mutlosigkeit, die im Augenblick unwillkommener nicht hätte sein können.
»Zuallererst«, sagte ich und legte in meine Worte eine Begeisterung, die nicht wirklich überzeugend klang, »müssen wir diese schreckliche Stadt verlassen – sie ist es, die uns diese ganzen Widerwärtigkeiten beschert hat. Ihre viktorianischen Häuser samt der Bewohner können gar nicht anders, als das Unglück anzuziehen. Und wissen Sie, warum? Weil man sie gegenüber dem Meer erbaut hat, und das ist ein Affront, den die Götter nicht verzeihen. All diese bleichen, gierigen Gesichter der Leute, die durch die Straßen von Brighton schleichen, bloß um den Londoner Überdruss zu vergessen, geben uns zu verstehen, dass wir uns in einem Land der Toten befinden. Merken Sie nicht, dass alles hier nur Schein ist und ebendarum wieder wirklich wird? Nichts als der Tod, der über den großen bunten Glasgewölben wacht, über den verbogenen Eisenstücken, die vergangene Epochen zu wiederholen versuchen, und den Herden von Schafsköpfen, die nicht wissen, wozu sie hergekommen sind. Gehen wir weg von hier, mit dem Geld, das wir noch haben – egal, wohin, aber gehen wir.«
Seit Langem war Sverre meine Phobien und Verwünschungen gewohnt, und er war einverstanden, unverzüglich die Flucht zu ergreifen. Tatsächlich bestiegen wir am nächsten Tag einen Frachter nach Saint-Malo, auf dem man uns erlaubte, unsere Hängematten in einer Kabine neben dem Maschinenraum aufzuhängen, mitten in einem Höllenlärm und einem Dieselgestank, der einem den Appetit benahm. Von mir kann ich nur sagen, dass ich mich wie im Paradies fühlte, als wir uns von diesem unheimlichen Albtraum entfernten, Zufluchtsort einer ›middle class‹, die ebenso verhungert wie die Ärmsten, dabei aber eine fingierte Würde bewahrt. Die Überfahrt dauerte zwei Tage und zwei Nächte, denn wir mussten Cherbourg anlaufen, um irgendeine Fracht zu löschen. Ich bin mit jeder denkbaren Art von Schiff gefahren, aber nie hatte ich die Wogen an Bord eines ähnlichen Kastens gepflügt wie der Pamela Lansing, ein Name, der einzig dazu diente, das Elend ihrer grotesken Erscheinung noch zu vergrößern. Wie uns ihr Kapitän, ein Ire, der aussah, als wäre er im letzten Moment vor dem Galgen errettet worden, gestand, hatte das Schiff im Ersten Weltkrieg Truppen nach Gelibolu transportiert. Damit war alles gesagt.
Als wir in Saint-Malo an Land gingen, hallte das höllische Geknatter von Maschinen und Rumpfblechen der Pamela Lansing in unseren Ohren noch nach. Außerdem entdeckte ich in diesen Tagen und Nächten, dass über dem Schicksal meines guten Sverre ein düsterer Schatten lag. Ich werde zu schildern versuchen, wie ich ohne explizite Worte meines Freundes zu dieser traurigen Gewissheit kam. Schon bei unserem Wiedersehen in Brighton hatte ich hinter seiner herzlichen Begrüßung eine Müdigkeit wahrgenommen, eine Gleichgültigkeit gegenüber den Geschäften und Arbeiten, die zuvor seinen ganzen zurückhaltenden Enthusiasmus beansprucht hatten. Andererseits war der Grund für diesen Zustand offensichtlich kein körperlicher; Sverre strotzte vor Gesundheit und Kraft wie ehedem. Die Ursache lag in einem Winkel seiner Seele, dem eine giftige Substanz entströmte, die ihn nach und nach von den Dingen dieser Welt entfernte. Im Wissen, dass sich seine religiösen Überzeugungen darauf beschränkten, gewohnheitsmäßig einige Gebote seines protestantischen Glaubens zu erfüllen, schrieb ich seinen Zustand nicht irgendwelchen Gewissensproblemen zu. Mehrmals versuchte ich mit größter Diskretion, mich zu dem Thema, das mich beschäftigte, vorzutasten, doch Jensen ging jedem Bekenntnis aus dem Weg. Seine Frau war vor vielen Jahren an einer Krebskrankheit gestorben, die sehr qualvoll gewesen war, ohne dass ihr je eine Klage über die Lippen gekommen wäre. Sverre stand ihr mit ergreifender Liebe und Hingabe bei. Sie hatten keine Kinder, und der Norweger kehrte zu seinen langen Fischzügen zurück. An eine erneute Heirat dachte er nicht. Ich wusste aber, dass er in einigen Häfen Freundinnen hatte, mit denen er zwar nicht gerade eine Liebesbeziehung, aber doch ein Verhältnis vergnügter Herzlichkeit unterhielt, immer so weit fröhlich, als es ihm sein skandinavisches Phlegma gestattete. Es war charakteristisch für seinen besonderen Sinn für Humor, dass er alle anders nannte, als sie hießen. Beispielsweise erinnere ich mich an eine Florence, die er hartnäckig Rosalie nannte und von der er behauptete, sie stamme aus Grenoble, wo sie doch aus Seattle war und kein Wort Französisch sprach. Und eine Schwarze aus Martinique, die ihn aufs Äußerste verwöhnte, sich mit ihm sehr amüsierte und sein Kommen jeweils mit tausend Liebesbekundungen beging, nannte er immer wieder Yukio San, was ein doppelter Unsinn war, denn in diesem Fall war auch die Anrede ›San‹ unzulässig.
Eine weitere Konstante im Charakter meines Freundes war das, was man sein Abkommen mit Gott nennen könnte. Er war kein Mann regelmäßiger oder eingewurzelter religiöser Gepflogenheiten, aber immer wenn man in seiner Gegenwart das höchste Wesen anrief, sei es während eines riskanten Manövers auf dem Meer, sei es bei einem Geschäft, das sich aus irgendeinem Grund verzögerte, machte Sverre eine Handbewegung, als wollte er etwas ganz Heikles, neben ihm Stehendes abwehren, und wiederholte jedes Mal denselben Satz: »Den lassen wir jetzt mal aus dem Spiel. Der hat schon genug andere Probleme am Hals.« Es fiel mir auf, dass er das mit größter Gelassenheit sagte und nicht, um einen amüsanten Satz anzubringen. Er sprach im selben Ton, wie wenn er gesagt hätte: Drossle den linken Motor, oder: Man darf die Winde nicht so forcieren. Seht ihr denn nicht, dass sie überhitzt ist? Bemerkenswert erschien mir immer, dass es, soweit ich mich entsinne, niemand wagte, Sverre zu widersprechen, wenn er Gott von täglichen Arbeiten ausschloss, oder ihm mit einem Argument der elementarsten Theologie zu antworten.
Ich könnte jetzt viele weitere merkwürdige Aspekte der Persönlichkeit meines langjährigen Kameraden zur Sprache bringen, aber es wird im Verlauf dieser Geschichte hoffentlich noch die Gelegenheit geben, einige davon zu erwähnen. Im Moment bleibt mir nur zu sagen, dass er einer der reinlichsten Menschen war, was die Pflege seiner Person betraf, und dass er bei allen Arbeiten des Seemannsberufs seine Kleidung tadellos zu halten wusste. Sie war immer schlicht und in keiner Weise ausgefallen. Wenn wir in eine Hafenstadt kamen und einiges aus unserer Garderobe erneuert werden musste, suchte er sich in den auf Seemannskleidung spezialisierten Geschäften unter den vielen vom Verkäufer vorgelegten Stücken umständlich ein Hemd oder eine Hose aus. Das Ergebnis des langen Auswahlprozesses war immer elegant in Farbe und Schnitt, aber nie auf äußere Wirkung bedacht. Als er in Brighton eintraf, fiel mir daher als Erstes auf, dass seine Kleidung zwar nicht gerade vernachlässigt war, aber doch einen Mangel an der Achtsamkeit zeigte, die Sverre, den ich in gefühlvollen Momenten den ›Beau de la Régence‹ nannte, ihr sonst zu schenken pflegte.
Anfänglich maß ich dem keine allzu große Bedeutung bei, aber auf der Fahrt zur bretonischen Küste konnte ich feststellen, dass diese Gleichgültigkeit Hand in Hand ging mit bestimmten Gedanken von verschwommener Ferne, die er im unerwartetsten Moment äußerte, einem allmählichen Rückzug von den Dingen dieser Welt, Gedanken, die mich mit immer größerer Sorge erfüllten. Ich erinnere mich genau an eines dieser Gespräche, vielleicht das erste, das in mir die Alarmglocke läuten ließ. Wir sprachen von unseren Fischzügen im Alexanderarchipel und davon, wie wenig Profit wir nach all den zahllosen Nöten herausgeschlagen hatten und nachdem wir im Kampf gegen das Eis einen Dieselmotor verbrannt hatten.
»Wir werden«, sagte ich zum Trost, »zu einer günstigeren Zeit wiederkommen. In dieser Gegend ist der Fang ergiebig, das wissen wir von früher.«
»Ich glaube nicht, dass ich zu den Alexanderinseln noch sonst wohin zurückfahre, wo ich noch einmal erleben muss, was wir damals durchgemacht haben«, antwortete Sverre mit einer Bestimmtheit, die meine Neugier weckte.
»Na schön, ob zu den Alexanderinseln oder in eine weniger mühselige Gegend. Man soll sich schließlich nicht zu Tode schuften, um dann kaum die Ausgaben wieder hereinzukriegen«, fügte ich hinzu.
»So braucht man sich nicht umzubringen. Ich meine nicht das. Sterben ist ein Pakt, den wir mit uns selbst schließen. Wichtig ist, zu wissen, wann und wie er sich erfüllt, und sicher zu sein, dass es eine Reise ohne Zurück ist.« Sverre sprach ganz gelassen, beinahe gleichgültig. Aber es lag auf der Hand, dass wir nicht mehr von unseren Fischzügen redeten, sondern dass das Gespräch eine andere Richtung eingeschlagen hatte.
»Seltsam, was Sie da sagen«, bemerkte ich. »Den Pakt habe ich schon lange geschlossen, aber ich glaube nicht, dass es sich lohnt, darüber zu reden. Wenn man solche Dinge ausspricht, bekommen sie einen melodramatischen Beigeschmack.«