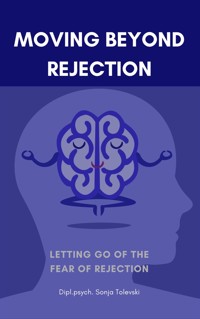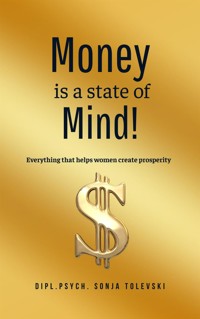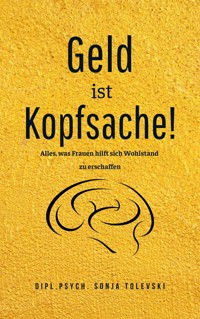9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dies sind 11 Interviews mit 11 wunderbaren Großmüttern, die von ihrem Leben und ihren Problemen erzählen. Ich wollte Ausschnitte aus deren Leben festhalten, die auch für die heutigen Frauen interessant sein können. Es sind bewegende 11 Schicksale, welche berühren, welche den eigenen Alltag in einem anderen Licht erscheinen lassen.
Die Interview-Fragen:
1. Was waren die wichtigsten Ereignisse in Ihrem Leben?
2. Welche Träume hatten Sie mit Anfang 20?
3. Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt?
4. Was denken Sie über Ehe und Liebe?
5. Welches sind Ihre schönsten Erlebnisse?
6. Wie sieht Liebe im Alltag aus?
7. Wie sah Ihr Alltag früher aus?
8. Welche Gedanken gingen Ihnen früher oft durch den Kopf?
9. Wie war Weihnachten früher?
10. Wie haben Sie den Krieg erlebt?
11. Was empfehlen Sie den jungen Frauen von heute?
Die Frage ist doch viel weniger der Job, der besser sein könnte, die Beziehung, die besser sein könnte, das Einkommen, das besser sein könnte, sondern: was nehmen wir wahr? Was hält uns davon ab glücklich zu sein?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Trotzdem das Leben lieben
11 Fragen – 11 Großmütter- 11 Schicksale
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenWas erwartet dich in diesem Buch?
Es sind Interviews mit 11 wunderbaren Großmüttern, die von ihrem Leben und ihren Problemen erzählen. Ich wollte Ausschnitte aus deren Leben festhalten, die auch für die heutigen Frauen interessant sein können. Aus meiner Beobachtung beschäftigt sich die Frau von heute zu über 70 Prozent mit ihrer Beziehung, sei das die Beziehung zu ihrem Partner, zu ihren Kolleginnen und Kollegen, zu der Familie, oder eben zu der fehlenden Beziehung. Sehr viel Zeit fällt auf das Thema Beziehung und die daraus entstehenden Fragen.
Selbstverständlich gab es bei allen Interviews denselben Frageleitfaden und dennoch fällt jedes Interview ein wenig anders aus. Der ursprüngliche Leitfaden ist unten angeführt. Ich bitte um Nachsicht bei möglichen Wiederholungen, bei manchen Überschneidungen der Thematik und natürlich bitte auch bei manchen Formulierungen. Mir war es wichtig, dass die sprachliche Grundfärbung erhalten bleibt, sonst hätte ich den Inhalt einfach nacherzählen können. Genau das wollte ich aber nicht! Ich wollte den Vorteil des eigenen Erzählens nutzen, denn diese Geschichten prägen sich in unser Gedächtnis. Ich wiederhole immer wieder in meinen Seminaren, dass es einfacher ist, den zufällig erlauschten Klatsch und Tratsch in der Bäckerei-Warteschlange noch abends sehr genau im Gedächtnis zu haben als einen gut ausformulierten Text. Auf diesen Zug wollte ich mit diesem Buch aufspringen! Nur so kommen Emotionen ins Spiel und nur über Emotionen entstehen Veränderungen. Es hat sich wie von selbst ein therapeutischer Effekt in dem Buch ergeben, welcher von mir so nicht eingeplant war.
Natürlich werden dich nicht alle Interviews berühren. Aber auch wenn es nur zwei sind, die ein kleines Steinchen in deinem Inneren anstoßen, dann hat sich für mich diese Arbeit schon gelohnt.
Die Interview-Fragen:
Was waren die wichtigsten Ereignisse in Ihrem Leben?
Welche Träume hatten Sie mit Anfang 20?
Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt?
Was denken Sie über Ehe und Liebe?
Welches sind Ihre schönsten Erlebnisse?
Wie sieht Liebe im Alltag aus?
Wie sah Ihr Alltag früher aus?
Welche Gedanken gingen Ihnen früher oft durch den Kopf?
Wie war Weihnachten früher?
Wie haben Sie den Krieg erlebt?
Was empfehlen Sie den jungen Frauen von heute?
Einleitung
Was ist der Inhalt eines Lebens? Sind es nicht immer dieselben Fragen, die uns beschäftigen? Stolpern wir nicht immer wieder in ähnliche Fallen des Lebens? Und immer wieder haben wir das Gefühl, wir sind am Ende angekommen. Zumindest was unsere Kraft, unsere Geduld und auch unseren Spaß an den Herausforderungen angehen. Doch ist es wirklich so?
Im Jahr 2005 hatte ich ein langes Gespräch mit einer wunderbaren älteren Dame, die mir einige Geschichten aus ihrem Leben erzählte. Ich war förmlich gefesselt von ihren Erzählungen, ihren Erlebnissen, welche sicherlich einen wesentlichen Beitrag zu ihrer Erscheinung und ihrem Auftreten geleistet hatten. Sie wirkte wie eine „Grande Dame“ mit einem zufriedenen Lächeln, einer ausdrucksstarken Gelassenheit und einem souveränen Auftreten. Wenn sie sprach, dann schwang kein Selbstmitleid mit, es war eher eine Dankbarkeit zu fühlen. Eine Dankbarkeit, welche sich auf das Wesentliche bezog. Obwohl die Geschichten, welche sie erzählte, alles andere als schön waren. Manches davon wäre Material für einen Thriller gewesen. Dennoch, sie formulierte ihre Sätze so, als ob sie von Lektionen sprach. Sie hatte einige familiäre Verluste erlitten, es gab Vieles, was Traurigkeit in ihr Leben gebracht hatte, aber - was mir sehr auffiel - sie stellte es anders dar. Das Leben war nicht nur böse zu ihr, nein, es war damals so und zwar zu allen. Vielleicht unterscheidet das die damalige Generation von den Nachfolgenden. Wenn wir uns heute unterhalten, dann richtet sich der Fokus hauptsächlich auf uns. Etwas stimmt in unserem Leben nicht. Das Leben und auch das Glück meint es nicht gut mit uns. Alle anderen sitzen auf der Sonnenseite des Lebens, nur wir sitzen, seit wir uns erinnern können, im Schatten. Von Zeit zu Zeit beschließen wir, dass wir auf die Glücksseite gelangen könnten, wenn einige Punkte abgearbeitet, diese Probleme gelöst sind, ja, dann geht das Leben richtig los! Wir fokussieren uns auf das, was nicht funktioniert und öffnen Tür und Tor für neue Probleme, neue Schwierigkeiten und neue Fragestellungen, die uns wieder davon abhalten, endlich glücklich zu sein. Wie soll man denn dieses Leben lieben, wenn es sich nicht von der schönen Seite zeigt? Wer liebt denn schon das, was wir täglich erleben?
Ich habe 2006 mit drei Interviews begonnen, weil mich plötzlich dieses Thema gepackt hatte. Ich wollte hören, was die älteren Damen, die Großmütter, alles erlebt haben und was vielleicht für die jüngeren Frauen von Interesse sein könnte. Nicht umsonst gibt es in anderen Kulturen den Rat der Alten. Einer meiner Schwierigkeiten in diesem Projekt war, dass die ältere Generation auch zum Schweigen erzogen wurde und nicht viele Großmütter so begeistert von der Idee waren an einem Interview bei einer Psychologin teilzunehmen. So geriet das Projekt ins Hintertreffen und erst 2014 ist es mir wieder ins Auge, oder besser auf den Schreibtisch, gefallen. Jetzt war offenbar die richtige Zeit gekommen, um es zu Ende zu führen. Wir fanden noch sieben weitere bereitwillige, offene Damen und so konnte dieses Buch entstehen. Ich selbst habe in den letzten Wochen, seit ich mich intensiv mit dem Inhalt dieses Buches auseinander gesetzt habe, sehr viel gelernt. Vieles, was hier erzählt wird, hat mich tief berührt. Vieles hat aber auch nur ein Kopfschütteln über die heutige Zeit nach sich gezogen.
Worüber beschweren wir uns eigentlich?
Nehmen wir ein eher alltägliches Beispiel: Ist es tatsächlich wichtig, dass die Bahn ständig Verspätung hat? Das sind Gespräche, die kann man bei nahezu jeder Zugfahrt belauschen. Aber es ist für die Betroffenen ein ernstes Thema. Vielleicht haben wir aber auch mit der Tendenz es noch bequemer zu haben, uns selbst eine Falle gebaut. Möglicherweise ist das ein Faktor, der unseren täglichen Stress auslöst. Das Leben soll wie im Bilderbuch sein oder zumindest wie in der Werbung. Da sehen alle entspannt aus! Weitestgehend entspannt war auch die Dame, die in diesem Buch erzählt, dass sie sich von Norddeutschland auf den Weg zu ihrer Schwester nach Bayern gemacht hat. Mit dem Zug. Es war ihr von vornherein klar, dass es ungewiss sein würde, wann sie dort ankommt. Es war ihr bewusst, dass die Züge völlig überfüllt sein werden. Aber vor allem war ihr nicht klar, bis wohin sie mit diesem Zug mitfahren konnte, auf welchem Bahnsteig sie wohl übernachten muss und wie sie da wieder wegkommt. Genauer gesagt, sie kannte nur ihr Ziel, sonst nichts. Und das war normal für sie. Kennen wir denn unser Ziel?
So wie es für uns anscheinend normal ist durch die Gegend zu hetzen und uns über Verspätungen aufzuregen. Dagegen ist zunächst nichts zu sagen, wenn es nicht an unsere Gesundheit gehen würde, wenn die Burnout-Quote nicht täglich ansteigen würde. Da höre ich schon die kritischen Stimmen, die da rufen, wir sind doch gefangen in einem System, welches Zeit zu Geld macht oder es zumindest so bewirbt. Sind wir! Doch sollten wir überprüfen, wie viel von diesem System ist das System selbst und wie viel ist sozusagen „hausgemacht“. Wie viel entspringt unserer Vorstellung, wie das Leben zu funktionieren hat? Natürlich sind wir auf Leistung getrimmt, das haben in den meisten Familien unsere Eltern uns antrainiert. Sicher aus der Angst heraus wir könnten Nichtsnutze werden oder bleiben. Vieles haben uns unsere Eltern antrainiert. Wir wurden konditioniert! Immer Leistung bringen oder sich an vorgegebene Regeln halten, dann ist man ein gutes Kind. Mussten wir nicht als Kinder zu einer bestimmten Uhrzeit pünktlich daheim sein? Eine Regel, an die wir uns meistens gehalten haben. Interessanterweise haben wir sehr schnell, nach dem Auszug aus dem elterlichen Wohnbereich, uns umgewöhnt. Wir haben nicht monatelang zu der früher vorgegebenen Uhrzeit auf die Uhr geschaut und wollten uns auf den Heimweg machen.
Und jetzt tun wir so, als ob wir uns aus unserer Erziehung nicht befreien können - wir müssen leisten, pünktlich sein, schöne Dinge besitzen, uns für Geld aufopfern. Dabei ist es unser Ego, welches Probleme mit den Konsequenzen hat. Wenn wir ab morgen das Leben leben, welches wir wollen und welches wir lieben, gibt es sehr viel Kritik aus unserem Umfeld. Nicht mehr „Everybody´s Darling“ zu sein, das bedarf gewisser Übung.
So redet uns das Ego ein, was der tatsächliche Sinn des Lebens ist. Das ist sehr bequem nicht selbst darüber nachzudenken, sondern immer auf Trab gehalten zu werden mit schöner, reicher, besser, glücklicher...Dabei haben wir viel mehr die Möglichkeit, nach Innen zu hören und über unser Leben zu entscheiden als das bei den Damen in diesem Buch der Fall war.
Ich behaupte, dass die meisten unserer “Lebensbaustellen “ genau hieraus entstehen. Gibt es eine zufriedene Gesellschaft? Die Glücksforschung hat vor einigen Jahren festgestellt, dass wir zwar immer mehr arbeitserleichternde Maschinen haben, die uns das Leben leichter machen, wir aber trotzdem nicht glücklicher sind als vor 60 Jahren. Schade.
Die Frage ist doch viel weniger der Job, der besser sein könnte, die Beziehung, die besser sein könnte, das Einkommen, das besser sein könnte, sondern was nehmen wir wahr? Für die Menschen die Frage nach dem Sinn des Lebens zu beantworten, wird leider nicht funktionieren. Aber was möglicherweise eine gewisse Chance hat, ist den Blickwinkel auf das Leben zu verändern. Genau dieses soll in diesem Buch geschehen.
Eine Dame, geboren im Jahre 1927
Wichtigste Ereignisse
Also die wichtigsten, ich würde sagen die einschneidendsten Ereignisse, die mich sehr geprägt haben, ich glaube, das war vieles, sehr vieles. Das muss ich wirklich erst mal sortieren, wo fange ich an?
Es waren in der Kindheit schon sehr prägende Erlebnisse. In meiner Generation waren ja die finanziellen Verhältnisse noch ganz andere, als sie es heute sind und zu vergleichen mit der heutigen Armut, die ja auch groß ist, aber das war eine ganz andere. Mein Vater wurde nicht arbeitslos 1932, sondern arbeitete verkürzt und hat dann noch verdient; in der Woche zwischen 12 und 18 Mark und die Miete kostete 42 Mark und paar Pfennige. Damit musste man hinkommen, denn eine Sozialunterstützung gab es nicht. In der Familie bei uns, die nun bald ziemlich groß wurde, ist meine Mutter zum Sozialamt gegangen, musste dreimal hingehen und dann hat man ihr eine Mark angeboten. Da hat sie gesagt: „Ich bin kein Bettler, die Mark können Sie auch behalten.“
Also, das erst einmal so als Voraussetzung, wie das früher gelaufen ist. Meine Mutter hat dann die Wohnung ohne Beschluss meines Vaters gekündigt, hat eine andere gesucht, was sehr schwer war, die aber preiswerter sein sollte. Die hat sie dann auch gefunden, aber eben dann in Wedding, wo es ja politisch ziemlich hoch her ging. Und an unserem Haus war auch ein SA-Lokal, wo sich manches abgespielt hat. Da sind die Leute abends zusammengeschlagen worden. Ich erinnere mich, dass mein Vater manchmal das Radio laut gestellt hat, damit wir nichts von draußen hören. Was weiß ich, Schreie oder was zu hören war; und mir wurde dann auch gesagt: „Also, wenn du zur Schule gehst morgens, was immer du da hörst, du gehst weiter!“ Also so sind wir, bin ich aufgewachsen. In Berlin-Wedding und unter diesen Umständen. Ich habe zwischen U-Bahn Reinickendorfer Straße und Schwarzdorfstraße gewohnt. Bis zur Friedrichstraße fährt die Bahn, aber das Haus ist weg, da ist jetzt alles weg, alles zerbombt. Heute ist die Müllerstraße sehr befahren… Reinickendorfer Straße, da so etwa in der Höhe und da war ein Bunker. Das war zu der Zeit ein Gasometer. Der ist dann als Bunker ausgebaut worden. Da hab ich viele Nächte zugebracht, nachdem unser Haus abgebrannt war, durch Bombeneinschlag.
Davor haben wir `Im Engelbecken´ gewohnt. Weiß auch nicht zu welchem Bezirk das gehört, da war ich fünf Jahre alt. Von da sind wir rüber gezogen, in die Bäumstraße, und da bin ich dann eben aufgewachsen bis 1944 und dann bin ich mit der Firma verlagert worden, nach Erlangen.
Über den Umzug war mein Vater zwar sehr böse, weil es dieses politisch sehr explosive Gebiet war und eben auch das SA-Lokal da war. Eine Wohnung zu kündigen, ohne etwas anderes zu haben, das ist schon riskant, aber meine Mutter wollte eben nicht Schulden machen. Das war ganz eisernes Gesetz. Das war die Grundlage, wie wir aufgewachsen sind.
Wir haben dann auch sehr eng gewohnt: Zweizimmerwohnung, zu der dann 1938 noch meine Oma kam, weil mein Opa gestorben war. Die hatte sechs Kinder groß gezogen und kriegte keine Rente. Die konnte gar nicht allein existieren und so waren die Familien, also es war eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man zusammenlebte. Dadurch habe ich auch sehr prägende Eindrücke von meiner Großmutter gehabt, da sie mir viel aus ihrer Jugend erzählt hat. Wir haben dann nun in einem Zimmer geschlafen. Ich wurde nie müde zu fragen: „Oma, Oma erzähl mal noch was.“
Als ich fünf Jahre alt war, hatte ich noch ein sehr prägendes Erlebnis und zwar hatten meine Eltern den Neffen meines Vaters zu sich geholt. Meine Mutter kam nicht ganz gut mit ihm zurecht, aber mein Vater hat ihn zu sich genommen und der war damals etwa 17 oder 18 Jahre alt, also Sturm und Drang-Zeit, und wie gesagt, mein Vater hat verkürzt gearbeitet. Er hatte wohl keine Arbeit und da war der immer unterwegs und hat die Haken-Kreuz Bande runter gezogen. Eines Tages sind wir mal aus der Wohnung gekommen, meine Mutter und ich, und da rannten mein Vater und mein Cousin an uns vorbei und mein Vater rief nur: „Ihr habt niemanden gesehen!“ Wir wohnten da im Gartenhaus und mussten durch so einen großen Hausflur gehen, wie es sie oft in Berlin gibt, mit den Scheiben am Ende des Flures. Da sahen wir ein Polizeiauto vorfahren. Polizisten, die hatten früher einen offenen Wagen und die konnten dann hinten raus springen. Die Polizei mit ihren Mützen, mit Sturmband und so kamen uns entgegnen gestürmt und riefen immer: „Wo ist der Lange?“ Mein Cousin war sehr groß und dann sagte meine Mutter ganz erstaunt: „Was für ein Langer?“, „Da ist doch gerade ein Langer hier rein gelaufen“, „Ich habe hier keinen gesehen. Von wo kommen die her?“, „Ja von da hinten.“ Meine Mutter drückte meine Hand fest. Die musste natürlich auch Angst gehabt haben, dass ich nun irgendwas sage, fünfjähriges Kind, aber ich wusste, wenn mein Vater das sagte, dann hielt ich mich dran. Dann sind die vorderen Polizisten raus gelaufen und inzwischen waren mein Vater und mein Cousin natürlich in der Wohnung verschwunden, sodass sie die nicht bekommen haben. Aber die wussten, wer es war und haben ihn dann 1933 sofort in den Arbeitsdienst eingezogen, um ihn arbeiten zu lassen, sodass er Tuberkulose gekriegt hat. 1939 ist er daran gestorben. Dieses war einmal ein Erlebnis. Mein Vater war von vornherein gegen das Naziregime und so bin ich halt erzogen worden. Es hieß dann zu Hause: Was hier bei uns zu Hause gesprochen wird, geht draußen niemanden etwas an! Dadurch bin ich auch zum Schweigen erzogen worden.
Meine Schwester, die sieben Jahre jünger war, bei der war alles ganz anders. Wenn da politisch was gesprochen wurde in der Wohnung und meine Schwester tauchte auf, dann hieß es immer: „Oh Vorsicht, der Ofen!“ Später hat meine Schwester erzählt: „Ach, das weiß ich, dass ihr das immer gesagt habt, da hab ich meine Ohren immer besonders lang gemacht“.
Ja, das sind nun schon von klein an diese Erinnerungen, die mich doch geprägt haben. Dann kamen noch andere Erlebnisse hinzu. Nach meiner Lehre wurde ich beim Anwalt und Notar nicht übernommen. Meine Mutter arbeitete in dieser Zeit schon bei Siemens. Sie hat dann mit dem Personalchef gesprochen und so habe ich dann angefangen bei Siemens als „Anfängerin“, wie das damals hieß, in der Büroarbeit zu arbeiten. Mit dieser Firma bin ich dann 1944 verlagert worden, nach Erlangen. Mein Vater ist noch hingegangen zum Personalchef und wollte Einspruch erheben, weil ich erst 17 Jahre war. Man war ja damals nicht ganz so weit wie heute die jungen Leute. Aber der Personalchef hat gesagt: „Ja, es tut mir leid, wenn sie nicht mitgeht, dann muss ich sie melden, dann wird sie irgendwie eingezogen, als Arzthelferin oder was weiß ich.“, und mein Vater hat dann gesagt: „Nehmen Sie sie mit.“
Dann bin ich nach Erlangen gekommen. Zu dieser Zeit kamen die Kämpfe immer näher. Wir wurden dann zur Untermiete bei irgendwelchen Familien untergebracht und wurden dann bei einem Betriebsheim angemeldet. Da ging man dann abends hin und bekam nochmal eine Mahlzeit. Mittags aßen wir in der Kantine und so haben wir dann dort das Kriegsende erlebt.
Das weiß ich noch, wie ich da stand am Morgen, großer Anschlag von den Amerikanern im April und wie man aufgeatmet hat: Jetzt ist es vorbei, du hast es überstanden! Ich steh‘ ja heute noch auf den Standpunkt, dass es ein Wunder war. Alle die überlebt haben, haben irgendwie ein Wunder für sich erlebt! Allein die vielen Bombenangriffe in Berlin… also wir sind durch brennende Teile durchgelaufen, wo die Luft gebrannt hat.
Die Amerikaner haben ja ganz systematisch Berlin bombardiert. Die haben zum Beispiel an der Straße…Moment jetzt muss ich auch erst mal überlegen…Schwarzkopfstraße, die Chausseestraße, an der Chausseestraße Ecke Wiesenstraße, da haben die an der einen Straßenseite der Chausseestraße aufgehört mit der Bombardierung und in der nächsten Nacht, genau an der Stelle auf der anderen Straßenseite weiter bombardiert. Ganz systematisch wurde Berlin zerstört.
Ich habe dann in dem besagten Bunker gesessen. Da haben wir dann drei Nächte auf dem Stuhl gesessen und zwar Tag und Nacht. Also tagsüber sind wir dann rausgegangen und haben geguckt, was an der Wohnung war. Wir hatten also insofern Glück, dass unser Seitenflügel nicht abgebrannt ist, aber das war dann später auch ziemlich kaputt. Es war sehr zerstört nach dem Krieg.
Als ich dann wieder nach Berlin zurück kam, war mein Vater inzwischen verstorben. Wir konnten von unserem Schlafzimmer aus an die Brandmauer. Das klappte nach oben so ein Stück auseinander, wo wir dauernd hätten irgendwie runter fallen können, aber da lebten wir halt. Der Wohnraum war dann ja in ganz Berlin sehr knapp. Es war alles kaputt.
Ich habe in Erlangen bei Siemens gearbeitet und nach dem Krieg, gleich die erste Zeit, es gab ja keinen Briefverkehr, keine Korrespondenz. Es dauerte eine Zeit, da gab es dann alles wieder. Die große Mutter Siemens, Sozialfirma, hat die drei jüngsten Mitarbeiter entlassen. Wir wurden zum Betriebsarzt gerufen und dessen Frau arbeitete als Managerin beim Roten Kreuz. Er hatte ihr wohl erzählt, dass wir, drei Jüngsten, entlassen werden. Ich war die Allerjüngste, ich wurde zum Kriegsende Anfang Mai 18. Die andere war 20 und die andere war 23. Wir drei wurden entlassen. Da wurde uns angeboten, dass wir dort beim amerikanischen Roten Kreuz arbeiten könnten, bei seiner Frau eben. Ist uns ja nichts anderes übrig geblieben! Ich hatte ja nichts! Wir haben dann zugesagt und dann hieß es, wir würden als Serviererin arbeiten, aber wir waren nur Putzfrauen, mehr nicht. Mit deren großen Tick, Reinigungstick. Es war sehr deprimierend, wenn wir durch den großem Raum, der etwa so groß wie hier war, wenn wir dann mit unseren Eimerchen und Putzlappen durch die Gegend zogen. Überall dieses Gepfeife und Gejohle von den amerikanischen Soldaten, war ja nicht sehr schön.
Das ging eine Weile ganz gut. Da weiß ich nicht, ob ich das in so Einzelheiten erzählen soll. Das waren ganz besondere Umstände. Ich wurde dann am 1. November von einem Amerikaner vergewaltigt, konnte aber gar nichts machen, weil dieser Amerikaner immer an meiner Seite war und alle glaubten wir hatten ein Verhältnis miteinander, während ich innerlich an jemanden gebunden war und auf die Nachricht wartete, dass er auch den Krieg heil überstanden hatte. Ich bekam am 31. Oktober die Nachricht, dass er heil zu Hause angekommen ist und in der Nacht am 1. November wurde ich vergewaltigt - mit Folgen.
Dieser Amerikaner war dann nicht mehr in Erlangen. Er war schon mit der Truppe verlegt worden, nach Wiesbaden und diese andere Kollegin von mir, die 23-Jährige, die war mitgegangen nach Wiesbaden. Ja, die konnte Englisch besser als ich. Ich hab‘ dann erst noch Unterricht genommen, bei einem Studenten, der auch in Erlangen geblieben war. Zu der Kollegin hatten wir noch Kontakt. Als ich merkte, dass es Folgen hatte, habe ich mich an sie gewandt und sie hat ihn dann auch benachrichtigt. Er ist dann auch nur noch einmal gekommen und hat dumm daher geredet und hat mir dann letztendlich gesagt, er freue sich über ein Kind in Deutschland. Er würde aber in Kürze nach Amerika zurückkehren. Sein Vater läge im Sterben. Es war eine kurze Zeit, die er in Deutschland verbringen würde. Seine Familie würde ihn erwarten und dann hab ich von ihm nie wieder etwas gehört und ich wollte auch nicht.
Ja, das war es also. Welches Gefühl ich hatte gleich nach dem Krieg, als ich wusste, ich hab alles überstanden sind mir die Flügel geschnitten worden. Ich war dann eingeengt. Mein Vater war gestorben, meine Mutter war mit meiner Schwester alleine in Berlin. Ich hatte dann nach meiner Schwester noch einen Bruder bekommen, der mit 2 dreiviertel Jahren an Hirnhautentzündung gestorben war. Was im Nachhinein gut war. Er wäre so geschädigt gewesen und auch die Zeit, die wir nach dem Krieg so erlebt haben; es war gut, dass er gegangen war.
Aber ich war in Erlangen. Dann habe ich mich in Adelshofen angemeldet. Da gab es eine Mission, ein Mutterheim, wo Mütter eigentlich hingehen, die entbunden hatten und dann sehr schwach waren und die aufgepäppelt werden sollten. Dort waren auch junge Frauen, die dort ihre Kinder zur Welt brachten. Das hab ich dann auch getan. Ich habe sie in einem Kinderheim angemeldet. Ich konnte nicht in meinem kleinen Untermietzimmer mit einem kleinen Kind sein und ich musste ja auch arbeiten.
Dann schrieb meine Mutter, ich solle nach Wedding kommen, sie wäre so allein und ich war ja sehr abhängig, und so bin ich im Oktober zurück. Also meine Tochter wurde dann im Juli 1946 geboren und ich bin im Oktober 1946 nach Berlin. Ach, zwischendurch als ich merkte, dass ich schwanger bin, da bin ich zum Gesundheitsamt in Erlangen gegangen und hab das vorgetragen und da habe ich auch viel Böses erlebt, das muss ich sagen. Bemerkungen sind da gemacht worden und geholfen wurde mir natürlich nicht. Das war ja in Berlin anders. Da gab es Massenvergewaltigungen, da wurde den Frauen anders geholfen. Aber ich konnte ja nichts beweisen. Ich bin ja dann nach Berlin erst mal alleine zurückgegangen und wollte erst mal die Lage klären. Das habe ich denn auch zu meiner Mutter gesagt. Ich würde versuchen, da Arbeit zu finden und sie könnte dann bei meinem Kind bleiben. Ich würde dann mehr verdienen. Daraus wurde nichts, es gab eine Währungsreform! Am Anfang durften wir aus Berlin kein Geld überweisen. Es ging einfach nicht und bis das dann in Gang kam. Es war bei den amerikanischen Behörden sehr langsam. Das dauerte viele Monate; weiß gar nicht wie lange. Da war ja in diesem Jahr die Luftbrücke dann.
Ich hatte dann 300 Mark Schulden beim Kinderheim, 50 Mark waren monatlich zu zahlen und ich konnte nicht überweisen. Ich habe das Geld immer zurück gelegt, aber ich hatte keine Möglichkeit. Ein paar Mal habe ich über die Firma Siemens Geld hingeschickt. Also kurz und gut, jetzt bin ich doch ausführlich geworden. Im Februar 1947 habe ich endlich eine Arbeit bekommen, über das englische Arbeitsbüro und habe dann in der Zivilverwaltung für Engländer, englische Familien also, besetzte Häuser, in dieser Verwaltung habe ich gearbeitet. Dann bekam ich im April 1947 die Nachricht, dass das Kind operiert werden muss. Da habe ich sofort telegrafisch erst mal meine Genehmigung dazu gegeben. Über Kollegen - die haben über Beziehungen mit einem Chauffeur, der für den General fuhr, es ging alles um sieben Ecken - habe ich dann eine Genehmigung bekommen mit dem Zug nach Erlangen zu fahren. Ich durfte allerdings meinen Mund nicht aufmachen, dass man nicht merkt, dass ich deutsch bin. Dann bin dort gewesen und da lag sie dann und die Schwestern dort hätten mir am liebsten das Kind in den Arm gedrückt: Da nehmen Sie es mit! Aber das konnte ich nicht. Ich bemühe mich weiter, aber sie musste erst mal in Behandlung bleiben in Nürnberg. Ich bin dann nach Berlin zurück und die Währungsreform war vorbei. Ich hatte zu dem Mann von Siemens in Erlangen, der für die Berliner zuständig war, der diese Untermietzimmer besorgt hatte, zu dem hatte ich ganz guten Kontakt. Ich war da in der Familie gut aufgenommen worden und dort habe ich auch gewohnt. Als ich die Kleine dann besucht habe, dachte ich, es wäre schlau ihn darum zu bitten, dass er sich doch etwas um die Kleine kümmern soll. Dann hat das Heim den Eindruck, das Kind ist nicht alleine da und das war genau das Verkehrte.
Er war 40 Jahre älter. Der war selber von seiner Mutter in ein Kinderheim gegeben worden und hatte Kinderheimzeiten, ganz arme Kinderheimzeiten. Er hat sich dann in meiner Abwesenheit immer wieder mit der Diakonissin unterhalten, ob sie das Kind nicht zur Adoption geben könnten, ob das nicht gut wäre und die war froh, dass das so angeboten wurde. Dann bekam ich eines Tages die Nachricht von diesem Herrn, da wäre ein Elternpaar, die hätten im vergangenen Jahr einen kleinen Jungen adoptiert und die würden auch gerne ein kleines Mädchen adoptieren und wollten sogar. Inzwischen war sie etwas über ein Jahr, hab noch ein Foto davon. Die würden gerne dieses kleine Mädchen haben. Wie kommen die da drauf das anzubieten? Habe mich dann bei der Diakonissin beschwert und da kam raus, dass das gar nicht stimmte. Dass zwar ein Ehepaar da war, die ein Kind adoptieren wollten, aber dass meine Tochter da überhaupt nicht im Gespräch war. Das hat mir wieder dieser Herr so beibringen wollen, dass ich sie doch weggeben soll usw. Ich hatte am Anfang meine Genehmigung gegeben. Dazu musste ich auch zum Notar gehen. Dann stellte sich heraus, dass das gar nicht stimmte und dann habe ich immer geschrieben, sie möchten von der Genehmigung keinen Gebrauch machen. Die Genehmigung wäre nur für dieses Ehepaar gewesen und ich hoffte immer noch, dass ich das Kind zu mir nehmen könnte. Inzwischen hatte ich meinen Mann kennengelernt. Dieses andere Verhältnis, welches ich hatte, wo auch an Heirat gedacht worden war, und auf den ich eigentlich durch den Krieg hindurch gewartet hatte, das ist dann auseinander gegangen, weil mein Körper ihn geekelt hat nach der Vergewaltigung. Irgendwann habe ich meinen Mann kennen gelernt. Mit dem bin ich dann in Berlin von Kinderheim zu Kinderheim gezogen und wollte immer ein Platz für sie haben, aber ich fand keinen.
Plötzlich kam eine Nachricht, eine Karte: Ich möchte doch nochmal eine Genehmigung geben. Es wäre erneut ein Ehepaar da. Die hätten allerdings nicht die Zeit. Ich möchte mich also beeilen und meine Genehmigung geben, dass das Kind jetzt adoptiert werden könnte. Das war kurz nach der Währungsreform. Ich war ja nicht einmal volljährig. Man wurde damals mit 21 Jahren erst volljährig, d. h. also das Kind hatte einen Vormund in Berlin und dann hab ich mich mit dem in Verbindung gesetzt und er hat gesagt: „Wenn Sie nichts unterschreiben, kann überhaupt nichts passieren.“ Am 15. September habe ich Geld bekommen und am Abend bin ich nach Erlangen gefahren, komme am nächsten Morgen ins Kinderheim und da ist so eine Helferin, die guckt mich an und sagte: „Ja, wo kommen Sie denn her?“, „Ich will meine Tochter besuchen.“
„Moment, ich hol‘ sie“. Dann kam sie und es stellte sich heraus, dass meine Tochter seit drei Tagen weg war. Die haben sie ohne weitere Genehmigung dem Ehepaar mitgegeben, weil die eine Gutsaussage hatten. Er war im Krieg in Frankreich, der Mann, in Gefangenschaft geraten und war dort geblieben und hatte dort von ihrem dortigen Pfarrer ein Schreiben, gutes Ehepaar usw., und daraufhin haben die, ohne weitere Kontrollen, das Kind mit nach Frankreich gegeben.
Ich stand da und wusste nun. Es war eine schreckliche Situation. Sie war nicht da, sie war mitgegeben worden. Was sollte ich machen? Ich konnte ihr nicht mehr bieten als ein Kinderheim, auch in Berlin, und dort war ein Elternpaar. Und dann hab ich hin und her überlegt. Es war ja niemand da, mit dem ich mich hätte besprechen können. Ich hatte niemanden dort und habe dann mit dem Vormund in Berlin telefonieren wollen. Der war in Urlaub und dann habe ich letztendlich meine Genehmigung gegeben. Ich hatte den Eindruck, das ist für das Kind das Beste. Was konnte ich ihr bieten? Dann habe ich von dem Kind nichts mehr gehört. Das ist wohl mit das einschneidendste Erlebnis gewesen, das ich hatte und wie gesagt, die Diakonissin hatte mir versprochen, zwei Mal im Jahr von dem Kind Nachricht zu geben und eventuell auch ein Bildchen zu schicken und daran habe ich mich dann fest gehalten.
Und dann war da ein Weihnachten. Ich weiß jetzt nicht, war es 1949, es muss wohl 1950 gewesen sein, da habe ich ein Negerpüppchen hingeschickt. Zuvor muss ich erwähnen, dass ich weder am Geburtstag noch an Weihnachten jemals eine Nachricht bekommen hatte und immer wieder darum gebeten hatte. Es wäre untergegangen. Ich antwortete, dass ich immer noch Wert drauf legen würde. Dann kriegte ich die Antwort von der Diakonissin, das müsste doch jetzt wohl mal aufhören. An dieser Stelle muss ich nochmal kurz zurückgreifen: Als ich bei dem Notar die Abtretungserklärung unterschrieben habe, da hat er zu mir gesagt und hat eben ganz böse mitgespielt: „Ich geh jetzt mal aus dem Zimmer, hier ist die Adresse.“, und da habe ich mir die Adresse notiert. Er wollte wohl ganz sicher gehen, denn in der Abtretungserklärung waren die Namen des Elternpaares und auch die Adresse mit angegeben worden, was ja gar nicht üblich war. Das hat er gemacht, sodass ich die Adresse hatte. Dann habe ich also an Weihnachten geschrieben und dieses Negerpüppchen geschickt. Ich habe noch gestrickt, gehäkelt, gemacht mit Kleidung. Die brauchten dem Kind natürlich nicht zu sagen, woher das kommt, aber ich hätte das Gefühl, dass sie etwas in der Hand hat, was von mir stammt. Darauf kriegte ich einen ganz bösen Brief von dem Mann: Neger hätten ja wohl im Leben schon genug angerichtet. Die hätten die Negerpuppe in den Müll. Sie wollten nicht, dass das Kind mit einem Negerpüppchen spielt! Aber ich konnte ja nichts machen bis 1951. Da kriegte ich aus Amerika einen Brief, sie wären inzwischen ausgewandert nach Amerika. Der Brief war aber ohne Absender. Die Frau hatte einen Bruder in Amerika und er hat dann den Brief abgeschickt und da war dann nun jeglicher Kontakt abgebrochen.
Im Januar 1950 bin ich für eineinhalb Jahre arbeitslos geworden und da hab ich mich bei einem Anwalt beworben. Ich bin Anwaltsangestellte und ich hab sehr gut geschrieben. 240 Anschläge reichten nicht. 260 schrieb damals die Meisterin, also die Vorgesetzte, auf der Schreibmaschine.
Die Ansprüche waren damals ganz andere. Natürlich hatte man keine Computer, man hatte kein Gerät, in das man rein sprechen konnte. Ja, so war das.
Wir haben dann 1955 geheiratet und sind im August 1959 aus Berlin raus gegangen, weil beruflich konnte mein Mann nichts in Berlin finden. So sind wir nach Köln gegangen. Im September 1959 meldete sich unsere Tochter an. Das war natürlich auch wieder keine gute Situation. Wir wohnten da zur Untermiete, wo man nicht mal ein Babykörbchen hätte hinstellen können, weil es so klein war. Wir sind dann am 30. April 1960 in ein Wochenendhaus bei Köln umgezogen und am 5. Mai wurde unsere Tochter geboren, alles sehr improvisiert.
Wir haben es geschafft und unsere Tochter war auf den Tag genauso alt, wie meine andere Tochter als ich nach Berlin ging. Da kriegte ich eine Karte von der Tante des Adoptivvaters, dass ich gesucht werde. Wir hatten unsere Wohnung in Berlin untervermietet, weil wir immer nach Berlin zurückkehren wollten und damals war Datenschutz noch nicht so angesagt, das kannte man ja gar nicht. Die sind dann einfach zum Einwohnermeldeamt gegangen und haben nachgefragt, kriegten dann unsere Berliner Anschrift und mit den Untermietern standen wir im Kontakt. Die haben ihnen dann unsere neue Anschrift bei Köln gegeben.
Da kriegte ich also eine Karte, dass ich gesucht werde und sie könnte mir sagen, das Kind wäre gut bei ihrem Neffen untergebracht. Das war dann 1960. Da bin ich nach Berlin geflogen und dann haben meine Schwiegereltern ihr Enkelkind zum ersten Mal gesehen. Wir haben dann dort auch gewohnt und haben uns mit den Adoptiveltern getroffen. Auf der Treppe kam mir schon der Mann entgegen und sagte zu mir: „Also halten Sie sich bitte zurück, man kann manches tun für sein Kind.“, und ich habe gesagt: „Was man tun kann, habe ich ja wohl bewiesen.“ Dann stand ich dem Kind, die war damals 13 Jahre, gegenüber. Sie sieht mir sehr ähnlich. Bei der Geburt hat die Hebamme gesagt: „So eine Ähnlichkeit zwischen Mutter und Kind habe ich noch nicht erlebt.“