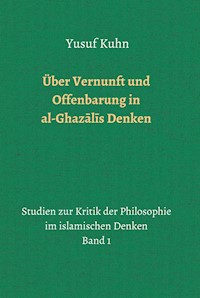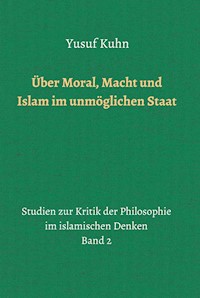
5,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Studien zur Kritik der Philosophie im islamischen Denken
- Sprache: Deutsch
Ist die Krise der modernen Moral und Moralphilosophie in der Tat so tief, dass sich in deren Rahmen diese Krise weder angemessen verstehen noch irgendein gangbarer Ausweg aufweisen lässt? Welche Ressourcen stehen dem islamischen Denken zur Verfügung, um einen Beitrag zur gemeinsamen Suche nach einem Ausweg aus der globalen Krise der Moral leisten zu können? ----- Der »islamische Staat« ist, gemessen an irgendeiner Standarddefinition dessen, was den modernen Staat ausmacht, sowohl eine Unmöglichkeit wie auch ein Widerspruch in sich. - Wael Hallaq ----- Die rivalisierenden Ansprüche auf Wahrheit von konkurrierenden Traditionen der Untersuchung sind für ihre Rechtfertigung abhängig von der Angemessenheit und der Erklärungskraft der Geschichten, welche die Ressourcen jeder dieser Traditionen im Widerstreit ihre Anhänger zu schreiben befähigen. - Alasdair MacIntyre
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Yusuf Kuhn
Über Moral, Macht und Islam im unmöglichen Staat
YUSUF KUHN
Über Moral, Macht und Islamim unmöglichen Staat
Studien zur Kritik der Philosophieim islamischen Denken
Band 2
Bibliografische Information der
Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek
verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind
im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-7482-3015-1
Der Zweck des Vereins ist die Förderung des
wissenschaftlichen Austausches, der Übersetzung und/oder
Veröffentlichung von Büchern und Neuen Medien auf
gemeinnütziger Basis, die dem Dialog, dem internationalen
Friedensgedanken, der Völkerverständigung sowie dem Abbau
von Vorurteilen zwischen unterschiedlichen Kulturen dienen.
www.vdmev.de
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons
Lizenz vom Typ Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine
Bearbeitungen 4.0 International.
Eine Kopie dieser Lizenz ist einzusehen unter:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.
1. Auflage 2019
ISBN Taschenbuch: 978-3-7482-3015-1
ISBN Hardcover: 978-3-7482-3016-8
ISBN e-Book: 978-3-7482-3017-5
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
Umschlaggestaltung & Satz: Yusuf Kuhn
Der islamische Staat« ist,gemessen an irgendeiner Standarddefinition dessen,was den modernen Staat ausmacht,sowohl eine Unmöglichkeit wieauch ein Widerspruch in sich.
Wael Hallaq
Die rivalisierenden Ansprücheauf Wahrheit von konkurrierendenTraditionen der Untersuchung sind für ihreRechtfertigung abhängig von derAngemessenheit und der Erklärungskraft der Geschichten,welche die Ressourcen jeder dieserTraditionen im Widerstreit ihreAnhänger zu schreiben befähigen.
Alasdair MacIntyre
INHALT
VORWORT
ERSTER TEILUNMÖGLICHER STAAT?
1 DER UNMÖGLICHE STAAT: ISLAM, POLITIK UND DIE MORALISCHEMISERE DER MODERNITÄT
2 ÜBER WISSEN, MACHT UND INTELLEKTUELLE SKLAVEREI:EIN INTERVIEW MIT WAEL HALLAQ
ZWEITER TEILUNMÖGLICHE MORALPHILOSOPHIE?
3 MODERNE MORALPHILOSOPHIE:AUSWEG ODER IRRWEG?
4 MORALPHILOSOPHIE – EIN IRRTUM?
5 MORAL, VERNUNFT UND GRÜNDE
6 MORAL NACHDER TUGEND:VERNUNFT UND TRADITION
ANHANG
ZUR PERSON VON WAEL B. HALLAQ
AUSFÜHRLICHES INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
ERSTER TEIL UNMÖGLICHER STAAT?
1 DER UNMÖGLICHE STAAT: ISLAM, POLITIK UND DIEMORALISCHE MISERE DER MODERNITÄT
1.1 Einführung
1.1.1 Die moralische Dimension
1.1.2 Staat, Islam, Moral: Worum geht es?
1.2 Einleitung
1.2.1 These der Unvereinbarkeit von Islam und modernem Staat
1.2.2 Wie wird die These der Unvereinbarkeit entfaltet?
1.3 Prämissen
1.3.1 Kolonialismus, Staat, Scharia
1.3.2 Projekt der Aufklärung und moralische Ressourcen
1.3.3 Begriff des Paradigmas
1.3.4 Paradigma und islamische Gouvernanz
1.3.5 Nostalgie und Fortschrittsideologie
1.4 Der moderne Staat
1.4.1 Der Staat ist ein spezifisches historisches Produkt
1.4.2 Souveränität und ihre Metaphysik
1.4.3 Gesetzgebung, Recht und Gewalt
1.4.4 Die rationale bürokratische Maschine
1.4.5 Kulturelle Hegemonie oder die Politisierung des Kulturellen
1.4.6 Verflechtungen
1.5 Gewaltenteilung: Herrschaft des Rechts oder Herrschaft des Staates?
1.5.1 Gewaltenteilung im Nationalstaat
1.5.2 Das Paradigma der islamischen Gouvernanz
1.5.2.1 Souveränität im Lichte der Scharia
1.5.2.2 Scharia und Herrschaft des Rechts
1.5.3 Vergleiche und Schlussfolgerungen
1.1 Das Rechtliche, das Politische und das Moralische
1.1.1 Moralität und der Aufstieg des Rechtlichen
1.1.2 Opfer und der Aufstieg des Politischen
1.1.3 Die moralische Dimension: eine abschließende Bemerkung
1.2 Politisches Subjekt und moralische Technologien des Selbst
1.2.1 Die Produktion der Staatssubjekte
1.2.2 Die moralischen Technologien des Selbst
1.2.3 Unvereinbarkeit der Subjektivitäten
1.3 Belagernde Globalisierung und moralische Ökonomie
1.3.1 Eine globalisierte Welt
1.3.2 Die moralische Ökonomie des Islam
1.3.3 Abschließende Bemerkungen über Dilemmata
1.4 Zentralgebiet des Moralischen
1.4.1 Hauptsächliche Inkompatibilitäten
1.4.2 Ein Ausweg?
1.4.3 Handlungsoptionen
2ÜBER WISSEN, MACHT UND INTELLEKTUELLE SKLAVEREI:EIN INTERVIEW MIT WAEL HALLAQ
2.1 Wissen als Politik mit anderen Mitteln
2.1.1 Vorbemerkung von Hasan Azad zu Teil 1 des Interviews mit Wael Hallaq in Jadaliyya
2.1.2 Interview mit Wael Hallaq Teil
2.2 Muslime und der Pfad der intellektuellen Sklaverei
2.2.1 Vorbemerkung von Hasan Azad zu Teil 2 des Interviews mit Wael Hallaq in Jadaliyya
2.2.2 Interview mit Wael Hallaq Teil
ZWEITER TEILUNMÖGLICHE MORALPHILOSOPHIE?
3 MODERNE MORALPHILOSOPHIE: AUSWEG ODER IRRWEG?
3.1 Trennung von Sein und Sollen
3.2 Theologische Ursprünge der modernen Moral
4 MORALPHILOSOPHIE - EIN IRRTUM?
4.1 Aufgabe der Moralphilosophie
4.2 Falsches Verständnis der Moral
4.3 Die Moralphilosophie beruht auf einem Irrtum!
4.4 Warum überhaupt moralisch sein?
5 MORAL, VERNUNFT UND GRÜNDE
5.1 Autonomie der Ethik
5.2 Ethik der Autonomie und Metaphysik der modernen Welt
5.3 Platonismus von Gründen
5.4 Vernunft als Vermögen der Prinzipien: Kant
5.5 Selbstgesetzgebung der Vernunft?
5.6 Autonomie bedarf der Heteronomie
5.7 Gründe als Gegenstand der Vernunft
5.8 Zwischen Subjektphilosophie und Ontologie
6 MORALNACH DER TUGEND: VERNUNFT UND TRADITION
6.1 MacIntyre: Ein marxistisch-aristotelischer Thomist?
6.2 Moralische Ressourcen
6.3 Kritik der modernen Moralphilosophie
6.3.1 Hauptthesen von After Virtue
6.3.1.1 Sieben zentrale Thesen
6.3.2 Gedankenexperiment und Katastrophe der Moral
6.3.3 Moralischer Widerstreit und Emotivismus
6.3.4 Emotivismus und gesellschaftliche Wirklichkeit
6.3.4.1 Ästhet, Manager und Therapeut
6.3.4.2 Das moderne Selbst
6.3.5 Das Projekt der Aufklärung zur rationalen Rechtfertigung der Moral
6.3.6 Gründe für das Scheitern des Projekts der Aufklärung zur Rechtfertigung der Moral
6.3.7 Folgen des Scheiterns des Projekts der Aufklärung
6.3.7.1 Utilitarismus und kantische Pflichtethik
6.3.7.2 Rechte, Protest und Entlarvung
6.3.7.3 Expertentum der Manager und Bürokraten
6.3.8 Tatsache, Experte und moralisches Subjekt
6.3.9 Soziale Physik
6.3.10 Nietzsche oder Aristoteles?
6.3.10.1 Anthropologischer Blick
6.3.10.2 Nietzsches Entlarvung der Moral
6.3.10.3 War es richtig, Aristoteles zu verwerfen?
6.4 Tugenden und das gute Leben
6.5 Nietzsches großer Mensch ganz klein
6.6 Liberaler Individualismus oder aristotelische Tradition
6.6.1 Drei Einwände
6.6.2 Wiederbelebung des moralischen Lebens
6.7 Kritiken und Einsichten im Rückblick
6.7.1 Philosophie und Geschichte
6.7.2 Tugenden und Relativismus
6.7.3 Moralphilosophie und Theologie
6.8 Wessen Gerechtigkeit? Welche Rationalität?
ANHANG
ZUR PERSON VON WAEL B. HALLAQ
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
die in diesem Buch versammelten Texte sind Teil eines größeren Projektes, das sich mit der Kritik der Philosophie im islamischen Denken befasst. Es trägt den Titel: alastu-Projekt – Studien zur Kritik der Philosophie im islamischen Denken.Eine Erläuterung dieses Titels1 und eine knappe Vorstellung des Projektes2 finden sich auf der Website3 des Projektes. Die Texte, die aus diesem Projekt hervorgehen, sollen in Gestalt von Büchern wie dem vorliegenden und auf der Website des Projektes alastu.net veröffentlicht werden.
Das vorliegende Buch ist der zweite Band der Reihe Studien zur Kritik der Philosophie im islamischen Denken. Bisher erschienen ist Band 1 mit dem Titel Über Vernunft und Offenbarung in al-Ghazālīs Denken.4 Weitere Bände sind in Vorbereitung und Planung.
Wie das Projekt als Ganzes so verstehen sich auch diese Texte als work in progress. Sie liefern also keine abschließenden Ergebnisse, sondern bieten vielmehr einen schlaglichtartigen Einblick in die Werkstatt einer fortschreitenden Arbeit, deren derzeitigen und vorläufigen Stand sie widerspiegeln. Die Texte könnten daher auch als Vorstudien bezeichnet werden.
Der vorliegende Band 2 trägt den Titel Über Moral, Macht und Islam im unmöglichen Staat, der etwas rätselhaft erscheinen mag. Denn: Was ist wohl ein unmöglicher Staat? Dieser „unmögliche Staat“ im Titel verdankt sich einem Buch von Wael Hallaq5, das eben diesen Titel trägt und in diesem Band ausführlich dargestellt und behandelt wird: The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament.6 Dieser Titel lautet vollständig ins Deutsche übertragen: Der unmögliche Staat. Islam, Politik und die moralische Misere der Modernität. Es gibt bislang leider keine deutsche Übersetzung dieses Buches, was neben der gewichtigen Bedeutung und Brisanz des Inhalts, in dessen Zentrum die Erörterung des modernen Staates und dessen Verhältnis zum Islam steht, eine eingehende Darstellung rechtfertigt.
Diese Darstellung füllt den ersten Teil, der mit Unmöglicher Staat? überschrieben ist, und damit etwa die Hälfte des Bandes. Im zweiten Teil mit dem Titel Unmögliche Moralphilosophie? werden im Anschluss an die Ausführungen von Wael Hallaq grundlegende moralphilosophische Fragen auf den Spuren der Moralphilosophen H. A. Prichard, Charles Taylor, Charles Larmore und insbesondere Alasdair MacIntyre behandelt.
Das erste Kapitel ist der Befassung mit Wael Hallaqs The Impossible State gewidmet und hat dessen Titel ererbt: Der unmögliche Staat. Islam, Politik und die moralische Misere der Modernität. Hallaq vertritt die These, dass der moderne Staat und der Islam nicht vereinbar sind. Der unmögliche Staat (The Impossible State) des Titels ist also der moderne und zugleich islamische Staat. Die tieferen Gründe für diese Unvereinbarkeit liegen nicht, wie das Thema des Staates vermuten lassen könnte, allein auf der politischen Ebene, sondern im wesentlichen auf der moralischen Ebene. Daher besitzen in dieser Untersuchung moralphilosophische Überlegungen und insbesondere die Diagnose einer tiefen moralischen Krise der modernen westlichen Zivilisation einen zentralen Stellenwert. So erklärt sich auch der Untertitel: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament (Islam, Politik und die moralische Misere der Modernität). Und diese Krise ist so tief, dass nicht nur der moderne islamische Staat, sondern der moderne Staat selbst und darüber hinaus das Überleben der Menschheit insgesamt fraglich werden.
Die Krise übergreift westliche und islamische Zivilisation. Sie strahlt vom Westen auf den ganzen Rest aus, ist universell und verlangt nach entsprechenden Lösungen. Schließlich haben, wie Hallaq resümiert, Muslime kein Monopol auf Krise. Welche Rolle spielt dabei der moderne Staat selbst und sein Verhältnis zum Islam? Welche Bedeutung kommt der moralischen Grundlagenkrise der westlichen Kultur und deren Verhältnis zum Islam zu? Gibt es einen Ausweg aus der universellen Krise? Hallaq wirft diese Fragen auf und stellt sich ihnen, übrigens nicht aus einer muslimischen Perspektive, sondern, wie er immer wieder betont, aus der Sicht eines Beobachters, der durch seine kulturübergreifenden Analysen diskursive Schnittstellen zwischen westlicher und islamischer Zivilisation schafft und so das Gespräch all derer befördert, die erkannt haben, dass die universelle Krise, welche die geistige wie die physische Existenz aller Menschen in einem Strudel der Sinnlosigkeit und Vernichtung zu verschlingen droht, nur durch gemeinsame Anstrengung und Verantwortlichkeit überwunden werden kann.
Für das Verständnis dieser These ist es von großer Wichtigkeit, nicht aus dem Auge zu verlieren, dass die Begründung, wie sie im Verlauf der Untersuchung vorgetragen wird, nicht ausschließlich auf der politischen Ebene verbleibt, sondern weit darüber hinausgeht, indem die Grundlagen des modernen Staates in den sehr viel weiter gefassten Strukturen des Projekts der Moderne verortet und auf dieser dann auch moralphilosophischen Ebene in ihrem Verhältnis zur Scharia verhandelt werden.
Das Projekt der Moderne und die moderne Gesellschaft selbst bedürfen der moralischen Erneuerung, zu der eine Wiederbelebung des islamischen Denkens und der Scharia einen nicht unwesentlichen Beitrag leisten könnte, vorausgesetzt, dass das moderne Denken einer ernsthaften Prüfung und Kritik unterzogen wird. Wie sich zeigen wird, kann und muss dabei an die bereits geleistete interne Kritik angeknüpft werden, wodurch erstaunliche Überschneidungen und Parallelen kenntlich werden.
Die moderne Krise der Moral wird einer genaueren Untersuchung unterzogen. Die strukturellen und begrifflichen Grundlagen der modernen Moralphilosophie werden als die Wurzel der moralischen Misere ausgemacht, welche die Moderne in allen ihren Gestalten in Ost und West erfahren hat.
Unter diesen Umständen gibt es gute Gründe, auf die Suche nach moralischen Ressourcen in anderen Traditionen zu gehen. Hallaq sucht hier Anschluss an westliche Denker wie Alasdair MacIntyre und Charles Taylor. Insbesondere MacIntyre hat sich ausgehend von der Diagnose, dass das moderne Projekt der rationalen Rechtfertigung der Moral gescheitert ist und die moralischen Ressourcen moderner Gesellschaften erschöpft sind, vormodernen Traditionen zugewandt. Diese Denker haben sich dabei auf die sogenannte »europäische« Tradition beschränkt, etwa auf Platon, Aristoteles und Thomas von Aquin.
Hallaq hingegen richtet seine Untersuchung auf die moralischen Ressourcen der muslimischen Kultur aus. Denn Muslime verfügen über ihre eigene reiche Tradition, welche die kulturellen Leistungen vieler Jahrhunderte in sich birgt. Diese Tradition übt auch heute noch einen tiefen und bestimmenden Einfluss auf moderne Muslime aus. Aus der Sicht des Projekts der Aufklärung, das ausschließlich die autonome Vernunft als Grundlage der Moral anerkennt, erscheint jeder Versuch, eine alternative Weise des Verstehens, die sich zudem auf eine Tradition stützt, zu entwickeln, als irrational. MacIntyre versucht dagegen nicht nur aufzuzeigen, dass das Projekt der Aufklärung selbst gescheitert ist, sondern auch, dass Tradition und Vernunft sich keineswegs ausschließen müssen. Vielmehr können rationale Untersuchung und ethische Werte in einer Tradition eingebettet sein und über verschiedenen Traditionen hinweg wirksam werden.
Das zweite Kapitel enthält ein Interview mit Wael Hallaq mit dem Titel Über Wissen, Macht und intellektuelle Sklaverei. Hallaq behandelt darin umfassende Fragen hinsichtlich der moralischen und geistigen Grundlagen konkurrierender moderner Projekte. Im ersten Teil mit dem Titel Wissen als Politik mit anderen Mitteln beschäftigt er sich insbesondere mit dem Versagen westlicher Intellektueller, sich mit Gelehrten in islamischen Gesellschaften auseinanderzusetzen, wie auch mit den intellektuellen und strukturellen Herausforderungen, mit denen muslimische Gelehrte konfrontiert sind. Hallaq kritisiert zudem das zugrunde liegende hegemoniale Projekt des westlichen Liberalismus und seine unkritische Übernahme durch manche muslimische Denker.
Hallaq plädiert für eine engagierte Auseinandersetzung zwischen muslimischen Denkern und ihren westlichen Pendants, nicht nur für ein besseres westliches Verstehen des Islam, sondern auch für eine Erweiterung des Bereichs der intellektuellen Möglichkeiten innerhalb des euro-amerikanischen Denkens. Denn das islamische Denken hat einen großen Beitrag zur Bereicherung der Reflexionen über das Projekt der Moderne zu leisten, im Westen nicht weniger als im Osten.
Im zweiten Teil des Interviews mit dem Titel Muslime und der Pfad der intellektuellen Sklaverei geht Hallaq auf den Konflikt ein, den er in dem Verhältnis zwischen Gelehrten in der muslimischen Welt und der Tradition der westlichen Wissensproduktion erkennt. Er sieht dabei insbesondere eine unkritische Übernahme von westlichen intellektuellen Kategorien und Weisen der Wissensübermittlung entlang dessen, was er als »den Pfad der intellektuellen Sklaverei« bezeichnet. Er beschreibt das Unvermögen von Intellektuellen in der muslimischen Welt, das sich wandelnde Verhältnis zwischen Wissen und Macht in der Moderne zu erfassen. Aber tragen nicht auch die westlichen Intellektuellen einen Teil der Verantwortung dafür? Nur ein ernstliches Gespräch über die vermeintlichen Grenzen von Zivilisationen und Kulturen hinweg kann Auswege aus der globalen Krise eröffnen.
Der zweite Teil, der unter dem Titel Unmögliche Moralphilosophie? steht, erkundet die Frage, was die moderne Moralphilosophie zur Suche nach diesem Ausweg beizutragen hat. Wie steht es um das Projekt der Begründung einer modernen Moral? Liefert es eine moralphilosophische Grundlage oder ist es an seinen eigenen Ansprüchen gescheitert? Kann das moderne Unterfangen einer rationalen Rechtfertigung der Moral überhaupt gelingen oder musste es scheitern? Unmögliche Moralphilosophie?
Das dritte Kapitel wirft die Grundfrage einleitend auf: Moderne Moralphilosophie – Ausweg oder Irrweg? Auf der Suche nach einem Ausweg aus der moralischen Misere begeben wir uns im Anschluss an Hallaqs Überlegungen auf den Weg einer moralphilosophischen Grundlagendiskussion. Die globale Krise verlangt einen globalen Blick. Die Tiefe ihrer Ursachen erfordert zudem eine grundsätzliche Erörterung des modernen Moralverständnisses weit über die bloß politischen Dimensionen des »unmöglichen Staates« hinaus. Und die zu behandelnden Probleme betreffen keineswegs lediglich dessen »islamische« Gestalt, sondern den modernen Staat selbst. Das Projekt der Moderne samt dem mit ihm untrennbar verbundenen Versuch einer Neufassung der Moral muss daher einer gründlichen Kritik unterzogen werden. Denn die grundlegendsten Probleme des modernen Islam sind nicht ausschließlich islamisch, sondern wohnen in der Tat gleichermaßen dem modernen Projekt selbst in Ost und West inne.
Hallaq stellt in seiner Krisendiagnose insbesondere zwei Probleme heraus, die als Grundbausteine der modernen Moralphilosophie eng miteinander verbunden sind: einerseits die Trennung von Sein und Sollen sowie andererseits das Projekt einer rationalen Begründung der Moral. Bei der Erörterung dieser Fragen stützt Hallaq sich vor allem auf die Untersuchungen von vier herausragenden Vertretern der modernen Moralphilosophie, die mehr oder weniger grundsätzliche Kritiken am modernen Moralverständnis entwickelt haben, namentlich Harold A. Prichard, Charles Larmore, Charles Taylor und Alasdair MacIntyre. Die Kapitel des zweiten Teils folgen Hallaq auf diesem Weg, um seine Ausführungen allerdings in einigen wesentlichen Belangen zu vertiefen und zu erweitern.
Das vierte Kapitel greift insbesondere die Frage nach und der Sinnhaftigkeit des Projekts der modernen Moralphilosophie und ihrer Weise der Moralbegründung auf: Moralphilosophie – ein Irrtum? Im Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung mit Prichards einflussreichem Aufsatz7 aus dem Jahr 1912 mit dem provokanten Titel Beruht die Moralphilosophie auf einem Irrtum? Prichard verficht darin die These von der Unmöglichkeit einer rationalen Begründung der Moral. Gibt es überhaupt so etwas wie Moralphilosophie? Kann es sie überhaupt geben? Wenn ja, in welchem Sinne? Für Prichard jedenfalls steht fest: Die Moralphilosophie beruht auf einem Irrtum! Und daher ist schon der Versuch einer Begründung der Moralphilosophie zum Scheitern verurteilt. Wie gelangt Prichard zu diesem Ergebnis? Welche Voraussetzungen macht er? Was versteht er unter »Moralphilosophie«? Von welchem Irrtum und Scheitern ist hier die Rede?
Die Argumente von Prichard mögen nicht immer überzeugend sein und die von ihm vorgeschlagene Lösung, der intuitionistische Ansatz, mag sogar unplausibel erscheinen, aber seine Überlegungen sind gewiss bezeichnend und aufschlussreich für die geistige Situation, in der sich die moderne Moralphilosophie befindet. Und er hat seine Wirkung getan, indem er neben der klassischen Frage nach der Begründung von Inhalten der Moral eine andere Frage ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt hat, die sich unter den Bedingungen einer modernen Moral besonders stark aufdrängt: Warum überhaupt moralisch sein?
Das fünfte Kapitel befasst sich unter dem Titel Moral, Vernunft und Gründe mit Charles Larmores Kritik an Grundgedanken der modernen Moralphilosophie, insbesondere in ihrer an Kant angelehnten Gestalt. Mit Prichard verbindet ihn dabei die These, dass der Versuch einer Begründung der Moral aus bloßer Vernunft nicht gelingen kann. Die Vernunft, wenn sie denn moralisch wirksam werden können soll, bedarf gewissermaßen der Unterstützung von außen, aus einem Bereich, der zudem über eine gewisse Selbständigkeit verfügt. Was bei Prichard moralische Intuitionen sind, wird bei Larmore daher zu moralischen Gründen.
Während Prichard der Vernunft lediglich eine sehr begrenzte Rolle zuweist, entwickelt Larmore eine wesentlich anspruchsvollere Konzeption der Vernunft, die letzterer in ihrem komplexen Wechselspiel mit dem unabhängigen Bereich des Moralischen größeres Gewicht verleiht. Bei allen Unterschieden lassen beide Konzeptionen sich als moralischen Realismus bezeichnen. Die objektiven Gründe, auf welche die Vernunft angewiesen ist, wurzeln nach Larmore in einer normativen Ordnung von Gründen, die ihn von einem Platonismus der Gründe sprechen lässt. Aus der Ablehnung der kantischen Moralkonzeption und der Entscheidung für den moralischen Realismus ergibt sich in Gegenüberstellung zur Ethik der Autonomie Larmores Formel von der Autonomie der Moralität.
Die Vernunft verliert damit ihren Status autonomer Spontaneität und wird zu einem heteronomen und rezeptiven Vermögen, das für Gründe empfänglich ist, die ihr von außen vorgegeben werden. Mit dieser Konzeption wendet sich Larmore gegen die vorherrschende Strömung in der modernen Moralphilosophie, die sich in der Nachfolge Kants bis heute, wie etwa auch in der Diskursethik, in einer Verbindung von Naturalismus und Vernunftautonomie den zahllosen Versuchen einer Neuauflage verschrieben haben, die noch auf jedes Scheitern dieses Ansatzes gefolgt sind.
Wer darin unzulässige Metaphysik wittert, dem erwidert Larmore, dass doch jeder, ob eingestanden oder nicht, seine Metaphysik, seine Auffassung von der Welt im Ganzen und von dem Platz des Menschen darin, hat, und es es vor allem darauf ankommt, Metaphysik verantwortlich zu betreiben, insbesondere wenn man sich mit solchen Grundfragen wie der nach der Natur der Vernunft befasst. Kann Larmore seinem Anspruch einer verantwortlichen Metaphysik gerecht werden? Wie weit reicht seine Kritik der modernen Moralphilosophie tatsächlich? Wie fasst er das Verhältnis von Moral, Vernunft und Gründen?
Das sechste Kapitel geht der Frage nach der Verfassung der modernen Moral und Moralphilosophie weiter auf den Grund: Moral nach der Tugend: Vernunft und Tradition. Kaum ein anderer hat die Krise der modernen Moral so gründlich ausgelotet wie Alasdair MacIntyre. In seinem 1981 erschienen Buch After Virtue8 (wörtl.: Nach der Tugend) führt er die Krise der modernen Moral auf eine Entwicklung in der Dimension einer historischen Katastrophe zurück, welche die Moral und Moralphilosophie weit mehr als nur in ihren Grundfesten erschüttert, so dass in ihrer modernen Gestalt lediglich einige Überreste der vergangenen Moral als fiktionale Bruchstücke bestehen bleiben.
Hallaq greift die Grundgedanken und die Konzeption von MacIntyre auf, indem er sie in seinem Sinne weiterentwickelt und modifiziert. Kein anderer Denker dürfte in seiner Auseinandersetzung mit der modernen Moralphilosophie in Impossible State auch nur annähernd einen ähnlichen Stellenwert einnehmen. Daher rechtfertigt sich eine ausführliche und gründliche Befassung mit MacIntyres Denken. Sie ist für ein besseres Verständnis von Hallaqs Denken in Impossible State unerlässlich, da dessen Grundstruktur auf diese Weise in besonders deutlichen Konturen hervortritt.
Unter den Bedingungen der Krise der modernen Moral gibt es gute Gründe, auf die Suche nach moralischen Ressourcen in anderen Traditionen zu gehen. Hallaq sucht hier Anschluss an westliche Denker wie Alasdair MacIntyre und Charles Taylor. Insbesondere MacIntyre hat sich ausgehend von der Diagnose, dass das moderne Projekt der rationalen Rechtfertigung der Moral gescheitert ist und die moralischen Ressourcen moderner Gesellschaften erschöpft sind, vormodernen Traditionen zugewandt. Diese Denker haben sich dabei auf die sogenannte »europäische« Tradition beschränkt, etwa auf Platon, Aristoteles und Thomas von Aquin.
Hallaq hingegen richtet seine Untersuchung auf die moralischen Ressourcen der muslimischen Kultur aus. Denn Muslime verfügen über ihre eigene reiche Tradition, welche die kulturellen Leistungen vieler Jahrhunderte in sich birgt. Diese Tradition übt auch heute noch einen tiefen und bestimmenden Einfluss auf moderne Muslime aus. Aus der Sicht des Projekts der Aufklärung, das ausschließlich die autonome Vernunft als Grundlage der Moral anerkennt, erscheint jeder Versuch, eine alternative Weise des Verstehens, die sich zudem auf eine Tradition stützt, zu entwickeln, als irrational.
MacIntyre versucht dagegen nicht nur aufzuzeigen, dass das Projekt der Aufklärung selbst gescheitert ist, sondern auch, dass Tradition und Vernunft sich keineswegs ausschließen müssen. Vielmehr können rationale Untersuchung und ethische Werte in einer Tradition eingebettet sein und über verschiedenen Traditionen hinweg wirksam werden.
Hallaq sieht große Ähnlichkeiten auf der theoretischen Ebene zwischen seinem Projekt und insbesondere dem von MacIntyre. Die moralischen Ressourcen der vormodernen islamischen Tradition, um die es ihm zu tun ist, spiegeln aber nicht nur eine geteilte theoretische und philosophische Untersuchung wider, sondern auch eine paradigmatische Lebensweise, was von noch größerer Bedeutung ist. Die westlichen Denker beziehen sich auf eine Tradition und Gemeinschaft, die es als gelebte Realität nie gegeben hat, sondern allenfalls als Ideal einer bloß intellektuellen Tradition. Die islamische Tradition, auf die sich das Projekt der Wiedergewinnung moralischer Ressourcen beziehen kann, verbindet hingegen theoretische und philosophische mit soziologischen, anthropologischen, rechtlichen, politischen und ökonomischen Phänomenen, die in der islamischen Geschichte als paradigmatische Überzeugungen und Praktiken entstanden sind.
Das Paradigma der islamischen Gouvernanz ist von der Scharia bestimmt. Die Scharia wird durch ein moralisches Recht repräsentiert und konstituiert. Daraus ergibt sich ihre Bedeutung als moralische Ressource für das moderne Projekt, in Analogie zu Aristoteles und Thomas von Aquin im Entwurf von MacIntyre. Diese Ähnlichkeit, ja Gemeinsamkeit, ist weder eine bloße Koinzidenz noch zufällig, da alle diese Stimmen – muslimische und christliche, östliche und westliche – auf die gleiche moralische Lage antworten, wie sehr ihre jeweiligen Vokabularien und Sprechweisen sich auch voneinander unterscheiden mögen.
Es handelt sich also um ein Projekt, das gar nicht anders als gemeinsam verwirklicht werden kann. Und MacIntyre kommt dabei gewiss eine gewichtige Rolle zu. Das ist der Grund, warum eine eingehende Auseinandersetzung mit seinem Denken geboten ist, zu der hier ein weiterer und vertiefender Schritt beigetragen werden soll.
Ist die Krise der modernen Moral und Moralphilosophie in der Tat so tief, dass sich in deren Rahmen diese Krise weder angemessen verstehen noch irgendein gangbarer Ausweg aufweisen lässt? Welche Ressourcen stehen dem islamischen Denken zur Verfügung, um einen Beitrag zur gemeinsamen Suche nach einem Ausweg aus der globalen Krise der Moral leisten zu können?
Mein Dank gilt all denen, die mich durch ihre anregenden und bereichernden Beiträge in Diskussionen und anderweitig bei der Arbeit an diesem Projekt, mitunter über viele Jahre, unterstützt haben und die viel zu zahlreich sind, um namentlich aufgeführt werden zu können. Besonders bedanken möchte ich mich bei den Mitgliedern des VDM9, die mir mit ihrer großmütigen Unterstützung in allerlei Gestalt stets tatkräftig zur Seite standen. Möge Allāh es ihnen allen reichlich lohnen und unser Projekt mit Seinem Beistand zum Gelingen führen!
März 2019 / Radschab 1440
Yusuf Kuhn
1 https://alastu.net/ueber
2 https://alastu.net/node/29
3 https://alastu.net
4 Yusuf Kuhn, Über Vernunft und Offenbarung in al-Ghazālīs Denken. Studien zur Kritik der Philosophie im islamischen Denken - Band 1, Hamburg, 2018; https://alastu.net/node/109.
5 Siehe Zur Person von Wael B. Hallaq im Anhang, S. 399.
6 Wael B. Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament, New York, Columbia University Press, 2013.
7 Harold Arthur Prichard, Does Moral Philosophy Rest on a Mistake?, in: Mind, New Series, Bd. 21, Nr. 81 (Jan., 1912), S. 21-37. Deutsche Übersetzung von Günther Grewendorf: Beruht die Moralphilosophie auf einem Irrtum?, in: Kurt Bayertz (Hg.), Warum moralisch sein?, Paderborn, 2002, S. 49-68.
8 Alasdair MacIntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, University of Notre Dame Press, 3rd ed., Notre Dame, Indiana, 2007 (1. Auflage 1981); deutsche Übersetzung von Wolfgang Rhiel: Der Verlust der Tugend. Zur moralischen Krise der Gegenwart, Frankfurt, 1995 (1. Auflage 1987).
9 Verein für denkende Menschen e.V., Website: vdmev.de
ERSTER TEILUNMÖGLICHER STAAT?
1
Der unmögliche Staat: Islam, Politik und die moralische Misere der Modernität
Dieser Text ist eine ausführliche Vorstellung des Buches The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament von Wael B. Hallaq.1 Der vollständige Titel lautet ins Deutsche übertragen: Der unmögliche Staat. Islam, Politik und die moralische Misere der Modernität. Zunächst folgt eine kurze Einführung in die Thematik. Daraufhin wird das gesamte Buch relativ ausführlich kapitelweise vorgestellt.
1.1 Einführung
Wael B. Hallaq2 versteht dieses Buch als Fortsetzung und Erweiterung seiner großen, sechshundertseitigen Studie über die Scharia: Sharīʿa:: Theory, Practice, Transformations (Scharīʿa Theorie, Praxis, Transformationen), die 2009 erschienen ist.3 Darin fand sich angesichts ihres ohnehin schon gewaltigen Umfangs kein Platz mehr für die Behandlung des modernen Staats und dessen Verhältnis zum Islam. Diese Untersuchung über die Scharia (scharīʿa) ist weitgehend historisch und nicht normativ angelegt. Sie bietet eine Erzählung über die historische Entwicklung der Scharia in Theorie und Praxis von den Anfängen bis in die postkoloniale Gegenwart.
1.1.1 Die moralische Dimension
An die Darstellungsweise seiner großen Studie über die Geschichte der Scharia knüpft Hallaq auch mit seinem Buch The Impossible State (Der unmögliche Staat) an, allerdings mit einem bemerkenswerten Unterschied, auf den der Autor ausdrücklich hinweist: Nicht nur werden die historische Darstellung des modernen Staates im islamischen Kontext und ihre theoretischen Implikationen breiter ausgeführt, indem sie mit Bezug auf westliche Wissenschaften wie Politologie, Rechtswissenschaft und Moralphilosophie erörtert werden, sondern vor allem besitzt diese Studie auch eine normative Dimension.
Hallaq stellt am Ende der Einleitung klar, dass »dieses Buch nicht lediglich eine Geschichte des islamischen Rechts ist«;4 und an anderer Stelle betont er überdies, dass es »nicht eine Geschichte des islamischen Rechts ist und nicht als solche betrachtet werden sollte.«5 Es schließt zwar an das empirische Narrativ der Scharia-Studie an, wählt aber eine deutlich unterschiedene Darstellungsform:
[…] während es Mannigfaltigkeit, Unordentlichkeit (messiness) und Verletzungen (violations) in der langen Geschichte der Scharia anerkennt und in Rechnung stellt, zieht es Nutzen aus dem Begriff des Paradigmas, um aus einer paradigmatischen Struktur heraus die moralische Dimension wiederzugewinnen, die gleichwohl diese komplexen und verworrenen Realien durchdringt. (S. xiv)6
Was dies genau zu bedeuten hat, wird sich hoffentlich im Verlauf der Vorstellung des Buches aufklären. Es sollte hier lediglich vorab schon auf diesen wichtigen Aspekt aufmerksam gemacht werden. Denn es soll dem Eindruck vorgebeugt werden, der gleichwohl häufig zu entstehen scheint und auch in etlichen Rezensionen des Buches zum Ausdruck gebracht wird, dass es sich um eine historische Darstellung der Geschichte des islamischen Rechts handele, die allzu beschönigend, verklärt oder gar rosig ausfalle. Doch dabei gerät offenkundig die entscheidende Unterscheidung zwischen einer empirischen und einer paradigmatischen Darstellung aus dem Blick. Es geht also keineswegs um eine Beschönigung, Verschleierung oder gar Leugnung von Unrecht, Unterdrückung, Gewalt oder Rechtsverletzungen in der islamischen Geschichte, die vielmehr als solche anerkannt werden, sondern um einen anderen Blick auf diese Geschichte, der den Begriff des Paradigmas ins Zentrum stellt. Hallaq versucht diesem Missverständnis in einer Anmerkung entgegenzuwirken, auf die eben schon Bezug genommen worden ist und die darüber hinaus zur weiteren Klärung vollständig wiedergegeben sei:
Es muss hier so klar wie möglich gemacht werden, dass mein Narrativ des vormodernen islamischen Rechts auf dem beruht, was ich in Sharīʿa7 und Introduction8 dargelegt habe. Das vorliegende Werk als Abweichung von diesen beiden Büchern oder als Ausdruck eines Wechsels in Richtung einer Reduktion der Komplexität dieses Narrativs zu betrachten, ist eine Versuchung, der widerstanden werden sollte. Wenn die Leserin, die mit meinem früheren Werk vertraut ist, eine derartige qualitative Differenz im Narrativ feststellt, so ist ihr dringlich anzuraten, dies in Begriffen der hier dargelegten Theorie des Paradigmas zu verstehen. Es sollte klar werden, dass unser Narrativ des vormodernen islamischen Rechts in einer Weise gestaltet ist, die dem vorliegenden Projekt angemessen ist, nämlich dem, was wir moralische Wiederherstellung genannt haben. Daher ist der vorliegende Band nicht eine Geschichte des islamischen Rechts und sollte nicht als solche betrachtet werden. (S. 174, Fußnote 22)
Damit sollte deutlich geworden sein, dass es keineswegs um ein nostalgisches Plädoyer für eine Rückkehr in eine vermeintliche Idylle geht, sondern vielmehr, in voller Anerkennung der Kluft zwischen sozialer Wirklichkeit und Norm, um eine vergleichende Reflexion über unterschiedliche Paradigmen, die zwar Einfluss auf die soziale Wirklichkeit haben, aber weit davon entfernt sind, diese kraft ihrer Normativität vollständig zu determinieren. Es ist hier nicht der Ort, diesen Ansatz weiter auszuführen, der durch die folgende Darstellung ohnehin ausführlich erläutert werden soll. An dieser Stelle muss es genügen, auf dieses mögliche Missverständnis mit aller Deutlichkeit hingewiesen zu haben, so dass die weitere Darlegung in diesem klärenden Lichte betrachtet werden kann. Wer dennoch dazu neigt, einen entsprechenden Vorwurf der Nostalgie zu erheben, sollte dies allerdings in voller Kenntnis der in obigem Zitat erwähnten beiden Bände tun, und nicht allein auf der Grundlage des hier erörterten Buches The Impossible State, das aus den genannten Gründen nicht der geeignete Adressat einer solchen Kritik sein kann.
Ein weiteres Missverständnis bestünde in der Annahme, dass sich aus der in diesem Buch vorgenommenen Analyse des modernen Staates unmittelbar Schlüsse über das politische Verhältnis von Muslimen, die in einem solchen Staat leben, zu eben diesem Staat ableiten ließen. Diese müssten in der Tat Kurzschlüsse sein, da diese Frage hier überhaupt nicht thematisiert wird und daher die nötigen Voraussetzungen gar nicht vorliegen, um daraus entsprechende Schlüsse ziehen zu können.
Nachdem also einiges dazu gesagt worden ist, worum es in diesem Buch nicht geht, um gängigen Missverständnissen möglichst vorzubeugen, nun aber näherhin zum eigentlichen Inhalt: Wovon handelt dieses Buch?
1.1.2 Staat, Islam, Moral: Worum geht es?
Zunächst sei der Titel kurz erläutert. Hallaq vertritt die These, dass der moderne Staat und der Islam nicht vereinbar sind. Der unmögliche Staat (The Impossible State) des Titels ist also der moderne und zugleich islamische Staat. Die tieferen Gründe für diese Unvereinbarkeit liegen nicht, wie das Thema des Staates vermuten lassen könnte, allein auf der politischen Ebene, sondern im wesentlichen auf der moralischen Ebene. Daher besitzen in dieser Untersuchung moralphilosophische Überlegungen und insbesondere die Diagnose einer tiefen moralischen Krise der modernen westlichen Zivilisation einen zentralen Stellenwert. So erklärt sich auch der Untertitel: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament (Islam, Politik und die moralische Misere der Modernität). Und diese Krise ist so tief, dass nicht nur der moderne islamische Staat, sondern der moderne Staat selbst und darüber hinaus das Überleben der Menschheit insgesamt fraglich werden.
Die Krise übergreift westliche und islamische Zivilisation. Sie strahlt vom Westen auf den ganzen »Rest« aus, ist universell und verlangt nach entsprechenden Lösungen. Schließlich haben, wie Hallaq resümiert, Muslime kein Monopol auf Krise. Welche Rolle spielt dabei der moderne Staat selbst und sein Verhältnis zum Islam? Welche Bedeutung kommt der moralischen Grundlagenkrise der westlichen Kultur und deren Verhältnis zum Islam zu? Gibt es einen Ausweg aus der universellen Krise? Hallaq wirft diese Fragen auf und stellt sich ihnen, übrigens nicht aus einer muslimischen Perspektive, sondern, wie er immer wieder betont, aus der Sicht eines Beobachters, der durch seine kulturübergreifenden Analysen diskursive Schnittstellen zwischen westlicher und islamischer Zivilisation schafft und so das Gespräch all derer befördert, die erkannt haben, dass die universelle Krise, welche die geistige wie die physische Existenz aller Menschen in einem Strudel der Sinnlosigkeit und Vernichtung zu verschlingen droht, nur durch gemeinsame Anstrengung und Verantwortlichkeit überwunden werden kann.
1.2 Einleitung
1.2.1 These der Unvereinbarkeit von Islam und modernem Staat
Der Autor beginnt die Einleitung mit einer knappen und klaren Darlegung der zentralen These:
Das Argument dieses Buches ist ziemlich einfach: Der »islamische Staat« ist, gemessen an irgendeiner Standarddefinition dessen, was den modernen Staat ausmacht, sowohl eine Unmöglichkeit wie auch ein Widerspruch in sich. (S. ix)
Das Buch dient der Darstellung, Erläuterung und Begründung dieser These samt ihrer weitreichenden Konsequenzen.
Die Scharia, das moralische Recht des Islam – wie Hallaq sagt –, hatte über zwölf Jahrhunderte lang Gesellschaft und Regierung als höchste moralische und rechtliche Kraft erfolgreich geordnet. Hallaq setzt dieses »Recht« ganz richtig in Anführungszeichen, denn die Scharia war immer sehr viel mehr und anderes als bloßes Recht. Scharia mit Recht gleichzusetzen, wäre daher ein großer Fehler. Um dem von vornherein zu wehren, betont Hallaq den moralischen Charakter der Scharia.
Zudem führt er sogleich den Begriff des Paradigmas ein, dem in seiner Analyse große Bedeutung zukommt, wie sich im Fortgang zeigen wird, indem er feststellt:
Dieses »Recht« war paradigmatisch, da es als zentrales System von hohen und allgemeinen Normen von den Gesellschaften und den dynastischen Mächten, die über sie regierten, Anerkennung fand. (S. ix)
Doch die von der Scharia geleitete soziale und politische Ordnung wurde seit dem Beginn des neunzehnten Jahrhunderts durch das kolonialistische Europa strukturell zersetzt. Dadurch wurde die Scharia selbst ausgehöhlt und auf einen Status herabgesetzt, der ihr keine andere Rolle mehr beließ als die Lieferung von Rohmaterial für die Gesetzgebung des modernen Staates auf dem Gebiet des Personenstandsrechts. Und selbst in diesem beschränkten Bereich verlor die Scharia ihre Selbständigkeit und gesellschaftliche Wirksamkeit zugunsten des modernen Staates. Die Scharia sollte fortan nur noch als Lieferant bestimmter Vorkehrungen dienen, welche die Gesetzgebung des Staates legitimieren sollten und zu diesem Zweck umgeformt und geradezu wieder erschaffen wurden.
Diese Entwicklung änderte nicht allzu viel daran, dass die Scharia gleichwohl ihre zentrale Stellung für die große Mehrheit der Muslime als eine und wohl die entscheidende geistige Quelle für ihr Leben und für alle religiöse und moralische Autorität beibehielt. Es kann kaum Zweifel daran bestehen, dass sich daher die überwältigende Mehrheit der modernen Muslime eine Rückkehr der Scharia wünscht. Warum dies so ist, wird in der folgenden Untersuchung deutlich werden, obgleich dies, wie Hallaq betont, nicht die mit ihr verfolgte Absicht ist.
Dieser Wunsch heutiger Muslime mündet jedoch unter den Bedingungen der Moderne in eine ausweglose Lage, derer sich kaum jemand bewusst ist. Nicht nur wird kein Widerspruch erkannt, sondern die meisten Muslime und ganz besonders ihre führenden Intellektuellen betrachten den modernen Staat als selbstverständliche und natürliche Wirklichkeit. Sie nehmen nicht nur an, dass er während des gesamten Verlaufs der langen muslimischen Geschichte existiert habe, sondern darüber hinaus auch noch im Islam selbst seine Rechtfertigung finde. Beispiele dafür gibt es zuhauf. Hallaq verweist u.a. auf den pakistanischen Intellektuellen al-Mawdudi.
Als wenn dies nicht schon genügen würde, wird überdies der Nationalismus, ein vor der Moderne unbekanntes Phänomen, das von einzigartiger Bedeutung für die Herausbildung des modernen Staates ist, auf islamische Grundlagen zurückgeführt, wie etwa die sogenannte Verfassung von Medina. Und auch so moderne Begriffe wie Bürgerschaft, Demokratie und Wahlrecht sollen in den islamischen Grundlagen verankert oder zumindest von den frühen islamischen Gesellschaften ausgebildet worden sein. Andere wiederum mit einem etwas mehr autoritären Staatsverständnis meinen, den modernen Staat islamisieren zu können, indem er um bestimmte drakonische Strafen bereichert wird, die vorgeblich aus der Scharia abgeleitet werden, jedoch in Wirklichkeit gegen die von ihr vorgesehene Verfahrensweise und Berücksichtigung der sozialen Umstände verstoßen.
Hallaq zieht daraus den Schluss:
Moderne Muslime sind daher mit der Herausforderung konfrontiert, zwei Tatsachen miteinander zu vereinbaren: erstens die ontologische Tatsache des Staates und seiner unbestreitbar mächtigen Präsenz und zweitens die deontologische Tatsache der Notwendigkeit, eine Form der Scharia-Gouvernanz herbeizuführen. (S. x)
Moderne Muslime stehen also vor der Aufgabe, angesichts der Existenz des modernen Staates und seiner Macht dem islamischen und moralischen Gebot gerecht zu werden, eine Gesellschaft zu schaffen, deren Ordnung und Zusammenhalt von der Scharia gewährleistet wird – mittels einer Form der Scharia-Gouvernanz. Ich habe den englischen Ausdruck governance absichtlich unübersetzt gelassen oder, genauer gesagt, durch die deutsche Entsprechung des französischen Wortes gouvernance ersetzt, daher »Gouvernanz«. Dieses Wort hat sich im Deutschen bisher zwar nicht wirklich durchsetzen können, bleibt aber mangels Alternative die bessere Wahl, wenn der Bedeutungshorizont nicht vorschnell eingeschränkt werden soll, was mit einer Übersetzung als Regierung oder auch Regierungsform geschehen würde. Denn der Begriff der governance (Gouvernanz) soll ja gerade auf die Wichtigkeit auch außerstaatlicher Lenkungsformen anspielen. Umgekehrt wäre eine Übersetzung mit Lenkungsform wiederum zu allgemein, da somit der Bezug auf den Staat verlorenzugehen drohte. Ich gehe hier deswegen so ausführlich auf Fragen der Übersetzung ein, weil damit inhaltliche Fragen eng verknüpft sind, die dadurch ersichtlich werden. Der Begriff der Gouvernanz soll daher im folgenden beibehalten werden, auch um den offenen Charakter der Frage zu betonen, was – im Unterschied und möglicherweise Gegensatz zu »Staat« oder »Regierung« – »Gouvernanz« wohl bedeuten wie auch worin diese Gouvernanz tatsächlich bestehen könnte.
Trotz der realen Schwierigkeiten und des Scheiterns vieler Versuche bei der Errichtung eines »islamischen Staates« bleibt der Staat die Folie, auf deren Hintergrund moderne muslimische Intellektuelle in der Gestalt von »Islamisten« ihre Projekte entwerfen. An Beispielen dafür, wie gesagt, mangelt es nicht. Hallaq führt eine »repräsentative Stellungnahme« der Organisation der Muslimbrüder (ikhwān al-muslimīn) an, in der es heißt, dass der moderne Nationalstaat »nicht im Widerspruch zur Anwendung der Scharia steht« oder zumindest »stehen sollte«, was durch entsprechende Maßnahmen im Rahmen einer fortschreitenden Entwicklung zu erreichen sei. Ein Zwischentitel dieses Dokuments bringt es auf den Punkt: »Es gibt keinen Widerspruch zwischen dem Nationalstaat und der islamischen Scharia« (siehe S. xi).
Gleiches gilt für die islamistische Konkurrenz auf der ägyptischen politischen Bühne in Gestalt der von Saudi-Arabien unterstützten wahhabitischen, ihrem Selbstverständnis zufolge salafistischen Partei an-Nūr. Sie spricht sich in ihren Erklärungen für die Anwendung der Scharia aus, ohne die Bedeutung dieses Ausdrucks näher zu erläutern, und erklärt zugleich, dass ihr höchstes Ziel darin bestehe, einen »islamisch gegründeten demokratischen Nationalstaat« (siehe S. xi) aufzubauen.
Gegenüber diesem Ansinnen betont Hallaq, dass es sehr wohl einen Widerspruch zwischen modernem Staat und Islam gibt:
Jedwede Konzeption eines modernen islamischen Staates ist inhärent selbstwidersprüchlich. (S. xi; Hervorhebungen im Original)
Für das Verständnis dieser These ist es von großer Wichtigkeit, nicht aus dem Auge zu verlieren, dass die Begründung, wie sie im Verlauf der Untersuchung vorgetragen wird, nicht ausschließlich auf der politischen Ebene verbleibt, sondern weit darüber hinausgeht, indem die Grundlagen des modernen Staates in den sehr viel weiter gefassten Strukturen des Projekts der Moderne verortet und auf dieser dann auch moralphilosophischen Ebene in ihrem Verhältnis zur Scharia verhandelt werden.
Das ist vielleicht der Ort, um deutlich darauf aufmerksam zu machen, worum es nicht geht. Denn es könnte sich angesichts dieser These das Missverständnis einstellen, es solle behauptet werden, dass die Scharia oder eine Form der islamischen Gouvernanz in dieser Welt überhaupt keinen Platz finden könne. Das Gegenteil ist richtig. Um nicht falsch verstanden zu werden, stellt Hallaq nachdrücklich fest:
Daher muss ein für alle Mal festgestellt werden, dass das Argument dieses Buches auf der Prämisse beruht, dass eine kreative Reformulierung der Scharia und der islamischen Gouvernanz eine der bedeutendsten und konstruktivsten Weisen sein kann, das moderne Projekt umzugestalten, denn es hat einen moralischen Wiederaufbau bitter nötig. […] Dieser Wiederaufbau und seine politischen und rechtlichen Folgeerscheinungen sind für Muslime nicht vorstellbar ohne eine richtige Diagnose des Problems des »islamischen Staates«, woraus sich ebenfalls erklärt, warum ein robuster Entwurf für solch eine zukünftige Rekonstruktion ein echtes Verstehen des vielschichtigen Widerspruchs, der jedwedem Konzept des »islamischen Staates« innewohnt, zur Voraussetzung hat. (S. 172-173, Fußnote 15)
Das Projekt der Moderne und die moderne Gesellschaft selbst bedürfen der moralischen Erneuerung, zu der eine Wiederbelebung des islamischen Denkens und der Scharia einen nicht unwesentlichen Beitrag leisten könnte, vorausgesetzt, dass das moderne Denken einer ernsthaften Prüfung und Kritik unterzogen wird. Wie sich zeigen wird, kann und muss dabei an die bereits geleistete interne Kritik angeknüpft werden, wodurch erstaunliche Überschneidungen und Parallelen kenntlich werden.
Vielleicht muss an eine Tatsache erinnert werden, die allzu leicht aus dem Blick gerät: Auch die Muslime leben in der Modernität und sind insofern ebenfalls Teil des Projekts der Moderne. Wenn also diese Modernität eine moralische Misere erfährt, sind alle davon betroffen, die daran teilhaben. Hallaq vertritt die These, dass die Widersprüche, die das Konzept des modernen islamischen Staates birgt, ihre hauptsächlichen und wesentlichen Gründe in der moralischen Misere der Modernität haben. Die politischen und ökonomischen Probleme gehen letztlich auf diese moralische Misere zurück. Was bedeutet, dass die Aufhebung der moralischen Misere auch zu einer Lösung der politischen und ökonomischen Probleme führen würde, oder zumindest einen wesentlichen Beitrag dazu leisten würde.
Hallaq beschließt daher diesen Abschnitt seines Gedankengangs mit folgender Bemerkung:
Die inhärenten Widersprüche jeder Konzeption eines modernen muslimischen Staates erfassen – kraft des gewaltigen vertikalen Effekts und der horizontalen Macht des modernen Staates – nicht nur das gesamte Spektrum dessen, was als die »Krise des modernen Islam« beschrieben worden ist, sondern implizieren auch die moralischen Dimensionen des modernen Projekts in unserer Welt von Anfang bis Ende. Dieses Buch ist daher ein Essay in moralischem Denken mehr noch als ein Kommentar über Politik oder Recht. (S. xi-xii)
1.2.2 Wie wird die These der Unvereinbarkeit entfaltet?
Zur Entfaltung der These der Unvereinbarkeit ist es erforderlich, einerseits die »paradigmatische islamische Gouvernanz« wie auch andererseits den »paradigmatischen modernen Staat« zu beschreiben. Dies erfolgt jeweils in Kapitel 1 und 2. Zur Vorbereitung darauf wird der Begriff des Paradigmas vorgestellt. Da das Argument mit vielen Annahmen des Modernismus in Konflikt gerät, ist es unvermeidbar, die Ideologie zu erörtern, die einem weit verbreiteten Denken über Modernität und die Leistungen der Moderne zugrunde liegt. Und im Zentrum dieser Ideologie steht die Idee des Fortschritts.
In Kapitel 2 werden dann Eigenschaften des Staates ausgezeichnet, die trotz aller vielfältigen historischen Entwicklungen seinen Wesenskern ausmachen. Dazu gehören die Ideen des souveränen Willens und der Herrschaft des Rechts (rule of law). Ich übersetze rule of law nicht mit Rechtsstaatlichkeit, weil damit eine zu große Nähe zwischen Recht und Staat im Sinne von Gesetzmäßigkeit oder gar Identität von Recht und Staat vorausgesetzt wäre, was mit dem vorgetragenen Argument jedoch nicht vereinbar ist. Denn das auf moralischer Grundlage verstandene Recht im Sinne der Scharia kann und darf keinesfalls darauf eingeschränkt werden.
Die beiden genannten Ideen werden in Kapitel 3 in Begriffen der Theorie und Praxis der Gewaltenteilung untersucht. Dies dient dazu, den konstitutionellen Bezugsrahmen sowohl des modernen Staates als auch der islamischen Gouvernanz herauszustellen, um zugleich damit die konstitutionellen Unterschiede dieser beiden Formen der Gouvernanz aufzuzeigen.
Dies führt in Kapitel 4 zu einer weitergehenden Erkundung der Bedeutung des Rechts und seines Verhältnisses zur Moral. Diese eher philosophische Abhandlung rückt die qualitativen Differenzen der beiden Konzeptionen des Rechts in den Vordergrund. Darauf aufbauend werden sodann die politischen Differenzen analysiert, die sich als ebenso inkompatibel erweisen.
Kapitel 5 vollzieht dann einen Wechsel von den Ordnungen des Denkens und der Politik auf die Ebene des Selbst und der Subjektivität. Der moderne Nationalstaat und die islamische Gouvernanz verfügen über sehr unterschiedliche Verfahren, Subjektivität auszubilden, die Hallaq im Anschluss an Foucault als »Technologien des Selbst« bezeichnet. Die durch diese beiden paradigmatischen Felder erzeugten Subjekte verfügen dementsprechend über »zwei verschiedene Arten von moralischen, politischen, epistemischen und psychosozialen Konzeptionen der Welt.« (S. xiii)
In Kapitel 6 wird sodann die Frage aufgeworfen, was geschehen würde, wenn gegen alle Hemmnisse eine islamische Gouvernanz tatsächlich verwirklicht werden sollte. Hallaq argumentiert, dass die modernen Formen der Globalisierung und die Stellung des Staates darin jede Ausprägung der islamischen Gouvernanz völlig unmöglich oder zumindest auf längere Sicht nicht überlebensfähig machen würden. Das kann freilich nur als verstärkendes Argument verstanden werden, da die Hauptthese ja besagt, dass eine islamische Gouvernanz unter den Bedingungen der Moderne ohnehin unhaltbar ist, da sie schon aufgrund der Widersprüche unmöglich ist.
Im abschließenden siebten Kapitel wird die moderne Krise der Moral einer genaueren Untersuchung unterzogen. Die strukturellen und begrifflichen Grundlagen der modernen Moralphilosophie werden als die Wurzel der moralischen Misere ausgemacht, welche die Moderne in allen ihren Gestalten in Ost und West erfahren hat. Hallaq stellt fest:
Wir bestehen darauf, dass es, wenn die Unmöglichkeit der islamischen Gouvernanz in der modernen Welt direkt das Ergebnis des Fehlens einer günstigen moralischen Umgebung ist, die den minimalen Standards und Anforderungen dieser Gouvernanz genügen kann, dann geboten ist, diese moralisch begründete Unmöglichkeit mit den weiteren problematischen Kontexten in Verbindung zu bringen, welche die moralischen Schwierigkeiten der Modernität erzeugt haben. Daher argumentieren wir, dass diese Unmöglichkeit lediglich eine weitere Manifestation – und ein steter Begleiter – einer Reihe von anderen Problemen ist, zu denen nicht zuletzt der zunehmende Zerfall der organischen sozialen Einheiten, das Wachstum der ökonomischen Ungerechtigkeit und in erster Linie die Zerstörung der natürlichen Wohnstätte und der Umwelt gehören. All dies wird in diesem Buch als ebenso philosophisch-moralische und epistemische wie auch materielle und physikalische Angelegenheit betrachtet. Wir finden in der Tat bei näherer Betrachtung der internen moralischen Kritiken innerhalb der westlichen Postmodernität enge Parallelen, sogar eine virtuelle Identität, zwischen ihnen und den latenten Bedeutungen des modernen muslimischen Rufs nach der Errichtung einer islamischen Gouvernanz. (S. xiii)
1.3 Prämissen
Wenn ein moderner islamischer Staat unmöglich und sogar ein Widerspruch in sich ist, drängen sich zwei Fragen auf: Welche Form der Gouvernanz haben Muslime in der Vergangenheit praktiziert? Und welche Regierungsformen bestehen in der gegenwärtigen muslimischen Welt? Diese Fragen stellen sich insbesondere vor dem Hintergrund der Geschichte der letzten zweihundert Jahre, die von Kolonialherrschaft und postkolonialer nationalistischer Reaktion und Kontinuität geprägt war.
1.3.1 Kolonialismus, Staat, Scharia
Hallaq geht davon aus, dass die postkolonialen nationalistischen Eliten die Machtstrukturen, die ihnen der Kolonialismus vermacht hatte, aufrechterhalten und nach der Erlangung der Unabhängigkeit keinen wirklichen Bruch mit der Kolonialpolitik vollzogen haben. Die europäischen Kolonialmächte vermachten ihnen einen Nationalstaat samt seiner konstitutiven Machtstrukturen, der nicht zu den bestehenden Gesellschaftsformen passte. Das paradigmatische Konzept des Bürgers, ohne das kein Staat bestehen kann, bildete sich nur sehr schleppend heraus. Die politischen Lücken, die durch die Zerstörung der traditionellen Strukturen aufbrachen, wurden nicht angemessen aufgefüllt. Der Nationalstaat stand daher immer in einem Spannungsverhältnis zu den Gesellschaften in der muslimischen Welt. Die politische Organisation, die vom Kolonialismus übernommen und danach weiter ausgebaut wurde, blieb stets von Autoritarismus und Unterdrückung gekennzeichnet. Soweit die Scharia für die Regierungsform in Anspruch genommen wurde, ging dies kaum über bloße Lippenbekenntnisse hinaus. Wo mehr angestrebt wurde, hat der Staatsapparat die Scharia-Normen der Gouvernanz in seinen Dienst gestellt und entstellt, woraus sich in der Folge ergeben hat, dass sowohl die islamische Gouvernanz als auch der moderne Staat als politische Projekte misslungen sind.
Das moderne Experiment in der muslimischen Welt muss daher als in politischer und rechtlicher Hinsicht gescheitert gelten. Aus ihm können keine positiven Lehren darüber gezogen werden, wie Muslime sich selbst regieren sollten. Dass die »Scharia« in etlichen Verfassungen als »eine« oder »die« Quelle des Rechts verankert wurde, ändert nichts daran, dass sie institutionell tot und politisch missbraucht ist. Für die Frage nach einer islamischen Gouvernanz hat die Erfahrung mit dem modernen Staat und seiner sogenannten »Scharia« keinen positiven Beitrag zu leisten. Daher muss sich unsere Aufmerksamkeit darauf richten, was die Scharia für Muslime während der zwölf Jahrhunderte vor der Kolonialzeit bedeutete, als ihr noch der Rang eines Paradigmas zukam.
So bleibt einzig die Frage, wie sich Muslime in der vorkolonialen Geschichte organisiert und regiert haben. Wenn die These von der Unmöglichkeit eines modernen islamischen Staates zutrifft, kann es eine solche Regierungsform nicht gegeben haben. Aber auch historische Gründe schließen diese Möglichkeit aus, da der moderne Staat ausschließlich ein Produkt der europäischen Geschichte ist. Zudem sprechen nicht-historische Gründe dafür, denn es bestand eine qualitative Differenz bereits zwischen vormodernen prototypischen »Staaten« und vormodern islamischen Formen der Gouvernanz. Wer letztere unterschiedslos als vormoderne »Staaten« klassifiziert, macht sich Hallaq zufolge des Versäumnisses schuldig, die paradigmatischen Kräfte nicht gebührend zu berücksichtigen, die der »islamischen Gouvernanz« Form und Inhalt verliehen.
Gestalt und Verfassung der modernen Welt sind weitgehend von den materiellen und geistigen Institutionen des übermächtigen Europas samt seinem kolonialen Ableger Nordamerika bestimmt. Während der Westen in einer Gegenwart lebt, die immerhin aus seiner eigenen Geschichte mit Aufklärung, industrieller Revolution, moderner Wissenschaft, Nationalismus, Kapitalismus und amerikanisch-französischer Verfassungstradition hervorging, wurden dem »Rest« der Welt die Bedingungen der Modernität von außen aufgezwungen. Die meisten Menschen wurden ihrer eigenen Geschichte und Lebensweise beraubt. Die politischen, rechtlichen und kulturellen Kämpfe der heutigen Muslime entspringen daher in hohem Maße der durch die westliche Vorherrschaft gegen ihren eigenen Willen erzeugten Spannungen zwischen den moralischen Realitäten der modernen Welt, in denen sie zwangsweise leben müssen, einerseits und ihren eigenen moralischen und kulturellen Bestrebungen und Hoffnungen andererseits. Der hegemoniale Diskurs der Modernität lässt ihnen dabei nur die Wahl zwischen Untergang und Anpassung, bestenfalls Aufholen. Fortschritt jedenfalls gibt es nur um den Preis des Verlusts der eigenen Traditionen und historischen Erfahrungen. Und meist führen die Anstrengungen in diese Richtung ohnehin nur in verheerende Kriege, Armut, Elend, Krankheit und Zerstörung der Natur.
Die Fürsprecher des modernen Projekts mögen dagegenhalten, dass es Armut und Elend schon immer gegeben habe und gerade der Fortschritt einen Ausweg aufzeige. Hallaq begegnet ihnen mit drei Gegenargumenten. Erstens sind Armut und Elend unter den Bedingungen der Moderne allemal nicht mehr das Werk der Natur, sondern menschengemacht, also Produkt von Kapitalismus, Industrialismus und der damit einhergehenden Naturzerstörung; sie sind eben Wirkungen des sogenannten Fortschritts. Zweitens führt die durch den staatlichen Kapitalismus hervorgerufene Zersplitterung der Gesellschaft zur Auflösung der traditionellen Familie und Gemeinschaft und zur Herausbildung des entzauberten, fragmentierten und narzisstischen Individuums; dieser Zusammenbruch ist ein wesentlicher Bestandteil des modernen Projekts. Drittens kann es keinen Zweifel an den zerstörerischen Folgen des modernen Projekts für die natürliche Umwelt geben.
Dieses Projekt der Zerstörung muss auf einer moralischen Grundlage untersucht und bewertet werden, wie Hallaq unmissverständlich deutlich macht:
Es ist ein Desaster, für das wir alle verurteilt werden müssen, nicht als wissenschaftlich bestimmter homo oeconomicus oder bloß als unverantwortliche Konsumenten, sondern als moralisch verantwortliche Wesen. Die moralischen und anderen Implikationen dieses Projektes sind im wesentlichen epistemologischer Natur, denn sie betreffen unsere Philosophien, Soziologien, Wissenschaften, Technologien, Politiken und alles, was wir tun. (S. 4)
Alle drei Gegenargumente sind mit unserer Konstitution als moralische Subjekte untrennbar verbunden und müssen auf moralische Verantwortung hin befragt werden. Erst die Marginalisierung der moralischen Dimension und ihre Abspaltung von Wissenschaft, Ökonomie und Recht, die zum Wesen des modernen Projekts gehören, hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass soziale Ungerechtigkeit, gesellschaftliche Auflösung und Naturzerstörung in einem solchen Ausmaß hervorgebracht werden konnten. Selbst nach Maßgabe der Aufklärung, die doch meist immerhin Moral auf rationaler Grundlage predigt, - geschweige denn nach islamischen Ansprüchen – sollte die Frage nach der moralischen Verantwortung nicht völlig aufgegeben werden. Und die Fürsprecher der Moderne müssen sich zumindest vorhalten lassen, dass das Verständnis moralisch verantwortlichen Handelns in vormodernen Gesellschaften eine hohe Hürde gegen die Durchführung des Projekts der Zerstörung gebildet hätte, wenn letzteres dieses Verständnis freilich nicht ohnehin völlig neutralisiert und unterminiert hätte. Menschen, die sich bewusst sind, für die Folgen ihres Handelns zur Verantwortung gezogen zu werden, und die mit den verheerenden Konsequenzen nicht leben können und wollen, bilden sich nur unter sorgsam gewählten und gehüteten Bedingungen heraus. Doch alle dafür erforderlichen Voraussetzungen und Schranken wurden vom Projekt der Moderne niedergerissen. Und der Staat hat dabei eine ebenso entscheidende wie unrühmliche Rolle gespielt.
1.3.2 Projekt der Aufklärung und moralische Ressourcen
Unter diesen Umständen gibt es gute Gründe, auf die Suche nach moralischen Ressourcen in anderen Traditionen zu gehen. Hallaq sucht hier Anschluss an westliche Denker wie Alasdair MacIntyre und Charles Taylor. Insbesondere MacIntyre hat sich ausgehend von der Diagnose, dass das moderne Projekt der rationalen Rechtfertigung der Moral gescheitert ist und die moralischen Ressourcen moderner Gesellschaften erschöpft sind, vormodernen Traditionen zugewandt. Diese Denker haben sich dabei auf die sogenannte »europäische« Tradition beschränkt, etwa auf Platon, Aristoteles und Thomas von Aquin – »sogenannte«, weil es sich um eine konstruierte eurozentrische Tradition handelt. Denn Platon und Aristoteles sind keineswegs so eindeutig »europäisch«, sondern vielmehr durch einen Prozess der Ausblendung dazu gemacht worden, und Thomas von Aquin könnte durchaus als Schüler des arabischen und muslimischen Philosophen Ibn Ruschd gelten.
Hallaq hingegen richtet seine Untersuchung auf die moralischen Ressourcen der muslimischen Kultur aus. Denn Muslime verfügen über ihre eigene reiche Tradition, welche die kulturellen Leistungen vieler Jahrhunderte in sich birgt. Diese Tradition übt auch heute noch einen tiefen und bestimmenden Einfluss auf moderne Muslime aus. Aus der Sicht des Projekts der Aufklärung, das ausschließlich die autonome Vernunft als Grundlage der Moral anerkennt, erscheint jeder Versuch, eine alternative Weise des Verstehens, die sich zudem auf eine Tradition stützt, zu entwickeln, als irrational. MacIntyre versucht dagegen nicht nur aufzuzeigen, dass das Projekt der Aufklärung selbst gescheitert ist, sondern auch, dass Tradition und Vernunft sich keineswegs ausschließen müssen. Vielmehr können rationale Untersuchung und ethische Werte in einer Tradition eingebettet sein und über verschiedenen Traditionen hinweg wirksam werden.
So schreibt MacIntyre etwa:
Gibt es also solch eine alternative Weise des Verstehens? Wessen hat uns die Aufklärung beraubt? Wofür uns die Aufklärung größtenteils blind gemacht hat und was wir wiedererlangen müssen, ist, so werde ich argumentieren, eine Konzeption der rationalen Untersuchung als in einer Tradition verkörpert, eine Konzeption, der zufolge die Maßstäbe der rationalen Rechtfertigung selbst aus einer Geschichte hervorgehen und zu dieser gehören, in der sie bestätigt werden durch die Weise, in der sie die Grenzen überschreiten und Abhilfen für die Mängel ihrer Vorgänger innerhalb der Geschichte eben derselben Tradition liefern.9
Hallaq sieht große Ähnlichkeiten auf der theoretischen Ebene zwischen seinem Projekt und insbesondere dem von MacIntyre. Die moralischen Ressourcen der vormodernen islamischen Tradition, um die es ihm zu tun ist, spiegeln aber nicht nur eine geteilte theoretische und philosophische Untersuchung wider, sondern auch eine paradigmatische Lebensweise, was von noch größerer Bedeutung ist. Die westlichen Denker beziehen sich auf eine Tradition und Gemeinschaft, die es als gelebte Realität nie gegeben hat, sondern allenfalls als Ideal einer bloß intellektuellen Tradition. Die islamische Tradition, auf die sich das Projekt der Wiedergewinnung moralischer Ressourcen beziehen kann, verbindet hingegen theoretische und philosophische mit soziologischen, anthropologischen, rechtlichen, politischen und ökonomischen Phänomenen, die in der islamischen Geschichte als paradigmatische Überzeugungen und Praktiken entstanden sind.