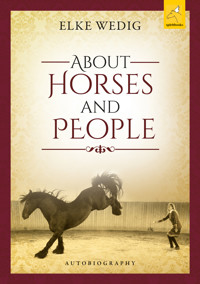Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: spiritbooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Pferde haben mich mein ganzes Leben lang begleitet. Lange habe ich geglaubt, dass es meine Aufgabe ist, sie zu korrigieren und ihnen etwas beizubringen. Dass das bestenfalls in beide Richtungen geht, habe ich erst relativ spät verstanden. Heute weiß ich, die Pferde haben mich zu der gemacht, die ich heute bin. Sie sind meine besten Freunde, meine Lehrmeister und meine Therapeuten. Sie sind geradlinig, viel klüger als wir denken und treu. Sie spiegeln uns und geben uns immer wieder die Chance, es besser zu machen. Wenn sie lieben, werden sie niemals ihre Kraft und Schnelligkeit gegen uns einsetzen und vor allem können sie verzeihen und haben unglaublich viel Geduld. Mit diesem Buch, mit meinen persönlichen Erfahrungen, habe ich versucht, etwas von diesen Geschenken an sie zurückzugeben. Ich wünsche mir, dass immer mehr Reiter und Pferdemenschen ähnliche Erfahrungen machen wie ich und ihren Pferden und vielleicht sogar ihren Mitmenschen mit einem offenen Herzen, Geduld und Liebe begegnen können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Einstimmung
Kindheit und erste Begegnungen mit Pferden
Das Glück dieser Erde in der Reitschule Hölzel
Freizeitreiterfahrungen auf dem Hasenhof – mein erstes eigenes Pferd
Erste Turniererfahrungen
Wenninger Höfe und Gunnar Schlosser
Endlich erfolgreiche Springreiterin
Im Dressurstall Udo Lange
Elegant
Im Reitinstitut Egon von Neindorff
Meine Zeit mit Melissa
Umbruchstimmung
Ein eigener Hof
Monty Roberts
Barockreitzentrum – die Aufbauphase
Auf den Spuren von Xenophon und Guérinière
Das Barockreitzentrum präsentiert sich öffentlich
Cor de Jong Zirzensik und Fahren
Die Zeit der Friesen
Jean Claude Racinet – Feines Reiten in der französischen Tradition der Légèreté
Schiefentherapie
Dr. Gerd Heuschmann und ein ganzheitlicher Blick auf das Pferd
Sommerfeste, Seminare, Messen
Ulrike Dietmann, Epona und die ersten therapeutischen Ansätze
Zurück in die Staaten
Workshop
Die authentische Gemeinschaft
Meet the Herd
Der Bodyscan
Energetische Felder und Grenzen
Authentisches Selbst versus Falsches Selbst
Emotional Message Chart
Nuno Avelar und Working Equitation
Amanecer
Schlussbetrachtungen
Danksagung
Abbildungsverzeichnis
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Verlag verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne die Zustimmung des Verlags unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Verlags.
© 2023 Elke Wedig · www.barockreitzentrum.de
Verlag: spiritbooks, Ulrike Dietmann, Plieninger Str. 1 / 43, 70771 Leinfelden-Echterdingen · spiritbooks.de
Satz u. Layout / E-Book: Büchermacherei · Gabi Schmid · buechermacherei.de
Covergestaltung: OOOGrafik · ooografik.de
Bildquellen: Privatarchiv Autorin; Anja Blum · anja-blum.com; Angela Brückl; Thomas Hartig · tomspic.de; Karolin Heepmann; Miriam Heidt · miriam-heidt.fotograf.de; Carola Steen · carola-steen.de;Sabine Walczuch · swphotoart.com
Druck und Distribution im Auftrag des Verlags: tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg
ISBN Softcover: 978-3-946435-18-1
ISBN Hardcover: 978-3-946435-19-8
ISBN E-Book: 978-3-946435-20-4
Vorwort
Elke Wedig kann man eigentlich nicht beschreiben. Sie ist ein Geist mit vielen Dimensionen.
Für mich ist Elke eine wundervolle Freundin, mit der ich sprichwörtlich schon viele Pferde gestohlen habe. Und sie ist eine großartige Inspiration, nicht nur, was Pferde betrifft. Sie ist eine Welten-Reisende, die fließend vier Sprachen spricht. Und ein paar Sprachen, die nur die Reisenden der Anderswelt kennen.
Ich kenne keine andere Pferdefrau, die so viel erlebt hat und gelernt hat und sich umgeschaut hat in der Pferdewelt wie Elke. Ihr Geist ist ewig neugierig, ähnlich wie meiner, und wenn wir uns treffen, vergessen wir, die Stopptaste zu drücken.
Ich habe von Elke unendlich viel gelernt über Pferde. Wir sind uns begegnet, als ich einen Hof gesucht habe, um die Arbeit von Linda Kohanov in Deutschland bekannt zu machen. Elke hat mir großzügig ihre einzigartigen, wertvollen Pferde zur Verfügung gestellt. Ich durfte viele Jahre in Workshops mit ihnen arbeiten, mit Maxim, Baron, Habanero, Impressioso, den Ponies Susi und Snow und vielen anderen. Die Pferde von Elke haben die Herzen und Seelen vieler Menschen unvergesslich berührt.
In Elkes Barockreitzentrum durfte ich auch zehn Jahre lang das Horse & Spirit Festival veranstalten, ein hoch spirituelles Event, das neue Visionen vom nicht-dominanten Umgang mit Pferden und einer friedlichen Mensch-Pferd-Beziehung in die Welt trug.
Elke und ich haben viele Jahre zusammen Horse Dancing und andere Seminare unterrichtet, wir haben wundervolle Reisen zusammen unternommen und sie hat mir im Dschungel von Jamaika das Leben gerettet, indem sie einen Arzt für mich fand.
Elke ist ein Mensch mit ungewöhnlicher Intelligenz und Tatkraft. Das Barockreitzentrum zu leiten, mitsamt dem Programm internationaler Trainer, war ein Kraftakt, den nur wenige zu Stande bringen würden. Ihr unbestechlicher Realitätssinn, ihre Toleranz und ihre sehr hohe Arbeitsmoral haben es möglich gemacht.
Mit Elke kann ich Tacheles reden wie mit wenigen Menschen, schnörkellos, wahr und mit viel Gelächter. Sie ist nicht nur eine wetterfeste Geschäftsfrau, sondern auch ein kreativer Freigeist, der immer offen ist für neue Abenteuer. Und dabei liebevoll und herzlich, wohlwollend und großzügig. Wie gesagt, man kann Elke eigentlich nicht beschreiben. Man muss sie erleben. Oder lesen. Ich lege ihre Autobiografie jedem Pferdemenschen ans Herz.
Elkes Buch ist ein Zeugnis der wichtigsten Entwicklungen, die es in den letzten Jahrzehnten in der Pferdewelt gegeben hat. Elke war hautnah dabei. Egon von Neindorff, Monty Roberts, Linda Kohanov, you name it - Elke kennt sie alle.
Elkes Buch beschreibt, wie sich die Pferdewelt hin zu einem einfühlsamen Umgang mit Pferden entwickelt hat. Elke hat diese Bewegung selbst mit in Gang gebracht.
Es ist eine Ehre, eine Freude und ein Geschenk, ihre Freundin zu sein.
In jeder Zeile ihres Buches stecken nicht nur wertvolle Informationen, sondern vor allem auch eine überaus große, ganz und gar gelebte Liebe für die Pferde.
Toll, dass du das alles aufgeschrieben hast, liebe Elke.
Ich wünsche vielen Lesern den Genuss, den ich beim Lesen haben durfte.
Deine Ulrike
Einstimmung
Ich heiße Elke Wedig und – das kann ich heute mit über fünfzig Jahren Reiterfahrung sagen – ich habe mein Leben den Pferden gewidmet.
Pferde haben mich schon immer fasziniert. Ich hatte aber auch durch meine erste schicksalhafte Begegnung mit einer bissigen Stute im zarten Alter von sechs Jahren gebührenden Respekt vor ihnen.
Mit dreizehn begann meine reiterliche Karriere, und schon wenige Jahre später wurde ich zur erfolgreichen Turnierreiterin und war stolz, mich dem Reitsport verschrieben zu haben.
Über zwanzig Jahre lang war ich fast jedes Wochenende auf Reitturnieren. Anfangs ritt ich Springprüfungen bis zur schweren Klasse, danach Military bis Klasse M und schließlich, weitere zehn Jahre klassische Dressur, ebenfalls bis zur schweren Klasse.
Persönlich war ich damals auch sehr aktiv in der esoterischen Szene unterwegs. Ich besuchte viele Seminare und Kongresse im In- und Ausland und übte mich täglich in der indischen Raja Yoga Meditation. Durch meine persönlichen Erfahrungen wurde mir immer bewusst, dass Pferde nicht wie Motorräder funktionieren, also nicht auf Knopfdruck. Es machte also gar keinen Sinn, nur technisch perfekt reiten zu wollen. Man musste einen Zugang zu ihnen finden und eine persönliche, freundschaftliche und vertrauensvolle Beziehung mit ihnen aufbauen. Man musste herausfinden, wie sie ticken und was sie wollen.
Da es in der Turnierszene natürlich in erster Linie um Erfolge geht und der Spruch „gekämpft wird mit allen Mitteln“ leider kein Märchen ist, verlor sich deshalb für mich irgendwann die Faszination für Erfolg und Schleifen unter den auf Turnieren herrschenden Bedingungen, und Reiten als Sport zu betreiben war auf einmal keine Option mehr.
Ich wollte mehr und machte mich auf zu neuen Ufern. Immer mehr festigte sich mein Wunsch, Reiten als Kunst erlernen zu wollen und so entstand die Idee für das Barockreitzentrum, dessen Aufbau ich über fünfzehn Jahre meines Lebens gewidmet habe.
Das Konzept war von Anfang an klar: mein Reitzentrum sollte ein Tempel der Ruhe, der Kompetenz und der Möglichkeiten sein für eine fachgerechte und geduldige Ausbildung von Reiter und Pferd.
Die Pferde sollten durch die Ausbildung glücklicher und schöner werden. Die Reiter sollten nicht nur lernen, korrekte Hilfen zu geben, sondern immer mehr in die Seele des Pferdes eindringen und die Welt mit den Augen der Pferde sehen können. Das war auch der Grund, warum ich außer meinen eigenen Pferden, die als Schul- und Showpferde dienten, nur zehn Kundenpferde hatte. Ich brauchte nicht nur Raum für Kunden und Reitschüler, sondern auch für neue Ideen. Dabei sollten meine ganz unterschiedlichen persönlichen Erfahrungen und Fähigkeiten in das Konzept mit einfließen.
Aber am Wichtigsten war mir, dass das Ausbildungszentrum eine Begegnungsstätte mit den Besten werden sollte. Und so begann ich, einen Seminarbetrieb mit den hervorragendsten Ausbildern und Coaches, die ich bekommen konnte, aufzubauen.
Durch das Reitinstitut und später auch durch meine Reitweisen übergreifenden Ausbildungen in American Horsemanship bei Monty Roberts in Kalifornien und der fortführenden, ganz ins Therapeutische gehenden Ausbildung bei Linda Kohanov in Arizona, kam ich meinem Ziel, holistisch arbeiten wollen, entscheidend näher. Durch Monty habe ich gelernt „Schnell ist langsam“ und „Langsam ist schnell“. Linda wurde dann mit dem „Tao des Equus“ noch präziser: „Der Weg ist das Ziel“.
Das war für mich eine entscheidende Erkenntnis. Ich verstand auf einmal, dass der Prozess das Entscheidende war. Ich musste die Geduld bekommen für die kleinen Schritte und die Wichtigkeit Herrn von Neindorffs Standardsatz „Gehe bis an die Grenze, überschreite diese nie!“ verstehen und umsetzen lernen. Ich musste aufhören, Kommandos zu geben und das Endprodukt erzwingen zu wollen. Ich musste lernen, zuzuhören und dem Prozess zu vertrauen.
Die besten Lehrmeister waren aber mit Unterstützung meiner zweibeinigen Ausbilder zweifelsfrei die Pferde. Ich habe ihnen alles zu verdanken. Kluge Ausbilder sagen immer „Reiten ist Persönlichkeitsentwicklung“. Und ja, wenn man ausdauernd genug ist und keine Rückschläge und Enttäuschungen scheut, wenn man bereit ist, sich von erfahreneren Reitern und vor allem von den Pferden korrigieren zu lassen, hat man die Chance zum Diamanten geschliffen zu werden.
Ich erinnere mich noch an meine Diskussionen mit Herrn von Neindorff, weil ich es als junger Mensch – ich war damals Anfang dreißig – einfach nicht wahrhaben wollte, dass Reiten Reife und Erfahrung erfordert. Wir sprachen mehrfach über Nicole Uphoff, die 1988 in Seoul mit Rembrandt die Goldmedaille in der Einzelwertung und in der Mannschaft gewonnen hatte, und ich fand es höchst ungerecht, dass Herr von Neindorff den eigentlichen Erfolg ihrem Trainer Uwe Schulten-Baumer zusprach und meinte, Frau Uphoff sei viel zu jung um eine derartige Anforderung zu bewältigen.
Ich dachte damals, aus seinen Worten spreche Neid auf das junge, hübsche Mädchen, das es der Reiterwelt und den ganzen Favoriten gezeigt hatte.
Aus heutiger Sicht habe ich die Wichtigkeit des Ausbilders verstanden. Ich weiß heute, dass der Reiter Hilfestellung von Seiten eines versierten Trainers braucht, und dass das Pferd gleichermaßen einen Herdenchef und einen Freund braucht, den es respektiert und zu dem es Vertrauen fassen kann.
Ein Gegenüber, das seiner Kraft, Schnelligkeit und Sensibilität ebenbürtig ist. Es braucht einen Menschen, dem es nicht mehr auf Selbstdarstellung, egoistische Zielerreichung und Zurschaustellung ankommt, jemand der in den Hintergrund treten kann und über Jahre täglich für sein Pferd da ist, ihm lebenslang regelmäßige, an Alter und Fähigkeiten angepasste Arbeit bietet und ohne Zeitdruck die Entfaltung seines ganzen Potentials ermöglicht.
Kurz gesagt kämpfe ich heute nicht mehr mit allen Mitteln. Ich kämpfe überhaupt nicht mehr.
Ich arbeite dafür auf mehreren Ebenen mit meinem Pferd: der körperlichen, der mentalen, der intuitiven, der emotionalen und der seelischen.
Ich wünsche mir, dass immer mehr Menschen die Welt mit den Augen ihres Pferdes sehen lernen und Freude daran finden, an sich selbst zu arbeiten. Dass die Reiter still werden und beobachten lernen, dabei ihrer persönlichen Erfahrung vertrauen und sich immer mehr auf die Erkenntnisse, die uns die Pferde vermitteln, einlassen können.
Ich bin stolz darauf, dass ich in einigen meiner Reitschüler die gleiche Leidenschaft für die Pferde entfachen konnte, die ich von frühester Jugend an verspürt habe und die mich mein ganzes Leben lang begleitet und zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin.
Wie Audrey Hasta Luego, eine junge Reiterin, die ich das erste Mal 2006 auf der Apassionata kennengelernt habe und seither maßlos bewundere, gesagt hat, kann die Erfüllung der Leidenschaft die Quelle größten Glücks sein. Sie kann einen aber auch in die Isolation führen, wenn man niemanden findet, der sie teilt.
In diesem Zusammenhang wäre es schön, wenn ich mit meiner Geschichte und dem Teilen meiner Erfahrungen einen kleinen Beitrag in Richtung Verständnis und Liebe für die Pferde leisten könnte.
Herzlichst, Elke Wedig
Kindheit und erste Begegnungen mit Pferden
Ich hatte eine behütete Kindheit mit meinen Eltern und meiner Urgroßmutter Friederike, die bereits über achtzig war und mit der ich mein Kinderzimmer teilte. Mein Leben war völlig unspektakulär. Ich ging wie alle anderen Kinder in der Nachbarschaft mit drei Jahren in den Kindergarten, der einen wunderschönen großen Garten hatte mit Wildblumen und vielen bunten Schmetterlingen, die ich sehr liebte.
Ich war ein verträumtes Kind und beobachtete gerne Tiere, nicht nur Schmetterlinge, sondern auch Ameisen und Kellerasseln und von den meisten Wiesenblumen wusste ich schon damals, wie sie hießen und wofür sie gut waren.
Meinen Vater bekam ich die ganze Woche über kaum zu Gesicht. Er war nach dem verlorenen Krieg Architekt geworden. Mehr aus einer Laune heraus. Er hatte, um nach dem Krieg als schlesischer Flüchtling Lebensmittelmarken zu bekommen, helfen müssen in Stuttgart, seiner neuen Wahlheimat, Kriegstrümmer in der Innenstadt zu beseitigen.
Da diese Tätigkeit beim Architekturstudium als Praktikum anerkannt wurde und da nach dem Krieg die meisten Häuser zerstört waren, dachte er sich, wenn er schon nicht Flugzeugbauer werden konnte, was eigentlich sein Traumberuf gewesen wäre, wäre es schlau, Architekt zu werde und statt Flugzeugen Häuser zu bauen. Seine Überlegungen waren richtig gewesen. Er war ein ziemlich erfolgreicher Architekt und hat einige hundert Häuser gebaut.
Für mich als Kind hatte das eher negative Folgen, weil ich meinen Vater so gut wie nie sah. Zum Mittagessen war er selten da und abends kam er oft so spät, dass ich schon schlief. Selbst am Wochenende sah ich ihn nur zu den Mahlzeiten und, wenn das Wetter gut war, am Sonntagnachmittag bei einem Spaziergang um den Riedsee. Sonst verbrachte er seine Zeit im Büro, auf Baustellen oder im Kunden- oder Handwerkergespräch.
Da ich ein Einzelkind war und – zumindest aus meiner Warte – immer nur den Mund zu halten hatte und lieb und unauffällig sein musste, verbrachte ich die meiste Zeit bei meinen Freundinnen Christine und Conny auf der anderen Seite der Straße. Dort genossen wir viele Freiheiten. Wir spielten im Garten und im Haus. Dort bauten wir manchmal die halbe Wohnung um, wenn wir eins unserer Lieblingsspiele „Geisterbahn“ spielten. Dann wurden die Rollläden heruntergelassen und die Möbel mit Leintüchern abgedeckt. Zwei von uns versteckten sich in der Kulisse und erschreckten die Dritte, die die Geisterbahn alleine betreten musste. Das war ein großer Spaß. Bei uns zu Hause wären derartige Spiele völlig undenkbar gewesen.
Christine und Conny hatten auch eine Puppenküche, die mit Karbid funktionierte. Darauf produzierten wir in den Wintermonaten Apfelkompott, und geröstete Haferflocken. Das schmeckte köstlich, und so konnten wir auch „Restaurant“ spielen.
Super waren auch unsere Zeltnächte im Garten, bei denen es, als wir etwas älter waren, eine Mutprobe gab. Wir mussten nachts um zwölf Uhr über die Zäune in andere Gärten steigen. Das war besonders aufregend, weil wir uns nicht immer sicher waren, ob die Leute Hunde hatten.
Der absolute Exzess war aber, mitten in der Nacht über den dunklen Friedhof zu laufen. Wir hatten alle drei tierische Angst, waren aber total stolz, dass wir uns das getraut hatten. Die Erwachsenen hatten natürlich keine Ahnung von unseren nächtlichen Abenteuern.
Besonders schön war es auch, mit Christine und Conny und deren Mutter zum Volksfest auf den Cannstatter Wasen mitgehen zu dürfen. Da fuhren wir nämlich Kettenkarussell, Boxauto, Achterbahn und natürlich Geisterbahn. Am beeindruckendsten für mich war aber, dass Conny, die Jüngste von uns, auf dem Volksfest immer reiten wollte. Ich bewunderte sie maßlos, hatte ich doch große Angst vor Pferden.
Meine erste Begegnung mit Pferden war nämlich eher traumatisch gewesen. Wie jeden Sonntag musste ich mit meinen Eltern und meiner Urgroßmutter nach dem Mittagessen spazieren gehen. Das war total doof, aber unumgänglich. Meine Eltern wussten natürlich, dass ich diese Spaziergänge überhaupt nicht mochte, zumal wir immer denselben Weg vor und zurück gingen, vom Sonnenberg in Richtung Möhringen, einmal um den besagten Riedsee und wieder heim. In meinen Augen ein völlig sinnloses Unterfangen Dann gab es Kaffee. Ich fand das schrecklich langweilig und völlig unsinnig, und Kaffee war für mich zu damaligen Zeiten nichts Erfreuliches.
Dieses Mal, es war ein sonniger Sonntag im Mai, machten wir einen Umweg über die Felder an einer Koppel vorbei, auf der mehrere Pferde grasten. Meine Eltern hatten sich das höchstwahrscheinlich ausgedacht, um mehr Begeisterung für ihre Spaziergänge bei mir hervorzurufen, was ihnen allerdings niemals gelungen ist. Bis heute sehe ich keinen gesteigerten Sinn im sinnlosen durch die Gegend Laufen oder Wandern.
Trotzdem, die Aussicht bei unserem Spaziergang an der Pferdekoppel vorbei zu kommen, gefiel mir. Ich mochte Tiere schon immer sehr gerne, vor allem Pferde, und ich war sehr traurig, dass ich nach jahrelangem Betteln nur eine Schildkröte bekam. Ein Hund, eine Katze oder womöglich ein richtiges Pony waren völlig außer Diskussion.
Ich war erst sechs Jahre alt und daher noch niemals auf einem Pferd gesessen. Ich bewunderte meine Freundin Conny immer total, wenn sie jede Gelegenheit mit Pferden in Kontakt zu kommen nutzte und dann überglücklich strahlte und unendliche Runden auf dem Rücken von irgendwelchen Zirkus- oder Volksfestpferden drehte, anstatt wie ihre Schwester und ich Eis zu essen oder Kettenkarussell, Riesenrad oder Boxauto zu fahren.
Als wir uns nun dieser Koppel näherten, wollte ich mir die Pferde ganz genau aus der Nähe ansehen. Ich hegte ja bereits seit einiger Zeit den heimlichen Wunsch, auch einmal reiten zu dürfen. Die Pferde erschienen mir sehr groß, aber zwischen uns war ja zum Glück ein ziemlich hoher und, wie ich dachte, sicherer Zaun. Umso erschrockener war ich, als ein riesiges weißes Pferd blitzschnell einen Satz nach vorne machte, seinen langen Hals über den Zaun bog, die Ohren anlegte und mich beherzt in den Rücken biss. Das Pferd biss richtig zu und ließ auch nicht los. Es hob mich an meiner Jacke hoch und schüttelte mich durch die Luft.
Ich erinnere mich noch genau an den Schmerz und das Gefühl der Panik, die ich damals empfand. Ich war mir sicher, dass das wilde Pferd mir den Rücken brechen und ich gleich tot sein würde. Mein Vater griff ein, indem er laut schreiend, mit einem Knüppel bewaffnet, auf das Pferd losging. Die Drohgebärde war erfolgreich und der Schimmel ließ mich mit einem Ruck fallen. Es sollte fast sieben Jahre dauern, bevor ich mich wieder in die Nähe von Pferden wagte.
Mit zwölf Jahren – ich war inzwischen schon auf dem Gymnasium – erzählte mir eine Klassenkameradin, dass sie Reitunterricht nehme. Ich war völlig sprachlos, auf der einen Seite entsetzt, auf der anderen Seite neidisch, und rang mehrere Wochen mit mir selbst, was das nun für mich bedeutete. Je länger ich darüber nachdachte, umso sicherer war ich mir, dass ich auch reiten lernen wollte.
Ich nahm allen Mut zusammen und teilte meiner Mutter meinen Wunsch mit. Ihre Antwort war „Du spielst doch schon Klavier und im Übrigen gehst du doch auch noch aufs Gymnasium. Du hast doch gar keine Zeit für noch ein Hobby.“
Klavier spielen war für mich ähnlich wie unsere sonntäglichen Spaziergänge eine ebenso unerfreuliche wie sinnlose Tätigkeit, obwohl ich im Grunde genommen ein musischer Mensch bin und schon immer dem Künstlerischen gegenüber aufgeschlossen war. Aber ich sah einfach keinen Sinn im Üben endloser Etüden, zumal es ja Radios und Plattenspieler gab, wenn man richtig schöne Musik hören wollte, und die Fingerübungen hauten einen echt nicht vom Hocker. Und überhaupt fragte ich mich, wieso das Ganze bei stillstehender Hand und leicht gebogenen Fingern ablaufen sollte. So bescheuert, wie das in meinen Ohren klang, das hätte mir erst einmal einer erklären müssen.
Meine Klavierlehrerin, die meiner kindlichen Auffassung nach mindestens siebzig sein musste, trug leider auch nicht zu meiner Begeisterung für das Klavierspiel bei. Mit ihrem ewigen Czerny und der Kunst der Fingerfertigkeit, sowie kurzen, täglichen und praktischen, in jedem Fall aber endlosen Fingerübungen hatte ich einfach keine Freude daran. Ich erinnere mich bis heute an die Schmerzen, die ich hatte, wenn sie mir meinen kleinen Finger mit ihrem fetten Daumen auf eine schwarze Taste drückte und dabei „haaalten!!!“ brüllte.
Meine Freundinnen, die nicht annähernd so lange spielten wie ich, durften bereits Schlager und Volkslieder spielen, während ich mich immer noch mit Akkorden oder blödsinnigen Triolenübungen, abplagte.
Aber das Allerschlimmste waren meine Freundinnen Christine und Conny, an deren Haus ich jedes Mal vorbeigehen musste, wenn ich in die Klavierstunde ging. Sie wussten genau, wann ich Unterricht hatte, und lauerten schon am Gartentörchen. Sie hüpften dann herum, zeigten mit dem Finger auf mich und lachten mich aus, weil meine Klaviermappe größer war als ich selbst.
Meine Mutter hatte einmal etwas über das Wunderkind Mozart gelesen und mich deshalb im zarten Alter von drei Jahren gefragt, ob ich nicht Klavierspielen lernen wollte. Ich hatte nur einmal an der falschen Stelle „ja“ gesagt und musste das nun seit meinem vierten Lebensjahr bereits neun Jahre lang durchziehen.
Als ich bei meiner Mutter auf Granit biss, fragte ich am nächsten Sonntag meinen Vater. Er meinte diplomatisch, ich solle es mir die nächsten vier Wochen überlegen, denn Reiten sei teuer, und wenn ich das wirklich anfangen wolle, dann müsste ich ganz sicher sein, dass ich dabeibleiben würde.
Ich war ein folgsames, eher schüchternes Kind und als Einzelkind war es ja sowieso schwer, einen eigenen Standpunkt vertreten zu können. Die Erziehung in den fünfziger Jahren war immer noch von den Kriegserfahrungen der Erwachsenen und damit natürlich auch von denen meiner Eltern geprägt. Meine Mutter hatte im Krieg mit siebzehn Jahren beide Eltern verloren und lebte mit ihrer Großmutter zusammen. Mein Vater war seit seinem siebzehnten Lebensjahr als Nachtjäger im Krieg gewesen und wusste lange Zeit nicht einmal, ob seine Familie überhaupt noch lebte und wo sie waren.
Als Schlesier waren sie aus ihrer Heimat vertrieben worden und das Einzige, was meinem Vater wichtig war, war, die russische Besatzungszone zu verlassen, sonst, so teilte er seiner Familie schon während des Krieges mit, würde er sie nie mehr besuchen kommen. Er selbst ging nach dem Krieg mit einem Kriegskameraden, der aus Stuttgart kam, in die amerikanische Zone, möglichst weit weg von den Russen, und landete deshalb in Stuttgart. Das war ein großes Glück für ihn und unsere Familie. Viele seiner Verwandten und Freunde waren in Ostdeutschland geblieben und lebten so bis zum Mauerfall am 9. November 1989 in der DDR.
Das Datum des Mauerfalls hat sich mir stark eingeprägt, weil ich mich noch ganz genau erinnere, wie ich davon Kenntnis erhielt. Ich war damals mit meinen Eltern, wie schon seit einigen Jahren, im Urlaub in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mein Vater hatte im November Geburtstag und den verbrachten wir immer traditionell bei einem Strandurlaub in Sharjah.
Wir hatten das schönste Hotel am Ort und waren begeistert von den üppigen arabischen Büffets, den frischen Früchten und Desserts, aber auch von Langusten, Austern und Kaviar, Dinge, die ich von Deutschland überhaupt nicht kannte und die es im Nachkriegsdeutschland für Otto Normalverbraucher vermutlich auch gar nicht gab. Nach dem Abendessen machten wir meistens noch einen ausgedehnten Spaziergang in Richtung der arabischen Souks, einer Art Markthalle, in denen man allerlei Exotisches, aber auch zunehmend europäische Waren zu Schnäppchenpreisen erwerben konnte. Die Emiratis bezahlten ihre Importwaren damals nämlich mit Erdgas und Öl, das aus der Wüste sprudelte und hatten daher noch nicht den richtigen Bezug zu westlicher Ware und internationalen Währungen.
An besagtem 9. November 1989 nahmen wir noch einen Fruitcocktail. Das war ein halber Liter frisch gepresster Saft in mehreren Farbschichten aus mindestens fünf verschiedenen Früchten wie Kiwi, Mango, Erdbeere, Banane und Orange. Wir fanden das absolut köstlich und setzen uns in einen der vielen Saftläden. Im Hintergrund saßen einheimische, im traditionellen Dishdash gekleidete arabische Männer mit den typischen weißen Baumwolltüchern und dem doppelgeflochtenen Stirnband, das das Tuch hält und früher angeblich zum Anbinden der Kamele in der Wüste verwendet wurde. Man konnte es in eine Acht legen und so den Kamelen die beiden Vorderbeine zusammenbinden, was sie daran hinderte, einfach in der Wüste zu verschwinden.
Ich beobachtete die arabischen Männer. Sie erschienen mir damals geheimnisvoll und elegant und, obwohl ich nur ein paar Floskeln arabisch verstand, empfand ich ihre Unterhaltungen immer als harmonisch und fröhlich, ganz anders, als die Unterhaltungen deutscher Männer, die nach meiner Erfahrung oft in Streitgesprächen über Politik, Wirtschaft oder Ähnlichem endeten.
Mir fiel deshalb auf, dass die Stimmung am anderen Tisch plötzlich total kippte. Alle waren plötzlich sehr aufgeregt und automatisch sah ich zum Fernseher und sah Willy Brandt auf der Mauer. Mein erster Gedanke war „die spinnen doch total die Araber. Wie kann man so einen Schrottfilm drehen. Und wie haben die das wohl gemacht. Einfach unglaublich.“ Auch meine Eltern waren der Meinung, dass es sich um einen schlecht inszenierten Film handelte. Wir konnten uns einfach gar nicht vorstellen, dass das, was wir da sahen, wahr sein konnte. Erst am nächsten Morgen, als wir darüber in der Zeitung lasen, verstanden wir, dass das wirklich passiert war.
Ähnliche Erlebnisse hatte ich noch öfter in meinem Leben und ich habe daraus gelernt, wie sehr wir alle von Vorurteilen, unserer Erziehung und unserem Umfeld geprägt sind. Ich verstand, dass auch ich in einer subjektiven Realität lebte, in der es das, was ich mir nicht vorstellen konnte, selbst, wenn ich es sah, einfach nicht gab.
Ganz ähnlich erging es mir, als ich am 11. September 2001 nachmittags unser Wohnzimmer betrat und dort meinen Mann vorfand, der, wie gebannt auf den Fernseher starrte, wo man gerade sehen konnte, wie ein Flugzeug in einen Tower des World Trade Centers flog. Ich war nicht besonders beeindruckt, weil ich dachte, das sei wieder einer dieser typischen Katastrophenfilme, die mein Mann so toll fand.
Diese ganzen Erlebnisse sollten meinen Umgang mit Ereignissen jedweder Art, anderen Menschen und in späteren Jahren vor allem den Umgang mit Pferden maßgeblich beeinflussen.
Doch zurück zum Jahr 1967, dem Jahr, in dem ich beschlossen hatte, dass ich nichts auf der Welt mehr wollte, als reiten zu lernen.
Die Verhandlungen mit meinem Vater liefen zäh.
Nach vier Wochen war ich mir meiner Sache ganz sicher, bekam aber nur Ausflüchte zu hören: Reiten sei eine harte Angelegenheit, teuer, anstrengend und gefährlich und ich solle mir überlegen, ob ich nicht lieber Tennis spielen wolle. Es war natürlich suboptimal, dass mein Vater in meinem Alter bereits bei der HJ geritten war. Reiten und fliegen zu lernen war damals auch für junge Männer ohne Geld leicht möglich. Es diente der Kriegsvorbereitung, obwohl das damals vermutlich den Wenigsten klar war. Jedenfalls war mein Vater einige Jahre vor dem Krieg geritten und hatte beim Thema Reiten keine Erinnerungen an weiße Einhörner mit Glitter in der wehenden Mähne oder von Pferdeflüsterern, die ganz ohne Longe und Peitsche mit den Pferden arbeiteten, und von einfühlsamer Hand und sanfter Kommunikation hatte er bei der HJ auch nie etwas gehört.
Es folgten daher noch wochenlang Berichte über unschöne Erlebnisse, die mein Vater bei der Reiter-HJ gehabt hatte. Besonders auf der rüden Art des Unterrichts hackte er andauernd herum und auf den bösartigen Pferden, die einem schon beim Satteln nach dem Leben trachteten. Der Ausbilder habe ihnen bei ihrer ersten Reitstunde gesagt, sie hätten das große Glück, nun reiten lernen zu dürfen. Das bedeute, sie müssten ab sofort nicht mehr zu Fuß gehen. Dann ging es sofort aufs Pferd und es wurde Abteilung gebildet. Nach zwei Runden Schritt wurde angetrabt, was bedeutete, dass die Hälfte der Jungs bereits das erste Mal vom Pferd fiel. Es wurde sofort wieder aufgesessen, weil es nun ans Galoppieren gehen sollte. Die meisten seien da natürlich wieder heruntergefallen, was total weh täte und die, die sich bis dahin noch oben gehalten hätten wie – seinem Bericht zufolge – er selbst, hätten dann zum Abschluss noch über Cavalettis springen müssen.
Mit dieser Geschichte war die Diskussion fürs Erste beendet. So zogen sich die Reitdiskussionen über ein halbes Jahr. Anfang Januar fragte mich meine Mutter, was ich mir denn zum Geburtstag wünsche. Ich erwiderte spontan „Ich will aufhören, Klavier zu spielen und stattdessen reiten lernen.“ Meine Mutter sagte überhaupt nichts dazu, aber am nächsten Wochenende erklärte mir mein Vater, ich müsse noch bis Ostern in die Klavierstunde gehen, danach könne ich dann mit dem Reitunterricht beginnen.
Ich konnte mein Glück kaum fassen und grinste nur vergnügt vor mich hin, wenn sich meine Klavierlehrerin mal wieder darüber beschwerte, dass ich den Czerny nicht richtig hinkriegte.
Eine neue Ära würde in Kürze beginnen und eins hatte ich in den zehn Jahren Klavierunterricht gelernt: hartes Exerzieren und ein autoritärer Unterricht ließen keine Freude aufkommen. Und ohne Freude am Spiel, Begeisterung und Leichtigkeit gab es eben auch keine Glanzleistungen.
Das Glück dieser Erde in der Reitschule Hölzel
Ich kann mich auch heute, nach über fünfzig Jahren, noch genau an den Tag in den Osterferien erinnern, als meine Eltern gemeinsam mit mir zur Reitschule Martin Hölzel ins untere Körschtal nach Stuttgart-Möhringen fuhren, um mich für den Reitunterricht anzumelden. Es war ein sonniger Tag mit blauem Himmel. Im Eingangsbereich der zur Reitschule gehörenden Gaststätte gab es einen runden Tisch, um den wir alle standen. Hier wurde uns zuerst einmal erklärt, was ich für den Unterricht alles brauchte: eine Reithose, Reitstiefel und Helm, eine Gerte und Handschuhe.
Im Hintergrund hörte ich Gespräche einiger Jugendlicher, die sich für ein Reitturnier vorbereiteten, was großen Eindruck auf mich machte. Außerdem wurden die Turnierergebnisse der Jugendlichen diskutiert, die bereits Turniere ritten. Wie ich hörte war Martin Hölzels Tochter Gisela Sechste in der A-Dressur geworden. Ich war total beeindruckt.
Für mich überschlugen sich ab diesem Moment die Dinge. Der Unterricht begann schon in der folgenden Woche mit einer von fünf Einzelstunden an der Longe, danach würde ich in der Abteilung mitreiten können. Geplant waren zwei Reitstunden pro Woche. Ich war glücklich.
Aber zuerst fuhren wir in die Stadt, und ich durfte mir bei „Reiter und Pferd“ meine erste Reitkombination aussuchen. Eine grüne Reitjacke bekam ich noch dazu, und so sah ich zumindest äußerlich wie eine richtige Reiterin aus.
Endlich war der große Tag gekommen. Ich durfte aufs Pferd. Ich holte mir mein Pferd, Polar, einen kleinen Schimmel, im Schulpferdestall ab und war ehrlich gesagt etwas schockiert als man von mir erwartete, das Pferd alleine in die etwa zweihundert Meter entfernte Reithalle zu führen. Das Pferd nutzte meine Unsicherheit voll aus und drängte mich ständig gegen irgendwelche Boxenwände. Es versuchte auch mehrfach umzudrehen. Kein Mensch war in der Nähe, der mir hätte helfen können, aber irgendwie kamen wir schließlich in der Reithalle an.
Ich stieg auf, was sich bereits als die erste große Herausforderung herausstellte, und wir drehten die ersten Runden im Schritt. Ich war sehr überrascht wie das schwankte und wie schwierig es war, das Gleichgewicht zu halten. Trotz allem entspannte ich mich ein wenig und fand das Schrittreiten gar nicht so übel. Gerade als ich es richtig toll finden wollte, kam Stufe zwei der Ausbildung: wir trabten an. Das war nun wieder ein völlig unsicheres, beängstigendes Erlebnis. Ich hatte überhaupt keinen Halt und drohte in jedem Moment, herunterzufallen. Man erklärte mir, dass ich Leichttraben solle, wobei ich auf das äußere Vorderbein achten sollte. Ich sollte mich immer dann hinsetzen, wenn das Vorderbein zurückging und aufstehen, wenn es nach vorne ging. Das war ziemlich viel auf einmal, klappte aber mit der Zeit ganz gut. Mein Vater saß auf der Zuschauertribüne und beobachtete uns die ganze Zeit über. Die Stunde verging wie im Fluge, das Pferd ließ sich auch wieder in den Stall zurückführen, und ich war ziemlich stolz, meine erste Reitstunde so gut gemeistert zu haben.
Ich freute mich bereits auf meine weiteren Longenstunden und wurde zunehmend sicherer im Sattel.
In der fünften Longenstunde bekam ich King, ein größeres schwarzes Pferd, zugeteilt. Wir kamen problemlos in die Halle. Ich war ziemlich erstaunt, als noch weitere vier Pferde in der Halle erschienen, und nur jeweils einer von uns longiert wurde, während die anderen vier im Schritt ganze Bahn reiten sollten. Bei der zweiten Schrittrunde bockte mein Pferd King und ging im gestreckten Galopp und wild buckelnd mit mir durch. Ich hatte gar keine Zeit, mir viel zu überlegen und flog in hohem Bogen vom Pferd. Die Berührung mit dem Boden verlief ziemlich hart, und ich hatte das Gefühl, mir alle Knochen gebrochen zu haben. Herr Schreiner, der Reitlehrer, ein Kriegsversehrter mit Holzbein, der so laut brüllen konnte, dass man ihn auch noch drei Ortschaften weiter hören konnte, fing an dieser Stelle an, laut zu werden und brüllte mich im Befehlston an, ich solle augenblicklich wieder aufsteigen. Von außen kam eine Helferin, die mein Pferd einfing und es mir zum Aufsteigen festhielt. Nach dem Vorfall durfte ich als Nächste an die Longe und die weitere Stunde verlief unauffällig, wenngleich ich auch am ganzen Körper zitterte und das erhebende Gefühl zu Pferde zu sitzen, sich nicht wirklich einstellen wollte.
Um ehrlich zu sein, wäre an dieser Stelle meine Reiterkarriere beendet gewesen. Ich hatte nur das Problem, dass ich meine Eltern nun monatelang drangsaliert hatte, Reiten lernen zu wollen, und mein Vater hatte mir ganz klar zu verstehen gegeben, dass das kein Sport für mich sei und dass ich auf keinen Fall nach den ersten Rückschlägen wieder aufhören konnte. Er begleitete mich auch zu allen meinen Reitstunden und verfolgte meine Fortschritte.
Zu allem Unglück fing er auch noch an, sich bei Herrn Hölzel über das unqualifizierte Geschrei von Herrn Schreiner zu beschweren, worauf dieser meinte, der Kasernenton erscheine einem nur auf der Zuschauerbank so schlimm, er solle doch am besten mitreiten.
Mein Vater hatte ja vor dem Krieg bereits das Jugendreitabzeichen Reiten und Fahren in Bronze und Silber gemacht und war mir daher haushoch überlegen. Er akzeptierte zu meinem Erstaunen den Vorschlag von Herrn Hölzel, und so traten wir bald darauf gemeinsam zur Reitstunde an.
So hatten wir natürlich nicht gewettet. Mir gefiel diese Wendung der Dinge absolut nicht, aber was blieb mir anderes übrig als den Mund zu halten und mitzuspielen.
Wir blieben ein gutes halbes Jahr in der Reitschule Hölzel. Ich durfte ab und zu auf kleinen „Ausritten“ mitreiten, die sich als halbstündige Schrittrunden erwiesen und mir sehr viel Spaß machten und immer samstags stattfanden. Mein Lieblingspferd Kristall bekam ich nur, wenn Herr Grimm, ein für mich damals ziemlich alter Herr und Stammkunde in der Reitschule Hölzel, nicht da war oder keine Lust zum Reiten hatte.
Ein besonderes Highlight war, dass ich sogar beim Umzug des Möhringer Kinderfestes mitreiten durfte und es gibt noch entsetzliche Bilddokumente, wie ich krumm und schief auf meinem Pferd hänge.
Unser Reiterleben änderte sich aber völlig unerwartet durch eine Einladung eines Geschäftsfreundes meines Vaters, Walter Osterland, der uns nach Waldenbuch in den Hasenhof einlud, wo er drei Pferde hatte. Er bot uns an, am Wochenende mit ihm auszureiten. Das war natürlich phantastisch, da es in der Reitschule Hölzel eine lange Warteschlange für die beliebten Samstagvormittagsritte gab, und wir, speziell bei schönem Wetter, wenig Chancen hatten, berücksichtigt zu werden. Herr Hölzel hatte meinem Vater auch schon ein Pferd zum Kauf angeboten, da er meinte, wir wären jetzt so weit, und wenn man richtig reiten lernen wollte, brauche man ein eigenes Pferd.
Freizeitreiterfahrungen auf dem Hasenhof – mein erstes eigenes Pferd
Herbert Näher und erste Einblicke in die Springreiterszene
Unser erster Besuch auf dem Hasenhof war traumhaft. Wir bekamen zwei Pferde gestellt und machten einen wunderschönen Ausritt durch Wiesen und Wälder. Anschließend hielt Frau Osterland Kaffee und Kuchen bereit, den wir vor dem auf der Pferdekoppel geparkten Wohnwagen im Freien einnahmen und dabei den Pferden beim Grasen zusahen.
So ging das zwei Mal. Bei unserem dritten Besuch zeigte mir Herr Osterland einen braunen Wallach, der auf der Koppel graste und meinte, dass sei Flingo, den ich heute reiten dürfe. Ich war überrascht, ging aber mit Flingo in die Halle und hatte sehr viel Spaß. Sein Besitzer, Herr König, baute sogar einen kleinen Sprung für uns auf, den wir ganz gut bewältigten, und ich war absolut begeistert. Nach der Reitstunde kam Herr König auf uns zu und fragte, ob uns denn das Pferd gefallen würde. Als wir ihm versicherten, dass das ein ganz tolles Pferd sei, meinte er, Flingo würde fünftausend Mark kosten.
Mein Vater, als Architekt, meinte dazu nur, dafür würde er ja ein ganzes Haus bauen. Um Herrn König los zu werden, fragte er, ob da Sattel, Trense und Halfter wenigstens mit dabei seien. Herr König meinte, der Sattel allein koste schon sechshundert Mark, und mein Vater warf zurück, ohne Sattel könne man nicht reiten und freute sich schon, dass das Thema damit beendet war.
Keine fünf Minuten später kam Herr König und meinte, es sei ok. Wir bekämen das Pferd mit dem gesamten Zubehör für fünftausend Mark, aber das Wichtigste sei beim jetzigen Stand der Dinge, dass wir nun eine Runde für alle schmeißen müssten. Das sei so Sitte. Das sprach sich herum wie ein Lauffeuer und der ganze Stall, mit dem wir nun auf einen Schlag befreundet zu sein schienen, brach in Richtung Hasenhofwirtschaft auf, und ich trank mit dreizehn Jahren meinen ersten Williams Christ.
Nach einiger Zeit fiel uns plötzlich ein, dass wir meine Mutter anrufen sollten. Mein Vater übertrug mir diese Aufgabe. Schließlich sei es ja auch mein Pferd. Als sie fragte, ob etwas passiert sei, da wir so lange nicht nach Hause kämen, meinte ich „Keine Sorge, wir haben nur ein Pferd gekauft!“ Meine Mutter war sprachlos und befürchtete schon, die Garage leer räumen zu müssen, denn keiner von uns, ich am allerwenigsten, hatte mit dem Kauf eines Pferdes gerechnet und, wo das Pferd nun stehen sollte, hatten wir uns auch überhaupt noch nicht überlegt. Als ich das Thema dann am Wirtshaustisch ansprach, meldete sich gleich Herr Beck, der Reitstallbesitzer, zu Wort und meinte, er habe zufällig einen Ständer frei.
Auch das war wieder eine gute Lektion für mich als Einzelkind, die ich bei meinen Aufgaben und Herausforderungen in der Schule oder auch ganz allgemein immer auf mich selbst gestellt war. Probleme ließen sich, wie man sah, am besten in der Gruppe und in der Praxis lösen, und reden half da ungemein weiter.
Flingo war ein fünfjähriger Württemberger Wallach und nach kurzer Zeit wurden wir ein richtig gutes Team. Wir nahmen regelmäßig an der Gruppenreitstunde teil, wo Flingo es sich allerdings angewöhnt hatte, immer mindestens ein bis zwei Mal pro Reitstunde aus der rechten oberen Ecke wild buckelnd im Galopp über die Diagonale auszubrechen, also wie ein Rodeopferd buckelnd quer durch die Halle zu rasen. Ich saß mittlerweile schon so gut im Sattel, dass ich das lustig fand, wenngleich ich mich auch ein kleines bisschen schämte, dass ich das Pferd nicht von seinen Scherzen abhalten konnte.
An den Wochenenden nahmen wir an großen Gruppenausritten teil, die mindestens zwei bis drei Stunden dauerten und ein halbes Jahr später, im Oktober, ritt ich meine erste Fuchsjagd. Es war wunderbar. Wir waren alle sehr zufrieden und glücklich und in völliger Harmonie mit uns und unserem Pferd, und ich war unsagbar stolz auf mein Pferd.
Flingo war eine Lebensversicherung. Wir ritten – so dachten wir damals wenigstens – Dressur und Springen und gingen regelmäßig ins Gelände. Für die Weihnachtsfeier im Stall studierten wir unsere erste Quadrille ein, und an Fasching gab es dann sogar eine Springquadrille in bunten Kostümen.
Ein Jahr später beschlossen wir, um endlich gemeinsam ausreiten zu können, ein zweites Pferd zu kaufen. Wir kauften eine super schöne achtjährige Hannoveraner Stute, ein Fuchs mit vier weißen Beinen und viel Weiß im Auge. Sie hieß Welfenherz und stammte von Welf ab, einem hübschen Hannoveraner Hengst, der, wie wir später erfuhren, viele Pferde gezeugt hatte, die Probleme mit der Wirbelsäule hatten in Form von sogenannten Kissing Spines, also Wirbel, die zu eng standen und die den Pferden beim Reiten riesige Probleme und Schmerzen bereiten konnten.
Wir nannten unsere hübsche Stute Winnie und fanden es toll, dass man sie nicht treiben musste. Sie ging sehr gut vorwärts, hatte elegante Bewegungen und sprang sehr gut, allerdings konnte sie auch kerzengerade steigen und die Courbette springen. Wir wussten damals natürlich noch nicht, dass die Courbette eine höhere Lektion der Schulen über der Erde ist, bei der das Pferd kerzengerade steigt und dann wie ein Känguru mehrere Sprünge nach vorne macht, ohne mit den Vorderbeinen den Boden zu berühren.
Winnie tat genau das. Sie stieg senkrecht und hüpfte dann auf zwei Beinen durch die Halle. Uns störte das damals nicht sonderlich, da wir ja einfach nur Spaß haben wollten, und es nicht darauf ankam, dass die Pferde irgendeine Lektion unbedingt ganz korrekt und sofort beherrschen mussten. Wir hatten auch so wenig Erfahrung mit Pferden, dass wir Steigen eher cool und gar nicht als gefährlich empfanden. Wir gingen viel ins Gelände, ließen die Pferde täglich auf die Koppel und fühlten uns sehr wohl mit den beiden.
Besonders gut gefielen mir die sonntäglichen Gruppenausritte, die oft den ganzen Tag dauerten. Meistens ritten wir den Sommer über in die Walzenmühle zu Fritz Limbächer, der damals Pferde züchtete. Es war immer lustig dort. Die Familie Limbächer war sehr gastfreundlich. Es gab jede Menge Most, den ich auf nüchternen Magen gar nicht so gut vertrug und der mir auch überhaupt nicht schmeckte, aber als Reiter muss man halt Verschiedenes abkönnen und dann ging es ja auch viel beschwingter und wagemutiger über den kleinen Springparcours, der im Freien für uns aufgebaut war. Das waren meine allerersten Parcours-Erfahrungen nach dem Prinzip „Learning by Doing“.
Anschließend wurde gevespert und dann ritten wir wieder zurück zum Hasenhof. Heute ist Klaus Limbächer, der Sohn von Fritz, der damals noch gar nicht geboren war, sehr erfolgreich in der Military und reitet sogar als Kadermitglied in der CIC*** international.
Ebenfalls ein Highlight in unserem damaligen Reiterleben waren die Hubertusjagden im September / Oktober, bei denen immer ungefähr zwanzig Reiter starteten. Fritz war ganz klar auch einer der Aktiven. Es ging durch Wald und Wiese, über kleine Birkensprünge und sogar durchs Wasser, und Flingo machte sich ganz hervorragend bei diesen Veranstaltungen, weil er niemals extrem heftig wurde und die kleinen Sprünge immer zuverlässig und brav absolvierte. Auch vor Wasser hatte er keine Angst und die vielen anderen Pferde und Zuschauer waren absolut kein Problem für ihn.
Im Herbst kam dann der bekannte Turnierreiter, Herbert Näher, mit fünf Pferden in den Stall. Er war der beste Reiter, den ich je gesehen hatte, ich bewunderte ihn sehr und war maßlos in ihn verliebt.