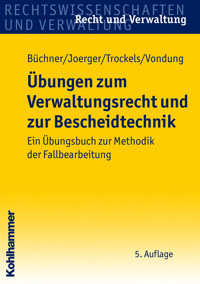
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Zur Lösung verwaltungsrechtlicher Fälle erläutern die Autoren im ersten Teil verständlich die Technik des Syllogismus und die erforderlichen Arbeitsschritte vom Erfassen des Sachverhalts über die Abfassung des Gutachtens bis zur Umsetzung in einen Bescheid. Sie vermitteln das erforderliche Wissen zum Allgemeinen Verwaltungsrecht und fassen es in übersichtliche Aufbauschemata zusammen. Ein Kapitel widmen die Autoren der Bedeutung und dem Erlernen einer verständlichen Sprache und überzeugender Formulierungen in Bescheiden. Im zweiten und dritten Teil sind Fälle zur Anfertigung von Gutachten und zur Bescheidtechnik mit ausformulierten Lösungsvorschlägen enthalten. In der 5. Auflage wird der Inhalt des Buchs unter Berücksichtigung der neuesten Rechtslage, Rechtsprechung und Literatur aktualisiert. Mit dem Buch können sich insbesondere Studierende an Hochschulen der öffentlichen Verwaltung und der Rechtswissenschaften auf Prüfungen und Verwaltungspraxis vorbereiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zur Lösung verwaltungsrechtlicher Fälle erläutern die Autoren im ersten Teil verständlich die Technik des Syllogismus und die erforderlichen Arbeitsschritte vom Erfassen des Sachverhalts über die Abfassung des Gutachtens bis zur Umsetzung in einen Bescheid. Sie vermitteln das erforderliche Wissen zum Allgemeinen Verwaltungsrecht und fassen es in übersichtliche Aufbauschemata zusammen. Ein Kapitel widmen die Autoren der Bedeutung und dem Erlernen einer verständlichen Sprache und überzeugender Formulierungen in Bescheiden. Im zweiten und dritten Teil sind Fälle zur Anfertigung von Gutachten und zur Bescheidtechnik mit ausformulierten Lösungsvorschlägen enthalten. In der 5. Auflage wird der Inhalt des Buchs unter Berücksichtigung der neuesten Rechtslage, Rechtsprechung und Literatur aktualisiert. Mit dem Buch können sich insbesondere Studierende an Hochschulen der öffentlichen Verwaltung und der Rechtswissenschaften auf Prüfungen und Verwaltungspraxis vorbereiten.
Professoren der Fachhochschule Ludwigsburg und Kehl, Hochschulen für öffentliche Verwaltung.
Übungen zum Verwaltungsrecht und zur Bescheidtechnik
Ein Übungsbuch zur Methodik der Fallbearbeitung
vonDr. Hans Büchner Professor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen LudwigsburgDr. Gernot Joerger Professor (em.) an der Hochschule für öffentliche Verwaltung KehlMartin Trockels Professor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung KehlUte Vondung Professorin an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg5. Auflage
Verlag W. Kohlhammer
Alle Rechte vorbehalten © 1980/2010 W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart Gesamtherstellung: W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG, Stuttgart Printed in Germany
Print: 978-3-17-021478-1
E-Book-Formate
pdf:
epub:
978-3-17-028298-8
mobi:
978-3-17-028299-5
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Erster Teil: Anleitung zur Fallbearbeitung
A. Vorbemerkung
I. Bedeutung der drei Teile des Buches
1. Allgemeine Zielsetzung
2. Zielsetzung des ersten Teils
3. Zielsetzung des zweiten Teils
4. Zielsetzung des dritten Teils
II. Arbeitsanleitung für Leser und Leserinnen
1. Arbeitsanleitung für den ersten Teil
2. Arbeitsanleitung für den zweiten Teil
3. Arbeitsanleitung für den dritten Teil
B. Anfertigung eines Gutachtens
I. Wesen des Gutachtens
1. Praxisbedeutung
2. Inhalt des Gutachtens
3. Form des Gutachtens
4. Besonderheiten in Klausur und Hausarbeit
II. Methodik der gutachtlichen Fallbearbeitung
1. Erfassen der Aufgabe
2. Hintasten zur Lösung
a. Der Syllogismus als Lösungsansatz
b. Verwendung von Schemata
c. Alternativlösungen – Hilfsgutachten
3. Planung der Darstellung
4. Niederschrift
C. Aufarbeitung verwaltungsrechtlicher Fragestellungen (Aufbauschemata)
I. Anwendungsbereich der Schemata
II. Rechtmäßigkeitsprüfung künftiger belastender Eingriffe (Eingriffsschema I)
1. Vorüberlegungen
a. Suche nach vernünftiger Lösung
b. Rechtsform
c. Ermächtigungsgrundlage
2. Vorgeschaltete (vorrangige) formelle Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen
a. Sachliche, örtliche, instanzielle und funktionelle Zuständigkeit der Behörde oder des Behördenorgans
b. Ausgeschlossene Personen, Befangenheit 7
c. Anhörungspflichten
d. Antragserfordernis und Sachbescheidungsinteresse
e. Fristen
3. Materielle Voraussetzungen
a. Eingriffsgrundlage (Ermächtigungsgrundlage)
b. Adressat
c. Ermessensausübung
d. Inhaltliche Bestimmtheit
4. Nachgeschaltete (nachrangige) formelle Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen
a. Mitwirkung anderer Stellen
b. Anhörungspflichten
c. Fristen
d. Form
e. Begründung
f. Rechtsbehelfsbelehrung
g. Bekanntgabe der Maßnahme
5. Prüfschema für die Rechtmäßigkeit einer geplanten Eingriffsmaßnahme der Verwaltung (Eingriffsschema I)
III. Rechtmäßigkeitsprüfung bereits erfolgter Eingriffe (Eingriffsschema II)
1. Vorüberlegungen
2. Formelle Voraussetzungen
3. Materielle Voraussetzungen
4. Prüfungsschema bei bereits erfolgten Eingriffen (Eingriffsschema II)
IV. Rechtmäßigkeitsprüfung einer bevorstehenden staatlichen Leistung zugunsten des Bürgers (Leistungsschema I)
1. Vorüberlegungen
a. Inhalt der Leistung
b. Rechtsform
c. Rechtsgrundlage
d. Anspruch auf Leistung
2. Vorgeschaltete formelle Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen a. Sachliche, örtliche, instanzielle und funktionelle Zuständigkeit
b. Ausgeschlossene Personen, Befangenheit
c. Anhörungspflichten
d. Antragserfordernis und Sachbescheidungsinteresse
e. Fristen
3. Materielle Voraussetzungen
a. Rechtsgrundlage/Anspruchsgrundlage
b. Adressat/Leistungsempfänger
c. Ermessensausübung
d. Inhaltliche Bestimmtheit
e. Leistungsverbote und Einwendungen Dritter
4. Nachgeschaltete formelle Voraussetzungen
a. Mitwirkung des Begünstigten und anderer Stellen
b. Anhörung, Begründung
c. Fristen
d. Formvorschriften
e. Rechtsbehelfsbelehrung
f. Bekanntgabe der Maßnahme
5. Prüfungsschema zur Vorbereitung von Leistungen (Leistungsschema I)
V. Rechtmäßigkeitsprüfung einer bereits erbrachten Leistung (Leistungsschema II)
VI. Gültigkeitskontrolle einer untergesetzlichen Rechtsvorschrift
1. Fehlerfolge
2. Rechtmäßigkeit der Ermächtigungsgrundlage
a. Erfordernis der Rechtsgrundlage
b. Formelle Vorgaben
c. Materielle Vorgaben
3. Formelle Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen für die Rechtsverordnung bzw. Satzung selbst
a. Prüfungsmaßstab
b. Formelle Vorgaben aus Rechtsverordnungen und Satzungen
c. Formelle Vorgaben aus förmlichen Gesetzen
d. Formelle Vorgaben aus der Verfassung
e. Heilung
4. Materielle Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen für die Rechtsverordnung bzw. Satzung selbst
a. Prüfungsmaßstab
b. Materielle Vorgaben aus Satzungen und Rechtsverordnungen
c. Materielle Vorgaben aus förmlichen Gesetzen
d. Materielle Vorgaben aus der Verfassung
e. Heilung
5. Normprüfungsschema
VII. Erfolgsprüfung bei Rechtsbehelfen (Prozessschemata)
1. Anwendungsbereich der Schemata
2. Erfolgsprüfung bei Widersprüchen
3. Erfolgsprüfung bei verwaltungsgerichtlichen Klagen (einschließlich Normenkontrollverfahren nach § 47 VwGO)
D. Das Anfertigen von Bescheiden
I. Der Begriff und die Arten des Bescheids
1. Bescheid im engen Sinn, d. h. Verwaltungsakt
2. Bescheid im weiten Sinn, d. h. nicht nur Verwaltungsakte
II. Der Begriff der Bescheidtechnik
III. Die Beherrschung der Bescheidtechnik als Anforderung an Verwaltungspraktikerinnen und -praktiker
IV. Kritische Anmerkungen zur Verwaltungspraxis
1. Kurze Auswahl von Beispielen aus der Verwaltungspraxis
2. Bescheide in Verwaltungspraxis oft weder extrem schlecht, noch besonders gut
V. Die Vorüberlegungen vor Erlass eines Bescheides
1. Unter Umständen ist kein Bescheid die beste Lösung
2. Nicht untätig bleiben
3. Der Weg zum Endergebnis „Bescheid“
a. Sachverhaltsermittlung
b. Gutachten zur Rechtslage
c. Entscheidung
VI. Die Umsetzung der Vorüberlegungen in einen Bescheid im engeren Sinn (Verwaltungsakt)
1. Der Aufbau eines Bescheids im engeren Sinn
2. Hinweise zum Aufbau von Bescheiden
a. Einleitung
b. Höflichkeitsformeln auch bei förmlichen Bescheiden und in E-Mails
c. Bedauern
d. Tenor
e. Nebenentscheidungen
f. Umfangreiche Entscheidungsformel
g. Bestimmtheit des Tenors
h. Verständlichkeit des Tenors aus sich heraus
i. Sorgfältiges Formulieren der Gründe
j. Anordnung der sofortigen Vollziehung
k. Androhung von Zwangsmitteln
l. Kostenentscheidung
m. Beratende Hinweise
n. Ihre Rechte – Rechtsbehelfsbelehrung
o. Grußformel, Unterschrift, Amtsbezeichnung
p. Geschäftsgangvermerke
q. Faxen/elektronische Versendung
r. Interne Vermerke
3. Inhaltliche Anforderungen an Bescheide
4. Angemessenes Eingehen auf den Bürger
a. Behördenschreiben enthalten mehr als Sachinformationen
b. Ratschläge zur Adressatenorientierung
5. Die Nutzung der modernen Informations- und Kommunikationstechnik als Mittel zur größeren Bürgernähe
6. Was können Sie zur besseren Verständlichkeit beitragen?
a. Auf welche „Verständlichmacher“ sollten Sie achten?
c. Wie lässt sich Einfachheit erreichen?
d. Wie lässt sich Gliederung und Ordnung erreichen?
e. Wie lassen sich Kürze und Prägnanz erreichen?
f. Wie lassen sich anregende Texte erreichen?
g. Lesefreundliche Textgestaltung 122
h. Textoptimierung und inhaltliche Schwerverständlichkeit
7. Überzeugen
a. Was heißt, „ein Bescheid überzeugt“?
b. Ist es Aufgabe von Behörden, Bürger zu überzeugen?
c. Will die Verwaltung überzeugen?
d. Woran können Überzeugungsversuche scheitern?
e. Was fördert Überzeugungsprozesse?
VII. Rationelle Textverarbeitung und Qualitätsmanagement für Bescheide
1. Pflicht zur rationellen Arbeit
2. PC-Einsatz, Internet, Intranet und verstärkte E-Mail-Nutzung
3. Wirtschaftlichkeitsüberlegungen
4. Empfehlungen zur persönlichen Arbeitstechnik
a. Checkliste Nutzung von PCs
b. Qualitätsmanagement, -kontrolle und -sicherung und Bescheidtechnik
E. Literaturhinweise
I. Zeitschriften (mit Fallteil)
II. Bücher, Artikel, Internet
Zweiter Teil: Fälle und Lösungen zur Methode des Gutachtens
Fall 1: „Genehmigung einer Werbeanlage“
Fall 2: „Die Benutzung der Sporthalle“
Fall 3: „Der verschuldete Bäcker“
Fall 4: „Die Sperrzeitverkürzung“
Fall 5: „Birkenfall“
Fall 6: „Erstattung von Sozialhilfeleistungen“
Fall 7: „Die Ausnahmegenehmigung“
Fall 8: „Der Kinderspielplatz“
Fall 9: „Die Gaststättenplage“
Fall 10: „Der Notanbau“ (Staatsprüfungsklausur)
Dritter Teil: Fälle und Lösungen zur Methodik der Bescheidfertigung
Fall 11: „Die Wiedererteilung einer Fahrerlaubnis“
Fall 12: „Die Gaststättennachbarn“
Fall 13: „Die Versetzung“
Fall 14: „Die Ausweisung“
Fall 15: „Der Bedenkenerlass“
Fall 16: „Die Ausräumungsaktion“
Fall 17: „Das Bienenhaus“
Fall 18: „Abschleppfall“
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Die 5. Auflage des Werkes setzt das bisherige Konzept fort. Deshalb kann auf das Vorwort zur 4. Auflage verwiesen werden. Die Überarbeitung der 5. Auflage berücksichtigt die Literatur und Rechtsprechung bis Mitte 2010.
Ludwigsburg/Kehl, Juni 2010
Die Verfasser
Vorwort zur 4. Auflage
Studierenden fällt es erfahrungsgemäß besonders schwer, ihr verwaltungsrechtliches Wissen richtig einzusetzen, um Fälle lösen zu können. Noch hilfloser fühlen sie sich häufig, wenn sie ihre rechtlichen Überlegungen in einen Bescheid umsetzen sollen, der nicht nur die Sach- und Rechtslage zutreffend wiedergibt, sondern zusätzlich den bescheidtechnischen Anforderungen entspricht. Jede Ausbildung, die sich am Berufsfeld des Verwaltungsdienstes orientiert, will aber gerade diese Fähigkeiten vermitteln.
Das Buch soll auch in seiner 4. Auflage den Studierenden helfen, ihre Schwierigkeiten zu überwinden. Es zeigt auf, wie man ein verwaltungsrechtliches Gutachten erstellt und sich an die richtige Lösung einer Fallfrage herantastet.
Es will außerdem anleiten, die verwaltungsrechtlichen Kenntnisse so in Bescheide umzusetzen, dass sie sachlich richtig, rechtmäßig, verständlich, überzeugend, äußerlich ansprechend, rationell erstellt und ablauforganisatorisch praxisgerecht sind.
Die Fälle sollen dazu dienen, das Erlernte zu üben. Anhand der Lösungsvorschläge können die Studierenden überprüfen, ob sie mit ihren eigenen Gutachten und ihren eigenen Bescheiden zufrieden sein können.
Wir danken den Leserinnen und Lesern, die uns kritische Anmerkungen zur 3. Auflage zukommen ließen. Auch künftig sind wir an solchen Anregungen interessiert.
Als neue Autoren sind mit dieser 4. Auflage Frau Professorin Ute Vondung und Herr Professor Martin Trockels hinzugetreten. Sie haben die Fälle neu bearbeitet.
Ludwigsburg/Kehl, Dezember 2005
Die Verfasser
Vorwort
Auszug aus dem Vorwort zur 3. Auflage
… Es zeigt auf, wie man … sich … an die richtige Lösung einer Fallfrage herantastet. Sie lässt sich selten finden, ohne die Lehren des Allgemeinen Verwaltungsrechts heranzuziehen. Deshalb haben wir – neu eingefügt in der 3. Auflage – versucht, die komplexen Zusammenhänge dieses Rechtsgebietes fallbezogen zu systematisieren und in Aufbauschemata darzustellen. Es handelt sich um eine überarbeitete Fassung des 8. Kapitels aus Blasius/Büchner, Verwaltungsrechtliche Methodenlehre, 2. Auflage 1984. Wir danken Herrn Dr. Hans Blasius, dass er mit der Übernahme einverstanden war. …
Ludwigsburg/Kehl, Juni 1994
Die Verfasser
Literaturverzeichnis
Anwander/Draf
Bürgerfreundlich verwalten, Ein Leitfaden für Behördenkultur, 1998
Belz/Mußmann
Polizeigesetz für Baden-Württemberg, Kommentar, 6. Aufl., 2001, mit Nachtrag 2005
Blasius/Büchner
Verwaltungsrechtliche Methodenlehre, 2. Aufl., 1984
Bosch/Schmidt
Praktische Einführung in das verwaltungsgerichtliche Verfahren, 8. überarb. Aufl., 2004
Brandt/Schlabach
Polizeirecht, 1987
Büchner/
Schlotterbeck
Baurecht, 3. Aufl., 1999 (zitiert als „Baurecht“)
Büchner/
Schlotterbeck
Verwaltungsprozessrecht, 6. Aufl., 2001
Büter/Schimke
Anleitungen zur Bescheidtechnik, Wie Verwaltungsakte verständlich geschrieben werden, 1991
Dürr
Baurecht Baden-Württemberg, 11. Aufl., 2005
Engelhardt/App
Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz: VwVG, VwZG, Kommentar, 6. neubearb. Aufl., 2004
Erichsen/Ehlers
Allgemeines Verwaltungsrecht, 12. Aufl., 2002
Eyermann/Fröhler
VwGO, Kommentar, 11. Aufl., 2000
Götz
Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, 13. Aufl., 2001
Hufen
Verwaltungsprozessrecht, 6. neu bearb. Aufl., 2005
Jagusch/Hentschel
Straßenverkehrsrecht, Kommentar, 35. Aufl., 1999
Katz
Staatsrecht, Grundkurs im öffentlichen Recht, 16. neu bearbeitete Aufl., 2005
Knack
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Kommentar, 8. Aufl., 2004
Kock/Stüwe/
Wolffgang/
Zimmermann
Öffentliches Recht und Europarecht, 3. Aufl., 2004
Kohler-Gehrig
Die Diplom- und Seminararbeit in den Rechtswissenschaften, Technik und Struktur wissenschaftlichen Arbeitens, 2002
Kopp/Ramsauer
Verwaltungsverfahrensgesetz, 8. Aufl., 2003
Landmann/Rohmer
Gewerbeordnung und ergänzende Vorschriften: GewO, Band I: Gewerbeordnung, Loseblattsammlung, Kommentar, 46. Aufl., 2005
Langer/Schulz v. Thun/Tausch
Sich verständlich ausdrücken, 7. überarb. und erw. Aufl., 2002
LPK-BSHG
Birk/Brühl/Conradis, Bundessozialhilfegesetz, Lehrkommentar und Praxiskommentar, Mit einer Kurzkommentierung zum Asylbewerberleistungsgesetz, 6. Aufl., 2003
Maurer
Allgemeines Verwaltungsrecht, 15. überarb. u. erg. Aufl., 2004
Metzner
Gaststättengesetz, Kommentar, 6. Aufl., 2002
Michel/Kienzle/
Pauly
Das Gaststättengesetz, Kommentar, 14. Aufl., 2003
Pieroth/Schlink
Grundrechte, Staatsrecht II, 20. neu bearbeitete Aufl., 2004
Redeker/v. Oertzen
Verwaltungsgerichtsordnung, 14. überarb. Aufl., 2004
Sadler
Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Kommentar anhand der Rechtsprechung, 5. Aufl., 2002
Schneider
Deutsch für Profis, 1982
Schweickhardt/
Vondung (Hrsg.)
Allgemeines Verwaltungsrecht, 9. Aufl., 2010
Schwerdtfeger
Öffentliches Recht in der Fallbearbeitung. Grundfallsystematik, Methodik, Fehlerquellen, 12. Aufl., 2004 (Schriftenreihe der Juristischen Schulung, Heft 5)
Stein/Frank
Staatsrecht, 19. Aufl., 2004
Stelkens/Bonk/
Sachs
Verwaltungsverfahrensgesetz mit Erläuterungen, 8. Aufl., 2003
Stelkens/Bonk/
Sachs
Verwaltungsverfahrensgesetz, Kommentar, 6. Aufl., 2001
Volkert
Die Verwaltungsentscheidung, 4. Aufl., 1989
Welte
Zuwanderungs- und Freizügigkeitsrecht, Teil 1, Loseblattsammlung
Wettling
Rechtliche Gestaltung in der öffentlichen Verwaltung, 1990
Abkürzungsverzeichnis
Gesetze sind nach ihrer jeweiligen Fundstelle in der VSV (Vorschriftensammlung für die Verwaltung in Baden-Württemberg), im Dürig (Gesetze des Landes Baden-Württemberg), Sartorius I (Verfassungs- und Verwaltungsgesetze der Bundesrepublik, Band I) und Schönfelder (Deutsche Gesetze) zitiert. Falls ein Gesetz in einer der Sammlungen nicht enthalten ist, ist die Fundstelle im Gesetzblatt angegeben.
a. A.
anderer Ansicht
a. a. O.
am angegebenen Ort
Abk.
Abkürzung
Abs.
Absatz
ADV
Automatische Datenverarbeitung
a. E.
am Ende
AGVwGO
Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung [VSV 3401-1, Dürig 20]
Altern.
Alternative
Anm.
Anmerkung
AO
Abgabenordnung [VSV 6101]
arg.
Argument aus
Art.
Artikel
AufenthG
Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz – AufenthG) [Satorius 565]
Aufl.
Auflage
Az.
Aktenzeichen
Bad.-Württ.
Baden-Württemberg
BAföG
Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz – BAföG) [Sartorius 420]
BAnz.
Bundesanzeiger
BAT
Bundes-Angestelltentarifvertrag [VSV 8021]
BauGB
Baugesetzbuch [VSV 2130, Sartorius 300]
BauNVO
Verordnung über die Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) [VSV 2130-2, Sartorius 311]
Bay.
Bayern; bayerisch
BayVBl.
Bayerische Verwaltungsblätter, Zeitschrift für öffentliches Recht und öffentliche Verwaltung
BBesG
Bundesbesoldungsgesetz [VSV 2032, Sartorius 230]
BBG
Bundesbeamtengesetz [Sartorius 160]
Bd.
Band
ber.
berichtigt
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch [VSV 4000, Schönfelder 20]
BGBl.
Bundesgesetzblatt
BGH
Bundesgerichtshof
BlmSchG
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-lmmissionsschutzgesetz – BlmSchG) [VSV 2129, Sartorius 296]
BNatSchG
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege – (Bundes-
naturschutzgesetz – BNatSchG) [VSV 7911, Sartorius 880]
BodSchG
Gesetz zum Schutz des Bodens (Bodenschutzgesetz
– BodSchG) [VSV 2129-14, Dürig 124]
BRRG
Rahmengesetz zur Vereinheitlichung des Beamtenrechts (Beamtenrechtsrahmengesetz – BRRG) [VSV 2030, Sartorius 150]
BRS
Baurechtssammlung (Thiel/Gelzer)
BSHG
Bundessozialhilfegesetz (BSHG) [VSV 2170, Sartorius 410]
Bsp.
Beispiel
BT
Bundestag
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BVerfGE
Amtliche Sammlung der Entscheidungen des BVerfG
BVerwG
Bundesverwaltungsgericht
BVerwGE
Amtliche Sammlung der Entscheidungen des BVerwG
BW
Baden-Württemberg
BWVP
Baden-Württembergische Verwaltungspraxis
dB (A)
Dezibel (Messwert für Geräusche)
d. h.
das heißt
DO
Dienstordnung für die Landesbehörden in Baden-W</paragraf>ürttemberg [VSV 2002]
DÖV
Die öffentliche Verwaltung, Zeitschrift für öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaft
DVBl.
Deutsches Verwaltungsblatt
DVP
Deutsche Verwaltungspraxis, Fachzeitschrift für Wissenschaft und Praxis in der öffentlichen Verwaltung
EDV
Elektronische Datenverarbeitung
ESVGH
Amtliche Sammlung der Entscheidungen des hessischen und des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofes
f.
folgende
ff.
fortfolgende
GABl.
Gemeinsames Amtsblatt des Innenministeriums, des Finanzministeriums, des Wirtschaftsministeriums, des Ministeriums Ländlicher Raum, des Sozialministeriums, des Ministeriums für Umwelt und Verkehr, des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst sowie der Regierungspräsidien
GastG
Gaststättengesetz [VSV 7111, Sartorius 810]
GastVO
Verordnung der Landesregierung zur Ausführung des Gaststättengesetzes (Gaststättenverordnung) [VSV 7111-2, Dürig 77]
GBl.
Gesetzblatt für Baden-Württemberg
GebTSt
Gebührentarif für Maßnahmen im Straßenverkehr (Anlage zur GebOSt)
GebVerz
Verzeichnis der Verwaltungsgebühren (Gebührenverzeichnis) zum LGebG
GebVO
Verordnung der Landesregierung über die Festsetzung der Gebührensätze für Amtshandlungen der staatlichen Behörden vom 28. Juni 1993 (GBI. S. 381)
gem.
gemäß
GemO
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg [VSV 2021, Dürig 56]
GewArch
Gewerbearchiv, Zeitschrift für Gewerbe- und Wirtschaftsverwaltungsrecht
GewO
Gewerbeordnung [VSV 7100, Sartorius 800]
GewOZuVO
Verordnung der Landesregierung über Zuständigkeiten nach der Gewerbeordnung [VSV 7100-3, Dürig 143]
gez.
gezeichnet
gfl.
gefällig/geflissentlich
GG
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland [VSV 1000, Dürig 2, Sartorius 1, Schönfelder 1]
GVG
Gerichtsverfassungsgesetz [VSV 3002, Schönfelder 95]
H.
Heft
Hbs.
Halbsatz
Hess.
Hessen, hessisch
h. M.
herrschende Meinung
Hrsg.
Herausgeber
HS
Halbsatz
HwO
Handwerksordnung [VSV 7110, Sartorius 815]
i. A.
im Auftrag
i. d. F.
In der Fassung
i. d. R.
in der Regel
i. e. S.
im engeren Sinn
i. S. d.
im Sinne des
i. S. v.
im Sinne von
i. V.
in Vertretung
i. V. m.
in Verbindung mit
JA
Juristische Arbeitsblätter, Ausbildung, Examen, Fortbildung
Jura
Juristische Ausbildung (Zeitschrift)
JuS
Juristische Schulung, Zeitschrift für Studium und Ausbildung
KAG
Kommunalabgabengesetz [Düring 60]
Kap.
Kapitel
KBA
Kraftfahrt-Bundesamt
KGSt
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (Köln)
KrW-/AbfG
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz [VSV 2129-6/1]
KStZ
Kommunale Steuer-Zeitung
LAbfG
Gesetz über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen in Baden-Württemberg (Landesabfallgesetz – LAbfG) [VSV 2129-7, Dürig 102]
LBG
Landesbeamtengesetz [VSV 2030-1, Dürig 50]
LBO
Landesbauordnung für Baden-Württemberg [VSV 2130-4, Dürig 85]
LBOAVO
Allgemeine Ausführungsverordnung des Innenministeriums zur Landesbauordnung [VSV 2130-4/1, Dürig 85a]
LGebG
Landesgebührengesetz [VSV 2011, Dürig 41]
LPersVG
Landespersonalvertretungsgesetz [Dürig 54]
LPlG
Landesplanungsgesetz [VSV 2300-1, Dürig 46]
LPVG
Personalvertretungsgesetz für das Land Baden-Württemberg (Landespersonalvertretungsgesetz – LPVG) [VSV 2035, Dürig 150]
LRA
Landratsamt
LS
Leitsatz
LV (LVerf)
Verfassung des Landes Baden-Württemberg [VSV 1001, Dürig 1]
LVG
Landesverwaltungsgesetz [VSV 2000, Dürig 40]
LVwVfG
Verwaltungsverfahrensgesetz für Baden-Württemberg (Landesverwaltungsverfahrensgesetz – LVwVfG) [VSV 2001, Dürig 45]
LVwVG
Verwaltungsvollstreckungsgesetz für Baden-Württemberg (Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz – LVwVG) [VSV 2006, Dürig 43]
LVwVGKO
Verordnung des Innenministeriums über die Erhebung von Kosten der Vollstreckung nach dem Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz für Baden- Württemberg (Vollstreckungskostenordnung – LVwVGKO) [VSV 2006-3, Dürig 43a]
LVwZG
Verwaltungszustellungsgesetz für Baden-Württemberg [VSV 2010, Dürig 42]
m. a. W.
mit anderen Worten
m. d. B.
mit der Bitte
m. E.
meines Erachtens
m. w. N.
mit weiteren Nachweisen
NatSchG
Gesetz zum Schutz der Natur, zur Pflege der Landschaft und über die Erholungsvorsorge in der freien Landschaft (Naturschutzgesetz – NatSchG) [VSV7910, Dürig 123]
NJW
Neue Juristische Wochenschrift
Nr.
Nummer
NVwZ
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NVwZ-RR
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht, Rechtsprechungs-Report
NW
Nordrhein-Westfalen
o. V.
ohne Verfasserangabe
OVG
Oberverwaltungsgericht
OWiG
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten [VSV 4541, Dürig 64, Schönfelder 94]
OWiZuV
Verordnung der Landesregierung über Zuständigkeiten nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten [VSV 4541-5, Dürig 64 a]
PassG
Passgesetz [VSV 2100, Sartorius 1]
PolG
Polizeigesetz [VSV 2050, Dürig 65]
PROSOZ
Programmierte Sozialhilfe
Rdnr.
Randnummer
RK
Römisch-katholisch
Rn.
Randnummer
Rspr.
Rechtsprechung
s.
siehe
S.
Seite/Satz
SchG
Schulgesetz für Baden-Württemberg [VSV 2230, Dürig 170]
SGB X
Sozialgesetzbuch – Zehntes Buch – Verwaltungsverfahren [VSV 2150, Sartorius E 410]
SGB I
Sozialgesetzbuch – Erstes Buch [Satorius E 401]
s. o.
siehe oben
sog.
sogenannt
str.
strittig
StrG
Straßengesetz für Baden-Württemberg (Straßengesetz – StrG) [VSV 9100, Dürig 148]
st. Rspr.
ständige Rechtsprechung
StVG
Straßenverkehrsgesetz [VSV 9231, Schönfelder 35]
StVO
Straßenverkehrsordnung [VSV 9233, Schönfelder 35a]
StVO-ZuG
Gesetz über Zuständigkeiten nach der Straßenverkehrs-Ordnung [VSV 9233-1, Dürig 147d]
StVZO
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung [VSV 9232, Schönfelder 35 b]
s. u.
siehe unten
u.
und
u. a.
unter anderem
u. R.
unter Rückerbittung
UrlVO
Verordnung der Landesregierung über den Urlaub der Beamten und Richter (Urlaubsverordnung – UrIVO) [VSV 2030-7, Dürig 50 b]
usw.
und so weiter
u. U.
unter Umständen
v.
von
VA
Verwaltungsakt
VBIBW
Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg, Zeitschrift für öffentliches Recht und öffentliche Verwaltung
VDI
Verein Deutscher Ingenieure
VereinsG
Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts [Sartorius 425]
Verf. BW
Verfassung des Landes Baden-Württemberg [VSV 1001, Dürig 1]
VersG
Versammlungsgesetz [Satorius 385]
VGH
Verwaltungsgerichtshof
vgl.
vergleiche
VOP
Verwaltungsführung, Organisation, Personalwesen
VR
Verwaltungsrundschau, Zeitschrift für Verwaltung in Praxis und Wissenschaft
VwGO
Verwaltungsgerichtsordnung [VSV 3401, Dürig 19, Sartorius 600]
VwKostG
Verwaltungskostengesetz [Sartorius 120]
VwVfG
Verwaltungsverfahrensgesetz [Sartorius 100]
VwVG-Bund
Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz [Sartorius 112]
VwZG-Bund
Verwaltungszustellungsgesetz des Bundes [VSV 2010-1, Sartorius 110]
WG
Wassergesetz für Baden-Württemberg [VSV 7532, Dürig 100]
WHG
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) [VSV 7531, Sartorius 845]
WoGG
Wohngeldgesetz [Sartorius 385]
WpflG
Wehrpflichtgesetz [Sartorius 620]
Wv.
Wiedervorlage
Z.
Ziffer
z. B.
zum Beispiel
z. d. A.
zu den Akten
ZfBR
Zeitschrift für internationales und deutsches Baurecht
Ziff.
Ziffer
ZPO
Zivilprozessordnung [VSV 3104, Schönfelder 100]
Erster Teil: Anleitung zur Fallbearbeitung
A.Vorbemerkung
I.Bedeutung der drei Teile des Buches
1.Allgemeine Zielsetzung
1
Es ist Aufgabe dieses Buches, den Studierenden, die zum ersten Mal mit der Anwendung des Verwaltungsrechts – und hier insbesondere des allgemeinen Verwaltungsrechts – konfrontiert werden, einen Weg zu zeigen, wie man mit alltäglichen Anfangsschwierigkeiten der Rechtsanwendung fertig werden und schließlich auch schwierigere Fälle lösen kann.
2.Zielsetzung des ersten Teils
2
Im ersten Teil wird dargestellt, welche allgemeingültigen Grundsätze zu beachten sind, wenn Studierende oder „frischgebackene“ Praktiker an die Lösung eines Falles herangehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Falllösung im Rahmen einer Klausur oder einer Hausarbeit verlangt wird. Für beide gelten die gleichen methodischen Ansätze. Bei einer Hausarbeit kommt gegenüber einer Klausur lediglich hinzu, dass
bestimmte Formalien zu beachten sind
die längere Bearbeitungszeit eine tiefere Durchdringung der Probleme ermöglicht und
eine Auseinandersetzung mit Literatur und Rechtsprechung erwartet wird.
Im Studium oder in der Praxis können Sie vor zweierlei Aufgaben gestellt sein: Sie haben entweder ein Gutachten zu erstellen oder einen Bescheid zu fertigen. Deshalb enthält der erste Teil des Buches gesonderte Abschnitte über die Anfertigung von Gutachten und die Anfertigung von Bescheiden.
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass Sie auch dann nicht ohne – zumindest gedankliches – Gutachten auskommen, wenn Sie einen Bescheid zu fertigen haben. Allerdings sind dann noch weitere Gesichtspunkte zu beachten.
Die abstrakte Zusammenfassung der methodischen Regeln im ersten Teil des Buches darf Sie nicht dazu verleiten, diese Regeln auswendig zu lernen. Damit haben Sie nichts gewonnen. Sie sollten vielmehr diese Regeln an den Fällen im zweiten und dritten Teil des Buches üben. Sie werden dann erkennen, dass die Regeln vielfach Grundsätze enthalten, die Sie – wenn sie Ihnen bewusst geworden sind – nicht mehr auswendig zu lernen brauchen!
3.Zielsetzung des zweiten Teils
3
Im zweiten Teil des Buches können Sie die gutachtliche Fallbearbeitung nach den Regeln praktisch üben, die im ersten Teil vermittelt wurden. Bewusst wird dabei mit dogmatisch (vom Rechtsverständnis her) einfachen Fällen begonnen, weil Sie nur so in der Lage sind, sich auf die Methodik der Fallbearbeitung zu konzentrieren. Dogmatische Schwierigkeiten lassen sich dann später auf einer sicher beherrschten methodischen Grundlage leichter meistern.
Die Fälle stammen aus verschiedenen Bereichen des besonderen Verwaltungsrechts. Zu ihrer Lösung sind keine besonderen Kenntnisse aus diesen Gebieten erforderlich. Sie sind so ausgewählt, dass der rechtliche Schwerpunkt im Bereich des Allgemeinen Verwaltungsrechts liegt und Grundlinien dieses Rechtsbereichs offenbart. Die Einfachheit der Fälle mag manchen „Fortgeschrittenen“ zunächst verblüffen. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass die größten Schwierigkeiten dann entstehen, wenn es gilt, einfache Alltagsfälle mit Hilfe der anerkannten Dogmatik zu klären – und das ist ja gerade Hauptaufgabe später in der Verwaltungspraxis. Wir möchten Ihnen helfen, deren Anforderungen möglichst gut zu bewältigen.
Die im zweiten Teil dargestellten Lösungsvorschläge sind Muster, wie man die Fälle im Rahmen einer Klausur (nicht Hausarbeit) lösen kann.
4.Zielsetzung des dritten Teils
4
Im dritten Teil des Buches erhalten Sie Gelegenheit, die Kenntnisse und Fertigkeiten zu üben, die für die Anfertigung von Bescheiden benötigt werden.
Auch in diesem Teil werden Grundzüge des Allgemeinen Verwaltungsrechts verdeutlicht, wie sie in der Alltagspraxis der Verwaltungsbehörden zum Tragen kommen können. Auf dogmatische Grenzfälle und juristische Filigranarbeit wurde bewusst verzichtet.
Die Lösungsvorschläge sind als Durchschlagsentwürfe – ergänzt mit weiteren Verfügungen – ausgestaltet, wie sie im Reinschriftverfahren (vgl. Nr. 3.3.6 Abs. 2 der Dienstordnung für die Landesverwaltung Baden-Württemberg) üblich sind. Dabei wurde allerdings davon abgesehen, den Briefkopf, das Akten- oder Geschäftszeichen und das Datum aufzunehmen.
II.Arbeitsanleitung für Leser und Leserinnen
1.Arbeitsanleitung für den ersten Teil
Wenn Sie von dem Buch profitieren wollen, dann dürfen Sie es nicht nur durchlesen.
5
Sie sollten zunächst den ersten Teil des Buches durcharbeiten und sich die dort angepriesenen Regeln so erarbeiten, dass Ihnen die Grundzüge bewusst werden. Ob Ihnen das gelungen ist, stellen Sie am besten fest, wenn Sie versuchen, Ihre Erkenntnisse Ihrem Studienkollegen oder Ihrer Studienkollegin zu erklären!
2.Arbeitsanleitung für den zweiten Teil
6
Dann sollten Sie mit dem zweiten Teil des Buches beginnen. Versuchen Sie, mit Ihren vorhandenen methodischen und fachlichen Kenntnissen den ersten Fall zu lösen, ohne dass Sie sich dabei die Vorbemerkungen vorher ansehen. Die Zeitfrage braucht bei Ihrer Arbeit keine Rolle zu spielen; Sie sollten Ihre Lösung wenigstens skizzenhaft zu Papier bringen. Lesen Sie auf keinen Fall den Lösungsvorschlag, bevor Sie sich nicht selbst eine Lösung zurecht gelegt haben. Der Lerneffekt wäre sonst nur sehr gering.
7
Prüfen Sie dann nach, ob Sie in Ihrer Lösung die Probleme erkannt und erörtert haben, die in der Vorbemerkung genannt sind und ob Sie die Hinweise in der methodischen Anleitung beachtet haben. Wenn nein – und zur Auffrischung und Abrundung Ihres Wissens –, sollten Sie zunächst in der Literatur die Themen nachlesen, auf die in der Vorbemerkung verwiesen wird, bzw. sich Ihrer methodischen Fehler bewusst werden, indem Sie die Anleitungsregeln beachten.
8
Bei den angegebenen Literaturstellen werden Sie feststellen, dass wiederkehrend auf folgende Lehrbücher verwiesen wird:
Schweickhardt/Vondung
, Allgemeines Verwaltungsrecht;
Büchner/Schlotterbeck
, Verwaltungsprozessrecht;
Blasius/Büchner
, Verwaltungsrechtliche Methodenlehre
Dahinter steckt die Absicht, dass Sie bei der stofflichen Durcharbeitung der Fälle im Grunde genommen mit drei Lehrbüchern auskommen und Ihnen so eine echte „Arbeit am Schreibtisch“ ermöglicht wird. Sie sollen dabei auch nachvollziehen können, wie man Lehrbuchwissen fallbezogen anwendet und in die Falllösung einarbeitet. Es ist selbstverständlich, dass auch andere Lehrbücher des Allgemeinen Verwaltungsrechts, des Prozessrechts und der Methodenlehre (das Werk Blasius/Büchner ist vergriffen, deshalb empfehlen wir statt dessen: Schwacke, Juristische Methodik mit Technik der Fallbearbeitung oder Kohler-Gehrig, Diplom-, Seminar-, Bachelor- und Masterarbeiten in den Rechtswissenschaften, Kapitel „Die wissenschaftliche Eigenleistung“) zur stofflichen Aufbereitung des Wissens herangezogen werden können – manchmal sogar müssen, wenn es um die Vertiefung von Problemen geht. Die Lösungsvorschläge sind jedoch – so gut es ging – bewusst auf die inhaltlichen Aussagen dieser im Verlag W. Kohlhammer erschienenen Lehrbücher abgestellt.
9
Wenn Sie Ihr Wissen erweitert, abgerundet oder aufgefrischt haben, empfehlen wir Ihnen, eine eigene vollständige Lösung (nochmals) auszuarbeiten, um auch Ihre Fertigkeit im Formulieren zu trainieren. Erst dann sollten Sie sich den Lösungsvorschlag des Buches freigeben. Erschrecken Sie nicht, wenn Sie das Gefühl bekommen, dass Sie den Fall nie so, wie der Lösungsvorschlag lautet, hätten lösen können. Seien Sie sich bewusst, dass die Lösungsvorschläge dieses Buches zwar nach Auffassung der Autoren die gestellte Aufgabe optimal lösen, aber dass es dazu durchaus brauchbare Alternativen geben kann. Machen Sie sich außerdem klar, dass eine gute Bewertungsnote auch zu erreichen ist, wenn man dem Muster nicht gerecht wird. Wer Ihre Arbeit zu korrigieren hätte, würde nämlich berücksichtigen, dass Sie ja gerade erst dabei sind, sich die Fertigkeiten anzueignen, also noch nicht die höchste Fertigkeit besitzen können.
10
Arbeiten Sie auf diese Weise alle 10 Fälle des zweiten Teiles durch. Dabei kann es durchaus passieren, dass Sie feststellen, dass Ihre Kenntnisse nicht ausreichen, um den Fall spontan zu lösen. Lassen Sie sich dadurch nicht erschrecken, sondern bemühen Sie sich nun zunächst, anhand eines Lehrbuchs Ihre Lücken zu füllen. Machen Sie sich erst dann an die Lösung. Auf keinen Fall dürfen Sie aber den Lösungsvorschlag vorher heranziehen.
11
Bei den letzten beiden Fällen handelt es sich um Originalklausuren der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Ludwigsburg (Fall 9: Leistungsnachweisklausur; Fall 10: Staatsexamensklausur), die in einem Zeitrahmen zu fertigen waren. Versuchen Sie, diese Fälle „im ersten Anlauf“ innerhalb der vorgegebenen Zeit zu lösen. Sie tun sich mit der Zeitvorgabe im Ernstfall (Prüfungsklausur) weniger schwer, wenn Sie vorher geübt haben, Ihre Zeit richtig einzuteilen.
3.Arbeitsanleitung für den dritten Teil
12
Sie müssen nicht den gesamten zweiten Teil bewältigt haben, ehe Sie sich mit dem dritten Teil beschäftigen. Vielmehr lässt sich gerade bei den Anfangsfällen zwischen zweitem und drittem Teil abwechseln. Dabei wird Ihnen am ehesten deutlich, welche Unterschiede in der Methode, teilweise auch im Denkansatz, zwischen der Erstellung eines Gutachtens und der Fertigung eines Bescheids bestehen.
Wenn Sie den dritten Teil durcharbeiten, sollten Sie zunächst genauso vorgehen wie beim zweiten Teil. Fertigen Sie zuerst – ohne in die Vorüberlegungen zu schauen – ein Gutachten, auch wenn in der Aufgabe ein Bescheid verlangt wird. Entwerfen Sie dann die notwendigen Schreiben und Geschäftsgangvermerke. Versuchen Sie, sich dabei den praktischen Verwaltungsablauf vorzustellen. Denken Sie vor allem aber an die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger gegenüber Behörden. Gehen Sie davon aus, dass sie meist nicht juristisch geschult sind. Bemühen Sie sich deswegen, möglichst leichtverständlich und überzeugend zu schreiben. Im Anschluss daran dürfen Sie einen Blick in die Vorüberlegungen werfen und durch Nachlesen Ihre Lücken füllen. Erst nach einem weiteren Lösungsversuch sollten Sie sich des Lösungsvorschlags annehmen.
Wenn Sie das gesamte Buch auf diese Weise durchgearbeitet haben und die Ratschläge und Erkenntnisse beherzigen, dürften Sie in der Methodik so gefestigt sein, dass Sie auch einen Einstieg und Weg finden, um rechtlich und tatsächlich schwierigere Fälle des Verwaltungsrechts angemessen zu lösen und die Anforderungen der Verwaltungspraxis und die berechtigten Erwartungen der Bürger zu erfüllen.
B.Anfertigung eines Gutachtens
I.Wesen des Gutachtens
1.Praxisbedeutung
13
In den juristischen Prüfungsaufgaben, die in Universitäten, anderen Hochschulen und Ausbildungsstätten gestellt werden, wird meist verlangt, ein Gutachten zur Rechtslage anzufertigen.
14
Aber auch in der Praxis spielt das Gutachten eine gewichtige Rolle. Überall dort, wo mehrere Menschen an der Entscheidungsfindung beteiligt sind, sind meist eine oder mehrere Personen beauftragt, die Entscheidung durch ein Gutachten vorzubereiten. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiteten in einer Verwaltungsbehörde; Ihr Vorgesetzter bäte Sie um Rücksprache in einer Angelegenheit, in der die Behörde eine Maßnahme zu treffen hat. Ihr Vorgesetzter wird erwarten, dass Sie ihm den Fall, so wie er sich Ihnen tatsächlich darstellt, vortragen, dann die für die Entscheidung (Lösung des Falles) maßgebenden rechtlichen Gesichtspunkte schildern und ihm schließlich einen Entscheidungsvorschlag unterbreiten. Mit anderen Worten: Sie müssen Ihrem Vorgesetzten ein mündliches Gutachten vortragen.
15
Das gleiche Verfahren finden Sie bei allen Kollegialgerichten. Dort ist stets ein Richter mit der „Berichterstattung“ beauftragt; d. h., ein Richter erstellt ein Gutachten als Grundlage für die Entscheidung des Richterkollegiums.
Es ist also keine Marotte von Ausbildern und kein überflüssiger Ballast, wenn man versucht, Ihnen mit Nachdruck die Technik zur Anfertigung eines Gutachtens zu vermitteln. Sie brauchen diese Fertigkeit vielmehr für die Praxis!
2.Inhalt des Gutachtens
16
Das Wesen des Gutachtens besteht in der rechtlichen Würdigung eines Falles zur Vorbereitung einer fremden Entscheidung. Das Gutachten ist also eine Entscheidungshilfe. Aus dieser Zielerkenntnis heraus ergeben sich drei Begrenzungen, die für die praktische Arbeit wichtig sind:
17
Hinführen zum Ergebnis:
Der Leser darf nicht mit einem fertigen Ergebnis „vor den Kopf gestoßen werden“. Er muss gedanklich zum Ergebnis logisch hingeführt werden.
Bezug zur Aufgabe:
Die rechtliche Würdigung darf keine abstrakte Erörterung von Rechtsfragen sein. Nur soviel an rechtlicher Erörterung und Theorie ist angebracht, wie für die Lösung des Falles notwendig ist.
Klarheit der Entscheidung:
Der Verfasser darf nicht im unklaren lassen, was er selbst vorschlägt und meint. Ein noch so großer Fundus an juristischem Wissen rettet ein Gutachten nicht, wenn das Ziel, eine konkrete Entscheidung treffen zu müssen, aus den Augen verloren wird.
3.Form des Gutachtens
18
Das Gutachten lässt sich in drei Teile untergliedern:
Es beginnt mit einem
Sachbericht
. Der Gutachter stellt die Tatsachen dar, die für die Beurteilung des Falles von Bedeutung sein können.
Dann folgt die
rechtliche Würdigung
. Sie muss so ausführlich sein, dass ein anderer Rechtskundiger eine eigene Entscheidung fällen kann.
Es endet mit einem
Entscheidungsvorschlag
. Nicht die gesamte Entscheidung ist vorzutragen, sondern nur die Entscheidungsformel.
Ein einfaches Beispiel mag dies verdeutlichen:
Beispiel: Ein Bürgermeister erteilt Ihnen den Auftrag, eine Stellungnahme auszuarbeiten, ob er an eine bestimmte, mündlich erteilte Zusage gebunden sei.
Sie müssen zunächst einen kurzen Sachbericht erstellen. Nur so kann der Bürgermeister ersehen, ob Sie auch alle tatsächlichen Gesichtspunkte berücksichtigt haben, auf die es ihm ankam.
Dann müssen Sie ihm die gesetzlichen Grundlagen (§ 38 LVwVfG? Anwendungsbereich?) und den Meinungsstand in Literatur und Rechtsprechung, soweit es für die rechtliche Würdigung seiner Frage von Bedeutung ist, so darlegen, dass er sich eine eigene Meinung bilden und entsprechend entscheiden kann und trotzdem gleichzeitig zu einer bestimmten Entscheidung geführt wird (keine unnötigen theoretischen Abhandlungen, die mit der Sache nichts zu tun haben; Bezug zur Aufgabe muss stets da sein). So interessant die Theorie sein mag, im Zweifel hat der Bürgermeister dafür keine Zeit.
Enden müssen Sie mit einem eigenen konkreten Entscheidungsvorschlag (die Zusage als bindend oder nicht bindend anzusehen), der sich als Ergebnis Ihrer rechtlichen Würdigung aufdrängt. Der Bürgermeister möchte sehen, welche konkreten Konsequenzen sich nach Ihrer Auffassung aus dem Fall ergeben.
19
In der Verwaltungspraxis werden die drei Abschnitte – Sachbericht, rechtliche Würdigung, Entscheidungsvorschlag – nicht immer nötig sein; sie werden häufig auch nicht klar getrennt. So kommt es oft vor, dass der Auftrag nicht lautet, einen ganzen, komplexen Fall zu lösen, sondern nur dahin geht, zu Einzelfragen Stellung zu nehmen.
Beispiel: Stellen Sie sich vor, Ihr Bürgermeister erhält einen förmlichen Widerspruch einer Bürgerinitiative gegen eine Verwaltungsentscheidung. Er hat Bedenken, ob eine Bürgerinitiative widerspruchsbefugt ist, und beauftragt Sie, diese Frage zu prüfen.
Hier kann der Sachbericht entfallen. Statt dessen steht zu Beginn die klar formulierte Fragestellung: Ist eine Bürgerinitiative widerspruchsbefugt? Bei der rechtlichen Würdigung ändert sich jedoch nichts. Sie müssen die Frage so durcharbeiten, dass Sie den Bürgermeister zu einer Entscheidung hinführen, die er selbst nachvollziehen kann. Statt mit einem Entscheidungsvorschlag endet Ihr Gutachten hier mit einem klar formulierten Ergebnis (die Widerspruchsbefugnis besteht nicht – es sei denn, § 64 BNatSchG oder § 2 Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzt treffen zu).
4.Besonderheiten in Klausur und Hausarbeit
20
In Klausuren und Hausarbeiten wird Ihnen oft mit der Aufgabe ein fertiger Sachverhalt geliefert. Sie brauchen dann keinen Sachbericht zu fertigen; diese Aufgabe hat Ihnen ja der Aufgabensteller abgenommen, als er den Sachverhalt formulierte.
Eine weitere Besonderheit ist, dass selten ganz allgemein gefragt wird: „Wie ist zu entscheiden?“, sondern dass eine ganz konkrete Frage an Sie gerichtet wird: „Ist der Verwaltungsakt rechtmäßig?“ – „Um welche Nebenbestimmung handelt es sich?“ – oder aber aus der Aufgabenstellung herausgearbeitet werden kann: „Wie ist die Rechtslage?“ Ziel eines Gutachtens in einer Klausur ist es deshalb im Regelfall, als Ergebnis nicht einen Entscheidungsvorschlag zu unterbreiten, sondern auf eine bestimmte Frage eine klare Antwort geben zu können. Am Schluss eines solchen Gutachtens steht deshalb kein Entscheidungsvorschlag, sondern als Ergebnis die Antwort auf die Frage.
II.Methodik der gutachtlichen Fallbearbeitung
21
Die folgende Darstellung der Methodik ist auf ein Gutachten ausgerichtet, das von Studierenden in einer Klausur oder Hausarbeit verlangt wird. Die Methodik vereinfacht sich etwas, wenn man in der Praxis ein Gutachten zu erstellen hat, weil durch die praktische Erfahrung Schwierigkeiten entfallen, die in einer Klausur noch existieren. In den Grundzügen bleibt sie aber dieselbe.
22
Es gibt viele Vorschläge in der Literatur, wie man einen Fall methodisch in den Griff bekommt. Besonders praktikabel und einprägsam erscheint der Ansatz Schwerdtfegers (siehe dort, Rn. 772 ff.); an ihm orientiert sich die folgende Darstellung. Schwerdtfeger zeigt auf, dass jede Fallbearbeitung – wie auch jede wissenschaftliche Arbeit – vier „Stationen“ zu durchlaufen hat:
Erfassen der Aufgaben,
Hintasten zur Lösung,
Planung der Darstellung und
Niederschrift.
Dieser Vorgabe wollen wir folgen und untersuchen, welche Überlegungen und Handlungen Sie bei den einzelnen Stationen anzustellen haben.
1.Erfassen der Aufgabe
23
Eine Aufgabe kann man nur richtig erfassen, wenn man den Text gründlich liest. Sie müssen also zunächst den Aufgabentext sorgfältig durchlesen. Dabei verstehen wir unter Aufgabe sowohl den Lebenssachverhalt als auch die Aufgabenstellung (Rechtsfrage). Beim ersten Lesen dürfen Sie zügig lesen, weil Sie zunächst das „Terrain“ erforschen müssen, in dem Sie agieren sollen.
24
Beim zweiten oder – besser – dritten Lesen, sollten Sie aber bereits die Fragestellung im Blick haben, um Ihre ersten Eindrücke von der Bedeutung des Sachverhalts für die gestellten Fragen durch Unterstreichungen oder Randbemerkungen festzuhalten. Noch besser: Legen Sie ein Blatt neben sich und notieren Sie sich die rechtlichen Probleme und Sachverhaltsangaben, die Ihnen auf den ersten Blick auffallen, damit Sie später eine Kontrolle haben, ob Sie nichts vergessen haben, was Ihnen auf den ersten Blick wichtig erschien. Wohlgemerkt: Diese Notizen sind reine Merkposten. Den Weg zur Lösung finden Sie dadurch nicht. Ihn müssen Sie systematisch erarbeiten (vgl. Rn. 31 ff. „Hintasten zur Lösung“).
Das Erfassen der Aufgabenstellung kann schwierig sein, wenn der Aufgabensteller die Fragestellung unklar formuliert.
Beispiele: Wie ist die Rechtslage? – Wie ist der Sachverhalt zu beurteilen? – Erstatten Sie ein Gutachten!
25
In diesen Fällen müssen Sie zunächst die Fragestellung selbst konkretisieren, indem Sie nach der Interessenlage aller Beteiligten fragen und daraus ermitteln, was der Einzelne will (wer will was von wem?). Ob dieses Wollen verwirklicht werden kann, ist dann letztlich die konkrete Fragestellung.
26
Typische, aber vermeidbare Fehler treten beim Erfassen der Aufgabe immer wieder auf:
27
a. Sie dürfen sich nicht dadurch in einen lähmenden Schock versetzen lassen, dass Sie auf den ersten Blick den Eindruck gewinnen, Sie wüssten mit dem Fall nichts anzufangen (sei es, weil Ihnen der Einstieg fehlt, weil Ihnen die Problematik nicht deutlich wird oder weil Ihnen das Rechtsgebiet fremd erscheint). Dieser Eindruck ist selbst einem erfahrenen Rechtspraktiker zuweilen nicht fremd! Der Eindruck verfliegt, wenn man systematisch (vgl. Rn. 31 ff.) an die Lösung herangeht, wenn man die im Fall angegebenen Paragraphen nachliest, wenn man sich klarmacht, dass in einer Klausur keine spitzfindigen Einzelkenntnisse aus besonderen Rechtsgebieten erwartet und deshalb auch nicht verlangt sein können.
28
b. Sie sollten nicht über Lücken im Sachverhalt verzweifeln! Manchmal werden tatsächliche Angaben in Zweifel gezogen, wo keine Zweifel angebracht sind.
Beispiele:
Es wird gerätselt, ob die Behörde örtlich zuständig war, obwohl im Sachverhalt eindeutig von der zuständigen Behörde die Rede ist.Es wird vermutet, dass der 16.1. ein Samstag oder Sonntag sein könnte, obwohl der Sachverhalt keine Anhaltspunkte gibt und auch kein Terminkalender mitgeliefert wird.Es wird angenommen, der Aussteller eines Schreibens, sei nicht erkennbar, wenn es im Sachverhalt heißt: Die Behörde erließ folgendes Schreiben: „Sehr geehrter Herr Meier, Sie werden aufgefordert, Ihr Haus abzubrechen …“Wenn wirklich ein Sachverhalt zweifelhaft ist, müssen Sie das unterstellen, was nach der Lebenserfahrung normal ist. Hätte der Aufgabensteller etwas anderes gewollt, hätte er es geschrieben (oder sollte es zumindest tun).
29
c. Sie müssen Tatsachenbehauptungen, die im Sachverhalt unwidersprochen aufgestellt werden, als wahr unterstellen.
Beispiele:
Es wird nach den Erfolgsaussichten einer Klage gefragt, wenn ein Gesellenprüfling behauptet, seine politischen Anschauungen hätten Einfluss auf das Prüfungsergebnis genommen. – Sie müssen davon ausgehen, dass es so war.Im Sachverhalt ist von giftigen Abwässern einer Molkerei die Rede. Sie haben dies anzunehmen, selbst wenn Sie Zweifel haben, dass es so etwas gibt.30
d. Sie müssen Bearbeitungshinweise beachten. Manchmal „umschifft“ der Verfasser eine vom Erfassen und vom Lösen der Aufgabe her schwierige Stelle dadurch, dass er sie durch einen Bearbeitungshinweis umgeht.
Beispiele:
Der Bearbeitungshinweis gibt vor, dass der Tatbestand einer bestimmten Ermächtigungsgrundlage erfüllt sei. Die Subsumtion kann (muss) entfallen.Der Bearbeitungshinweis kann regeln, dass bestimmte rechtliche Gesichtspunkte (etwa verfassungsrechtliche) nicht zu erörtern sind.Der Bearbeitungshinweis ist also wesentlicher Bestandteil der Aufgabe!
2.Hintasten zur Lösung
31
Sind Sachverhalt und Fragestellung eindeutig fixiert, kommt die Hauptarbeit, das Kernstück, der schwierigste Teil des Gutachtens. Sie sollen und müssen zeigen, wie weit Ihre Kenntnisse des Rechts und der Methodik des Rechts reichen, indem Sie eine brauchbare, nachvollziehbare, abgesicherte, alle wesentlichen Gesichtspunkte beachtende Lösung erarbeiten.
Den ersten vorsichtigen Schritt dazu taten Sie schon, als Sie beim Erfassen der Aufgabe Teile des Sachverhalts unterstrichen oder Problemstellungen auf ein gesondertes Blatt herausschrieben. Vorsichtig muss der Schritt deshalb sein, weil man sich nicht durch erste Eindrücke programmieren lassen darf.
a.Der Syllogismus als Lösungsansatz
32
Jetzt gilt es entschlossen voranzuschreiten. Dies ist nur möglich, wenn der Fallbearbeiter den Weg zum Ziel – die richtige Methode – gesucht und gefunden hat. Die Folgerichtigkeit des Denkens ist Gegenstand der allgemeinen Logik; sie hat ihren Platz auch im juristischen Denken. Deshalb liegt es nahe, sich nach einer logischen Methode umzusehen, die von der Fragestellung zur Antwort führt.
33
Als logische Methode anerkannt ist der „juristische Syllogismus“. Sein Kern ist der Schluss vom Allgemeinen auf das Besondere, der in drei Schritten abläuft. Er vollzieht sich nach folgendem Schema:
Man geht von einem verbindlichen, anerkannten
Obersatz
aus, in dem für eine Vielzahl von Fällen eine bestimmte Rechtsfolge aufgestellt wird.
Hat man nun einen konkreten Lebenssachverhalt
(Untersatz)
,
so braucht man nur zu prüfen, ob die allgemeinen Voraussetzungen des Obersatzes erfüllt sind,
um dann daraus den logischen Schluss zu ziehen
(Schlusssatz)
, welche konkrete Rechtsfolge für den tatsächlichen Lebenssachverhalt gilt.
34
Dieses Verfahren soll anhand eines weiteren Beispiels dargestellt werden:
Beispiel:
Obersatz: (Allgemeine Rechtsnorm)
Eine Ernennung (zum Beamten) ist zurückzunehmen, wenn sie durch … arglistige Täuschung … herbeigeführt wurde … (§ 14 Abs. 1 Nr. 1 LBG).
Untersatz: (Konkreter Sachverhalt)
A ist zum Landesbeamten ernannt worden, weil er der Einstellungsbehörde (absichtlich) ein gefälschtes Zeugnis vorgelegt hat.
Schlusssatz: (Konkrete Rechtsfolge)
Also ist die Ernennung des A zum (Landes-)Beamten zurückzunehmen.
35
Der juristische Syllogismus ist die Grundregel der Rechtsanwendung. Sie lässt sich auch nutzbar machen, um sich bei juristischen Gutachten zu Lösungen vorzutasten. Sie finden dann einigermaßen sicher zur Lösung, wenn Ihnen ein allgemein verbindlicher Obersatz bekannt ist, dessen Folgeregelung („Dann“-Aussage/Rechtsfolge) eine positive oder negative Anwort auf die im Aufgabentext gestellte Frage enthält. Ob Ihnen ein solcher Obersatz einfällt, hängt weitgehend von Ihren juristischen Kenntnissen und Fähigkeiten ab.
Beispiele:
Frage 1: Obersatz: (Antwort)
Hat die Klage Aussicht auf Erfolg?
Die Klage hat dann Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist.
Frage 2: Obersatz: (Antwort)
Ist der Verwaltungsakt rechtmäßig?
Er ist dann nicht rechtmäßig, wenn er gegen die Grundsätze vom Vorbehalt oder Vorrang des Gesetzes verstößt
oder wenn er den formellen und materiellen gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
Frage 3: Obersatz: (Antwort)
Ist das Landratsamt zuständig?
Es ist dann zuständig, wenn ihm eine gesetzliche Regelung die Befugnisse zuweist.
36
Auch wenn die Frage positiv gestellt ist (Ist der VA rechtmäßig?), darf negativ geantwortet werden (Er ist dann rechtswidrig, wenn …). Meist ist es einfacher, den Obersatz negativ zu formulieren, weil dafür bereits ein fehlendes Kriterium ausreicht, während für einen positiven Einstieg sämtliche Voraussetzungen in den Obersatz einbezogen sein müssen.
Beispiel:
Der Verwaltungsakt ist dann rechtmäßig, wenn er allen formellen und materiellen Anforderungen entspricht.Aber: Der Verwaltungsakt ist (schon) dann rechtswidrig, wenn (nur) eine formelle Vorgabe (z. B. die Anhörungspflicht) nicht beachtet wurde.37
Ist ein solcher Obersatz gefunden, ergibt sich der weitere Weg nach dem syllogistischen Schlussverfahren fast von selbst. Nachdem der konkrete Lebenssachverhalt im Aufgabentext mitgeliefert wird, braucht man „nur noch“ zu überprüfen, ob sich dieser Sachverhalt unter die Voraussetzungen des Obersatzes subsumieren lässt und kommt auf diese Art und Weise zum konkreten Ergebnis, das als Rechtsfolge in dem Obersatz ja bereits enthalten war.
Beispiel:
Frage:
Darf A auf einer öffentlichen Straße nach Vollendung seines 18. Lebensjahres das Auto fahren, das ihm sein Vater zum Geburtstag schenkte?
Antwort: (Obersatz)
Nach § 2 Abs. 1 Satz 1 StVG darf auf öffentlichen Straßen ein Kraftfahrzeug nur führen, wer eine Erlaubnis der zuständigen Behörde besitzt.
Sachverhalt: (Untersatz)
Das Auto ist ein Kraftfahrzeug. A will es auf einer öffentlichen Straße führen. Er besitzt keine behördliche Fahrerlaubnis.
Ergebnis: (Schlusssatz)
A darf das Auto nicht fahren.
38
Ganz so einfach ist es aber doch nicht. Denn der Obersatz, der zum Einstieg in die Lösung verhilft, ist im Regelfall so allgemein gehalten, dass seine Voraussetzungen zunächst hinterfragt und durch weitere (nachgeordnete) Obersätze konkretisiert werden müssen – usw., bis man schließlich zu einem Obersatz kommt, der so konkret ist, dass man den Sachverhalt darunter subsumieren und eine Schlussfolgerung ziehen kann.
Beispiel:
Hauptfrage: (Aufgabe)
Hat die Anfechtungsklage Aussicht auf Erfolg?
Antwort: (Obersatz)
Sie hat dann Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist.
Unterfrage:
Wann ist eine Klage zulässig?
Antwort: (nachgeordneter Obersatz)
Sie ist dann zulässig, wenn die allgemeinen und besonderen Zulässigkeitsvoraussetzungen vorliegen.
Unterfrage:
Welches sind die allgemeinen Zulässigkeitsvoraussetzungen?
Antwort: (nachgeordneter Obersatz)
Bei einer Klage fehlt gem. § 81 Abs. 1 VwGO eine allgemeine Zulässigkeitsvoraussetzung, wenn sie nicht schriftlich bei Gericht eingeht oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle des Gerichts erklärt wird.
Untersatz: (Sachverhalt)
Die Klage wurde lediglich telefonisch, d. h. mündlich eingelegt.
Schlusssatz: (Schlussfolgerung)
Also liegt eine allgemeine Zulässigkeitsvoraussetzung nicht vor; also ist die Klage unzulässig; also hat sie keine Aussicht auf Erfolg!
39
Erhebliche Schwierigkeiten können ferner noch auftreten, wenn man endlich einen Obersatz gefunden hat, der eine Frage beantwortet und subsumierbar erscheint, bei dem man aber dann beim konkreten Subsumieren feststellen muss, dass er bestückt ist mit unbestimmten Rechtsbegriffen.
Beispiele:
Es wurde im vorangegangenen Beispiel als selbstverständlich unterstellt, dass eine telefonische Klageerhebung weder schriftlich noch zur Niederschrift im Sinne des § 81 VwGO erfolgt. Eigentlich hätte noch untersucht werden müssen, was man unter „schriftlich“ und „zur Niederschrift“ versteht.In dem Beispielsfall des 18-jährigen A, der Auto fahren will, konnte nur deshalb so geradlinig subsumiert werden, weil der Sachverhalt die Probleme des unbestimmten Rechtsbegriffes ausräumte. Ohne die Hilfe hätte der Sinngehalt der Worte „Kraftfahrzeug“ und „öffentliche Straße“ ermittelt werden müssen, ehe der Sachverhalt hätte subsumiert werden können.40
Die Regeln über die Auslegung von Gesetzen helfen, den unbestimmten Rechtsbegriff zu konkretisieren, damit er für den einzelnen Lebenssachverhalt subsumierbar wird und sich eine zum Ergebnis führende Schlussfolgerung ziehen lässt. An dieser Stelle wollen wir uns mit dem Hinweis auf die vier herkömmlichen Auslegungsarten begnügen:
Philologische Interpretation
(= Auslegung nach dem Wortlaut, dem Sprachgebrauch)
Systematische Interpretation
(= Auslegung nach dem Zusammenhang)
Historische Interpretation
(= Auslegung nach der Entstehungsgeschichte)
Teleologische Interpretation
(= Auslegung nach dem Gesetzeszweck)
Wer sich des Verfahrens der Auslegung nicht sicher ist, sollte in einem der Methodenlehrbücher nachlesen (etwa: Kohler-Gehrig, Kapitel VI). Die Auslegungstechnik gehört zum „juristischen Handwerkzeug“ eines jeden, der beruflich mit Gesetzen umzugehen hat.
41
Wir haben die syllogistische (logische) Methode oben aus didaktischen Gründen in den Beispielen ganz streng in allen Details dargestellt. Haben Sie die Vorgehensweise grundsätzlich verstanden, so können und sollen Sie – um schnell das Ziel zu erreichen – selbstverständlich die (unproblematischen) Gedankenfolgerungen überspringen und gleich zum zentralen Problem der Rechtsanwendung kommen.
Beispiel:
Frage:
Obersatz: (als Einstieg)
Hat die Klage Aussicht auf Erfolg?
Sie hat dann Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist.
Sprung:
Bedenken wegen der Zulässigkeit bestehen im Hinblick auf die formgerechte Erhebung der Klage.
Obersatz: (konkrete Rechtsnorm)
Gem. § 81 VwGO ist eine Klage nur dann formgerecht erhoben und damit zulässig, wenn dies schriftlich oder zur Niederschrift geschah.
Untersatz:
Im vorliegenden Fall wurde sie telefonisch, d. h. mündlich eingelegt.
Schlusssatz:
Also ist die Klage nicht formgerecht erhoben, also ist sie nicht zulässig, also hat sie auch keine Aussicht auf Erfolg.
Sie dürfen sogar so weit gehen, dass Sie von der gestellten Frage gleich auf den entscheidenden Rechtssatz springen.
Beispiel:
Frage: Lösungsansatz:
Hat die Klage Aussicht auf Erfolg?
Bedenken, ob die Voraussetzungen des § 81 VwGO erfüllt sind und die Klage deshalb unzulässig ist, ergeben sich insoweit, als die Klage telefonisch eingelegt wurde.
42
Bei genügender Erfahrung lässt sich also der Einstieg in die Aufgabenlösung in der Weise finden, dass man eine Antwort auf folgende Frage sucht: Gibt es eine Rechtsnorm, die es mir in ihrer Rechtsfolge gestattet, die Fallfrage positiv oder negativ zu beantworten? Die Anwendung dieser Rechtsnorm ist dann der Weg, den man im syllogistischen, logischen Verfahren zu beschreiten hat, indem man den bekannten Subsumtionsvorgang vollzieht.
Beispiele:
Frage 1 : Obersatz als Lösungsansatz:
Hat die Klage Aussicht auf Erfolg?
Sie hat dann keinen Erfolg, wenn sie gem. § 81 VwGO unzulässig ist, weil sie nicht formgerecht erhoben wurde.
Frage 2:
Darf die Baurechtsbehörde die Nutzung des Gebäudes verbieten?
Obersatz als Lösungsansatz:
Sie darf es dann, wenn sie § 65 Satz 2 LBO dazu ermächtigt.
43
Bei genügend Übung wird es Ihnen bald selbst auffallen, dass die ständige Wiederholung des Konditional-Stiles (Der VA ist dann rechtswidrig, wenn …) mit der Zeit schwerfällig wirkt. Eleganter wird Ihre Lösung, wenn Sie sich auch des hypothetischen Stiles bedienen (In Betracht kommt ein Verstoß gegen …; als Anspruchsgrundlage könnte … in Frage kommen; möglicherweise ergibt sich eine Ermächtigung aus …; zu prüfen ist, ob …).
Beispiele:
Frage 1: Hypothese als Lösungsansatz:
Hat die Klage Aussicht auf Erfolg?
Möglicherweise ist sie nach § 81 VwGO unzulässig, weil sie dessen Formerfordernisse nicht erfüllt.
Frage 2:
Darf die Baurechtsbehörde die Nutzung des Gebäudes verbieten?
Hypothese als Lösungsansatz:
Als Ermächtigungsgrundlage kommt § 65 Satz 2 LBO in Betracht. Danach darf sie nur einschreiten, wenn …
Sie werden bemerkt haben: Auch wenn man die syllogistische Methode auflockert, bleibt sie der richtige Einstieg für das Herantasten an die Lösung und für die Anwendung des Rechtssatzes, unter den der Lebenssachverhalt schließlich zu subsumieren ist. Dazwischen sind Sprünge erlaubt – eine stilistische Abwechslung ist sogar erwünscht.
b.Verwendung von Schemata
44
In jeder Bearbeitungsanleitung finden Sie eine Auseinandersetzung mit den Schemata, die man zur Bearbeitung verwaltungsrechtlicher Fälle aufgestellt hat – so auch hier.
Auf ihre Gefährlichkeit braucht man dann nicht ausführlich hinzuweisen, wenn man ihre richtige Handhabung beschreibt. Deshalb soll hier nochmals ausdrücklich betont werden: Wenn ein Schema den richtigen Weg zur Lösung weist, dann ist es der syllogistische Denkansatz. Passt aber ein anderes Schema in diesen Denkansatz oder lässt es sich auf diesen Denkansatz „trimmen“, so ist es durchaus als Hilfe beim Hintasten zur Lösung geeignet, nicht aber bei der Planung der Darstellung und der Niederschrift selbst! Bevor Sie ein Schema oder Teile eines Schemas anwenden, müssen Sie stets prüfen, ob das Schema – als Obersatz umformuliert – eine Antwort auf die konkret gestellte Frage gibt.
Beispiel:
Frage: Kann der Verwaltungsakt zwangsweise durchgesetzt werden?
Das Schema zur Prüfung der Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsaktes ist kein geeigneter Lösungsansatz. Es würde – als Obersatz formuliert – lauten: „Der Verwaltungsakt ist dann rechtswidrig, wenn …“ Die Frage ist aber nicht auf seine Rechtmäßigkeit, sondern seine Vollstreckbarkeit gerichtet. Deshalb lautet der passende Einstiegsobersatz: „Er kann dann zwangsweise durchgesetzt werden, wenn die allgemeinen und besonderen Vollstreckungsvoraussetzungen vorliegen.“
Wenn Sie unsere „Bedienungsanleitung“ beherzigen und nicht gedankenlos mit den Schemata umgehen, dürfen und sollen Sie sich ihrer gerne bedienen. Wer Sie belächelt, sucht oft selbst nach Schemata, um einen Fall „durchprüfen“ zu können, den er in einem ihm fremden Rechtsgebiet zu bearbeiten hat. Für vertraute Rechtsfälle orientiert man sich ohnehin an Strukturen (= Schemata), die aus früheren Fällen geläufig sind.
Einige solcher Aufbauschemata besprechen wir deshalb ausführlich in einem gesonderten Abschnitt (vgl. Rn. 64 ff.).
c.Alternativlösungen – Hilfsgutachten
45
Manchmal ist ein Fallbearbeiter versucht, eine Aufgabe alternativ zu lösen.
Beispiel: Bei der Prüfung, ob die Aufhebung eines Verwaltungsakts als Widerruf oder Rücknahme zu behandeln ist, lässt der Sachbearbeiter diese Frage offen und prüft den Fall für beide Alternativen durch.
46
Derartige Alternativlösungen sind in einem Gutachten unzulässig. Auch wenn man bei einer Rechtsfrage Zweifel an der eigenen Lösung hat, muss man sich klar entscheiden. Gleiches gilt, wenn es zu einer Rechtsfrage verschiedene Theorien gibt: In diesem Fall muss man sich mit den Theorien auseinandersetzen und sich für eine entscheiden (dass man eine eigene Theorie entwickelt, wird man von Studierenden in einer Klausur nicht erwarten!). Nur so bleibt der „Rote Faden“ für die logische Hinführung zum Ergebnis erhalten.
Zulässig ist es, eine Streitfrage dahingestellt sein zu lassen, wenn sie nicht relevant wird.
Beispiel: Es kann dahingestellt bleiben, ob eine Zusicherung (vgl. § 38 LVwVfG) einen VA darstellt, wenn es um die Frage der Voraussetzungen für eine Rücknahme der Zusicherung geht. § 38 Abs. 2 LVwVfG erklärt die Vorschriften über die Rücknahme eines VA für entsprechend anwendbar.
47
Als eine Art Alternativlösung kann man auch das Hilfsgutachten bezeichnen. Von einem Hilfsgutachten spricht man dann, wenn für die Aufgabe eine eindeutige Lösung gefunden und das Ergebnis festgehalten worden ist, wenn man aber dann ein anderes Ergebnis unterstellt, um nun ausdrücklich hilfsweise von diesem anderen Ergebnis aus den Fall nochmals weiterzuentwickeln.
Beispiel: Ein Bearbeiter muss überprüfen, ob ein Antragsteller einen Anspruch auf Wiederaufgreifen des Verfahrens besitzt. Dabei kommt er zum Ergebnis, es bestehe eine neue Sachlage i. S. d. § 51 LVwVfG. Er kommt also zu dem Ergebnis, der Antragsteller besitze einen Anspruch auf Wiederaufgreifen. Dies ist seine Antwort auf die gestellte Frage und seine Lösung der Aufgabe. Wenn er nun anschließend überprüft, welchen Anspruch der Antragsteller besäße, wenn man davon ausginge, eine neue Sachlage läge nicht vor, so wäre dies ein Hilfsgutachten.
48
Derartige Hilfsgutachten sind grundsätzlich unzulässig, es sei denn, sie sind laut Aufgabenstellung ausdrücklich verlangt oder es handelt sich um ein prozessuales Gutachten.
Beispiel: Wird in einer Aufgabe nach den Erfolgsaussichten eines Widerspruchs gefragt und kommt der Bearbeiter zum Ergebnis, der Widerspruch sei unzulässig, so muss er in einem Hilfsgutachten – das als solches ausdrücklich zu kennzeichnen ist – auch noch die Begründetheit überprüfen, wenn dazu nach dem Sachverhalt Anlass besteht (d. h., wenn im Sachverhalt materiell-rechtliche Probleme angesprochen sind).
Aufpassen müssen Sie, dass Sie Hilfsgutachten und Alternativlösung nicht mit einem anderen Problem verwechseln, das Anfängern und Anfängerinnen oft Schwierigkeiten bereitet:
Beispiel: Bei der Prüfung der Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsakts kommen Sie zum Ergebnis, dass die Maßnahme schon wegen fehlender örtlicher Zuständigkeit rechtswidrig ist. Nun fragt es sich, ob auch noch andere mögliche Mängel überprüft werden müssen, nachdem das Ergebnis ja bereits feststeht.
49
Wenn man früh ein Ergebnis gefunden hat, so darf man sich damit nicht begnügen, wenn der Fall noch Ansatzpunkte bietet, um das Ergebnis zu untermauern. Man sollte sein Ergebnis auf „möglichst viele Beine stellen“. Das bedeutet z. B., dass Sie alle Gesichtspunkte durchzuprüfen (und später auch klarzustellen) haben, die im Sachverhalt für oder gegen die Zulässigkeit eines Rechtsbehelfs sprechen, auch wenn Sie schon beim ersten Blick einen Mangel gefunden haben, der zur Unzulässigkeit führt. Gleiches gilt für die Prüfung der Rechtmäßigkeit einer Handlung, für mehrere Anspruchsgrundlagen, für die Begründetheit eines Rechtsbehelfs usw.
3.Planung der Darstellung
50
Nachdem Sie sich in einem logischen Verfahren zum Ergebnis hingetastet haben, müssen Sie sich überlegen, wie Sie Ihre Gedanken darstellen wollen. Sie sollten nicht alles, was Sie sich überlegt haben, auch im Gutachten ausführen, sondern nur das Nötige und das, was zum Fall Bezug hat.
51
Ein Gutachten ist keineswegs optimal, wenn man jeden logischen Schritt und jeden Problempunkt für die Darstellung einplant. Im Gegenteil: Jetzt gilt es spätestens, sich vom schematischen (nicht vom logischen) Denken zu lösen. Nur die Gesichtspunkte und Probleme dürfen Sie für darstellenswert ansehen, die für den „fremden Dritten“ (Korrektor), an den Sie Ihr Gutachten als den verständigen Leser richten, aus dem Sachverhalt heraus wirklich problematisch sind. Hierin besteht oft für Anfänger die Hauptschwierigkeit, die Sie nur durch Üben überwinden können.
52
Auf jeden Fall müssen Sie in die Planung der Darstellung die rechtlichen Gesichtspunkte aufnehmen, die nach Ihrer Auffassung logisch zum Ergebnis hinführen. Nie außer Acht lassen dürfen Sie dabei die Argumente und Einwände, die im Sachverhalt von der Behörde oder einem sonstigen Betroffenen vorgetragen werden (beim ersten Lesen schon notieren!). Wird man so auf ein Problem „hingewiesen“, besteht stets Anlass, die Auseinandersetzung mit diesen Argumenten in die Darstellung mitaufzunehmen.
53
Arbeitstechnisch empfehlen wir, wie früher beim Aufsatzschreiben vorzugehen: Fertigen Sie eine Gliederung mit dazugehörigen, stichwortartigen Problempunkten, die den roten Faden Ihrer logischen Gedankenführung erkennen lässt. Bewusst ist nur von der Gliederung die Rede, nicht von einem „Konzept“ oder „Entwurf“ oder von einer „Kladde“. Sie sind unnötig – dafür reicht auch die Zeit nicht!
54
„Steht die Gliederung“, sollten Sie prüfen, ob Sie ein Problem übersehen haben, das Ihnen auf den ersten Blick wichtig erschien und das Sie deshalb auf ein Konzeptblatt geschrieben hatten. Fehlt dieses Problem in Ihrer Gliederung, ist damit noch nicht gesagt, dass es dort hineingehört. Sie hatten es ja nur herausgeschrieben als Merkposten, ohne Bezug zur logischen Falllösung. Durch den Vergleich Ihrer Gliederung mit Ihren Notizen versichern Sie sich, dass Sie nichts vergessen haben.
4.Niederschrift
55
Sobald die Gliederung erstellt ist, können (müssen) Sie sich an die Niederschrift wagen. Beherzigen Sie dabei durchaus, was Sie (hoffentlich) im Deutschunterricht gelernt haben. Schreiben Sie verständlich (wie man das erreicht, wird unten im Einzelnen ausgeführt, vgl. Rn. 266 ff.). Ein juristisches Gutachten ist nur dann wirklich gut, wenn es auch gut verständlich und elegant formuliert ist.
56
Schreiben Sie im Gutachtenstil. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er den Leser in logischen Schritten zum Ergebnis hinführt. Zu Beginn wird ein mögliches Ergebnis in Erwägung gezogen, dann werden die Voraussetzungen für dieses Ergebnis überprüft, um schließlich zum konkreten Ergebnis, der Schlussfolgerung zu kommen. Wir erinnern Sie, dass der Einstieg sowohl in die konditionale (dann, wenn …) als auch in die hypothetische Form (in Betracht kommt, …) gefasst sein kann (vgl. Rn. 43).
Beispiel: Der Anspruch auf Erteilung der Baugenehmigung könnte sich aus § 58 Abs. 1 Satz 1 LBO ergeben. Voraussetzung dafür ist, dass keine von der Baurechtsbehörde zu prüfenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen. Als entgegenstehende öffentlich-rechtliche Vorschrift kommt § 5 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 7 Satz 2 LBO in Frage. Danach muss mit einer mehr als 5 Meter breiten Wand ein Grenzabstand von mindestens 2,5 Meter eingehalten werden. Das eingeschossige Gebäude, um dessen Genehmigung es geht, hält nur einen Grenzabstand von 2,00[xxx]nbsp[xxx]m ein, obwohl die maßgebliche Wand länger als 5 Meter ist. Also verstößt es gegen § 5 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 7 Satz 2 LBO – eine öffentlichrechtliche Vorschrift. Ein Anspruch auf Genehmigung besteht somit nicht.
Oder: Der Bauherr hat dann einen Anspruch auf Erteilung der Baugenehmigung, wenn die Voraussetzungen des § 58 Abs. 1 Satz 1 LBO erfüllt sind ...
57
Sie haben sicherlich bemerkt, dass auch bei der Niederschrift die logische (syllogistische) Methode angewandt wird. Sie ist allerdings kein Spezifikum des Gutachtenstils, sie ist auch beim Urteilsstil anzuwenden. Gutachten- und Urteilsstil unterscheiden sich dadurch, dass der Gutachtenstil zum Ergebnis hinführt, während beim Urteilsstil das Ergebnis an den Anfang gestellt und erst dann begründet wird.
Beispiel: Der Widerspruch ist unzulässig. Er ist nicht fristgerecht eingelegt. Gem. § 70 VwGO muss der Widerspruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsaktes eingelegt werden. A hat den Widerspruch jedoch erst 2 Monate nach Bekanntgabe des Verwaltungsaktes eingelegt.
In Stichworten lassen sich die Unterschiede durch die verschiedenen Bindeglieder zwischen den einzelnen Gedankengängen darstellen:
Beispiel:
Gutachtenstil:
Es könnte sein … vorausgesetzt ist … also ist …; es ist dann, wenn … so ist es … also ist …
Urteilsstil:
Es ist so, denn … denn … denn …
Man nennt deshalb den Gutachtenstil auch den „Also-Stil“ und den Urteilsstil den „Denn-Stil“. Urteilsstil und Gutachtenstil unterscheiden sich inhaltlich dadurch, dass der Urteilsstil knapper ist. Während man in einem Gutachten auch Randprobleme darstellen kann, erfordert der Urteilsstil eine straff geführte, klare Begründung eines vorweg genannten Ergebnisses. Das bedeutet, dass man auf Randfragen nicht einzugehen hat und die Darstellung abbrechen muss, sobald das Ergebnis begründet ist.
Beispiel: In einem Widerspruchsbescheid haben Ausführungen zur Begründetheit nichts zu suchen, wenn der Widerspruch unzulässig ist.
58
Auch beim Urteilsstil ist es jedoch zulässig (in der Klausur und vom Bürger sogar erwünscht), dass ein Ergebnis mit möglichst vielen Argumenten abgesichert wird – Mehrfachbegründungen sind also erlaubt.
Sie sollten, wenn Sie ein Gutachten zu schreiben haben, die folgenden häufig vorkommenden typischen Fehler vermeiden.
1. Fehler: Übertriebener Gutachtenstil
59
Ein Gutachten wirkt schwerfällig, wenn der Leser ständig auf die gleichen Formeln stößt: „Es ist dann, wenn …“, „Es ist zu prüfen …“, „Voraussetzung ist …“ und „also ist …“. Eine Arbeit wird nicht schon dadurch den Ansprüchen der Logik und des Gutachtenstiles gerecht, dass diese Worte und Begriffe ständig wiederholt werden. Sie entspricht diesen Ansprüchen in besonderem Maß, wenn sie ohne diese Wörter auskommt und trotzdem die logische Gedankenführung erkennen lässt.
Vor allem die Eingangsformel: „Es ist zu prüfen …“ sollten Sie sparsam verwenden. Bevor Sie sich wegen des Gutachtenstils mit den Grundsätzen auf den Kriegsfuß begeben, die Sie im Deutschunterricht gelernt haben, sollten Sie lieber auf den Urteilsstil ausweichen, der weniger die Gefahr in sich birgt, Formulierungen ständig zu wiederholen. Es ist zwar nicht optimal – aber auch kein schlimmes Vergehen, wenn in einem Gutachten auch teilweise im Urteilsstil formuliert wird. Er muss sogar verwendet werden, wenn Selbstverständlichkeiten dargestellt werden.
Beispiel:
Nicht: Voraussetzung für das Vorliegen eines Verwaltungsaktes könnte sein, dass es sich um eine Regelung handelt. Es ist deshalb zu prüfen, ob die Verwaltungsaktdefinition dieses Merkmal enthält.
Sondern: Ein Verwaltungsakt liegt gem. § 35 LVwVfG nur dann vor, wenn es sich bei der Maßnahme um eine Regelung handelt. Unter Umständen sogar: Bei der Maßnahme handelt es sich um einen Verwaltungsakt (vgl. § 35 Abs. 1 Satz 1 LVwVfG).
2. Fehler: Begründung des Aufbaus
60
Der Aufbau Ihres Gutachtens muss sich aus der zwingenden Folge Ihrer Gedanken ergeben und darf nicht besonders begründet werden.
Beispiel:





























