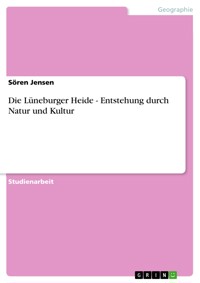17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: ...für Dummies
- Sprache: Deutsch
Sich all die Regeln der verschiedenen Gebiete der Wirtschaftsmathematik zu merken ist schon ein hartes Geschäft und dann soll man sie auch noch richtig anwenden. Ist die Not groß, ist das passende »... für Dummies«-Buch nicht weit. Mit dem »Übungsbuch Wirtschaftsmathematik für Dummies« können Sie sich zielgerichtet auf die nächsten Prüfungen vorbereiten. Mit zahlreichen Übungen zu Algebra, Analysis, Linearer Algebra, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Finanzmathematik gewinnen Sie Sicherheit und können mit Zuversicht den Herausforderungen aus der Welt der Wirtschaftsmathematik entgegensehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Übungsbuch Wirtschaftsmathematik für Dummies
Schummelseite
NIEMALS NULL IM NENNER
, aber ist undefiniert.
SPEZIELLE PRODUKTE
Ausklammern:
binomische Formel:binomische Formel:binomische Formel:QUADRATFORMELN
abc-Formel: Wenn ist, dann gilt: .
pq-Formel: Wenn ist, dann gilt: .
REGELN FÜR POTENZEN
REGELN FÜR WURZELN
LOGARITHMUSREGELN
Äquivalenzen:
Logarithmus von 1:
Logarithmus von a zur Basis a:
Natürlicher Logarithmus:
Logarithmus eines Produkts:
Logarithmus eines Quotienten:
Logarithmus einer Potenz:
Logarithmus eines Kehrwerts:
DIE HANDLICHE ABLEITUNGSTABELLE
Die Summenregel
Die Produktregel
Die Quotientenregel
Die Kettenregel
Übungsbuch Wirtschaftsmathematik für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
2. Auflage 2019
© 2019 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: © Aris Suwanmalee / stock.adobe.comKorrektur: Petra Heubach-Erdmann, KölnExternes Projektmanagement: Harriet Gehring, Köln
Print ISBN: 978-3-527-71620-3ePub ISBN: 978-3-527-82369-7
Über die Autoren
Dr. Sören Jensen, CFA, studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und promovierte am dortigen Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfoliomanagement und Versicherungswirtschaft. Er arbeitet nun im strategischen Kapitalanlagemanagement bei einer großen Versicherung. Nebenbei führt er Seminare in der Privatwirtschaft zu den Themen Risikomanagement sowie Investment Management durch und hält eine Vorlesung zur Einführung in die Betriebswirtschaftslehre an der VWA München. In der übrigen Zeit freut er sich über den Verkaufserfolg des Buches Wirtschaftsmathematik für Dummies. Sein Spaß an der Wirtschaftsmathematik wurde ihm im ersten Semester von einem Super-Dozenten vermittelt:
Prof. Dr. Christoph Mayer studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und promovierte am dortigen Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfoliomanagement und Versicherungswirtschaft. Im Anschluss war er im Konzernrisikomanagement der EnBW Energie Baden-Württemberg AG tätig. Unter anderem führte er dort als Projektleiter die wahrscheinlichkeitsbasierte Modellierung relevanter Finanzkennzahlen ein. Im Jahr 2013 nahm er einen Ruf der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden auf die Professur für Betriebswirtschaftslehre/Investition und Finanzierung an. Seit 2017 ist er zudem Mitglied des Vorstandes der Risk Management Association e. V.
Dr. Olivia Gwinner absolvierte an der Universität Mannheim und der University of the Sunshine Coast in Australien ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre. Im Anschluss promovierte sie am Lehrstuhl für Business-to-Business Marketing, Sales & Pricing der Universität Mannheim. Während ihres Studiums und ihrer Promotion sammelte sie langjährige Lehrerfahrung in den Fächern Finanzmathematik, Quantitative Methoden, Statistik und Marketing. Mittlerweile arbeitet sie bei einem großen Softwareunternehmen.
Marina Friedrich studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und der HEC Paris. Schon während ihres Studiums sammelte sie Lehrerfahrung in den Fächern Finanzmathematik, Quantitative Methoden und Management. Sie promoviert am Center for Doctoral Studies in Business an der Universität Mannheim im Bereich Management. Außerdem forscht und lehrt sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für ABWL, Public & Nonprofit Management.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelseite
Impressum
Über die Autoren
Einführung
Über dieses Buch
Konventionen in diesem Buch
Törichte Annahmen über den Leser
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie es weitergeht
Teil I: Einfache Algebra
Kapitel 1 Das kleine Einmaleins der Wirtschaftsmathematik: Einfache Algebra
Mit Vorzeichen rechnen
Wichtige Rechengesetze
Mit Brüchen rechnen
Prozent und Promille
Potenzrechnung
Back to the roots: Mit Wurzeln rechnen
Lassen Sie sich von Logarithmen nicht aus dem Rhythmus bringen
Mehrere Terme ausmultiplizieren
Lösungen
Kapitel 2: Gleichungen lösen
Lineare Gleichungen
Quadratische Gleichungen
Bruchgleichungen?! Immer schön rational bleiben
Wurzelgleichungen lösen
Exponentialgleichungen lösen
Lösungen
Teil II: Analysis
Kapitel 3: Folgen und Reihen
Grundlagen der Folgen
Arithmetische und geometrische Folgen
Immer der Reihe nach ...
Lösungen
Kapitel 4: Die Funktion der Funktionen
Die Grundlagen der Funktionen
Lösungen
Kapitel 5: Eigenschaften von Funktionen
Schnittpunkte mit den Achsen
Grenzwerte
Stetige Funktionen
Lösungen
Kapitel 6: Testen Sie Ihr Fahrverhalten: Kurvendiskussion
Ableitungen bestimmen
Die Höhen und Tiefen des Lebens: Extrema finden
Aufgabenstellung aus der Wirtschaft
Lösungen
Kapitel 7: Mehrdimensionale Funktionen
Lassen Sie sich kein x für ein u vormachen – partielle Ableitungen bilden
Für alle, die höher hinaus wollen – Ableitungen höherer Ordnung
Minima und Maxima bestimmen
Lösungen
Kapitel 8: Und jetzt andersherum – Integralrechnung
Stammfunktionen – die Rückwärts-Differentiation
Flächen unter Funktionskurven bestimmen
Lösungen
Teil III: Matrizen und Gleichungssysteme
Kapitel 9: Mehr Mathe mit mächtigen Matrizen
Verschiedene Matrizentypen
Addieren und Subtrahieren
Multiplizieren mit einem Skalar
Multiplizieren von Matrizen
Innerbetriebliche Materialverflechtung
Lösungen
Kapitel 10: Lineare Gleichungssysteme lösen
Zuerst auf die grafische Art und Weise
Dann durch Addition
Oder doch lieber durch Einsetzen?
Mehr als nur zwei Gleichungen
Betriebswirtschaftliche Anwendungen
Lösungen
Kapitel 11: Noch mehr Möglichkeiten mit Matrizen
Determinanten von Matrizen
Dichter schreiben in Versen – Sie ermitteln Inversen
Das Leontief-Modell
Lösungen
Teil IV: Wahrscheinlichkeitsrechnung
Kapitel 12: Warm-up für die Wahrscheinlichkeitsrechnung – die wichtigsten Grundlagen
Mengennotationen verstehen und formulieren
Die verschiedenen Arten der Wahrscheinlichkeit und Regeln zur Berechnung
Unabhängige Ereignisse
Ausschließlichkeit von Ereignissen
Lösungen
Kapitel 13: Wahrscheinlichkeitsdiagramme – ein Bild sagt mehr als tausend Worte
Venn-Diagramme interpretieren und zeichnen
Baum-Diagramme interpretieren und zeichnen
Das Gesetz der totalen Wahrscheinlichkeit
Das Bayes-Theorem
Lösungen
Kapitel 14: Immer schön die Diskretion wahren – der richtige Umgang mit diskreten Verteilungen
Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen
Ermittlung und Anwendung kumulativer Verteilungsfunktionen
Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung diskreter Zufallsvariablen bestimmen
Lösungen
Kapitel 15: »Also normal ist das nicht!« – die Normalverteilung verstehen und anwenden
Der Umgang mit Normalverteilungen
Rückwärtsrechnung
Lösungen
Kapitel 16: Besondere diskrete und stetige Verteilungen
Diskrete Verteilungen
Stetige Verteilungen
Lösungen
Kapitel 17: Groß denken, aber Grenzen kennen – das Gesetz der großen Zahlen und der zentrale Grenzwertsatz
Der zentrale Grenzwertsatz
Das Gesetz der großen Zahlen
Lösungen
Teil V: Finanzmathematik
Kapitel 18: Von Zinsen und Zinseszinsen
Verschiedene Verzinsungen
Lösungen
Kapitel 19: Eines ist sicher: Die Rentenrechnung
Jährliche gleich hohe Zahlungen
Unterjährige Rente
Kapitalverzehr
Wachsende oder fallende Renten
Ewige Renten
Lösungen
Kapitel 20: Tilgen, tilgen, tilgen!
Grundlegendes
Ratentilgung
Annuitätentilgung
Laufzeit des Darlehens
Lösungen
Kapitel 21: Das Anleihen-Einmaleins
Mit Anleihen Geld an andere leihen
Immer schön fair bleiben – gerade beim Kurs einer Anleihe
Renditen ermitteln
Lösungen
Kapitel 22: To invest or not to invest – das ist hier die Frage
Zahlungsströme aufstellen und verstehen
Die Kapitalwertmethode verstehen und anwenden
Interne Zinssätze berechnen
Amortisationsdauern bestimmen
Lösungen
Teil VI: Top-Ten-Teil
Kapitel 23: Zehn Excel-Funktionen, die Ihnen das Leben erleichtern
Pivot-Tabelle
Daten filtern
Weiße Hintergrundfarbe
Bedingte Formatierung
Umbruchvorschau
Der S-Verweis
Absoluter Verweis
Doppelklick zum Kopieren von Formeln
Spur zum Nachfolger
Makro aufzeichnen
Kapitel 24: Zehn Orte zum mehr oder weniger effektiven Mathelernen
In den eigenen vier Wänden
Im Café
Im Garten
In der Bibliothek
Am Strand
Am Küchentisch
Im Keller
In der U-Bahn
Am Schreibtisch
Im Baumhaus
A: Tabelle für die Normalverteilung
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 8
Tabelle 8.1: Formeln zur Bestimmung von Stammfunktionen
Kapitel 10
Tabelle 10.1: Text in Tabellen – so ist es übersichtlicher
Tabelle 10.2: Anfallende Primärkosten je Kostenstelle
Kapitel 14
Tabelle 14.1: Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion von X
Tabelle 14.2: Kumulative Verteilungsfunktion von X
Tabelle 14.3: Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion zur Zufallsvariablen X
Tabelle 14.4: Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion der Zufallsvariablen Z
Tabelle 14.5: Kumulative Verteilungsfunktion der Zufallsvariablen Z
Tabelle 14.6: Intervalle und ihre Komplemente
Tabelle 14.7: Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion von X
Tabelle 14.8: Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion zur Zufallsvariablen Z
Tabelle 14.9: Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion zur Zufallsvariablen X
Tabelle 14.10: Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion zur Zufallsvariablen Z
Kapitel 17
Tabelle 17.1: Vorhergesagte und tatsächliche Häufigkeiten
Tabelle 17.2: Vorhergesagte und tatsächliche Häufigkeiten der getroffenen Freiwürfe
Kapitel 18
Tabelle 18.1: Kontostaffel bei linearer Verzinsung
Tabelle 18.2: Kontostaffel bei exponentieller Verzinsung
Tabelle 18.3: Kontostaffel bei unterjähriger Verzinsung und halbjährlicher Zinsgutschrift
Tabelle 18.4: Effektivzinssätze für die verschiedenen Zinsmodelle bei
,
und
Kapitel 20
Tabelle 20.1: Tilgungsplan bei Ratentilgung
Tabelle 20.2: Tilgungsplan bei Annuitätentilgung
Tabelle 20.3: Tilgungsplan bei Ratentilgung
Tabelle 20.4: Tilgungsplan bei Annuitätentilgung
Kapitel 22
Tabelle 22.1: Zahlungsstrom der Erdbeereisproduktion
Tabelle 22.2: Zahlungsstrom verschiedener Investitionsalternativen
Tabelle 22.3: Zahlungsstrom der neuen Druckmaschine
Tabelle 22.4: Zahlungsstrom Ihrer Investition in einen Waffelstand
Tabelle 22.5: Zahlungsstrom der Textmarkerproduktion in Tabellenansicht
Tabelle 22.6: Tabellarische Übersicht der Kapitalanlage im Sparstrumpf
Tabelle 22.7: Zahlungsstrom beim zweimaligen Kuchenbacken
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Täglich verkaufte Eismenge im Jahresverlauf
Abbildung 4.2: Kosten in Abhängigkeit der telefonierten Minuten
Kapitel 5
Abbildung 5.1:
Der Graph der Funktion
Kapitel 8
Abbildung 8.1: Graph von
Abbildung 8.2: Graph von
Abbildung 8.3: Entrepreneurheims neues Gewerbegebiet
Abbildung 8.4: Graph von
Abbildung 8.5: Graph von
Kapitel 9
Abbildung 9.1: Die Verflechtung von Rohstoffen zu Endprodukten als Pfeildiagramm
Kapitel 10
Abbildung 10.1: Der Punkt, in dem sich die Geraden treffen, ist die Lösung des Gleichungssystems.
Abbildung 10.2: Die Leistungsverflechtungen als Pfeildiagramm
Abbildung 10.3: Grafische Lösung eines Gleichungssystems
Abbildung 10.4: Grafische Lösung eines Gleichungssystems mit drei Gleichungen
Kapitel 13
Abbildung 13.1: Beispiel für ein Venn-Diagramm mit Schnittmenge
Abbildung 13.2: Venn-Diagramm zu Aufgabe 13.2
Abbildung 13.3: Venn-Diagramm zu Aufgabe 13.3
Abbildung 13.4: Baumdiagramm für einen zweistufigen Prozess (Münzwurf)
Abbildung 13.5: Zweistufiges Baumdiagramm
Abbildung 13.6: Baumdiagramm zu Aufgabe 13.6
Abbildung 13.7: Schritt 1 des Venn-Diagramms zu Aufgabe 13.1
Abbildung 13.8: Schritt 2 des Venn-Diagramms zu Aufgabe 13.1
Abbildung 13.9: Schritt 3 des Venn-Diagramms zu Aufgabe 13.1
Abbildung 13.10: Schritt 4 des Venn-Diagramms zu Aufgabe 13.1
Abbildung 13.11: Venn-Diagramme zu Aufgabe 13.2
Abbildung 13.12: Baumdiagramm zu Aufgabe 13.4
Abbildung 13.13: Baumdiagramm zu Aufgabe 13.5
Abbildung 13.14: Baumdiagramm zu Aufgabe 13.8
Abbildung 13.15: Baumdiagramm zu Abbildung 13.9
Kapitel 14
Abbildung 14.1: Histogramm der Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion von X
Abbildung 14.2: Form einer kumulativen Verteilungsfunktion
Abbildung 14.3: Kumulative Verteilungsfunktion zu Aufgabe 14.4
Abbildung 14.4: Baum zu Aufgabe 14.1
Abbildung 14.5: Histogramm der Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion von X
Abbildung 14.6: Kumulative Verteilungsfunktion zu Aufgabe 14.2
Kapitel 15
Abbildung 15.1: Normalverteilung zu Aufgabe 15.1
Abbildung 15.2: Normalverteilung mit
und
Abbildung 15.3: Form der Funktion aus Aufgabe 15.2
Abbildung 15.4: Form der Funktion aus Aufgabe 15.3
Abbildung 15.5: Form der Funktion aus Aufgabe 15.4
Kapitel 16
Abbildung 16.1: Kumulative Verteilungsfunktion
Kapitel 21
Abbildung 21.1: Eine vierjährige Anleihe
Abbildung 21.2: Eine sechsjährige Anleihe
Abbildung 21.3: Fairer Wert einer Anleihe mit einem Nominalzinssatz von 6 % p.a. sowie einem Rückzahlungskurs und Nennwert von 100 Euro
Abbildung 21.4: Zahlungsstrom einer fünfjährigen Anleihe
Abbildung 21.5: Zahlungsstrom einer sechsjährigen Anleihe
Abbildung 21.6: Zahlungsstrom einer am Markt notierten Anleihe
Abbildung 21.7: Grafische Veranschaulichung des Zahlungsstroms einer Anleihe
Kapitel 22
Abbildung 22.1: Grafische Veranschaulichung des Zahlungsstroms der Erdbeereisproduktion
Guide
Cover
Inhaltsverzeichnis
Begin Reading
Pages
C1
1
2
3
4
7
8
9
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
395
396
397
398
E1
Einführung
Stellen Sie sich vor, Sie gehen in eine Wirtschaft. Sie bestellen ein kühles, erfrischendes Getränk und eine deftige Mahlzeit zur Stärkung. Im Laufe des Abends trinken Sie vielleicht noch das ein oder andere leckere Getränk Ihrer Wahl. Bevor Sie sich dann zu später Stunde auf den Heimweg machen, müssen Sie natürlich noch Ihre Rechnung begleichen. Da Sie dem etwas zwielichtigen Wirt – warum haben Sie sich eigentlich ausgerechnet so eine Spelunke ausgesucht? – nicht über den Weg trauen, rechnen Sie vorab lieber mal aus, wie viel Sie ihm eigentlich schulden und wie viel Rückgeld Sie erwarten dürfen. Und was brauchen Sie, um diese Berechnungen durchzuführen? Wirtschaftsmathematik!
Wirtschaftsmathematische Fragestellungen begegnen Ihnen natürlich nicht nur in der Kneipe, sondern an ganz vielen Stellen im Berufsleben und auch im Alltag. Vielleicht haben Sie auch schon ein Buch darüber gelesen oder sich in der Schule oder Uni mit Wirtschaftsmathematik befasst. Wenn Ihnen das bisher zu theoretisch war und Sie auf der Suche nach anschaulichen Übungsaufgaben sind, halten Sie genau das richtige Buch in den Händen. Dieses Übungsbuch steckt voller Aufgaben aus allen Bereichen der Wirtschaftsmathematik, die darauf warten, von Ihnen gelöst zu werden – und natürlich voller Lösungen.
Über dieses Buch
Das Übungsbuch Wirtschaftsmathematik für Dummies richtet sich an Schülerinnen und Schüler an Wirtschaftsschulen, an Studierende der Wirtschaftswissenschaften im Haupt- oder Nebenfach in den ersten Semestern und natürlich an all diejenigen, die sich anhand von kurzweiligen Übungsaufgaben in das Thema einarbeiten möchten.
Für Schülerinnen und Schüler an Wirtschaftsschulen bietet dieses Buch zahlreiche Übungsaufgaben aus den Bereichen der Wirtschaftsmathematik. Mit der zusätzlichen Vertiefung in linearer Algebra, Analysis und Finanzmathematik ist es aber auch für Schülerinnen und Schüler anderer Schulformen bestens geeignet.
Wenn Sie gerade mit dem Studium der Wirtschaftswissenschaften begonnen haben und Ihnen die mathematischen Vorlesungen zu theoretisch sind, sollten Sie dieses Buch durcharbeiten. Es wiederholt die wichtigsten Inhalte der Wirtschaftsmathematik und bietet anhand von anschaulichen Aufgaben unzählige Möglichkeiten zur Anwendung Ihres theoretischen Wissens.
Auch wenn Sie einen nicht wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang absolvieren, benötigen Sie oftmals eine betriebswirtschaftliche Grundbildung. Mit diesem Buch finden Sie die richtige Herangehensweise an Fragestellungen und lösen diese zielgerichtet.
Auch wenn Ihre Schulzeit schon ein paar Tage zurückliegt, können Sie mit diesem Buch rechnen. Wirtschaftsmathematik begegnet Ihnen schließlich nicht nur in der Schule oder im Studium, sondern lauert hinter jeder Ecke, sowohl im Alltag als auch im Berufsleben. Da kann ein bisschen Übung sicherlich nicht schaden.
Bei diesem Übungsbuch handelt es sich um ein benutzerfreundliches Mathematikbuch. Wo immer es möglich ist, wurde auf Fachchinesisch verzichtet. Kurze Wiederholungen zu Beginn der Kapitel rufen Ihnen noch einmal die wichtigsten Dinge in Erinnerung, sodass Sie ohne Zusatzmaterialien gleich voll durchstarten und üben, üben, üben können. Bis Sie ein wahrer Meister der Wirtschaftsmathematik sind!
Konventionen in diesem Buch
Die folgenden Konventionen sollen Ihnen helfen, sich in diesem Buch schnell zurechtzufinden.
Wichtige Begriffe werden bei ihrem ersten Auftreten in diesem Buch
kursiv
gekennzeichnet und erklärt.
Die Kapitel widmen sich nach kurzen Wiederholungen der wichtigsten Grundlagen anwendungsbezogenen Übungsaufgaben.
Am Ende jedes Kapitels finden Sie die Lösungen zu den Übungsaufgaben.
Zwischendurch finden Sie hilfreiche Tipps, mit denen Sie in Zukunft alle Fragestellungen problemlos beantworten können.
Törichte Annahmen über den Leser
Als Leser dieses Buches sollten Sie …
… schon einmal etwas vom Begriff Mathematik gehört haben.
… nicht ganz ohne mathematische Vorkenntnisse mit den Übungsaufgaben starten, auch wenn dieses Buch zu Beginn jedes Kapitels nochmals die wichtigsten Grundlagen wiederholt. Wenn Ihre letzte Begegnung mit der Mathematik etwas länger her ist, schauen Sie, bevor Sie mit dem Rechnen beginnen, vielleicht besser noch mal in das Hauptbuch
Wirtschaftsmathematik für Dummies
.
… bereit sein, ein wenig Zeit und Mühe aufzubringen. Obwohl wir natürlich versucht haben, den Stoff so intuitiv und simpel wie möglich darzustellen, gilt auch hier: ohne Fleiß kein Preis. Ganz ohne etwas Zeit und Mühe in die Lösung der Aufgaben zu stecken, werden Sie in Sachen Wirtschaftsmathematik nicht weiterkommen.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Dieses Übungsbuch orientiert sich an der Struktur des Hauptbuchs Wirtschaftsmathematik für Dummies. Es besteht aus den fünf Teilen Algebra, Analysis, lineare Algebra, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Finanzmathematik. Diese Teile sind wiederum in mehrere Kapitel gegliedert, in denen Übungsaufgaben mit Lösungen vorgestellt werden.
Teil I: Einfache Algebra
Die wichtigsten Grundlagen finden Sie in Teil I – von der einfachen Algebra bis hin zum Lösen von Gleichungen. Die Aufgaben in diesem Teil eignen sich wunderbar zum Warmwerden. Wenn danach das grundlegende Handwerkszeug wieder sitzt, kann in den folgenden Teilen nichts mehr schiefgehen!
Teil II: Analysis
Teil II richtet sich an den Analytiker in Ihnen – Sie werden sich hier ausschließlich mit Analysis befassen. Nachdem Sie Folgen und Reihen wiederholt haben, können Sie sich voll und ganz den Funktionen widmen. Denn diese sind nicht nur in der Schule oder Uni wichtig, sondern auch für viele wirtschaftliche Fragestellungen äußerst hilfreich. Anhand verschiedenster Aufgaben lernen Sie zunächst alle wichtigen Eigenschaften von Funktionen kennen. Dann sind Sie fit für Kurvendiskussionen: Schnittpunkte berechnen, Extrema bestimmen und Funktionen zeichnen wird nach diesem Teil ein Leichtes für Sie sein. Zum Abschluss werden Sie sich sogar mit mehrdimensionalen Funktionen beschäftigen und durch die Integralrechnung auch verstehen, wieso es der e-Funktion auf Partys schwerfällt, sich zu integrieren.
Teil III: Matrizen und Gleichungssysteme
Wenn Sie systematische Lösungen mögen, sind Sie in diesem Teil genau richtig. Denn hier dürfen Sie mit Matrizen rechnen. Komplizierte Gleichungssysteme werden mit der Matrixrechnung gleich viel überschaubarer. Mit ihr bringen Sie Ordnung in Ihre Zahlenwelt. Dies ist auch für viele ökonomische Probleme äußert hilfreich: Sie wollen beispielsweise wissen, wie viele Rohstoffe Sie für die Produktion Ihres Endprodukts benötigen? Oder welche Preise Sie setzen sollten? All diese Fragen zu beantworten, wird nach Teil III ein Kinderspiel für Sie sein.
Teil IV: Wahrscheinlichkeitsrechnung
Sie möchten wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie nach Teil III bereits aufgegeben haben? Dazu sollten Sie unbedingt mit Teil IV weitermachen, denn hier üben Sie alle wichtigen Aspekte der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Sie wiederholen zunächst grundlegende Notationen, um dann Erwartungswerte, Varianzen und Standardabweichungen berechnen zu können. Außerdem lernen Sie verschiedene Arten von Wahrscheinlichkeitsverteilungen kennen, mit deren Hilfe Sie Entscheidungen treffen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Fehlentscheidung wäre, nach Teil III aufzugeben? Wohl sehr hoch!
Teil V: Finanzmathematik
Welches Thema darf in einem Wirtschaftsmathematik-Buch nicht fehlen? Das liebe Geld natürlich. Teil V widmet sich diesem voll und ganz. Sie möchten die Höhe Ihrer Rente berechnen? Oder endlich wissen, wie genau die Zinsen auf Ihrem Konto eigentlich zustande kommen? Oder auch wenn Sie groß denken und gerne wissen möchten, ob Ihre geplante Millionen-Investition vorteilhaft ist, sind Sie in diesem Teil gut aufgehoben. Nachdem Sie die Übungsaufgaben gemeistert haben, werden Sie all diese Fragen mit Leichtigkeit beantworten können.
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Zum Abschluss, wie in jedem …für Dummies-Buch: die Top-Ten-Listen. Diesmal mit zehn hilfreichen Excel-Funktionen und zehn Orten, die sich besonders gut zum Mathelernen eignen.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Im Buch werden Sie öfter über einige Symbole stolpern. Diese sollen Sie auf Besonderheiten und wichtige Informationen aufmerksam machen.
Neben diesem Symbol finden Sie Definitionen oder andere Informationen, die Sie sich merken sollten.
Die Glühbirne weist Sie auf wichtige Tipps und Tricks hin, die Ihnen das Leben leichter machen und Sie schneller zur Lösung der Aufgaben führen.
Achtung! Dieses Symbol soll Sie auf häufig gemachte Fehler hinweisen, die Sie unbedingt vermeiden sollten.
Wie es weitergeht
Zuerst einmal sollten Sie Ihr Getränk austrinken, die Rechnung begleichen, sich dabei nicht vom zwielichtigen Wirt übers Ohr hauen lassen und dann nach Hause gehen – oder an einen anderen tollen Ort zum Mathelernen. Anregungen dafür finden Sie übrigens im letzten Kapitel dieses Buchs. Und dann geht's endlich los mit den Grundlagen in Kapitel 1. Falls Sie keine Auffrischung Ihres Grundwissens benötigen, können Sie aber auch an einer anderen Stelle einsteigen. Wenn Sie dann in ein paar Wochen nach dem Lösen ganz vieler Aufgaben wieder in der Wirtschaft sitzen und ein zwangloses Gespräch beginnen möchten, haben Sie ein Thema mehr zum Einstieg:
Das Wetter
Der Tatort vom letzten Sonntag
Staudensellerie
Politik
Fußball
Die Gesellschaft im Allgemeinen
Hydrokulturen im Speziellen
Wirtschaftsmathematik
Teil I
Einfache Algebra
IN DIESEM TEIL …
Mit der Mathematik ist es wie mit dem Kochen: Wie wollen Sie ein kompliziertes Drei-Gänge-Menü kochen, wenn Sie nicht wissen, wie man ein Ei aufschlägt oder das Messer richtig hält? Genau: gar nicht! Und wie wollen Sie Tilgungsraten bestimmen, mit Matrizen hantieren oder Ihre Gewinnchancen beim Lotto ausrechnen (übrigens eine sehr ernüchternde Rechnung), wenn Sie die Grundlagen der Mathematik nicht kennen? Wieder richtig geraten: gar nicht! Aber Sie haben Glück – genau diese notwendigen Grundlagen finden Sie in Teil I dieses Buches. Los geht es mit einfacher Algebra, bevor Sie sich dem Lösen von Gleichungen widmen. Hier können Sie Ihr Basiswissen auffrischen, wenn Sie schon länger nichts mehr mit Mathematik am Hut hatten und schon seit einigen Jahren aus der Schulbank herausgewachsen sind. Nach dem Lösen der Aufgaben sollte das Jonglieren mit Brüchen, Potenzen und Wurzeln ein Kinderspiel für Sie sein. Worauf warten Sie noch?! Satteln Sie die Pferde, schärfen Sie die Messer, spitzen Sie die Bleistifte und werden Sie Wirtschaftsmathematik-Profi!
Kapitel 1
Das kleine Einmaleins der Wirtschaftsmathematik: Einfache Algebra
IN DIESEM KAPITEL
Mit Vorzeichen und Klammern rechnen
Wichtige Rechengesetze kennenlernen und anwenden
Sich mit Brüchen und Prozenten anfreunden
Potenzen, Wurzeln und Logarithmen berechnen
Mehrere Terme ausmultiplizieren
Dieses Kapitel behandelt die Grundlagen der Algebra und legt damit das Fundament für die folgenden Kapitel. Vieles, was hier behandelt wird, haben Sie sicherlich schon einmal angewendet – im Alltag, im Job, im Studium oder im Mathematikunterricht. Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihr Wissen aufzufrischen und die Grundlagen zu wiederholen.
Mit Vorzeichen rechnen
Haben Sie sich schon mal gefragt, warum eins plus eins zwei ergibt? Und wie werden eigentlich negative Zahlen addiert? Die Addition von zwei Zahlen wird mit dem Pluszeichen »+« gekennzeichnet:
Dabei nennt man und Summanden. Addiert man sie, das heißt, rechnet sie zusammen, erhält man die Summe. Natürlich können auch mehr als zwei Zahlen addiert werden.
DieSubtraktion, auch bekannt als Minus-Rechnung, ist die Umkehroperation der Addition. Was bedeutet das? Betrachten Sie beispielsweise die Zahl 5. Wenn Sie 3 zu 5 addieren, ist das Ergebnis 8. Die Addition können Sie umkehren, indem Sie 3 wieder von 8 abziehen. Das Ergebnis ist 5 – die ursprüngliche Zahl. Die Subtraktion wird mit dem Minuszeichen »–« aufgeschrieben.
Man nennt Minuend und Subtrahend. ist das Ergebnis der Subtraktion und wird als Differenz zwischen und bezeichnet. Die Subtraktion kann auch als Addition der Gegenzahl verstanden werden. Statt von abzuziehen, können Sie also auch zu addieren:
Bei der Multiplikation und der Division multiplizieren oder dividieren Sie zunächst die Beträge der Zahlen. Der Betrag einer Zahl ist die Zahl ohne ihr Vorzeichen. Über das Vorzeichen des Ergebnisses entscheiden die Vorzeichen der Zahlen, die Sie miteinander multiplizieren beziehungsweise durcheinander dividieren.
Bei der Multiplikation oder Division von zwei Zahlen ist das Ergebnis positiv, falls beide Zahlen das gleiche Vorzeichen haben. Haben die beiden Zahlen unterschiedliche Vorzeichen, dann ist das Ergebnis negativ.
Aufgabe 1.1
Führen Sie die folgenden Berechnungen durch.
Wichtige Rechengesetze
Es gibt einige wichtige Rechengesetze, die Ihnen das Leben leichter machen. Das Kommutativgesetz besagt, dass es egal ist, in welcher Reihenfolge Zahlen addiert oder miteinander multipliziert werden. Das Ergebnis ist immer das gleiche.
Kommutativgesetz der Addition:
Kommutativgesetz der Multiplikation:
DasAssoziativgesetz sagt aus, dass Sie die Gruppierungen von Operationen verändern können, ohne dass sich dadurch das Ergebnis ändert. Oder einfacher ausgedrückt: Sie können Klammern setzen, wie Sie möchten.
Assoziativgesetz der Addition:
Assoziativgesetz der Multiplikation:
Das Kommutativgesetz und das Assoziativgesetz gelten für die Addition und die Multiplikation, aber NICHT für die Subtraktion und die Division.
Ein weiteres wichtiges Rechengesetz, das die Multiplikation mit der Addition beziehungsweise Subtraktion verbindet, ist das Distributivgesetz.
Distributive Multiplikation über die Addition:
Distributive Multiplikation über die Subtraktion:
Wie Sie sehen, können Sie nach dem Distributivgesetz jeden Term innerhalb einer Klammer mit dem Koeffizienten außerhalb der Klammer multiplizieren, ohne dass sich das Ergebnis ändert. Umgekehrt funktioniert es natürlich auch, dann spricht man vom Ausklammern.
Aufgabe 1.2
Vereinfachen Sie die folgenden Ausdrücke so weit wie möglich.
Aufgabe 1.3
Klammern Sie aus.
Mit Brüchen rechnen
In diesem Abschnitt lernen Sie, wie Sie mit Brüchen rechnen können. Ein Bruch besteht aus einem Zähler, einem Bruchstrich und einem Nenner. Der Zähler steht über dem Bruchstrich, der Nenner darunter. Der Zähler wird durch den Nenner geteilt, also zum Beispiel:
Der Nenner eines Bruchs darf nie null sein!
Vertauscht man den Zähler und den Nenner eines Bruchs, so erhält man seinen Kehrwert. Der Kehrwert von ist also . Multipliziert man eine Zahl – außer null – mit ihrem Kehrwert, so ist das Ergebnis immer 1.
Die Multiplikation von Brüchen ist ganz einfach:
Wenn Sie einen Bruch durch einen anderen Bruch teilen möchten, tun Sie dies, indem Sie den ersten Bruch unverändert lassen und ihn mit dem Kehrwert – also der Umkehrung – des zweiten Bruchs multiplizieren:
Die Addition und Subtraktion von Brüchen sind etwas komplizierter.
Sie können Brüche nur addieren oder subtrahieren, wenn sie den gleichen Nenner haben.
Wenn zwei Brüche den gleichen Nenner haben, werden sie addiert, indem Sie die beiden Zähler addieren und den gemeinsamen Nenner beibehalten:
Wenn Sie hingegen zwei Brüche zusammenrechnen möchten, die unterschiedliche Nenner haben, so müssen Sie die beiden Brüche zunächst erweitern, sodass sie einen gemeinsamen Nenner haben. Dazu multiplizieren Sie den Zähler und den Nenner des Bruchs mit der gleichen Zahl. Der Wert des Bruchs verändert sich dadurch nicht. Nach der Erweiterung können Sie die Zähler addieren und den gemeinsamen Nenner beibehalten. Formal dargestellt sieht das so aus:
Aufgabe 1.4
Führen Sie die folgenden Berechnungen durch.
Prozent und Promille
Ein Prozent ist ein Hundertstel. Sie können also als ausdrücken.
Sie können jede Prozentzahl auch als Dezimalzahl ausdrücken, indem Sie den Bruch ausrechnen.
Um mit Prozenten zu rechnen, sollten Sie die folgenden Formeln kennen. Hier sind die Formeln für Steuern und Rabatte aufgeschrieben, aber natürlich können Sie sie auch für alle anderen Anwendungsbereiche verwenden.
Preis ohne Steuern = Preis mit Steuern / (1 + Steuersatz in %)
Ermäßigter Preis = ursprünglicher Preis
(1 – Rabatt in %)
Ursprünglicher Preis = ermäßigter Preis / (1 – Rabatt in %)
Der Begriff Promille ist Ihnen vielleicht weniger geläufig. Das Promillezeichen ist ‰. 1 % entspricht 10 ‰. Promillewerte kann man auch als Brüche darstellen. Hier steht im Nenner die Zahl 1.000.
Aufgabe 1.5
Wie viel Prozent sind 72,9 ‰?
Wie viel Promille sind 0,263 %?
Ein Verkäufer bietet Ihnen zwei mögliche Rabatte an: einen Rabatt in Höhe von 15 % oder einen Rabatt in Höhe von 143 ‰. Für welchen sollten Sie sich entscheiden?
Aufgabe 1.6
Sie möchten in Urlaub fahren und haben sich bereits für eine Kreuzfahrt entschieden. Nachdem Sie alle Angebote verglichen haben, nehmen Sie drei Anbieter in die engere Wahl. Die gebotenen Leistungen sind bei den drei Angeboten identisch. Das erste Angebot haben Sie online entdeckt. Es liegt bei 799 Euro. Wenn Sie heute noch buchen, bekommen Sie außerdem einen Preisnachlass von 20 Euro. Das zweite Angebot stammt von einem Reisebüro und beträgt 870 Euro. Das Reisebüro feiert diese Woche seinen elften Geburtstag. Daher gibt es gerade 11,11 % Rabatt auf alle Reisen. Schließlich haben Sie noch ein weiteres Angebot online entdeckt. Der Grundpreis der Reise ist mit 999 Euro wesentlich höher als bei den anderen beiden Angeboten. Dennoch schauen Sie sich das Angebot genauer an und stellen fest, dass es gleich zwei Rabatte gibt. Zunächst erhalten Sie 10 % Rabatt, danach auf den reduzierten Preis weitere sensationelle 13 %. Bei welchem der drei Anbieter sollten Sie Ihre Kreuzfahrt buchen?
Aufgabe 1.7
Sie verlassen den Elektromarkt mit einem neuen Laptop. Der Laptop hat 722 Euro gekostet. Wie viel hätte er ohne Mehrwertsteuer gekostet? Auf dem Heimweg kaufen Sie sich noch eine Bratwurst für 2,50 Euro. Wie viel hätte sie ohne Mehrwertsteuer gekostet? Der Mehrwertsteuersatz für den Laptop beträgt 19 %, für die Bratwurst gilt der ermäßigte Steuersatz von 7 %.
Da es sich bei dem Laptop nicht um das allerneueste Modell handelt, haben Sie 5 % Rabatt bekommen. Wie viel hätte er ohne den Rabatt gekostet?
Björn kauft einen Milchaufschäumer. Dieser kostet ursprünglich 75 Euro. Da der Verkäufer heute gut gelaunt ist, schenkt er Björn die Mehrwertsteuer. Der Mehrwertsteuersatz liegt bei 19 %. Wie viel Rabatt hat Björn bekommen (in Prozent und in Euro)?
Potenzrechnung
In der Analysis und anderen Teilgebieten der Mathematik werden Ihnen immer wieder Potenzen begegnen. Beim Rechnen mit Potenzen gibt es einige Regeln zu beachten, die hier kurz für Sie zusammengefasst sind:
»Hoch 2« bedeutet, dass eine Zahl mit sich selbst multipliziert wird. Die Hochzahl, in diesem Fall 2, nennt man Exponent.
»Hoch 3« bedeutet, dass eine Zahl dreimal mit sich selbst multipliziert wird.
Das gilt für alle außer für . ist nicht definiert.
Ein negativer Exponent bedeutet NICHT, dass das Ergebnis negativ ist.
Es gilt NICHT: . Wie Sie den Ausdruck berechnen, erfahren Sie im Abschnitt Mehrere Terme ausmultiplizieren am Ende dieses Kapitels.
Aufgabe 1.8
Berechnen Sie beziehungsweise vereinfachen Sie so weit wie möglich.
Back to the roots: Mit Wurzeln rechnen
Das Wurzelziehen kann als eine Umkehrung des Potenzierens betrachtet werden. Schauen Sie sich einmal den folgenden Ausdruck an:
Wie würden Sie hier vorgehen, um zu bestimmen? Sie würden die »a-te« Wurzel ziehen. Damit berechnen Sie die Zahl, die mit potenziert ergibt: .
Wenn über der Wurzel keine Zahl steht, also , dann ist damit die zweite Wurzel gemeint, das heißt . Die zweite Wurzel bezeichnet man auch als Quadratwurzel.
Jede Wurzel lässt sich als Potenz aufschreiben. Dabei ist der Exponent, also die Hochzahl, ein Bruch. So lässt sich als schreiben, als und allgemein als . Da sich jede Wurzel als Potenz schreiben lässt, gelten für das Rechnen mit Wurzeln ebenfalls die Regeln, die Sie im vorigen Abschnitt für das Rechnen mit Potenzen kennengelernt haben.
Unter einer Quadratwurzel oder einer anderen geradzahligen Wurzel kann keine negative Zahl stehen – zumindest nicht in der grundlegenden Algebra.
Für geradzahlige Wurzeln gilt:
und so weiter
Bei geradzahligen Wurzeln müssen Sie immer Betragsstriche setzen. Das Ergebnis ist nämlich stets positiv, egal ob positiv oder negativ ist. Bei ungeradzahligen Wurzeln werden hingegen keine Betragsstriche gesetzt, also:
und so weiter
Aufgabe 1.9
Berechnen Sie beziehungsweise vereinfachen Sie so weit wie möglich.
Lassen Sie sich von Logarithmen nicht aus dem Rhythmus bringen
Logarithmus – puh, das klingt ganz schön kompliziert. Ist es aber eigentlich gar nicht! Erinnern Sie sich an den Ausdruck, den Sie sich zu Beginn des letzten Abschnitts angeschaut haben, um den Wurzelbegriff zu verstehen:
Wenn Sie bestimmen wollen, ziehen Sie die a-te Wurzel. Aber was tun Sie, wenn und gegeben sind und Sie bestimmen wollen? Dann hilft Ihnen der Logarithmus weiter. Sie müssen den Logarithmus von zur Basis bestimmen. Das schreibt man dann so auf: . Das erscheint auf den ersten Blick kompliziert? Schauen Sie sich das folgende Beispiel an, danach wird Ihnen der Logarithmus bestimmt klarer.
Gesucht wird hier eine Zahl, mit der man 2 potenzieren muss, um 16 zu erhalten. Anders ausgedrückt: 2 hoch welche Zahl ergibt 16? Die Antwort ist:
Die Lösung muss 4 sein, denn ergibt 16.
Die Basis eines Logarithmus kann irgendeine positive Zahl sein. Wenn die Basis 10 ist, wird die Schreibweise verwendet. In diesem Fall wird die Basis nicht spezifiziert. Zum Beispiel ist , denn . Wenn die Basis die eulersche Zahl ist, schreibt man und spricht vom natürlichen Logarithmus. Dieser Ausdruck steht für . Auch für das Rechnen mit Logarithmen gibt es ein paar Regeln, die Sie kennen sollten:
Das gilt für alle . Unabhängig von der Basis ist der Logarithmus von 1 immer 0. Das sollte Sie nicht überraschen, da Sie wissen, dass (für alle außer 0) stets 1 ergibt.
Diese Eigenschaft ist besonders hilfreich, wenn Sie Logarithmen ausrechnen wollen. Auf dem Taschenrechner finden Sie nämlich nur den Zehnerlogarithmus (log) und den natürlichen Logarithmus (ln). Wenn Sie mit Ihrem Taschenrechner ausrechnen wollen, können Sie oder eintippen.
Aufgabe 1.10
Berechnen Sie die folgenden Logarithmen und machen Sie die Probe.
Aufgabe 1.11
Vereinfachen Sie so weit wie möglich.
Mehrere Terme ausmultiplizieren
Am Anfang dieses Kapitels haben Sie das Distributivgesetz kennengelernt, mit dessen Hilfe Sie einen Term mit einer Reihe weiterer Terme ausmultiplizieren können. In diesem Abschnitt geht es jetzt darum, Binome und Polynome auszumultiplizieren.
Ein Polynom ist eine Summe von Vielfachen von Potenzen einer Variablen. Ein Polynom, bei dem zwei Terme addiert werden, bezeichnet man als Binom. Sind es drei Terme, spricht man von einem Trinom.
ist also ein Binom, weil es aus zwei Termen besteht. ist ein Trinom.