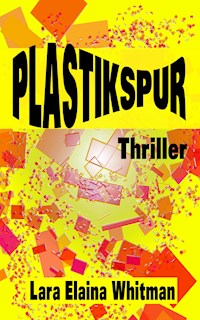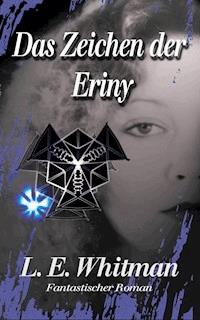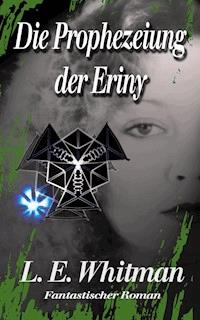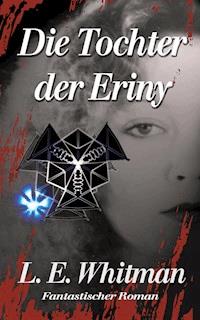Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Verlorene Siegel
- Sprache: Deutsch
Erdjahr 2088 Mond. Auf der Erde gibt es große Veränderungen. Immer mehr Aliensichtungen halten die Welt in Atem, Menschen verschwinden spurlos. Die Geheimdienste stehen vor einem Rätsel. Sie wollen Antworten und sie hoffen, dass sie sie von Ramirez Estar alias Ullisten Getrillum bekommen. Doch der ist ihnen in Kanada erneut entwischt. Das jedoch bringt Maria Lautner, die versucht ihre alte Vergangenheit in Armenien zurückzulassen, in den Fokus der diversen Interessen. Während sie vor ihren Verfolgern nach Chile flüchtet, muss Ullisten Getrillum in der Erzmine Montes Taurus auf dem Mond eine gefährliche Herausforderung nach der anderen meistern. Er ahnt nicht, dass ihm längst der Schlimmste all seiner Widersacher auf der Spur ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lara Elaina Whitman
Ullisten Getrillum (3)
In den Tiefen von Montes Taurus
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Zum Buch
Prolog Erdjahr 2088 Mond
Fortgeschleppt
Knapp entkommen
Alienalarm in Worthing
Defektes Terminal
Haarsträubender Anflug
Futter
Auf dem Mond
Geheimes Treffen
Puerto Montt
Keine Chance zu entkommen
Verleumdet
Verräterisches Blut
Gefährliches Manöver
Dumm gelaufen
Eine böse Überraschung
Was für ein Zufall
Schwarzes Erz
Der Prinz von Aasch
Die Angst im Nacken
Totale Überwachung
Ein Mantel und eine Waffe
Gefährlicher Auftrag
Vollständig rehabilitiert
Abgestürzt
Verschwendete Monate
Kribbeln im Bauch
Zum Sterben verurteilt
Verdammt harte Strecke
Zu weich?
Fehlendes Wissen
Retter in der Not
Endlich ein Zeichen
Die Schlinge zieht sich zusammen
Niederschmetternde Erkenntnis
Wilde Schafe und ein dicker Fisch
Ein unerwartetes Treffen
Ein gekappter Berg
Mörderischer Pfad
Am Rand des Mare Crisium
Eissturm
Höllische Nacht
Zurück zur Erde
Glossar
Danksagung
Über die Autorin
Weitere Romane von L. E. Whitman
Leseprobe: Das Erbe von Algol
Leseprobe: Das Zeichen der Eriny
Rechtliche Hinweise
Impressum neobooks
Vorwort
L. E. WHITMAN
aus der Reihe: "Das Verlorene Siegel"
Ullisten Getrillum
In den Tiefen von Montes Taurus
eBook
Science-Fiction Thriller
Umfang: 641.845 Zeichen
Printausgabe ca. 380 Seiten
Die Ullisten Getrillum-Reihe besteht aus:
Band 1: Verschollen auf der Erde
Band 2: Flucht zum Mond
Band 3: In den Tiefen von Montes Taurus
Für meinen Mann, den ich über alles liebe.
Anmerkung für die Leser/innen, die auch die anderen Romane aus der Reihe "Das Verlorene Siegel" lesen wollen oder bereits gelesen haben:
Das Spinoff über Ullisten Getrillum ist eine eigenständige Trilogie. Die drei Bände lassen sich zeitlich zwischen die Kapitel "Ein Job" und "Oficina Montes Taurus" in "Das Verlorene Siegel - Das Erbe von Algol" einordnen. Die Abenteuer, die Ullisten Getrillum und Maria Lautner in dieser Trilogie bestehen müssen, kommen in den Hauptbänden der Serie nicht vor. Nur der Anfang des ersten Bandes Flucht zum Mond ist zum besseren Verständnis inhaltlich an den Hauptband (Das Erbe von Algol) angelehnt.
Wer also die beiden Protagonisten genauso gerne mag wie ich, sollte sich ihre Abenteuer nicht entgehen lassen.
Am Ende dieses eBooks gibt es übrigens ein Glossar zum Nachschlagen und Leseproben aus einigen meiner anderen Romane, falls Sie mögen.
Ich wünsche allen viel Freude beim Lesen.
Lara
Die Reihe "Das Verlorene Siegel" umfasst derzeit folgende Bände:
No 1: Ullisten Getrillum – Verschollen auf der Erde
No 2: Ullisten Getrillum – Flucht zum Mond
No 3: Ullisten Getrillum – In den Tiefen von Montes Taurus
Das Verlorene Siegel – Das Erbe von Algol (Band 1)
Das Verlorene Siegel – Der Silberne Turm (Band 2)
Das Verlorene Siegel – Die Gesperrte Welt (Band 3)
Zum Buch
Erdjahr 2088 Mond.
Auf der Erde gibt es große Veränderungen. Immer mehr Aliensichtungen halten die Welt in Atem, Menschen verschwinden spurlos. Die Geheimdienste stehen vor einem Rätsel. Sie wollen Antworten und sie hoffen, dass sie sie von Ramirez Estar alias Ullisten Getrillum bekommen. Doch der ist ihnen in Kanada erneut entwischt. Das jedoch bringt Maria Lautner, die versucht ihre alte Vergangenheit in Armenien zurückzulassen, in den Fokus der diversen Interessen. Während sie vor ihren Verfolgern nach Chile flüchtet, muss Ullisten Getrillum in der Erzmine Montes Taurus auf dem Mond eine gefährliche Herausforderung nach der anderen meistern. Er ahnt nicht, dass ihm längst der Schlimmste all seiner Widersacher auf der Spur ist.
Prolog Erdjahr 2088 Mond
»Nicht die äußere Gestalt macht eine Kreatur zu einem Monster, sondern ihre Taten.«
Ullisten Getrillum
In den Tiefen der Erzmine von Montes Taurus, 10057 a. d. Algolii
Fortgeschleppt
Es war schon spät am Abend, die Familie hatte bereits gegessen und Mary Longley brachte gerade ihre kleine Tochter Ludmilla ins Bett, als ein ohrenbetäubender Lärm von der Haustür zu ihr heraufdrang. Ludmilla schrie vor Angst auf, doch Mary Longley hatte keine Zeit das Kind zu beruhigen, denn von unten hörte sie plötzlich laute unheimliche Stimmen, die das ganze Haus zu füllen schienen. Ihr Mann Peter rief etwas das sie nicht verstand, aber sie konnte Furcht in seiner Stimme erkennen. Erschrocken drehte sie sich um und wollte aus dem Zimmer laufen um nachzusehen was dort unten los war, doch Ludmilla hielt sich an ihrem Rock fest und behinderte sie damit.
»Ludmilla, bleib hier! Sei leise!« Mary Longley bedeutete der Kleinen ruhig zu sein, die sie aus geweiteten Augen furchtsam anblickte. »Versteck dich! Rasch!«
Mary Longley sah zu, wie ihre Tochter unter das Bett kroch und hastete dann mit klopfendem Herzen die Treppe hinunter. Fast wäre sie dabei gestolpert. Ein seltsamer, scharfbrandiger Geruch drang ihr in die Nase. Schwarze Rauchfahnen wirbelten ihr vom Eingangsbereich des Hauses her in dünnen Schwaden entgegen. Panisch versuchte sie nicht zu atmen, doch was sie dann sah, ließ sie alles vor Schreck vergessen. Rauch drang in ihre Nase und löste einen quälenden Hustenreiz in ihrer Kehle aus. Keuchend, mit Tränen in den Augen, starrte sie auf die Haustür, doch da war nur noch ein großes zackiges Loch in dem bröckelnden Mauerwerk. Die Holztür war offenbar komplett zu Asche verbrannt, große graue Flocken segelten durch die Luft. Der schöne, weiß lackierte Boden im Flur war völlig versengt. Dicke schwarze Schwaden zogen durch den Schlund hinaus ins Freie. Schatten bewegten sich in dem Rauch auf sie zu. Steif vor Angst stand sie wie festgenagelt da, unfähig sich zu bewegen. Erst als eine Hand nach ihrem Arm griff, die nichts Menschliches an sich hatte, begann Mary Longley zu schreien. Entsetzt wand sie sich in dem schmerzhaften Griff der krallenbewehrten dreifingrigen Klaue der Kreatur. Augen, die nur aus vertikalen Schlitzen bestanden, hinter denen es bösartig funkelte, starrten sie abschätzend an. Etwas wie Gier flackerte in dem grausamen Blick. Von dem schrecklichen Gesicht war nicht viel zu sehen, da das meiste davon von einer Art silberfarbenem Helm bedeckt war. Doch plötzlich schlängelte sich eine lange gegabelte Zunge aus dem breiten, mit spitzen Zähnen bewehrten Maul heraus und betastete genüsslich die Wangen der Frau. Mary Longley schrie wie am Spieß und versuchte die Zunge mit der freien Hand wegzuschlagen. Eine scharf riechende Flüssigkeit, die wie verrückt juckte, verteilte sich über ihre Gesichtshaut.
»Lass das, Pothon!«, sagte plötzlich eine knarzige Stimme befehlend aus dem Hintergrund. Die Stimme gehörte zu einem riesigen Mann, der aus dem Wohnzimmer in den zerstörten Hausflur herauskam und dem sie sofort ansah, dass das ebenfalls kein Mensch sein konnte, auch wenn die Ähnlichkeit erstaunlich war. Der fremdartige Riese fixierte sie aus unheimlichen hellblauen Augen, denen jegliche Wärme fehlte. »Wo ist Ullisten Getrillum?«, blaffte er sie an, während er drohend auf sie herabsah.
»Wer?«, wimmerte Mary Longley verständnislos, brachte aber kein weiteres Wort heraus.
»Du wirst mir sagen wo der Tarante ist! Sofort!«, er griff ihr unters Kinn und drehte ihren Kopf in den Nacken. Ein scharfer Stich jagte ihre Wirbelsäule hinunter und sie japste laut auf.
»Bitte lassen Sie mich los! Ich weiß nicht was Sie meinen!!«, flehte sie unter Tränen.
Der Kerl ließ angewidert ihr Kinn wieder los und trat einen Schritt zurück. »Bring sie in den Frachtraum, Pothon. Wir nehmen sie mit und verhören sie in der Basis.«
Die Kreatur, die sie immer noch unerbittlich in ihrem Griff festhielt, gab ein paar zischende unwillige Laute von sich, schleppte sie dann aber hinter sich her durch die zerstörte Haustür hinaus. Mary Longley konnte kaum noch laufen, ihre Knie gaben nach und sie stolperte mehr, als das sie ging. Hilflos sah sie sich um, aber von ihren Nachbarn war nichts zu sehen. Keiner kam ihr zu Hilfe. Die mussten doch mitbekommen haben, was hier los war! Warum half ihr niemand? Das riesige, schwarze Raumschiff, das wie ein Raubvogel über ihrem Haus schwebte, war doch nicht zu übersehen!
Mary Longley wollte schreien, aber sie brachte einfach keinen Laut mehr heraus. Furcht schüttelte sie durch, ihre Zähne schlugen unkontrolliert aufeinander. Ein scharfer Schmerz peinigte Mary Longleys Beine. Er wurde von dem grauschuppigen Reptilienschwanz verursacht, der hinten fast zwei Meter lang aus der Uniform des fremden Wesens heraushing. Bei jedem seiner gewaltigen Schritte schlug ihr der scharfzackige Wirbelsäulenfortsatz schwungvoll gegen die Beine. Doch das schien die Kreatur selbst nicht zu stören. Mitleidlos wurde sie von dem Monster über eine lange Rampe in den Bauch des Raumschiffes gezerrt und dort wie ein gefangenes Tier in einen, nur wenige Quadratmeter großen, Metallkäfig gesperrt. Wenig später brachten sie ihren Mann Peter, der eine große blutende Wunde am Hinterkopf hatte. Er war nicht bei Bewusstsein. Die Monster warfen ihn einfach vor ihre Füße, so als wäre er nur ein Sack Kohlen und kein lebendiges Wesen. Inständig betete Mary Longley, dass sie ihre kleine Tochter Ludmilla nicht fanden, doch es war vergebens. Eine ziemlich große, erstaunlich menschenähnliche Frau, mit dem Gesicht eines Engels und der Figur eines Modells, schleppte das schreiende und strampelnde Kind wie eine Puppe unter den Arm geklemmt die Rampe herauf und warf es mit Schwung in den Käfig. Mary Longley konnte ihre Tochter gerade noch auffangen, bevor sie auf dem Boden aufschlug.
Die Kleine wimmerte angsterfüllt und klammerte sich zitternd an ihre Mutter. »Die bösen Riesen sind gekommen, die bösen Riesen sind gekommen«, stammelte sie immer wieder.
Mary Longley strich mechanisch über das schmale Gesichtchen des kleinen Mädchens. Sie konnte nichts für ihre Tochter tun. Hilflos sah sie durch die Öffnung in der Schleuse des Raumschiffes hinaus. Dort lag die Freiheit und ihr einst so schönes Haus, das nun halb zerstört einen traurigen Anblick bot. Ein paar weitere uniformierte Kreaturen hasteten über die sich einziehende Rampe herauf und zwängten sich in letzter Minute durch den sich nur langsam schließenden Schlitz in der Schleuse herein. Ein Zittern lief durch den Rumpf des Raumschiffes und noch bevor die Schleuse ganz geschlossen war, hob es ab. Draußen gab es einen grellen Lichtblitz, gefolgt von einem gänsehautfördernden Knirschen. Eine Dreckfontäne sandte einen Steinchenhagel durch die noch immer offene Schleuse herein. Dort wo einmal ihr Haus gestanden hatte, klaffte nun ein riesiger Krater. Wie betäubt starrte Mary Longley auf das Loch, das einst ihr geliebtes Heim gewesen war. Mit stumpfem Blick betrachtete sie den schmalen Spalt, der sich nun endgültig und unwiederbringlich schloss. Erst das Wimmern ihrer Tochter rief sie in die Wirklichkeit zurück.
Mary Longley drückte Ludmilla kurz an sich und sagte, »wir müssen nach Papa sehen!« Sie setzte die Kleine ab, die sich jedoch weinend an ihrem Arm festklammerte und so blieb ihr nichts übrig, als sie wieder hochzunehmen.
Ihr Mann lag noch immer dort, wo diese Monster ihn vorhin abgeladen hatten und rührte sich nicht. Mary Longley sah sich im Frachtraum um, aber keine der Kreaturen kümmerte sich mehr um sie. Sie setzte sich neben ihren Mann auf den Boden und strich ihm die Haare aus dem Gesicht. Am Hinterkopf hatte er einen langen Riss, der Knochen der Schädeldecke schimmerte durch. Rasch fühlte sie nach seinem Puls. Er ging schwach, aber er war noch am Leben.
»Peter, Peter, bitte wach auf!« flüsterte sie leise, doch ihr Mann gab keinen Laut von sich. Sanft rüttelte sie ihn am Arm. Ein langgezogenes leises Stöhnen kam über seine aufgeplatzten Lippen. Erschrocken hielt sie inne. Sie wollte ihm schließlich nicht noch mehr Schmerz zufügen, aber sie wusste nicht, was sie nun tun sollte. Ihre Angst begann einem dumpfen Gefühl zu weichen, das sich wie eine alles erstickende Decke auf ihre Seele legte und ihr die Energie zum Leben wegnahm. Bleich und mit verlorenem Blick betrachtete sie ihren Mann. Der Schock darüber was da gerade passierte, war für sie zu groß und so blieb sie einfach sitzen und sah mit leeren Augen vor sich hin, bis ihre Tochter sie daran erinnerte, dass sie auch noch da war.
»Mama!«, die piepsige Stimme ihrer Tochter riss sie erneut aus ihrer Lethargie.
»Leise Ludmilla!« Mary Longley strich ihr über das tränennasse Gesichtchen und drückte sie noch ein wenig fester an sich. Ihr Blick wanderte durch den Frachtraum, so als ob sie dort etwas finden würde, das ihr helfen würde von hier fort zu kommen. Vielleicht konnte sie ja doch etwas tun? Sie musste ihre Tochter retten. Vielleicht, wenn sie die Frage beantworten konnte, die der Anführer ihr gestellt hatte, vielleicht konnten sie dann wieder gehen. Wonach hatte der Kerl sie gefragt? Nach einem Mann, Ullisten irgendwas. Den Namen kannte sie nicht, aber vor ihrem inneren Auge erschien das Bild eines ziemlich großen Menschen, der ihr von Anfang an ein wenig seltsam vorgekommen war. Ramirez Estar! Sie hatten ihn und seinen Freund Maxim Grey, den Sohn eines angesehenen Londoner Unternehmers, vor nicht allzu langer Zeit aus dem Wasser gezogen. War das der Mann, den diese Monster suchten? War das alles nur passiert, weil sie freundlich zu zwei Fremden gewesen sind?
Mary Longley wurde in ihren Überlegungen unterbrochen, denn etwas veränderte sich. Eine Gruppe Uniformierter kam aus einer Schleuse in den Frachtraum zurück und steuerte direkt auf den Käfig zu, in dem sie saßen. Mary Longley drückte beschützend ihre Tochter an ihre Brust und sah ihnen angstvoll entgegen. Ihr Herz klopfte panisch beim Anblick dessen, was da auf sie zukam. Diese Gruppe bestand fast ausschließlich aus echsenartigen Kreaturen. Ihre Schwänze schwangen im Rhythmus des Gleichmarsches ihrer stampfenden Schritte hin und her. Es erinnerte sie an aufrecht gehende Krokodile mit flacher Schnauze in einem eher schlangenartigen Gesicht. Ein groteskes Bild, das ihr ein leises hysterisches Lachen entlockte.
»Mama, warum lachst du?«, hauchte Ludmilla, doch ihre Mutter antwortete ihr nicht, starrte nur mit geweiteten Augen auf die grünschuppigen Monster, die vor dem Käfig stehen geblieben waren und nun salutierten, so als wären sie in der britischen Armee.
Ihr Mann Peter bewegte sich endlich. Stöhnend griff er sich an den Kopf, richtete sich dann aber auf und lehnte sich schwach mit dem Rücken an die graue metallische Wand, die eine Seite des Käfigs abschloss. »Mary, was ist passiert?«, fragte er mit schwacher Stimme. Er hatte die Kreaturen offenbar noch gar nicht wahrgenommen. Sie mussten ihn ihm Haus niedergeschlagen haben oder er hatte es vergessen.
Mary Longley kam nicht dazu, seine Frage zu beantworten, denn just in diesem Moment wurde die Käfigtüre geöffnet und zwei der Echsenwesen kamen herein. Ihre Schritte hatten etwas Lauerndes und erinnerten sie unwillkürlich an Raubtiere auf der Jagd. Unsanft wurden sie auf die Beine, dann aus dem Käfig gezerrt und gefolgt von unverständlichen Zischlauten in Richtung Schleuse gestoßen.
»Oh Gott! Was sind das für welche?«, stammelte Peter Longley, während er neben seiner Frau her stolperte. Frisches Blut rann aus seiner Wunde am Kopf. Er schien es nicht zu bemerken.
»Ich weiß nicht, Peter! Sie haben unser Haus zerstört«, sagte Mary Longley traurig.
Einer der Uniformierten stieß sie mit einem langen Stab in den Rücken und zischte etwas Unverständliches. Die Schleuse öffnete sich und gab den Blick auf eine lange, breite, gelblich leuchtende Straße frei, auf der leicht mehrere dieser Raumschiffe nebeneinander Platz gehabt hätten und die in schwindelerregender Höhe in der Luft zu hängen schien. Unter und über ihnen gab es noch etliche dieser frei im Raum schwebenden straßenartigen Bänder, an denen unzählige kleinere und größere Roboter arbeiteten. Der Untergrund jedoch verlor sich in der hell erleuchteten Tiefe. Winzige Figuren bewegten sich auf dem Boden weit unter ihnen, wie emsige Ameisen. Die drei Menschen sahen sich erschrocken um, während sie auf den seltsam glatten Belag der atemberaubenden Konstruktion hinausgeschubst wurden.
Vor ihnen, in ein paar hundert Metern Entfernung endete die Rampe vor einem riesigen metallisch schimmernden Tor, das in eine mausgraue Felswand eingelassen war. Die Felswand ragte erdrückend vor ihnen in die Höhe und verlor sich wie die Steilwand eines Gebirges in der Dunkelheit über ihnen. Am Ende der Rampe, kurz vor dem großen Tor, parkte ein weiteres Raumschiff, auf dem ein in verschiedenen Rottönen schillerndes Wappen prangte.
Die Longleys hoben den Kopf und sahen nach oben, auf der verzweifelten Suche nach einer Fluchtmöglichkeit. Doch über ihnen gab es nur einen nachtschwarzen Himmel, bedeckt von einem seltsamen flackernden Leuchten. Eine Art Schutzkuppel schien das gesamte Gelände zu umspannen. Durch deren irritierendes Flimmern schickten unzählige Sterne ihr eisiges Licht. Es war einfach nur gewaltig und furchteinflößend.
»Das ist nicht auf der Erde. So einen schwarzen Himmel habe ich noch nie gesehen. Sind wir etwa auf dem Mond?«, stammelte Peter Longley unsicher. Panik schwang in seiner Stimme mit. Mary Longley schüttelte den Kopf. Sie wusste es nicht. Außerdem hatte sie alle Hände voll damit zu tun ihre Tochter festzuhalten, die krampfartig zitterte.
Die Kreaturen ließen ihnen keine Zeit sich weiter umzusehen. Unsanft wurden sie vorwärts gestoßen, auf eine Gruppe Leute zu, die sie offenbar schon erwartete. Die Longleys starrten entsetzt auf das bunte Gemisch aus Monstern, die da standen. Außer weiteren der grünschuppigen schlangengesichtigen Echsenwesen gab es noch ein anderes, mit einem Kamm auf dem Kopf, aus dem irritierend blaue Federn herausragten. Es hatte den Körper eines enorm muskulösen Mannes und es hatte keinen Schwanz, dafür rasiermesserscharfe Zähne hinter schmalen Lippen. Neben der monströsen Kreatur wippte eine Riesenheuschrecke auf und nieder, deren Körper graurot leuchtete. Nur ein weiterer Fremder sah annähernd wie ein Mensch aus. Aber wie ein riesiger Mensch mit seltsam glatten Gesichtszügen und einer großen auffälligen Hakennase.
Dieser Mann trat nun vor und sagte mit befehlsgewohnter Stimme, durchsetzt mit vielen rollenden "Rs", »bringt ihn zum Verhör. Die Frau und das Kind schafft in das Shuttle. Die medizinische Abteilung wartet bereits auf sie. Die Frau wird nach Rokan Tarr gebracht. Ihre blauen Augen und dieses feine helle Haar sind dort Gold wert.« Er griff prüfend in das lange blonde Haar der Menschenfrau, so als wäre sie ein Pferd.
Mary Longley wich angeekelt zurück. »Nimm deine dreckigen Pfoten weg!«, schrie Peter Longley außer sich und versuchte sich zwischen seine Frau und den Alienmann zu drängen.
Ra Aldaron schenkte ihm keine Beachtung, sondern gab seinen Untergebenen einen kurzen Wink. Mary Longley musste mit ansehen wie zwei der Echsenwesen Peter Longley in die Mitte nahmen und fortschleppten. Ein weiterer zerrte ihr ihr Kind aus den Armen. Mary Longley kreischte laut auf. Mit aller Kraft trat sie nach dem fremdartigen Wesen, das bösartig zischte, doch es war nutzlos, denn Ludmilla entglitt ihren Händen. Die Verzweiflung gab ihr Kraft. Noch bevor Ra Aldaron reagieren konnte, stürzte sich Mary Longley mit einem Schrei, der durch Mark und Bein ging, auf ihn. Der Mefarr, der die Gruppe leitete, reagierte sofort und schoss. Mary Longley sank mit einem Wimmern zu Boden. Das Kind begann mit schriller Stimme aus Leibeskräften zu schreien.
»Cruchur! Jetzt hast du die Ware beschädigt!«, stieß Ra Aldaron zornig hervor.
»Mama!«, wimmerte Ludmilla panisch, doch die Riesenheuschrecke kam unaufhaltsam auf sie zu und packte sie mit ihren messerscharfen Krallen. Ludmilla Longley verstummte vor Entsetzen. Zusammen mit ihrer Mutter, die in eine erlösende Ohnmacht gefallen war, wurden sie in das Raumschiff gebracht.
Knapp entkommen
Eigentlich war Maria Lautner immer noch ziemlich wütend auf die CIA. Dass schon wieder irgendjemand über ihren Kopf hinweg einfach so über ihr Leben entschied, war nicht nach ihrem Geschmack, auch wenn es sich dabei um Michael Fremont handelte. Der verdeckte Ermittler der CIA und sein Kollege, Donald Hastings, hatten ihr damals das Leben gerettet, als sie gegen Manfredo Cortez y Diega eingesetzt worden war. Das war dann schon das zweite Mal, denn auch das Wiesel hatten ihr die beiden Agenten vom Hals geschafft. Ohne sie hätte sie vermutlich die Nacht nicht überlebt, nicht einmal in der Pension Kamsarakan selber. Das Wiesel, das ihr der Boss auf den Hals gehetzt hatte, war einer der übelsten Killer, der ihr bisher begegnet war und er war nun tot. Ihr Glück, denn sonst wäre es um sie geschehen gewesen. Eigentlich sollte sie traurig sein, dass Menschen einander einfach so umbrachten, aber wenn es das Wiesel betraf, dann konnte sie das einfach nicht bedauern. Es gruselte sie bei dem Gedanken daran was der Kerl mit ihr angestellt hätte, wenn er sie in die glitschigen Finger bekommen hätte. Maria Lautner schüttelte sich unwillkürlich. Sie sollte das einfach aus ihrem Gedächtnis streichen, aber ihr Gewissen hatte schon immer ein Eigenleben geführt. Es würde wohl eine Weile dauern bis sie darüber hinwegkam. Immerhin hatten die zwei CIA-Agenten den Mann getötet und nicht sie.
Die beiden verdeckten Ermittler wussten erstaunlich gut Bescheid über sie. Selbst über das was der Erzbischof von Sjunik mit ihr vor hatte. Sie wusste, dass die Beiden es nur gut mit ihr meinten und sie nur vor Manfredo Cortez y Diega beschützen wollten. Sie war den Beiden nicht mehr böse, dass sie sie so überrumpelt hatten. Aber auf Dauer würde ihnen das sowieso nicht gelingen. Irgendwann würde Hernez Breitmeier, der Sekretär des einflussreichen Geschäftsmannes, die Aufnahmen von der großen Kaskade in die Finger bekommen und dann war die Hetzjagd auf sie eröffnet. Besser sie kam dem zuvor und wusste, wann es soweit war. Es war ihr Risiko und sie ging das gerne ein, wenn sie dazu beitragen konnte, dass die beiden Männer vielleicht eines Tages in irgendeinem Gefängnis versauerten. Immerhin hatte sie jetzt zwei bezahlte Jobs. Einmal als "Ghost" für die Organisation des Erzbischofs und wohl jetzt auch noch für die CIA.
Maria Lautner schüttelte unwillig den Kopf. Sie sollte an andere Dinge denken. In einer Stunde würde sie die Pension Kamsarakan in Aschtarak verlassen und vermutlich niemals wieder hierher zurückkommen. Das tat ihr ein wenig leid, denn der Ort hier gefiel ihr sehr gut. Leider war es nun nicht mehr zu ändern. Rasch packte sie ihre wenigen Habseligkeiten in die kleine Reisetasche und sah sich noch einmal akribisch um. Alle Spuren waren beseitigt, ihre Fingerabdrücke peinlichst von den Oberflächen entfernt. Schade, dass sie die restlichen Räume der Pension nicht saubermachen konnte, aber sie hatte ohnehin von Anfang an darauf geachtet, dass sie kaum verwertbare Spuren hinterließ. Die Besitzerin, Frau Kamsarakan, war sehr reinlich und in ein paar Tagen würde deshalb gewiss nicht einmal mehr ein Haar von ihr zu finden sein. Ob der Boss schon wusste, dass der Anschlag auf sie gescheitert war? Nervös knabberte sie an ihrer Unterlippe und ging hinunter zur Lobby der kleinen Pension um zu bezahlen, natürlich in bar.
Nachdem sie sich verabschiedet hatte, stieg sie in das gemietete Auto und fuhr nach Echmiadzin. In der Nähe der Kirche parkte sie ihren Wagen und ging das letzte Stück zu Fuß. Es war noch sehr früh am Morgen und dadurch waren nur wenige Menschen auf den zugeschneiten Straßen unterwegs. Eine klirrende Kälte war über Nacht von Norden herangezogen und ließ die Bäume und Sträucher mit einem weißen, vom Raureif überhauchten Kleid zurück. Maria Lautner zog den dünnen Mantel enger um sich, als sie die Mashtots Poghots entlanghastete, die zu der Kirche der Hripsime führte.
Der Erzbischof stand schon am Fuß der Treppe des altehrwürdigen Gotteshauses und wartete ungeduldig auf seinen Füßen wippend auf sie. »Guten Morgen, meine Tochter!«, er winkte Maria Lautner hastig zu ihm zu folgen.
Sie hatte nicht einmal die Zeit ihn zu begrüßen, so eilig hatte er es. Gemeinsam stiegen sie die steile Treppe hinauf. Maria Lautner wollte eigentlich nicht in die Kirche hineingehen, da sie dadurch unangenehm an ihren letzten Besuch erinnert wurde. An den Besuch, bei dem ihr das Wiesel aufgelauert hatte. Der Erzbischof ließ ihr keine Wahl und schob sie ohne ein Wort zu verlieren durch das Kirchenportal. Drinnen zog er sie zur Seite, hin zu den Hunderten von Kerzen, die auf einem mit Sand bestreuten schwarzen Metallgestell leise rußend vor sich hinbrannten. Mit einem raschen Blick vergewisserte er sich, dass sie nicht beobachtet werden konnten. Er griff unter seine Soutane und zog eine längliche Mappe heraus, die er ihr in die Hand drückte.
»Das hier sind deine Papiere, meine Tochter. Lass das Mietauto stehen. Wir kümmern uns darum. Die Delegation startet in einer halben Stunde. Der Bus steht vor dem Gevorgian Seminar. Du brauchst nur einzusteigen. Der Fahrer weiß Bescheid. Er bringt dich zum Flughafen nach Jerewan. Tauch unter, mindestens für ein halbes Jahr, bevor du mit deinen Ermittlungen beginnst. Erst dann nimmst du Kontakt mit dem CIA-Mann auf. Er wird mich auf dem Laufenden halten. Kein direkter Kontakt zu mir in den nächsten zwölf Monaten. Verstanden! Viel Glück, meine Tochter.« Er segnete sie kurz und lächelte ihr aufmunternd zu.
Maria Lautner stutzte ein wenig bei den letzten Worten. War das wirklich nötig? Dass es ziemlich gefährlich für sie werden würde, war ihr doch sowieso klar. Sie stellte ihre Fragen zurück. Wenn sie das nächste halbe Jahr unerkannt überstand, sah alles anders aus. Bis dahin war sicher Gras über ihre alte Existenz gewachsen. Zwölf Monate waren entschieden zu viel und in ihren Augen auch überflüssig. Bevor der Erzbischof davonstürmen konnte, hielt sie ihn schüchtern am Ärmel zurück und umarmte ihn fest. Natürlich war das nicht wirklich angemessen, aber irgendwie war sie sich plötzlich nicht mehr sicher, ob sie ihm in diesem Leben noch einmal persönlich begegnen würde oder nur noch über das Spezialtelefon mit ihm in Verbindung bleiben konnte. Mit Tränen in den Augen sagte sie, »Danke für alles, Exzellenz.«
Der Geistliche räusperte sich ein wenig verlegen und verschwand dann ohne sich noch einmal umzudrehen in Richtung Kirchenschiff. Lächelnd sah sie ihm hinterher und atmete ein paarmal tief durch. Nach einem kurzen Blick in die schmale Mappe, die neben dem Flugticket einen neuen Pass, einen weiteren einfachen Briefumschlag, eine erkleckliche Summe Dollarnoten und ECOS-Coupons enthielt, steckte sie sie in die Innentasche ihres Reisemantels, nachdem sie ihren neuen Reisepass herausgenommen hatte. Sie hatte später noch Zeit den Inhalt der Mappe genauer zu untersuchen. Jetzt war es erst einmal wichtig, dass sie möglichst schnell von hier wegkam. Dennoch nahm sie sich kurz die Zeit einen Blick auf ihre neue Identität zu werfen.
ESMERALDA PARADOR
geboren am 08.04.2060 in VALDIVIA
CHILE,
stand da in großen fetten Buchstaben. »Aha, das Geburtsdatum hat er also gelassen. Valdivia! Eine vor langer Zeit von Deutschen aufgebaute Stadt also. Der Erzbischof denkt mit«, dachte Esmeralda belustigt. Immerhin sprach sie perfekt Deutsch, da ihre Eltern aus Österreich stammten. Das würde einen möglichen leichten Akzent erklären, den sie anfangs sicherlich noch hatte. Nachdem es auch heute noch viele von Deutschen abstammende Einwohner im Kleinen Süden von Chile gab, war das zumindest eine glaubwürdige Erklärung für ihre sprachliche Unzulänglichkeit. Sie steckte die neue Identitätskarte in eine der Innentaschen ihres Reisemantels und zog ihren alten Pass und alle anderen Ausweiskarten, die sie noch besaß, aus ihrer Handtasche. Nach einem letzten prüfenden Blick in die Tiefen ihrer Tasche, damit sie auch nichts vergessen hatte, schob sie die alten Identitätskarten und Kreditchips in eine durchsichtige Tüte. Es zischte ein klein wenig und roch nach verbrannten Chemikalien, aber von den Plastikkarten war nun nichts mehr übrig, außer einem winzigen Klümpchen zerschmolzenem Kunststoff und etwas Gold. Ab jetzt war sie nicht mehr Maria Lautner, sondern Esmeralda Parador.
Mit neuem Mut trat sie durch das Kirchenportal hinaus in den Sonnenschein, der den Schnee auf den Bäumen und Dächern der Häuser glitzern ließ. Die Luft war klar und roch nach weiteren Schneefällen. Es war ein ziemlich kalter Morgen und sie fror in dem dünnen Reisemantel. Rasch stieg sie die steile Treppe zur Hauptstraße hinunter und machte sich zu Fuß auf den Weg zum Gevorgian Seminar. Ihr Auto ließ sie einfach stehen, so wie der Erzbischof sie angewiesen hatte.
Der Weg, den sie zurücklegen musste, um zum Seminar zu gelangen, war nicht allzu weit. Sie brauchte nur die Mashtots Poghots bis zum Komitas Hraparak entlangzulaufen um zum Seminar zu kommen. Schon von weitem sah sie den Bus vor der denkmalgeschützten Anlage stehen. In schwarze Anzüge mit weißem Kragen gekleidete Priester stiegen gerade ein. Sie sahen verdutzt auf, als sich die ihnen unbekannte Frau hintenanstellte. Hatte der Erzbischof nicht Bescheid gesagt, fragte sich Maria Lautner alias Esmeralda Parador besorgt. Der Busfahrer erschien von der anderen Seite des Busses, nahm ihr wortlos ihren Koffer ab und bedeutete ihr mit einer stummen Geste ebenfalls einzusteigen.
Die Herren waren alle recht mundfaul. Keiner sagte auch nur einen Ton zu ihr. Nur erstaunte Blicke folgten ihr, als sie sich den schmalen Gang zwischen den Sitzreihen hindurchzwängte. Sie nickte grüßend und setzte sich dann ganz hinten auf die Rückbank. Ihre Hände waren ein wenig feucht vor Aufregung. Der Bus füllte sich mit noch mehr Priestern, die gerade aus dem Seminar herauskamen. Am Ende saßen fünfzig schwarzgekleidete Geistliche auf den Sitzen und unterhielten sich leise tuschelnd. Niemand schenkte ihr mehr Beachtung. Langsam entspannte sie sich ein wenig. Bis hierhin war doch alles gut gegangen.
Von Echmiadzin zum Jerewaner Flughafen war es nur ein Katzensprung. Maria Lautner übte während der ganzen Fahrt stumm ihren neuen Namen ein. »ESMERALDA PARADOR, ESMERALDA PARADOR …«, sagte sie sich in Gedanken immer wieder vor. Es war ziemlich schwer, den alten Namen abzulegen, da sie ihn so viele Jahre getragen hatte, aber ab sofort existierte der nicht mehr.
Einer der Priester erhob sich und kam den schmalen Gang entlang auf sie zu. Mit einem unguten Gefühl sah sie ihm entgegen. »Verflixt, muss ich jetzt irgendetwas sagen?«, überlegte sie angespannt. Der Priester setzte sich neben sie und faltete die Hände. Sie kannte ihn nicht, aber der Mann war ihr aus einem unerfindlichen Grund extrem unsympathisch.
Nachdem er sich geräuspert hatte, sagte er in unfreundlichem Tonfall, »wir wissen wer sie sind, Frau Lautner. Wenn wir in Rom sind möchte ich, dass sie mich zum Vatikan begleiten.« Er sah ihr starr ins Gesicht, nicht ein Blinzeln störte den unangenehmen Blick aus stechend stahlblauen Augen. Bevor sie etwas erwidern konnte, erhob er sich wieder und ging auf seinen Platz zurück.
Esmeralda Parador sah ihm verwirrt hinterher. Davon hatte der Erzbischof nichts gesagt und sie bezweifelte, dass er davon etwas wusste. »Aber, um des Himmels Willen, woher weiß der Vatikan, dass ich mit der Delegation zum Flughafen fahre«, fragte sie sich erschrocken. Gab es ein Leck in der Organisation des Erzbischofs? Das wäre ein großes Problem. Hastig überlegte sie weiter und kam zu dem Schluss, dass der Vatikan nicht alle Informationen haben konnte, denn sie flog doch gar nicht nach Rom. Ihr Anschlussflug ging von der Orbitalstation SPACEGULL sofort weiter nach Chile. Sie hatte überhaupt kein Ticket und keine Einreisegenehmigung für Italien. Allerdings hatte es für sie nicht wie eine Einladung geklungen, sondern eher wie eine Drohung. Plötzlich stutzte sie. Wie hatte der Priester sie genannt? Frau Lautner? Das war sie doch jetzt nicht mehr, denn Maria Lautner existierte nicht mehr. Sämtliche Daten waren gelöscht worden, die es jemals unter diesem Namen über sie gegeben hatte. Sie war jetzt Esmeralda Parador und die würde auf keinen Fall nach Rom fliegen. Außerdem waren ihr die rückwärtsgewandten, in ihren altertümlichen Vorstellungen verhafteten Geistlichen in Rom ein Gräuel. Diejenigen, die sie in den letzten Jahren kennengelernt hatte waren jedenfalls alles andere als menschenfreundlich gewesen und ziemlich von sich eingenommen, quasi unfehlbar. Aber zum Glück für sie war der Vatikan nicht halb so gut informiert wie er selber dachte, denn dann wäre ihnen der Fehler nicht unterlaufen. Denn dann hätten die gewusst, dass ihr Ticket nicht in Rom endete wie das der übrigen Geistlichen in diesem Bus, sondern dass sie den Transit von der Orbitalstation SPACEGULL zur Orbitalstation SILVERCONDOR nehmen würde, um nach Antofagasta weiter zu fliegen. Esmeralda Parador lehnte sich etwas beruhigter in ihrem Sitz zurück und betrachtete die vorbeihuschende Landschaft. Ein leises sehnsüchtiges Gefühl befiel sie. Ob sie jemals wieder hierher zurückkommen würde? Rasch wischte sie den Anflug von Heimweh fort, aber sie konnte nicht verhindern, dass sie umso nervöser wurde, je näher sie dem Flughafengelände kamen. Und wenn doch etwas schiefging? Esmeralda Parador schalt sich selber einen Dummkopf. All die Jahre, die sie für die Organisation des Erzbischofs gearbeitet hatte, war nie etwas schiefgegangen. Dann würde das auch dieses Mal klappen.
Der Bus fuhr durch eine Schranke auf das weitläufige Gelände des Jerewaner Frachtflughafens und hielt dort vor einer kleinen Maschine des Typs Douglas Electro 100 an. Die Douglas Electro 100 war ein hypermodernes Passagierflugzeug für maximal einhundert Personen und mit dem Modernsten ausgestattet, was die Flugzeugentwicklung derzeit so hergab. Esmeralda Parador kannte nur eine Fluggesellschaft, die diesen Flugzeugtyp einsetzte, die Bethlem Aircraft Incorporate. So wie es aussah, hatte die Delegation einen eigenen Charterflug gemietet, um auf die Orbitalstation zu kommen. Wie Schuppen fiel es ihr von den Augen, als sie das Flugzeug näher betrachtete. Die flogen gar nicht zur Orbitalstation, sondern direkt nach Rom. Damit hatte sie nicht gerechnet. Schweißperlen traten ihr auf die Stirn, trotz des kalten Gebläses aus der Klimaanlage. Zögernd folgte sie den Priestern, die eilig aus dem Bus drängten. Eine klobige Hand hielt sie zurück. Es war der Busfahrer.
»Setzen Sie sich wieder hin«, flüsterte er leise, während er selber hinaus hastete. Er drehte sich noch einmal zu ihr um und rief durch die Tür, bevor er auf die andere Seite des Busses verschwand, um die Koffer der Passagiere aus dem Gepäckfach zu holen, »steigen Sie auf keinen Fall aus!«. Er deutete auf einen Geistlichen, der sich suchend umblickte.
Esmeralda Parador setzte sich überrascht in einen der vorderen Sitze und duckte sich so tief wie möglich. Der Busfahrer brauchte nicht lange mit dem Gepäck der Priester. Er schien sich beeilt zu haben, da er wenige Minuten später schon wieder da war. Ihren Koffer in der Hand stieg er wieder ein und schloss sofort die Tür. Im gleichen Moment wummerte jemand dagegen und verlangte, dass der Bus wieder geöffnet wurde. Esmeralda Parador warf einen ängstlichen Blick auf das wutverzerrte Gesicht des Vatikanpriesters, aber der Busfahrer ignorierte ihn einfach und startete ungerührt den Elektromotor.
»Ich fahre Sie direkt zur Abflughalle. Wir müssen uns beeilen. Ihr Flug geht in einer Viertelstunde. Sie werden schon erwartet«, sagte er gelassen und fuhr los.
Verwundert nickte Esmeralda Parador. Auffälliger ging es aber nun wirklich nicht mehr, oder? Sie warf noch einmal einen Blick zurück auf das Flugzeug der Delegation. Der Priester telefonierte hektisch gestikulierend mit irgendjemandem. Hoffentlich reichte sein Einfluss nicht so weit, dass sie nicht abfliegen konnte. Der Busfahrer schien jedenfalls sämtliche Regeln auf dem Flughafengelände zu brechen. Er fuhr viel zu schnell. Wenige Minuten später hielten sie vor der Abflughalle. Eine Stewardess erwartete sie bereits.
Der Busfahrer drückte Esmeralda Parador ihren Koffer in die Hand, wünschte ihr mit einem freundlichen Lächeln eine gute Reise und ließ sie vorne aussteigen.
»Frau Parador folgen Sie mir bitte«, sagte die Stewardess aufmunternd zu ihr.
Esmeralda Parador runzelte die Stirn. Ihr Blick suchte unauffällig Kameras, aber sie fand keine. Offenbar hatte dieser Eingang keine optische Überwachung. Das war erstaunlich, verstieß das doch gegen die Sicherheitsvorschriften des Flughafens. Rasch folgte sie der Flugbegleiterin, die sie durch eine Reihe von Fluren und Treppen in die Abflughalle lotste und freundlich auf ein Abfertigungsterminal zeigte.
»Sie brauchen nur ihren Chip hinein zu schieben. Ich wünsche Ihnen einen guten Flug. Auf Wiedersehen!« Mit einem aufmunternden Lächeln ging die junge Frau.
Die verdutzte Esmeralda Parador sah ihr noch ein paar Sekunden hinterher, dann zog sie die kleine Mappe aus der Innentasche ihres Mantels, holte ihren Flugchip heraus und ließ ihn in das Lesegerät gleiten. Innerlich betete sie zitternd, dass die Organisation keinen Fehler gemacht hatte. Als der Chip wieder herauskam und das Drehkreuz mit einem leisen Klacken freigab, atmete sie erleichtert auf. Der erste Teil wäre geschafft. Mit jedem Schritt, den sie den langen Gang entlanglief, der zum Shuttle hinunterführte, fühlte sie sich ein wenig sicherer. Ihr Platz im Shuttle befand sich zum Glück ganz vorne, so dass sie nicht durch die vollbesetzte Maschine gehen musste. Die Stewardess nahm ihr ihren Koffer ab und verstaute ihn zu ihren Füßen in einem kleinen Fach. Dann zeigte sie ihr routiniert, wie sie sich anschnallen musste und die magnetischen Sohlen an ihren Schuhen befestigen konnte. Nach einem letzten prüfenden Blick schloss die Flugbegleiterin die Stehkabine.
Esmeralda Parador warf einen kurzen Blick auf den in die Kabinentür eingelassenen Bildschirm, der Bilder von der Orbitalstation zeigte. Routineinformationen. Es war nicht das erste Mal, dass sie zu einer der Orbitalstationen flog, aber sie mochte es trotzdem nicht besonders. Die Andruckkräfte während der Startphase waren unangenehm und ihr wurde immer ein wenig übel davon. Außerdem war es stickig und es roch nach Chemikalien und abgestandener Luft auf diesen Stationen. Leider war es der einzig schnelle Weg auf die andere Seite der Erde. Seufzend lehnte sie sich zurück und versuchte sich zu entspannen, während die Maschine auf das Startfeld rollte.
Ihre Gedanken beschäftigten sich mit den letzten Monaten und blieben bei Ramirez Estar hängen. Ob er wohl entkommen konnte? Wo er wohl jetzt war? Vermutlich würde sie das niemals herausfinden und sie sollte ihn einfach vergessen, auch wenn er ein netter Mann gewesen war. Das mit diesem ganzen Außerirdischengeplapper verdrängte sie einfach. Jedenfalls hatte sie ihn gemocht, aber sie würde ihn sowieso nie wiedersehen, weshalb also weiter Energie dafür verschwenden. Sie hatte ihre eigenen Probleme. Außerdem war sie irgendwie erleichtert, dass sie aus der Sache raus war. Ramirez Estar war ihr ungewöhnlichster Auftrag gewesen, den sie bis jetzt ausgeführt hatte. Das was in Chile kam war Routinearbeit, auch wenn sie sich in den Dunstkreis des in ihren Augen gefährlichsten Verbrechers der Welt begeben würde. Doch davor hatte sie keine Angst. Als Ghost war sie richtig gut.
Das Shuttle startete und ein paar Minuten später übernahmen die Andruckkräfte für sie das Denken. Es gab einen kleinen Hüpfer in ihrem Magen, als sie in die Schwerelosigkeit eintraten. Ihre magnetischen Sohlen hielten sie am Boden fest. Auf dem Bildschirm wurde nun das Anflug- und Andockmanöver eingeblendet. Esmeralda Parador nutzte die Zeit, um den Inhalt des Briefumschlages zu inspizieren, der noch in der Mappe gewesen war. Er enthielt eine handgeschriebene zusammengefaltete Notiz. Überrascht zog sie den Zettel heraus und faltete ihn auseinander. Eine Buchungsbestätigung für einen sechswöchigen Intensivspanischkurs, ein Zugticket nach Puerto Montt und einen Kreditkartenchip samt ECOS-Logo auf den Namen Esmeralda Parador fielen ihr entgegen. Auf dem Zettel stand in feinsäuberlicher Schrift eine Adresse in Puerto Montt. Das sah nach einem Appartement aus. Also kein Hotel. Sie musste lächeln. Der Erzbischof hatte wirklich an alles gedacht. Weitere Instruktionen gab es nicht. Es blieb ihr also selbst überlassen, wie sie sich in das Umfeld von Manfredo Cortez y Diega hineinarbeitete und sie wusste auch schon, wo sie anfangen würde. Sobald sie lange genug untergetaucht war und annähernd perfekt Spanisch sprach, würde sie in den Norden von Chile reisen. Das Bild einer schönen Frau erschien vor ihrem geistigen Auge, Lisa von Waldrow-Pagini.
Alienalarm in Worthing
Seit ein paar Wochen gab es eine Arbeitsgruppe innerhalb des britischen MI6, die sich um Ramirez Estar kümmern sollte und um Maxim Grey, der sich wieder einmal ins Fettnäpfchen gesetzt hatte. Der Syrische Geheimdienst war bezüglich des jungen Mannes richtiggehend penetrant geworden und das hatte die Formulierungskünste des Außenministers und die politischen Beziehungen beider Länder arg strapaziert. Schließlich konnten sie sich darauf einigen, dass für beide Männer ein Einreiseverbot erteilt wurde. William Samford seufzte vernehmlich bei dem Gedanken daran, wieviel Ärger die beiden ihm bereitet hatten. Ursprünglich hatten sie Ramirez Estar und Maxim Grey in Margate verhaften wollen, was dann allerdings gründlich schiefgelaufen war. Dass Syrien im Fall Estar so schnell eingewilligt hatte es bei einem Einreiseverbot zu belassen, zeigte ihm deutlich, dass eine Beteiligung des Mannes an den Anschlägen in Syrien nur ein Vorwand gewesen war, um ihn verhaften zu können. Was dann allerdings hinter der ganzen Aufregung steckte, hatte er leider nicht herausfinden können. Auch die Befragung des Kapitäns des Frachtschiffes, der seine Hände in Unschuld gewaschen hatte, hatte nichts erbracht. William Samford war sich aber von Anfang an sicher gewesen, dass der Kapitän gelogen hatte. Keiner der seine sieben Sinne beieinander hatte, wäre bei so einem Wetter freiwillig in ein Ruderboot gestiegen, noch dazu im Ärmelkanal. Leider hatte er keine Handhabe gegen den Kapitän gehabt und Ramirez Estar war ihnen nun endgültig entkommen. Dass die Beiden ihre abenteuerliche Flucht vor der südenglischen Küste überlebt hatten, grenzte an ein Wunder. Selbst die Küstenwache war der festen Meinung gewesen, dass die See viel zu rau dafür war, es mit einem Ruderboot an Land zu schaffen. Und doch war es so.
William Samford bedauerte es fast. Nicht weil die Beiden noch lebten, sondern weil er jetzt diesen ganzen Mist am Hals hatte. Hätten die beiden Männer nicht das seltsame Goldstück eingetauscht, dann hätten sie niemals mitbekommen, dass die Beiden ihr haarsträubendes Abenteuer überlebt hatten und er hätte den Fall zu den Akten legen können. Jetzt saß Maxim Grey in einer Verwahrzelle des MI6. Leider wollte Maxim Grey partout nichts über Ramirez Estar preisgeben. Am Ende hatte er Major Eleanor Hunt von der Special Force Unit ENU, einer Spezialabteilung der CIA, um Hilfe bitten müssen, da sich die Briten und die Kanadier seit den Ereignissen in den 2050er Jahren immer noch nicht sonderlich gut verstanden. Bedauerlicherweise hatte ihn auch das kein Stück weitergebracht und seit Tagen traten sie nun schon mit ihren Ermittlungen auf der Stelle. Ramirez Estar war in den Weiten des kalten kanadischen Nordens verschwunden, obwohl die CIA interveniert hatte. Der Kanadische Geheimdienst hatte allerdings seine eigene Meinung zu dem Fall und sich deshalb auf stur gestellt. Das war sogar so weit gegangen, dass der britische Botschafter vom kanadischen Premierminister einbestellt worden war, der sich vehement gegen die Ausspioniererei in seinem Land verwahrt hatte.
William Samford seufzte noch einmal innerlich gequält und wünschte sich, Postbote geworden zu sein oder Bäcker oder irgendetwas anderes Harmloses. Der einzige Trost für ihn war, dass nun nicht einmal die CIA wusste, wo der Kerl abgeblieben war und die wussten doch sonst immer alles. Und mit diesem neuen Vorfall in Worthing wuchs ihm das Ganze langsam aber sicher über den Kopf. Alienalarm in Worthing, einem kleinen Ort an der südenglischen Küste. Ein ALIENALARM! Das war das Abenteuerlichste, das er in den letzten Tagen gehört hatte, mit Ausnahme des Gerüchtes, dass Ramirez Estar ebenfalls ein Außerirdischer sein sollte und das weitere Aliens gesichtet worden waren. Das aber hatte ihm die Majorin nur hinter vorgehaltener Hand erzählt.
Die Ereignisse in Worthing, einem kleinen Ort an der englischen Südküste, waren da schon greifbarer. Gestern Nachmittag hatten die Nachbarn einer gewissen Familie Longley die örtliche Polizei angerufen und etwas von außerirdischen Monstern gebrabbelt. Zum Beweis hatten sie ein selbstgedrehtes Video von einem Jungen vorgelegt, der den Mut gehabt hatte sich nach draußen zu wagen und hinter Büschen versteckt seine Minidrohne loszuschicken, um die Aufnahmen zu machen. Der Junge war immer noch völlig geschockt von dem was er gesehen hatte und befand sich jetzt in ärztlicher Behandlung. Leider war das Video schon im Netz bevor das Verteidigungsministerium überhaupt etwas von der Sache mitbekommen hatte, da die Kamera mit dem Onlineaccount des Jungen gekoppelt war und den Stream automatisch abgesetzt hatte. Seine Experten hatten nun alle Hände voll zu tun die Spuren im XNet zu tilgen und Dementis für die aufgeregte Bevölkerung zu formulieren. Von höchster Stelle war der Presse ein Maulkorb verpasst worden, aber das hatte nicht wirklich funktioniert. Die Nachrichtensender stürzten sich auf den Fall wie die Schmeißfliegen auf einen Hundekothaufen. Am liebsten hätte William Samford einfach alle Nachrichtensender lahmlegen lassen, aber so einfach war es leider nicht. Wenn es wahr war, was in Worthing geschehen war, konnte das der Anfang von etwas wirklich Schlimmem sein. Noch war er nicht bereit, es einfach zu glauben.
William Samford gähnte übermüdet. Seit Tagen hatte er nicht mehr richtig geschlafen und einen richtigen Urlaub hatte er seit einem Jahr nicht mehr gehabt. Warum mussten denn alle immer so früh morgens bei ihm anrufen? Um sechs Uhr früh, zu nachtschlafender Zeit quasi, hatten sie ihn aus dem Bett geholt, um ihn nach Worthing zu jagen. Hätte das nicht noch warten können? Der Vorfall war doch sowieso schon zwölf Stunden alt. Da wäre es doch auf eine Stunde mehr auch nicht angekommen, in der er hätte etwas frühstücken können. Jedoch war die örtliche Polizei so aufgeregt, dass das Verteidigungsministerium sofort reagieren musste. Und dann war sprichwörtlich die Hölle über ihn hereingebrochen.
Nach einem kurzen Flug mit dem Hubschrauber stand er nun fassungslos vor dem Grundstück der Familie Longley und starrte in den tiefen Krater, der anstelle eines kleinen englischen Hauses die Lücke zwischen anderen Häusern füllte. In der Realität sah es noch übler aus, als in dem Video des Jungen. Ein scharfer eigenartiger Brandgeruch lag über dem Gelände und es war unnatürlich still. Selbst die Vögel waren von hier verschwunden. Prüfend zog William Samford die Luft ein. Sie roch leicht nach Gas. Vielleicht war es doch ein Gasleck, das das Haus in die Luft gejagt hatte. Ganz glaubte er diese Geschichte von einem Alienangriff immer noch nicht, zumindest redete er sich das ein. Sie war ihm einfach zu weit hergeholt. Aufnahmen konnten gefälscht werden. Die jungen Leute waren geschickt im manipulieren. Vielleicht wollte der kleine Kerl sich nur aufspielen. Warum sollte ausgerechnet an diesem kleinen Ort an der Südenglischen Küste Aliens auftauchen? William Samford wusste die Antwort, aber er wollte sie nicht akzeptieren und zog es im Augenblick vor sich selbst zu belügen. William Samford sah sich um, es war Zeit mit den Nachbarn darüber zu sprechen, was sie gesehen hatten. Erwachsene dachten sich meistens nicht so abenteuerliche Geschichten aus. Sie würden ihm erzählen, was wirklich passiert war. William Samford war fest entschlossen, sich keinen Bären aufbinden zu lassen. Aber sollte die Geschichte tatsächlich stimmen, dann konnte er nur froh sein, dass Ramirez Estar nach Kanada entkommen war und er ihn nicht festnehmen musste. Denn wer immer diese angeblichen Außerirdischen waren, sie suchten nach dem Mann und schreckten vor nichts zurück. Das bewies der Krater im Boden inmitten von Worthing. Aber das würde er trotzdem erst glauben, wenn die Echtheit des Streams erwiesen war. Mit verkniffener Miene machte er sich auf den Weg zum ersten Haus, das irgendwie verloren am Abgrund des tiefen Lochs stand, so als hätte es Angst hineinzustürzen.
Eine Stunde später, nachdem William Samford ausführlich mit den Nachbarn der Longleys gesprochen hatte, musste er zugegeben, dass die Aufnahmen wohl echt waren. Ein wenig bleich und ziemlich nachdenklich ging er zurück zum Hubschrauber, der etwas außerhalb von Worthing auf einem freien Feld auf ihn wartete. Die Aussagen waren alle gleich und entsprachen im Wesentlichen dem, was der Junge gefilmt hatte. Aliens, die aussahen wie aufrecht gehende Schlangenkrokodile. Müde strich er sich über die Augen, froh, dass er nicht hier gewesen war, als diese Monster in Worthing ihr Unwesen getrieben hatten. Das war ja grässlich. Er sollte möglichst schnell mit der Majorin telefonieren und sich mit ihr Treffen und er sollte schleunigst die gesamte Familie Grey in Gewahrsam nehmen, denn die hatten ebenfalls Kontakt mit Ramirez Estar gehabt. Rasch rief er im Hauptquartier an und veranlasste, dass der Vater von Maxim Grey in Sicherheitsverwahrung gebracht wurde.
Als er in London ankam, wartete der Unternehmer mit seinem Sohn bereits in einem der oberirdischen Besucherräume des Hauptquartieres des MI6 auf ihn. Gabriel Grey protestierte anfangs vehement gegen die Maßnahme, aber nachdem William Samford ihm die Situation erklärt hatte, war er damit einverstanden für ein paar Wochen zusammen mit seinem Sohn ein Zimmer in einem der Erholungszentren des MI6 im Norden von Schottland zu beziehen. Die beiden Greys waren erstaunlich schnell dazu bereit gewesen, die Geschichte über die Aliens zu glauben. Das überraschte ihn, hatte er doch fest damit gerechnet, dass sie ihn für verrückt erklären würden. Erleichtert sah William Samford den beiden nach, die, eskortiert von zwei Männern der Schutzwache, in eine mit dunkel getönten Scheiben versehene Limousine stiegen, die sie nach Schottland bringen würde. Eine Aktion mitten in London wie in Worthing hätten sie auf keinen Fall mehr vertuschen können. Wenn William Samford geahnt hätte, was noch alles auf ihn zukommen würde, dann hätte er mit Sicherheit den Dienst quittiert.
Defektes Terminal
Das Andockmanöver des Shuttles an die Orbitalstation SPACEGULL hatte länger gedauert, als geplant. Esmeralda Parador spurtete durch die Ankunftshalle, um noch ihren Anschlussflug zur Orbitalstation SILVERCONDOR zu erreichen. Sie war spät dran. Wenn sie den verpasste, musste sie hier oben übernachten und das wollte sie auf keinen Fall. Erstens hatte sie das Gefühl, dass sie so schnell wie möglich in Chile untertauchen sollte, denn der Vatikan hatte ausgezeichnete Beziehungen zur europäischen Raumfahrtbehörde in Darmstadt, die für die Orbitalstationen zuständig war. Zweitens war es enorm teuer in einem der Minizimmerchen ein Bett zu bekommen. Sie hatte das einmal machen müssen und in einer dieser Röhren mit Bett und Waschgelegenheit, viel mehr waren die Hotelzimmer nicht, übernachten müssen. Das reichte ihr für den Rest ihres Lebens. Schweratmend vom schnellen Laufen drückte sie sich durch die Menschenmenge in der Abflughalle, die erstaunlich voll war. Der Aufruf für ihren Flug kam nun schon das zweite Mal. Hoffentlich wurde sie nicht noch mit Namen aufgerufen. Entschuldigungen murmelnd schob sie ein knutschendes Pärchen aus dem Weg, das zwischen ihr und dem Check in-Computer stand. Rasch steckte sie ihren Chip in das Lesegerät und wartete auf die Freigabe, doch nichts geschah. Verwirrt betrachtete sie den Computer. Hatte der Vatikan es etwa doch noch geschafft, ihren Flug sperren zu lassen. Das war doch unmöglich, denn dafür gab es doch gar keine Rechtsgrundlage. Verwirrt betrachtete sie den Automaten. Was hatte sie falsch gemacht. Ihr Blick fiel auf die blinkende Laufschrift auf dem schmalen Display des Gerätes.
DEFEKT – BITTE GEHEN SIE ZUM TERMINAL 7.
Schimpfend steckte sie ihren Chip wieder ein und sah sich um. Wo war dieses blöde Terminal? Endlich entdeckte sie es am anderen Ende der Halle. Jetzt musste sie den ganzen Weg wieder zurück, dorthin wo sie hergekommen war.
»Mist, hätten die das nicht schon während des Fluges durchsagen können?«, grummelte sie leise. Den ganzen Weg also wieder zurück. Mühsam zwängte sie sich erneut durch die Menschenmenge. Zum Glück war sie nicht so klein, so konnte sie wenigstens sehen was am Transfergate zu den Ankunftsflügen vor sich ging. Zwei Uniformierte der Europäischen Raumfahrtbehörde erschienen am Durchgang zur Passkontrolle für die Flüge nach Italien und blickten suchend über die Menge. Esmeralda Parador zog unwillkürlich den Kopf ein. Rasch holte sie ihr Kopftuch aus der Tasche und band es sich um. Ein wenig Tarnung konnte nicht schaden. So schnell wie möglich eilte sie weiter zum Terminal 7, während die Männer zu dem defekten Check in-Automaten unterwegs waren. Das konnte kein Zufall sein. Die wollten sie abfangen! Mit zitternden Fingern steckte sie den Chip in den Schlitz. Es summte leise, die Schleuse zum Abflugbereich öffnete sich. Ihr Flug war gerade in der Abfertigung. Erleichtert sah sie zu, wie die Schleuse sich hinter ihr schloss. Ein paar Minuten später war sie an Bord der Maschine, die sie hinüber zu einer der beiden südlichen Orbitalstationen bringen würde. Solange der Vatikan in den nächsten Stunden nicht herausfand, unter welchem Namen sie reiste, war sie sicher. Sie sollte sich darüber keine Gedanken machen, denn die Organisation arbeitete in diesem Punkt sauber und niemand wusste, dass sie einen neuen Namen hatte. Selbst wenn irgendeine Kamera eine Aufnahme von ihr gemacht haben sollte, würde diese gelöscht werden. Im Verwischen von Spuren waren sie gut, sonst hätten sie niemals ihre Arbeit tun können. Trotzdem würde sie, sobald sie in Chile gelandet war, selbst noch ein paar Viren ins Netz schicken, die sämtliche Informationen über sie vollends eliminieren würden.
Einige Stunden später landete sie wohlbehalten auf dem Flughafen Arturo Merino Benítez in Santiago de Chile, der einige Kilometer außerhalb des Zentrums der von einigen Millionen Menschen bevölkerten Metropole lag. Der Transfer in die Orbitalstation SILVERCONDOR und von dort zurück auf die Erde war reibungslos verlaufen. Niemand war ihr gefolgt oder hatte nach ihr gefragt. Erleichtert verließ sie das Flughafengelände, warf noch einmal einen Blick auf das atemberaubende Panorama der Anden, die Santiago de Chile mit weißgekrönten schroffen Spitzen umschlossen, bevor sie in den Bus stieg, der sie in die Innenstadt bringen würde. Das Ticket dafür hatte sie selbstverständlich bar bezahlt. Die Alameda Bernardo O´Higgins führte einmal quer durch die halbe Stadt, vorbei an bunt gestrichenen Jugendstilfassaden. Die Strecke, die der Bus nahm, gab ihr einen lebendigen Eindruck vom Alltagsleben in Santiago. Eine Besichtigungstour der Extraklasse. Leider hatte sie für mehr keine Zeit, obwohl sie gerne ein paar Tage geblieben wäre um auf den Cerro San Cristóbal zu fahren oder im Viertel Bellavista in einem der gemütlichen Restaurants etwas zu essen. Es war besser für sie die Stadt sofort wieder zu verlassen und weiter in den Süden des Landes zu reisen. Im Kleinen Süden von Chile war sie noch nie gewesen. Puerto Montt war angeblich sehr schön. Die ganze Gegend dort wurde auch die chilenische Schweiz genannt. Esmeralda Parador war ziemlich gespannt auf die kleine Stadt, die gerade einmal um die 140.000 Einwohner hatte. Früher waren es etwas mehr gewesen, aber in den Chaosjahren war das Wetter so unbeständig geworden, dass viele weiter nach Norden gezogen waren. Trotzdem sah Puerto Montt wohl fast noch so aus, wie um die Jahrtausendwende. Sie würde es bald wissen. Erstaunlicherweise hatte der gestiegene Meeresspiegel kaum Auswirkungen auf die Stadt gehabt, was wohl nicht zuletzt daran lag, dass sich das Gelände nach einem großen Erdbeben etwas angehoben hatte.
In Los Héroes, wo der Flughafenbus endete, nahm Esmeralda Parador die Metro und fuhr bis zur Station Universidad de Santiago. Dort befand sich das Abfahrtterminal für die Züge in den Süden Chiles. Nachdem sie sich noch ein letztes Mal umgesehen hatte, stieg sie in den Zug und suchte sich ihren Platz. Ihre Kollegen von der Organisation hatten die Zeit genau richtig eingeschätzt. Es dauerte nur ein paar Minuten, bis der Zug losfuhr. Erleichtert lehnte sie sich in ihrem Sitz zurück und betrachtete durch das Fenster die vorüberhuschende Landschaft. Schade, dass der Zug in Temuco endete. Den Rest bis Puerto Montt musste sie mit dem Überlandbus fahren. Aber alles in allem sollte es für sie möglich sein in Puerto Montt anzukommen, ohne Spuren zu hinterlassen.
Haarsträubender Anflug
Von all dem hatte Ullisten Getrillum, der immer noch seinen irdischen Decknamen Ramirez Estar benutzte, in den Weiten des kanadischen Nordens kaum etwas mitbekommen. Vielleicht hätte er sich eine neue Identität zulegen sollen, aber die Erfahrung mit dem Mann, der sich "Boss" nannte, reichte ihm eigentlich. Und jetzt war nicht einmal Maria Lautner da, um ihm zu helfen. Die Monate, die er zusammen mit Serge Massin über die Eisstraßen gefahren war, hatten deutliche Spuren bei ihm hinterlassen. Er fühlte sich gehetzt und müde und sehnte sich nach einem Ort, an dem er ein wenig Ruhe finden konnte. Kein Wunder, dass er schon lange nicht mehr auf die täglichen Katastrophenmeldungen achtete, über die die irdischen Nachrichtensender täglich berichteten. Auch auf dem Weg nach Chile war er so mit seiner Flucht beschäftigt gewesen, dass er den Gerüchten über Alienattacken nur mit einem Ohr zugehört hatte, die sich die Matrosen auf dem Frachtschiff erzählt hatten, das ihn nach Antofagasta gebracht hatte. Möglicherweise lag es daran, dass er im Gegensatz zu Menschen keine Probleme mit der Existenz von Außerirdischen hatte und für ihn die Tatsache, dass sich auf der Erde angeblich Aliens herumtrieben keine Sensation war. Natürlich würden die Adschirr´arr nicht einfach aufgeben, schließlich wollten sie das Siegelstück haben und sie wollten ihn finden. Sichtungen blieben da also nicht aus, zumal sich diese räudigen Kanny nicht gerne zurückhielten, was sie aber erstaunlicherweise taten. Irgendetwas musste in der Liga los sein, dass die Adschirr´arr diesen Planeten noch nicht überrannt hatten. Immerhin hatten sie in den ersten fünf Jahren auf frisch entdeckte Sternensysteme umfangreiche Kaperrechte. Zu dumm, dass er seinen Kommandanten, Manri Rubellicum, nicht erreichen konnte. Ullisten Getrillum hing noch eine Weile seinen düsteren Gedanken nach, während er auf das Boarding wartete.
Es war bereits später Nachmittag, als das Shuttle endlich startklar war, das sie zur Orbitalstation SILVERCONDOR bringen sollte. Soweit ihn sein neuer Arbeitgeber Los Morrenos informiert hatte, sollten sie dann von dort in einem anderen Shuttle zum Mond weiterfliegen. Ullisten Getrillum hob den Kopf in den Nacken und starrte angespannt in den langsam dunkler werdenden Himmel hinauf. Der Tag neigte sich bereits dem Ende zu. Ullisten Getrillum kniff die Augen zusammen. Weit oben am türkisblauen Firmament konnte er einen winzigen Punkt erkennen. Es war die Orbitalstation. Für menschliche Augen war sie ohne Hilfsmittel nicht zu erkennen, aber für seine verbesserten Sehkräfte schon. Er löste den Blick wieder von dem grauglänzenden Fleck, da das nicht viel brachte. Stattdessen suchte er angestrengt die Umgebung nach Verfolgern ab, aber es viel ihm nichts auf. Der Stress der letzten Tage, das Eingesperrtsein auf dem Frachtschiff, die ständige Ungewissheit, ob er seine Jäger hatte abschütteln können, hatte ihn ganz schön geschlaucht. Dazu noch die haarsträubenden Untersuchungen im Firmenlabor, die seine Nerven ebenfalls ziemlich strapaziert hatten. Wenn er richtig darüber nachdachte, dann war er nur noch auf der Flucht gewesen, seit er diesen Planeten betreten hatte. Es wurde Zeit, dass er ein sicheres Versteck fand. Hoffentlich hatte er auf dem Mond seine Ruhe vor seinen Verfolgern.
Einige der wartenden Passagiere eilten an ihm vorbei. Ullisten Getrillum sah ihnen nervös hinterher, entspannte sich aber gleich wieder. Auf der Aussichtsplattform des Zentralgebäudes dieses winzigen Flughafens in der chilenischen Atacamawüste gab es ein einfaches Teleskop, das in einer Ecke montiert war. Die Fluggäste scharten sich aufgeregt um das astronomische Gerät, jeder wollte einmal hindurchsehen. Ullisten Getrillum überlegte kurz, ob er sich der Traube von Menschen anschließen sollte, ließ es aber dann sein. Da nicht alle Menschen danach gierten sich die Raumstation durch ein Teleskop anzuschauen, würde er nicht auffallen, wenn er es bleiben ließ. Neugierig musterte er die Reisenden, die ebenso wie er auf den Abflug des Shuttles warteten. Die meisten waren Arbeiter der Mine, was ihn nicht verwunderte, gehörte der Raumhafen doch Los Morrenos. Aber es gab auch ein paar Geschäftsreisende, Touristen und welche, die aussahen wie Wissenschaftler. Sie alle wollten zur Orbitalstation SILVERCONDOR, die in einer geostationären Umlaufbahn langsam ihre Kreise um die Erde zog. Es gab noch drei weitere Stationen, die sich auf festgeschriebenen Bahnen synchron zueinander im Orbit auf einer Höhe von etwa 300 Kilometern bewegten und den Passagiertransfer für die anderen Kontinente abwickelten. Es gab sogar Querflüge von einer Station zur anderen, was Ullisten Getrillum bei dem technologischen Stand den die Menschheit erreicht hatte für eine erstaunliche Leistung hielt. Dabei bedienten die Orbitalstationen SILVERCONDOR und DIDGERIDOO die südlichen Erdteile, während SPACEGULL und ICECUBE für die nördliche Hemisphäre zuständig waren.
Ullisten Getrillum konnte sich noch gut an die Orbitalstationen erinnern, da er bei seiner Ankunft auf diesem Planeten an ihnen vorbeigeflogen war. Die vier Stationen waren ziemlich bizarre Gebilde und hingen wie große silbrig glänzende Quallentiere vor dem samtschwarzen Hintergrund des Alls. Ihre Sonnensegel, mit denen sie Energie erzeugten, zogen sie hinter sich her wie die giftigen, massenhaft in den irdischen Ozeanen beheimateten Nesseltiere ihre Tentakel. Die Sonnensegel bestanden aus filigranen Netzen, die dem Beschuss der aggressiven Raumstrahlung und winzig kleinen Teilchen aus Staub, menschlichem Abfall und Meteoritenstückchen kaum standhalten konnten. Die Techniker waren ständig damit beschäftigt, die Schäden zu reparieren, primitive krabbelnde Roboter an ihrer Seite, die ihnen einen Teil der lebensgefährlichen Aufgabe abnahmen.
Die Sonne stand schon tief, als sich Ullisten Getrillum zusammen mit den anderen fünfzig Arbeitern vor dem Abflugschalter des Miniraumhafens für das Boarding anstellte. Die anderen Passagiere, kleine sich bewegende schwarze Punkte auf dem rissigen Rollfeld, waren bereits abgefertigt worden und bestiegen gerade das Shuttle. Dieser Raumhafen tief in der Atacama Wüste war eine Farce in seinen Augen. Er war nicht mehr als eine Start- und Landebasis für die regelmäßig verkehrenden Shuttles von und zur Erzmine auf dem Mond und für ein paar wenige Passagiere, die, aus welchen Gründen auch immer, diesen abgelegenen Flughafen benutzten. Die Gesellschaft, für die er in den Eingeweiden des Mondes nach den begehrten Rohstoffen graben sollte, war stolz auf ihre Shuttles. Sie waren angeblich nach den neuesten technischen Erkenntnissen gebaut worden und galten unter den Menschen als die sichersten ihrer Art. Wie mochten dann erst die Shuttles anderer Fluggesellschaften aussehen? Er wollte lieber nicht darüber nachdenken. Wohl war ihm bei der Sache ohnehin nicht, doch er hatte keine andere Wahl.