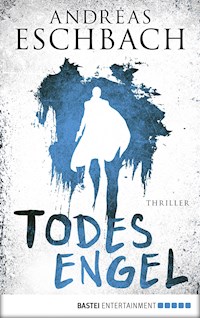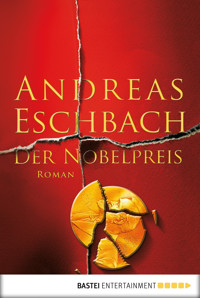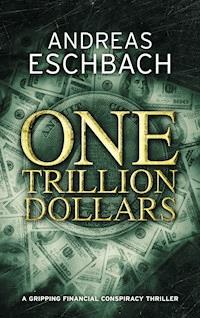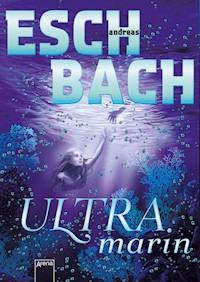
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Aquamarin-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Ein erschütterndes Zukunftsszenario von Bestseller-Autor Andreas Eschbach. Und ein Meermädchen, das für das Überleben der Menschheit an ihre Grenzen geht. 2152: In den Tiefen der Weltmeere braut sich eine große Gefahr zusammen. Denn nach Jahrzehnten der Genforschung sind die Submarines, die Wassermenschen, nun bereit, für die Alleinherrschaft über ihren Lebensraum zum Äußersten zu gehen und gegen die Menschen zu kämpfen… Saha, halb Meermädchen, halb Mensch, weiß, sie hat keine Wahl: Sie muss ihr Schicksal annehmen und als Mittlerin zwischen Wasser- und Luftmenschen den großen Krieg verhindern. An Bord der Segeljacht "Ultramarin" beginnt ein rasanter Wettlauf gegen die Zeit. Ein Wettlauf, der nicht nur beide Völker, sondern auch die ganze Welt in den Abgrund reißen könnte! Mit seinen Erwachsenenromanen ist Andreas Eschbach neben Frank Schätzing und Sebastian Fitzek einer der erfolgreichsten deutschen Belletristikautoren. Zuletzt erschien sein brisanter Roman "NSA", der einen großen Erfolg verzeichnen konnte. "Ein großes Lesevergnügen!" - Die Rheinpfalz "Andreas Eschbach legt erneut einen spannenden Thriller vor, der jugendliche und erwachsene Leser nicht aus der Lektüre entlässt, bevor die letzte Zeile gelesen ist." - BuchMarkt "Andreas Eschbach kreiert eine pralle, fantasievolle und zugleich gesellschaftskritische Welt für Jung und Alt." - Kölner Stadtanzeiger Die "Meermädchen-Saga" im Arena Verlag: Aquamarin (Band 1) Submarin (Band 2) Ultramarin (Band 3)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Andreas Eschbach
Ultramarin
Weitere Bücher von Andreas Eschbach im Arena Verlag:
Aquamarin
Submarin
Black*Out
Hide*Out
Time*Out
Perfect Copy
Die seltene Gabe
Gibt es Leben auf dem Mars
Das Marsprojekt – Das ferne Leuchten (Band 1)
Das Marsprojekt – Die blauen Türme (Band 2)
Das Marsprojekt – Die gläsernen Höhlen (Band 3)
Das Marsprojekt – Die steinernen Schatten (Band 4)
Das Marsprojekt – Die schlafenden Hüter (Band 5)
1. Auflage 2019
© Arena Verlag GmbH, Würzburg
Alle Rechte vorbehalten
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Einbandgestaltung: Juliane Lindemann unter Verwendung einer Illustration von Mia Steingräber
Reihenkonzept Umschlaggestaltung: Frauke Schneider
E-Book-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmund, www.readbox.net
E-Book ISBN 978-3-401-80834-5
Besuche uns unter:
www.arena-verlag.de
www.twitter.com/arenaverlag
www.facebook.com/arenaverlagfans
www.andreaseschbach.de
1
Ich tue so, als würde ich den Hubschrauber nicht hören. Er ist noch weit entfernt, und vielleicht hat es auch gar nichts mit mir zu tun, dass er da draußen herumfliegt. Schließlich befinden wir uns in Seahaven, einer Küstenstadt. Es gibt tausend Gründe, aus denen hier ein Hubschrauber unterwegs sein kann.
Wir schreiben Donnerstag, den 25. Mai des Jahres 2152. Dieses Datum habe ich gerade in ein neues Dokument getippt, das die Hälfte des Bildschirms auf meiner Tafel belegt. In der anderen Hälfte habe ich die Fragen der Großen Prüfung in Chinesisch vor mir, die wir heute schreiben und vor der ich die letzten sechs Wochen gezittert habe. Und nicht nur gezittert: Heute früh war mir richtiggehend schlecht – bis die Prüfungsaufgaben verteilt worden sind. Dann ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, der ein mittleres Erdbeben hätte auslösen müssen, denn meine Gebete wurden erhört: Alle Aufgaben stammen aus den paar klassischen Texten, auf die ich vorbereitet bin.
Mit anderen Worten, ich habe Chancen, die Prüfung zu bestehen. Vielleicht nicht glänzend, aber gut genug, um den Abschluss zu schaffen.
Vorausgesetzt, dieser Hubschrauber hat wirklich nichts mit mir zu tun. Zwar kann ich die Prüfung nachholen – tatsächlich wäre es nicht das erste Mal, dass ich eine versäumte Prüfung nachhole –, aber so geniale Fragen werde ich nie wieder kriegen.
Ich tue also so, als würde ich nicht bemerken, dass der Hubschrauber näher kommt. Es gibt tausend Gründe … na gut, vielleicht nicht tausend, aber jedenfalls eine Menge Gründe, aus denen sich ein Hubschrauber der Stadt nähern kann, ohne dass es etwas mit mir zu tun haben muss.
Zum Beispiel, weil …
Mir fällt gerade kein Grund ein, aber das liegt daran, dass ich mich auf die Prüfung konzentriere und schreibe, so schnell ich kann. Am liebsten würde ich die Spracheingabe benutzen und alles heraussprudeln, was ich gelernt habe. Das wäre am einfachsten, aber aus naheliegenden Gründen ist die Benutzung der Spracheingabe in Prüfungen verboten.
Der Hubschrauber kommt immer näher. Jetzt gucken die anderen schon auf. Ich sehe es aus den Augenwinkeln, aber ich tue so, als würde ich auch das nicht bemerken.
Es ist, wie gesagt, eine Große Prüfung. Im Abschlussjahr müssen wir in jedem Fach zwei Große Prüfungen ablegen, zu denen Prüfer der Schulkommission anreisen und vor denen die Lehrer fast genauso viel Bammel haben wie wir: Dies ist die erste, im November startet die zweite Runde, und dann … Ja, dann werden wir den Abschluss entweder geschafft haben oder nicht.
Ich bin eigentlich eine gute Schülerin. Das heißt, früher war ich es, als ich noch nichts anderes zu tun hatte, als zu lernen. Doch seit ich die Mittlerin bin, die für die Verständigung zwischen den Luft- und den Wassermenschen sorgen soll, ist alles anders. Ich habe viel weniger Zeit, und außerdem fällt es mir viel schwerer als früher, mich auf den Schulstoff zu konzentrieren. Wenn man an dem einen Tag eine Besprechung mit Zonenräten, Welträten und Konzernführern hat, dann kommen einem am nächsten Tag Dinge wie Integralrechnung, die Stoffkreisläufe in der Atmosphäre oder Protolysegleichgewichte in wässrigen Lösungen irgendwie nicht wirklich wichtig vor.
Und abgesehen von all dem, war Chinesisch noch nie meine Stärke. Egal, wie viele dieser Bildzeichen ich mir ins Hirn hämmere, es sind nie genug.
Nur heute – heute sind es genug. So eine Chance werde ich nie wieder kriegen, deswegen schreibe ich, so schnell ich kann.
Während der Hubschrauber immer näher kommt und immer lauter wird.
Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie die Prüferin stehen bleibt und verwundert aus dem Fenster späht. Es eine kleine, streng wirkende Frau mit scharfen Falten um die Mundwinkel, die bis gerade eben unablässig durch die Reihen getigert ist. Frau Chang, unsere Chinesischlehrerin, die sich mit undurchdringlichem Gesichtsausdruck hinter ihrem Pult verschanzt hat, gibt der Prüferin ein Zeichen, zu ihr zu kommen, was die Frau auch tut.
Ich will weiterschreiben, will fertig werden, aber ich muss einfach hingucken. Die beiden beugen sich über Frau Changs Tafel und flüstern miteinander, und ich fürchte, ich weiß, worüber.
Die Prüferin nickt, greift nach ihrer eigenen Tafel – und im nächsten Augenblick werden unsere Tafeln alle schwarz.
Allgemeines Aufstöhnen.
»Wir müssen kurz unterbrechen!«, sagt die Prüferin, nein, sie ruft es, um den Lärm des sich nähernden Hubschraubers zu übertönen. »Ihr bekommt die Zeit natürlich nachher wieder.«
Dann sagt Frau Chang: »Saha?«
Nichts von dem, was sie mir danach sagt, überrascht mich. Das ist alles schon mehr als einmal da gewesen. Diesmal ist es die Seepolizei, die meine Hilfe braucht, und es ist wie immer ungeheuer dringend.
Ich könnte heulen. Ich helfe ja gerne, aber muss es ausgerechnet heute sein?
»Du darfst die Prüfung selbstverständlich zu einem späteren Zeitpunkt nachholen«, fügt Frau Chang hinzu.
Die Prüferin nickt, wenn auch säuerlich: Kein Wunder, denn das heißt, sie wird meinetwegen noch einmal von Carpentaria anreisen müssen.
Ich heule natürlich nicht, aber ich habe auch noch kein Wort herausgebracht. Irgendwie macht es mich fertig, dass ich inzwischen nicht einmal mehr gefragt werde. Man braucht mich, also holt man mich – als wäre ich irgendein Gerät, das man für den Bedarfsfall im Schrank aufbewahrt.
Ich schaue mich um. Alle blicken sie mich an, alle meine Klassenkameraden, von denen die meisten früher kaum ein Wort mit mir gewechselt haben, dieselben, die heute stolz sind, in derselben Klasse zu sein wie Saha Leeds, das Mädchen, das unter Wasser atmen kann, die Botschafterin der Submarines, die jüngste Politikerin der Welt. Und das sind bloß drei von tausend Schlagzeilen, die inzwischen über mich getextet worden sind.
Da ist zum Beispiel Annmarie. In ihren türkisfarbenen Augen leuchtet nicht nur blanker Neid, sondern auch Bewunderung. So hat sie früher Carilja Thawte angehimmelt, die lange so etwas wie die ungekrönte Prinzessin von Seahaven war. Nun ist Carilja weg, und ich werde das Gefühl nicht los, dass Annmarie mit mir genau das gleiche Spiel spielen würde, wenn ich mich darauf einließe.
Da ist Danilo, ein gläubiger Anhänger der Prinzipien des Neotraditionalismus. Er sieht mich an, als könne er es immer noch nicht fassen, dass der Zonenrat jemandem wie mir, einem gentechnisch veränderten Menschen, erlaubt, weiterhin in Seahaven zu leben. Vermutlich kann er es tatsächlich nicht fassen. Was wohl wäre, wenn er wüsste, dass ich sogar an Besprechungen des Zonenrats teilnehme?
Da ist Pigrit, einer der besten Schüler unserer Klasse und mein bester Freund. Er hat mir damals geholfen, das Geheimnis meiner Herkunft zu enträtseln; ohne ihn wäre ich heute nicht die, die ich bin. Er und ich haben die letzten Wochen gemeinsam für diese Prüfung gebüffelt, und es ist nicht schwer zu erraten, warum er mich so fassungslos anschaut: Weil es absoluter Wahnsinn ist, jetzt zu gehen. Heute werde ich lauter Dinge gefragt, die ich weiß – was mit anderen Worten heißt, dass ich in der Nachholprüfung lauter Dinge gefragt werde, die ich nicht weiß!
Im Gegensatz zu Judith, die in allen Fächern beste Noten schreibt und natürlich auch mit dieser Prüfung keinerlei Probleme haben wird. Ihr Blick ist durchdringend, voller Anerkennung, weil ich mich für die Submarines einsetze, und zugleich voller Verwunderung, warum ausgerechnet ich es bin, die nun weltberühmt ist, und nicht sie. Das hat sie auch einmal gesagt: dass ich meine Position nur dem Zufall meiner Abstammung verdanke und nicht eigener Leistung.
Und damit hat sie sogar recht. Dass mein Vater ein Submarine war und meine Mutter eine Luftmenschenfrau, dass ich ein Mischling zweier Menschenarten bin – dafür kann ich nichts. Ich habe lange darunter gelitten, anders zu sein als andere, das schon. Aber zu leiden ist auch keine Leistung. Dass ich unter Wasser so gut atmen kann wie an der Luft, dass ich sogar der einzige bekannte Mensch bin, der mühelos zwischen beiden Medien wechseln kann – das hat niemand vorher wissen können. Und dass die Submarines eine Legende haben, wonach in einer Zeit der Bedrängnis eine Mittlerin auftreten wird, und dass sie in mir diese Gestalt sehen, ist einfach nur ein völlig verrückter Zufall.
So verrückt, dass ich es in manchen Momenten selber nicht glauben kann. Sechzehn Jahre lang war ich das hässliche Entlein, die Ausgestoßene. Sechzehn Jahre lang war ein schöner Tag für mich einer, an dem ich nicht beachtet wurde – und heute spreche ich mit Politikern, Zonenräten, Richterinnen, führenden Wissenschaftlern, und das, was ich sage, kommt in den Nachrichten. Ist es da ein Wunder, dass ich manchmal denke, es ist alles nur ein wilder Traum, und eines Morgens wache ich auf und alles ist wieder, wie es immer war?
Der Punkt ist: Ich will nicht, dass es wieder aufhört. Ich will nicht, dass es wieder vorbei ist. Und ganz bestimmt will ich nicht, dass es je wieder so wird, wie es davor war; das würde ich nicht mehr ertragen, nun, da ich gesehen habe, wie es anders sein kann.
Und deshalb werde ich alles tun, damit der schöne Traum nicht endet, egal, wie anstrengend er sein mag.
Also packe ich meine Tafel ein, stehe auf und sage: »In Ordnung. Vielen Dank.« Gleich darauf eile ich durch die verlassenen Flure der Schule. Der Hubschrauber setzt zur Landung an, das Dröhnen seiner Triebwerke erfüllt das gesamte Gebäude und macht jetzt jeden Unterricht unmöglich. Die Rektorin hat mich höchstpersönlich darum gebeten, dass ich mich beeile, wenn einer meiner »Einsätze« ansteht, wie sie es nennt.
Ich beeile mich auch. Die Flure mögen verlassen daliegen, niemand mich sehen, aber mir kommt es trotzdem so vor, als seien die Augen all meiner Mitschüler auf mich gerichtet, und das ist mir immer noch unangenehm. Ich betaste meine Umhängetasche. Habe ich alles dabei, was ich brauchen könnte? Ja. Seit solche Aktionen immer häufiger werden, gehe ich nie ohne die nötige Ausrüstung aus dem Haus.
Das wievielte Mal heute ist, weiß ich gar nicht; ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Die ersten Male waren grandios, das gebe ich zu; ich bin mir vorgekommen wie die Präsidentin des Weltrats höchstpersönlich. Alle haben geschaut, gestaunt, mich hinterher ausgefragt … doch, das war sensationell.
Aber inzwischen nervt es, ehrlich gesagt. Vor allem, dass man mich so herumkommandiert. Das scheint etwas zu sein, dass ich nie loswerde, egal, was ich mache.
Ich erreiche das Hauptportal und trete ins Freie. Der Hubschrauber ist auf der Plattform gelandet, die eigentlich für Krankentransporte gedacht ist. Seine Rotorblätter drehen sich langsam im Leerlauf. Ein Mann in der Uniform der Seepolizei steigt aus, duckt sich unter dem Rotor weg und kommt mir bis ans obere Ende der Treppe entgegen.
Ich eile über den Schulhof. Würde ich mich umdrehen, würde ich eine Menge Mitschüler sehen, die sich an den Scheiben die Nase platt drücken und zusehen, deswegen vermeide ich es, mich umzudrehen. Die Treppe, das sind nur ein paar Stufen, dann stehe ich vor dem Mann, der zackig salutiert.
»Leutnant Xi«, stellt er sich vor und gibt mir die Hand. »Ist mir eine Ehre, Miss Leeds.«
»Danke«, sage ich laut, um die Maschine zu übertönen. »Wohin geht es?«
»Methanmine Daru-7«, erwidert er. »Rund zwei Stunden Flug.«
Er begleitet mich zum Hubschrauber und passt auf, dass ich meinen Kopf unten halte. Das machen sie immer, obwohl ich gar nicht groß genug wäre, um mit den Rotorblättern in Kontakt zu kommen. Er verpasst mir einen Helm mit Ohrschützern und Sprech-Set, hilft mir, mich anzuschnallen, und schwingt sich dann neben den Piloten. Die Tür fährt zu, die Maschinen heulen auf und im nächsten Moment heben wir ab und rasen in nördlicher Richtung davon.
2
Mir gegenüber sitzt ein Mann, den ich zuerst auch für einen Seepolizisten halte und nicht weiter beachte. Stattdessen verrenke ich mir den Hals, um aus dem schmalen Fenster neben meinem Sitz zu schauen und unseren Flug zu verfolgen.
Doch das wird schnell langweilig, denn man sieht nur grau wogendes Wasser. Ich bemerke, dass der Mann wohl doch kein Polizist ist. Er trägt Zivilkleidung, einen seltsamen Anzug, der aussieht, als sei er aus Luftpolsterfolie, und natürlich dieselbe Ohrschützer-Sprech-Set-Kombi wie ich.
»Guten Tag«, sagt er und beugt sich vor, wodurch sein Gesicht aus dem Schatten kommt. Er hat etwas von einer Grinsekatze; einen breiten Mund, eine riesige Nase und eine hohe Stirn. »Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Ron Van Gilder. Ich bin Journalist für das Westpazifische Netzwerk – sagt dir das was?«
»WPN?« Ich nicke. »Habe ich schon gesehen.« Das ist eins der großen Nachrichten-Netzwerke; es versorgt die Zonen von Sibirien über die chinesische und ostindische Küste bis nach Australien.
»Ich mache eine Reportage über die Methanminen und wie sie mit den Submarines zurechtkommen«, erklärt er weiter und sein Grinsen wird immer breiter. »Und da wir gerade zusammensitzen und die nächsten zwei Stunden nichts zu tun haben – wie wär’s mit einem Interview?«
So richtig sympathisch ist er mir nicht und ich hätte nichts dagegen, zwei Stunden lang nichts zu tun, aber ich fühle mich verpflichtet, Ja zu sagen. Es könnte eine Gelegenheit sein, wichtige Dinge über die Submarines klarzustellen, und das ist schließlich mein Job.
Er zückt ein handgroßes Gerät mit einer großen Linse auf der Vorderseite und fragt: »Ist es in Ordnung, wenn ich das aufnehme?«
»Ja klar«, sage ich und hoffe, dass ich nicht zu genervt klinge.
Er braucht eine Weile, bis er die Tonaufnahme mit dem Sprech-Set gekoppelt hat, dann stellt er seine Fragen. Es sind keine besonders originellen, sondern lauter Dinge, die ich schon hundert Mal gefragt worden bin, beginnend damit, wann und wie ich denn meine »Gabe« entdeckt hätte?
Also erzähle ich ihm zum hundertundersten Mal meine Geschichte. Wie man mir mein Leben lang gesagt hat, die Schlitze an den Seiten meines Brustkorbs seien Verletzungen aus der Kindheit, die nicht heilen wollten. Wie ich vor einem guten halben Jahr von gehässigen Mitschülern ins Wasser geworfen worden bin – ich bin in Versuchung, Cariljas Namen zu nennen, verkneife es mir aber – und in der Folge gemerkt habe, dass die Schlitze in Wirklichkeit Kiemen sind und dass ich unter Wasser atmen kann: Wäre es anders gewesen, ich wäre durch Cariljas Attacke gestorben.
Viel zu erzählen gibt es auch über die Probleme, die diese Entdeckung mit sich gebracht hat. Künstliche Veränderungen des Erbguts, wie man sie in den freien Zonen sehen kann, sind im Neotraditionalismus streng verboten. Wären meine Eltern für meine Gabe verantwortlich gewesen, hätte ich die Zone sofort verlassen müssen.
Doch meine Eltern, das ist ein Thema für sich. Meine Mutter ist gestorben, als ich vier Jahre alt war, und über meinen Vater habe ich nie etwas erfahren. Erst durch heimliche Recherchen, bei denen mir mein bester Freund Pigrit und dessen Vater, der berühmte Historiker James William Bonner, geholfen haben, bin ich darauf gestoßen, dass mein Vater ein Submarine namens Geht-hinauf war. Nicht ich bin genetisch manipuliert worden, vielmehr gehen die Submarines, die Wassermenschen, auf einen koreanischen Wissenschaftler namens Yeong-Mo Kim zurück, der sie vor über hundert Jahren erschaffen hat. Und weil das so ist, hat sich der Zonenrat schließlich überzeugen lassen, dass meine Existenz nicht gegen die Regeln verstößt.
»Die Existenz der Submarines wurde also lange Zeit als Geheimnis gehütet?«, hakt Van Gilder nach.
»Ja. Nur eine geheime Organisation von Helfern, die Gipiui Chingu, die von Anfang an über die Wassermenschen gewacht haben, wusste darüber Bescheid.« Ich zögere, ehe ich hinzufüge: »Und irgendwann sind auch die Tiefseekonzerne dahintergekommen.«
Er geht nicht darauf ein, sondern fragt: »Du hast dich dann auf die Suche nach deinem Vater gemacht, hast über zwei Monate unter Wasser mit den Submarines gelebt und schließlich das Geheimnis auf reichlich spektakuläre Weise gelüftet – wieso?«
»Weil einige der Tiefseekonzerne einen regelrechten Krieg gegen die Submarines begonnen hatten«, sage ich und wundere mich, dass ich das immer noch gefragt werde. »Sie wollten die Submarines ausrotten, ehe sich die Frage stellt, ob sie vielleicht irgendwelche Rechte auf die Tiefsee haben.«
»Und? Haben sie das?«
Er scheint keine Ahnung zu haben, was für eine komplizierte Frage das ist. »Zumindest sind es Menschen wie wir und haben folglich dieselben Rechte wie wir«, sage ich. »Zum Beispiel das Recht auf Leben. Auf Unversehrtheit. Die ganze Bandbreite der Menschenrechtskonvention.«
»Na ja«, meint er gedehnt und grinst dabei, »also ganz so wie wir sind sie ja nicht …«
»Sie stellen eine verwandte Spezies dar«, sage ich und tippe mir auf die Brust. »Verwandt genug, dass Mischlinge möglich sind.«
Sein Grinsen erlischt. Ich nehme das als Punktsieg.
»Du bist«, fährt er fort, »seither berühmt. Eine Heldin für viele. Für dich hat sich die ganze Sache also gelohnt.«
Ich mustere ihn skeptisch und frage mich, worauf er hinauswill. Irgendwie scheint er mich aufs Glatteis führen zu wollen. »Ich habe es nicht deswegen gemacht«, sage ich vorsichtig. »Ich habe Freunde unter den Submarines gefunden und die wollte ich beschützen.«
Aber seine Frage sitzt wie ein Giftstachel in mir. Denn es stimmt ja, dass es sich für mich gelohnt hat, wenn man es unbedingt so sehen will. Ich führe ein völlig anderes Leben als vorher. Ich habe einen Lover – das allein ist schon etwas, von dem ich zuvor nicht einmal zu träumen gewagt habe. Ich bin berühmt, kann man sagen, wobei das auch seine Nachteile hat. Vor allem aber habe ich das Gefühl, endlich, endlich, endlich meinen Platz im Leben gefunden zu haben.
Aber dass ich dieses neue Leben mit der Öffentlichmachung der Submarines erkauft habe, ist lächerlich. Was alles passieren würde, konnte ich doch nicht ahnen! Und das war auch nicht der Grund, warum ich es getan habe. Der Grund war, dass ich keine andere Möglichkeit mehr gesehen habe, das Morden im Pazifik zu beenden.
»Stimmt es, dass du jetzt einen Freund hast?«, fragt er weiter. »Einen Lover, wie man bei euch in der Zone sagt?«
Muss ich darauf wirklich antworten? Das wird mir allmählich zu privat.
»Ja«, sage ich. Ich knurre es eher, aber ich fürchte, solche Feinheiten gehen im System der Sprech-Sets und im Dröhnen der Turbinen unter.
»Ihr lebt zusammen?«
Wen interessiert denn das? »Ja.«
»Bei deiner Tante Mildred?«
»Nein. Wir haben eine eigene Wohnung.« Er soll bloß meine Tante aus dem Spiel lassen; die hat in der ganzen Geschichte schon genug durchgemacht. Und sie hat mich großgezogen, als wäre ich ihre eigene Tochter.
Ich muss ihm ein bisschen Futter hinwerfen, damit er zufrieden ist, also füge ich hinzu: »Ich arbeite hin und wieder für diverse Organisationen – wie heute zum Beispiel für die Seepolizei –, und dafür bekomme ich eine Wohnung gestellt.«
Irgendwie werde ich nie wirklich begreifen, wie diese Nachrichtenleute ticken. Die ganze Welt weiß inzwischen, dass ich einen Freund habe – aber dass dieser Freund ein Mischwesen ist, genau wie ich, ist ihnen bislang völlig entgangen. Der einzige Unterschied: Bei ihm war die Mutter eine Submarine und der Vater ein Luftmensch. Noch nicht einmal, dass er sechs Finger an jeder Hand hat, ist ihnen aufgefallen. Wenn sie erst wüssten, dass er ein Prinz ist!
Von mir werden sie das jedenfalls nicht erfahren. Und Sechsfinger selbst ist ein Meister im Wahren von Geheimnissen.
»Ist es eine schöne Wohnung?«, bohrt Van Gilder weiter.
Es ist ein Traum von einer Wohnung, doch auch das geht diesen selbstgefälligen Kerl nichts an. »Ich bin zufrieden«, sage ich. »Sie liegt direkt über der besten Bäckerei von Seahaven, das heißt, ich werde morgens vom Duft frischer Brötchen geweckt. Was kann man sich mehr wünschen?«
In diesem Moment bemerke ich, dass der Hubschrauber langsamer wird und tiefer geht, und bin unsagbar erleichtert. Ich spähe aus dem Fenster. Tief unten sehe ich eine graue Plattform, die aus den Wellen ragt, und auf der sich das grell leuchtende H eines Hubschrauber-Landeplatzes ausmachen lässt.
Wir sind da. Endlich!
Der Hubschrauber schwankt, hat in dem heftigen Wind Schwierigkeiten zu landen. Doch dann setzen wir auf, das Dröhnen der Turbine erstirbt und wir dürfen aussteigen. Wie immer nach einem Hubschrauberflug habe ich das Gefühl, taub zu sein.
Eine Frau in der Uniform der Seepolizei wartet schon auf uns. Ich kenne mich mit den Dienstgraden immer noch nicht aus, aber ich sehe ziemlich viele goldene Streifen auf ihrem Schulterstück, also dürfte sie die Chefin hier sein.
»Captain Morauta«, stellt sie sich vor und schüttelt mir die Hand. »Danke, dass du kommen konntest.«
»Keine Ursache«, sage ich und versuche, dabei nicht an die verpasste Chance bei der Chinesischprüfung zu denken.
Während sich ein Team um den Hubschrauber kümmert, führt sie uns – klappe-di-klong – über eine angerostete Gitterstahltreppe abwärts. Es geht in ein riesiges Büro, in dem riesige Meereskarten auf einem riesigen Tisch liegen. Dort kommt sie gleich zur Sache.
»Gestern Nachmittag wurde eins der Datenkabel gekappt, die zwischen der Mine und dem Festland verlaufen«, erklärt sie uns. »Es ist nicht das erste Mal, dass das passiert, aber als unsere Techniker an die betroffene Stelle gekommen sind, haben sie bemerkt, dass ein Schwarm Submarines in der Nähe lagert. Ich hoffe, sie sind noch da. Wir möchten, dass du Kontakt mit ihnen aufnimmst und fragst, wer für das Kappen des Kabels verantwortlich ist und welche Beweggründe dahinterstecken.«
Es ist schon erstaunlich: Vor einem halben Jahr war die Existenz der Submarines noch ein sorgsam gehütetes Geheimnis – doch kaum ist allgemein bekannt, dass es sie gibt, tauchen sie plötzlich überall auf.
Vielleicht war es doch kein so großes Geheimnis, wie die Leute von der Gipiui Chingu immer gedacht haben.
Auf jeden Fall stimmt es, dass die Sache eilig ist. Ich habe selbst miterlebt, wie schnell ein Schwarm ein Lager wieder aufgeben und weiterziehen kann: Das ist oft nur eine Angelegenheit von Minuten.
»Ja«, sage ich. »In Ordnung.«
»Das Wetter ist ein bisschen, hmm … unfreundlich. Ich hoffe, das ist kein Hindernis?«
Ich schüttle den Kopf. »Unter Wasser merkt man davon nichts.«
Sie wirft mir einen eigenartigen Blick zu, in dem ich ein gewisses Befremden lese. Obwohl sie als Seepolizistin ständig mit Tauchern und Tiefseearbeitern zu tun hat, scheint es ihr unheimlich zu sein, dass jemand ohne technische Hilfsmittel ins Meer hinabgehen kann.
»Haben Sie einen Verdacht, Captain, wer hinter dem Anschlag steckt?«, fragt Van Gilder mit seiner schnarrenden Stimme.
Nun ist er es, der ihren befremdeten Blick abbekommt. »Wir vermuten«, sagt sie spitzlippig, »dass es Submarines waren.«
Noch während er verwirrt dreinschaut und offenbar überlegen muss, was sie ihm damit sagen wollte, drängt sie zum Aufbruch. Es geht zu einer anderen Tür hinaus, aber als der Journalist uns folgen will, verwehrt sie es ihm. »Ab hier nur Frauen«, sagt sie, gibt einem im Hintergrund wartenden Wachmann einen Wink, sich um Van Gilder zu kümmern, und führt mich dann eine weitere Treppe hinab, die auf einer schwimmenden Anlegestelle endet.
Ein bulliges kleines Boot wartet auf uns und tatsächlich sind nur drei Frauen an Bord, die Steuerfrau, eine Maschinistin und eine junge Matrosin. Als ich mich erkundige, ob das einen besonderen Grund hat, meint Captain Morauta: »Nun, wenn ich recht informiert bin, musst du dich ausziehen, um tauchen zu können, oder? Unnötig, dass Männer dabei zusehen.«
»Ah«, mache ich. Als jemand, der in einer neotraditionalistischen Zone aufgewachsen ist, verblüfft es mich immer wieder, was für seltsame Reaktionen ein unbekleideter weiblicher Oberkörper bei manchen Leuten auslöst. Bei uns läuft im Sommer die Hälfte der Frauen halb nackt am Strand herum, ohne dass es je irgendjemanden gestört hätte oder die Männer deswegen seltsam würden.
Aber in diesem Fall ist es mir ganz recht, dass mir dieser Ron Van Gilder nicht zusehen wird; der war ohnehin schon viel zu aufdringlich.
Wir steigen ein, die Leinen werden losgemacht, dann brausen wir davon. Die Wellen sind heftig, wir müssen uns regelrecht vorwärtskämpfen, und ich fange an, mir Sorgen zu machen, wie ich später wieder zurück an Bord kommen soll. Wir sitzen schräg hinter der Steuerfrau und können auf einem Monitor verfolgen, wie sich ein roter Punkt – das sind wir – allmählich einem blauen Kreuz nähert, der für das Zielgebiet steht.
Als wir fast da sind, zeigt Captain Morauta auf eine Tür und meint: »Dadrin kannst du dich umziehen.«
Das tue ich, aber ich muss aufpassen, mir keine blauen Flecken zu holen. Der Seegang ist inzwischen derart heftig, dass es mich beim Ausziehen zwischen den Wänden der kleinen Kammer hin und her wirft. In meine Bikinihose zu schlüpfen, ist ein Kunststück für sich.
Als ich wieder herauskomme, trage ich nur diese Hose und meinen kleinen Rucksack, den ich immer auf meine Tauchgänge mitnehme. Mein Anblick scheint Captain Morauta nervös zu machen. Sie reicht mir hastig ein großes Handtuch und sagt, schon fast im Befehlston: »Häng dir das um. Es ist kalt.«
Ich wickle mich gehorsam ein, obwohl mir Kälte nie viel ausgemacht hat. Wir haben den Zielpunkt so gut wie erreicht. Draußen mühen sich die beiden anderen Frauen damit ab, eine Außenbordleiter anzubringen.
»Ich denke, ich geh dann mal los«, schlage ich vor.
Captain Morauta begleitet mich hinaus. Als ich das Tuch ablege, nimmt sie es und sagt: »Wir warten hier auf dich.«
»Danke«, sage ich, steige auf die Leiter und lasse mich ins Wasser gleiten.
Ich durchstoße die graue, wild bewegte Wasseroberfläche. Wie oft habe ich diesen Übergang schon vollzogen? Ich könnte es beim besten Willen nicht mehr sagen. Inzwischen fällt es mir ganz leicht. Ich habe beim Eintauchen ausgeatmet, und nun atme ich Meerwasser ein, lasse mich davon durchströmen, spüre, wie die letzten Bläschen Atemluft durch die Kiemen entweichen. Ab jetzt atme ich keine Luft mehr, sondern Wasser, ganz genau so, wie Fische es tun.
So haben mich die Medien auch schon genannt: Saha, das Fischmädchen.
Ich schüttle den Gedanken ab und tauche tiefer. Oben, in der Nähe des Bootes mit seinem starken Methanmotor, schmeckt das Wasser scheußlich, nach Ammoniak, nach Desinfektionsmittel, ungefähr so, als würde ich das Abwasser aus dem Chemiesaal der Schule trinken. Deswegen mache ich eine Rolle, sodass ich kopfüber im Wasser schwebe, und tauche dann mit ein paar kräftigen Schwimmzügen abwärts. Ab einer gewissen Tiefe sinke ich von alleine, es sei denn, ich erzeuge Luft in mir, um die Schwerkraft durch Auftrieb auszugleichen.
Die Farben schwinden rasch. Der Himmel ist bewölkt, das heißt, es fällt nicht allzu viel Licht aufs Wasser, und noch weniger davon dringt bis in die Tiefe vor. Während ich weiter und weiter in eine Welt aus Grautönen hinabtauche, denke ich an die Farbenpracht zurück, die ich bei meinen allerersten Tauchgängen erlebt habe. Aber das war im November und Dezember, in den Sommermonaten also, während sich inzwischen, Ende Mai, allmählich die Regenzeit ankündigt. In Seahaven gibt es reiche Leute, die sich demnächst für einige Monate in ihre Ferienhäuser in der neotraditionalistischen Zone in Europa verabschieden werden, wo um diese Zeit Sommer ist.
Ein paar silbrig schimmernde Fische nähern sich, scheinen mich neugierig zu beäugen, immer darauf bedacht, sich außerhalb meiner Reichweite zu halten. Ich kann nicht erkennen, um welche Art es sich handelt; es gibt viele Fischarten, die so aussehen. Und nach einer Weile schlagen sie alle gleichzeitig einen Haken und sausen davon.
Ich halte inne, lausche, schmecke das Wasser. Es gibt allerlei Spuren, an denen man erkennen kann, dass sich Submarines in der Nähe aufhalten, und nach und nach habe ich gelernt, sie zu deuten. Kindergeschrei ist zum Beispiel ein deutliches Zeichen, und ich höre etwas, das so klingt. Es ist noch ein Stück entfernt, denn Schall trägt unter Wasser weit, aber die Richtung ist klar auszumachen.
Etwa zehn Meter über dem Meeresgrund schwimme ich weiter und präge mir dabei den Weg ein, den ich nehme, damit ich später auch zum Boot zurückfinde.
Nach etwa zwanzig Minuten mache ich vor mir die ersten Bewegungen aus, die eindeutig nicht so aussehen wie die von Fischen, und kurz darauf erreiche ich das Lager des Schwarms.
Wie immer empfangen mich die Submarines freundlich, neugierig, arglos. Das, was wir »gesundes Misstrauen« nennen, ist den meisten von ihnen fremd. Kinder sausen kichernd um mich herum. Frauen beäugen mich verwundert, weil ich gar keinen Schmuck trage und meine Haare mir nur bis kurz über die Schultern gehen. Männer wollen wissen, wieso ich keinen Speer bei mir habe als Kundschafterin. Als ich anfange zu erklären, dass meine Mutter ein Luftmensch war, wissen sie aber plötzlich alle Bescheid.
Du bist die Mittlerin!, erzählen sie mir strahlend und mit zwei Dutzend Händen zugleich. Wir haben schon von dir gehört.
Ich staune mal wieder. Die Ozeane sind riesig und die Zahl der Submarines entspricht höchstens der Bevölkerung einer Stadt wie Rockhampton: Trotzdem verbreiten sich manche Dinge in Windeseile.
Ja, lasse ich meine Hände sagen. Mein Name ist Von-oben und ich bin die Mittlerin. Ich habe euch Geschenke mitgebracht, aber gekommen bin ich, weil ich euch etwas fragen muss.
Das finden sie in Ordnung – sofern wir mit den Geschenken anfangen. Ich winde mich aus meinem winzigen Rucksack, der dank seiner seltsam dreieckigen Form und genialen Trageriemen so dicht am Körper sitzt, dass ich ihn unterwegs kaum bemerke. Die Submarines lachen, als sie mir dabei zusehen. Das bin ich mittlerweile gewöhnt, ich lache einfach mit.
Dann packe ich mein Bündel aus. Es ist eins der Pakete, die mir die Organisation der Gipiui Chingu zur Verfügung stellt, mit Geschenken, die bei den Submarines immer willkommen sind. Zuerst bringe ich zwei Messer zum Vorschein, richtige, gute Tauchermesser inklusive einer Halterung, mit der sie sich gefahrlos an den Gurten anbringen lassen, mit denen die Submarines ihre Lendenschurze befestigen.
Leuchtende Augen um mich herum. Ich gebe die Messer der Schwarmältesten, einer stämmigen, verknittert aussehenden Frau. Sie nickt wohlwollend und reicht die Messer dann weiter, an zwei breitschultrige Männer, zweifellos die besten Jäger des Schwarms.
Dann kommen die farbigen Glasperlen an die Reihe, die ich direkt an die Frauen und Mädchen verteile, die mir gierig die Hände entgegenstrecken – aber auch einige Männer sind darunter. Ich verteile, was ich habe, so gerecht wie möglich, und sowieso geht gleich danach ein großes Handeln und Tauschen los.
Zum Schluss habe ich noch ein paar Blister mit Medikamenten dabei, wasserresistente Kautabletten, wie sie auch Taucher verwenden. In diesem Schwarm ist es ein älterer Mann, der die Funktion des Heilers ausübt, ein magerer, sanft lächelnder Mann namens Kleiner-Finger. Warum er so heißt, verstehe ich nicht, denn seine Hände sehen ganz normal aus. Er hat sogar prächtige Schwimmhäute und muss in jungen Jahren ein guter Schwimmer gewesen sein. Ich erkläre ihm, welche Tabletten gegen Darmkrankheiten sind, welche gegen hohes Fieber und welche gegen Entzündungen, wie sie nach Verletzungen vorkommen können.
Dann endlich sind wir so weit, dass ich meine Fragen stellen kann. Ich muss ausholen, herausfinden, was sie wissen. Dass sich in der Nähe eine Mine befindet, ein Bauwerk der Luftmenschen, das ist ihnen bekannt. Wie viele Schwärme suchen auch sie manchmal solche Orte auf in der Hoffnung, Abfälle aus Metall zu finden. Metall ist sehr begehrt bei den Submarines.
Dann erkläre ich, dass Leitungen aus Metall zwischen dem Festland und der Mine verlaufen und dass eine dieser Leitungen gekappt worden ist.
Das waren Graureiter!, erzählen sie sofort. Wir haben sie gesehen.
Ich muss unwillkürlich seufzen. Das habe ich befürchtet.
Wie sahen sie aus?, frage ich.
Daraufhin haben sie viel zu erzählen. Vier Graureiter waren es, sagen sie, die auf zwei Pottwalen gekommen sind. Und dass sie ihre Haare zu Zöpfen geflochten getragen haben.
Das ist leider keine sonderlich nützliche Information, denn Graureiter – die richtigen Graureiter, die, die wirklich Wale reiten – tragen alle solche Zöpfe. Sechsfinger trägt auch immer noch einen solchen Zopf, obwohl er seit drei Monaten an Land lebt. Schließlich ist er der Prinz der Graureiter; eine andere Art, die Haare zu tragen, käme ihm überhaupt nicht in den Sinn.
Und dann?, frage ich. Was genau ist passiert?
Die Graureiter sind dem Verlauf der Leitung gefolgt, entnehme ich ihren Schilderungen. Es sah aus, als hätten sie sich sorgfältig überlegt, an welcher Stelle sie zuschlagen wollten. Dann sind sie abgestiegen und haben das Kabel mit einem »Metall« der Luftmenschen durchtrennt: Sie versuchen, mir verständlich zu machen, wie dieses Werkzeug ausgesehen hat, und ich vermute, dass die Graureiter eine Kneifzange oder einen Seitenschneider bei sich gehabt haben, zweifellos Diebesgut aus einem anderen Raubzug.
Und dann, fügen sie hinzu, haben sie sich versteckt und gewartet, bis die Luftmenschen gekommen sind.
Versteckt?, frage ich verwundert zurück. Wie denn? Wie versteckt man einen Wal?
Allgemeines Gelächter. Dann erzählen sie es noch einmal genauer. Es sind nur zwei der Graureiter geblieben, die anderen beiden sind mit den Walen abgezogen. Die, die geblieben sind, haben sich hinter einem Felsen oberhalb des Kabels versteckt und gewartet. Dann kam eine Maschine der Luftmenschen: ein Tauchboot wohl, wie es Wartungstechniker verwenden. Als die Reparatur beendet und das Tauchboot wieder verschwunden war, sind die Graureiter davongeschwommen, in dieselbe Richtung, die auch die Wale genommen haben.
Mehr finde ich nicht heraus. Das muss eben reichen.
Aber zum Schluss stelle ich die Frage, die ich allen Submarines stelle, denen ich zum ersten Mal begegne: Ich suche meinen Vater. Er war ein Submarine namens Geht-hinauf – kennt ihn jemand von euch?
Hände wirbeln los, so viele und so wild, dass ich der Diskussion nicht mehr folgen kann. Schließlich meldet sich eine scheu wirkende Frau und sagt, sie habe den Namen schon einmal gehört. Geht-hinauf habe bei den Graureitern gelebt und deren König gedient, sei aber eines Tages verschwunden. Mehr wisse sie aber auch nicht, schließt sie und schlägt die Augen nieder; das sei nur etwas, das ihr ein Mann von einem anderen Schwarm erzählt habe, mit dem sie kurz zusammen gewesen sei.
Ich danke ihr, obwohl das für mich keine Neuigkeit ist. Dass mein Vater für Hohe-Stirn an Land gegangen ist, weiß ich schon seit ein paar Monaten, und dass er irgendwann spurlos verschwunden ist, auch. Ich würde gern jemanden finden, der weiß, wohin er verschwunden ist.
Ich danke euch allen, sage ich mit meinen Händen. Ihr habt mir sehr geholfen. Ich muss nun weiterziehen, aber ich hoffe, wir sehen uns eines Tages wieder.
Ich verneige mich ein letztes Mal und will mich gerade abwenden, als eine alte, etwas verrückt aussehende Frau mit einer Frisur aus Hunderten weißer Zöpfchen sich nach vorn drängt und mich am Arm packt. Warte!, sagt sie, lässt mich los und fährt fort: Mein Name ist Sieht-das-Morgen und ich sehe, dass du deinen Vater bald finden wirst. Aber sei gewarnt! Du bist in Gefahr! Und da ist ein Mann mit einem …
Sie zögert, weiß nicht recht, wie sie es beschreiben soll. … ein Metall, das den Himmel befährt, vom Wind getrieben, erklärt sie.
Die Submarines verstehen unter dem Himmel in der Regel die Wasseroberfläche, also meint sie vermutlich ein Segelboot. Ich mache die entsprechende Gebärde, aber die wiederum sagt ihr nichts.
Die anderen Submarines giggeln und grinsen. Hör bloß nicht auf sie!, meint jemand. Sie sieht Dinge, die nie passieren.
Sieht-das-Morgen lässt sich nicht irritieren. Es ist ein Mann, der die ganze Welt umfährt mit diesem … Ding. Er wird dir helfen!
Danke, gebe ich zurück und weiß nicht, was ich davon halten soll, erst recht nicht, als ich ihr schiefes Grinsen sehe. Kleiner-Finger kommt heran, legt den Arm um sie und zieht sie mit sich, und die Schwarmälteste schüttelt den Kopf. Entschuldige, Mittlerin, meint sie. Normalerweise belästigt sie Gäste nicht.
Kein Problem, erwidere ich, verabschiede mich noch einmal und mache mich auf den Rückweg.
Als ich endlich wieder im Hubschrauber sitze und es zurück nach Seahaven geht, fällt mir siedend heiß ein, dass heute ja Sechsfingers Geburtstag ist und ich den ganzen Tag kein einziges Mal daran gedacht habe.
Wir wollten nach der Schule gemeinsam auf den Markt gehen und später zusammen mit Pigrit und dessen Freundin Susanna etwas kochen. Seit es ihn wieder an Land gespült hat, steht Sechsfinger nämlich total aufs Kochen. Er liebt es, Soßen abzuschmecken, Rezepte auszuprobieren, Leute zu bewirten. Deswegen habe ich ihm auch eine besonders tolle Kochschürze zum Geburtstag gekauft.
Doch nun ist aus alldem nichts geworden. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht einmal daran gedacht habe, mich von unterwegs kurz zu melden. Alles, weil ich mich unbedingt von diesem spitznasigen Reporter interviewen lassen wollte!
Ich krame meine Tafel hervor, schalte sie ein. Aber sie findet kein Netz.
»Qĭng wèn«, beginne ich zaghaft, denn beide Piloten sind, habe ich gesehen, Chinesen. »Nă lĭ néng shàng wăng …«
»Bitte sprechen Sie Englisch«, unterbricht mich der Kopilot und er klingt etwas genervt. »Wir stammen beide aus der Freien Zone Melbourne und sprechen kein Wort Chinesisch.«
»Entschuldigung«, sage ich und frage noch einmal, was ich tun muss, um ins Netz zu kommen.
»Tut mir leid«, bekomme ich zur Antwort. »Normalerweise müssen Sie gar nichts tun, aber unser Modul ist seit ein paar Tagen defekt.«
»Danke«, sage ich, schalte die Tafel aus, versenke sie wieder in meiner Tasche und lehne mich zurück.
Mist.
3
Zum Schluss kann ich es kaum noch erwarten, dass wir endlich zurück sind. Das Dröhnen der Maschine, das ständige Schaukeln und Wackeln, wenn uns wieder eine Windböe trifft, all das reicht mir allmählich.
Schließlich gehen wir tiefer, sinken aus düsteren Wolken auf den Landeplatz hinab, von dem wir heute Vormittag gestartet sind. Die Sonne ist schon untergegangen, als ich aussteigen darf, den Helm abnehme und mich verabschiede.
Am Horizont ist noch ein Streifen silbernen Lichts zu sehen, der von sich dunkel ballenden Wolken niedergedrückt wird. Die Straßenlaternen sind gerade angegangen, glimmen in fahlem Orange, werden erst in einiger Zeit weiß leuchten. Das hat etwas mit Energiesparen zu tun, aber was genau, habe ich vergessen.
Die Stadt, die Straßen, der Abend – das alles kommt mir nach den Stunden in dem schrecklich lauten Hubschrauber unnatürlich still vor. Ich höre meine Schritte kaum. Der Asphalt ist feucht, Nebel wallt durch die Gassen, Regen liegt in der Luft. Es ist nicht unangenehm. Noch ist es relativ warm, die kühlen, richtig regnerischen Tage kommen erst im Juli.
Es ist so gut wie niemand unterwegs, als ich nach Hause schlappe. Ein einsamer Swisher rollt vorbei. Eine Frau in einem steif wirkenden Kostüm steht darauf, die missgelaunt dreinblickt und mich nicht beachtet. Vor Larry’s Deli ist gerade ein Lieferwagen ausgeladen worden und fährt mit sanft schnurrendem Motor davon, als ich näher komme.
Die Freedom Avenue ist eine von Seahavens Hauptstraßen, eine der Einkaufsmeilen. Von ihr führt eine unscheinbare, kurze Nebenstraße ab, die zur allgemeinen Verwirrung Freedom Street heißt. Dort findet man nur Miller’s Sport Shop, ein Geschäft, das Sportausrüstung verkauft, und schräg gegenüber, genau an der Ecke, eine Bäckerei namens Orin’s Oven – und über der wohnen wir.
Es ist eine hübsche kleine Wohnung, die zudem nach hinten orientiert ist, sodass wir vom Lärm der Straße so gut wie nichts mitbekommen. Viel Aussicht haben wir nicht, nur einen Blick auf die Wand des benachbarten Hauses, aber das ist uns herzlich egal. Ich merke, wie müde ich bin, als ich die Treppe hochsteige, und wie froh, als ich endlich den Schlüssel ins Schloss schieben und aufschließen kann.
Doch als ich die Tür öffne, ist alles dunkel.
Ich knipse das Licht an und rufe: »Leon?« Das ist Sechsfingers »Luftname«, wie wir sagen, den er seinerzeit von seinem Vater, dem Meeresbiologen James Farnsworth, bekommen hat.
Keine Antwort. Ich gehe die Räume ab – was rasch erledigt ist, denn wir haben nur ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche und ein winziges Bad –, dann steht fest, dass Sechsfinger nicht zu Hause ist.
An einem der Küchenstühle hängt der Einkaufskorb, den Sechsfinger immer benutzt. Seine Tafel liegt auf dem Tisch. Ich tippe sie an, aber sie ist verriegelt. Keine Nachricht also. Ich ziehe meine eigene Tafel heraus, doch noch ehe ich sie einschalte, weiß ich, dass auch keine lokale Nachricht da ist, sonst hätte ich schon das entsprechende Signal gehört.
Was hat das zu bedeuten? Ich öffne den Kühlschrank. Die Gemüsefächer sind voll. Er war also auf dem Markt und hat eingekauft, genau wie wir es vorgehabt hatten. Und nun?
Als ich mich umdrehe, sehe ich ein Stück Karton auf dem Küchenbord liegen. Es stammt von einer Schachtel, in der Nudeln verpackt waren; wir füllen sie immer in ein großes Glas um.
Wenn mir Sechsfinger eine Notiz hinterlassen will, benutzt er lieber solche Kartonstücke. Auf diesem steht, mit einem roten Farbstift geschrieben:
Du brauchst nicht nach mir zu suchen.
S.
Ein Schreck durchzuckt mich wie ein elektrischer Schlag. Mein Herz rast auf einmal, hämmert wild in meiner Brust, und meine Knie werden zittrig.
Er hat mich verlassen, schießt es mir durch den Kopf. Er hat mir schon ganz am Anfang gesagt, dass er eines Tages ins Meer zurückkehren wird, und nun hat er es getan. Weil ich an seinem Geburtstag nicht da war!
Dann halte ich inne, schließe die Augen und atme ein paar Mal tief und ruhig durch. Das ist alles Unsinn. Das würde Sechsfinger nicht tun. Nicht, ohne es vorher anzukündigen. Und nicht ohne Beistand, denn den wird er brauchen. Ich kann ohne Weiteres zwischen Luft und Wasser wechseln, aber er kann das nicht. Er hat bei seiner Mutter unter Wasser gelebt, bis er drei Jahre alt war, dann hat ein Versuch, ihn Luft atmen zu lassen, dazu geführt, dass er nicht zurück ins Wasser konnte, und er musste bei seinem Vater an Land bleiben, die Schule besuchen und so weiter. Im Alter von acht Jahren hat er einen Tauchversuch unternommen, der damit endete, dass er wieder Wasser atmete – und nicht an Land zurückkonnte. Von da an hat er wieder bei seiner Mutter gelebt, wurde schließlich der Prinz der Graureiter …
Ja, und seit knapp drei Monaten ist er nun wieder an Land. Niemand weiß, wie lange er warten muss, ehe es überhaupt einen Sinn hat zu versuchen, ins Meer zurückzukehren.
Nein, er ist nicht zurück ins Meer gegangen. Diesen Wechsel alleine und auf eigene Faust zu riskieren, könnte ihn das Leben kosten, und das weiß er.
Auf einmal ist mir klar, wo er steckt. Ich brauche ihn tatsächlich nicht zu suchen – denn ich weiß, wo ich ihn finde.
Ich lasse die Lampen in der Wohnung an, schließe nur die Tür hinter mir zu und eile los, einen Teil des Weges zurück, den ich gekommen bin, und dann hinab zum Stadtstrand. Um diese Jahreszeit und so spät am Abend liegt er dunkel und verlassen da, grau und öde, voller langer Schatten, die die Strandbalustrade im Licht der Laternen wirft.
Es hat zu regnen begonnen, ein feiner Nieselregen, warm und leicht, so als befeuchte jemand Seahaven vom Himmel aus mit der Sprühflasche. Ich gehe die kurzen dunklen Stufen der Treppe hinab auf den Sand, stapfe auf das träge anrollende Meer zu, das sich schwarzschaumig vor mir bewegt, und schaue mich um.
Dann sehe ich ihn. Die Silhouette einer Gestalt, die reglos mitten auf dem Strand sitzt, die Arme um die aufgestellten Knie geschlungen, den Kopf darauf gestützt, den Blick unverwandt auf den Ozean gerichtet.
Seahaven hat insgesamt drei Strände, von denen der Stadtstrand der kleinste und unscheinbarste ist – trotzdem ist er Sechsfingers Lieblingsort. Hier hat er schon ganze Nachmittage gesessen, einfach so. Anfangs, als noch Badebetrieb herrschte, habe ich ihn, um ihn zu necken, gefragt, ob er das tue, um den vielen nackten Mädchen zuzuschauen. Aber ich glaube, er hat gar nicht verstanden, was ich gemeint habe.
Ich gehe langsam auf ihn zu, auf einmal unsicher, ob es überhaupt richtig war, hierherzukommen und ihn zu stören. Natürlich bemerkt er mich schon von Weitem. Er hebt einladend den rechten Arm, ohne sich zu rühren, und als ich mich neben ihn auf den nassen Sand setze, drückt er mich an sich, als hätte er mich vermisst.
»Hallo«, sagt er mit seiner tiefen dunklen Stimme, bei deren bloßem Klang ich jedes Mal schwach werde.
»Hallo«, erwidere ich und habe jetzt erst das Gefühl, wirklich nach Hause gekommen zu sein.
So sitzen wir eine Weile schweigend und lauschen dem niemals endenden, langsamen Pulsschlag des Meeres. Dann sage ich: »Du warst einkaufen.«
»Ja«, antwortet er. »Auf dem Markt habe ich übrigens Frau Brenshaw getroffen. Sie hat gesagt, du sollst dringend Frau Chang anrufen. Sie wollte es dir selber sagen, aber sie hat dich nicht erreicht.«
»Ja, das Netzmodul im Hubschrauber war kaputt«, erzähle ich und überlege, was um alles in der Welt Frau Brenshaw und meine Chinesischlehrerin miteinander zu tun haben. Dann seufze ich. »Ehrlich gesagt, reicht es mir, wenn ich sie am Montag wiedersehe. Wahrscheinlich geht es um den Nachholtermin für die Prüfung. Diesmal muss ich wirklich büffeln, sonst gehe ich unter.«
Sechsfinger hebt nur kurz die Schultern und meint gleichgültig: »Ich soll es dir nur ausrichten.«
Ich mustere ihn von der Seite. Er hat doch was! »Du«, sage ich und knuffe ihn ein bisschen in die Rippen. »Es tut mir schrecklich leid, dass dein Geburtstag so untergegangen ist.«
»Mein Geburtstag?« Er schaut mich befremdet an. »Ach so. Der ist heute? Das hatte ich ganz vergessen.«
»Was? Aber wir hatten doch ausgemacht, dass Pigrit und Susanna heute zum Essen kommen!«
Er nickt. »Das weiß ich. Bloß, dass es deswegen war … Ich meine, wir treffen uns auch so oft mit denen, oder? Ohne besonderen Anlass.« Er grinst melancholisch und schüttelt den Kopf. »Ich finde Geburtstage echt nicht wichtig, Saha. Das ist für mich so ein typisches Luftmenschending, weißt du?«
Es fällt mir schwer, ihm das zu glauben, obwohl ich weiß, dass die Submarines keinen Kalender in unserem Sinne haben. »Aber du hast irgendwas«, beharre ich. »Ich sehe es dir an, Leon Farnsworth!«
Er zögert mit der Antwort. Er nimmt den Arm von meiner Schulter, richtet den Blick auf das schwarze Wogen der Wellen.
Und dann erzählt er.
Ich liebe es, wenn Sechsfinger erzählt. Er erzählt mit Worten und Gebärden zugleich, und wenn ich ihm zuhöre und zusehe, dann kommt es mir immer vor, als entführe er mich in seine Welt, in seine Gedanken und Erinnerungen. Mir ist dann, als sei ich dabei gewesen, als könne ich fühlen, was er gefühlt hat, und als wüsste ich, was genau ihm durch den Kopf gegangen ist.
Und so lässt er mich den dunklen Strand und den feinen Nieselregen vergessen; stattdessen bin ich bei ihm, wie er über den Markt schlendert, sich am Anblick des aufgetürmten Obstes erfreut, den Duft der Garstände schnuppert und das Angebot an Gemüse kritisch vergleicht. Um ihn herum ist ein buntes Treiben, in dem er mitfließt wie ein Stück Treibholz in einem quirligen Bach. Ein Gewirr von Stimmen und Diskussionen umgibt ihn, Gelächter, Kindergeschrei. Auf dem Markt herrscht meistens gute Laune. Sechsfinger liebt es, hier einzukaufen, genießt den Trubel, lässt sich Zeit. Das Einzige, was er in diesem Moment bedauert, ist, dass ich nicht bei ihm bin.
Dann kommt er an einen Stand, der noch nie da war, ein Stand, der Holzspielzeug feilbietet. Auf braunem Tuch stehen ausgesägte Tiger und Elefanten neben Pinguinen mit Rädern, gefleckte Kühe neben dicken roten Marienkäfern mit schwarzen Punkten …
Ich kann förmlich sehen, wie Sechsfingers Blick auf einen Wal fällt, einen schön geschnitzten, grau lackierten Wal, und er fühlt einen heftigen Stich in der Brust.
Mir ist sofort klar, was in ihm vorgeht: Er muss an Kleiner-Fleck denken, den jungen Pottwal, den er geritten hat, als er noch Prinz der Graureiter war. Und als er an ihn denkt, spürt er, wie sehr er ihn vermisst, wie sehr er sein altes Leben vermisst, die Jagd durch die Tiefen des Ozeans, das schwerelose Gleiten im tiefblauen Wasser, all das.
Kleiner-Fleck fehlt ihm.
Aber das ist nicht alles. Das ist nicht der Grund für den Schmerz, den er fühlt. Der Grund ist das Gefühl, etwas verpasst zu haben, etwas sehr Wichtiges.
Nämlich die Sicht.
»Die Sicht?«, wiederhole ich verblüfft.
Ich durchschaue sowieso nicht so ganz, was es mit der Beziehung zwischen einem Graureiter und seinem Wal auf sich hat, nur dass es eine sehr enge, sehr besondere Bindung ist. Aber diesen Begriff höre ich zum ersten Mal.
»Es ist schwer zu erklären«, räumt Sechsfinger ein.
Dann macht er eine Pause, eine lange, nachdenkliche Pause, die mich die Luft anhalten lässt, weil er das in jenem speziellen Ton gesagt hat, der mir verrät, dass da noch etwas kommt. Wenn ich ihn nicht unterbreche. Also warte ich.
»Eigentlich gibt es im Englischen kein Wort dafür«, sagt er schließlich und macht dabei eine Gebärde, die ich nicht kenne. »Ich sage Sicht, weil mir kein besseres Wort einfällt. Und eigentlich ist es ein Geheimnis, etwas, über das nur Graureiter untereinander sprechen.« Er holt tief und geräuschvoll Luft. »Andererseits bin ich vielleicht gar kein richtiger Graureiter, weil ich nie die Sicht gehabt habe … und du bist immerhin die Mittlerin, die uns prophezeit wurde … also ist es vielleicht doch in Ordnung, wenn ich darüber rede.«
Er klingt, als verletze er gerade ein strenges Tabu, von dem ich bis jetzt nicht einmal geahnt habe, dass es existiert.
»Die Sicht«, fährt er fort, »bedeutet, dass du siehst, was dein Wal sieht. Auch dann, wenn du ihn nicht reitest. Vor allem dann. Wenn du die Sicht hast, kannst du deinen Wal auf Erkundung schicken und alles sehen, was er in weiter Ferne sieht oder in der Tiefe …«
»Du meinst, das ist eine Art Telepathie?«, muss ich nun doch nachfragen. »So wie … Gedankenlesen?«
Sechsfinger neigt den Kopf, greift in den Sand und lässt ihn zwischen den Fingern herabrieseln. »Ja, das ist es wohl. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich weiß ja nicht einmal, wie es sich anfühlt. Die meisten Graureiter glauben, dass es von den Walen ausgeht. Dass sie uns … nun ja, dass sie uns senden, was sie sehen.«
Er reibt die Hände gegeneinander, um den restlichen Sand abzustreifen, und blickt dabei wehmütig hinaus auf das dunkel wogende Meer. »Ich hatte immer das Gefühl, dass Kleiner-Fleck und ich dicht davor waren, die Sicht zu haben. Und dann – bum. Strande ich.«
Ich schaue ebenfalls hinaus auf den nächtlichen Ozean und spüre plötzlich auch einen Schmerz.
»Ich wusste nicht, dass es dir an Land so wenig gefällt«, sage ich dann und beinahe hätte ich hinzugefügt, bei mir – aber das wäre ungerecht gewesen. Da hätte nur meine Angst gesprochen, ihn wieder zu verlieren.
»So ist das nicht«, sagt er und legt den Arm endlich wieder um mich. »Es gibt vieles, was mir am Leben an Land gefällt. Das Essen – all die verschiedenen Nahrungsmittel und Zubereitungsarten. Die Musik – na gut, manches davon. Die ganzen technischen Geräte. Ich mag es, auf einer Gasflamme zu kochen. Ich mag es, elektrisches Licht einschalten zu können, wenn es dunkel wird. Inzwischen mag ich es sogar wieder, in einem Bett zu schlafen … besonders wenn ich neben dir aufwachen kann, natürlich. Und ich mag es, Bücher zu lesen – ich hab das jahrelang nicht gemacht, aber jetzt merke ich, dass ich es richtig vermisst habe!« Er seufzt schwer. »Und trotzdem … trotzdem gehöre ich eigentlich ins Meer. Das ist mir heute klar geworden.«
»In erster Linie«, sage ich, »gehörst du zu mir.«
»Das auch«, meint er und lächelt. »Das macht es ja so schwierig!«
»Was ist daran schwierig? Wenn du eines Tages ins Meer zurückgehen solltest, dann folge ich dir eben. So einfach wirst du mich nicht los.« Ich lasse meinen Kopf auf seine Schulter fallen. »Aber da unten im Ozean ist es dann vorbei mit Spaghetti Carpentaria, das muss dir klar sein. Keine panierte Scholle mehr, keine Pommes frites, kein Erdbeereis, keine Mangobrause …«
Jetzt muss er lachen. Er drückt mich wieder ein bisschen und meint: »Schon gut. Ich bleib ja. Auch wenn Mangobrause nun wirklich kein Argument ist.«
»Du weißt halt nicht, was gut schmeckt.« Mangobrause ist mein absolutes Lieblingsgetränk, während man Sechsfinger damit jagen kann.
Er räuspert sich. »Übrigens, was das Treffen mit Pigrit und Susanna anbelangt … Wir haben natürlich alle mitgekriegt, dass du mal wieder losgezogen bist, um die Welt zu retten. Ich hab in der Pause mit den beiden geredet und wir haben das Ganze auf Samstagmittag verschoben. Sie bringen auch den Fisch mit.«
»Oh gut.« Sechsfinger hat, als wir in Seahaven angekommen sind, einen Einstufungstest machen müssen und sitzt seither in der ersten Klasse der Mittelstufe, ein erwachsener Mann zwischen lauter Zwölfjährigen. Er behauptet steif und fest, dass ihm das nichts ausmacht, aber ich habe den Verdacht, dass er es genießt, wie die Mädchen dort ihn alle anhimmeln.
Er mustert mich. »Und bei dir?«, fragt er. »Was war heute los?«
»Ach, nichts Besonderes«, sage ich. Ich erzähle ihm, wie mein Tag verlaufen ist, und während ich das tue, kommt mir die ganze Aktion vor wie eine große Zeitverschwendung. Es wäre wirklich besser gewesen, ich hätte mich geweigert. Dann hätte ich in Ruhe meine Prüfung schreiben und den Rest des Tages mit Sechsfinger Geburtstag feiern können, anstatt jetzt hier im Regen zu sitzen und allmählich durchzuweichen.
Doch als ich fertig bin, spüre ich, dass Sechsfinger aufs Äußerste beunruhigt ist.
»Du solltest so was nicht mehr machen«, meint er, dreht sich zu mir um und packt mich bei den Schultern. »Hörst du? Sag ihnen, dass du für solche Einsätze nicht länger zur Verfügung stehst.«
Ich sehe ihn verwundert an. »Wieso das denn?«
»Weil Hohe-Stirn hinter all diesen Attacken steckt!«
»Ist mir klar. Na und? Das ist halt seine bescheuerte Art, Krieg gegen die Luftmenschen zu führen.«
Sechsfinger schüttelt den Kopf. »Nein, Saha. Hinter diesen Aktionen steckt mehr. Ich kenne ihn. Er plant etwas.«
»Und was?«
»Nimm den Vorfall heute«, sagt er ernst. »Die Graureiter haben ein Kabel gekappt. Dann haben sie beobachtet, wie lange es dauert, bis jemand kommt, um es zu reparieren. Wenn sie das ein paar Mal machen, weiß Hohe-Stirn, wie solche Reparaturen organisiert sind. Und jede Wette, dass das bei dem, was er vorhat, eine wichtige Rolle spielt.«
»Und was hat er vor, deiner Meinung nach?«
»Saha«, sagt Sechsfinger in einem Ton, der mir eine Gänsehaut über den Rücken jagt. »Hohe-Stirn hat dich zum Tode verurteilt, aber du bist entkommen. Glaub nicht, dass er das auf sich beruhen lässt. Er ist der König der Graureiter. Wenn er etwas verspricht, dann hält er es, koste es, was es wolle. Ich weiß nicht, was er vorhat, aber ich kann mir nur allzu gut vorstellen, dass seine Leute das nächste Mal nicht den Unterwassertechnikern auflauern werden, sondern dir!«
4
Seine Worte treffen mich wie ein Hammerschlag. Auf einmal wird mir so kalt, dass ich zu zittern beginne.
Aber vielleicht zittere ich gar nicht vor Kälte.
Das, was er sagt, habe ich mir vorher nie überlegt, aber natürlich hat er recht. Er hat völlig recht. Hohe-Stirn ist ein Wahnsinniger, mit dem nicht zu spaßen ist. Auf einmal ist die Erinnerung wieder da, wie ich an den scharfkantigen Gerichtspfahl gefesselt hänge und mich nicht rühren, mich nicht verteidigen kann; wie sie mich zurücklassen und davonziehen, wie keiner mir hilft, keiner mir auch nur noch einen Blick gönnt, weil Hohe-Stirn es so befohlen hat. Wie dann die kleinen, gefräßigen Fische kommen, angelockt von meinem Blut, das aus Schnittwunden fließt, die ich mir an den messerscharfen Kanten zugezogen habe … Wie mir klar geworden ist, dass man mich allein und wehrlos zurückgelassen hat, damit die Haie mich fressen.
Ich muss mich ruckartig aufrichten, Sechsfingers Arm abschütteln, aufstehen. »Komm«, sage ich. »Lass uns nach Hause gehen.«
Er steht ebenfalls auf, nimmt mich an der Hand und dann stapfen wir über den dunklen, konturlosen Sand zurück zur Strandpromenade.
Eine Weile sagt keiner von uns etwas. Der Schock seiner Worte wirkt nach, lässt mich immer wieder frösteln.
»Aber«, wende ich schließlich ein, »warum sollte sich Hohe-Stirn überhaupt um jemanden wie mich kümmern? Ich meine, er hat geschworen, Krieg gegen die Luftmenschen zu führen – da hat er doch Wichtigeres zu tun, oder?«
Sechsfinger schüttelt langsam den Kopf. »Du kennst ihn nicht so gut wie ich. Glaub mir, er hat dich nicht vergessen. Er vergisst nie etwas. Oder jemanden. Und vor allem«, fügt er hinzu und drückt meine Hand fest, »darfst du nicht glauben, dass du unwichtig wärst. Das bist du nicht. Du bist die Mittlerin, vergiss das nicht.«
Ich habe das Gefühl, dass mir etwas die Luft zum Atmen abschnürt. Ja, die Submarines sehen in mir die legendäre Mittlerin, die ihre Mythen prophezeit haben – aber habe ich etwa darum gebeten, diese Rolle zu spielen?
Andererseits führe ich dieses neue, wunderbare Leben nur deshalb, weil ich diese Mittlerin bin!
Hach, ist das alles kompliziert.
Aber in einem hat Sechsfinger recht: dass er Hohe-Stirn besser kennt als ich. Der König der Graureiter hat ihn adoptiert und ihn zum Prinzen erklärt. Und diese Entscheidung, hat mir Sechsfinger einmal klargemacht, ist unwiderruflich. Hohe-Stirn würde ihn verurteilen und hinrichten, sollte er ihn je wieder zu fassen bekommen, aber er würde ihm niemals seinen Status aberkennen. Das wäre in Hohe-Stirns Weltsicht undenkbar.
»Aber«, bringe ich nach einer Weile des Schweigens zaghaft hervor, »ich kann mich nicht einfach weigern, der Seepolizei zu helfen oder den Gipiui Chingu oder den Meeresforschern … Da ich die Mittlerin bin, bin ich quasi verpflichtet zu vermitteln!«
»Schon«, gibt Sechsfinger zu. »Aber du kannst Bedingungen stellen.«
»Was für Bedingungen?«
»Bisher läuft alles immer genau so ab, wie die sich das vorstellen. Wenn sie denken, sie brauchen dich, dann schicken sie einen Hubschrauber los oder ein Boot, was auch immer, um dich abzuholen, ganz egal, was du gerade machst oder vorhast. Und du lässt alles liegen und gehst mit. Als könnte nie etwas, das du gerade tust, wichtiger sein.«
Die bloße Vorstellung, Nein zu sagen, raubt mir den Atem. »Das kann ich nicht machen. Wenn die schon einen Hubschrauber schicken, kann ich doch nicht einfach sagen …«