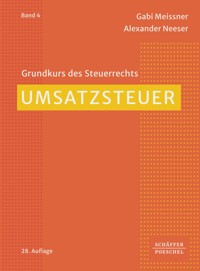
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Grundkurs des Steuerrechts
- Sprache: Deutsch
Band 4 der Reihe »Grundkurs des Steuerrechts« vermittelt die Grundbegriffe, die allgemeinen Grundlagen und die systematischen Zusammenhänge des Umsatzsteuerrechts. Ausführlich eingegangen wird unter anderem auf die Regelungen zum Lieferort und Ort der sonstigen Leistungen, die Steuerbefreiungsvorschriften, unentgeltliche Wertabgaben, Grundstücksumsätze, innergemeinschaftliche Lieferungen und die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers. Zahlreiche Beispiele, Übungsfälle, Klausuraufgaben, Prüfungsschemata und Lernkontrollen helfen beim prüfungsorientierten Erarbeiten des Stoffgebiets. Die 28. Auflage wurde hinsichtlich Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsmeinung umfassend überarbeitet und aktualisiert u.a.: Einarbeitung Finanzzweitmarktfördererungsgesetz, Wachstumschancengesetz, JStG 2024, wichtige EuGH- und BFH-Entscheidungen, BMF-Schreiben. Rechtsstand: 1. Juni 2025 Die Lehrbuchreihe »Grundkurs des Steuerrechts« bietet kompaktes Grundlagenwissen und praktische Arbeitshilfen für alle, die einen methodischen Einstieg in die unterschiedlichen Bereiche des Steuerrechts suchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 732
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
InhaltsverzeichnisHinweis zum UrheberrechtmyBook+ImpressumAutorenVorwort zur 28. AuflageAbkürzungsverzeichnisTeil A Einführung1 Bedeutung der Umsatzsteuer2 Umsatzsteuer in der Europäischen Union3 Rechtsgrundlagen des UmsatzsteuerrechtsTeil B Allgemeiner Überblick über das Umsatzsteuergesetz1 Allgemeines2 Typische Merkmale des Allphasennetto-Umsatzsteuersystems mit Vorsteuerabzug3 Anwendung des Allphasennetto-Umsatzsteuersystems mit Vorsteuerabzug in der Praxis4 Sonderregelungen für den innergemeinschaftlichen Warenverkehr5 Besteuerungsformen des Umsatzsteuergesetzes6 Ausgangsumsatzsteuer6.1 Steuergegenstand6.1.1 Umsatzart Lieferungen und sonstige Leistungen6.1.2 Einfuhr6.1.3 Innergemeinschaftlicher Erwerb7 Übersicht über die steuerbaren Umsätze8 Schema zur Lösung umsatzsteuerrechtlicher SachverhalteTeil C Umsatzart Lieferungen und sonstige Leistungen gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG1 Allgemeines2 Lieferungen3 Liefergegenstand3.1 Sachgesamtheit3.2 Vertretbare Sachen4 Verschaffung der Verfügungsmacht an einem Gegenstand4.1 Verschaffung der Verfügungsmacht (= Lieferung) bei Beförderung bzw. Versendung des Gegenstands4.2 Verschaffung der Verfügungsmacht (= Lieferung) ohne Beförderung bzw. Versendung des Gegenstands4.3 Verschaffung der Verfügungsmacht in Sonderfällen5 Lieferweg5.1 Allgemeines5.2 Reihengeschäft6 Ausführung der Lieferung im InlandTeil D Inland, Gemeinschaftsgebiet, Drittlandsgebiet1 Inland2 Büsingen3 Zollfreigebiete4 Besonderheiten5 Gemeinschaftsgebiet, übriges Gemeinschaftsgebiet und DrittlandsgebietTeil E Lieferort1 Grundsatz1.1 Ort der Beförderungs- und Versendungslieferung1.2 Ort der Lieferung bei Reihengeschäften1.3 Ort der Lieferung bei Lieferungen ohne Warenbewegung1.4 Lieferungen über eine elektronische Schnittstelle ‒ Fiktion eines Reihengeschäfts 2 Sonderregelungen nach § 3 Abs. 8 UStG und § 3c UStG2.1 Sonderregelung nach § 3 Abs. 8 UStG2.2 Sonderregelung nach § 3c UStG2.2.1 Innergemeinschaftlicher Fernverkauf (§ 3c Abs. 1 Satz 1 UStG)2.2.2 Fernverkauf mit aus dem Drittlandsgebiet über einen anderen Mitgliedstaat eingeführten Gegenständen (§ 3c Abs. 2 Satz 1 UStG)2.2.3 Fernverkauf aus dem Drittland bis 150 € (§ 3c Abs. 3 Satz 1 UStG)262.2.4 Option nach § 3c Abs. 4 und Ausschluss der Fernhandelsregelung nach § 3c Abs. 5 UStGTeil F Teilumsatzart »sonstige Leistungen«1 Begriff der Leistung2 LeistungswegTeil G Ort der sonstigen Leistung 1 Allgemeine Grundsätze1.1 Sonstige Leistung an eine Betriebsstätte (A.3 a.1 Abs. 3 UStAE)1.2 Begriff Betriebsstätte2 Verwendung einer Identifikationsnummer durch den Leistungsempfänger3 Umkehr der Steuerschuld bei Dienstleistungen4 Ausnahmeregelung nach § 3a Abs. 3 UStG beiB2B-Leistungen5 Besteuerungsverfahren bei B2B-Leistungen5.1 Nichtsteuerbare sonstige Leistung nach § 3a Abs. 2 UStG mit Leistungsort im EU-Ausland5.2 Steuerpflichtige sonstige Leistung nach § 3a Abs. 2 UStG eines im EU-Ausland ansässigen Leistenden mit Leistungsort im Inland5.3 Vorsteuerabzug der »§ 13b-Steuer«6 B2C-Leistungen (Business-to-Consumer)6.1 Leistungsort bei B2C-Leistungen6.2 Ausnahmeregelungen bei B2C-Leistungen7 Prüfungsschema für B2C-Leistungen8 Sonstige Leistungen im Zusammenhang mit Grundstücken (§ 3a Abs. 3 Nr. 1 UStG)9 Messeleistungen (vgl. A 3 a.4 UStAE)9.1 Grundstücksüberlassung9.2 Messekatalogleistungen10 Leistungsort bei kulturellen, künstlerischen, wissenschaftlichen und unterrichtenden Leistungen11 Leistungsort bei Eintrittsberechtigungen zu kulturellen, künstlerischen und ähnlichen Veranstaltungen (§ 3a Abs. 3 Nr. 5 UStG)12 Abgabe von Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle (Restaurationsleistungen)13 Vermietung/Vercharterung von Beförderungsmitteln13.1 Allgemeines13.2 Begriff Beförderungsmittel (A 3 a.5 Abs. 2 UStAE)13.3 Begriff der Vermietung bzw. Vercharterung von Beförderungsmitteln13.4 Vermietungsdauer13.5 Kurzfristige Vermietung von Beförderungsmitteln14 Beförderungsleistungen14.1 Personenbeförderungen14.2 Güterbeförderungen14.2.1 Güterbeförderungen mit Beginn im Inland/Drittland und Ende im Inland/Drittland14.2.1.1 Leistungsempfänger ist Unternehmer (B2B)14.2.1.2 Leistungsempfänger ist Nichtunternehmer (B2C)14.2.2 Steuerfreiheit der Güterbeförderung nach § 4 Nr. 3 Buchst. a UStG(A 4.3.2 Abs. 1 UStAE)14.2.3 Güterbeförderungen mit Beginn und Ende in zwei verschiedenen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftliche Güterbeförderungen)14.2.3.1 Leistungsempfänger ist Unternehmer14.2.3.2 Leistungsempfänger ist Nichtunternehmer14.2.4 Steuerfreiheit der Güterbeförderung nach § 4 Nr. 3 Buchst. a UStG(A 4.3.2 Abs. 1 UStAE)14.2.5 Innergemeinschaftliche Güterbeförderung an Nichtunternehmer14.3 Güterbeförderung mit Beginn und Ende ausschließlich im Drittland15 Arbeiten an beweglichen körperlichen Gegenständen (§ 3a Abs. 2 Nr. 3 a, Buchst. b UStG; A.3 a.6 UStAE)16 Vermittlungsleistungen17 Katalogleistungen nach § 3a Abs. 4 UStG17.1 Allgemeines17.2 Bestimmung des Leistungsorts18 TRFE-Leistungen (§ 3a Abs. 5 UStG)19 GutscheineTeil H Grundsatz der Einheitlichkeit der LeistungTeil I Werklieferungen und Werkleistungen1 Allgemeines2 Definition Werklieferung, Werkleistung2.1 Hauptstoff, Nebenstoff2.2 Begriff der Beschaffung3 Ort der Werklieferung4 Ort der WerkleistungTeil K Leistungsaustausch1 Allgemeines2 Leistung und Entgelt (Gegenleistung)3 Mehrere Beteiligte4 Wirtschaftliche Verknüpfung zwischen Leistung und Entgelt5 Fehlender Leistungsaustausch5.1 Echte Schenkung5.2 Echter SchadenersatzTeil L Die Steuerbefreiungsvorschriften bei den Lieferungen und sonstigen Leistungen (§ 4 UStG)1 Allgemeines2 Absolut zum Vorsteuerabzug berechtigende Steuerbefreiungen (§ 4 Nr. 1 ‒ 7 UStG)2.1 Allgemeines2.2 Ausfuhrlieferungen nach § 4 Nr. 1 Buchst. a UStG i. V. m. § 6 UStG2.3 Begriffsbestimmungen2.3.1 Ausland2.3.1.1 Gebiete i. S. v. § 1 Abs. 3 UStG2.3.1.2 Übriges Gemeinschaftsgebiet2.3.1.3 Drittlandsgebiet2.3.2 Ausfuhr2.3.3 Ausführer2.3.4 Ausländischer Abnehmer2.4 Ausfuhrlieferung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 UStG2.5 Ausfuhrlieferung nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 UStG 2.6 Ausfuhrlieferung nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 UStG2.6.1 Allgemeines2.6.2 Ausfuhr von Gegenständen nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 UStG2.6.3 Ausfuhr von Gegenständen zur Ausrüstung oder Versorgung eines Beförderungsmittels (§ 6 Abs. 3 UStG)2.6.4 Ausfuhrlieferungen im persönlichen Reisegepäck (§ 6 Abs. 3a UStG)2.7 Ausfuhrlieferungen im Rahmen eines Reihengeschäfts2.8 Lohnveredelung nach § 4 Nr. 1 Buchst. a UStG i. V. m. § 7 UStG2.8.1 Allgemeines2.8.2 Lohnveredelung nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 UStG2.8.3 Lohnveredelung nach § 7 Abs. 1 Nr. 3 UStG2.8.4 Lohnveredelung nach § 7 Abs. 1 Nr. 2 UStG2.9 Innergemeinschaftliche Lieferung nach § 4 Nr. 1 Buchst. b i. V. m. § 6a UStG2.9.1 Innergemeinschaftliches Verbringen2.9.2 Einzelheiten zum innergemeinschaftlichen Verbringen2.9.3 Begriff »Nicht nur vorübergehende Verwendung«2.9.4 Nichterfassung bestimmter innergemeinschaftlicher Verbringenstatbestände als innergemeinschaftliche Lieferung bzw. Erwerb2.9.5 Innergemeinschaftliche Lieferungen nach § 4 Nr. 1 Buchst. b i. V. m. § 6a UStG im Rahmen eines Reihengeschäfts3 Befreiungen mit absolutem Vorsteuerabzugsverbot (§ 4 Nr. 8 ff. UStG, ausgenommen die unter 4 und 5 genannten Befreiungen)3.1 Allgemeines3.2 Heilberufliche Leistungen nach § 4 Nr. 14 Buchst. a UStG3.2.1 Begriff »ärztliche Heilbehandlungen« (A 4.14.1 Abs. 4 UStAE)3.2.2 Tätigkeit als Arzt (A 4.14.2 UStAE)3.2.3 Sonderregelung bei Zahnärzten3.3 Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 28 UStG bei der Lieferung von Gegenständen4 Befreiungen mit Optionsmöglichkeit gemäß § 9 UStG (§ 4 Nr. 8 Buchst. a‒g, Nr. 9 Buchst. a, Nr. 12, Nr. 13 und Nr. 19 UStG)4.1 Allgemeines4.2 Vermietung von Grundstücken nach § 4 Nr. 12 Buchst. a UStG4.2.1 Allgemeines4.2.2 Begriff des Grundstücks4.2.3 Begriff Vermietung4.2.4 Reine Grundstücksmietverträge4.2.5 Gemischte Verträge (A. 4.12.5 UStAE)4.2.6 Ausschluss der Steuerfreiheit bei Grundstücksvermietungen4.3 Veräußerung von Grundstücken nach § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG4.4 Option nach § 9 UStG4.4.1 Voraussetzung der Option bei Grundstücksvermietungen (§ 9 Abs. 2 UStG)4.4.2 Begriff Errichtung4.4.3 Begriff Fertigstellung4.4.4 Eingreifen des Optionsverbots4.4.5 Allgemeine Grundsätze zur Option gemäß § 9 UStG5 Bedingt zum Vorsteuerabzug berechtigende Steuerbefreiungen (§ 4 Nr. 8 Buchst. a‒g, Nr. 10 Buchst. a UStG)5.1 Allgemeines5.2 Steuerfreie Kreditgewährung nach § 4 Nr. 8 Buchst. a UStGTeil M Bemessungsgrundlage bei der Umsatzart Lieferungen und sonstige Leistungen1 Allgemeines2 Einzelfälle2.1 Bruttoentgelt2.2 Kosten2.3 Trinkgelder2.4 Skonto2.5 Forderungsausfall2.6 Zuschüsse2.7 Mindestbemessungsgrundlage2.8 Durchlaufende Posten 2.9 Materialgestellung, MaterialbeistellungTeil N Steuersätze1 Allgemeines2 Nullsteuersatz bei Lieferung und Installation von Photovoltaikanlagen (§ 12 Abs. 3 UStG)3 Ermäßigter Steuersatz bei Lieferungen nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 UStG3.1 Land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse3.2 Futtermittel3.3 Lebensmittel3.4 Getränke3.5 Verlagserzeugnisse und Erzeugnisse des grafischen Gewerbes3.6 Rollstühle, Körperersatzstücke und ähnliche Gegenstände3.7 Hygieneartikel4 Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle4.1 Abgabe von Speisen und Getränken im Catering-Bereich4.2 Abgabe von Speisen im Bereich der Imbissbuden und Imbissecken in Ladengeschäften (Bäckereien u. Ä.)4.3 Abgabe von Speisen in Theatern, Kinos, Multiplexkinos4.4. (Geplante) Änderung ab 20265 Ermäßigter Steuersatz nach § 12 Abs. 2 Nr. 2 UStG bei der Vermietung von Gegenständen der Anlage 26 Ermäßigter Steuersatz bei Zahntechnikern und Zahnärzten nach § 12 Abs. 2 Nr. 6 UStG7 Ermäßigter Steuersatz bei kurzfristigen Beherbergungsleistungen sowie kurzfristiger Vermietung von Campingflächen nach § 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG 8 Steuersatz und Grundsatz der Einheitlichkeit der LeistungTeil O Sonderfälle zu den Lieferungen und sonstigen Leistungen1 Tausch/tauschähnlicher Umsatz1.1 Allgemeines1.2 Bemessungsgrundlage (§ 10 Abs. 2 Satz 2 UStG)1.3 Besonderheit der Bemessungsgrundlage beim Tausch bzw. tauschähnlichem Umsatz mit Baraufgabe2 Rückgabe 3 Leistungen des Unternehmers an sein Personal (Arbeitnehmer)3.1 Allgemeines3.2 Unentgeltliche Leistungsabgabe an das Personal (Arbeitnehmer)3.3 Entgeltliche Leistungsabgabe an das Personal (Arbeitnehmer)3.4 Ansatz lohnsteuerlicher Werte3.5 Mindestbemessungsgrundlage bei Leistungen des Unternehmers an sein Personal gegen besonders berechnetes Entgelt4 Kommissionsgeschäfte und Vermittlungsleistungen4.1 Allgemeines4.1.1 Definition Kommissionsgeschäft4.1.2 Definition Vermittlungsleistung4.2 Die Leistung des Kommissionärs und des Handelsvertreters (Agenten)4.3 Abgrenzung Kommissionsgeschäft ‒ Vermittlungsleistung4.3.1 Handeln für fremde Rechnung4.3.2 Handeln im fremden Namen4.4 Bemessungsgrundlage beim Kommissionsgeschäft (Verkaufskommission)4.4.1 Bemessungsgrundlage für die Lieferung des Kommissionärs4.4.2 Bemessungsgrundlage für die Lieferung des Kommittenten an den Kommissionär4.5 Bemessungsgrundlage bei Vermittlungsleistungen4.5.1 Bemessungsgrundlage für die sonstige Leistung des Vermittlers4.5.2 Bemessungsgrundlage für die Lieferung des Auftraggebers an den Abnehmer4.6 Dienstleistungskommission4.7 Leistungskettenfiktionen4.7.1 Verkauf über elektronische Schnittstellen (§ 3 Abs. 3a UStG)4.7.2 App-Verkauf über App-Stores (§ 3 Abs. 11a UStG)Teil P Unternehmer, Unternehmen1 Unternehmer1.1 Allgemeines1.2 Unternehmerfähigkeit1.3 Selbstständigkeit1.4 Nachhaltige Tätigkeit1.5 Einnahmeerzielungsabsicht2 Unternehmen2.1 Allgemeines2.2 Leistungen vom Unternehmensbereich an Dritte2.3 Umsätze aus Vermietung und Verpachtung2.4 Verfahrensrechtliche Auswirkung der Einheitstheorie3 Unternehmensvermögen bei Gegenständen3.1 Ausübung des Zuordnungswahlrechtes3.2 Frist für die Ausübung der Zuordnungsentscheidung 3.3 Umsatzsteuerrechtliche Auswirkung der Zuordnung bei gemischter Nutzung von Gegenständen mit Ausnahme von Grundstücken3.4 Umsatzsteuerrechtliche Auswirkung der Zuordnung bei gemischter Nutzung von Grundstücken4 Unternehmensvermögen bei Nutzungsrechten an Gegenständen und sonstigen Leistungen5 Vertretbare Sachen6 Grundgeschäfte7 Beginn und Ende der Unternehmereigenschaft7.1 Beginn der Unternehmereigenschaft7.2 Ende der Unternehmereigenschaft7.3 ErbschaftTeil Q Unentgeltliche Leistungsabgaben1 Allgemeines1.1 Hintergrund1.2 Regelungsgegenstand des § 3 Abs. 1b und Abs. 9a UStG1.3 Ortsbestimmung1.4 Ermittlung des richtigen Tatbestandes2 Entnahme eines Gegenstandes gemäß § 3 Abs. 1b Nr. 1 UStG2.1 Steuerbefreiung für Lieferungen gemäß § 3 Abs. 1b Nr. 1 UStG2.2 Steuersätze für Lieferungen gemäß § 3 Abs. 1b Nr. 1 UStG2.3 Bemessungsgrundlage bei Lieferungen gemäß § 3 Abs. 1b Nr. 1 UStG3 Unentgeltliche Zuwendung eines Gegenstandes an das Personal gemäß § 3 Abs. 1b Nr. 2 UStG3.1 Allgemeines3.2 Steuerbefreiungen, Bemessungsgrundlage und Steuersatz4 Unentgeltliche Zuwendung eines Gegenstandes für Zwecke des Unternehmens gemäß § 3 Abs. 1b Nr. 3 UStG4.1 Allgemeines4.2 Lieferort, Steuerbefreiungen, Bemessungsgrundlage und Steuersatz5 Besteuerungsverbot bei Lieferungen ohne zumindest teilweisen Vorsteuerabzug 6 Sonstige Leistungen nach § 3 Abs. 9a UStG7 Verwendung eines dem Unternehmen zugeordneten Gegenstandes nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG7.1 Ortsbestimmung bei sonstigen Leistung nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG7.2 Steuerbefreiung und ermäßigter Steuersatz für sonstige Leistungen nach § 3 Abs. 9a Nr. 1 UStG7.3 Bemessungsgrundlage bei unentgeltlichen Leistungen nach § 3 Abs. 9 Nr. 1 UStG7.3.1 Anschaffungs- oder Herstellungskosten als Bemessungsgrundlage7.3.2 Steuern und Versicherungsbeiträge7.3.3 Unfallreparaturkosten als Bemessungsgrundlage bei (auch) nichtunternehmerischer Pkw-Nutzung7.3.4 Ermittlung der Bemessungsgrundlage bei der nichtunternehmerischenPkw-Nutzung 7.3.5 Private Telefonbenutzung8 Unentgeltliche andere sonstige Leistungen nach § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG8.1 Steuerbefreiung für sonstige Leistungen nach § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG8.2 Ermäßigter Steuersatz für sonstige Leistungen nach § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG8.3 Bemessungsgrundlage für sonstige Leistungen nach § 3 Abs. 9a Nr. 2 UStG9 Absehen von Besteuerung aus BilligkeitsgründenTeil R Innergemeinschaftlicher Erwerb1 Allgemeines2 Tatbestandsvoraussetzungen des innergemeinschaftlichen Erwerbs (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG)2.1 Innergemeinschaftlicher Erwerb i. S. d. § 1a UStG2.2 Ort des Innergemeinschaftlichen Erwerbs nach § 3d UStG3 Weitere Fälle des innergemeinschaftlichen Erwerbs3.1 Innergemeinschaftliches Verbringen 3.2 Lieferung von Neufahrzeugen 4 Ausnahmen vom innergemeinschaftlichen Erwerb5 Steuerbefreiungen für den innergemeinschaftlichen Erwerb6 Berechnung der Steuer7 Beispiele zum innergemeinschaftlichen Erwerb8 Steuerliche Erfassung des innergemeinschaftlichen Erwerbs8.1 Vorausrechnungen8.2 Anzahlungs- und SchlussrechnungenTeil S Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (Umkehr der Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG)1 Allgemeines1.1 Systematik1.2 Besonderheiten1.3 Überblick1.4 Zweifelsfälle1.5 Leistung für den privaten Bereich2 Umkehr der Steuerschuld bei nach § 3a Abs. 2 UStG im Inland steuerpflichtigen sonstigen Leistungen eines im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 1 UStG)3 Umkehr der Steuerschuld bei steuerpflichtigen Werklieferungen und nicht unter § 13b Abs. 1 UStG fallenden sonstigen Leistungen eines im Ausland ansässigen Unternehmers (§ 13b Abs. 2 Nr. 1 UStG)4 Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei inländischen Bauleistungen (§ 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG)4.1 Die § 14c Abs. 1-Steuer kann allerdings durch einfache Rechnungsberichtigung in entsprechender Anwendung des § 17 Abs. 1 UStG geändert werden (§ 14c Abs. 1 Satz 2 UStG).Bauleistungen i. S. d. § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG4.2 Voraussetzungen für die Steuerschuldnerschaft des LeistungsempfängersTeil T Vorsteuer (Eingangsumsatzsteuer)1 Allgemeines2 Tatbestandsvoraussetzungen für den Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 UStG2.1 Steuerpflichtige Leistungen2.2 Leistungen an das Unternehmen2.3 Vorsteuerabzug aus laufenden Kosten bei Gegenständen im außerunternehmerischen Bereich2.4 Rechnung i. S. d. §§ 14 und 14a UStG2.4.1 Notwendigkeit und Begriff2.4.2 Gutschrift2.5 Einzelheiten zur Rechnungserteilung2.5.1 Erforderliche Angaben in der Rechnung2.5.2 Einzelheiten zu den in § 14 Abs. 4 UStG vorgeschriebenen Angaben2.5.2.1 Name und Anschrift des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers2.5.2.2 Steuernummer oder USt-IdNr. des leistenden Unternehmers2.5.2.3 Fortlaufende Nummer (Rechnungsnummer)2.5.2.4 Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder Umfang und Art der sonstigen Leistung2.5.2.5 Zeitpunkt der Leistung und Vereinnahmung des Entgelts2.5.2.6 Angabe des Entgelts2.5.2.7 Angabe des Steuersatzes und des Steuerbetrags2.5.3 Weitere Voraussetzungen nach § 14a UStG2.5.4 E-Rechnung und sonstige Rechnung 2.5.4.1 Grds. Verpflichtung zur Ausstellung von E-Rechnungen2.5.4.2 Übergangsregelungen2.5.5 Berichtigung fehlender oder unrichtiger Angaben in der Rechnung2.6 Sonderfälle von Rechnungen2.6.1 Kleinbetragsrechnungen i. S. d. §§ 33 und 35 UStDV2.6.2 Fahrausweise i. S. d. § 34 UStDV als zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnungen2.6.3 Rechnungen in den Fällen der Mindestbemessungsgrundlage2.7 Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs2.7.1 Allgemeines2.7.2 Vorsteuerabzug vor Bezug der Leistung nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 UStG 2.8 Rechnungen mit falschem Umsatzsteuerausweis2.8.1 Allgemeines2.8.2 Unrichtiger Umsatzsteuerausweis (§ 14c Abs. 1 UStG)2.8.3 Unberechtigter Umsatzsteuerausweis (§ 14c Abs. 2 UStG)2.8.4 Zu niedriger Umsatzsteuerausweis 2.9 Vorsteuerabzug aus Reisekosten2.9.1 Vorsteuerabzug aus Übernachtungskosten2.9.2 Vorsteuerabzug aus Verpflegungskosten2.9.2.1 Verpflegungskosten des Unternehmers (Geschäftsreise)2.9.2.2 Verpflegungskosten des Arbeitnehmers3 Prüfungsschema zur Abziehbarkeit der Vorsteuer494 Abzug der Einfuhrumsatzsteuer als Vorsteuer nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG4.1 Allgemeines4.2 Entstehung der Einfuhrumsatzsteuer4.3 Einfuhr für das Unternehmen5 Vorsteuerabzug der Erwerbssteuer nach § 15 Abs. 1 Nr. 3 UStG5.1 Allgemeines5.2 Einzelheiten6 Tatbestandsvoraussetzung: kein Vorsteuerabzugsverbot6.1 Vorsteuerabzugsverbot nach § 15 Abs. 1a UStG6.2 Vorsteuerabzugsverbot nach § 15 Abs. 1b UStG6.3 Nichtabzugsfähige Vorsteuer nach § 15 Abs. 2 UStG6.3.1 Zusammenhang zu Ausgangsumsätzen6.3.2 Vorsteueraufteilung nach § 15 Abs. 4 UStG6.3.2.1 Allgemeine Grundsätze6.3.2.2 Besonderheiten bei Gebäuden7 Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG7.1 Allgemeines7.2 Anknüpfungspunkt Verwendungsabsicht7.3 Einstiegsfall7.4 Fallgruppen der Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG7.5 Vorsteuerberichtigungstatbestand nach § 15a Abs. 1 und 6 UStG (Fallgruppen a) und b))7.6 Vorsteuern auf Leistungen, die in ein Wirtschaftsgut eingehen (Erhaltungsaufwand), § 15a Abs. 3 UStG7.7 Durchführung der BerichtigungTeil U Besteuerung der Kleinunternehmer1 Regelung bis Ende 20241.1 Allgemeines1.2 Gesamtumsatz i. S. d. § 19 UStG1.3 Kleinunternehmer nach § 19 Abs. 1 UStG1.4 Option nach § 19 Abs. 2 UStG1.5 Räumlicher Anwendungsbereich2 Regelung ab 20252.1 Nationale Kleinunternehmereigenschaft (§ 19 UStG)2.2 EU-grenzüberschreitende Kleinunternehmereigenschaft (§ 19a UStG)Teil V Differenzbesteuerung (§§ 25 und 25a UStG)1 Allgemeines2 Voraussetzungen für die Differenzbesteuerung nach § 25a UStG3 Bemessungsgrundlage nach § 25a Abs. 3 UStG4 Ausweitung der Differenzbesteuerung nach § 25a Abs. 2 UStG auf vorsteuerbelastete Gegenstände5 Steuersatz und Vorsteuerabzug bei § 25a UStG6 Option zur Besteuerung nach den allgemeinen Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes gemäß § 25a Abs. 8 UStG7 Verbot des gesonderten Steuerausweises in einer Rechnung bei § 25a UStG8 Besonderheiten nach § 25a Abs. 7 UStG8.1 Ausschluss der Differenzbesteuerung nach § 25a Abs. 7 Nr. 1 Buchst. a UStG8.2 Ausschluss der Differenzbesteuerung nach § 25a Abs. 7 Nr. 1 Buchst. b UStG8.3 Auswirkung der Differenzbesteuerung nach § 25a UStG auf den innergemeinschaftlichen Warenverkehr9 Beispiele zur Differenzbesteuerung nach § 25a UStG10 Die Margenbesteuerung bei Reiseleistungen nach § 25 UStGTeil W Besteuerungsverfahren1 Allgemeines2 Umsatzsteuer-Voranmeldungsverfahren2.1 Voranmeldungszeitraum2.1.1 Nachträgliche Änderung der Steuer für das Vorjahr2.1.2 Verkürzung des Voranmeldungszeitraums bei Unternehmensneugründungen2.2 Übersicht über den Abgabezeitraum3 Entstehungszeitpunkt der Steuer3.1 Entstehungszeitpunkt bei der Ist-Besteuerung ‒ Voranmeldungszeitraum3.2 Entstehungszeitpunkt bei der Soll-Besteuerung3.2.1 Teilleistungen3.2.2 Anzahlungen, Abschlagszahlungen und Vorauszahlungen 3.3 Entstehungszeitpunkt bei unentgeltlichen Leistungen i. S. d. § 3 Abs. 1b und 9a UStG3.4 Entstehungszeitpunkt der Steuer beim unrichtigen und unberechtigten Steuerausweis nach § 14c Abs. 1 und 2 UStG3.5 Entstehungszeitpunkt der Erwerbssteuer4 Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs 5 Abgabezeitpunkt der Steueranmeldungen und Fälligkeit der Steuer5.1 Abgabefrist5.2 Zahlungsfrist5.3 Erstattung von Umsatzsteuer gegen Sicherheitsleistung5.4 Rechtsfolgen vorsätzlich nicht bezahlter Umsatzsteuer6 Der One-Stop-Shop (OSS) 7 Dauerfristverlängerung8 Zusammenfassende Meldung8.1 Meldezeiträume und Meldefristen8.2 Angaben in der Zusammenfassenden Meldung9 Vergütung der Vorsteuerbeträge (Vergütungsverfahren)10 Umsatzsteuer-Nachschau11 Besondere Sanktionen bei Beteiligung an einer Steuerhinterziehung (§ 25f UStG)Teil X Lösungshinweise zu den Fällen 1 ‒ 31Teil Y Komplexe Übungsfälle1 Übungsfall 12 Übungsfall 23 Übungsfall 3Teil Z Lösungshinweise zu den komplexen Übungsfällen1 Lösung zu Übungsfall 12 Lösung zu Übungsfall 23 Lösung zu Übungsfall 3Ihre Online-Inhalte zum Buch: Exklusiv für Buchkäuferinnen und Buchkäufer!StichwortverzeichnisBuchnavigation
InhaltsubersichtCoverTextanfangImpressumHinweis zum Urheberrecht
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
myBook+
Ihr Portal für alle Online-Materialien zum Buch!
Arbeitshilfen, die über ein normales Buch hinaus eine digitale Dimension eröffnen. Je nach Thema Vorlagen, Informationsgrafiken, Tutorials, Videos oder speziell entwickelte Rechner – all das bietet Ihnen die Plattform myBook+.
Ein neues Leseerlebnis
Lesen Sie Ihr Buch online im Browser – geräteunabhängig und ohne Download!
Und so einfach geht’s:
Gehen Sie auf https://mybookplus.de, registrieren Sie sich und geben Sie Ihren Buchcode ein, um auf die Online-Materialien Ihres Buches zu gelangen
Ihren individuellen Buchcode finden Sie am Buchende
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit myBook+ !
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-6571-7
Bestell-Nr. 20204-0007
ePub:
ISBN 978-3-7910-6572-4
Bestell-Nr. 20204-0102
ePDF:
ISBN 978-3-7910-6573-1
Bestell-Nr. 20204-0156
Gabi Meissner/Alexander Neeser
###BOOK TITLE###
28. überarbeitete und aktualisierte Auflage, August 2025
© 2025 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
Reinsburgstr. 27, 70178 Stuttgart
www.schaeffer-poeschel.de | [email protected]
Bildnachweis (Cover): © Umschlag: Starkekonzepte, Christina Peter, Wörthsee
Produktmanagement: Rudolf Steinleitner
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Der Verlag behält sich auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
Autoren
Prof. Dr. Gabi Meissner
Professorin an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
Prof. Dr. Alexander Neeser
Professor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, Referent im Bereich der Aus- und Fortbildung von Steuerberatern
Bearbeiterübersicht:
Meissner: Teile A-L, Y, Z
Neeser: Teile M-X, Y, Z
Vorwort zur 28. Auflage
Der vorliegende Band gibt eine systematische Einführung in das Umsatzsteuerrecht. Anhand von typischen Beispielsfällen kann sich der Leser gründlich mit den wesentlichen Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes vertraut machen. Er soll nach dem Studium dieses Buches zumindest die wichtigsten und in der Praxis am häufigsten vorkommenden Fälle sicher lösen können. Als Hilfe hierzu sind an geeigneten Stellen Prüfungsschemata abgedruckt und wichtige Aussagen in Merksätzen hervorgehoben.
Nach Darstellung eines bestimmten Wissensstoffes werden Lernzielkontrollen in Form von 31 (aktualisierten) Fällen angeboten. Diese haben sich in den vielen Jahren, in denen die Autoren Studierende an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen, Ludwigsburg, durch das Umsatzsteuerrecht geführt haben, bewährt. Die Lösungen zu den Fällen sind im Teil X abgedruckt. Weitere komplexe Übungsfälle einschließlich ausführlicher Lösungen finden sich in den Teilen Y und Z.
Das Lehrbuch ist auf dem Stand vom 01.07.2025. Gesetzesänderungen, Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen sind mindestens bis zu diesem Zeitpunkt berücksichtigt, was wichtige Änderungen des Lehrbuches erforderlich gemacht hat:
Hier ist auf Seiten des Gesetzgebers besonders die Einführung der E-Rechnung mitsamt umfangreicher Übergangsregelungen (§ 14 und § 27 Abs. 38 UStG) und die komplette Überarbeitung der Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) mit erstmaliger Implementierung einer grenzüberschreitenden Regelung (§ 19a UStG) zu nennen. Auch die Neuregelung des Ortes der per Stream übertragenen Schulungsleistungen nach § 3a Abs. 3 Nr. 3 Satz 2 UStG ist hier zu nennen.
Weitere Änderungen werfen ihre Schatten voraus. So soll ab 2026 erneut der ermäßigte Steuersatz auf Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen (mit Ausnahme von Getränken) eingeführt werden. Wir haben dies in einem zusätzlichen Hinweis im Teil N (4.4) dargestellt, die alte – noch geltende – Regelung aber weiter abgedruckt.
Aber auch die Rechtsprechung war nicht untätig. So wurden zwar Fragen zu Gutscheinen vom EuGH beantwortet (s. Teil G 19), bei Redaktionsschluss war aber die mit Spannung vom BFH an den EuGH gerichtete Frage, ob die Aufteilung der Steuersätze bei Übernachtungsleistungen mit EU-Recht vereinbar ist, noch nicht beantwortet (s. Teil H und Teil N 7).
Das vorliegende Lehrbuch kann damit auch dieses Mal wieder nur eine Momentaufnahme darstellen. Diese ist aber besonders anschaulich und – wie immer – topaktuell!
Unser Dank geht an Frau Bandl und Frau Lange vom Schäffer-Poeschel Verlag, die unsere Beiträge stets kritisch begleitet und uns auf Ungenauigkeiten und Fehler hingewiesen haben. Damit sei abermals auch unser Wunsch an Sie als Leser verbunden, sich bei uns zu melden, wenn sich trotz aller Sorgfalt bei den vielen notwendigen Änderungen der Fehlerteufel eingeschlichen haben sollte.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern kurzweilige und lehrreiche Stunden mit unserem Lehrbuch, damit Ihnen allen der Spaß und die Spannung am Umsatzsteuerrecht noch recht lange erhalten bleibt.
Ludwigsburg, im Juli 2025
Die Verfasser
Abkürzungsverzeichnis
A
Abschnitt
a. a. O.
am angegebenen Ort
ABl.
Amtsblatt
ABl. EG, ABl. EU
Amtsblatt der Europäischen Union
Abs.
Absatz
Abschn.
Abschnitt
a. F.
alte Fassung
AfA
Absetzung/en für Abnutzung
Alt.
Alternative
AN
Arbeitnehmer
AO
Abgabenordnung
Art.
Artikel
Az.
Aktenzeichen
BewG
Bewertungsgesetz
BfF
Bundesamt für Finanzen
BFH
Bundesfinanzhof
BFHE
Sammlung der Entscheidungen und Gutachten des Bundesfinanzhofs
BFH/NV
Sammlung amtlich nicht veröffentlichter Entscheidungen des Bundesfinanzhofs
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl
Bundesgesetzblatt
BMF
Bundesminister der Finanzen
BStBl
Bundessteuerblatt
Buchst.
Buchstabe
BZSt
Bundeszentralamt für Steuern
bzw.
beziehungsweise
DB
Deutsche Bahn AG
d. h.
das heißt
DStR
Deutsches Steuerrecht (Zeitschrift)
DVO
Durchführungsverordnung
EG
Europäische Gemeinschaft
EG-RL
EG-Richtlinie zur Harmonisierung der Umsatzsteuer
ErwUSt
Erwerbsumsatzsteuer
ESt
Einkommensteuer
EStG
Einkommensteuergesetz
EU
Europäische Union
EuGH
Europäischer Gerichtshof
EUSt
Einfuhrumsatzsteuer
f., ff.
folgende, fortfolgende
Fa.
Firma
FA
Finanzamt
GbR
Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
gem.
gemäß
ggf.
gegebenenfalls
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GrEStG
Grunderwerbsteuergesetz
HGB
Handelsgesetzbuch
HS
Halbsatz
Id-Nr.
Identifikations-Nummer
i. d. R.
in der Regel
igE
Innergemeinschaftlicher Erwerb
i. H. v.
in Höhe von
h. M.
herrschende(r) Meinung
i. R.
im Rahmen
i. S. d.
im Sinne der/des
i. S. v.
im Sinne von
i. V.
in Verbindung
i. V. m.
in Verbindung mit
JStG
Jahressteuergesetz
KG
Kommanditgesellschaft
KJ
Kalenderjahr
L
Leistender
LE
Leistungsempfänger
LSt
Lohnsteuer
LStR
Lohnsteuer-Richtlinien
lt.
laut
m. E.
meines Erachtens
Mio.
Million
m. w. N.
mit weiteren Nachweisen
MwStSystRL
Mehrwertsteuersystemrichtlinie
Nr.
Nummer
o. Ä.
oder Ähnliches
o. g.
oben genannte/r/s
OHG
Offene Handelsgesellschaft
Rn.
Randnummer
Rs.
Rechtssache
Rz.
Randziffer
S.
Seite
s.
siehe
sog.
sogenannte/n/r/s
StÄnd-AnpG
Steueränderungs-Anpassungsgesetz/KroatienAnpG
Stpfl.
Steuerpflichtige/r
stpfl.
steuerpflichtig
Tz.
Textziffer
u. a.
unter anderem
u. E.
unseres Erachtens
UR
Umsatzsteuer-Rundschau
USt
Umsatzsteuer
UStAE
Umsatzsteueranwendungserlass
UStDV
Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung
UStG
Umsatzsteuergesetz
UStR
Umsatzsteuer-Richtlinien
VersStG
Versicherungsteuergesetz
vg.
vorgenannt(e)
vgl.
vergleiche
VJ
Vierteljahr
VO
Verordnung
VStA
Vorsteuerabzug
VZ
Voranmeldungszeitraum
WG
Wirtschaftsgut
z. B.
zum Beispiel
ZM
Zusammenfassende Meldung
ZollBefrVO
Zollbefreiungsverordnung
zuzügl.
zuzüglich
Teil A Einführung
1 Bedeutung der Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer (USt) ist neben der Einkommensteuer (inklusive Lohnsteuer) die wichtigste Einnahmequelle von Bund und Ländern. Im Jahr 2023 wurden in Deutschland insgesamt 915, 8 Mrd. € Steuern eingenommen, ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 20 Mrd. € (+ 2,2 %). Den größten Teil davon machten die Gemeinschaftssteuern1 aus (690,7 Mrd. €, + 2,3 %). Innerhalb dieser Gemeinschaftssteuern waren die Umsatzsteuer (einschließlich Einfuhrumsatzsteuer) mit 291,4 Mrd. € (+ 2,3 %) und die Lohnsteuer mit 236,2 Mrd. € (+ 4,0 %) am ertragreichsten.2 Nach der aktuellen Steuerverteilung blieben dem Bund 356,0 Mrd. € Steuereinnahmen (+ 5,6 %), den Ländern 382,6 Mrd. € +- 0,5 %) und den Gemeinden 143,5 Mrd. € (+ 7,1 %). An die Europäische Union wurden von den Steuereinnahmen 35,4 Mrd. € +- 8,2 %) abgeführt.
Neben ihrer finanzpolitischen Bedeutung trägt die USt auch wirtschafts- und sozialpolitischen Zwecken Rechnung, z. B. durch Verfahrenserleichterungen für klein- und mittelständische Unternehmen, ermäßigte Steuersätze für Lebensmittel oder Steuerbefreiungen für spezifische tägliche Leistungen wie z. B. die Wohnungsvermietung oder die ärztliche Heilbehandlung oder gar pandemiebedingte Erleichterungen für besonders betroffene Branchen wie z. B. Hotels und Gaststätten.3
1 Die Verteilung des USt-Aufkommens regelt das Finanzausgleichsgesetz (Art. 106 Abs. 5a GG); durchschnittlich erhalten die Länder ca. 43 % und der Bund ca. 52 % des USt-Aufkommens.
2https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Steuereinnahmen/steuereinnahmen.html (abgerufen am 07.03.2025).
3 Detaillierte Unternehmens- und Branchenergebnisse der USt-Statistik (Voranmeldungen) sind abrufbar über die Homepage des Statistischen Bundesamts: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/03/PD22_091_733.html (abgerufen am 07.03.2025).
2 Umsatzsteuer in der Europäischen Union
Die USt ist die erste und bisher einzige einheitliche Steuer innerhalb der EU. Mit geringfügigen Abweichungen sind die Besteuerungsgrundlagen für die USt in allen EU-Ländern einheitlich gestaltet. Unterschiede bestehen vor allem noch bei den Steuersätzen. Aber auch insoweit wird eine Harmonisierung angestrebt. Die EU-Länder haben sich darauf geeinigt, dass der Regelsteuersatz in allen EU-Ländern bei mindestens 15 % liegen soll und 25 % grundsätzlich nicht übersteigen darf.
Welche unterschiedlichen Steuersätze innerhalb der EU gelten, zeigt die nachfolgende Übersicht (Stand Januar 2021):
Staaten
Normalsatz
ermäßigte Sätze
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
21
20
25
19
22
25,5
20
24
6; 12 (Zwischensatz 12)
9
‒
7
9
10, 14
2,1; 5,5/10
6; 13
Irland4
Italien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
4,8; 9; 13,5
4; 5; 10
5; 13
12; 5
5; 9
3; 8; 14
5; 7
9
10; 13
5; 8
6; 13
5; 9
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
Zypern (nur griechischer Teil)
25
23
22
21
21
27
19
6; 12
10
5; 9,5
10
12/0
5; 18
5; 9
Quelle: Die Mehrwertsteuersätze in den EU-Ländern https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_de.htm (abgerufen am 07.03.2025)
Der Erklärung der Europäischen Kommission vom 07.12.2021 zufolge5 sollen die Vorschriften für die auf Waren und Dienstleistungen erhobene Mehrwertsteuer (MwSt) aktualisiert werden und die Regierungen mehr Flexibilität in Bezug auf die anwendbaren Steuersätze erhalten. Gleichzeitig soll für eine Gleichbehandlung zwischen den EU-Mitgliedstaaten gesorgt werden. Durch diese Aktualisierung werden die MwSt-Vorschriften gleichzeitig mit gemeinsamen EU-Prioritäten wie etwa der Eindämmung des Klimawandels, der Förderung der Digitalisierung und dem Schutz der öffentlichen Gesundheit in Einklang gebracht.
Die einheitliche Regelung der USt innerhalb der EU geht auf die vom EG-Ministerrat am 17.05.1977 verabschiedete 6. EG-RL zur Harmonisierung der Umsatzsteuern der Mitgliedstaaten zurück. Die EU-Länder haben sich dabei verpflichtet, ihre nationalen USt-Gesetze entsprechend der 6. EG-RL abzuändern (RL 77/388, Abl. EG vom 13.06.1977 Nr. L 145, 1). Sinn der Vereinheitlichung der nationalen Umsatzsteuergesetze war zum einen das Bestreben, die innergemeinschaftlichen Steuergrenzen aufzuheben, zum anderen, der EU eigene Einnahmen zu verschaffen. Letzteres geschieht in der Weise, dass die EU von allen EU-Ländern einen bestimmten Anteil des USt-Aufkommens erhält. Wegen der gerechten Verteilung der Beiträge richtet sich der Anteil aufgrund der unterschiedlichen Steuersätze nicht direkt nach dem USt-Aufkommen. Vielmehr dient als Basis für die Errechnung dieses Anteils der im jeweiligen EU-Land getätigte Umsatz an den Endverbraucher. Dieser lässt sich aufgrund der einheitlichen Bestimmungen ohne Schwierigkeiten ermitteln (vgl. VO des Rates der EG vom 19.12.1977, Abl. EG vom 27.12.1977 Nr. L 336/8 i. V. m. BGBl I 1977, 154).
Eine weitergehende Vereinheitlichung des USt-Rechts innerhalb der EU erfolgte Ende 1991 durch die sog. Binnenmarktrichtlinie. Ziel war die Schaffung eines einheitlichen Binnenmarkts. Deshalb wurden zum 01.01.1993 die Zollgrenzen zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten abgeschafft. Wegen der weiterhin bestehenden unterschiedlichen Steuersätze wurden als Ersatz für den Wegfall der EUSt und der Steuerfreiheit der Ausfuhrlieferungen Sonderregelungen für den innergemeinschaftlichen Warenverkehr eingeführt. Sie sollten zunächst nur für eine Übergangszeit von vier Jahren gelten, um dann durch einen echten Binnenmarkt, wie er innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten besteht, abgelöst zu werden. Allerdings haben sich diese Übergangsregelungen als beständig erwiesen. Es ist derzeit noch nicht absehbar, ob und wann es tatsächlich zu einem vollständig harmonisierten europäischen Binnenmarkt kommen wird.
Am 28.11.2006 wurde die Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem verabschiedet. Mit dieser Richtlinie wurde insbesondere die 6. EG-RL (Basisrechtsakt) neu gefasst. Diese Neufassung trat am 01.01.2007 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt wurden die 1. sowie 6. EG-RL und die jeweiligen Änderungsrechtsakte aufgehoben.
Mit der Neufassung des geltenden Gemeinschaftsrechts durch die Richtlinie 2006/112/EG sind keine Änderungen des geltenden Rechts verbunden, es erfolgte zur besseren Übersichtlichkeit lediglich eine Neustrukturierung der einzelnen Artikel. Mit der Richtlinie 2008/8/EG, ABl. EU 2008 Nr. L 44, 11 vom 12.02.2008 (MwStSystRL) wurden die gemeinschaftsrechtlichen Regelungen zum Ort der Dienstleistung und zum Vorsteuervergütungsverfahren neu gefasst (sog. EU-Paket). Diese Regelungen hat das JStG 2009 durch die Neufassung der §§ 3a, 3b, 3e UStG in Art. 7 am 19.12.2008 BGBl I 2008, 2794 in nationales Recht umgesetzt. Die Änderungen traten am 01.01.2010 in Kraft. Mit dem Amtshilferichtlinien-Umsetzungsgesetz (2013) und dem Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuerrechts (StÄnd-AnpG-Kroatien 2014) sowie dem Zollkodex-Anpassungsgesetz (Zollkodex-AnpG) wurden weitere europarechtliche Vorgaben in das nationale USt-Recht integriert.
Eine Zäsur in der Rechtsentwicklung und einen Meilenstein stellt der sog. Aktionsplan im Bereich der Mehrwertsteuer dar, den die Kommission am 07.04.2016 angenommen hat. Ihn gilt es in den nächsten Jahren Schritt für Schritt umzusetzen. Mit dem Ziel der Vereinfachung des grenzüberschreitenden Handels, der Bekämpfung des MwSt-Betrugs, der Sicherung fairer Wettbewerbsbedingungen für EU-Unternehmen und der Gleichbehandlung elektronischer Veröffentlichungen werden bzw. wurden sowohl administrative als auch formelle bzw. materiellrechtliche Änderungen beschlossen und mit großem Nachdruck angegangen. Denn, um es mit den Worten der Kommission auszudrücken, »dieser Mehrwertsteuerraum soll eine Stütze für einen vertieften und faireren Binnenmarkt sein und zur Förderung von Beschäftigung, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Nur ein solcher Mehrwertsteuerraum wird den Erfordernissen des 21. Jahrhunderts gerecht.«
Was den zeitlichen Horizont angeht, ist beabsichtigt, das europäische Mehrwertsteuerrecht ‒ frühestens 2027 ‒ auf ein endgültiges System umzustellen.
In diesem Zusammenhang wurden zunächst zum 01.01.2020 mit den sog. Quick fixes, mithin die für die Praxis dringlichsten Regelungen umgesetzt.6 Sie umfassen im Wesentlichen:
die Abgabe der Zusammenfassenden Meldung (§ 4 Nr. 1b UStG) und die Implementierung der Umsatzsteuer Identifikationsnummer (§ 6a Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a und Nr. 4 UStG) als zwingende Voraussetzungen für die Steuerbefreiung der innergemeinschaftlichen Lieferung,
die Neuregelung des Reihengeschäfts einschließlich der Zuordnungsregeln für die bewegte Lieferung innerhalb des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs (§ 3 Abs. 6a UStG),
die Einführung einer Gelangensvermutung bei innergemeinschaftlichen Lieferungen in Beförderungs- und Versendungsfällen (§ 17 a UStDV) und
die Konsignationslagerregelung (§ 6b UStG).
Überdies wurde mit dem Jahressteuergesetz 20207 zum 1. Juli 2021 die zweite Stufe des sog. Mehrwertsteuer-Digitalpakets in nationales Recht übertragen. Diese beinhaltet insbesondere
die Änderungen beim Versandhandel an Privatpersonen (§ 3c UStG) einschließlich der Lieferungen mittels elektronischer Schnittstelle (§ 3 Abs. 3a und Abs. 6b UStG);
die Erweiterung des bestehenden (besonderen) Besteuerungsverfahrens für in der EU ansässige Unternehmer, die bestimmte Dienstleistungen erbringen, auf innergemeinschaftliche Fernverkäufe und alle am Ort des Verbrauchs ausgeführten Dienstleistungen an Privatpersonen in der EU (sog. One-Stop-Shop, OSS, vgl. §§18 und 13a UStG);
die Ausdehnung des bestehenden (besonderen) Besteuerungsverfahrens für nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer, die bestimmte Dienstleistungen erbringen (sog. ECOM-Verfahren), auf alle am Ort des Verbrauchs ausgeführten Dienstleistungen an Privatpersonen in der EU (§ 18i UStG);
die Einführung eines neuen Import-One-Stop-Shops (IOSS) für Fernverkäufe von Gegenständen in Sendungen mit einem Sachwert bis 150 Euro aus Staaten außerhalb der EU an Privatpersonen in der EU (§ 18k UStG);
die Schaffung einer (optionalen) Sonderregelung (Special Arrangement) ebenfalls für Sendungen mit einem Sachwert bis 150 Euro, bei denen der IOSS nicht genutzt wird: Die Einfuhrumsatzsteuer für die Einfuhren eines Monats kann dabei durch die Beförderer (Post- bzw. Expresskurierdienstleister) von den Sendungsempfängern erhoben und im Folgemonat gesammelt an die Zollverwaltung entrichtet werden (§ 21a UStG);
und die Abschaffung der 22-Euro-Freigrenze bei der Einfuhrumsatzsteuer (§ 1a EUStBV).
Als weiteren Meilenstein der europäischen Entwicklungen lässt sich der Richtlinienvorschlag »VAT in the Digital Age« (ViDA) charakterisieren, den die Europäische Kommission am 08.12.2022 veröffentlicht hat.8 Er umfasst im Wesentlichen drei Themenblöcke:
Neuregelungen zur umsatzsteuerlichen Behandlung der Plattformwirtschaft
Unter bestimmten Voraussetzungen soll es zu einer fiktiven Leistungskette zwischen Anbieter (meist von Ferienwohnungen bzw. Personenbeförderungsleistungen), Plattform und Kunden kommen, um eine Ungleichbehandlung zur Hotel- und Taxibranche zu vermeiden.
Neue elektronische MWSt-Meldepflichten in Kombination mit einer elektronischen Rechnungsstellung
Rechnungen sollen zunächst im EU-grenzüberschreitenden B2B-Verhältnis nur noch in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt und übermittelt werden dürfen. Zwei Tage nach Rechnungsstellung sind bestimmte Daten dann der Finanzverwaltung zu übermitteln. Diese transaktionsbasierten digitalen Berichtspflichten werden die Zusammenfassende Meldung ersetzen. Diese Verpflichtungen sollen schrittweise auf mehr Leistungen ausgeweitet werden.
Einheitliche EU-MwSt-Registrierung
Das One-Stop-Shop-Verfahren (OSS-Verfahren) gestaltet sich erfolgreich im Hinblick auf die Steuererhebung. Daher soll es auf die wichtigsten sonstigen Leistungen sowie Lieferungen ausgeweitet werden, für die aktuell eine Registrierung von Unternehmern im EU-Ausland erforderlich ist. Überdies ist geplant, dass auch innerunternehmerische Verbringenssachverhalte über dieses Verfahren gemeldet werden können.
Am 5. November 2024 erzielten die 27 EU-Mitgliedstaaten eine einstimmige politische Einigung über den Vorschlag zur Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter (»ViDA«). Zwar müssen noch einige Formalitäten erledigt werden, bevor der Vorschlag vollständig in das EU-Recht übernommen wird, doch mit dieser Einigung ist die größte politische Hürde genommen. Das bedeutet, dass größere Änderungen an der Funktionsweise der Mehrwertsteuer in der EU anstehen werden. ViDA sieht verschiedenste Termine für das Inkrafttreten der einzelnen Regelungen vor, die wichtigsten Umsetzungsdaten werden nach derzeitigem Stand jedoch voraussichtlich sein:
1. Juli 2028 in Bezug auf die Einführung der Plattformwirtschaft und die einheitliche MwSt-Registrierung und
1. Juli 2030 in Bezug auf die elektronische Rechnungsstellung und die digitale Berichterstattung.
Alle aktuellen Rechtsänderungen werden im vorliegenden Werk berücksichtigt und an den maßgebenden Stellen eingearbeitet. Sofern unmittelbar bevorstehende Änderungen absehbar sind, wird darauf hingewiesen.
4 Aufgrund des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der EU hat Nordirland hinsichtlich des Dienstleistungsverkehrs seit dem 01.01.2021 Drittland-Status; nur hinsichtlich des Warenverkehrs verbleibt es beim Status als EU-Mitgliedstaat: vgl. BMF vom 10.12.2020 ‒ III C 1 ‒ S 7050/19/10001:002.
5https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_6608 (abgerufen am 05.02.2023).
6 Art. 11 bis Art. 15 des Gesetz(es) zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (JStG 2019), BGBl I, 2451 ff.
7 Art. 11 bis Art. 16 des Jahressteuergesetz(es) 2020 (JStG 2020) vom 21. Dezember 2020, BGBl I, 3096 ff.
8https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-Mehrwertsteuer-im-digitalen-Zeitalter_de (abgerufen am 05.02.2023).
3 Rechtsgrundlagen des Umsatzsteuerrechts
Rechtsgrundlagen für die USt sind im Wesentlichen:
das UStG,
die UStDV.
Daneben kommt dem Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) als allgemeiner Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des UStG wesentliche Bedeutung zu. Er bindet die Verwaltung und sichert bundesweit eine einheitliche Rechtsanwendung.
Der UStAE hat die USt-Richtlinien 2008 ersetzt. Letztere wurden mit Wirkung zum 01.11.2010 aufgehoben (BMF vom 01.10.2010, BStBl II 2010, 846). Mit der Änderung wurde der Schnelllebigkeit des Umsatzsteuerrechts Rechnung getragen: der Erlass unterliegt ‒ anders als eine Richtlinie ‒ nicht der Zustimmung des Bundesrats. Er wird einmal jährlich grundlegend überarbeitet und laufend durch BMF-Schreiben ergänzt. Insoweit empfiehlt es sich, in regelmäßigen Abständen die konsolidierte, den aktuellen Stand wiedergebende Fassung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses auf der Homepage des Bundesministeriums der Finanzen herunterzuladen.9
Einzelne USt-Vorschriften, vor allem die über die Steuerbefreiung, nehmen Bezug auf außersteuerliche Vorschriften wie das Nato-Truppenstatut und das Offshore-Steuerabkommen. Weitere Regelungen beziehen sich auf steuerverfahrensrechtliche Normen in der AO oder dem Finanzverwaltungsgesetz.
Basis des nationalen USt-Rechts bildet die Richtlinie 2006/112/EG des Rates über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem, kurz Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL) genannt (S. 2), einschließlich der dazu ergangenen Durchführungsverordnung (EU-VO 282/2011). Sie bindet alle staatlichen Organe der Mitgliedstaaten und verpflichtet sie, das nationale UStG den Vorgaben des europäischen USt-Rechts anzupassen. Sie gebietet überdies die richtlinienkonforme Auslegung nationaler Vorschriften.
Hat es der nationale Gesetzgeber versäumt, eine für den Steuerpflichtigen günstige Regelung der MwStSystRL in nationales USt-Recht zu transferieren, kann sich der Steuerpflichtige unmittelbar auf die für ihn günstige Regelung der MwStSystRL berufen oder auch auf die Umsetzung der Vorgaben der Richtlinie klagen. Weder Steuerbürger noch Finanzverwaltung haben aber ein Vorlage- oder Klagerecht an den EuGH oder das EuG. Die Einwirkungsmöglichkeiten der Regelungen der MwStSystRL auf das deutsche USt-Recht bleiben allein den nationalen Finanzgerichten bzw. der EU-Kommission vorbehalten. Ergänzend sei bemerkt, dass im Gegensatz zur MwStSystRL, für deren Umsetzung es eines Rechtssetzungsakts auf nationaler Ebene bedarf, der EU-VO 282/2011 (DVO zur MwStSysRL) unmittelbare Wirkung für das nationale Recht zukommt. Insoweit hilft, neben der Lektüre des nationalen Rechts, durchaus an der einen oder anderen Stelle wie z. B. bei den grundstücksbezogenen Leistungen nach Art. 31a ff. EU-VO 282/2011 ein Blick in diese VO.
9https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer_Anwendungserlass/umsatzsteuer_anwendungserlass.html.
Teil B Allgemeiner Überblick über das Umsatzsteuergesetz
1 Allgemeines
Fast täglich werden wir mit der USt konfrontiert, sei es
beim Einkauf von Waren oder
bei der Inanspruchnahme von Werk- bzw. Dienstleistungen (z. B. Haarschnitt beim Friseur, Kinobesuch, Beförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln etc.).
In allen Situationen werden Umsätze erbracht oder, um es mit den Worten des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu sagen, in allen Fällen erhält der Leistungsempfänger einen Vorteil, der zu einem Verbrauch i. S. d. gemeinsamen Mehrwertsteuerrechts führt. Insoweit fällt neben dem Entgelt für die Ware bzw. die Werk- oder Dienstleistung regelmäßig USt an.
Das UStG kennt außer dem eben beschriebenen Haupttatbestand des Leistungsaustauschs, also der Lieferungen und sonstigen Leistungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG), sowie den sich darauf beziehenden sog. Ergänzungstatbestände der unentgeltlichen Wertabgaben (§ 3 Abs. 1b und 9a UStG), die Einfuhr (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG) und den innergemeinschaftlichen Erwerb (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG). Alle fallen unter den Sammelbegriff »Umsätze« des § 1 Abs. 1 UStG.
Allerdings löst nicht jeder Umsatz USt aus. So fällt z. B. keine USt an, wenn eine Privatperson ihren gebrauchten Pkw verkauft. USt entsteht vielmehr nur dann, wenn die Warenverkäufe bzw. sonstigen Leistungen durch einen Unternehmer10 ausgeführt werden.
Typische Unternehmer i. S. d. UStG sind u. a.:
Gewerbetreibende (z. B. der Kaufmann, Fabrikant oder Bauunternehmer),
Freiberufler (z. B. der Rechtsanwalt, Steuerberater oder Architekt).
Insoweit kommt dem Begriff des Unternehmers ‒nach der Begrifflichkeit der MwStSystRL des »Steuerpflichtigen« (Art. 9 ‒ 13 MwStSystRL) ‒im USt-Recht eine Schlüsselfunktion zu. Wie bereits ausgeführt, fällt i. d. R. nur USt an, wenn Unternehmer Umsätze11 tätigen. Nur diese sind dann auch Schuldner der USt. Im Allgemeinen trifft die USt-Schuld den leistenden Unternehmer (§ 13a Abs. 1 Nr. 1 UStG). Der Leistungsempfänger kann ‒ soweit die Voraussetzungen dafür vorliegen ‒ im Gegenzug die von ihm gezahlte USt als Vorsteuer geltend machen (§ 15 UStG).
Allerdings wird dieses Prinzip durchbrochen durch das Bestimmungslandprinzip bei den innergemeinschaftlichen Warenbewegungen (vgl. R) und das sog. Reverse-Charge-Verfahren nach § 13b UStG (vgl. S). Insoweit wird die Steuerschuld auf den die Leistung empfangenden Unternehmer verlagert.
Erbringt jedoch ein Unternehmer Umsätze an private Endverbraucher, verbleibt es beim o. g. Grundsatz und der leistende Unternehmer schuldet die anfallende USt.
Die USt ist im weiteren Sinn eine Verbrauchssteuer.12 Ihr Ziel ist die Besteuerung des Endverbrauchs innerhalb der EU. Dieser soll zum einen nicht unversteuert bleiben, zum anderen aber auch nicht mehrfach besteuert werden. Dies wird dadurch erreicht, dass auf jeder Umsatzstufe USt anfällt, die anfallende USt innerhalb der Unternehmerkette jedoch wiederum als Vorsteuer abgezogen wird. Im Ergebnis fällt dann einmal USt auf der Endstufe, nämlich beim Umsatz an den Endverbraucher an.
Beispiel
Der Pkw-Hersteller P liefert einen Pkw zum Preis von 20 000 € zuzügl. 19 % USt = 3 800 € an den Großhändler G. G liefert den Pkw an den Einzelhändler E mit 10 % Aufschlag zum Preis von 22 000 € zuzügl. 19 % USt = 4 180 €. E liefert den Pkw an den privaten Endverbraucher V mit weiteren 10 % Aufschlag zum Preis von 24 200 € zuzügl. 19 % USt = 4 598 €.
Lösung: P führt aus seiner Lieferung an G 3 800 € USt an das Finanzamt ab. G führt für seine Lieferung an E 4 180 € USt ab. Er hat jedoch aus der Lieferung des P den Vorsteuerabzug i. H. v. 3 800 €. Per Saldo zahlt er also lediglich 4 180 € ./. 3 800 € = 380 € an das Finanzamt. E führt aus seiner Lieferung an V 4 598 € USt an das Finanzamt ab. Er hat aber aus der Lieferung des G den Vorsteuerabzug i. H. v. 4 180 €. Per Saldo zahlt er damit lediglich 4 598 € ./. 4 180 € = 418 € an das Finanzamt. Insgesamt erhält das Finanzamt somit 3 800 € + 380 € + 418 € = 4 598 €. Das ist genau der USt-Betrag, der für die Lieferung an den Endverbraucher V anfällt.
Die anfallende USt kalkulieren die Unternehmer in ihre Preise ein. Insoweit erhöht sich der Preis für den Endverbraucher. Er zahlt indirekt über den Kaufpreis die USt, die der Unternehmer an das Finanzamt abzuführen hat. Deshalb bezeichnet man die USt auch als indirekte Steuer: der wirtschaftliche Träger der Steuer ist nicht identisch mit demjenigen, der sie an das Finanzamt bezahlt.
Dieses Prinzip der indirekten Steuer gilt im Ergebnis auch dann, wenn der Unternehmer selbst zum Endverbraucher wird.
Beispiel
Der Großhändler G liefert den Pkw an den Einzelhändler E zum Preis von 22 000 € zuzügl. 19 % USt = 4 180 €. E nutzt das Fahrzeug nur kurz für seinen Betrieb, dann überlässt er es seiner Ehefrau zur ausschließlich privaten Nutzung.
Lösung: G bezahlt für seine Lieferung an E 4 180 € USt. E hat aus der Lieferung des G zunächst den Vorsteuerabzug i. H. v. 4 180 €. Er muss jedoch die Entnahme des Fahrzeugs aus seinem Unternehmen versteuern (§ 3 Abs. 1b Nr. 1 UStG), d. h. er hat USt i. H. v. 4 180 € an das Finanzamt zu entrichten. Per Saldo bezahlt er also nichts an das Finanzamt; dieses erhält insgesamt 4 180 €. Das ist genau der Betrag, der für die Entnahme aus dem Unternehmen zum privaten Verbrauch anfällt.
Über den Vorsteuerabzug (§ 15 UStG) wird die USt im Unternehmensbereich ausgeglichen (Neutralität der Umsatzsteuer in der Unternehmerkette). Deshalb kommt es vor, dass bei einem Unternehmer zweimal USt anfällt, ohne dass dies einen Systembruch darstellt.
Beispiel
Der Großhändler G in der Schweiz (Drittlandsgebiet) liefert einen Pkw zum Preis von 20 000 € aus der Schweiz an den Einzelhändler E in Deutschland. Aus der Sicht der Schweiz tätigt G eine steuerfreie Ausfuhrlieferung. E holt den Pkw in der Schweiz ab und hat bei der Einfuhr nach Deutschland EUSt i. H. v. 19 % = 3 800 € zu entrichten (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG). Anschließend liefert E den Pkw an den privaten Endverbraucher V mit 10 % Aufschlag zum Preis von 22 000 € zuzügl. 19 % USt = 4 180 €.
Lösung: Die entrichtete EUSt kann E als Vorsteuer abziehen (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 UStG). Per Saldo hat E somit USt i. H. v. 4 180 € zu entrichten. Das ist genau der USt-Betrag, der für die Lieferung an den Endverbraucher V anfällt.
Auch bei Lieferungen aus einem anderen Mitgliedstaat wird das Prinzip der einmaligen Besteuerung des Endverbrauchs gewahrt.
Beispiel
Der Großhändler G mit Sitz in Frankreich liefert einen Pkw zum Preis von 20 000 € aus Frankreich an den Einzelhändler E in Deutschland. Anschließend liefert E den Pkw in Deutschland an den privaten Endverbraucher V mit 10 % Aufschlag zum Preis von 22 000 € zuzügl. 19 % USt = 4 180 €.
Lösung: Die Lieferung des G ist in Frankreich als innergemeinschaftliche Lieferung steuerfrei (analog § 4 Nr. 1 Buchst. B i. V. m. § 13a UStG). Dafür hat E in Deutschland für den Erwerb des Pkw USt i. H. v. 19 % von 20 000 € = 3 800 € zu entrichten (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 i. V. m. § 1a Abs. 1 UStG). Weiterhin hat E für die Lieferung an V 19 % USt = 4 180 € an das Finanzamt zu zahlen. Die entrichtete USt darf E als Vorsteuer abziehen (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 UStG).
Das vorstehende Beispiel belegt das sog. Bestimmungslandprinzip innerhalb der EU: die Besteuerung erfolgt in dem Land, in dem der Verbrauch stattfindet. Dieses Prinzip wird nicht konsequent durchgehalten, sondern für bestimmte Fälle, in denen das Steueraufkommen der beteiligten Mitgliedstaaten nur in geringem Umfang beeinträchtigt wird, zugunsten der Besteuerung im Ursprungsland (Ursprungslandprinzip) durchbrochen.
Beispiel
Der private Endverbraucher V aus Deutschland reist nach Paris. U. a. erwirbt er dort im Bekleidungsgeschäft B einen neuen Anzug zum Preis von 500 € zuzügl. 20 % USt = 100 €. Er nimmt den Anzug sofort mit nach Deutschland.
Lösung: B hat die Lieferung des Anzugs in Frankreich zu versteuern und dort die USt i. H. v. 100 € abzuführen. In Deutschland findet keine Umsatzbesteuerung statt. Die Mitnahme des Anzugs von Frankreich nach Deutschland ist umsatzsteuerrechtlich irrelevant. Hier gilt aus praktischen Gründen das Ursprungslandprinzip. An der Grenze zwischen Frankreich und Deutschland findet keine Zollkontrolle statt. Auch ist es für B nicht ohne weiteres erkennbar, dass sein Kunde aus einem anderen Mitgliedstaat kommt und den Liefergegenstand dorthin mitnimmt.
Im oben dargestellten Fall der Fahrzeuglieferung aus Frankreich musste der Großhändler G in Frankreich keine USt abführen. Dies wurde dadurch ausgeglichen, dass sein Erwerber E gleich zweimal USt zu begleichen hatte, zum einen für den Erwerb und zum anderen für die Weiterlieferung an V. Das Gleiche gilt auch in den Fällen des Reverse-Charge-Verfahrens (vgl. S).
Beispiel
Der private Endverbraucher V beauftragt den Bauunternehmer B in Kehl mit der schlüsselfertigen Erstellung eines Einfamilienhauses in Kehl (Deutschland). B beauftragt damit seinerseits den Subunternehmer S in Straßburg (Frankreich).
Lösung: S erbringt eine in Deutschland steuerpflichtige Werklieferung an B. Dieser erbringt seinerseits eine steuerpflichtige Werklieferung an V. Da S aus deutscher Sicht ein im Ausland ansässiger Unternehmer ist, schuldet nicht S die USt aus der Werklieferung an B, sondern der Abnehmer B (Reverse-Charge-Verfahren gem. § 13b UStG). Für die Werklieferung an V schuldet B nochmals USt. Die im Reverse-Charge-Verfahren geschuldete USt darf B als Vorsteuer geltend machen (§ 15 Abs. 1 Nr. 4 UStG). Per Saldo hat B somit einmal USt i. H. v. 19 % des von V zu zahlenden Entgelts zu entrichten.
10 Die Bezeichnungen erfolgen aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich funktionsbezogen. Sie gelten für alle Geschlechter gleichermaßen.
11 Ausgenommen die Einfuhr und der innergemeinschaftliche Erwerb von neuen Fahrzeugen.
12 Vgl. Art. 1 Abs. 2 Satz 1 MWStSystRL; im engeren Sinn sind Verbrauchsteuern nur die EUSt sowie Steuern wie die Mineralöl- und Sektsteuer.
2 Typische Merkmale des Allphasennetto-Umsatzsteuersystems mit Vorsteuerabzug
Erneut sei ein Blick auf das oben dargestellte Beispiel gestattet:Allphasennetto-Umsatzsteuersystem, mit Vorsteuerabzug
Beispiel
Der Pkw-Hersteller P liefert einen Pkw zum Preis von 20 000 € zuzügl. 19 % USt = 3 800 € an den Großhändler G. G liefert den Pkw an den Einzelhändler E mit 10 % Aufschlag zum Preis von 22 000 € zuzügl. 19 % USt = 4 180 €. E liefert den Pkw an den privaten Endverbraucher V mit weiteren 10 % Aufschlag zum Preis von 24 200 € zuzügl. 19 % USt = 4 598 €.
Lösung: Die umsatzsteuerrechtliche Behandlung lässt sich wie folgt darstellen (in €):
Einkaufspreis netto
Netto-Umsatz
Verkaufspreis netto
USt
Vorsteuer
Zahllast
Bruttoverkaufspreis
P
‒
20 000
20 000
3 800
0
3 800
23 800
G
20 000
2 000
22 000
4 180
3 800
380
26 180
E
22 000
2 200
24 200
4 598
4 180
418
28 798
V
24 200
‒
‒
‒
‒
0
‒
Folgende systematischen Merkmale lassen sich ableiten:
Der Unternehmer versteuert letztlich lediglich die Differenz zwischen Nettoeinkaufs- und Nettoverkaufspreis, den sog. Nettoumsatz. Z. B. beträgt die Differenz beim Einzelhändler E 2 200 €. Multipliziert man diesen Betrag mit dem Steuersatz von 19 %, ergibt sich die oben dargestellte Zahllast des E in Höhe von 418 €. Dies lässt sich damit erklären, dass durch den VStA die Umsatzbesteuerung auf der Vorstufe vollständig rückgängig gemacht wird. Die effektive Besteuerung des Nettoumsatzes nennt man Besteuerung des Mehrwerts. Daher stammt die im allgemeinen Sprachgebrauch übliche Bezeichnung Mehrwertsteuer.Mehrwertsteuer
Wie am obigen Beispiel deutlich wird, bedeutet dies jedoch nicht, dass tatsächlich ein Mehrwert geschaffen wurde, da sich der Pkw auf den einzelnen Umsatzstufen nicht verändert. Vermutlich wird häufig Hand in Hand mit dem Mehrwert i. S. d. UStG auch ein tatsächlicher Mehrwert der Ware durch ihre Ver- oder Bearbeitung etc. geschaffen.
Die USt ist innerhalb der UnternehmerketteUnternehmerkette kostenneutral. Infolge des VStA erhält der Unternehmer seine an den Vorunternehmer bezahlte USt indirekt zurückerstattet und braucht sie somit nicht als Kosten in seine Kalkulation einzubeziehen. Ebenso ist die beim Ausgangsumsatz entstandene USt kostenneutral, wenn der Umsatz an einen Unternehmer für dessen Unternehmen bewirkt wird. In diesem Fall kann die USt voll auf den Abnehmer abgewälzt werden, weil die Höhe der USt beim Abnehmer wegen des VStA ebenfalls keine Rolle spielt. Dies wird deutlich, wenn im u. g. Fall auch V Unternehmer ist und den Pkw für sein Unternehmen kauft. Lässt man sonstige Faktoren außer Betracht, ergibt sich beim Unternehmer E folgende Einnahmen- und Ausgabenrechnung:
Kostenmäßige Darstellung
Kaufpreis Ausgabe(./.)/Einnahme (+)
Umsatzsteuer Ausgabe (./.)/Einnahme (+)
E bezahlt an G:
22 000 € Kaufpreis + 4 180 € Umsatzsteuer
./. 22 000 €
./. 4 180 €
E erhält von V:
24 200 € Kaufpreis + 4 598 € Umsatzsteuer
+ 24 200 €
+ 4 598 €
E bezahlt an das Finanzamt als Zahllast 418 €
./. 418 €
Gesamtergebnis:
+ 2 200 €
0 €
Die USt hat danach auf den Gewinn keinen Einfluss.
Ist dagegen V ‒ wie im Ausgangsbeispiel ‒ Nichtunternehmer, kann möglicherweise eine Überwälzung der USt von E auf V nicht oder nicht in vollem Umfang erfolgen. Denn da V als Nichtunternehmer keinen VStA hat, wird seine Kaufentscheidung ausschließlich vom Bruttoeinkaufspreis abhängen. Ist ihm dieser zu hoch, wird E unter Umständen gezwungen sein, seinen Bruttoverkaufspreis zu Lasten seines Gewinns zu senken. Unterstellt, E würde in diesem Fall seinen Preis um 5 % auf den Kaufpreis in Höhe von brutto 27 358 € ermäßigen, ergäbe sich bei E folgende Einnahmen- und Ausgabenrechnung:
Kostenmäßige Darstellung
Kaufpreis Ausgabe(./.)/Einnahme (+)
Umsatzsteuer Ausgabe (./.)/Einnahme (+)
E bezahlt an G:
22 000 € Kaufpreis + 4 180 € Umsatzsteuer
./. 22 000 €
./. 4 180 €
E erhält von V:
22 990 € Kaufpreis + 4 368 € Umsatzsteuer
+ 22 990 €
+ 4 368 €
E bezahlt an das Finanzamt als Zahllast 188 €
0 €
./. 188 €
Gesamtergebnis:
+ 990 €
0 €
Die USt wirkt sich in diesem Fall nur scheinbar kostenneutral aus, denn E erhält nicht seinen ursprünglich angestrebten kalkulatorischen Gewinn in Höhe von 2 200 €. Wäre der USt-Satz allerdings entsprechend niedriger, würde er diesen bei gleichem Endverkaufspreis erzielen.
Die USt realisiert sich für den Staat letztlich erst auf der Stufe des Endverbrauchers. Er erhält am Ende genau die USt, die der Unternehmer dem Endverbraucher in Rechnung stellt. Das Finanzamt bekommt diesen Betrag gewissermaßen in Raten: 3 800 € von P, 380 € von G und 418 € von E (fraktionierte Zahlungsweise).
Gelangt die Ware nicht an den Endverbraucher, erhält der Staat letztlich keine USt. Unterstellt im obigen Falle geht der Pkw bei E in Flammen auf, bevor er ihn veräußern konnte. Dann hat E nach wie vor den VStA i. H. v. 4 180 €. Mangels Ausgangsumsatz fällt bei ihm jedoch keine Ausgangsumsatzsteuer an. E hat somit einen Vergütungsanspruch von 4 180 €. Damit muss das Finanzamt gewissermaßen den von P und G erhaltenen Betrag von 4 180 € (3 800 € + 380 €) wieder an E ausbezahlen.
Der gleiche Effekt tritt bei einem Verkauf in das Drittlandsgebiet, also in ein Gebiet außerhalb der EU-Mitgliedstaaten ein: Verkauft der Einzelhändler E den Pkw an einen Abnehmer in die Schweiz, ist der von ihm getätigte Umsatz steuerbefreit. E kann trotzdem einen VStA i. H. v. 4 180 € vornehmen. Ein Steueraufkommen für den Fiskus liegt nicht vor. Allerdings kommt der Gegenstand auch in diesem Fall nicht unversteuert zum Endverbraucher, denn i. d. R. erhebt der Einfuhrstaat EUSt. Das Steueraufkommen fließt dann dem Einfuhrstaat zu.
Fazit
Das USt-Aufkommen realisiert sich nur dann, wenn der Umsatz im Inland an einen Endverbraucher gelangt. Nur in diesem Fall fließen dem Fiskus Steuereinnahmen zu.
Bleibt der Umsatz im Unternehmensbereich (Investition) bzw. liegt ein Exportgeschäft vor, kommt es zu keinen USt-Einnahmen für den Fiskus. Der beträchtliche Betrag von ca. 291 394 Mio. € USt-Aufkommen im Kalenderjahr 2023 wird somit ausschließlich13 vom inländischen Endverbraucher getragen.
13 Dies gilt auch dann, wenn der Umsatz auf der Endstufe steuerfrei ist und auf Vorstufen Umsatzsteuer anfällt, da auch diese Umsatzsteuer in den Preis auf der Endstufe einkalkuliert wird.
3 Anwendung des Allphasennetto-Umsatzsteuersystems mit Vorsteuerabzug in der Praxis
Allphasennetto-UmsatzsteuersystemAufgrund des obigen Beispiels (vgl. 2) entsteht der Eindruck, ein Unternehmer habe bezüglich jedes einzelnen Umsatzes durch Saldierung der Ausgangsumsatzsteuer mit der Vorsteuer eine Zahllast zu errechnen. Hält man sich jedoch die Vielzahl der Umsätze vor Augen, die ein Unternehmer tätigt, wird schnell deutlich, dass es einer verfahrensmäßigen Bündelung dieser Aktivitäten und der daraus resultierenden Umsätze bedarf.
Bitte lesen Sie §18 Abs. 1 Satz 1 UStG!
§ 18 Abs. 1 UStG verpflichtet den Unternehmer, i. d. R. für jedes Quartal bzw. ggf. für jeden Kalendermonat (Voranmeldungszeitraum ‒ VZ) auf elektronischem Weg eine sog. USt-VoranmeldungUmsatzsteuer-Voranmeldung abzugeben. Näheres hierzu vgl. W 2. Darin hat er sämtliche Umsätze anzumelden, die er im betreffenden Voranmeldungszeitraum getätigt hat, und die Ausgangsumsatzsteuer zu berechnen. Ferner muss er alle in diesem Zeitraum angefallenen Vorsteuerbeträge ermitteln und auch diese Summe in die Voranmeldung aufnehmen. Die Differenz aus beiden Summen stellt seine Zahllast oder Erstattung für den betreffenden VZ dar. Im Fall einer Zahllast hat er den Betrag bis zum zehnten Tag nach Ablauf des VZ als Vorauszahlung an das Finanzamt abzuführen (Selbstveranlagungsprinzip; vgl. §§ 150 Abs. 1 Satz 3 und 168 Satz 1 AO).
Bitte lesen Sie §18 Abs. 3 Satz 1 UStG!
Nach Ablauf des Kalenderjahres muss der Unternehmer nach demselben Prinzip die endgültige jährliche Zahllast in der USt-Jahresanmeldung berechnen und dem Finanzamt melden. Der Unternehmer reicht somit im Regelfall neben zwölf USt-Voranmeldungen eine USt-Jahresanmeldung ein.
Die Verpflichtung zur Abgabe von zwölf bzw. vier Voranmeldungen bezweckt ein zeitnahes Entrichten der USt an den Fiskus. Die zusätzliche Erfassung sämtlicher Umsätze und Vorsteuern in der USt-Jahresanmeldung schafft sowohl für den Unternehmer als auch für den Staat die Möglichkeit, die gesamte jährliche Zahllast nochmals zu ermitteln bzw. zu verifizieren.
Ist die Summe der Vorauszahlungen niedriger als die Zahllast in der Jahressteueranmeldung, hat der Unternehmer die Differenz gem. § 18 Abs. 4 Satz 1 UStG innerhalb eines Monats nach Abgabe der Jahresanmeldung nachzuentrichten.
Anmerkung: Tätigt der Unternehmer Warenverkäufe an Unternehmer, die in den anderen Mitgliedstaaten der EU ansässig sind, muss er neben den Voranmeldungen auch noch sog. Zusammenfassende Meldungen (ZM) gem. § 18a UStG beim BZSt einreichen (Näheres hierzu vgl. W 12).
4 Sonderregelungen für den innergemeinschaftlichen Warenverkehr
Für den Warenverkehr mit dem Ausland galt bis Ende des KJ 1992 allgemein der Grundsatz:
Einfuhren werden mit EUSt belastet.
Ausfuhren werden von der USt als steuerfreie Ausfuhrlieferungen entlastet.
Mit dem Wegfall der innergemeinschaftlichen Zollgrenzen musste ein neues Verfahren gefunden werden.
Als Alternativen boten sich an:
Besteuerung am Ort der Leistung (Ursprungslandprinzip) und Verteilung der insgesamt innerhalb der EU angefallenen USt auf die Mitgliedstaaten entsprechend der makroökonomischen Basis (z. B. nach Einwohnerzahl). Dies hätte jedoch einheitliche Steuersätze innerhalb der EU vorausgesetzt. Insoweit schied diese Alternative aus.
Besteuerung am Ort des Verbrauchs (Bestimmungslandprinzip), was aber nach dem Wegfall der innergemeinschaftlichen Zollgrenzen Ersatzlösungen erforderte. Diese Alternative wurde mit gewissen Einschränkungen realisiert.
Hieraus ergaben sich verschiedene Fallgruppen:
a) Fallgruppe 1
Der größte Teil des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs betrifft den Warenverkehr im zwischenunternehmerischen Bereich (sog. B2B-Umsätze ‒ Business to Business). Das Bestimmungslandprinzip ließ sich dadurch aufrechterhalten, dass an die Stelle der Einfuhrumsatzsteuer die Erwerbsumsatzsteuer (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG) trat.
Beispiele
Unternehmer A in Frankreich liefert an Unternehmer B in Deutschland Waren.
Lösung: Die Lieferung des A an den Erwerber B in Deutschland ist als innergemeinschaftliche Lieferung in Frankreich steuerfrei (analog § 4 Nr. 1b i. V. m. § 6a UStG). B tätigt in Deutschland einen innergemeinschaftlichen Erwerb, der als eigenständiger Umsatz (als Ersatz für die frühere EUSt) steuerbar und stpfl. ist (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 i. V. m. § 1a UStG).
Unternehmer A in Deutschland unterhält eine unselbstständige Zweigniederlassung in Frankreich. Er befördert Waren von seinem Unternehmen in Deutschland zur Zweigniederlassung nach Frankreich.
Lösung: Der Transport der Waren von Deutschland nach Frankreich stellt ein Verbringen dar. Dieses ist ‒ sofern es im Inland erfolgt ‒ aufgrund des Grundsatzes der Unternehmensheit (§ 2 Abs. 1 Satz 2 UStG) als sog. rechtsgeschäftsloses Verbringen nicht steuerbar. Erfolgt das Verbringen jedoch von einem Mitgliedstaat in einen anderen, werden eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung im Ursprungsland (§§ 1 Abs. 1 Nr. 1, 3 Abs. 1a, 3 Abs. 6; 4 Nr. 1b und 6a Abs. 2 UStG) und gleichzeitig ein steuerpflichtiger innergemeinschaftlicher Erwerb im Bestimmungsland fingiert, den A im Bestimmungsland zu versteuern hat (§§ 1 Abs. 1 Nr. 5, 1a Abs. 2 UStG). Hintergrund für diese Fiktion ist der Umstand, dass die Warenbewegung anhand der umsatzsteuerlichen Regelungen nachvollzogen werden soll. Überdies gilt es ganz allgemein, Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, die aufgrund der unterschiedlichen Steuersätze in den Mitgliedstaaten entstehen können.
Zur Gewährleistung der Besteuerung im Bestimmungsland wurden Kontrollmechanismen geschaffen (vgl. § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG, § 6a Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 4 UStG). Dies führt dazu, dass die Befreiung der innergemeinschaftlichen Lieferung nur dann gewährt wird, wenn Lieferer und Abnehmer unter ihrer USt-IdNr. im jeweiligen Mitgliedstaat registriert sind, diese auch aktiv verwenden und überdies der Lieferer eine sog. Zusammenfassende Meldung (ZM, § 18a UStG) abgibt, in der er die Details seiner Lieferung, insbesondere den Abnehmer und dessen USt-IdNr. etc. (vgl. § 18a Abs. 7 UStG) an das BZSt meldet. Der Waren-Abgangsstaat übermittelt diese Informationen dem Mitgliedstaat des Erwerbs, um diesem die Kontrolle der Erwerbsbesteuerung zu ermöglichen.
Ausnahmsweise kommt innerhalb dieser Fallgruppe das Ursprungslandprinzip zum Zug, wenn die Erwerber zwar Waren für ihr Unternehmen erwerben, es sich jedoch um Unternehmer mit speziellen Eigenschaften handelt, wie z. B. Unternehmer mit ausschließlich steuerfreien Umsätzen wie z.B. Ärzte (§ 4 Nr. 14 UStG) und die Erwerbe bestimmte Umsatzgrenzen (sog. Erwerbsschwellen) nicht überschreiten (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 i. V. m. § 1a Abs. 3 UStG).
b) Fallgruppe 2
Ein weiterer bedeutsamer Bereich des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs ist der sogenannte Versandhandel an Privatpersonen (sog. B2C-Umsätze ‒ Business to Consumer). Dabei befördert oder versendet der Lieferer die Waren zum Abnehmer in einen anderen Mitgliedstaat. Da die Besteuerung des Erwerbs bei Privatpersonen nicht realisierbar ist, wird in diesen Fällen ‒ von einigen Ausnahmen abgesehen ‒ bei Überschreiten eines bestimmten Umsatzvolumens der Lieferort vom Ursprungsland des Warenabgangs in das Bestimmungsland des Warenempfangs verlagert (vgl. § 3c UStG). Der Lieferer hat in diesen Fällen die Lieferung im Bestimmungsland zu versteuern. Diese Regelung wird als Fernverkauf bezeichnet. Um zu vermeiden, dass die Lieferanten der Ware sich für diese Art der Lieferungen in jedem Bestimmungsstaat für Umsatzsteuerzwecke registrieren lassen müssen, wurde mit dem sog. One-Stop-Shop-Verfahren (§ 18h UStG) eine Vereinfachung geschaffen.
Beispiel
Versandhändler V in Deutschland beliefert Kunden in den anderen Mitgliedstaaten. Diese bestellen anhand eines Katalogs. Die Waren werden von V zu den Kunden versandt.
Lösung: Mit Überschreiten der Lieferschwelle (§ 3c Abs. 4 Satz 1 UStG) verlagert sich der Lieferort ins Bestimmungsland, d. h. ihm kommt dann das aus diesen Umsätzen resultierende Steueraufkommen zugute. Der Lieferer kann sich für das besondere Besteuerungsverfahren (OSS) nach § 18h UStG beim BZSt registrieren lassen.
Überschreiten die Lieferungen des Versandhändlers die o. g. Lieferschwelle nicht, verbleibt es bei der Besteuerung im Abgangsstaat der Ware (Herkunftsland).
c) Fallgruppe 3
Erwirbt eine in einem Mitgliedstaat ansässige Privatperson in einem anderen Mitgliedstaat Ware und befördert oder versendet sie diese in ihren Ansässigkeitsstaat, lässt sich das Bestimmungslandprinzip ebenfalls kaum durchführen. Weder vom Erwerber noch vom Lieferer kann verlangt werden, im Bestimmungsland zu versteuern, zumal zuletzt Genannter oftmals nicht weiß, ob die Ware im Ursprungsland bleibt oder in einen anderen Mitgliedstaat mitgenommen wird. Fälle dieser Art haben im Allgemeinen keine maßgebende Auswirkung auf das USt-Aufkommen, daher bleibt es insoweit bei der Besteuerung im Ursprungsland.
Beispiel
Die Privatperson P aus Deutschland verbringt ihren Urlaub in Österreich. Sie erwirbt dort einige Souvenirs, die sie mit nach Deutschland nimmt.
Lösung: Die Lieferungen sind in Österreich steuerbar und steuerpflichtig. In Deutschland erfolgt hierfür keine Besteuerung.
Ausnahmsweise findet auch in dieser Fallgruppe das Bestimmungslandprinzip Anwendung, wenn es sich um den Erwerb neuer Fahrzeuge handelt (§ 1b UStG). Aufgrund des Wertes dieser Gegenstände käme es bei einer Realisierung des Ursprungslandprinzips zu einer unzumutbaren Wettbewerbsverzerrung zugunsten der Unternehmer, die ihr Unternehmen in einem Mitgliedstaat mit niedrigem Steuersatz betreiben und zu Lasten der Mitgliedstaaten mit höheren Steuersätzen. Die Kontrolle wird dadurch erleichtert, dass Fahrzeuge dort, wo sie genutzt werden, angemeldet werden müssen.
5 Besteuerungsformen des Umsatzsteuergesetzes
Das Allphasennetto-UmsatzsteuersystemAllphasennetto-Umsatzsteuersystem mit Vorsteuerabzug wird im UStG nicht immer stringent durchgeführt. Es erfährt vielmehr teils aus Vereinfachungs-, teils aus wirtschafts- und sozialpolitischen Gründen Abwandlungen und Systembrüche.Besteuerungsform, KleinunternehmerregelungBesteuerungsformen des Umsatzsteuergesetzes, Differenzbesteuerung (§ 25a UStG)Besteuerungsformen des Umsatzsteuergesetzes, Regelbesteuerung (§§ 1 ‒ 18 UStG)
Besteuerungsformen
Regelbesteuerung
Allphasennettobesteuerung mit Vorsteuerabzug
Differenzbesteuerung
• Besteuerung von Reiseleistungen (§ 25 UStG)
Differenzbesteuerung (§ 25a UStG)
Besteuerung mit pauschalem Vorsteuerabzug
• Besteuerung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (§ 24 UStG)
Besteuerung begünstigter Vereinigungen i. S. v. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG (§ 23a UStG)
Steuerbefreit
Kleinunternehmer (§ 19 UStG)
ImBesteuerungsform, Differenzbesteuerung weiterenBesteuerungsform, land- und forstwirtschaftliche Betriebe VerlaufBesteuerungsform, allgemeine Durchschnittsätze dieses Lehrbuchs wird insbesondere die Regelbesteuerung näher erörtert. Ob ein Unternehmer die Besteuerung nach dem Grundfall der Regelbesteuerung vorzunehmen hat, hängt u. a. davon ab, dass sein Vorjahresgesamtumsatz mehr als 25 000 € beträgt und im laufenden KJ 100 000 € voraussichtlich übersteigen wird (Näheres hierzu vgl. U). Ist im Folgenden von einem Unternehmer die Rede und ergibt sich aus dem Sachverhalt nicht ausdrücklich etwas Gegenteiliges, handelt es sich stets um einen Unternehmer, der der Regelbesteuerung unterliegt.
6 Ausgangsumsatzsteuer
6.1 Steuergegenstand
Die Zahllast des Unternehmers ergibt sich als Saldo von Ausgangs-USt und Vorsteuer. Sie stellen somit die beiden Säulen dar, auf denen das USt-System ruht. Gegenstand der Ausgangs-USt (Steuergegenstand) ist der Umsatz (Ausgangsumsatz). Im folgenden Kapitel werden die einzelnen Arten der steuerbaren Umsätze vorgestellt.
§ 1 Abs. 1 UStG enthält eine abschließende Aufzählung der drei UmsatzartenAusgangsumsatzsteuer, Umsatzarten:
Lieferungen und sonstige Leistungen gegen Entgelt (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG),
Einfuhr (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG) und
innergemeinschaftlicher Erwerb (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 UStG).
6.1.1 Umsatzart Lieferungen und sonstige Leistungen
Typische Fälle der Umsatzart nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG sind:
Lieferungen von Gegenständen und
sonstige Leistungen, wie z. B. Dienst-, Werk- und Vermietungsleistungen.
Unentgeltliche Lieferungen und sonstige Leistungen an den Unternehmer selbst oder andere Personen werden unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 b und Abs. 9a UStG entgeltlichen Lieferungen bzw. sonstigen Leistungen gleichgestellt. Sie sind dann ebenfalls steuerbar nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG. Diese sog. Gleichstellungstatbestände behandelt Kapitel Q.
Typische Fälle unentgeltlicher Lieferungen nach § 3 Abs. 1b UStG sind:
Warenentnahmen für den privaten Bedarf,
Sachgeschenke an das Personal oder an Dritte (Kunden).
Typische Fälle von unentgeltlichen sonstigen Leistungen nach § 3 Abs. 9a UStG sind: Privatnutzung von Betriebsgegenständen, insbesondere von Pkws oder Einsatz von Personal im außerunternehmerischen Bereich.
Näheres vgl. C.
6.1.2 Einfuhr
Die Umsatzart »Einfuhr« nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 UStG liegt vor, wenn Gegenstände aus Gebieten außerhalb der EU (sog. Drittlandsgebiet nach § 1 Abs. 2a Satz 3 UStG) in den freien Warenverkehr im Inland eingeführt werden. Damit soll verhindert werden, dass Waren aus dem Drittland unversteuert in den Endverbrauch gelangen. Es wird gewährleistet, dass die eingeführten Waren mit inländischer USt (Bestimmungslandprinzip) belastet werden. Die Erhebung dieser EUSt erfolgt bei den Zollämtern, z. B. an Flughäfen.
Bislang wurden Einfuhren mit einem Wert von bis zu 22 € gem. § 1a EUStBV von der Einfuhrumsatzsteuer befreit. Der Missbrauch dieser Regelung verursachte allerdings zunehmend Steuerausfälle und Wettbewerbsnachteile für EU-ansässige Händler. Daher trat die Steuerbefreiung mit der Einführung der neuen Fernverkaufsregeln (§ 3c sowie § 3 Abs. 3a UStG) zum 01.07.2021 außer Kraft. Damit fällt Einfuhrumsatzsteuer für jede Einfuhr an. Die Zollbefreiung für Sendungen mit einem Wert bis zu EUR 150 gem. Art. 23 Abs. 1 ZollbefrVO bleibt dagegen bestehen.14
6.1.3 Innergemeinschaftlicher Erwerb
Einen innergemeinschaftlichen Erwerb nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 i. V. m. § 1 a UStG versteuert ein Unternehmer im Inland, der von einem anderen Unternehmer aus dem Gebiet eines anderen EU-Mitgliedstaats Ware erworben hat.
Die Erwerbsbesteuerung bewirkt, dass Waren aus anderen Mitgliedstaaten grundsätzlich mit der gleichen USt belastet werden wie die im Bestimmungsland produzierten. Insoweit dient sie der Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen. Näheres vgl. R.
14 Zur Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer bedarf es für jede Sendung einer Einfuhrabfertigung. Dies verursacht einen erhöhten Verwaltungsaufwand. Insoweit sieht § 21a UStG eine Verfahrenserleichterung vor für die Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer auf Sendungen mit einem Höchstwert von EUR 150. Dies stellt eine Sonderregelung für Fernverkäufe von aus Drittländern eingeführten Gegenständen dar, die direkt an einen Erwerber im Zollgebiet der Union versandt werden. Sie findet nur Anwendung, wenn der Lieferant der Ware nicht das Besteuerungsverfahren nach § 18k UStG nutzt oder die Sendung nicht im Normalverfahren eingeführt wird.





























