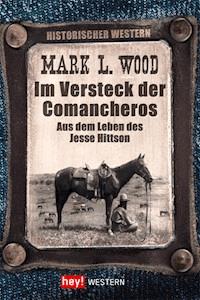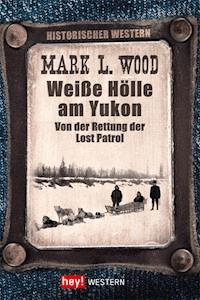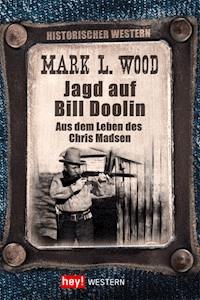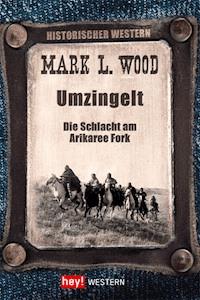
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HEY Publishing GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Western
- Sprache: Deutsch
Abner »Sharp« Grover gehört zu einer Gruppe von fünfzig erfahrenen Westmännern, die im Sommer 1868 in die Jagdgründe der Cheyenne eindringen, um die Indianer zu besiegen und in die Reservate zurückzutreiben. Am 16. September reiten sie in eine Falle der Indianer, und es gelingt ihnen nur unter großen Verlusten, sich auf eine Insel im Arikaree River zurückzuziehen. Ungefähr achthundert Indianer warten nur darauf, ihnen den endgültigen Todesstoß zu versetzen. Nur ein Wunder kann sie noch retten, und die sind im amerikanischen Westen eher selten. Der historische Kampf einer verschworenen Einheit gegen Roman Nose und seine Cheyenne-Krieger.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mark L. Wood
Umzingelt
Copyright der eBook-Ausgabe © 2013 bei Hey Publishing GmbH, München.
Originalausgabe © 2006, BASTEI, Bergisch Gladbach. Erschienen in der Reihe Western-Legenden.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Mark L. Wood wird vertreten durch die Verlagsagentur Lianne Kolf.
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung: FinePic®, München
Autorenfoto: © privat
ISBN: 978-3-942822-44-2
Besuchen Sie uns im Internet:
www.heypublishing.com
www.facebook.com/heypublishing
Abner "Sharp“ Grover gehört zu einer Gruppe von fünfzig erfahrenen Westmännern, die im Sommer 1868 in die Jagdgründe der Cheyenne eindringen, um die Indianer zu besiegen und in die Reservate zurückzutreiben. Am 16. September reiten sie in eine Falle der Indianer, und es gelingt ihnen nur unter großen Verlusten, sich auf eine Insel im Arikaree River zurückzuziehen. Ungefähr achthundert Indianer warten nur darauf, ihnen den endgültigen Todesstoß zu versetzen. Nur ein Wunder kann sie noch retten, und die sind im amerikanischen Westen eher selten.
Der historischer Kampf einer verschworenen Einheit gegen Roman Nose und seine Cheyenne-Krieger.
Bill Comstock kam nicht mehr dazu, etwas zu sagen. Eine Kugel traf ihn in den Rücken und riss ihn aus dem Sattel. Mit einem Auf schrei stürzte er zu Boden.
»Bill!«, rief Abner entsetzt. Im selben Augenblick traf auch ihn eine Kugel, und er spürte einen stechenden Schmerz an der Hüfte. Die Wucht der Kugel schleuderte ihn vom Pferd. Er prallte auf den harten Steppenboden, umklammerte den Karabiner mit eiserner Faust und kämpfte verzweifelt gegen eine drohende Bewusstlosigkeit an.
Durch die Schleier vor seinen Augen sah er, wie beide Pferde davonliefen. Mit einem heiseren Fluch stützte er sich auf die Ellbogen. Er sah, dass die feindlichen Krieger nur noch hundert Schritte entfernt waren, und robbte keuchend zu seinem leblosen Freund. Mit schmerzverzerrtem Gesicht blickte er ihn an. In der Brust des Scouts klaffte ein blutiges Loch, wo die Kugel ausgetreten war, sein Blick war starr und leer. Er lag auf der Seite, beide Hände nach seinem Karabiner ausgestreckt, der nur wenige Schritte entfernt auf dem staubigen Boden lag. Unter seinem Körper hatte sich eine Blutlache gebildet.
Abner Grover, von allen nur »Sharp« genannt, schnappte sich die Waffe. Er wusste, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb. Die Krieger kamen immer näher und stießen im Gefühl des sicheren Sieges laute Triumphschreie aus. Sie würden ihren Spaß mit dem weißen Mann haben, bevor sie ihn töteten.
So glaubten sie jedenfalls. Schließlich hatte ein weißer Mann gegen sieben tapfere Cheyenne keine Chance. Sieben war eine heilige Zahl. Der Große Geist ritt mit ihnen und würde sie beschützen.
»Das könnte euch so passen!«, stieß der Scout wütend hervor. »So leicht kriegt ihr mich nicht, ihr Hundesöhne!«
Sharp und Bill waren am frühen Morgen von Fort Wallace aufgebrochen. Ihr Auftrag lautete, die Spuren der aufständischen Sioux und Cheyenne zu finden, doch die Krieger hatten sich über das ganze Land verstreut und streiften in kleinen Banden umher. Die beiden Scouts waren einer dieser Banden gefolgt - und ihnen bereits nach wenigen Meilen in die Falle gegangen.
Sharp verschanzte sich hinter seinem toten Freund. »Tut mir Leid, Kumpel!«, sagte er zu ihm. »Anders geht es nicht. Unsere Gäule sind auf und davon, und auf offener Prärie knallen mich die roten Halunken ab wie die Hasen!«
Er lud den Karabiner durch und legte auf den vordersten Krieger an. Den Schmerz an seiner Hüfte spürte er kaum. Er lebte seit über zwanzig Jahren im Westen und war nicht zum ersten Mal verwundet. Vor vier Jahren, als Scout in Fort Phil Kearny, hatten sie ihn schon für tot erklärt, doch er war den Sioux entwischt und hatte sich mit letzter Kraft ins Fort geschleppt. Der Arzt hatte drei Kugeln aus seiner Brust geholt, ungläubig den Kopf geschüttelt und sich gewundert, dass er noch lebte.
Er drückte den Abzug durch und registrierte zufrieden, wie der anvisierte Krieger vom Pferd kippte und sich auf dem harten Boden mehrfach überschlug. Er blieb reglos im trockenen Büffelgras liegen.
Seine Stammesbrüder reagierten mit wütendem Geheul. Ihr Angriff kam für einen Augenblick ins Stocken, ein Zeichen dafür, dass es sich um junge und unerfahrene Krieger handelte, und Sharp nützte ihr Zögern und holte den zweiten Krieger von seinem Pony. Auch dieser stürzte zu Boden, rappelte sich auf und wurde von einem anderen Krieger fast über den Haufen geritten. Einen Lidschlag später wunder er von Sharps dritter Kugel umgerissen - und diesmal stand er nicht wieder auf.
Wieder erhob sich wütendes Kriegsgeheul.
»Na, was sagt ihr jetzt?«, rief Sharp mit verschwitztem Gesicht. »Gegen Mr. Spencer ist kein Kraut gewachsen, was?« Er klopfte gegen den Verschluss seines Karabiners und lächelte grimmig. »Nur weiter so, ihr Schwachköpfe! Bloß keine Müdigkeit vorschützen! Der Teufel freut sich, wenn ich ihm ein paar rote Halunken in die Hölle schicke!«
Doch die Krieger hatten erst einmal genug, zerrten hektisch ihre Pferde herum und verschwanden hinter einem Hügel.
Sharp atmete tief durch und legte seinem toten Freund eine Hand auf die Schulter. »Hast du das gesehen, Bill? Ich hab's ihnen ganz schön gegeben, was? Die Halsabschneider dachten wohl, sie könnten uns einfach überrennen!« Er blickte in das staubverkrustete Gesicht des Freundes und drückte ihm die Augen zu. »Keine Angst, Kumpel! Das haben sie nicht umsonst gemacht!«
Er wischte sich die verschwitzten Hände an der Lederweste trocken und hob vorsichtig den Kopf. Die Indianer waren verschwunden. Nur noch die staubigen Schleier über den Hügeln und die beiden Toten erinnerten an sie. Eine beinahe gespenstische Ruhe lag über der ausgetrockneten Prärie.
Doch Sharp lebte bereits zu lange in der Wildnis, um sich bluffen zu lassen. Die Krieger waren jung und fühlten sich in ihrer Ehre gekränkt. Sie mussten es noch einmal versuchen, wenn sie am großen Feuer gefeiert werden wollten. Sie hatten den toten Comstock weder berührt noch skalpiert. Wenn sie mit leeren Händen zurückkehrten, würde keiner der Anführer sie jemals zu einem Kriegszug einladen, und man würde sie zu den Kindern in die Tipis sperren.
Diesmal versuchten die jungen Krieger, ihre Beute zu überlisten. Sie ritten in einem großen Bogen um Sharp herum und tauchten urplötzlich in seinem Rücken auf. Nur ihr überhastet ausgestoßenes Kriegsgeheul rettete dem Scout das Leben. Erbrachte sich mit einem verzweifelten Satz auf die andere Seite seines toten Freundes in Sicherheit und riss den Karabiner an die Wange.
»Kommt und holt es euch!«, forderte er die herangaloppierenden Krieger heraus.
Die Indianer griffen auf breiter Front an, ritten im weiten Abstand voneinander, um Sharp das Zielen zu erschweren. Sie waren nicht so dumm, wie der Scout gehofft hatte. Einer schwang ein modernes Repetiergewehr, die anderen drei besaßen einschüssige Springfields, die sie wohl Soldaten abgenommen hatten.
»Hokahey!«, hörte Sharp den Krieger mit dem Repetiergewehr rufen.
Dicht vor Sharp klatschten zwei Kugeln in Comstocks leblosen Körper. Ein weiteres Geschoss traf die Gürtelschnalle des toten Scouts und zirpte als Querschläger davon. Die Krieger waren bis auf fünfzig Schritte heran. Ihre wütenden Kriegsrufe hallten durch die stickige Luft und hätten neun von zehn weißen Männern das Blut in den Adern stocken lassen.
Doch Sharp war aus einem anderen Holz geschnitzt. Der stämmige Scout mit dem kantigen Gesicht, der mit seinem wettergegerbten Gesicht und den dunklen Augen beinahe selbst wie ein Indianer aussah, rannte vor fünf jungen Kriegern nicht davon. In friedlicheren Zeiten hatte er zwei Jahre bei den Sioux gelebt. Er war mit ihnen gegen die Crow gezogen, hatte zwei Skalps genommen und war bei der Büffeljagd dabei gewesen. Beim Sonnentanz hatte er eine junge Oglala geheiratet, die Badet-ihre-Knie-im-Wasser hieß und außer ihrer Sauberkeit noch andere Vorzüge besaß. Seit sich die Sioux, Cheyenne und Arapaho auf dem Kriegspfad befanden, hatte er sie aus den Augen verloren. Manchmal träumte er von ihr.
Sharp tötete den Krieger mit dem Repetiergewehr durch einen Schuss in den Kopf. Dem Cheyenne blieb nicht einmal Zeit für einen Schrei. Er kippte vom Pferd und fiel lautlos zu Boden.
Ein weiteres Geschoss traf einen der restlichen vier Krieger in die Brust. Dieser sackte nach vorn, klammerte sich in die Mähne seines Ponys und galoppierte nach rechts davon. Sharp verschoss die letzte Kugel aus dem Karabiner seines toten Freundes und gab dem verwundeten Krieger den Rest.
Hastig lud er seinen eigenen Karabiner durch. Doch die jungen Krieger hatten genug. Sie rissen entmutigt ihre Pferde herum und brachten sich hastig in Sicherheit. Sie hatten nicht einmal mehr den Mut, ihre Toten zu bergen. Sie ritten, ohne sich umzublicken, über die Hügel davon und verschwanden im flimmernden Hitzedunst...
Diesmal war sich Sharp sicher, dass die Krieger nicht zurückkehren würden. Sie hatten gesehen, dass gegen ihn nichts zu holen war, und gaben auf. Die Opfer waren auch jetzt bereits zu hoch für zwei lausige Skalps.
Sharp blieb erschöpft sitzen und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Erst jetzt spürte er den drückenden Schmerz, der von seiner Hüftwunde ausging. Er griff unter sein Hemd und berührte vorsichtig die blutende Stelle. Ein glatter Durchschuss, aber er hatte viel Blut verloren und brauchte dringend einen Arzt, wenn sich die Wunde nicht entzünden sollte. Fluchend wischte er seine blutige Hand am Büffelgras trocken.
Automatisch lud er den Spencer-Karabiner seines toten Freundes nach.
Ihre Pferde waren verschwunden, aber er besaß jetzt zwei Karabiner, die er notfalls als Krücken benutzen konnte. Bei dem Gedanken lachte er heiser. Er wurde langsam alt. Mit über vierzig Jahren gehörte er bereits zu den Veteranen in Fort Wallace, die meisten Offiziere eingeschlossen. Doch kaum einer kannte die Indianer so gut wie er. Er sprach fließend Sioux und Cheyenne und konnte die Krieger des Stammes aus weiter Entfernung unterscheiden.
Und kaum einer der anderen Scouts fand sich auf den High Plains so gut zurecht wie er. Es gab keinen besseren Kundschafter als ihn. Sogar General Philip H. Sheridan, der Befehlshaber des Military Department of the Missouri, kannte seinen Namen. Und Major George A. Forsyth hatte sich persönlich dafür eingesetzt, dass Abner »Sharp« Grover zum Chefscout in Fort Wallace wurde.
Er stemmte sich vom Boden hoch und schloss die Augen, bis er wieder klar sehen konnte. Die Verletzung war anscheinend schlimmer, als er vermutet hatte. Er blickte auf die Stelle und sah den klitschnassen Blutfleck auf seinem Hemd und seiner Lederjacke. Vor sich hin fluchend presste er sein Halstuch auf die Wunde, bevor er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht die Karabiner über die Schultern hängte.
»Tut mir Leid, Bill!«, sagte Sharp zu seinem toten Freund. »Ich würde dich gern begraben. Aber unsere Gäule sind mit den Spaten durch, und mit den Händen brauch' ich gar nicht erst anzufangen. Du siehst ja selbst, wie's mir geht. Falls ich's jemals bis nach Fort Wallace schaffe, schick ich die Soldaten zu dir. Du bist mir doch nicht böse, oder?« Er zögerte einen Moment, als würde er wirklich eine Antwort erwarten.
Doch dann machte er sich seufzend auf den Weg. Bis zum Fort waren es ungefähr dreißig Meilen, aber in einem halben Tag würde er die Schienen der Kansas Pacific Railroad erreichen. Mit etwas Glück kam ein Bauzug vorbei, der ihn bis zum Fort mitnahm. Das Ende der Strecke lag nur wenige Meilen entfernt. Bis zum Ende des Jahres 1868 sollten die Schienen der Kansas Pacific bis zur Grenze zwischen Kansas und Colorado reichen.
Bis Sonnenuntergang war jeder Schritt eine Qual, aber dann ließ wenigstens die Hitze nach, und der kühle Abendwind linderte seine Schmerzen. Seine Schritte, die quälend langsam geworden waren, wurden wieder schneller. Noch waren es fünf Meilen bis zur Eisenbahn, aber im Schutz der hereinbrechenden Nacht brauchte er wenigstens keine Angst zu haben, einem Trupp kriegerischer Sioux oder Cheyenne zu begegnen. Auf der offenen Prärie wäre er ihnen hoffnungslos ausgeliefert gewesen. Nicht nur junge und unerfahrene Krieger trieben sich hier herum.
Die Indianer waren auf dem Kriegspfad, seit immer mehr Weiße über den Smoky Hill Trail zogen, und die Kansas Pacific unablässig nach Westen vordrang. Die aufgebrachten Krieger überfielen Ranches, Farmen, Eisenbahncamps und die Kutschen von Wells Fargo. Die Soldaten der Forts am Smoky Hill und Solomon River waren in höchster Alarmbereitschaft, und Scouts wie Abner »Sharp« Grover durchkämmten das Gebiet, um die Kriegscamps der Indianer ausfindig zu machen. Ein blutiger Indianerkrieg stand vor der Tür.
Sharp stolperte und fiel zu Boden. Stechender Schmerz durchfuhr seinen ganzen Körper. Neues Blut drang aus der Wunde und sickerte warm und klebrig durch das Halstuch. »Verdammt!« Er stand mit verkniffener Miene auf und biss die Zähne zusammen. Wenn er so weitermarschierte, hatte er es in zwei oder drei Stunden geschafft! Zum Teufel mit der Wunde!
Er nahm einen Schluck aus seiner Feldflasche, die er immer am Körper trug und in dem Bach mit frischem Wasser gefüllt hatte, und lief weiter. Er kannte die Gegend gut genug, um sich auch bei Nacht zurechtzufinden. Der Mond stand voll am Himmel und war von einer Vielzahl von Sternen umgeben. Die Nacht war ruhig. Ein trügerischer Frieden lag über der Prärie.
Gegen Mitternacht erreichte er endlich die Schienen. Ihnen folgte er zu einem Haltepunkt, der lediglich aus einem Schuppen und einem Wasserturm bestand, und setzte sich auf den Boden. Es konnte Stunden dauern, bis ein Zug vorbeikam, aber lieber warten und frieren als zwanzig Meilen laufen und verbluten. Er tränkte sein Halstuch mit dem kühlen Wasser aus der Feldflasche und presste es auf die Wunde.
Das Glück blieb ihm treu. Schon eine Stunde nach seiner Ankunft war der schrille Pfiff einer Lokomotive zu hören. Er schreckte aus seinem Halbschlaf und trat neben die Schienen. Die Frontlampe der Lok schaukelte durch die Dunkelheit und kam immer näher. Mit quietschenden Bremsen erreichte der kurze Bauzug den Haltepunkt. Er bestand aus der Lokomotive, einem geschlossenen und zwei offenen Güterwagen mit Schienen und Schwellen.
Neben dem Wasserturm kam er zum Stehen. Der Lokführer kletterte aus dem Führerstand und blickte den verletzten Scout überrascht an. »Wo kommen Sie den her, Mister?«
»Ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit ungezogenen Cheyenne«, antwortete Sharp mit einem gequälten Grinsen. »Abner Grover ... ich bin Scout in Fort Wallace.« Er kniff die Lippen zusammen. »Nehmen Sie mich zum Fort mit? Ich hab leider was abgekriegt!«
Der Lokführer betrachtete die Wunde und schüttelte ungläubig den Kopf. »Sieht nicht gut aus! Andere Leute wären mit so einem Loch längst tot! Kommen Sie!«
Er wandte sich an die beiden Arbeiter, die in der offenen Tür des Güterwagens standen und rauchten. »Bück! John!«, rief er. »Helft dem armen Kerl in den Wagen! Das ist Sharp Grover. Die Indianer haben ihm eine Kugel verpasst. Worauf wartet ihr noch?« Er trieb die Männer mit einer ungeduldigen Handbewegung an und fügte hinzu: »Machen Sie sich keine Sorgen, Grover! Wir werfen ein paar Kohlen mehr in den Kessel, dann liegen Sie in einer halben Stunde im Bett des Doktors. Wie ich Doc Moers kenne, spendiert er Ihnen ein Gläschen seines besten Whiskeys!«
»Eine Flasche war mir lieber!«, stöhnte Sharp, als ihm die Arbeiter in den Wagen halfen. Er sank zu Boden und lehnte sich erschöpft gegen die Wand. »Welcher Teufel hat mich nur geritten, diesen verdammten Job anzunehmen?«, seufzte er, als der Zug losfuhr.
Georgette Sayers kannte den Westen nur vom Hörensagen. Sie war neunzehn und bildhübsch. Ihre Augen strahlten so blau wie ein Bergsee in Montana. Sie hatte ihr blondes Haar zu einem modischen Knoten gebunden und trug ein grünes Reisekleid und einen zylinderähnlichen Hut mit grünen Bändern. Außer einem langweiligen Handelsvertreter, der die meiste Zeit geschlafen hatte, und ihrer Gouvernante, einer unauffällig gekleideten Frau in mittleren Jahren, war sie der einzige Fahrgast.
Es war um die Mittagszeit, und die Sonnenstrahlen prallten mit voller Wucht auf die Kutsche. Der Fahrtwind brachte nur wenig Linderung. Der Handelsvertreter wischte sich den Schweiß mit einem Taschentuch von der Stirn, sagte aber nichts.
Die Gouvernante schüttelte den Kopf und sagte: »Georgie, ich verstehe nicht, wie dir deine Eltern diese Fahrt erlauben konnten! Du weißt doch gar nicht, ob dieser Lieutenant Wilson dich noch heiraten will!«
»Natürlich will er das«, erwiderte Georgie. »Er hat offiziell um meine Hand angehalten und mich gebeten, nach Fort Wallace zu kommen. Sobald ich dort bin, wollen wir heiraten.« Sie lächelte hoffnungsvoll. »Sei doch nicht so pessimistisch, Tante Martha. Der Militärposten soll sehr gemütlich sein. Wir haben unser eigenes Haus, und es gibt sogar einen kleinen Garten! Und spätestens nächstes Jahr will sich Ben sowieso in den Osten versetzen lassen.«