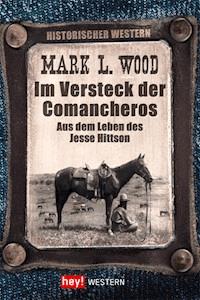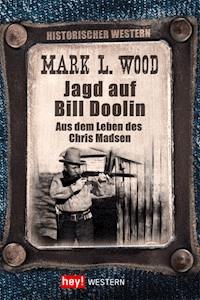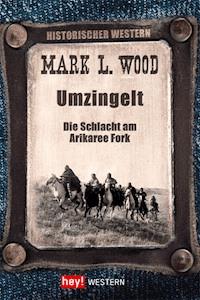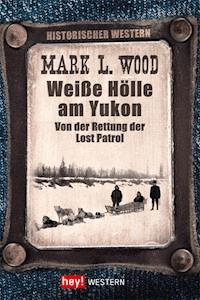
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HEY Publishing GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Western
- Sprache: Deutsch
Jack Dempster gehört zu den besten und erfahrensten Polizisten der Royal North-West Mounted Police, ein unbeugsamer Mann, der sich in den verschneiten Wäldern am Yukon River auskennt und kein Erbarmen mit Mördern und Dieben kennt. Als eine Patrouille seiner Einheit scheinbar spurlos in der Wildnis verschwindet, zieht er mit einem Suchtrupp los, um sie aufzuspüren und vor dem drohenden Kältetod zu retten. Kein Zuckerlecken bei Temperaturen bis zu fünfzig Grad unter Null. Doch Dempster lässt sich nicht entmutigen und dringt immer weiter in die Wildnis vor. Der authentische Roman um die legendäre »Lost Patrol«, die im Winter 1910 spurlos in der Wildnis am Yukon verschwindet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mark L. Wood
Weiße Hölle am Yukon
Copyright der eBook-Ausgabe © 2013 bei Hey Publishing GmbH, München.
Originalausgabe © 2006, BASTEI, Bergisch Gladbach. Erschienen in der Reihe Western-Legenden.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Mark L. Wood wird vertreten durch die Verlagsagentur Lianne Kolf.
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung: FinePic®, München
Autorenfoto: © privat
ISBN: 978-3-942822-35-0
Besuchen Sie uns im Internet:
www.heypublishing.com
www.facebook.com/heypublishing
Jack Dempster gehört zu den besten und erfahrensten Polizisten der Royal North-West Mounted Police, ein unbeugsamer Mann, der sich in den verschneiten Wäldern am Yukon River auskennt und kein Erbarmen mit Mördern und Dieben kennt. Als eine Patrouille seiner Einheit scheinbar spurlos in der Wildnis verschwindet, zieht er mit einem Suchtrupp los, um sie aufzuspüren und vor dem drohenden Kältetod zu retten. Kein Zuckerlecken bei Temperaturen bis zu fünfzig Grad unter Null. Doch Dempster lässt sich nicht entmutigen und dringt immer weiter in die Wildnis vor.
Der authentische Roman um die legendäre "Lost Patrol“, die im Winter 1910 spurlos in der Wildnis am Yukon verschwindet.
Die beiden Männer wollten töten. Wie zwei hungrige Wölfe blieben sie im dichten Schneetreiben stehen und blickten auf die Hütte hinab. Die eisige Kälte brannte auf ihrer Haut und kroch bis unter ihre gefütterten Lederjacken.
Albert Conolly war um die fünfzig, trug einen Vollbart und sah wie ein kauziger Oldtimer aus. Er lud seine Winchester 94 durch. »Wir legen sie beide um, hast du gehört? Auch die Squaw!«,
Greg Winston sah nach, ob der sechsschüssige Webley-Green in seiner Tasche steckte, und grinste frech. Er war halb so alt wie Conolly und wurde in den Vereinigten Staaten wegen Vergewaltigung gesucht. Die Angst vor dem Galgen hatte ihn bis zum Yukon im nördlichen Kanada getrieben. »Aber erst, wenn ich mir die Kleine vorgenommen habe. Ich hab seit drei Wochen keine Frau mehr gehabt.«
»Viel zu gefährlich«, erwiderte Conolly. »Mit diesen Squaws ist nicht zu spaßen! Die rammen dir ein Messer in den Bauch, während sie dir schöne Augen machen! Wir legen sie beide um! Vergiss nicht, warum wir hier sind!«
Winston kniff die Augen gegen das Schneetreiben zusammen. Er war seit zwei Jahren am Yukon und hatte sich noch immer nicht an das winterliche Zwielicht gewöhnt. Das nächste Mal würde er nach Mexiko fliehen. »Bist du sicher, dass das Gold im Haus liegt?«
»Abe Cardiff schläft auf seinem Gold«, bestätigte Conolly. »Wenn er auf der Bank in Dawson gewesen wäre, hätten wir es gemerkt. Er hat das Zeug im Haus, ganz sicher. Zwanzigtausend! Wenn wir Glück haben, sogar mehr. Sie haben den ganzen Sommer gebuddelt.«
Winston spuckte voller Vorfreude in den Schnee. »Damit geh ich in den Süden und kauf mir ein Freudenhaus«, sagte er. »Den ganzen Tag nur Whiskey und Weiber! Das lass' ich mir gefallen!«
»Wie man bei dieser Hundekälte an Weiber denken kann, ist mir ein Rätsel«, brummte der Oldtimer, als sie ins Tal hinabstapften. Um nicht gesehen zu werden, näherten sie sich dem Haus auf der fensterlosen Seite. Selbst auf ihren Schneeschuhen kamen sie nur mühsam voran. Der Schnee lag an manchen. Stellen mehrere Fuß hoch.
Conolly streifte den rechten Fäustling ab, stopfte ihn in die Tasche und schob seine Hand hinterher. Seine Finger mussten warm bleiben, damit er den Abzug seiner Winchester durchdrücken konnte, wenn sie die Hütte betraten.
Mit einem Kopfnicken bedeutete er Winston, das Gleiche zu tun. »Halt dem Goldsucher die Knarre an den Hals!«, befahl er leise. »Er soll uns verraten, wo das Gold liegt, bevor er ins Gras beißt. Ich hab keine Lust, lange zu suchen.«
»Und die Squaw?«
»Die übernehme ich. Und komm mir dabei bloß nicht in die Quere! Wenn wir die Sache hinter uns haben, kriegst du genug Weiber. Die Squaw lohnt nicht.«
»Schon gut«, murrte Winston.
Er hatte sich nur widerwillig mit dem Oldtimer eingelassen, musste aber zugeben, gut damit gefahren zu sein. Der Alte kannte sich am Yukon aus und wusste, wo etwas für sie zu holen war. Während des großen Goldrauschs am Klondike hatte er zur Bande von Soapy Smith gehört, dem legendären Outlaw von Skagway.
Links und rechts von der Tür blieben sie stehen. Vom giebelförmigen Dach hingen Eiszapfen herab.
Conolly nahm seine Hand aus der Tasche und legte sie um die Winchester. Winston zog den Webley-Green.
»Jetzt!«, flüsterte der Oldtimer.
Winston riss die Tür auf, und Conolly stürmte als Erster in die Hütte. Für sein Alter war er erstaunlich beweglich. Er sah die Indianerin am Herd stehen und schoss so schnell, dass ihr nicht einmal Zeit blieb, sich umzudrehen und zu schreien. Die Kugel traf die Indianerin in den Rücken und warf sie zu Boden.
Der Goldsucher wollte zur Tür rennen und sein Gewehr von der Wand reißen, kam aber nur zwei Schritte weit. Dann spürte er den kalten Lauf des Webley-Green an seinem Hals.
Er blieb stehen, als wäre er gegen eine Wand gerannt. »Ihr verdammten Schweine!«
Conolly würdigte die sterbende Indianerin kaum eines Blickes. Mit dem Gewehr an der Hüfte wandte er sich an den Goldsucher. »Wo ist das Gold?«
»Ich … ich hab kein Gold hier«, stammelte der. Seine Augen waren vor Angst geweitet. »Ich … ich hab alles … nach Dawson gebracht … auf … auf die Bank.«
»Red keinen Mist!«, erwiderte der Oldtimer. »Du warst seit einem halben Jahr nicht mehr in Dawson! Also … wo hast du dein Gold versteckt? Oder willst du genauso enden wie deine Squaw?«
Der Goldgräber blickte zitternd auf die Indianerin. Er war kurz davor, die Nerven zu verlieren. »Ich … ich hab das Gold einem … einem Freund mitgegeben«, brachte er mühsam hervor. »Es … es liegt alles in Dawson auf der Bank.«
Conolly senkte den Gewehrlauf und schoss ihm in den linken Oberschenkel. Der Goldsucher schrie schmerzerfüllt auf. Selbst Winston erschrak vor dieser beiläufigen Brutalität.
»Ich frage dich zum letzten Mal«, sagte der Oldtimer, ohne eine Miene zu verziehen. »Wo ist das Gold?«
»In der Truhe«, erwiderte der Goldsucher mit verzerrtem Gesicht. Er zitterte heftig. »In der Truhe unter dem Bett!«
Conolly deutete mit einer Kopfbewegung auf das ungemachte Bett an der Stirnseite. »Sieh mal nach, Winston!«
Sein Kumpan nahm den Revolverlauf vom Hals des Goldsuchers und ging hinter dem Oldtimer entlang, um nicht in dessen Schussbahn zu gelangen. Er zog eine hölzerne Truhe unter dem Bett hervor und öffnete sie. Seine Augen begannen zu strahlen. »Hier ist es!«, rief er begeistert. Er zog einen der Beutel heraus und ließ einige Nuggets in seine Hand kullern. »Sieh dir das an, das sind mindestens dreißigtausend!«
Conolly warf einen raschen Blick auf das Gold und grinste zufrieden. Dann drückte er den Stecher durch. Die Kugel löste sich krachend aus dem Lauf und warf den Goldsucher bis ans Fenster zurück. Sein Gesicht war selbst im Tod ungläubig verzerrt.
Ohne einen Blick auf den Toten zu werfen, ging Conolly zu seinem Komplizen. Er nahm drei der fünf Ledersäckchen aus der Truhe und stopfte sie in seine Jackentaschen.
»Ich hatte schließlich die Idee«, beantwortete er den vorwurfsvollen Blick des jungen Banditen.
Winston wollte etwas erwidern, ließ es aber. So wie der Oldtimer mit dem Goldsucher und dessen Squaw umgegangen war, ließ er bestimmt nicht mit sich reden. Der Alte hatte nicht mal mit den Wimpern gezuckt, als er die beiden abgeknallt hatte. Seine listigen Augen und der dichte Vollbart täuschten darüber hinweg, was für ein gnadenloser Killer er war. Vielleicht stimmte ja doch, was man sich erzählte, dass er seinen eigenen Bruder umgelegt hatte, weil der ihm in die Quere gekommen war.
Der Oldtimer zog seinen Fäustling an und hängte sich die Winchester über den Rücken. Das schwere Gold zog seine Jacke nach unten. »Komm endlich!«, forderte er seinen Kumpan auf. »Oder willst du bei der Squaw bleiben?«
Winston steckte seine beiden Beutel zusammen mit dem Revolver ein. Er vermied es, die tote Squaw anzusehen.
»Hoffentlich dauert es noch eine Weile, bis sie die Toten entdecken«, sagte er. »Wenn uns die Mounties erwischen, haben wir nichts zu lachen.« Er zog seine Handschuhe an und seufzte leise. »Bist du sicher, dass die Rotröcke nur alle paar Wochen hier vorbeikommen?«
»Wegen der Mounties brauchst du dir keine Sorgen zu machen«, winkte Conolly ab. »Hier draußen gibt's nur einen, und bis die in Dawson merken, was passiert ist, sind wir längst über alle Berge!« Er ging zur Tür und öffnete sie.
»Hoffentlich hast du Recht«, erwiderte Winston und folgte ihm in die Kälte hinaus. »Ich hab nämlich keine Lust, mir 'ne Hanfkrawatte verpassen zulassen …«
Vielleicht lag es am fernen Heulen einiger Wölfe, dass Corporal Jack Dempster das Unheil kommen sah. Manche Indianer behaupteten, dass sich die Bestien nur meldeten, wenn irgendwo in der Wildnis ein Unglück geschah, und er lebte lange genug am Yukon River, um solche Legenden ernst zu nehmen.
Der Mountie war seit einer Woche unterwegs. So lange dauerte es, alle Hütten in einem Bezirk abzufahren und bei den Indianern und Fallenstellern nach dem Rechten zu sehen. Er stand auf den Kufen seines leichten Schlittens und trieb das fünfköpfige Hundegespann über einen Trail, den die Indianer in den Schnee getreten hatten.
Als er die Wölfe hörte, hielt er an. »Hooaah!«, rief er den Hunden zu. Rusty, der Leithund seines Gespanns, blickte sich erstaunt um. Er war es nicht gewohnt, dass Dempster mitten auf dem Trail hielt.
»He, Rusty«, sagte er. Auf den einsamen Fahrten hatte er sich angewöhnt, mit dem Leithund zu sprechen. »Hast du das gehört? Deine wilden Verwandten sind wieder nervös.«
Ein leises Jaulen zeigte ihm, dass auch die Hunde das Heulen gehört hatten. Freckles, sein jüngster Hund, zerrte nervös an seinem ledernen Geschirr.
»Wir schauen besser mal bei Abe Cardiff vorbei! Seit er mit dieser jungen Indianerin zusammenlebt, mache ich mir große Sorgen um ihn. Er ist leichtsinnig geworden. Angeblich hat er nicht mal sein Gold auf die Bank gebracht.«
Dempster trieb die Hunde an und schlug die Richtung zur Blockhütte des Goldsuchers ein. Bevor er den Trail verließ, schnallte er seine Schneeschuhe an. Im Tiefschnee blieb ihm nichts anderes übrig, als vor den Hunden herzulaufen und einen Pfad für sie zu bahnen. Die Hunde folgten ihm hechelnd.
Der Corporal war ein pflichtbewusster Mann. Er lebte seit einigen Monaten im Außenposten von Fortymile, einer einsamen Blockhütte, ungefähr vierzig Meilen von Dawson City entfernt, und ging regelmäßig auf die Patrouillenfahrten. Bei Abe Cardiff und seiner Squaw war er erst vor zwei Monaten gewesen, doch die Warnung der Wölfe war eindeutig gewesen. Irgendetwas Ungewöhnliches war geschehen.
Schon als er die Blockhütte des Goldsuchers im leichten Schneetreiben liegen sah, erkannte er, dass er sich nicht getäuscht hatte. Die Tür stand offen. Kein normaler Mensch ließ in dieser Kälte die Tür offen stehen. Er tastete nach seinem Revolver, einem sechsschüssigen 700 Colt New Service, und hielt neben dem Pfad, den Abe Cardiff in den Schnee gegraben hatte. Er schnallte die Schneeschuhe ab, streifte die Handschuhe ab und zog den Colt aus dem Holster.
»Abel«, rief er. »Bist du hier?«
Aus der Hütte kam keine Antwort. Nur das Knarren der Tür, die sich langsam im Wind bewegte, war zu hören.
Dempster blickte vorsichtig über die Schneewehen hinweg. Vor der Tür waren Spuren im Schnee. Der treibende Schnee hatte sie bereits halb verdeckt.
Der Mountie stieg auf den Pfad und rannte geduckt zur Hütte. Er presste sich mit dem Rücken gegen die Hauswand, den Colt schussbereit in beiden Händen. Er war sich ziemlich sicher, dass niemand in der Hütte auf ihn wartete, aber er wollte kein unnötiges Risiko eingehen.
Vorsichtig spähte er in den einzigen Raum. Nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass man ihn nicht bedrohte, ging er hinein. Er hatte die beiden Toten sofort bemerkt. Bedrückt ließ er den Revolver sinken. Er steckte ihn in das verschließbare Holster zurück, schob die Kapuze seines fellbesetzten Anoraks vom Kopf und kniete neben dem Goldsucher nieder. Er brauchte nicht mal nach seinem Puls zu fühlen, um zu wissen, dass dem Mann nicht mehr zu helfen war.
»Abe!«, sagte Dempster leise zu dem Toten. »Wer hat das getan?«
Vom Herd drang ein leises Jammern herüber. Er lief zu der Indianerin und sah, dass sie noch am Leben war.
»Mary«, rief er. So hatte Abe Cardiff seine Frau genannt. »Ich bin's … Dempster!«
Er drehte vorsichtig ihren Kopf auf die Seite und blickte sie an. In ihren Augen konnte man noch immer den Schock sehen.
»Keine Angst, Mary!«, versuchte er sie zu beruhigen. »Ich bringe dich nach Dawson City. Du wirst wieder gesund!«
Er zog sein Messer und schnitt den Stoff über der Wunde aus ihrem Lederkleid. Er verstand zu wenig von Medizin, um zu erkennen, wie ernst sie war, aber sie hatte viel Blut verloren und schwebte schon deshalb in Gefahr.
Mit etwas Whiskey aus einer Flasche, die im Regal über dem Herd stand, desinfizierte er ihre Wunde. Dann verband er sie mit den Streifen von einem sauberen Laken, das er in der Kommode gefunden hatte.
»Du musst jetzt sehr tapfer sein, Mary!«, ermunterte er sie.
Er hob sie vom Boden auf und trug sie zu seinem Schlitten. Sie gab nur ein leichtes Stöhnen von sich, als er sie in die Felle packte. Er band sie mit zwei Lederriemen auf die Ladefläche und beugte sich noch einmal über sie. »Es wird ein bisschen wehtun«, sagte er, bevor er den Schlitten wendete und zum Haupttrail zurückfuhr. »Vorwärts!«, feuerte er dort seine Hunde an. »Lauft, ihr müden Gesellen! Wir haben eine kranke Frau bei uns! Bis heute Abend müssen wir in Dawson sein! Vorwärts!«
Bis zum Yukon River waren es ungefähr zehn Meilen. Ein Teil des Weges führte durch den Tiefschnee, und Dempster musste seine ganze Kraft aufwenden, um einen Trail für die Hunde zu ebnen. Der Wind hatte aufgefrischt und blies nasse Schleier vor sich her.
Rusty und die anderen Hunde schienen zu ahnen, dass es auf jede Minute ankam, und hechelten ungeduldig hinter dem Mountie her. »Mush!«, feuerte Dempster sie unablässig an. »Musher« wurden alle Hundeschlittenführer genannt, und »Mush!« war ihr Anfeuerungsruf. »Nur keine Müdigkeit vortäuschen! Nicht schlappmachen, Rusty!«
Auf den bewaldeten Hügeln nahe des Yukon River konnte Dempster wieder auf den Kufen mitfahren. Zwischen den Schwarzfichten lag der Schnee nicht so hoch, und die sibirischen Huskies kamen allein dagegen an. Wie alle Schlittenhunde fühlten sie sich wohl in der eisigen Kälte. Der frostige Wind, der von Norden über den Fluss wehte, konnte ihnen kaum etwas anhaben.
Auch Dempster lebte lange genug im Hohen Norden, um gegen die Kälte gewappnet zu sein. Er trug warme Unterwäsche, feste Baumwollhosen und einen Anorak aus Karibufell. Seine Kapuze war mit dem Pelz eines Vielfraßes abgesetzt, dem einzigen Fell, das auch bei starken Minusgraden nicht gefror.
Er war noch eine knappe Meile vom Flussufer entfernt, als die Hunde nervös wurden und zu jaulen begannen.
Beinahe gleichzeitig bemerkte er die dunklen Schatten zwischen den Bäumen. »Wölfe!«
Besorgt zog er seine »Smelly« aus dem Futteral auf dem Schlitten. So hieß die zehnschüssige Lee-Enfield Mark 1 bei den Mounties. Die Feuergeschwindigkeit war höher als bei seinem Revolver, und die Zehn-Patronen-Magazine ließen sich in Windeseile wechseln.
Die Wölfe kamen näher. Er zählte sieben. Mit steil aufragenden Schweifen huschten sie durch den Wald. Dempster kannte sich mit den Tieren aus. Er wusste, dass sie nur Menschen angriffen, wenn sie leichte Beute witterten oder vor Hunger so verzweifelt waren, dass sie sich auch mit dem Fleisch der Zweibeiner begnügten.
Der Gedanke, von einem hungrigen Wolf gefressen zu werden, jagte selbst einem erfahrenen Polizisten wie Dempster einen Schauer über den Rücken. Noch größere Sorge bereitete ihm jedoch die verletzte Indianerin, die viel zu schwach war, um sich gegen die Wölfe zu wehren. Er durfte es gar nicht zu einem Angriff kommen lassen. Die grauen Jäger mussten ihr Blut wittern.
Neben einem entwurzelten Baumstamm hielt er den Schlitten an. Er rammte den hölzernen Anker in den Boden. »Wölfe!«, sagte er zu der Indianerin, obwohl sie das Bewusstsein verloren hatte. »Keine Angst! Ich kümmere mich um die Biester!«
Er riss die Lee-Enfield an die Wange und feuerte auf einen der Schatten. Die Kugel verfehlte den Wolf knapp und fetzte Rinde von einem Baumstamm.
Über den Lauf seines Gewehres hinweg beobachtete er, wie einige Wölfe stehen blieben und erstaunt zu ihm herübersahen. Anscheinend hatten sie nicht mit Gegenwehr gerechnet. Die Witterung der verletzten Indianerin hatte ihnen signalisiert, auf leichte Beute gestoßen zu sein. Jetzt waren sie unsicher. Wölfe griffen nur an, wenn sie sich einer Beute überlegen glaubten.
Dempster nutzte ihr Zaudern aus und legte auf den Wolf an, der ihm am nächsten war. Die gelben Augen des Tieres leuchteten im dunklen Wald.
Er drückte ab. Die Kugel traf den Wolf genau zwischen die Augen und warf ihn zu Boden. Sein Blut sickerte in den Schnee. Das Echo des Schusses verhallte zwischen den Hügeln.
Die anderen Wölfe verschwanden, tauchten zwischen den dunklen Bäumen unter. Ein verzweifeltes Heulen hallte durch den Wald. Rusty und die Hunde wurden unruhig und zerrten an ihren Leinen, hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, mit ihren wilden Verwandten in die Berge zu ziehen, und der Angst, von ihnen gefressen zu werden. Mit eingezogenen Schwänzen zogen sie sich zum Schlitten zurück.
Dempster behielt die Lee-Enfield in beiden Händen. Eine Weile war nichts außer dem ängstlichen Jaulen der Hunde und dem Rauschen des Windes in den Bäumen zu hören. Die Luft war kalt und starr.