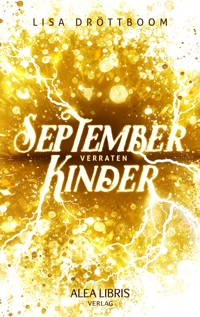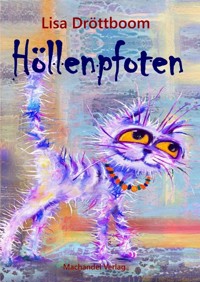Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Art Skript Phantastik Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Wärst du lieber ein Mann oder eine Frau? Das Apfelblütenfest steht an, die wichtigste Feier im Leben eines jungen Pan. Mit der finalen Wahl unseres Geschlechts überschreiten wir die Schwelle zum Erwachsensein und werden ein vollwertiges Mitglied unserer Gemeinschaft. Unsere Wahl öffnet uns nicht nur die Tore zur Welt außerhalb des Reservats, sondern sichert auch den Frieden zwischen Pan und Menschen. Dieses Jahr sitze ich nicht auf der Bank und schaue bei den Entscheidungen zu, dieses Mal muss ich selbst auf die Bühne. Ich wünschte nur, ich wüsste, wie meine Antwort lauten wird. Ein Monat bleibt mir noch, um meine Wahl zu treffen. Aber wie soll ich in dreißig Tagen die Antwort finden, nach der ich achtzehn Jahre lang vergeblich gesucht habe?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lisa Dröttboom
Unbestimmt
Wie entscheidest du dich,
wenn du alles sein kannst?
Content Notes
Alkohol, Trunkenheit
Angstzustände, Panikattacken (explizit)
Blut
Depression
Dysphorie (explizit)
Erbrechen
Erwähnung von Genitalien
Erwähnung von geschlechtsangleichenden Operationen
Essstörungen und Mangelernährung (explizit)
Gewalt
Krankheit und Unwohlsein
Medizinische Behandlung
Misgendering
Nadeln
(Internalisierte) Nonbinary-Feindlichkeit und Nonbinary-Erasure
Othering, Fremdenfeindlichkeit und fremdenfeindliche Gewalt (explizit)
(internalisierte) Queer-Erasure
Queerfeindlichkeit und queerfeindliche Gewalt (explizit)
Schlafstörungen
Soziale Ächtung
In diesem Buch wird eine von der Autorin eigene Variante des Pronomens ser für das Volk der Pan verwendet. Neopronomen werden aber auch außerhalb fantastischer Romane genutzt. Neben den klassischen Pronomen sie/ihr und er/ihm ist im englischsprachigen Raum vor allem they/them für nonbinary Personen geläufig, im Schwedischen wird beispielsweise hen bevorzugt. Im deutschsprachigen Raum ist die Lage (noch) nicht ganz so übersichtlich. Hier findet sich eine Fülle an Neopronomen wie sier/siem, xier/xiem oder analog zum Englischen they/them das eingedeutschte dey/dem.
Impressum
Alle Rechte an den abgedruckten Geschichten liegen beim
Art Skript Phantastik Verlag und den Autor*innen.
Copyright © 2023 Art Skript Phantastik Verlag
1. Auflage 2023
Art Skript Phantastik Verlag | Salach
Lektorat & Sensitivity Reading » Melanie Vogltanz
lektoratvogltanz.wordpress.com
Komplette Gestaltung » Grit Richter | Art Skript Phantastik Verlag
www.artskriptphantastik.de/grits-media-service.html
Druck » BookPress | www.bookpress.eu
ISBN » 978-3-949880-01-8
Auch als eBook erhältlich
Der Verlag im Internet » www.artskriptphantastik.de
Alle Privatpersonen und Handlungen sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit realen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Für Sonja
Vorwort
2018 saß ich auf dem PAN-Branchentreffen. In einer der Pausen erzählte mir Grit von einer Romanidee, die sie nicht losließ. Von einem Alienvolk, das das Geschlecht nach Belieben wechseln kann. An unserem Tisch entspann sich eine angeregte Diskussion darüber, ob wir auch wechseln würden, wenn wir die Chance hätten. Und die Antworten hätten unterschiedlicher nicht sein können. Von auf keinen Fall bis aber natürlich war alles dabei.
Ich habe damals eifrig mitdiskutiert, wohlwissend, dass ich niemals einen Roman über Aliens schreiben könnte. Science Fiction und Aliens, das ist einfach nicht meine Welt.
Aber in den darauffolgenden Tagen ließ mich die Idee nicht los, begleitete mich und wandelte sich immer mehr zu etwas, was ich schreiben würde. Denn ich wusste auf die Frage, ob ich wechseln wollen würde, nicht wirklich eine Antwort. Ausprobieren, ja. Aber würde ich mich im männlichen Körper wohler fühlen? Wahrscheinlich nicht. Was aber wäre, wenn ich von Anfang an die Wahl hätte? Würde ich dann überhaupt je den weiblichen Körper als angenehm empfinden? Wahrscheinlich nicht.
Aus all diesen Fragen wurde eine Idee geboren. Als ich schließlich zaghaft verkündete, dass ich da gerade so ein Plotbunny verfolgen würde, kam von Grit nur ein: »Schick mir ein Exposé, wenn es spruchreif wird.«
Also stürzte ich mich begeistert in die Recherchen. Heute möchte ich euch nur eine Frage stellen:
Könntet ihr euch entscheiden?
Kapitel 1
Freitag, 29 Tage bis zum Apfelblütenfest
Ein rascher Blick auf die Uhr verrät, dass mir nur noch Sekunden bleiben, um mich für die Unterrichtsstunde zu wappnen. Isabell grinst. »Sieh es positiv: Viel schlimmer als die Kinder aus der ersten Stunde können sie nicht sein.« Sie wackelt mit den Augenbrauen.
Ich schneide eine Grimasse. »Warum genau mache ich das noch mal?« Nervös ist kein Ausdruck für das aufgeregte Kribbeln, das Besitz von mir ergriffen hat. Es fällt mir schwer, zumindest äußerlich den Eindruck von Ruhe zu bewahren.
»Weil du ein Schatz bist und deine Lehrerin nicht hängen lässt.« Isabell haucht mir einen Kuss entgegen, bevor sie nach der Klinke greift. »Na komm, bringen wir es hinter uns.«
Begleitet vom elektronischen Gong der Schulglocke betreten wir das Klassenzimmer. Die Kinder stehen in Grüppchen zusammen und unterhalten sich angeregt. Nur ein paar sitzen auf ihren Plätzen, malen, basteln Papierflieger oder spielen mit ihren Mobilgeräten. Der Gong beeindruckt niemanden.
Das Chaos, das mir entgegenschwappt, überwältigt mich auch dieses Mal. Verunsichert lasse ich meinen Blick durch den Raum schweifen.
Vor dem Spiegelboard steht ein untersetzter Mann, der vergeblich versucht, die Aufmerksamkeit der Klasse auf sich zu ziehen. Seine Stimme geht im allgemeinen Lärm gnadenlos unter. Das Namensschild auf seinem Pult verrät mir, dass es sich um den Klassenlehrer Herrn Senderhorst handelt.
Als er uns bemerkt, entgleisen seine Züge für einen Moment und Panik schimmert in seinen Augen. Er fährt sich durch die ohnehin schon ramponierte Frisur, die in alle Richtungen absteht.
Eine Welle des Mitleids schwappt durch meinen Körper. Mich überkommt angesichts der vor Energie überbrodelnden Klasse eine ähnliche Hilflosigkeit wie die, die ich von seinem Gesicht ablesen kann. Gefolgt von bodenlosem Entsetzen über diese Schule. Ich habe noch nie gesehen, dass Kinder so undiszipliniert sind, wenn sich eine Lehrkraft im Raum befindet.
Isabell nimmt den Trubel gelassen. Ob sie so etwas noch aus der Zeit vor dem Reservat gewohnt ist? Während ich die Tür hinter mir ins Schloss ziehe, marschiert sie zu ihrem Kollegen. Sie diskutieren kurz, allerdings kann ich kein Wort verstehen. Als ich sehe, wie sich Isabell energisch zur Klasse dreht und ihre Zeigefinger in Richtung Mund bewegt, versuche ich mir noch die Ohren zuzuhalten, bin aber zu langsam.
Ich habe Isabells Pfiff erst ein paar Mal in meinem Leben gehört und mir geschworen, ihr nie einen Grund zu geben, ihn meinetwegen einsetzen zu müssen. Ich weiß nicht, was damals mehr Eindruck hinterlassen hat: Der Pfiff oder die Erkenntnis, dass sich Menschen tatsächlich prügeln, weil sie nicht einer Meinung sind.
Auch dieses Mal bohrt sich ihr gellender Pfiff in meine Gehirnwindungen und löscht meine Gedanken. Er zerschlägt den Lärm im Klassenzimmer mühelos. Die Kinder in der ersten Reihe schütteln benommen den Kopf. Die Gespräche sind jäh verstummt, die meisten Anwesenden versuchen verspätet, ihre Ohren zu schützen.
In der einsetzenden Stille bemerken die Kinder, dass sie Gäste haben. Zwei Dutzend Augenpaare richten sich auf uns. Isabells Gesichtsausdruck ist hart und unnachgiebig. »Setzt ihr euch bitte auf eure Plätze, damit wir anfangen können?« Ihre Stimme ist unterkühlt und jagt mir eine Gänsehaut über den Rücken. Das Bitte ist keine Option.
Die Kinder wechseln irritierte Blicke, tuscheln aufgeregt miteinander, doch sie gehorchen. Keine halbe Minute später haben alle ihren Platz gefunden. Die Verwirrung ist groß genug, um die Ruhe im Raum zu halten. Basierend auf meiner heutigen Erfahrung mit menschlichen Klassen wird das nicht von Dauer sein.
»Gut«, sagt Isabell. Ein schmales Lächeln erweicht ihre Züge. »Dann können wir ja beginnen.« Sie reibt zufrieden ihre Hände. »Kinder, wisst ihr, was ein Pan ist?«
Zeigefinger schnellen in die Höhe. »Ein Alien«, ruft ein Junge in der hintersten Reihe feixend und bringt die anderen damit zum Lachen. Er überragt die anderen Kinder in der Klasse um einen Kopf und kippelt lässig auf seinem Stuhl. Wann immer er droht, nach hinten zu kippen, zieht er sich mit einem Finger wieder näher an den Tisch heran.
»Tom, melden!«, ermahnt ihn Herr Senderhorst, woraufhin sein Schüler die Augen verdreht. »Und setz dich richtig hin!« Mit wachsendem Entsetzen beobachte ich, wie der Junge seinen Lehrer ignoriert.
Isabell durchbohrt den Jungen mit einem tödlichen Blick. Tom nimmt die Herausforderung erst an, muss die Augen letztendlich jedoch niederschlagen. Mit missmutiger Miene lässt er sich nach vorne fallen und hängt nun halb auf dem Tisch, bleibt aber ruhig.
Isabell mustert die Klasse eindringlich und warnend, bevor sie sich für ein Mädchen in der ersten Reihe entscheidet, das trotz Toms Eskapaden noch immer aufzeigt. »Ja, äh, Melanie?«, liest meine Lehrerin den Namen von dem rosa-bunten Schild auf dem Tisch ab.
»Ein Pan ist ein Außerirdischer von einem anderen Planeten«, sagt das Mädchen mit heller Stimme. Ihre Augen leuchten aufgeregt. »Sie sind vor einiger Zeit auf der Erde gelandet und leben jetzt in Reservaten.«
»Sehr gut«, lobt Isabell das Mädchen und zeigt erstmals die liebevolle Seite, die ich von ihr kenne. Die Kleine erntet bewundernde Blicke von ihren Sitznachbarn, was ihre Wangen in einem freudigen Rot färbt. »Weißt du denn auch, wie viele Reservate es gibt oder wann die Pan auf der Erde notlanden mussten?«
Damit ist das Mädchen überfragt. Isabell lässt ihren Blick durch die Klasse schweifen. »Gut«, sagt sie und unterstreicht das Wort mit einem Nicken. Sie nimmt einen Stift und ruft das Schreibprogramm auf dem Spiegelboard auf. »Heute widmen wir uns den Pan.«
Ich nutze die gespannte Stille und ziehe mich in eine Ecke des Zimmers zurück. Eingequetscht zwischen Tür und Waschbecken setze ich mich auf einen einsamen Stuhl. Die nächste halbe Stunde habe ich Zeit, die Klasse zu beobachten. Isabell ist ganz in ihrem Element. Die meisten Schülerinnen und Schüler diskutieren und rätseln voller Begeisterung mit, wann immer sie eine neue Frage zu den Pan stellt.
Nur in der letzten Reihe entwickelt sich mehr und mehr ein Eigenleben, das auch den allgemeinen Geräuschpegel in die Höhe treibt. Tom und seine Freunde zeigen ein negatives Interesse an den Pan, stiften Unruhe und rufen beleidigende Kommentare. Die Disziplinarversuche von Herrn Senderhorst prallen wirkungslos an ihnen ab.
Ich bin erschüttert. Im Reservat würde niemand daran denken, eine Lehrkraft so zu behandeln. Je länger ich mit Tom in diesem Raum festsitze, desto unwohler fühle ich mich. Auch Isabell wirkt zusehends von dem Verhalten genervt, konzentriert sich aber darauf, den anderen das Thema Switchen bei den Pan zu erklären.
»Das sind doch alles Freaks! Wer kann sich denn nicht entscheiden, ob er Junge oder Mädchen sein will?« Toms lauter Einwurf lässt mich zusammenzucken. Seine Worte bohren sich wie ein Fausthieb in meinen Magen.
Ja, wer kann das nicht?
Ich beneide die Menschen dafür, dass sie ihr Geschlecht nicht wechseln können. Ich möchte die Fähigkeit nicht missen, aber diese Gabe zu haben, bringt auch die Qual der Wahl mit sich. Und nicht jedem fällt es leicht, sich für eine Seite zu entscheiden.
Isabell legt den Stift zur Seite. Ihre Miene ist versteinert, doch in ihren Augen leuchtet Wut. »Junger Mann, es reicht mit den Kommentaren. Wenn du nicht vernünftig mitmachen willst, schreibe ich eine Mail an deine Eltern.«
Tom sieht Isabell geringschätzig an. »Klar, ey. Als ob. Wofür denn?«
Mir wird heiß und kalt. Am liebsten würde ich den Klassenraum verlassen, um dieser feindlichen Atmosphäre zu entkommen. Doch stattdessen sitze ich verkrampft auf meinem Stuhl und hoffe, dass die Sache nicht weiter eskaliert. Kein Wunder, dass Isabell mit Freuden die freie Stelle im Reservat angenommen hat und ihre alte Schule nicht vermisst. Wenn die Kinder dort nur annähernd so wie diese waren, wäre ich auch geflohen.
»Schluss mit ey und Mann. Wir sind keine Buddys und ich erwarte, dass du dich vernünftig ausdrückst, wenn du mit mir redest«, fährt meine Lehrerin den Jungen an, ohne ihre Stimme zu heben. Ihr Ton ist scharf. »Und die Mail schreibe ich, weil du den Unterricht störst.«
Toms Gesicht zeigt deutlich, dass er nicht an Isabells Drohung glaubt. Ich warte gespannt, doch für den Moment scheint sich der Junge nicht weiter mit ihr anlegen zu wollen. Zufrieden widmet sich Isabell wieder den restlichen Kindern und dem Board. Als wir uns den letzten zehn Minuten nähern, legt Isabell den Stift zur Seite und schaltet das Spiegelboard aus. Fast augenblicklich legt mein Herz den nächsten Gang ein. Jetzt kommt mein Part.
»Damit sind wir schon fast am Ende unserer Stunde angekommen.« Ich höre vereinzelt enttäuschte Laute. »Vergesst nicht: Wenn ihr noch mehr über die Pan erfahren möchtet, dann schaut doch morgen am Tag der offenen Tür im Reservat vorbei. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann raus damit«, sagt Isabell und kommt zu mir.
Ich erhebe mich mit einem mulmigen Gefühl im Magen und trete in den Fokus der Klasse.
»Das hier ist Gray und wie ihr euch vielleicht denken könnt, gehört Gray zu den Pan und nutzt das Pronomen ser. Und ser wird all eure Fragen beantworten.«
Ein Raunen geht durch die Klasse. Zwei Dutzend Augenpaare starren mich überrascht an, als wäre ich aus dem Nichts erschienen. Dann schießen Hände in die Höhe. Die meisten Kinder sind ruhig, durchbohren mich mit ihren Blicken und versuchen mich zu hypnotisieren, damit sie ihre Frage zuerst stellen dürfen. Nur ein paar Ungeduldige lehnen sich über ihren Tisch und versuchen, mir mit dem ausgestreckten Finger in der Nase zu bohren. Einige fiepsen wie aufgeregte Meerschweinchen oder schnipsen.
»Kinder, bitte. Gray wird euch alle drannehmen«, sagt Herr Senderhorst, doch seine Worte verklingen ungehört.
Ich starre überwältigt auf die fleißig winkenden Hände, bevor ich tief Luft hole. »Äh, Melanie?«, frage ich und wende mich hoffnungsvoll dem Kind zu, das mir in der vergangenen Stunde positiv aufgefallen ist.
Die Schülerin lächelt erfreut und lässt ihre Hand sinken. Als sie ihren Mund öffnet, um ihre Frage zu stellen, wird sie grob unterbrochen. »Ey, was passiert mit deinem Schwanz, wenn du ein Mädchen wirst?«, ruft Tom von hinten. Seine Freunde kichern.
Ich tausche einen schnellen, hilfesuchenden Blick mit Isabell, die Tom scharf fixiert. Unsicher sehe ich das Mädchen vor mir an und versuche Tom zu ignorieren, obwohl ich mir unhöflich vorkomme. Mein Herz schlägt hastig, doch ich bemühe mich um ein freundliches Lächeln. »Was ist deine Frage?«
Melanie braucht ein paar Sekunden, bevor sie sich neu sortiert hat. »Tut das Wechseln weh?«
»Nein. Manchmal ist das Switchen etwas unangenehm, aber in der Regel merke ich davon nichts.« Ich wische mir die feucht gewordenen Handflächen an der Hose ab und kämpfe gegen meine zuckenden Mundwinkel an. »Ich … ich kann dabei sogar schlafen.«
Die Kinder beginnen aufgeregt zu tuscheln. Ein paar Hände sinken auf den Tisch zurück, doch eine breite Masse wartet immer noch darauf, dass ich sie drannehme. Ich wähle den nächsten Kandidaten aus, dieses Mal einen Jungen.
»Bist du gerade männlich oder weiblich?« Er sieht mich kritisch an.
»Männlich«, sage ich und bemerke, wie sich prompt ein paar Hände heben.
»Bist du dir sicher?«, fragt der Junge. »Du hast lange Haare.«
Ich blinzele. Isabell neben mir versucht, ein Lachen zu unterdrücken.
»Na ja, man kann doch auch als Junge lange Haare haben, oder?«, frage ich vorsichtig.
Der Schüler sieht mich nachdenklich an, hat aber auf die Schnelle keine Antwort parat. Sein Sitznachbar nutzt den Moment und fragt aufgeregt: »Kannst du mal eben weiblich werden?«
»Äh, nein.« Auch wenn Isabell diesen Punkt in den letzten dreißig Minuten behandelt hat, bemühe ich mich um eine Erklärung: »Veränderungen brauchen Zeit. Wenn ich switchen möchte, könnte ich frühestens morgen als Mädchen vor euch stehen.«
»Was passiert mit deinem Schwanz, wenn du ein Mädchen wirst?«, fragt Tom noch einmal, nun offenkundig verärgert darüber, dass ich nicht auf ihn reagiere. Ich sehe ihn mit ausdrucksloser Miene an, versuche zu verstehen, warum er sich nicht an die Regeln halten kann. »Ey, bist du taub?«, fragt er mich, als ich ihm nicht antworte.
»Melde dich, wenn du eine Antwort bekommen willst«, sagt Isabell kalt.
Er schneidet eine Grimasse, sagt aber nichts mehr und funkelt sie böse an.
Ich suche den nächsten Schüler aus. »Warum bist du nicht grün?«, fragt er mich mit kritischem Blick.
Verwundert sehe ich ihn an. »Warum sollte ich grün sein?«
»Na, weil du ein Alien bist. Die sind doch alle grün.«
»Aber ich bin es nicht«, erwidere ich. »Und im Reservat ist keiner grün. Wir haben dieselbe Hautfarbe wie ihr.« Zumindest meine Generation. Den Älteren sieht man zum Teil noch an, wem wir uns früher angepasst hatten, bevor wir auf die Erde kamen. Ihre Haut ist robust wie Leder und versteckt zwischen ihren Haaren kann man noch die Ansätze von Hörnern erkennen.
Der Junge runzelt die Stirn. »Dann bist du kein Alien«, sagt er, offenbar nicht willig, seine Argumentationskette zu überarbeiten.
»Ich bin auf der Erde geboren worden. Macht mich das nicht zu einem Erdbewohner?«, frage ich zurück und bringe ihn nun völlig aus dem Konzept.
Isabell neben mir kämpft sichtbar mit sich, beißt sich auf die Unterlippe, um nicht laut loszulachen.
Ich lächele nachsichtig und nehme das nächste Kind dran, während der Junge in eine mittelschwere Sinnkrise zu stürzen scheint.
»Wie ist das, wenn du aufs Klo musst?«, fragt mich ein Mädchen. »Auf welche Toilette gehst du dann?«
Wieder blinzele ich irritiert. Ich habe heute schon eine Menge komischer Fragen gehört, aber diese verwirrt mich zutiefst.
Isabell tritt näher zu mir. »Die Menschen haben getrennte Toiletten für die jeweiligen Geschlechter«, flüstert sie mir zu.
Ich hebe eine Augenbraue. »Warum?«
Sie zuckt mit den Schultern. »Weiß ich auch nicht. Ich glaube, die Männer haben Angst, dass man ihnen was wegguckt.« Sie zwinkert mir zu und antwortet dem Mädchen an meiner Stelle. »Im Reservat gibt es Toiletten, die jeder benutzen kann. Da gibt es keine Klos für Jungen oder Mädchen.«
Damit scheinen die Kinder nicht gerechnet zu haben. Das Tuscheln wird so laut, dass Isabell einschreiten muss, um der nächsten Frage Gehör zu verschaffen. Nur mit Mühe bekommen sich die Kinder wieder unter Kontrolle.
»Hast du eine Freundin?« Das nächste Mädchen hat kurze Haare und einen frechen Ausdruck im Gesicht. Sie liegt halb auf ihrem Tisch, die Knie auf dem Stuhl, während sie mich mit großen Augen mustert.
»Ja, natürlich«, sage ich. »Jeder von uns hat doch einen Freund, oder nicht?«
Das Mädchen kichert. »Eine richtige Freundin, meine ich.« Ihre Erklärung lässt mich noch ratloser zurück.
»Äh, Gray«, schaltet sich Isabell ein. »Ser quare a lalana, nan jed«, erklärt sie mir auf Jandara.
Ich runzele die Stirn. Scham kriecht in meine Wangen. Wieso benutzen die Deutschen dasselbe Wort für Freund und Partner? Je mehr Fragen die Kinder stellen, desto mehr bereue ich es, für Torben eingesprungen zu sein. Wäre es nicht Isabell gewesen, die mich um Hilfe gebeten hätte …
»Ich habe keine Freundin, nein«, antworte ich dem Mädchen, das noch immer gebannt an meinen Lippen hängt.
Enttäuscht sinkt sie auf ihren Stuhl zurück. Die Zahl an eifrig in die Luft gereckten Händen ist stark gesunken.
»Willst du denn auch später ein Junge sein?«, fragt mich ein etwas untersetzter Schüler und rückt seine Brille zurecht.
»Ich habe mich noch nicht entschieden, was ich werden will«, gestehe ich, während ein Stich durch meine Brust fährt. Ich mag diese Frage nicht.
»Warum?«, kommt sogleich die bohrende Nachfrage.
Ich starre den Jungen an. In meinem Kopf schlägt ein kleiner Spielzeugaffe die Zimbeln aneinander. »Na ja«, sage ich langsam. »Wärst du gerne ein Mädchen?«
Der Junge lacht und schüttelt den Kopf.
Ich sehe seine Sitznachbarin Melanie an. »Wärst du gerne ein Junge?« Sie verneint ebenfalls, ein belustigtes Lächeln auf den Lippen.
»Warum nicht?«, frage ich die beiden.
Darauf weiß niemand eine Antwort. In der Klasse entsteht eine rege Diskussion und die letzten Minuten bis zum Klingeln verbringen wir damit, das Für und Wider jeder Seite durchzugehen. Eine Antwort finden wir nicht.
Kapitel 2
»Gott sei Dank, wir haben es endlich geschafft«, entfährt es Isabell, als wir nach der sechsten Stunde erlöst sind. Sie verschränkt ihre Finger über dem Kopf und streckt sich genüsslich, das Gesicht der Sonne zugewandt. »Ich hätte nicht gedacht, dass du dich so gut schlägst. Ich bewundere deine Geduld.«
»Wieso?«, frage ich und beobachte die Kinder, die an uns vorbei in Richtung Bushaltestelle strömen. Ein paar der Fünftklässler, die wir heute besucht haben, winken mir im Vorbeigehen zu. Ich hebe meine Hand zum Abschied und lächele.
»Ich weiß nicht, ob ich so offen und entspannt geblieben wäre, wenn die Schüler mir so intime Fragen gestellt hätten.«
Ich zucke mit den Schultern. »Ich bin froh, wenn sie neugierig sind. Das hält sie vielleicht davon ab, Steine auf Amas Laden zu werfen oder Beleidigungen an die Mauern zu schmieren.«
Isabell bedenkt mich mit einem mitleidigen Blick. »Deswegen machen wir diese Kampagne ja auch.« Sie legt eine Hand auf meine Schulter und zieht mich im Gehen kumpelhaft an sich. »Ich bin dir trotzdem dankbar, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Das hätte nicht jeder gemacht.«
»Pan helfen, wenn sie können«, sage ich, auch wenn ich in diesem Fall lieber abgesagt hätte. Aber Isabell hat recht: Ich habe den Tag durchgestanden und entgegen meiner eigenen Einschätzung scheine ich mich nicht allzu schlecht angestellt zu haben. »Auch wenn ich zugeben muss, dass mich einige Fragen sehr verwirrt haben.« Ich denke an die unzähligen zu meinem Penis und das Gelächter, das auf meine Antworten folgte.
Isabell lacht. »Das sind Kinder. Alles, was mit Sexualität zu tun hat, ist für die noch unglaublich witzig.« Sie scheint meine Gedanken zu erraten. »Aber du hast dich tapfer geschlagen.«
»Jedenfalls weiß ich jetzt, dass ich nicht unterrichten möchte«, murmele ich, ergänze dann aber: »Jedenfalls nicht außerhalb des Reservats.« Dort würde es niemand wagen, sich wie Tom zu benehmen.
Isabell gibt ein zustimmendes Geräusch von sich. »Meine beste Entscheidung war, die Stelle in Agana anzutreten. Im Vergleich zu dieser Horde Eichhörnchen auf Drogen seid ihr eine Herde lammfrommer Schafe.« Sie grinst mich frech an und tätschelt meinen Kopf.
»Bäääh!«, mache ich und bringe sie damit erneut zum Lachen.
Wir lösen uns aus dem Strom von Kindern und schlagen den Weg zum Parkplatz ein. Mein Blick bleibt an ein paar Jugendlichen hängen, die neben uns herlaufen. »Isabell, darf ich dich etwas fragen?«, will ich wissen, als wir im Auto sitzen. »Sind die Kinder an dieser Schule arm?«
Isabell blinzelt irritiert. »Wie kommst du darauf?«
Peinlich berührt zucke ich mit den Schultern. »Na ja, sie tragen alle kaputte Hosen.« Ein Großteil der Kinder, die ich heute gesehen habe, hatte mindestens einen Riss in der Hose. Bei vielen war der Stoff an den Knien sogar mehrere Zentimeter tief eingerissen und manche Hosen habe ich erst auf den zweiten Blick als solche identifizieren können, so zerfetzt war der Stoff.
Zu meiner Überraschung lacht Isabell. Verwirrt sehe ich zu, wie sie sich immer mehr hineinsteigert und den Bauch halten muss, weil ihr die Zeit zum Luftholen fehlt. »Das«, versucht sie mir zu erklären, als ihr Lachanfall endlich verebbt. »Das ist ein Modetrend, Gray. Die Kinder finden das stylisch.«
»Kaputte Hosen?« Ich verstehe die Menschen nicht. »Was finden sie an kaputten Hosen stylisch?«
Isabell zuckt mit den Schultern. »Laut meinen Eltern war das bereits in den 10ern Trend. Damals sind auch alle so herumgelaufen.«
»Verstehe ich nicht.«
»Ich auch nicht.« Sie startet den Wagen, gibt aber noch kein Ziel ein. Forschend mustert sie mich. »Warst du noch nie außerhalb des Reservats?«
Ich schüttele den Kopf. »Heute ist mein erstes Mal.«
Ihre Augen weiten sich. »Wie kommt’s?«
»Ich weiß nicht.« Ich zucke mit den Schultern. »Bis jetzt hatte ich keinen Grund, Agana zu verlassen. Das Reservat hat alles, was ich brauche.«
Isabell schüttelt den Kopf. »Dann müssen wir feiern, dass deine Welt gerade ein bisschen größer geworden ist. Wie wäre es mit einem kurzen Abstecher in die Eisdiele? Ich schulde dir etwas für deine Hilfe.«
Schnell schüttele ich den Kopf und denke an die Ausgeh-Erlaubnis, die in meiner Tasche steckt. »Ich darf das Reservat nur verlassen, um dir bei deiner Aufgabe in der Schule zu helfen«, erinnere ich sie. »Weitere Ausflüge sind nicht genehmigt.«
Isabell zieht eine Schnute. »Ach komm schon, es ist kein großer Umweg. Es liegt quasi auf dem Weg.«
Ich schüttele hartnäckig den Kopf. Stumm liefern wir uns ein Blickduell, bis sie mit einem frustrierten Stöhnen aufgibt und aus der Parklücke fährt. »Na gut«, sagt sie und seufzt.
Ich erwidere nichts, sondern schaue stur aus dem Fenster. Isabell brummelt noch eine Weile vor sich hin, versucht mich aber nicht mehr umzustimmen.
Nach einer Weile runzele ich die Stirn. »Das ist nicht der Weg, den wir gekommen sind«, informiere ich sie. Als sie schweigt, drehe ich den Kopf zu ihr. Isabell grinst, während wir auf einen kleinen Parkplatz biegen. Ich beuge mich vor, um einen Blick auf das Schild über dem Eingang des Hauses zu werfen. »Bibis Eispalast«, lese ich laut vor.
»Wo wir nun schon mal hier sind: Kommst du mit rein?«, fragt Isabell mich unschuldig und setzt ihr liebstes Lächeln auf.
Unglücklich presse ich die Lippen zusammen und schüttele den Kopf. »Ich hätte mir denken können, dass du nicht so einfach aufgibst«, murmele ich.
»Stimmt«, sagt Isabell und schnallt sich ab. »Man muss nur wissen, wie man euch austricksen kann. Torben hat seine Lektion auch auf diese Tour lernen müssen. Warte kurz hier, ich hole uns eben ein Eis.« Sie springt aus dem Auto und ist verschwunden, bevor ich reagieren kann.
Mit einem Seufzen lehne ich mich in meinem Sitz zurück und reibe mir übers Kinn. Meine Fingerspitzen prickeln. Wie lange ist es her, dass ich zur männlichen Seite gewechselt habe? Eine Woche? Länger?
Mit zwiegespaltenen Gefühlen betrachte ich mich im Seitenspiegel. Willst du denn auch später ein Junge sein? Die Frage des Schülers spukt wieder durch meinen Kopf. Will ich das? Oder will ich lieber ein Mädchen sein? Die Frage stelle ich mir seit achtzehn Jahren und keine Seite scheint eine Antwort für mich parat zu haben. Ich mag beide Geschlechter und will auf keines verzichten. Und je mehr mich die Gesellschaft zu einer Entscheidung drängt, desto weniger weiß ich, was ich wirklich will.
Kapitel 3
Samstag, 28 Tage bis zum Apfelblütenfest
»Guten Morgen, Gray. Es ist 6:13 Uhr. Möchtest du aufstehen?«
Ich blinzele müde. Ein dumpfer Schmerz hinter meiner Stirn begleitet jede Bewegung. »Ciel, frag mich in zehn Minuten noch mal«, murmele ich und ziehe mir die Decke über den Kopf. Im Dämmerzustand genieße ich die Wärme des Bettes, das Wissen, dass heute Samstag ist und ich liegen bleiben darf. Nach einer furchtbaren Nacht wie dieser ist das auch bitter nötig.
Viel zu früh spricht mich Ciel erneut an. »Guten Morgen, Gray. Es ist 6:23 Uhr. Möchtest du aufstehen?«
»Ja.« Mit einem Seufzen setze ich mich auf und gähne. Ich fühle mich wie gerädert, meine Schultern sind verspannt vom unruhigen Hin- und Herwälzen in der Nacht. Während Ciel die Rollläden hochfährt und nach und nach das erste Licht des Tages in mein Zimmer kriecht, schlurfe ich wie ein Zombie zum Schrank.
»Ciel, wie warm ist es draußen?«, frage ich und zwinge meine Augen auf. Meine beiden Wellensittiche Jed und Jadi schütteln müde ihr Gefieder und wünschen sich einen Guten Morgen.
»Das Wetter in Agana: Sieben Grad, sonnig. Erwartetes Wetter für heute: 16 Grad bei stetem Sonnenschein.«
Blind greife ich nach meinen Lieblingsjeans und einem blaukarierten Hemd, bevor ich mich ins Badezimmer verziehe. Nach der Dusche haben sich meine Kopfschmerzen beruhigt und auch wenn meine Augen noch brennen, fühle ich mich wacher. Ich aktiviere das Spiegelboard und schaue mir die Nachrichten an, während ich meine Haare mit Handtuch und Bürste bearbeite. Viel Neues gibt es nicht. Der Dorffunk ist schneller als die Zeitung und außerhalb des Reservates ist zwar einiges passiert, aber nichts Weltbewegendes.
Mäßig interessiert überfliege ich einen Artikel aus der Rubrik Aus aller Welt zum Thema Kairo – Das Venedig der Zukunft? Es ist ein Lobstück auf die geschaffte Energiewende und den baldigen Stopp der Klimaerwärmung. Die interviewte Wissenschaftlerin versucht, die Konsequenzen abzuschätzen und prognostiziert, dass Städte wie Kairo, die derzeit mit dem wachsenden Meeresspiegel zu kämpfen haben, überleben werden. Es ist ein interessantes Gedankenspiel, aber ich glaube nicht daran, dass die Energiewende bereits geschafft ist. Dafür verändert sich unsere Welt zu langsam.
Nach dem Zähneputzen schalte ich das Spiegelboard wieder aus. Nachdenklich fahre ich mir über das Kinn. Die Bartstoppeln sind spürbar, aber der Wandel zur weiblichen Seite ist bereits im Gange. Seit gestern Nachmittag arbeitet mein Körper ohne Unterlass daran. Wenn ich mich morgen rasiere, sollte die Haut glatt bleiben. Zufrieden will ich das Badezimmer verlassen, als sich Ciel zu Wort meldet und mich erinnert: »Es fehlen noch die Daten für den täglichen Gesundheitscheck.«
»Ah, ja. Danke, Ciel.« Ich lege meinen kleinen Finger auf den Pen neben dem Spiegel und unterdrücke ein Zucken, als sich die Nadel in meine Fingerkuppe bohrt. Das Lämpchen springt auf Grün. Ich ziehe die Hand zurück und warte kurz.
»Deine Werte entsprechen nicht der Norm. Ich sende sie zur Überprüfung an deinen Arzt«, informiert mich Ciel. Ich habe nichts anderes erwartet. Das Programm meckert seit Tagen über meine Werte. Das Switchen bringt meinen Hormonhaushalt noch mehr durcheinander.
Zurück in meinem Zimmer begrüßen mich Jed und Jadi bereits voller Freude. Das Wellensittichpaar ist im Gegensatz zu mir putzmunter und schiebt Kohldampf. Ich halte den frisch gefüllten Napf noch in der Hand, als sich die beiden Verhungernden auf die Körner stürzen. Ihre kleinen Füßchen krallen sich in meine Finger, während sie gierig ihre Lieblingssaat herauspicken. Mit einem Lächeln beobachte ich die beiden, rede mit ihnen und genieße die gefräßige Stille.
Als der erste Hunger überwunden ist, stelle ich den Napf zurück und lasse den Käfig offen. Den Tag über dürfen die beiden durch mein Zimmer toben. Dabei lassen sich Jed und Jadi keine Zeit. Belustigt beobachte ich, wie sie von Ast zu Ast jagen, die ich unter der Decke aufgehängt habe.
Mit der Kamera bewaffnet mache ich mich auf den Weg zum Bäcker. Über dem Dorf liegt eine schläfrige Ruhe. Nur eine Handvoll Pan sind schon auf den Beinen, bereiten das Frühstück vor oder stöbern in den Nachrichten. Die Sonne stiehlt sich langsam hinter den Bäumen hinauf in den Himmel, wirft ein munteres Spiel aus Licht und Schatten auf den festgetretenen Weg. Eine frische Brise lässt mich frösteln. In den letzten Tagen durften wir einen Vorgeschmack auf den Sommer genießen, nun scheint er sich verflüchtigt zu haben.
Der Weg ins Zentrum ist mit Apfelbäumen gesäumt. Noch sind die Äste kahl, nicht mehr als knochige Überreste nach einem langen Winter. Doch an den Zweigen tummeln sich schon die ersten Knospen. Die meisten sind noch braun und unscheinbar. Nur ein paar Knubbel haben bereits weiße Spitzen – ein Ausblick auf die baldige Blütenpracht.
Ich mag die Apfelbäume. Ihre Verwandlung. Ihre Blütenpracht im Frühjahr. Aber dieses Jahr begleiten Bauchschmerzen meinen Blick zu den Knospen. Aus ihrem Versprechen ist eine Drohung geworden, die mich daran erinnert, wie wenig Zeit mir noch bleibt.
Als ich unsere Dorfmitte erreiche, muss ich stehenbleiben und meine Kamera zücken. Der See, der neben dem großen Platz unser Zentrum dominiert, ist von einer dicken Schicht Nebel umgeben. Gemütlich wabert die weiße Masse über die Oberfläche. In Kombination mit dem Wald im Hintergrund, dem Schilfgras am Ufer und den ersten Sonnenstrahlen, die den Nebel erstrahlen lassen, bietet sich mir ein magisches Bild. Fasziniert trete ich näher, gehe in die Hocke und versuche, die Szenerie einzufangen.
Ich zucke zusammen, als es neben mir plötzlich quakt. Mein Herz macht einen Salto, gleichzeitig muss ich über mich selbst lachen. Die Enten bedenken mich mit einem zweifelnden Blick, während sie an mir vorbei zum Ufer watscheln und schwimmen gehen. Wellen schwappen über das Wasser, bringen die bis dahin ruhig daliegende Oberfläche in Bewegung. Ich beobachte, wie die Enten im flachen Wasser tauchen und ihr Gefieder putzen. Es ist genau das, was meinem Bild gefehlt hat.
Vertieft in den einmaligen Anblick krieche ich immer näher ans Ufer und versuche, die Enten zu fotografieren, wie sie umhüllt von Nebelschwaden im scheinbaren Nichts schwimmen.
»Na, wieder mal auf der Jagd nach dem perfekten Foto?«
Ich sehe auf. Elisa, unsere Dorffriseurin, beobachtet mich lächelnd. Ich stehe auf, trete vorsichtig aus dem Schilf heraus und grinse. »Ähm ja. Kennst mich doch.«
»Ich würde wirklich mal gerne ein Fotoalbum mit deinen Bildern sehen. Das Leben im Reservat – Impressionen jugendlicher Kunst.« Sie zwinkert mir zu.
Bei ihren Worten schießt mir das Blut in die Wangen. »So gut bin ich nicht«, wehre ich verlegen, aber auch geschmeichelt ab.
»So bescheiden wie eh und je.« Elisa lacht. »Du bist wirklich gut, Gray. Das ist nicht nur meine Meinung.« Sie wirft einen Blick über die Schulter und ich stelle fest, dass sie mit Maxi unterwegs ist. Dier junge Pan hält eine Tüte mit Brötchen im Arm und verfolgt ein paar Nachzügler-Enten auf dem Weg zum Teich. Empört schnatternd flüchten sie vor sihm und schlagen aufgeregt mit den Flügeln. »Nun denn, mein Laladi wartet bestimmt schon auf die Brötchen«, verabschiedet sich Elisa. »Wollen wir ihn mal lieber nicht verhungern lassen.« Sie schenkt mir ein Lächeln zum Abschied. »Maxi, kommst du?«
Enttäuscht lässt dier junge Pan von den Enten ab, winkt mir zu und rennt sihrer Ama hinterher.
»Guten Appetit«, wünsche ich verspätet und greife nach meiner Tasche. Besser, ich mache mich auch auf den Weg.
Ich haste über den Dorfplatz. Vor dem Bäcker hat sich bereits eine kleine Schlange gebildet. Verdammt, ich habe zu viel getrödelt.
Ungeduldig warte ich auf meine Brötchen, kaufe gleich noch ein paar Eier dazu und haste dann nach Hause. Erst, als mir dort eine schläfrige Stille entgegenschlägt, fällt die Spannung von mir ab. Ich schließe die Küchentür, atme tief durch und lege die Tüte auf den Tisch. »Ciel, spiel meine Morgen-Playlist in der Küche ab«, bitte ich unsere elektronische Hausassistentin und lasse meine Schultern kreisen.
Während die ersten elektronisch verzerrten Töne aus den kleinen Lautsprechern dringen, beginne ich, den Tisch zu decken und den Kaffee vorzubereiten. Die Lieder helfen mir, die Anspannung aus meinen Muskeln zu vertreiben. Summend und im Takt der Musik bewege ich mich durch die Küche, suche Besteck und Teller zusammen und mache Rührei. Als mein Lieblingslied einsetzt, kann ich nicht anders, als mitzusingen. Während ich darauf warte, dass der Kaffee durchgelaufen ist, verwandele ich die Küche in eine Bühne und spiele Luftgitarre. »And now it’s time to fight the night king«, singe ich leise, verliere mich im Gitarrensolo.
»An deinem Riff musst du aber noch ein wenig arbeiten«, sagt Markus, der just in diesem Moment die Küche betritt. »Guten Morgen, Hase.« Er zwinkert mir zu, schenkt sich einen Kaffee ein und rutscht auf die Bank, wo sein Tablet auf ihn wartet. Ich grinse, während er sich in die Zeitung vertieft.
Wenig später kommt auch Flora mit Juli auf dem Arm in die Küche. Mein kleiner Bruder trägt noch seinen Schlafanzug mit den Feuerwehrmännern und reibt sich müde die Augen. Das kurze, blonde Haar steht wild in alle Richtungen ab. Angesichts des reich gedeckten Frühstückstisches wird er rasch munter. Er befreit sich aus Floras Armen und klettert auf seinen Stuhl. »Guten Morgen, Gray«, sagt er mit einem breiten Lächeln und reißt sich das Rührei unter den Nagel.
»Guten Morgen, Juli«, begrüße ich den kleinen Mann und streiche ihm über die Haare. Ein warmes Glühen nistet sich in meiner Brust ein. Ich mag noch nicht lange einen kleinen Bruder haben, aber ich liebe ihn abgöttisch. »Und guten Morgen, Ama.«
Flora gibt mir einen Kuss auf die Stirn, bevor sie zu Markus auf die Bank rutscht. »Hallo, Liebling. Gut geschlafen?«
»Geht so.« Ich gieße mir Tee ein.
»Wieder Probleme beim Einschlafen gehabt?« Sie runzelt die Stirn. »Ich dachte, das wäre besser geworden.«
Ich zucke mit den Schultern und nehme mir ein Brötchen. Schlafprobleme sind nichts Neues für mich, ebenso wenig wie die Kopfschmerzen, die damit einhergehen.
»Apropos Probleme«, schaltet sich Markus ein und löst sich für einen Moment von seiner Zeitung. »Doktor Schneider hat sich gemeldet. Ihr gefallen deine Blutwerte nicht. Sie bittet dich, bei ihr vorbeizuschauen.«
»Heute noch oder am Montag?«, will ich wissen, während sich mein Herzschlag beschleunigt. Doktor Schneider hatte mich erst Anfang der Woche für ein paar Tests in die Praxis gebeten.
»Heute noch. Du sollst einfach am Vormittag in der Praxis vorbeischauen. Sie muss noch ein wenig Papierkram machen, ist also die ganze Zeit da.«
»Okay.« Wenn es so dringend ist, bedeutet das sicherlich nichts Gutes. Dabei war ich gerade erst aus der strengen Beobachtung raus. Noch eine Woche und wir hätten die tägliche Blutprobe auf zweimal wöchentlich herunterfahren können. »Danke.« Traurig schaue ich auf meinen kleinen Finger, der von Einstichstellen übersät ist. Wenn ich noch häufiger eine Blutprobe abgeben muss, wird die Fingerkuppe gar nicht mehr heilen.
Juli unterbricht seine Versuche, das Nutellaglas aufzudrehen, und sieht mich mit nachdenklich gerümpfter Nase an. »Bist du krank, Gray?«
Ich schüttele den Kopf. »Nein, kleiner Mann. Ich fühle mich so wie immer. Ein bisschen müde vielleicht.« Den Nebel in meinem Kopf werde ich seit Tagen nicht los. Ein oder zwei Nächte mit mehr als drei Stunden Schlaf könnten das sicherlich beheben.
Markus gibt ein tiefes Brummeln vor sich, ohne mir seine Gedanken zu verraten. Ama versucht, das Thema zu wechseln, während sie für Juli das Nutellaglas aufschraubt. »Und? Was habt ihr heute vor?«
»Ich treffe mich nachher mit Maxi«, sagt mein kleiner Bruder. »Wir bauen zusammen mit ein paar anderen ein Baumhaus am Waldrand.«
»Ganz alleine?«, fragt Markus und runzelt die Stirn. Der Gedanke, dass ein Haufen Sechs- und Siebenjähriger im Wald mit Säge und Hammer hantiert, scheint ihm nicht zu behagen. Ebenso wenig wie Flora, die ihren Sohn erschrocken mustert.
»Nein, ein paar aus der Elften sind mit dabei«, erkläre ich. »Das ist das diesjährige Projekt aus dem Werkunterricht. Sie wollen eine Art Abenteuerspielplatz am Waldrand bauen. Die Kleinen dürfen helfen.«
»Ach so.« Beruhigt wendet sich Markus wieder der Zeitung zu. Nachdenklich streicht er sich über den grau gewordenen Kinnbart. Für eine Weile herrscht gefräßige Stille in der Küche. Als Markus ausgetrunken hat, legt er sein Tablet zur Seite. »Gestern im Rat hat es den Antrag gegeben, das Apfelblütenfest für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen«, informiert er uns.
Ich starre auf mein halbgegessenes Brötchen. Ein wilder Mix aus Gefühlen rauscht durch meinen Körper. »Wirklich?«
Er nickt.
Ich lehne mich in dem Stuhl zurück, horche in mich hinein. Das Apfelblütenfest, Highlight des Jahres. Der Tag, an dem die Pan aus der Abschlussklasse ihr Geschlecht festlegen und damit die letzte Hürde auf dem Weg zum Erwachsenwerden meistern. In diesem Jahr werde auch ich Teil der Zeremonie sein und nicht mehr im Publikum sitzen.
»Ich finde, das ist eine großartige Idee«, sagt Flora mit aufrichtiger Begeisterung. »Dann können wir mit den Menschen gemeinsam feiern. Was denkst du, Hase?« Sie sieht ihren Mann fragend an.
Markus hebt abwehrend die Hände. »Ich werde mich aus der Sache raushalten. Das ist eine Entscheidung, die die Pan treffen sollten, nicht die Menschen, die hier im Reservat leben. Es ist euer Fest. Ich bin dankbar, dass ich mir die Zeremonie ansehen darf, aber ich will nicht darüber entscheiden, ob sich jeder diese Zeremonie anschauen darf.« Sein Blick zuckt zu mir, als wüsste er, was in meinem Kopf vor sich geht.
Ich schätze ihn sehr für diese Antwort. Es leben nicht viele Menschen im Reservat. Die meisten sind im Zuge eines Experiments hergezogen, bei dem getestet wird, ob Menschen und Pan zusammenleben können. Sie lernen von uns, wir lernen von ihnen und manchmal vergesse ich, dass sie keine Pan sind. Aber ich bin derselben Meinung wir Markus: Sie sind nicht diejenigen, die entscheiden sollen, ob das Fest für die Öffentlichkeit geöffnet wird. Es hat für sie nicht dieselbe Bedeutung wie für uns. Das werden sie niemals verstehen können und deswegen sollten sie auch nicht mitbestimmen dürfen.
»Warum sollte es sich nicht jeder anschauen dürfen?«, fragt Flora verwirrt. »Wer sollte etwas dagegen haben?«
»Ich halte es für keine gute Idee«, werfe ich ein. »Auf den jungen Pan lastet auch so schon ein enormer Druck an diesem Tag. Noch mehr Publikum zu haben, macht die Sache nicht einfacher.«
Flora streicht mit einer schnellen Bewegung ein paar Krümel von ihrem Kleid. Passenderweise trägt sie heute ein knielanges in dunklem Rosa, auf dem sich Apfelblüten tummeln. »Aber denk doch nur daran, wie toll es wäre, wenn noch mehr Menschen mit uns feiern würden. Ich meine, diesen Tag erleben Pan in ihrem Leben nur einmal.«
»Ich weiß, Ama«, erwidere ich mit zusammengebissenen Zähnen. Es fällt mir schwer, die Wut aus meinen Worten herauszuhalten, obwohl sich ein Teil von mir aufregen will. »Denk du doch mal an die Pan, die sich noch nicht entschieden haben. An mich zum Beispiel. Ich finde es schon schlimm genug, dass wir vor dem ganzen Dorf stehen und unsere Entscheidung verkünden müssen.«
»Ach, Schatz.« Flora beugt sich zu mir herüber und streicht mir über die Wange. »Du hast noch einen ganzen Monat Zeit, um dich zu entscheiden. Bis dahin wirst auch du wissen, was du werden willst.«
»28 Tage«, verbessere ich sie. Mein Blick ist auf das halb gegessene Brötchen auf meinem Teller gerichtet, meine Hände kämpfen gegen den Drang an, sich zu Fäusten zu ballen. »Und ich wäre mir da nicht so sicher. Ich habe achtzehn Jahre Zeit gehabt, meine Wahl zu treffen. Wieso sollte es mir in den nächsten 28 Tagen leichter fallen?«
»Es geht nicht nur um die jungen Pan, Hase«, gibt Markus zu bedenken. »Denk an all die Sicherheitsmaßnahmen, die zum Tag der offenen Tür getroffen werden müssen, damit es hier drinnen ruhig bleibt. Das Fest für die Öffentlichkeit freizugeben, wäre mit viel Aufwand verbunden.«
Ich nicke bekräftigend. »Am Ende kommen noch die Leute rein, die unsere Mauern beschmieren oder immer Steine in deinen Laden werfen. Die werden bestimmt keine Möglichkeit auslassen, das Fest zu stören.«
»Hm«, macht Flora nachdenklich. »Ich fände es trotzdem toll, mit den Menschen feiern zu dürfen.«
»Der Rat hat entschieden, dass es dazu einen Bürgerentscheid geben soll. Dann können wir ja sehen, wie die anderen Pan darüber denken«, sagt Markus und schenkt mir einen aufmunternden Blick.
Ich ringe mir ein schiefes Lächeln ab. Ich bin mir sicher, dass die Entscheidung nicht zu meinen Gunsten ausfallen wird. Die Pan lieben das Apfelblütenfest. Wenn es nach ihnen ginge, würde es die Mauer um das Reservat gar nicht geben. Die Tage der offenen Tür wären überflüssig. Das Fest mit noch mehr Leuten teilen zu können, wird für die meisten eine positive Nachricht sein.
Kapitel 4
»Hey, Doc?« Ich klopfe vorsichtig an die Tür.
Auf der anderen Seite bleibt es still. Ein zaghafter Druck auf die Klinke zeigt: Die Praxis ist wie angekündigt unverschlossen. Mit einem mulmigen Gefühl im Magen schiebe ich mich in den verwaisten Flur. Der Empfang gähnt mir entgegen, die Stühle stehen verlassen herum, nur halbherzig unter den Empfangstisch geschoben.
Es ist seltsam, hier zu sein, ohne angestarrt zu werden. Für gewöhnlich kann ich keinen Schritt in der Praxis machen, ohne den bohrenden Blick der Wartenden zu spüren. Ich weiß, dass hinter meinem Rücken über mich getuschelt wird. Meine Familie ist durch die Flucht meines Danans gebrandmarkt und ich bin zu oft hier, weil ich so häufig switche. Das macht es nur noch schlimmer.
Ich trete an den Tresen und betätige die Glocke. Sie gibt ein jämmerliches Läuten von sich, das verklingt, lange bevor es die hinteren Zimmer erreichen kann. Unsicher blicke ich in Richtung des Flurs, von dem die Untersuchungsräume abgehen. Ich fühle mich nicht wohl dabei, ohne Fachpersonal oder Anweisungen durch die Gänge zu stromern, aber ich kann schlecht im Wartezimmer sitzen, bis Doktor Schneider zufällig vorbeikommt.
Mit zögerlichen Schritten gehe ich den Flur entlang. Mein Herz schlägt so wild wie das eines Verbrechers, der bei Nacht in eine Wohnung eindringt. Bei jedem Raum bleibe ich stehen, drücke die Tür vorsichtig auf und werfe einen Blick ins Zimmer. »Doc?« Ich erhalte keine Antwort. Die verlassene Praxis wirkt gespenstisch, das leise Jaulen der Türscharniere jagt mir eine Gänsehaut über den Rücken.
Ich schrecke zusammen, als ich aus einem der hinteren Zimmer ein metallisches Poltern höre, gefolgt von einem derben Fluch. Ein Stapel Blätter ergießt sich in den Flur. Ich atme tief durch und versuche mich zu beruhigen, obwohl mir mein Herz bis zum Hals klopft. Ich mache mir selber Angst.
Langsam nähere ich mich der halbgeöffneten Tür mit der Aufschrift Labor, als sie auch schon aufgerissen wird und Doktor Schneider heraustritt. Sie kniet sich mit dem Rücken zu mir nieder und sammelt die Zettel ein.
Ich trete vor, um ihr zu helfen. Nun sehe ich auch, warum sie nicht auf meine Rufe reagiert hat: Sie hört Musik. Als sie die Bewegung aus dem Augenwinkel wahrnimmt, fährt sie zusammen und schnellt in die Höhe. »Du meine Güte, Gray!« Sie greift sich erschrocken an die Brust, bevor sie sich mit einem schiefen Grinsen die Kopfhörer aus den Ohren zieht.
»Entschuldigung, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich habe gerufen«, sage ich verlegen.
»Und ich Dummkopf habe die Musik so laut gedreht, dass ich dich nicht hören konnte.« Sie zieht ihren Musikplayer aus dem Kittel und schaltet ihn aus. »Das Lied war einfach zu gut«, gesteht sie und wackelt verschwörerisch mit den Augenbrauen. »Ich konnte nicht widerstehen.« Sie deutet eine Luftgitarre an und ich ahne, warum es im Labor so laut gescheppert hat.
Mit einem verständnisvollen Lächeln helfe ich Doktor Schneider, die restlichen Papiere einzusammeln. Sie stopft sie in eine leere Akte und lässt sie auf einen der Labortische fallen.
»Danke, dass du die Zeit gefunden hast, vorbeizuschauen.« Sie führt mich in ihr Büro und bedeutet mir mit einem Wink, mich zu setzen.
Nervös sinke ich auf die vordere Kante des Stuhls und reibe mit den Händen über meine Jeans. Ich bin nicht gerne hier. Die medizinischen Bilder an den Wänden machen mir Angst. Ich frage mich, ob in allen Praxen solche gruseligen Poster von Körperteilen an den Wänden kleben oder Doktor Schneider nur ein besonderes Faible dafür hat. Ich mag sie, ihren jugendlichen Elan, wie es die anderen Ärzte im Reservat formulieren, obwohl sie bereits Mitte dreißig sein muss. Ihr Kleidungsstil und Musikgeschmack harmonieren prima mit den seltsamen Bildern. Auch heute trägt sie unter dem Kittel ein schwarzes T-Shirt mit einem Band-Logo und dazu Schuhe mit dicker Gummierung.