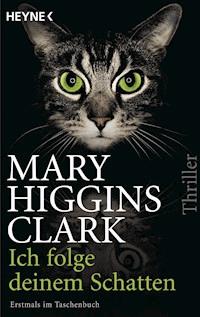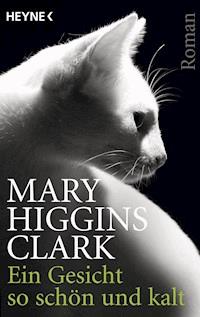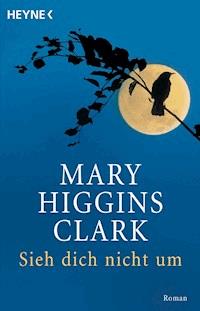2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Seit Jahren schon ist die TV-Journalistin Delaney Wright auf der verzweifelten Suche nach ihrer Mutter, die sie nie kennengelernt hat. Immerhin beruflich läuft alles perfekt. Täglich berichtet sie im Fernsehen über einen spektakulären Mordfall: Betsy Grant soll ihren alten, kranken – und sehr reichen Ehemann kaltblütig getötet haben. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse: Der Prozess nimmt eine schockierende Wendung, die Suche nach ihrer Mutter führt zu einem dunklen Geheimnis – und plötzlich schwebt Delaney selbst in höchster Gefahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Zum Buch
Gleich nach ihrer Geburt wurde Delaney von ihrer unbekannten Mutter fortgegeben. Obwohl die TV-Journalistin in einer liebevollen Adoptivfamilie aufwuchs, prägte dieses Trauma ihr Leben. Auch jetzt noch, mit 26 Jahren, will sie unbedingt das Geheimnis um ihre Herkunft lösen.
Immerhin erhält sie beruflich die Chance ihres Lebens: Jeden Abend darf sie in den 18-Uhr-Nachrichten von einem spektakulären Mordfall berichten. Angeklagt ist Betsy Grant, die ihren alzheimerkranken, reichen und viel älteren Ehemann ermordet haben soll. Betsy will unbedingt ihre Unschuld beweisen – auch wenn alle Indizien gegen sie sprechen. Doch je mehr sich der Prozess gegen sie zu wenden scheint, desto überzeugter ist Delaney von ihrer Aufrichtigkeit. Verzweifelt versucht sie, dem wahren Mörder auf die Spur zu kommen.
Währenddessen finden ihre Freunde Alvirah und Willy Meehan endlich heraus, was bei Delaneys Geburt geschah. Die Erkenntnis ist schockierend …
Zur Autorin
Mary Higgins Clark, geboren in New York, lebt und arbeitet in Saddle River, New Jersey. Sie zählt zu den erfolgreichsten Thrillerautoren weltweit. Ihre große Stärke sind ausgefeilte und raffinierte Plots und die stimmige Psychologie ihrer Heldinnen. Mit ihren Büchern führt Mary Higgins Clark regelmäßig die internationalen Bestsellerlisten an. Sie hat bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, u. a. den begehrten Edgar Award. Zuletzt bei Heyne erschienen: So still in meinen Armen.
MARY HIGGINS CLARK
UND DEINE ZEIT VERRINNT
THRILLER
Aus dem Amerikanischen von Karl-Heinz Ebnet
Für die Neuvermählten
Dr. James und Courtney Clark Morrison,
in Liebe
PROLOG
Das Neugeborene schrie so herzzerreißend, dass den beiden Paaren, die vor dem Geburtszimmer der Hebamme Cora Banks warteten, für einen Moment der Atem stockte. Dann aber strahlten James und Jennifer Wright vor Freude, während sich auf den Gesichtern von Rose und Martin Ryan, deren siebzehnjährige Tochter soeben das Kind auf die Welt gebracht hatte, traurige Erleichterung breitmachte.
Die beiden Ehepaare waren sich nur unter den Namen »Smith« und »Jones« vorgestellt worden. Sie hegten auch nicht den Wunsch, die wahre Identität der jeweils anderen zu erfahren. Eine Viertelstunde später warteten sie immer noch gespannt darauf, das Neugeborene sehen zu können.
Es handelte sich um ein dreieinhalb Kilo schweres Mädchen mit schwarzen Löckchen und heller Haut. Sie schlief, aber dann schlug sie plötzlich blinzelnd ihre großen, dunkelbraunen Augen auf.
Jennifer Wright wollte sie schon entgegennehmen, wurde von Cora Banks aber zurückgehalten. »Davor ist noch Geschäftliches zu erledigen«, sagte die Hebamme mit einem schmalen Lächeln.
James Wright öffnete die Aktentasche, die er bei sich hatte. »Sechzigtausend Dollar«, sagte er. »Zählen Sie nach.«
Die Mutter des Neugeborenen hatte man ihnen als siebzehnjährige Highschool-Absolventin beschrieben, die in der Nacht des Abschlussballs schwanger geworden war. Die Familie hatte es geheim gehalten, niemand sollte davon erfahren. Familienangehörigen und Freunden hatten sie erzählt, sie sei noch zu jung, um an ein College wegzugehen, weshalb sie übergangsweise im Damenmodegeschäft ihrer Tante in Milwaukee arbeiten würde. Der achtzehnjährige Vater war weggegangen, um zu studieren, ohne jemals von der Schwangerschaft zu erfahren.
»Vierzigtausend Dollar für die Collegeausbildung der jungen Mutter«, verkündete Cora, nachdem sie das Geld gezählt hatte und den Eltern der Mutter den Betrag aushändigte. Die restlichen zwanzigtausend Dollar, die sie für ihre eigenen Dienste einbehielt, erwähnte sie nicht.
Die Großeltern des Neugeborenen nahmen schweigend das Geld entgegen. Jennifer Wright streckte sehnsuchtsvoll die Arme nach dem Baby aus. »Ich bin ja so glücklich«, flüsterte sie.
»Ich werde Ihre Namen in die Geburtsurkunde eintragen«, sagte Cora Banks. Ihr freudloses Lächeln machte ihr rundes, reizloses Gesicht nicht unbedingt hübscher. Obwohl sie erst vierzig war, wirkte sie mindestens zehn Jahre älter.
Sie wandte sich an die Eltern der jungen Mutter. »Lassen Sie sie noch einige Stunden schlafen, dann können Sie Ihre Tochter nach Hause bringen.«
Im Geburtsraum versuchte die Siebzehnjährige, die Wirkung des großzügig bemessenen Beruhigungsmittels abzuschütteln. Nachdem sie ihr Kind kurz hatte halten dürfen, fühlten sich ihre Brüste noch geschwollener an. Ich will mein Kind behalten, ich will mein Kind behalten, dachte sie voller Verzweiflung. Gebt mein Baby nicht weg. Ich werde es schaffen, mich darum zu kümmern …
Zwei Stunden später lag sie zusammengerollt auf der Rückbank des elterlichen Wagens und wurde in ein nahegelegenes Motel gebracht.
Am nächsten Morgen saß sie in einer Maschine und trat allein den Flug nach Milwaukee an.
1
Und jetzt zur Werbung«, flüsterte Delaney Wright ihrem Mitmoderator bei den 18-Uhr-Nachrichten des Fernsehsenders WRL zu. »Die reißt einen doch immer wieder vom Hocker.«
»Damit werden unsere Gehälter bezahlt«, erinnerte Don Brown sie lächelnd.
»Ich weiß, Gott sei Dank«, entgegnete Delaney fröhlich und musterte sich im Spiegel.
Sie war sich nicht sicher, ob die dunkelrote Bluse, die die Garderobiere ihr herausgesucht hatte, nicht zu kräftig für ihre blasse Haut war, zumindest aber passte sie zu ihren schulterlangen schwarzen Haaren. Und Iris, die Maskenbildnerin, die sie am liebsten mochte, hatte ihre dunkelbraunen Augen und langen Wimpern mal wieder wunderbar betont.
Der Regisseur begann seinen Countdown: »Zehn, neun, acht … drei, zwei …« Nach »eins« setzte Delaney mit ihrem Text ein: »Morgen beginnt die Auswahl der Geschworenen für das Gerichtsverfahren gegen die dreiundvierzigjährige ehemalige Highschool-Lehrerin Betsy Grant am Gericht des Bergen County in Hackensack, New Jersey. Grant ist des Mordes an ihrem Ehemann Dr. Edward Grant angeklagt. Der an Alzheimer erkrankte Arzt war zum Zeitpunkt seines Todes erst achtundfünfzig Jahre alt. Die Angeklagte beharrt auf ihrer Unschuld, während die Staatsanwaltschaft ihr vorwirft, dass sie nicht mehr habe abwarten wollen, bis ihr kranker Mann eines natürlichen Todes starb. Sie und sein Sohn sind gleichberechtigte Erben seines auf über fünfzehn Millionen Dollar geschätzten Vermögens.«
»Aber nun zu etwas sehr viel Erfreulicherem«, übernahm Don Brown die Moderation. »Einer Geschichte, wie wir sie Ihnen mit Freuden präsentieren.« Auf dem Bildschirm wurde der dazugehörige Beitrag eingeblendet, der von der Wiedervereinigung eines dreißigjährigen Sohnes mit seiner leiblichen Mutter handelte. »Zehn Jahre lang haben wir beide einander gesucht«, sagte Matthew Trainor. »Ich hatte immer das Gefühl, als würde sie mich rufen. Ich musste sie einfach finden.«
Er hatte den Arm um eine stämmige, etwa fünfzigjährige Frau gelegt. Ihr natürlich gewelltes Haar legte sich weich um ihr freundliches Gesicht, in ihren haselnussbraunen Augen schimmerten Tränen. »Mit neunzehn habe ich Charles zur Welt gebracht.« Sie sah zu ihrem Sohn. »Für mich war er immer nur Charles. Und an seinem Geburtstag hab ich immer Spielsachen gekauft und sie an Wohltätigkeitseinrichtungen für Kinder verschenkt.« Mit zitternder Stimme fügte sie hinzu: »Aber mir gefällt auch der Name, den seine Adoptiveltern ihm gegeben haben. Matthew bedeutet nämlich ›Geschenk Gottes‹.«
»Solange ich mich erinnern kann«, sagte Matthew, »war in mir so ein Bedürfnis. Ich wollte immer wissen, wer meine leiblichen Eltern sind, und vor allem wollte ich meine Mutter kennenlernen.«
Er umarmte sie, worauf Doris Murray nun doch in Tränen ausbrach. »Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich meinen Sohn vermisst habe.«
»Was für eine herzergreifende Geschichte, nicht wahr, Delaney?«, wandte sich Don Brown an sie.
Delaney aber konnte nur nicken. Sie schluckte schwer und fürchtete, sie würde ebenfalls gleich losheulen, wenn sie jetzt auch nur ein Wort sagte.
Don wartete, und als von ihr nichts kam, fuhr er kurzerhand fort: »So, dann wollen wir mal sehen, was unser Wettermann Ben Stevens heute für uns bereithält.«
»Don«, sagte Delaney nach dem Ende der Sendung, »ich muss mich entschuldigen. Die Geschichte ist mir sehr an die Nieren gegangen, ich habe schon befürchtet, ich müsste genauso in Tränen ausbrechen wie die Mutter.«
»Na, wer weiß, ob die beiden in einem halben Jahr überhaupt noch miteinander reden«, entgegnete Don trocken. Er schob seinen Stuhl zurück. »So, das war’s für heute.«
Im angrenzenden Studio, hinter der Glaswand, sahen sie Richard Kramer, den Moderator der überregionalen Nachrichten, auf Sendung. Delaney wusste, dass Don als dessen Nachfolger gehandelt wurde, wenn Kramer in Rente ging. Sie stand auf, verließ das Studio und tauschte in ihrem Büro die dunkelrote Bluse gegen ein Yoga-Top aus. Sie war heute lediglich für Stephanie Lewis eingesprungen, die eigentliche Ko-Moderatorin, die sich krankgemeldet hatte. Ansonsten war Delaney für die Berichterstattung über den Betsy-Grant-Prozess zuständig, was sie besonders freute. Denn der versprach äußerst spannend zu werden.
Sie nahm sich ihre Umhängetasche, verabschiedete sich von den Kollegen, durchquerte mehrere lange Gänge und trat hinaus auf den Columbus Circle.
Sosehr sie den Sommer auch mochte, nun freute sie sich auf den Herbst. Nach dem Labor Day lag in Manhattan immer so ein Sirren in der Luft, dachte sie. Insgeheim aber wusste sie, dass sie sich mit diesen Gedanken nur ablenken wollte. Der Beitrag über die Adoption hatte die Mauern aufgerissen, die sie so sorgfältig errichtet hatte, um dieses Thema nicht an sich heranzulassen.
Sie musste ihre leibliche Mutter finden. James und Jennifer Wright hatten sie gleich nach ihrer Geburt adoptiert, ihre Namen waren sogar auf ihrer Geburtsurkunde eingetragen, laut der sie in Philadelphia zur Welt gekommen war. Bei ihrer Geburt war eine Hebamme anwesend gewesen, aber die Frau, die die Adoption vermittelt hatte, war schon tot.
Eine Sackgasse, scheinbar. Aber noch wollte sie nicht aufgeben. Sie hatte von einem pensionierten Polizisten gehört, der sich auf genau solche Fälle spezialisiert hatte: Er spürte Menschen auf, die eigentlich nicht aufzuspüren waren. Sie war während ihres eineinhalb Kilometer langen Heimwegs so tief in ihre Gedanken versunken, dass sie von der Fifth Avenue kaum etwas mitbekam.
An der 54th Street bog sie nach Osten ab. Ihre Wohnung in einem der älteren Gebäude dort lag genau neben der einstigen Wohnung von Greta Garbo. Deren berühmtes Zitat »Ich möchte alleine sein« kam Delaney am Ende eines hektischen Tages im Studio oft in den Sinn.
Der immer lächelnde Portier Danny öffnete ihr die Tür. Ihre Wohnung hatte drei weiträumige Zimmer, war aber natürlich nicht zu vergleichen mit dem großen und wunderschönen Haus in Oyster Bay, Long Island, wo sie aufgewachsen war. Sie legte die Tasche ab, holte sich ein Minerwalwasser aus dem Kühlschrank, ließ sich im Sessel nieder und legte die Füße auf den Polsterhocker.
Auf dem Tisch stand ein großes Familienbild, das aufgenommen wurde, als sie drei Jahre alt war. Es zeigte sie auf dem Schoß ihrer Mutter, gleich daneben saß ihr Vater. Dahinter standen ihre drei Brüder. Delaneys schwarze Locken und dunkelbraune Augen fielen einem sofort auf. Denn alle anderen hatten rötlich blonde Haare, und ihre Augenfarbe variierte zwischen blassblau und braun.
Sie konnte sich noch genau erinnern. Als sie dieses Foto zum ersten Mal gesehen hatte, war sie in Tränen ausgebrochen. »Warum sehe ich nicht aus wie die anderen?«, hatte sie geweint. Daraufhin hatte man ihr erzählt, dass sie adoptiert worden war. Nicht in diesen Worten, aber ihre Eltern hatten ihr in diesem frühen Alter, so gut sie es konnten, erklärt, dass sie sich ein Mädchen gewünscht hatten – und so war sie als Baby in die Familie gekommen.
Im vergangenen Monat war zum fünfundsiebzigsten Geburtstag ihrer Mutter die Familie wieder in Oyster Bay zusammengekommen. Jim war aus Cleveland angereist, Larry aus San Francisco und Richard aus Chicago, alle hatten ihre Frauen und Kinder mitgebracht. Sie hatten es alle sehr genossen. Ihre Eltern würden bald nach Florida ziehen. Sie hatten die Möbel, die sie nicht mehr brauchten, hergegeben und Delaney und ihren Brüdern gesagt, sie sollten sich aussuchen, was sie wollten. Sie hatte einige kleinere Stücke mitgenommen, die in ihre Wohnung passten.
Wieder sah sie zu dem Familienporträt und versuchte, sich ihre Mutter vorzustellen, die sie niemals gekannt hatte. Sehe ich aus wie du?, fragte sie sich.
Das Telefon klingelte. Delaney hatte eigentlich keine Lust dranzugehen, erkannte dann aber die Nummer des Anrufers. Carl Ferro, der Produzent der 18-Uhr-Nachrichten. »Stell dir vor«, begann er überschwänglich, »Stephanie hat das Angebot von NOW News angenommen. Wir freuen uns alle riesig, denn so langsam ist sie zu einer Wahnsinns…« – er legte eine kurze Kunstpause ein – »…nervensäge geworden. Sie bildet sich ständig ein, dass sie mehr weiß als Kathleen.« Kathleen Gerard war die leitende Produzentin der Nachrichtenredaktion. »Ihre Kündigung ist am Morgen reingeflattert. Damit bist du jetzt also die neue Ko-Moderatorin von Don Brown. Herzlichen Glückwunsch.«
Delaney schnappte nach Luft. »Carl, das ist großartig! Was soll ich sagen? Bloß, dann kann ich doch gar nicht mehr vom Grant-Prozess berichten, oder?«
»Doch, das sollst du sogar. Wir werden bis zum Ende des Prozesses mit ständig wechselnden Ko-Moderatoren arbeiten. Du bist eine tolle Reporterin. Dieser Prozess fällt genau in dein Ressort.«
»Carl, das ist wirklich fantastisch. Tausend Dank«, sagte Delaney.
Aber als sie auflegte, befiel sie eine seltsame Unruhe. Wie hatte ihr altes Kindermädchen immer gesagt? »Wenn alles bestens scheint, sind Probleme nicht mehr weit.«
2
Willy, ich brauche ein neues Projekt«, sagte Alvirah beim Frühstück in ihrer Wohnung an der Central Park South. Sie waren mittlerweile bei der zweiten Tasse Kaffee angelangt, und das war der Zeitpunkt, an dem Alvirah so richtig in Plauderlaune war. Willy hatte bis dahin auch schon den Sportteil der Post durch, bei dem ihn keiner stören durfte.
Mit einem ergebenen Seufzer legte er die Zeitung zur Seite und sah zu seiner geliebten Frau, mit der er seit dreiundvierzig Jahren verheiratet war. Seine weißen Haare, das runzelige Gesicht und die stechend blauen Augen erinnerten ältere Freunde manchmal an Tip O’Neill, den legendären Sprecher des Abgeordnetenhauses.
»Ich weiß, ich weiß, es wird dir langsam wieder langweilig.«
»Genau«, bestätigte Alvirah und nahm sich ein zweites Stück Kuchen. »In letzter Zeit war nicht viel zu tun. Ich meine, die Flusskreuzfahrt auf der Seine, die habe ich schon sehr genossen. Wer hätte das nicht? Und es war sehr schön zu sehen, wo van Gogh die letzten Monate seines Lebens verbracht hat. Wirklich toll. Aber jetzt ist es gut, wieder zu Hause zu sein.«
Sie sah aus dem Fenster und bewunderte den Blick über den Central Park. »Willy, können wir nicht von Glück reden, dass wir hier sein dürfen? Wenn ich nur an unsere frühere Wohnung in Astoria denke. Die Küche hatte noch nicht mal ein Fenster.«
Willy erinnerte sich nur allzu gut daran. Sechs Jahre zuvor hatte er noch als Klempner gearbeitet und Alvirah als Putzfrau. Sie hatten in ihrer alten Wohnung gesessen, Alvirah hatte ihre müden Füße in Epsom-Salz gebadet, als im Fernsehen die Gewinnlose der Lotterie verkündet wurden. Er musste ihre Losnummer zweimal vorlesen, bevor ihm klar wurde, dass sie gerade vierzig Millionen Dollar gewonnen hatten.
Sie hatten sich dafür entschieden, sich das Geld in jährlichen Raten auszahlen zu lassen, von dem sie immer die Hälfte zur Seite legten. Daraufhin hatten sie sich ihre jetzige Wohnung an der Central Park South gekauft, die Wohnung in Astoria aber behalten, für den Fall, dass der Staat pleitegehen sollte und ihre Raten nicht mehr auszahlen konnte.
Im weiteren Verlauf war Alvirah vom Daily Standard interviewt worden, und sie hatte von ihrem Wunschtraum erzählt, einmal das Cypress Point Spa in Kalifornien zu besuchen. Daraufhin bat der Reporter sie, für die Zeitung über ihre Erlebnisse dort zu berichten. Die Redaktion gab ihr eine rosettenförmige Brosche mit eingebautem Mikrofon mit, sodass sie alle Gespräche mit den anderen Gästen aufzeichnen konnte. Das, sagte man ihr, würde ihr beim Abfassen des Artikels helfen. Die Brosche leistete ihr dann aber vor allem gute Dienste, um den Mörder zu überführen, der sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in dem luxuriösen Erholungsressort aufhielt. Seitdem hatte Alvirah, stets mit Unterstützung ihres Mikrofons, eine Reihe von Verbrechen aufgeklärt.
»Und ich freue mich schon auf das Treffen mit Delaney morgen Abend«, sagte Alvirah. »Großartig, dass sie vom Betsy-Grant-Prozess berichten darf.«
»Das ist die, die ihren Mann umgebracht hat, oder?«, fragte Willy.
»Nein, Willy. Das ist die, die beschuldigt wird, ihren Mann umgebracht zu haben.«
»Na ja, nach allem, was ich darüber gelesen habe, würde ich aber sagen, dass die Angelegenheit ziemlich klar ist.«
»Ich stimme dir zu. Trotzdem bin ich bereit, mir das alles ganz unvoreingenommen anzusehen …«
Willy lächelte. »Dann solltest du aber auch ganz ›unvoreingenommen‹ die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass sie schuldig sein könnte.«
3
Zwanzig Kilometer entfernt kochte sich Betsy Grant in der Küche ihres herrschaftlichen Hauses in Alpine, New Jersey, eine zweite Tasse Kaffee. Nachdenklich sah sie aus dem Fenster, wobei sie nur am Rande wahrnahm, dass das goldfarbene Laub der Ulmen schon vom nahenden Herbst kündete.
Die großen Panoramafenster gaben einem das Gefühl, »eins mit der Natur zu sein«, so die Worte des enthusiastischen Immobilienmaklers, der ihnen vor zwölf Jahren das Haus mit den zehn Zimmern angeboten hatte.
Nach einer weiteren ziemlich schlaflosen Nacht war diese Erinnerung noch ganz frisch, so frisch wie die Erinnerung an Ted und wie er sie damals angesehen und auf ihre Reaktion gewartet hatte. Es war klar, dass er das Haus kaufen wollte. Und welche Einwände hätte sie schon haben können? Ich war ja so verliebt in ihn, er hätte alles kaufen können, ich wäre immer damit einverstanden gewesen. Nur eines gefiel mir nicht: dass der Besitzer das Haus billig abgeben musste, weil sein Unternehmen Konkurs angemeldet hatte. Mir gefiel nicht, dass wir vom Unglück eines anderen profitieren sollten. Aber es ist wirklich ein schönes Haus, dachte sie jetzt wieder.
Mit der Kaffeetasse in der Hand ging sie nach oben. Nach Teds Tod benutzte sie wieder das große Schlafzimmer. Sie durchquerte das Wohnzimmer, wo sie so viele glückliche gemeinsame Stunden verbracht und wo sie im Herbst und Winter oft den Kamin entfacht, ferngesehen oder einfach nur zusammengesessen und gelesen hatten.
Die Alzheimer-Diagnose, die Ted schon mit einundfünfzig Jahren ereilte, war eine Tragödie. Irgendwann hatte sie die Treppe absperren lassen, damit er nicht mehr nach oben konnte und die Gefahr bestand, dass er sich gefährlich weit über das Geländer lehnte. Die Bibliothek im Erdgeschoss wurde für ihn zum Schlafzimmer umgebaut. Sie selbst hatte zunächst im kleinen Zimmer nebenan geschlafen, bis sie es schließlich der Ganztagspflegekraft überließ und ihr Schlafzimmer ins Gästezimmer neben der Küche verlegte.
An all das dachte Betsy, während sie im Badezimmer die Tasse auf den Toilettentisch stellte und die Dusche aufdrehte.
Ihr Anwalt Robert Maynard würde in einer Stunde kommen. Keine Ahnung, was er von mir will, dachte Betsy nicht ohne Groll. Ich weiß doch genau, was er sagen wird. Ich weiß, was auf mich zukommt. Sie zog den Morgenmantel und ihr Nachthemd aus und musste an den schrecklichen Moment denken, als Maynard sie darüber in Kenntnis gesetzt hatte, dass die Anklagejury dem Verfahren gegen sie stattgegeben hatte. Das Polizeifoto, die Abnahme der Fingerabdrücke, die Anklagevernehmung, die Kautionsstellung – das alles ging ihr pausenlos durch den Kopf, egal, wie sehr sie es zu verdrängen versuchte.
Sie duschte, steckte die langen, hellbraunen Haare mit einem Kamm zusammen, trug Mascara und einen Hauch Lippenstift auf. Laut der Wettervorhersage sollte es heute merklich kühler werden. Daher wählte sie die langärmelige, jagdgrüne Kaschmirbluse, dazu eine dunkelbraune Freizeithose. Vor vier Monaten hatte sie aufgehört, Schwarz zu tragen, nachdem ein Kolumnist moniert hatte, sie, die des Mordes an Edward Grant angeklagt sei, stolziere in ihrer Witwenkleidung herum. Aber sie hatte schon immer eher gedeckte Töne getragen, auch zu Hause.
Bevor sie das Zimmer verließ, sah sie sich noch einmal um. Es war ihr zu einer festen Angewohnheit geworden. Hin und wieder war es nämlich vorgekommen, dass Ted nachts trotz der Absperrung unten an der Treppe nach oben gekommen war.
Sie hatte es immer recht schnell bemerkt. Denn dann waren sämtliche Schubladen aus den Kommoden und Nachtkästchen herausgezogen, und ihr Inhalt lag auf dem Boden verstreut. Als hätte er nach etwas gesucht, dachte Betsy. Es war für sie und Carmen, ihre Haushälterin, die jeden Tag kam, nicht viel Arbeit gewesen, alles wieder zurückzulegen. Nur einmal versetzte es ihr einen Stich, denn irgendwie musste er sich an die Kombination für den Safe im Schrank erinnert und das wunderbare Smaragd-Diamant-Armband herausgenommen haben, das er ihr zu ihrem ersten Hochzeitstag geschenkt hatte. Sie hoffte immer noch, dass sie oder Carmen es eines Tages finden würden. Aber vielleicht hatte Ted es einfach in den Müll geworfen.
Sie war versucht, das Bett zu machen, wusste aber, dass Carmen jeden Moment eintreffen würde. »Überlassen Sie das doch mir, Miss Betsy. Dafür bin ich doch da«, würde sie sagen. Aber Betsy, die viel zu lange mit ihrer unermüdlich putzenden, wischenden und staubsaugenden Mutter zusammengelebt hatte, fiel es immer noch sehr schwer, auch nur einen Teller im Ausguss stehen oder den Morgenmantel über der Stuhllehne hängen zu lassen.
Mit einem unwillkürlichen Seufzer ging Betsy nach unten, als Carmen gerade das Haus betrat. Eine halbe Stunde später verkündete die Türklingel, dass Robert Maynard auf der Eingangsveranda stand.
4
Alan Grant, Sohn des verstorbenen Edward »Ted« Grant, starrte seine Exfrau Carly an und musste schwer an sich halten, um sich seinen Zorn nicht anmerken zu lassen. Ihr vierjähriger Sohn und ihre zweijährige Tochter hatten gespürt, welche Aggression in der Luft lag, und waren längst in ihr Zimmer gehuscht.
Carly zeigte in deren Richtung. »Würdest du mir bitte erklären, wo ich mit ihnen wohnen soll, wenn wir hier rausgeworfen werden?«, herrschte sie ihn wütend an.
Sie war ausgebildete Tänzerin, ihre Broadway-Karriere hatte allerdings ein abruptes Ende gefunden, als sie von einem Raser, der noch dazu Fahrerflucht begangen hatte, angefahren und schwer verletzt worden war. Die Anspannung, die von den unfallbedingten Rückenschmerzen und den täglichen finanziellen Sorgen herrührte, war nicht spurlos an ihrem ausgesprochen hübschen Gesicht vorübergegangen.
Ihr Exmann hatte keine Antwort für sie. Verärgert blaffte er sie nur an: »Hör zu, du weißt, wenn der Prozess vorbei ist, wird das Geld von meinem Vater ausgezahlt. Mir steht eine ganze Menge zu. Betsy wird auf jeden Fall im Gefängnis landen, und das heißt, dass auch ihre Hälfte vom Vermögen mir zufällt. Du hast reiche Freunde. Leih dir von denen was. Zahl ihnen Zinsen.«
Er zog die Brieftasche heraus und warf ihr eine Kreditkarte auf den Tisch. »Da ist ein bisschen was drauf. Das Geld stammt von einem Auftrag in Atlanta, Architekturaufnahmen. Kauf damit Lebensmittel, bis zum dreißigsten habe ich die Miete.«
Ohne sich von seinen Kindern zu verabschieden, verließ er die Vierzimmerwohnung in der West 89th Street in Manhattan und ging mit schnellen Schritten in Richtung Downtown.
Alan, fünfunddreißig Jahre alt, glich in seinem Äußeren sehr seinem Vater. Den Medien war das nicht verborgen geblieben. Er war knapp über eins achtzig Meter groß, hatte rötlich braune Haare, haselnussbraune Augen und entsprach ansonsten exakt dem Klischee des privilegierten Sprösslings reicher Eltern, der mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden war.
Es war alles Betsys Schuld, dachte er. Anfangs hatte er sich mit ihr ganz gut verstanden, aber dann hatte sie seinen Vater gedrängt, ihm nicht jedes Mal einen Scheck auszustellen, wenn er wieder in Schwierigkeiten steckte, sondern ihm einen angemessenen, regelmäßigen Betrag zukommen zu lassen. »Alan ist ein hervorragender Fotograf«, hatte sie gesagt. »Wenn er sich weniger als Playboy hervortun und mehr auf seine Arbeit konzentrieren würde, könnte er gut davon leben.«
Von da an hatte sein Vater seine Rechnungen nicht mehr beglichen und sich darauf beschränkt, ihm an Weihnachten jeweils einen Scheck über hunderttausend Dollar auszustellen. Aber der reichte bei Weitem nicht aus, um für sich, eine Exfrau mit zwei Kindern und einen zehnjährigen Sohn aus einer früheren Beziehung zu sorgen.
Langsam beruhigte er sich wieder. Es war nur eine Frage der Zeit, sagte er sich. Kein Geschworener der Welt würde Betsy laufen lassen. Erst recht nicht, seitdem bekannt war, dass sie in den letzten zwei Jahren vor dem Tod seines Vaters eine heimliche Beziehung geführt hatte. Eine Beziehung zu einem Professor Dr. Peter Benson, Dekan der geisteswissenschaftlichen Fakultät der Franklin University in Philadelphia. Manchmal hätte Alan am liebsten alles einfach hingeworfen, aber dann redete er sich fest ein, dass am Ende alles gut gehen würde. Er würde das Geld bekommen, Betsy würde keinen Penny davon sehen. Er musste nur Geduld haben.
Er hatte keine große Lust auf die Modeaufnahmen der Frühlingskollektion, die das neue Modelabel irgendeines Starlets herausbrachte. Aber der Auftrag war dringend nötig.
Als er die Central Park West in Richtung Columbus Circle überquerte, zeichnete sich ein Lächeln auf seinem Gesicht ab. Wieder musste er daran denken, wie sein Vater auf Betsy losgegangen war, als sie – eine völlig unsinnige Aktion – den Geburtstag dieses Demenzkranken feiern wollten. »Ich ertrage es nicht mehr«, hatte sie in ihrer Verzweiflung gerufen. Alle hatten es gehört. In dieser Nacht war sein Vater ermordet worden – und Betsy war die Einzige gewesen, die sich mit ihm im Haus aufgehalten hatte.
Wird sie schuldig gesprochen, kann sie das Erbe nicht antreten, dachte er. Und Dads gesamtes Vermögen wird mir zufallen.
Dann versuchte er den grässlichen Gedanken auszublenden, dass sein Vater durch einen wuchtigen Schlag auf den Schädel gestorben war.
5
Dr. Scott Clifton holte sich vor dem Frühstück die Zeitungen von den Stufen seines Hauses in Ridgewood, New Jersey. Er war siebenundfünfzig Jahre alt, ein großer, muskulöser Mann mit sonnengebräuntem Gesicht und dichten blonden Haaren, die allmählich grau wurden. Ein Blick auf die Titelseiten genügte: Je näher der Prozessbeginn rückte, desto schriller wurden die Schlagzeilen.
Insgesamt zwanzig Jahre lang hatten er, Ted Grant und Dr. Kent Adams eine äußerst erfolgreiche orthopädische Praxis geführt, bis vor gut acht Jahren bei Ted Alzheimer diagnostiziert wurde. Danach hatten er und Kent sich getrennt, aber mit Scotts Praxis war es seitdem merklich bergab gegangen.
Lisa kam nicht oft zum Frühstück nach unten, dabei war sie gar keine Langschläferin. Aber spätestens um acht Uhr musste er immer schon das Haus verlassen. So machte er sich seine Frühstücksflocken und den Kaffee also selbst.
Heute tauchte sie allerdings überraschend in der Küche auf.
»Was ist los?«, fragte er.
Sie zögerte. »Du hast dich die ganze Nacht hin und her gewälzt und immer wieder Teds Namen gemurmelt. Ich weiß, der Prozess geht dir nicht aus dem Kopf.«
»Natürlich nicht. Tut mir leid, wenn ich dich beim Schlafen störe«, sagte er gereizt.
»Du störst mich nicht. Ich mach mir lediglich Sorgen.« Sie blinzelte die Tränen fort. »Egal, was ich sage, immer blaffst du mich gleich an«, sagte sie leise.
Scott antwortete nicht darauf. Ihre Hochzeit vor drei Jahren war ein Fehler gewesen.
Die Tinte auf seinen Scheidungspapieren war noch nicht trocken gewesen, da meinte er schon, sie heiraten zu müssen. Jetzt hatte er drei Kinder auf dem College und eine Exfrau, die nicht zögerte, ihn anzurufen, wenn sie mal wieder knapp bei Kasse war und er ihr aushelfen sollte. Natürlich würde er aushelfen. Immer. Das wussten sie beide.
Lisa, zwanzig Jahre jünger als er, hatte als Pharmavertreterin oft bei ihm in der Praxis angerufen. Normalerweise überließ er solche Telefonate seiner Sprechstundenhilfe, für Lisa aber hatte er sich immer Zeit genommen. Sie stammte aus dem Mittleren Westen, war früher Cheerleaderin in der Big Ten Conference gewesen, hatte ein atemberaubendes Lächeln und eine entsprechende Figur.
Was er allerdings nicht auf der Rechnung gehabt hatte: Nachdem der anfängliche Zauber verflogen war, stellte er bald fest, dass er sie weder brauchte noch wollte.
Nur, jetzt konnte er sie schlecht loswerden, eine Scheidung wäre momentan keine gute Idee. Auf keinen Fall wollte er, dass sich jemand eingehender mit seinen Finanzen beschäftigte.
Er würde es mit ihr aushalten müssen, bis der Prozess vorbei war und sich alles wieder etwas beruhigt hatte. Und er fragte sich, ob sie etwas ahnte.
Lisa hielt mit beiden Händen die Kaffeetasse umschlossen. Die Tasse mit seinem Bild und den Worten »Ich liebe dich, Scott«, die kreuz und quer auf die Tasse gedruckt waren. Das Ding trieb ihn noch in den Wahnsinn.
»Scott«, sagte sie zögernd.
Jetzt weinte sie sogar.
»Scott, wir wissen doch beide, dass unsere Ehe nicht funktioniert. Hast du eine Affäre?«
Er starrte sie an. »Natürlich nicht.«
»Ich weiß nicht, ob ich dir glauben kann, aber ich denke mir, es wäre besser, wenn wir getrennte Wege gehen. Ich werde nächste Woche einen Anwalt damit beauftragen, die Scheidung einzureichen.«
Das kann ich nicht zulassen, dachte Scott.
»Lisa, hör mir zu. Ich weiß, ich bin immer kurz angebunden und unaufmerksam, aber das heißt doch nicht, dass ich dich nicht liebe. Ich will dich nicht verlieren. Nur, Teds Tod und die Anklage gegen Betsy haben mir fürchterlich zugesetzt. Bitte.«
Lisa Clifton sah ihrem Mann nicht in die Augen. Sie glaubte ihm nicht. Sie war überzeugt, dass er eine Affäre hatte, hoffte aber immer noch, dass sie sich wieder versöhnen würden. »Würdest du mit mir zu einem Eheberater gehen?«, fragte sie.
Großer Gott, ein Eheberater, dachte Scott und bemühte sich trotzdem, begeistert zu klingen. »Natürlich, meine Liebe, was für eine gute Idee.«
6
Delaney und Alvirah ging der Gesprächsstoff nie aus. Sie hatten sich im Jahr zuvor angefreundet, als sie beide vom Prozess gegen eine Mutter berichtet hatten, die ihr Kind zur Adoption freigegeben, später aber die Adoptiveltern ausfindig gemacht und das Kind entführt hatte. Der Richter zeigte Verständnis für die leibliche Mutter, erinnerte sie aber daran, dass sie, als sie mit fünfundzwanzig Jahren ihr Baby weggegeben hatte, durchaus über die finanziellen Mittel verfügt hätte, um für ihr Kind zu sorgen – ganz zu schweigen von dem großen Kummer, den sie den Adoptiveltern bereitet hatte, als das Kind insgesamt zwei Monate spurlos verschwunden war.
Im Verlauf des Prozesses hatte Delaney Alvirah anvertraut, dass sie selbst adoptiert worden war. Das Thema erwähnte sie sonst nur selten. Die wenigen Male, in denen sie es zur Sprache brachte, hatten Jennifer und James Wright äußerst gekränkt reagiert. »Delaney, ich habe dich keine halbe Stunde nach deiner Geburt in den Armen gehalten«, hatte Jennifer ihr unter Tränen erzählt. »Jahrelang habe ich eine Tochter gewollt, immer habe ich mir ein kleines Mädchen gewünscht zu den drei großen Brüdern, die für sie da wären, wenn ich oder dein Vater einmal nicht mehr sind.«
Sie waren für sie da gewesen, alle zusammen. Sie konnte sich glücklich schätzen, in einer so liebevollen Familie aufgewachsen zu sein, in der jeder für den anderen einstand. Aber jetzt lebten sie alle weit verstreut. Vielleicht fühlte sie sich deshalb dazu gedrängt, ihre leibliche Mutter zu finden. Ihre Adoptiveltern waren mittlerweile nach Naples, Florida, gezogen, so empfand sie es nicht mehr als Verrat, wenn sie sich aktiv auf die Suche nach ihr machte.
Beim Abendessen mit Alvirah und Willy im Patsy’s in der West 56th Street kam das Thema erneut zur Sprache.
Delaney zögerte zunächst. »Alvirah«, sagte sie dann aber, »ich habe euch doch erzählt, dass ich adoptiert wurde.«
Beide nickten.
»Wisst ihr, was Bob Considine, der Journalist, mal geschrieben hat? ›Ich habe vier Kinder. Zwei davon sind adoptiert. Aber ich habe vergessen, welche zwei das sind.‹ Meine Eltern sagten immer, ich würde so anders aussehen, weil ich ganz nach der Großmutter meines Vaters schlage. Sie war gebürtige Italienerin.«
»Auf jeden Fall muss sie eine schöne Frau gewesen sein«, sagte Willy und nahm einen Bissen von seinem Salat.
Delaney lächelte. »Willy, das ist sehr nett von dir. Trotzdem möchte ich meine Wurzeln finden, die Wurzeln meiner leiblichen Familie. Dieses Gefühl ist inzwischen so stark, dass ich bei der letzten Moderation fast in Tränen ausgebrochen wäre, als das Thema erwähnt wurde.«
»Ich hab es gesehen«, sagte Alvirah. »Es ging um eine Mutter, die ihren Sohn wiedergefunden hat, nicht wahr?«
»Ja. Ich hatte einen Kloß im Hals, es war so schlimm, dass ich glatt meinen Einsatz verpasst habe. Don hat es überspielen und den nächsten Beitrag ankündigen müssen.«
»Was ist mit Facebook?«, fragte Alvirah und beantwortete die Frage gleich selbst. »Aber dann würde deine Familie natürlich davon erfahren.«
»Ja«, stimmte Delaney zu. »Die Frau meines Bruders Jim ist ununterbrochen auf Facebook. Mindestens dreimal in der Woche postet sie irgendwelche Fotos von ihren Kindern.«
Alvirah sah, wie Delaney feuchte Augen bekam. »Was genau weißt du über deine Geburt?«
»Nicht viel. Eine Hebamme hat mich in Philadelphia zur Welt gebracht. Zwanzig Minuten später wurde ich den Wrights übergeben, die sich zusammen mit meinen leiblichen Großeltern im angrenzenden Zimmer aufgehalten haben.
Vorgestellt wurden sie sich bloß unter den Namen Smith und Jones. Meine leiblichen Eltern aber waren siebzehnjährige Teenager, beide ausgezeichnete Schüler, die aufs College wollten. Und gezeugt wurde ich angeblich in der Nacht des Abschlussballs.«
Alvirah brach sich ein Stück Krustenbrot ab und tunkte es ins Olivenöl.
»Ich bin keine schlechte Detektivin. Ich werde mir das mal näher ansehen.«
Damit fasste Alvirah zum Revers ihrer Jacke und schaltete das Mikrofon an der Brosche an.
»Ach, Alvirah, mach dir doch nicht die Mühe, das aufzunehmen. Das ist sehr nett von dir, aber doch völlig sinnlos.«
»Das werden wir ja sehen«, erwiderte Alvirah ungerührt. »Delaney, weißt du zufällig, wo in Philadelphia du geboren wurdest? Wie hieß die Hebamme? Wie lautete ihre Adresse? Wer hat deine Eltern mit der Hebamme bekannt gemacht? Hat die Hebamme vielleicht gesagt, wo deine leibliche Mutter gewohnt hat?«
»Meine Adoptivmutter …« Delaney stockte. Es fiel ihr schwer, so über Jennifer Wright zu reden, die sich all die Jahre über so liebevoll um sie gekümmert hatte.
»Vor sechs Jahren«, begann sie von Neuem, »konnte ich ihr entlocken, dass ich in Philadelphia geboren wurde. Das wusste ich natürlich schon von der Geburtsurkunde. Aber die Hebamme hieß Cora Banks, ich habe auch deren damalige Adresse. Meine Adoptivmutter lernte sie durch eine Freundin vom College kennen, durch Victoria Carney, die bei einem Autounfall ums Leben kam, als ich zehn Jahre alt war. Ich bin ihr noch einige Male begegnet, sie war immer sehr nett zu mir. Sie hat nie geheiratet, aber nach ihrem Tod hat ihre Nichte alle ihre Unterlagen entsorgt. Mom war damals so aufgewühlt wegen meiner Fragen, dass ich ihr schließlich sagen musste, sie sei die einzige Mutter, die ich kenne oder jemals kennenlernen möchte.«
»Präsident Theodore Roosevelts Frau«, bemerkte Alvirah, »ist kurz nach der Geburt ihrer Tochter Alice Roosevelt Longworth gestorben. Als Alice zwei Jahre alt war, hat ihr Vater erneut geheiratet, und als sie nach ihrer leiblichen Mutter gefragt wurde, hat sie exakt die gleiche Antwort gegeben.«
Delaney lächelte versonnen. »Ich erinnere mich, das irgendwo gelesen zu haben. Gott sei Dank ist es mir an dem Tag wieder eingefallen. Aber ich war nicht ehrlich. Ich will meine richtige Mutter finden.« Sofort korrigierte sie sich. »Ich meine, meine leibliche Mutter.«
Alvirah griff wieder zu ihrer Brosche und stellte das Mikro ab. »Lass mich erst mal in Ruhe darüber brüten«, sagte sie. »Und außerdem kommt hier ja unsere Pasta.«
In freudiger Erwartung richteten sie die Blicke auf den Kellner, der die dampfenden Teller mit Linguine mit Muschelsoße für Alvirah und Delaney sowie Spaghetti mit Hackfleischbällchen für Willy brachte.
Willy wusste, dass es Zeit war, das Thema zu wechseln. »Delaney, Alvirah hat mir erzählt, dass du vom Betsy-Grant-Prozess berichtest. Wie schätzt du ihre Chancen auf einen Freispruch ein?«
»Gering«, antwortete Delaney. »Es würde mich nicht wundern, wenn man ihr einen Deal anbietet, ein Geständnis gegen ein möglicherweise milderes Strafmaß.«
»Aber würde sie das denn annehmen?«, fragte Willy.
»Auf keinen Fall. Sie sollte es auf den Prozess ankommen lassen. Ich habe das Gefühl, dass über Ted Grants Sohn Alan noch einiges ans Licht kommen wird. Es gibt Gerüchte, er sei ziemlich pleite.«
Delaney überlegte kurz, bevor sie fortfuhr: »Ihr wisst, die erste Frage, die sich nach einem Mord immer stellt, lautet: Wer profitiert von der Tat? Das vorzeitige Ableben seines Vaters hat Alan Grants finanzielle Probleme mit einem Schlag gelöst. Und wenn Betsy, seine Stiefmutter, für schuldig befunden wird, fällt ihr Erbteil natürlich auch an ihn.«
»Das habe ich mir schon gedacht«, sagte Alvirah.
»Und noch etwas«, sagte Delaney. »Robert Maynard galt zu seiner Zeit als erstklassiger Strafverteidiger, aber das ist schon lange passé. Er lebt nur noch von seinem Ruf. Natürlich schafft er es immer noch, hochrangige Angeklagte freizubekommen, und kassiert dafür gewaltige Honorare, aber die Prozessvorbereitung überlässt er den unerfahrenen jungen Anwälten in seiner Kanzlei.«
»Wir werden es ja bald sehen«, sagte Alvirah und versuchte, die Linguine auf ihrer Gabel aufzudrehen, was aber nur darin endete, dass die Nudeln allesamt zurück in den Teller flutschten.
7
Anthony Sharkey, in manchen Kreisen besser bekannt als »Tony der Hai«, betrachtete das Diamant-Smaragd-Armband. Er saß in seiner kleinen Wohnung in Moonachie, New Jersey, die im Keller eines einstöckigen Fachwerkhauses lag, das genau wie seine Wohnung einen sehr heruntergekommenen Eindruck machte.
Der Teppichboden war verdreckt, die Wände hätten dringend einen neuen Anstrich gebraucht, und alles roch nach Schimmel.
Tony war schwerer Alkoholiker und spielsüchtig. Keine Therapie hatte es bislang geschafft, ihn von seiner Trinksucht oder vom Glücksspiel zu kurieren. Manchmal, nach einem Aufenthalt in einer entsprechenden Einrichtung, schaffte er es, ein Jahr trocken zu bleiben, bevor alles wieder von vorn begann. Dann verlor er seine Arbeit, schlug sich mit kurzfristigen Jobs als Tellerwäscher oder Fensterputzer durch, und am Ende war er wieder pleite. Es blieb nur die Obdachlosenunterkunft, was das Schlimmste überhaupt war. Dort wurde er vielleicht wieder nüchtern, konnte irgendeinen lausigen Job ergattern und eine Müllhalde wie diese mieten, aber ihm blieb kaum genug Bares für etwas zu essen.
Üblicherweise behalf er sich dann mit kleineren Diebstählen, nur so vielen, damit er sich über Wasser halten, die Miete zahlen und ein paarmal im Monat nach Atlantic City in die Casinos fahren konnte. Beim Blackjack war er eigentlich immer ganz gut, in letzter Zeit aber hatte er eine richtige Pechsträhne gehabt, und jetzt brauchte er dringend Geld.
Er hatte beim Stehlen ein einzigartiges System entwickelt, mit dem er sich über seine Opfer auch noch lustig machte. Der Safe, den er nicht knacken konnte, musste erst noch erfunden werden, und diese albernen 08/15-Kästen, die die Leute in ihren Schlafzimmerschränken hatten, waren der reine Witz. Aber er räumte die Safes nie ganz aus. Er wusste nämlich, wie die Menschen tickten. Öffnete jemand seinen Safe, und er war leer, wusste er sofort, was passiert war, und rief die Polizei. Aber warf eine von diesen dusseligen Weibern einen Blick in ihren Safe, und es fehlte nur ein Stück, selbst wenn es das wertvollste war, dann suchte sie erst mal die Schuld bei sich selbst und überlegte fieberhaft, wo sie es zum letzten Mal getragen und wo sie es vielleicht abgelegt hatte. Schließlich würde kein Dieb, der noch irgendwie bei Trost war, die vielen anderen kostbaren Sachen einfach so zurücklassen, richtig? Falsch.
Er achtete immer darauf, nichts im Safe durcheinanderzubringen. Wenn er etwas rausnehmen musste, um an das gewünschte Stück zu kommen, legte er nachher alles wieder so zurück, wie es gewesen war. Die meisten Bestohlenen meldeten es der Polizei gar nicht, wenn ihnen ein Diamant-Halsband fehlte oder zwei Ohrringe nicht mehr da waren. Sie hofften, sie hätten die Sachen verlegt und würden sie irgendwann schon wieder finden.
Manche hatten das Glück, dass ihre Versicherung für das »rätselhafte Verschwinden« aufkam. Sie wussten nur nicht, dass er es war, der es auf so rätselhafte Weise hatte verschwinden lassen.
Er war siebenunddreißig Jahre alt, sah aber gut und gern zehn Jahre älter aus. Graue Strähnen zogen sich schon durch seine braunen Haare, an der Stirn lichteten sie sich zusehends. Er ging gebeugt, und seine hellbraunen Augen waren immer trübe, auch wenn er nicht betrunken war.
Erneut zählte er die Smaragde und Diamanten des Armbands. Ein Hehler hatte ihm dreißigtausend Dollar dafür geboten. Natürlich war es wesentlich mehr wert, aber dreißigtausend waren beileibe nicht zu verachten. Er hatte dem Hehler gesagt, er müsse es sich noch überlegen. Irgendetwas warnte ihn davor, das Stück zu behalten. Die Initialen auf der Schließe machten es nicht unbedingt besser. »BG und TG.« Wie rührend, dachte Tony.
Wäre es die Sache wert, wenn er mit Betsy Grant Kontakt aufnahm und ihr erzählte, was er über die Nacht wusste, in der ihr Mann ermordet wurde – jetzt, da die Gerichtsverhandlung anstand?
Das Problem war nur: Wenn er das Armband vorlegte, müsste er erklären, wie er dazu gekommen war, und dann würde er todsicher im Gefängnis landen.
8
Robert Maynards Kanzlei erstreckte sich über drei Stockwerke in dem funkelnden Turm, dem neuesten und teuersten Gebäude in der Avenue of the Americas.
Als sich abzeichnete, dass die Staatsanwaltschaft Betsy als Verdächtige im Mordfall an ihrem Mann ansah, hatte sie ihren Vermögensverwalter Frank Bruno gebeten, ihr einen Verteidiger zu empfehlen. Erst später sollte sie erfahren, dass Bruno zu diesem Zeitpunkt bereits von ihrer Schuld überzeugt war. Daher hatte er sie mit dem fünfundsiebzigjährigen Maynard bekannt gemacht, dem der Ruf vorauseilte, der beste Strafverteidiger des Landes zu sein. Und einer der teuersten.
Betsy verließ im achtundfünfzigsten Stock den Fahrstuhl. Eine Rezeptionistin mit Perlenkette und schwarzem Kostüm begrüßte sie lächelnd. »Guten Tag, Mrs. Grant. Mr. Maynards Assistent wird Sie umgehend in den Besprechungsraum führen.«
Mr. Maynards Assistent war, wie Betsy wusste, ein junger Anwalt, dessen Honorar achthundert Dollar die Stunde betrug. Im Besprechungszimmer würde noch ein zweiter Assistent anwesend sein, und erst wenn sie selbst Platz genommen hatte, würde Robert Maynard sie mit seiner Anwesenheit beehren.
Diesmal ließ er sie zehn Minuten warten. Während dieser Zeit versuchte sich der junge Anwalt, der sie hereingeführt hatte, im Small Talk. Wie hieß er noch gleich? … Ach ja, Carl Canon.
»Wie war die Fahrt von New Jersey?«
»Wie üblich. Außerhalb der Stoßzeiten kommt man meistens ganz gut voran.«
»Ich komme aus North Dakota und habe an der New York University Jura studiert. Sobald die Maschine auf dem Kennedy-Airport gelandet war, wusste ich, dass ich hier zu Hause bin.«
»In North Dakota kann es im Winter ziemlich kalt werden, oder?« Weitere sinnlose Konversation.
»North Dakota hat sich mal überlegt, wie es mehr Touristen anlocken könnte, und jemand kam auf die glorreiche Idee, den Staat in North Florida umzubenennen.«
Er ist ein ganz netter junger Mann, dachte Betsy, auch wenn er mich achthundert Dollar die Stunde kostet und die Uhr unweigerlich vor sich hin tickt, während wir über das Wetter plaudern.
Sie drehte sich um, als die Tür aufging und Robert Maynard, begleitet von seinem anderen persönlichen Assistenten, Singh Patel, das Konferenzzimmer betrat.
Wie immer war Maynard makellos gekleidet. Diesmal trug er einen grauen Anzug mit zarten Nadelstreifen; sein weißes Hemd, die Manschettenknöpfe, die dezente dunkelblaue Krawatte vermittelten den Eindruck ehrwürdigen Erfolgs. Die randlose Brille betonte seine kalten grauen Augen. Wie immer lag in seiner Miene etwas Mürrisches, als trage er eine schwere Last auf seinen Schultern.
»Betsy«, begann er, »es tut mir schrecklich leid, dass ich Sie habe warten lassen. Nun, es steht eine wichtige Entscheidung an, die ich Ihnen leider nicht ersparen kann.«
Vor Schreck verschlug es Betsy die Sprache. Welche Entscheidung?, fragte sie sich entsetzt.
Maynard kam ihr auch nicht zu Hilfe. »Sie kennen Singh Patel?«
Betsy nickte.
Maynard setzte sich. Patel legte einen Ordner vor sich auf den Tisch und nahm ebenfalls Platz. Maynard sah zu Betsy.
»Wir haben bereits mehrmals darüber geredet«, fuhr er mit ernster Stimme fort, »trotzdem müssen wir diesen Punkt jetzt, so kurz vor dem Prozess, noch einmal ansprechen. Sie haben immer darauf beharrt, sich der Anklage zu stellen, aber bitte hören Sie sich an, was ich Ihnen zu sagen habe. Die Beweislast gegen Sie ist, nun ja, erdrückend. Sicherlich werden die Geschworenen Verständnis und Mitgefühl für Sie aufbringen, nach allem, was Sie ertragen mussten, unter anderem, dass Ihr Ehemann Sie am Abend vor seinem Tod beschimpft und tätlich angegriffen hat. Aber es lässt sich nicht bestreiten, dass sechs Gäste gehört haben, wie Sie sagten, dass Sie das alles nicht mehr ertragen können. Diese Leute werden für die Staatsanwaltschaft aussagen.«
»Er hat mich geschlagen, weil er Alzheimer hatte«, protestierte Betsy. »Das ist nicht oft passiert. Er hatte einen schlechten Tag.«
»Aber Sie haben gesagt, ›ich ertrage es nicht mehr‹, oder?«
»Ich war doch ganz durcheinander. Ted ging es an dem Tag zunächst vergleichsweise gut. Deshalb habe ich gedacht, es würde ihn freuen, wenn er die alten Freunde aus der Praxis wiedersehen würde. Aber es hat ihn nur wütend gemacht.«