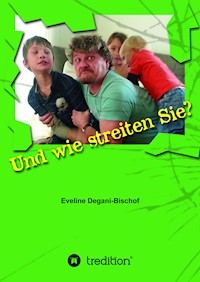
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Viele Menschen assoziieren mit Streit negative Erfahrungen. Doch wer sich dem Streit stellt, entdeckt neue Lösungsmöglichkeiten. Konstruktives Streiten belebt, baut Spannungen ab, hilft, zum Wesentlichen zu gelangen und kann so die Beziehung vertiefen. Eveline Degani-Bischof arbeitet als Konfliktpädagogin und Mediatorin. Sie ist Mutter von vier Kindern und leitet mit ihrem Mann Kommunikationstrainings und Streitseminare. In ihrem Buch "Und wie streiten Sie?" erzählt sie anhand zahlreicher Beispiele, wie Konflikte konstruktiv gelöst werden können. Dabei stellt sie hilfreiche Konfliktlösungsmodelle vor, die den Alltag erleichtern. So kann aus einer Vielfalt erfolgreicher Methoden, die mit Alltagsbeispielen illustriert sind, der eigene Streitstil entwickelt werden. Im Zentrum steht der Gedanke, durch das Streiten neue Möglichkeiten zu entdecken. Dafür ist es wichtig, die Erfahrungen als wertneutral zu begreifen und Lösungen zu kreieren, die für alle Beteiligten stimmig sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Und wie streiten Sie?
Über die Autorin
Die Konfliktpädagogin Eveline Degani lebt mit ihrem Mann und den gemeinsamen vier Kindern im St. Galler Rheintal in der Schweiz. Sie ist Mediatorin sowie Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation. Seit 2009 leitet sie die Beratungsstelle konfliktbewältigung.ch
Gemeinsam mit ihrem Mann Remo bietet sie Streitseminare, Kommunikationstrainings und Coachings an.
Urlaub und Lernzeit zugleich
Für Familien, die sich in der Gewaltfreien Kommunikation weiterbilden möchten, organisiert sie zusammen mit einem Trainerteam ein siebentägiges Familienseminar. Infos sind zu finden auf www.familycamp.ch
Kontakt
Mehr über die Arbeit von Eveline Degani sowie die aktuellen Kursangebote erfahren Sie auf der Homepage der Beratungsstelle www.konfliktbewältigung.ch
konfliktbewältigung.ch Beratungsstelle
Heimstrasse 9 CH – 9444 Diepoldsau +41 (0) 71 599 51 70
www.konfliktbewältigung.chinfo@konfliktbewältigung.ch
Eveline Degani-Bischof
Und wie streiten Sie?
Warum Streiten wichtig ist und wie es konstruktiv wird
Mit einem Vorwort
© 2014 Eveline Degani-Bischof
Umschlaggestaltung, Illustration: Stephanie Karcher, Sylvan Oehen
Lektorat, Korrektorat: Kristina Gnirke, Andrea Wierich, Johannes Ponader
Layout: Johannes Ponader, Christiane Schinkel
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-8495-7708-7
Dieses Werk ist unter der Creative-Commons-Lizenz vom Typ Namensnennung – Nicht-kommerziell – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported lizenziert. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, besuchen Sie http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Buch widme ich meinem Mann Remo sowie meinen Kindern
Inhalt
1. Was ist das überhaupt – ein Konflikt?
2. Warum Streiten für Kinder wichtig ist
Was nützen Streit und Konfliktlösung?
3. Verschiedene Arten von Konfliktverhalten
4. Verschiedene Streittypen
Streittypentest
Auswertung
5. Umgang mit Emotionen
Warum Wut gut tut
Dampf ablassen, statt Gefühle zu unterdrücken
Wie lernen Kinder mit heftigen Gefühlen umzugehen?
Weinen ist okay
Fluchen macht Spaß
Gefühle die wir haben
6. Wie man Bedürfnisse erkennen kann
Frustrationstoleranz entwickeln
Unterschiedliche Bedürfnisse erkennen
Eifersucht als Wegweiser
Zum Teilen verdonnert
7. Grenzen zeigen, um Bedürfnisse zu schützen
8. Hilfreiche Gesprächsmethoden
Schmerzen wollen gehört werden
Verneinungen vermeiden
Vorwurfsfreie Formulierungen
Umgang mit Erwartungen in der Partnerschaft
9. Konfliktlösungsmodelle
Vermittlung bei Kindern
Das Konfliktgespräch
4-Schritt-Modell
In der Streitarena
10. Ideen für den Alltag
Rituale
Signale und Codes
Umgang mit Gewalt
Organisation und Erholung
Systemisches Konsensieren – die neue Familiendemokratie
11. Wie Streit erträglich wird
Streitphasen
Papas entscheiden anders
Über die Versöhnung
12. Was macht Erziehung erfolgreich?
Selbstverantwortung erlernen
Fragen und Antworten
Vorwort
Meine Eltern haben nie gestritten. Sie haben diskutiert. Als Kind stand ich dann nachts im Treppenhaus und habe zitternd der Diskussion gelauscht. Die Diskussion wurde rein sachlich geführt – so wurde mir gesagt, dennoch hatte ich Angst. Ich spürte Emotionen, aber die gab’s doch gar nicht.
Harmonie war wichtig. Harmonie hieß: keinen Streit haben. Abends, wenn es ins Bett ging, musste alles immer „gut“ sein. Wir haben uns alle wieder vertragen. Oft habe ich dann vergessen, worum wir gestritten haben. Oft habe ich vergessen, worum es mir eigentlich ging. War ja auch egal. Hauptsache, allen ging es gut.
Später habe ich Menschen kennengelernt, denen Harmonie nicht so wichtig war. Lehrer, Chefs, Nachbarn. Auch sie haben auf der Sachebene diskutiert. Aber es war anscheinend nicht so wichtig, ob es allen gut ging. Mein Eindruck war, dass es vor allem ihnen gut gehen sollte. Damals habe ich gelernt gegenzusteuern. Ich wollte, dass es mir gut geht. Ich habe viel diskutiert.
In meiner jetzigen Familie lerne ich, wie wichtig Harmonie ist. Aber ich definiere sie anders. Harmonie bedeutet nicht die Abwesenheit von Streit – so wie Frieden nicht die Abwesenheit von Krieg bedeutet, sondern die Bereitschaft sich mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Strategien, Wünschen, Meinungen auseinanderzusetzen. Harmonie bedeutet die Vereinigung von Entgegengesetztem zu einem Ganzen. Dazu braucht es Gegensätze, die vertreten sein wollen. Es braucht den Austausch. Und, wenn die eigenen Interessen wichtig genommen werden, auch Energie, mit der sie vertreten werden. Energie in Form von Emotionen. Wir streiten nicht gegeneinander. Ich streite für mich. Du für dich. Wir für uns.
Wenn wir wollen, dass Kinder lernen zu sprechen, brauchen sie Ansprache. Wenn sie Verständnis erlernen sollen, brauchen sie verständliche Äußerungen. Um Empathie oder Einfühlung zu erfahren, brauchen sie Gefühle zum Fühlen, und um konfliktfähig zu werden, brauchen sie Konflikte. Sie werden sie bekommen. Irgendwo, irgendwie.
Mit diesem Buch können Sie als Eltern lernen, wie Sie mit Ihren Kindern in einer Weise streiten können, die Ihren Werten entspricht. Ihre Kinder werden davon profitieren. Und Sie auch. Spätestens, wenn es in der Pubertät Zeit ist zu ernten.
Frank Gaschler
Einführung
Was heißt „gutes Streiten“?
Viele von uns sind mit der Vorstellung aufgewachsen, dass Streiten nicht gut ist. Weil Streitsituationen oftmals unangenehme Gefühle hinterlassen, ist diese Schlussfolgerung nur logisch. Lärm, Tränen, Gefühlsausbrüche, heftige Diskussionen sind Faktoren, die ein konstruktives Streiten nicht unbedingt begünstigen. Oft stehen nach einem Streit Gewinner und Verlierer da. Jemand hat den Kürzeren gezogen, jemand muss der oder die Vernünftigere sein.
Aus meiner Sicht gehört Streiten zum Leben dazu. Genauso wie es auch in Ordnung ist, wenn wir „negative“ Gefühle haben. Auch sie sind ein Teil von uns.
Folglich wollen wir unseren Kindern eine gute Streitkultur beibringen. Das ist aber nicht so einfach, wenn wir selbst nicht gelernt haben, was es bedeutet konstruktiv zu streiten. Um diese Frage beantworten zu können, braucht es eine Vorstellung davon, was für Sie persönlich „gutes Streiten“ bedeutet.
Ich möchte in diesem Buch verschiedene Streitmöglichkeiten und Konfliktlösungsmodelle aufzeigen, denn es gibt verschiedene Arten zu streiten. Ein Streit kann laut oder leise sein, emotional oder ruhig. Welche Art für Sie stimmig ist, bestimmen Sie. Ich lade Sie ein, verschiedene Ideen auszuprobieren und so herauszufinden, welchen Weg Sie beschreiten möchten. Ich hoffe, dass Sie mit diesem Buch Klarheit für sich finden.
1. Was ist das überhaupt – ein Konflikt?
„Ich will auf der Ente sitzen, ich habe es zuerst gewollt!“, ruft der Junge auf dem Spielplatz, als ein Kind auf die Schaukelente zusteuert.
Was ist ein Konflikt?
Einen Konflikt habe ich dann, wenn ich etwas will, das ich (gerade) nicht bekommen kann.
„Nein! Ich habe sie zuerst gesehen. Du musst warten, jetzt bin ich dran!“, setzt sich der Freund zur Wehr.
Was ist Streit?
Einen Streit haben heißt, dass ich mich für mein vermeintliches Recht einsetze und sich das Gegenüber auf irgendeine Weise dagegen wehrt.
Zum Streiten braucht es also mindestens zwei. Wenn sich das Gegenüber nicht auf mich einlässt, spreche ich von einem Konflikt, nicht von einem Streit. In der Umgangssprache spricht man von einem Streit, wenn ein Konflikt zwischen zwei Parteien nicht gelöst ist.
Was ist eine Lösung?
Um einen Streit oder Konflikt lösen zu können, braucht es die Bereitschaft der betroffenen Parteien. Wenn eine Seite nicht will, ist es nicht möglich, den Konflikt gemeinsam zu lösen. Dann bleibt es ein Konflikt oder umgangssprachlich ein ungelöster Streit. Mir bleibt die Möglichkeit, den Konflikt für mich selbstverantwortlich zu bearbeiten und wenn möglich nach einer für mich stimmigen und fairen Lösung zu schauen. Wenn ich möchte kann ich mir dafür Hilfe holen. Manchmal bleiben Konflikte ungelöst. Auch das gehört zum Leben.
Was ist Versöhnung?
Eine Lösung findet dann statt, wenn die beteiligten Parteien dem Resultat zugestimmt haben. Eine Versöhnung unterscheidet sich von der Lösung durch die Wiederherstellung der Beziehungsqualität nach dem Streit. Nur wenn das gelingt und die Beziehung nach der Konfliktlösung wiederhergestellt ist, spreche ich von Versöhnung. Die Versöhnung ist also dann wichtig, wenn die Beziehung zwischen den Beteiligten nach dem Streit wieder stimmig sein soll.
Ein Streit ist erst mit der Lösung oder der Versöhnung beendet.
2. Warum Streiten für Kinder wichtig ist
Ein typischer Streit unter Kindern
Eine Horde Kinder spielt draußen. Plötzlich entsteht ein Gerangel. Der 11-jährige Sandro packt den drei Jahre jüngeren Armin und drückt ihn gegen die Wand. Armin wehrt sich verzweifelt und versucht vergeblich Sandro wegzustoßen.
Ein Mann, der draußen gerade Gartenarbeit verrichtet, wird auf das Gerangel aufmerksam. Er ruft: „He, was ist los?“ Sandro lässt Armin frei. Armin weint. Der Mann geht hin und fragt freundlich: „Was ist passiert?“ Die Buben beginnen gleichzeitig zu rufen: „Er stört uns immer!“ — „Sie lassen mich nie mitspielen.“ — „Er hat uns den Ball weggenommen und fortgeworfen. Er soll uns endlich in Ruhe lassen.“ — „Ich habe den Ball weggenommen, weil sie mich geärgert haben.“
Die Mutter des jüngeren Kindes eilt herbei: „Ich glaube dir, Armin! Komm doch nach Hause.“ Aber Armin will nicht nach Hause gehen. Schluchzend bleibt er stehen. Der Mann ergreift das Wort und wiederholt, was er von den Kindern gehört hat: „Armin, bist du traurig, weil du gerne mitspielen und dazugehören möchtest?“ Armin nickt. „Sandro, bist du verärgert, weil du mit deinem Freund in Ruhe gelassen werden möchtest?“ Sandro nickt ebenfalls. „Hm, was gibt es denn da für Möglichkeiten, dass alle wieder zufrieden sein können?“ Schweigen. Ein kleines Mädchen hat eine Idee: „Sie könnten sich die Hand geben und Frieden schließen.“ Der Mann leitet den Vorschlag an die Jungen weiter und fragt: „Wollt ihr das tun?“
Die Mutter sagt: „Es hat ja doch keinen Sinn, er ist halt einfach jünger. Ich habe schon oft beobachtet, dass sie ihn necken und davonrennen, aber bisher habe ich mich immer rausgehalten.“ Sie wendet sich den Großen zu: „Warum könnt ihr denn nicht alle zusammen spielen?“ — „Wir möchten halt alleine sein.“ — „Könnt ihr den Armin wenigstens in Ruhe lassen?“ — „Ja, wenn er uns in Ruhe lässt!“
Der Mann wiederholt: „Wollt ihr euch gegenseitig in Ruhe lassen?“ Die großen Jungs nicken. „Also Armin, dann komm jetzt nach Hause.“ Die Mutter nimmt ihn beschützend an der Hand und geht mit ihm nach Hause.
Kaum sind Mutter und Sohn um die Ecke, ärgert sich Sandro: „Immer glaubt sie dem Armin. Sie hat uns nicht einmal zugehört. Der Armin ist bei ihr immer ein Heiliger! Er soll bloß nicht zu uns kommen!“
Der Mann wendet sich nochmals Sandro zu: „Ist dir wichtig, dass beide Seiten neutral gehört werden?“ — „Ja, er ist ja auch kein Heiliger!“ — „Möchtest du gerne die Bereitschaft zur eigenen Fehlbarkeit spüren?“ — „Was heißt das?“ — „Dass man zugeben kann, dass das eigene Verhalten möglicherweise nicht immer ganz okay war. Und dass man bereit ist, zu überlegen, was man hätte anders machen können.“ — „Ja, es war vielleicht nicht fair, dass ich auf ihn losgegangen bin. Aber wenn er uns in Ruhe gelassen hätte, hätte ich das ja auch nicht gemacht.“ — „Du meinst, es sind beide Seiten verantwortlich für das, was passiert ist?“ — „Ja. Aber sie glaubt ja nur ihm.“ — „Möchtest du, dass deine Seite auch gehört wird?“ — „Ja.“ — „Hast du eine Vermutung, warum die Mutter so reagiert hat?“ — „Sie sorgt sich halt und möchte dass es Armin gut geht.“
Der Weg zur Versöhnung
„Hm. Hast du denn eine Idee, wie du das machen kannst, dass du dich gehört fühlst?“ – „Nächstes Mal sage ich es ihr!“ – „Du möchtest sie bitten, beide Seiten anzuhören, wenn es wieder einmal so eine Situation gibt?“ — „Ja, genau.“ — „Möchtest du dafür Unterstützung?“ — „Ne, das passt schon … Danke!“
Übung: Welche Interventionen empfinden Sie als störend und warum?
Soweit unser Beispiel. Ich möchte Sie zu folgender Übung einladen: Machen Sie sich selbst ein Bild, welche Sätze Sie in obigem Beispiel hilfreich finden und welche man Ihrer Meinung nach eher vermeiden sollte. Falls Sie dies sichtbar machen möchten, können Sie die für Sie hilfreichen Sätze markieren, und die, die Sie nicht hilfreich finden, mit einem Bleistift durchstreichen.
Auflösung der Übung
Haben Sie sich ein eigenes Bild gemacht? Gerne möchte ich Ihnen nun zeigen, welche der ausgesprochenen Sätze meiner Erfahrung nach hilfreich sind und welche Sätze eher schwierig aufgenommen werden.
Sehen wir uns das Beispiel Abschnitt für Abschnitt an:
Armin weint. Der Mann geht hin und fragt freundlich:„Was ist passiert?“
Mit der offenen Frage öffnet der Mann einen Raum, um einen echten Dialog zu ermöglichen.
Die Buben beginnen gleichzeitig zu rufen: „Er stört uns immer!“ — „Sie lassen mich nie mitspielen.“ — „Er hat uns den Ball weggenommen und fortgeworfen. Er soll uns endlich in Ruhe lassen.“ — „Ich habe den Ball weggenommen, weil sie mich geärgert haben.“ Die Mutter des jüngeren Kindes eilt herbei:„Ich glaube dir, Armin! Komm doch nach Hause.“
Hier wird die Lösungssuche von der Mutter unterbrochen. Vielleicht fällt es ihr schwer, an die Möglichkeit einer Lösung zu glauben – vielleicht kennt sie keine Alternativen oder reagiert so aus Gewohnheit. Nützlich ist es jedoch, wenn man daran glauben kann, dass stimmige Lösungen möglich sind.
Mit der Aussage „Ich glaube dir“ will die Mutter dem Kind vermutlich den Rücken stärken. Dieser Satz stößt bei Sandro jedoch auf großen Widerstand. Die schnelle Parteinahme der Mutter ist ungünstig, weil damit die Gefahr besteht, den Konflikt auf ein „Wer hat Recht und wer hat Unrecht?“ zu reduzieren. In einer konstruktiven Streitkultur ist dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht hilfreich, es führt zu mehr Unruhe statt zu Verständnis und Frieden.
Der Satz „Komm doch nach Hause“ stellt ein Fluchtverhalten dar. Manchmal ist es sinnvoll, einen Konflikt einfach zu verlassen. In dieser Geschichte wäre diese Reaktion jedoch bedauernswert, weil die Voraussetzung für eine konstruktive Konfliktlösung durch die Intervention des Mannes gegeben ist.
Aber Armin will nicht nach Hause gehen. Schluchzend bleibt er stehen. Der Mann ergreift das Wort und wiederholt, was er von den Kindern gehört hat:„Armin, bist du traurig, weil du gerne mitspielen und dazugehören möchtest?“Armin nickt.„Sandro, bist du verärgert, weil du mit deinem Freund alleine spielen möchtest?“Sandro nickt ebenfalls.„Hm, was gibt es denn da für Möglichkeiten, dass alle wieder zufrieden sein können?“
Gefühle formulieren
Der Erwachsene bietet den Kindern eine Deutung für ihre Gefühle an. Er hilft damit den Kindern, ihre Gefühle in Worte zu fassen. Mit einer erneuten offenen Frage öffnet der Erwachsene dann den Raum für eine gute Lösung.
Schweigen. Ein kleines Mädchen hat eine Idee: „Sie könnten sich die Hand geben und Frieden schließen.“ Der Mann leitet den Vorschlag an die Jungs weiter und fragt:„Wollt ihr das tun?“
Anstatt eine fertige Lösung als beschlossen zu präsentieren, stellt der Erwachsene auch hier wieder eine Frage, die mehrere Möglichkeiten offen lässt.
Die Mutter sagt: „Es hat ja doch keinen Sinn, er ist halt einfach jünger. Ich habe schon oft beobachtet, dass sie ihn necken und davonrennen, aber bisher habe ich mich immer rausgehalten.“ Sie wendet sich den Großen zu: „Warum könnt ihr denn nicht alle zusammen spielen?“ — „Wir möchten halt alleine sein.“ — „Könnt ihr den Armin wenigstens in Ruhe lassen?“ — „Ja, wenn er uns in Ruhe lässt!“
Die Mutter resigniert und verengt damit den Raum für eine für alle akzeptable Lösung. Ihre Fragen kommen bei den Kindern als Vorwurf an. Auch das Wort „wenigstens“ wirkt wie eine Schuldzuweisung. Es ist hilfreich, solche Wörter wegzulassen. Die Mutter könnte abwarten, was die Jungen zu dem Lösungsvorschlag sagen und, wenn nötig, ihr Anliegen wie folgt einbringen:
„Als ich gestern beobachtet habe, wie ihr Armin geneckt habt und dann davongerannt seid, war ich sehr besorgt, weil ich mir für Armin wünsche, dass er auch mitspielen kann. Wärt ihr bereit ihn mitspielen zu lassen?“
Der Mann wiederholt: „Wollt ihr euch gegenseitig in Ruhe lassen?“ Die großen Jungs nicken. „Also Armin, dann komm jetzt nach Hause.“ Die Mutter nimmt ihn beschützend an der Hand und geht mit ihm nach Hause.
Kaum sind Mutter und Sohn um die Ecke, ärgert sich Sandro: „Immer glaubt sie dem Armin. Sie hat uns nicht einmal zugehört. Der Armin ist immer der Heilige! Er soll bloß nicht zu uns kommen!“
Lösung oder Versöhnung?
Dass sich Sandro weiterhin ärgert, deutet darauf hin, dass der Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Es wurde zwar eine Lösung erreicht, aber noch keine Versöhnung. Der Mann wendet sich darum nochmals Sandro zu:
„Ist dir wichtig, dass beide Seiten neutral gehört werden?“— „Ja, er ist ja nicht heilig!“ — „Möchtest du gerne die Bereitschaft zur eigenen Fehlbarkeit spüren?“ — „Was heißt das?“ — „Dass man zugeben kann, dass das eigene Verhalten möglicherweise nicht immer ganz okay war. Und dass man bereit ist zu überlegen, was man hätte anders machen können.“ — „Ja, es war vielleicht nicht fair, dass ich auf ihn losging. Aber wenn er uns in Ruhe gelassen hätte, hätte ich das ja auch nicht gemacht.“ — „Du meinst es sind beide Seiten verantwortlich für das was passiert ist?“ — „Ja. Aber sie glaubt ja nur ihm.“ — „Möchtest du, dass deine Seite auch ernstgenommen wird?“ — „Ja.“ — „Hast du eine Vermutung, warum die Mutter so reagiert hat?“ — „Sie sorgt sich halt und möchte dass es Armin gut geht.“ —„Hm. Hast du denn eine Idee, wie du das machen kannst, dass du dich gehört fühlst?“ — „Nächstes Mal sage ich es ihr!“ — „Du möchtest sie bitten, beide Seiten anzuhören, wenn es wieder einmal so eine Situation gibt?“ — „Ja, genau.“ — „Möchtest du dafür Unterstützung?“ — „Ne, reicht schon. … Danke!“
Als die Kinder drei Tage später wieder gemeinsam auf der Straße spielen, ist Armin mittendrin. „Ist zwischen euch wieder alles gut?“, fragt der Mann die Gruppe. Armin strahlt ihn an: „Ja, der Sandro hat mich gefragt, ob ich mitspielen will.“
Konfliktbearbeitung lohnt sich
Sich die Mühe für die Konfliktbearbeitung zu nehmen lohnt sich, auch wenn man denkt, dass nicht alle Interventionen gleich tadellos über die Bühne gehen. Die Kinder verstehen worum es geht, sie lernen daraus und zeigen ihre Bereitschaft einander das Leben zu bereichern, wenn sie sich in ihrem Anliegen gehört fühlen. Dabei können sie ihr Streitverhalten reflektieren und weiterentwickeln.
Wenn ich an einen erfolgreichen Geschäftsmann denke oder an eine erfahrene Unternehmerin oder einfach an einen Menschen, der gut im Leben steht, so behaupte ich, dass diese Menschen unter anderem gerade durch diesen Glauben an eine mögliche Lösung in Konflikten so erfolgreich sind. Wer im Leben erfolgreich sein will, dem hilft es, wenn er sich gut ausdrücken kann, für seine Meinung einsteht, in schwierigen Situationen Lösungen finden kann und auch die nötige Sozialkompetenz besitzt, um andere zu verstehen. Diese Fähigkeiten können Kinder beim Streiten wunderbar entwickeln.
Wie bei den meisten Trainings ist es von Vorteil, wenn ein kompetenter Trainer die Leitung übernimmt. In einem Streit übernimmt diese Rolle der Vermittler – jemand, der neutral zuhört und wertfrei Unterstützung bietet, ohne dabei zu richten.
In unserer Geschichte hat der Mann die Vermittlung übernommen. Der Mutter fiel es sehr schwer, sich neutral zu verhalten, weil ihr Mutterinstinkt, das Kind zu beschützen, so groß war. Das geschieht häufig. Ich empfehle den Eltern, diesen Instinkt bewusst wahrzunehmen, wertzuschätzen und im Hinterkopf zu behalten. Mit der Zeit wird es leichter, neutrale Worte zu benutzen, auch wenn der Schutzinstinkt bleibt.
Was nützen Streit und Konfliktlösung?
In einem Streit lernen Kinder:
▶Für sich und ihre Bedürfnisse einstehen
▶Dass Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben
▶Gefühle ausdrücken
▶Sich ernst nehmen
Entdeckte Bedürfnisse aus dem Beispiel
In unserem Beispiel entdeckt Armin, dass er mitspielen und dazugehören möchte (Bedürfnis nach Gemeinschaft und Zugehörigkeit). Sandro will in Ruhe spielen können und selber wählen, mit wem er spielt (Bedürfnis nach Autonomie), und er möchte gerne von der Mutter neutral gehört werden (Bedürfnis nach Fairness). Die Mutter schließlich möchte ihrem Kind den Rücken stärken (Bedürfnis nach Schutz für das Kind).
Gefühle ausdrücken
Die Kinder zeigen verschiedene Gefühle: Armin ist traurig, Sandro ärgert sich. Die Mutter drückt Sorge und Resignation aus.
Sich gegenseitig ernst nehmen
Dass die Kinder ernst genommen werden, zeigt sich, indem sich die Beteiligten Zeit nehmen für den Austausch: „Was ist passiert, was braucht ihr?“. Dabei hilft die Haltung: „Ich bin okay, du bist okay, die Gefühle sind okay, niemand wird verurteilt.“
Bei der Konfliktlösung lernen Kinder:
▶Konstruktiv und lösungsorientiert bleiben
▶Einander zuhören
▶Die Gefühle und Bedürfnisse des andern hören
▶Lösungen suchen
▶Schwierigkeiten überwinden
▶Mitgefühl entwickeln
Im Beispiel
In unserem Beispiel wurden die Beteiligten mit Hilfe des Mannes konstruktiv und lösungsorientiert geführt: Beide Seiten wurden gehört, Ideen wurden eingebracht, es wurde Frieden geschlossen, und einander anschließend in Ruhe gelassen.
Dass es gelungen ist, Schwierigkeiten zu überwinden, wird oft erst im Nachhinein klar, wenn der Konflikt abgeschlossen ist.
Durch das Wiederholen der Positionen und Aussagen hat der Mann die verschiedenen Perspektiven aufgezeigt. Mitgefühl passiert im Innen und ist daher nicht einfach zu messen. Ob sich etwas verändert hat, zeigt sich manchmal erst in der Nachgeschichte. In diesem Beispiel war das der Fall, als drei Tage später wieder alle Kinder miteinander fröhlich auf der Straße spielen konnten.
3. Verschiedene Arten von Konfliktverhalten
In unserer Entwicklung, unserem Wachsen und Lernen, eignen wir uns verschiedene Verhaltensweisen an, wie wir Konflikten begegnen: Flucht, Kampf, Kompromiss und Konsens.
Aus meiner Sicht ist es wichtig zu wissen, dass jede dieser Verhaltensweisen sinnvoll sein kann. Wenn ich mir meiner Verhaltensweisen bewusst werde, gelingt es mir allmählich immer besser, mich im Konfliktfall für ein für mich passendes Verhalten zu entscheiden.
Flucht
Die erste Form des Konfliktverhaltens lässt sich beim Baby wunderbar beobachten, wenn es den Schutz der Mutter oder des Vaters sucht, sobald es Unbekanntem begegnet. Manche Babys „fremdeln“ eine Zeitlang. Größere Kleinkinder verstecken sich oft hinter Mamas oder Papas Beinen. Es ist ganz natürlich, dass sie dann dorthin wollen, wo sie sich wohl und sicher fühlen. Dieses Abwenden oder Verstecken ordne ich dem Fluchtverhalten zu.
Flucht bedeutet: Nur weg von hier. Schnell an einen Ort wo ich sicher bin und wo es ruhig ist. Diese Strategie kann sinnvoll sein (Flucht vor dem Krieg, um Leben zu schützen), manchmal vertun wir uns mit der Flucht aber auch die Chance, Dinge zu klären. Im Beispiel im letzten Kapitel wird ein Fluchtverhalten bei der Mutter erkennbar, als sie sagt: „Komm, wir gehen nach Hause.“
Kampf
Die Kampfbereitschaft beginnt unterschiedlich früh. Unser damals einjähriger Sohn hat zuerst gelernt, den Kopf zu schütteln und nein zu sagen, bevor er überhaupt ja sagen konnte. Mit dem „Nein“ drückt er seine Selbstbestimmung aus. Er zeigt Widerstand und will selbst entscheiden. Mit dem „Nein“ wehrt er sich gegen Fremdbestimmung und setzt dabei ein Zeichen: „Stopp, das will ich nicht“. Diesen Widerstand ordne ich dem Kampfverhalten zu. Nach meiner Erfahrung ist das eine ganz natürliche und gesunde Entwicklung des Kindes. Auch während der Sandkastenzeit erkenne ich in vielen Situationen das Kampfverhalten, zum Beispiel wenn ein Kind sein Spielzeug verteidigt. Die Kleinen beginnen sich zu wehren, das eine oder andere Kind wird dabei auch handgreiflich. Ein Kampf muss aber nicht unbedingt mit Körpereinsatz ausgetragen werden. Viele Kämpfe werden mit Worten ausgefochten, wenn Interessen verteidigt werden.
In der Geschichte im ersten Kapitel haben die Kinder körperlich gekämpft. Sandro hat Armin an die Wand gedrückt. Armin versuchte sich zu wehren. Zu Handgreiflichkeiten kommt es oft dann, wenn man mit Worten nicht weiterzukommen scheint.
Mit Hilfe des Vermittlers konnten die beiden Jungen wieder zur Sprache finden und ihre Bedürfnisse formulieren. Körperkontakt ist an und für sich nichts Schlechtes, wichtig ist dabei, dass Regeln eingehalten werden.
Kompromiss
Beim Kompromiss, so wie ich ihn verstehe, können verschiedene Verhaltensweisen eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Nachgeben, Zustimmen, Anpassen, Zugeständnisse machen, Kooperieren. Im Schweizerdeutschen gibt es einen Spruch, der das ganz wunderbar beschreibt: „De Gschiider git no, de Esel blibt stoh.“ Zu deutsch: „Der Klügere gibt nach, der Esel bleibt stehen.“
Kompromisse kommen zustande, wenn keine Einigung möglich scheint oder wenn es der einen Partei zu dumm wird, sodass sie nachgibt. Bei unseren Kindern kommt das manchmal auch vor, dann sagt schließlich jemand: „Also gut, dann nimmst du es eben…“
Im Beispiel besteht der Kompromiss in der Lösung „Wir lassen uns gegenseitig in Ruhe“. Der sehnliche Wunsch von Armin, mitspielen zu dürfen, bleibt auf der Strecke.
Konsens





























