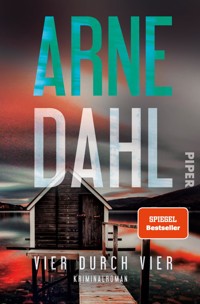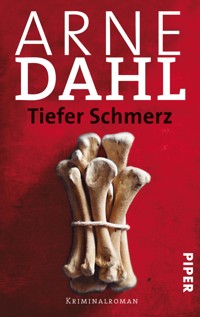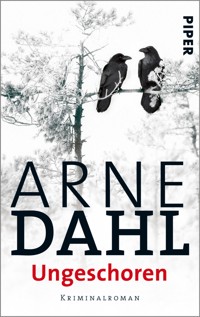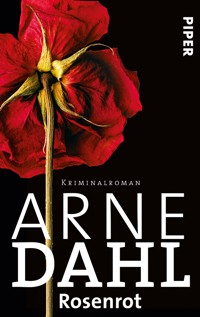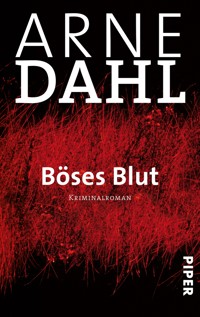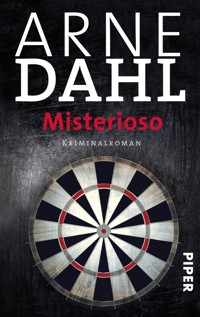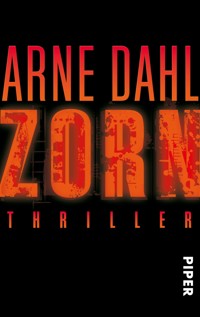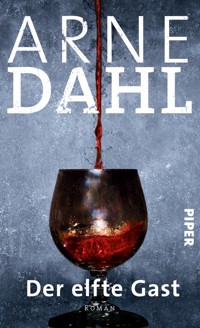8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Hitze des Sommers lähmt ganz Europa. Und während das Opcop-Team die Hintermänner eines internationalen Menschenhandelsrings observiert, begegnet Paul Hjelm bei einem Galadiner der attraktiven Französin Marianne Baillard. Sie bittet ihn um Hilfe in einem blutigen Kriminalfall von europäischer Tragweite: Einem Professor wird auf offener Straße die Kehle durchgeschnitten, und ein blinder Bettler flieht mit den sensiblen Daten, die sich auf dem Smartphone des Professors befinden. Paul Hjelm sieht keine andere Möglichkeit, als all seine Prinzipien über Bord zu werfen. Und deshalb kann ihm nur sein alter Freund Gunnar Nyberg, der sich längst auf eine griechische Insel zurückgezogen hat, bei seinem Plan behilflich sein ... »Ein wichtiger, interessanter, clever konstruierter Roman, der allen gefallen wird, die sich für intelligente Spannung begeistern.« Svenska Dagbladet
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzung aus dem Schwedischen von Kerstin Schöps
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2014
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »Blindbock« im Albert Bonniers Förlag, Stockholm.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-492-96658-0
© Arne Dahl 2013
Deutschsprachige Ausgabe:
© 2014 Piper Verlag GmbH, München
Published by agreement with Salomonsson Agency
Umschlaggestaltung: Hafen Werbeagentur
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
1 – Blindheit
Autobahn
Magdeburg – Braunschweig, 2. Januar
Sie ist direkt in das Licht gefahren. Es ist so hell, es blendet beinahe.
Als sie ihre lange Reise von Berlin nach Brüssel antrat, war es noch Nacht. Dann fuhr sie in die Morgendämmerung hinein, und jetzt geht die magisch klare Wintersonne über der Stadt auf. Sie weiß, dass es Magdeburg ist. In der Ferne, links von der Autobahn, meint sie die Doppeltürme des gotischen Doms zu erkennen. Die Sonne steht direkt hinter ihren Spitzen, als würde das Licht aus den Türmen strahlen und sie wie einen Glorienschein umgeben. Unter der Autobahn schlängelt sich der Mittellandkanal in die Elbe – oder vielleicht ist es andersherum –, um nicht weit entfernt, aber außer Sichtweite, die größte Wasserstraßenkreuzung Europas zu bilden. Eine andere Kreuzung – die der Autobahnen A2 aus Berlin und A14 aus Leipzig – lässt sie nur wenige Kilometer später an die warnenden Worte des gestrigen Abends denken.
Normalerweise fährt sie nicht Auto, schon gar nicht so weite Strecken, und wenn sie in letzter Zeit doch den Wagen nehmen musste, war sie immer gefahren worden. Aber heute nicht, heute herrschen besondere Umstände. Das letzte Schleudertraining hat sie mit zwanzig Jahren absolviert.
Und es ist glatt dort draußen. Mehrmals hat sie gespürt, wie der Wagen die Bodenhaftung verlor – so ein Moment, wo diese hinterhältige, uralte Angst den Brustkorb zusammenzieht –, und sie hat auf der Fahrt das ein oder andere mit Reif bedeckte Autowrack gesehen, das die A2 säumte. Eher Pannen als Unfälle, dennoch durch das Glatteis verursacht. Allerdings hatte ihr Automechaniker felsenfest behauptet, dass ihre Winterreifen den höchsten Ansprüchen genügten.
Es dürfte keinen Grund zur Sorge geben.
Wenn nicht der gestrige Abend gewesen wäre. Silvester in Berlin war überstanden. Eine träge Mattigkeit hatte sich über den Neujahrstag gelegt. Ein neues Jahr, neue Erwartungen, genau genommen neue Möglichkeiten. Ein mildes nach innen gerichtetes Lächeln. Es war viel besser gelaufen, als sie es zu hoffen gewagt hatte. Ihr Gegenbesuch. Jetzt erschien ihr alles viel sinnvoller, viel hoffnungsvoller. Und dann diese unerwartete Warnung.
»Deutschlands gefährlichste Autobahn.«
Die beginnt gleich hinter der Bundeslandgrenze, oder? Direkt hinter der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen –, und gerade als sie versucht, sich an die Städtenamen zu erinnern, passiert sie ahnungslos diese Grenze. Kurz dahinter taucht ein Autobahnschild mit Entfernungsangaben und Ortshinweisen auf. Sie erkennt zwei Namen wieder, Helmstedt und Peine. Das waren doch die beiden, oder?
Ja. Natürlich, die vertraute Männerstimme sagte: »Die gefährlichste Autobahn Deutschlands ist die A2 zwischen Helmstedt und Peine.«
Sie spürt, wie ihre Konzentration steigt. Bald hat sie Helmstedt erreicht. Zwischen Helmstedt und Peine liegt Braunschweig.
Professionelles Wissen aus Brüssel, sie liebt es, den Überblick zu haben. Das hier ist die Hauptverbindung zwischen Ost- und Westeuropa, sie führt einmal quer durch Deutschland. Täglich passieren sie hundertzwanzigtausend Fahrzeuge. Schwertransporter aus Polen. Große Mengen von Abgasen, Treibhausgasen, von klimaverändernden Emissionen, deren Bedrohungspotenzial nur von der Anzahl der Verkehrsunfälle übertroffen wird. Es heißt, die Braunschweiger Autobahnpolizei sei die am meisten beschäftigte Verkehrspolizei Europas.
Und jetzt auch noch Glatteis.
Die Schönheit des Winters ändert mit einem Schlag ihr Gesicht. Auch die Sonne, die es geschafft hat, den Horizont zu erklimmen, verändert sich. Ihre Magie verdunkelt sich – wird schwarze Magie. Als sie an Helmstedt vorbeifährt, spürt sie einen dicken Klumpen im Hals.
Sie ist noch nie gerne Autobahn gefahren. Diese seltsame Grenzenlosigkeit. Dass man gezwungen ist, häufiger in den Rückspiegel zu sehen als nach vorn. Dass man unentwegt auf Männer mittleren Alters gefasst sein muss, die sich selbst überschätzen und von hinten in ihren egotherapeutischen Schallgeschwindigkeitsblasen angerast kommen und sich mit Fernlicht an die Stoßstange hängen, weil man nur hundertsechzig fährt.
Gut, man konnte nicht im Ernst behaupten, dass die französischen Autofahrer so viel besser waren. Allerdings wurden die kulturellen Unterschiede an keiner Stelle so deutlich sichtbar. Fühlte sie sich tatsächlich im rechtlosen Raum des Verkehrsdschungels von Paris wohler als in der aufgeräumten Autobahnlandschaft?
Keines war dem anderen vorzuziehen. Beides war falsch. Beide Formen gehörten ins 20. Jahrhundert, und das war vorbei. Es war Zeit, endlich das neue Jahrhundert einzuläuten.
Wir haben die Chancen des 20. Jahrhunderts verstreichen lassen. Seine zahllosen Möglichkeiten, endlich eine Gesellschaft zu etablieren, in der für alle genügend Platz ist, in der niemand außen vor bleiben muss. Zum ersten Mal seit Menschengedenken verfügten wir über ausreichend Ressourcen. Und was haben wir damit gemacht? Wir sind praktisch widerstandslos zu den mittelalterlichen Werten zurückgekehrt, in eine primitive Gesellschaftsform, wo das Prinzip survival of the fittest herrscht.
Sie weiß genau, dass ihr diese Gedanken kommen, weil sie so schnell wie möglich diesen Autobahnabschnitt um Braunschweig hinter sich lassen will. An etwas anderes denken will. Als würde die Autobahn es zulassen, dass man an etwas anderes denkt.
Soeben hat sie den Kopf nach links gedreht und einen Blick auf die Silhouette von Braunschweig erhascht, als sie etwas anderes sieht. Ihr vorausschauender Blick, der gerade auf der Autobahn so wichtig, so lebenswichtig ist, registriert ein blinkendes Licht. Es ist das erste Signal einer ganzen Perlenkette von Zeichen, die mit einer Geschwindigkeit auf sie zurasen, dass ihr Interpretationsvermögen auf eine harte Probe gestellt wird. Etwa vier, fünf Wagen vor ihr leuchten Warnblinklichter auf. Davor sieht sie noch mehr Scheinwerfer aufblenden, Bremslichter und Warnblinker, rot und orange, in unmittelbarer Nähe hört sie Bremsgeräusche, Vollbremsungen. Schlittergeräusche?
Dann herrscht Stille.
Erst als ihr Auto zum Stehen kommt und der kurze schicksalsschwere Blick in den Rückspiegel bestätigt, dass auch die Autos hinter ihr stehen, folgt die nächste Kette von Ereignissen. Allerdings auf der gegenüberliegenden Fahrbahn.
Zuerst steigt Rauch auf. Und es ist kein zarter, anmutiger ätherischer Dunst, der sich in den Himmel schlängelt. Ganz und gar nicht. Es ist ein sphärischer Rauchball. Es sieht aus, als wäre dieser schwarze Ball auf der Erde aufgeprallt und würde wieder nach oben springen, zu einer gigantischen Hand, die schon längst zurückgezogen wurde. An ihrer Stelle befindet sich nun etwas anderes dort oben im Himmel, wo sich der Rauchball verflüchtigt – und das dürfte auf keinen Fall dort sein. Und sie sollte auch auf keinen Fall aus dem Auto steigen, um es anzusehen. Und das sollten die anderen Autofahrer ebenso wenig tun. Aber sie tun es. Das ist quasi unvermeidlich.
Dort, wo vorher der Rauchball in den Himmel stieg, ist jetzt ein Lkw-Anhänger. Ein schwerer, sehr schwerer Anhänger. Es ist wie ein Standbild. Man kann sich die Kräfte nicht vorstellen, die diesen Anhänger in die Luft katapultiert haben.
Es ist der Anhänger eines Tanklastwagens.
Das Ganze findet in einiger Entfernung statt und beinahe wie in Zeitlupe, sodass alles unwirklich erscheint, aber vermutlich sollte man in Deckung gehen. Diese Erkenntnis liest sie auch in den Blicken der anderen Autofahrer. Aber jetzt ist es zu spät, etwas dagegen zu unternehmen, denn der Anhänger stürzt zu Boden. Sie registriert die Bewegung. Eine Massenkarambolage. Sie sieht mehrere schwarze Autos, zwei rote, ein blaues, ein silbernes, und sie sieht ein kleines weißes Auto im Zentrum des Geschehens. Alle sind ineinander verkeilt, aber es wirkt nicht wie ein tödlicher Zusammenstoß, noch nicht.
Denn das Letzte, was sie wahrnimmt, bevor der Anhänger auf der Unfallstelle aufschlägt, ist, dass etwas aus dem Anhänger läuft. Aber nicht einfach nur läuft, sondern vielmehr fließt, strömt, ja stürzt. Von der klaren Flüssigkeit, die sie im Bruchteil einer Sekunde erkennt, steigt ein Flimmern auf. Die Flüssigkeit aus dem Tanklaster versetzt die Luft in Vibration.
Dann schlägt der Anhänger auf. Nahezu lautlos.
Sie dreht sich zu den anderen Fahrern um und erkennt, dass auch sie wissen, was jetzt geschehen wird. Sie kann es in deren Augen sehen.
In der Langsamkeit, mit der sie sich bewegen.
Mit der sie ihre Köpfe senken, wie zu einem gemeinsamen Gebet. Zu welchem Gott auch immer.
Die Stille dehnt sich unerträglich aus, während sich der Anhänger nach seinem langen Flug zurechtlegt. Sie kann es nicht sehen, aber das zunehmende Flimmern in der Luft verrät ihr, dass die Flüssigkeit unaufhörlich ausläuft.
Und dann tritt das Unausweichliche ein. Die Flüssigkeit entzündet sich. Eine einzige vollkommen lautlose Stichflamme schießt in die Luft, wie aus einem seitlich vergrößerten Bohrloch, in alle Richtungen. Dann kehren die Geräusche zurück. Wie eine Sequenz von Donnerschlägen. Als ein Benzintank nach dem anderen explodiert. Die unbarmherzige Kettenreaktion fossiler Brennstoffe.
Jetzt steht ein Flammenwald über der Autobahn. Ein dichter Feuerdschungel. Trotz der Entfernung erfasst die Hitze die Zuschauer auf der entgegengesetzten Fahrbahn. Sie werden von dem Echo der Explosion förmlich überrollt. Aus irgendeinem Grund muss sie daran denken, dass ihre Augenbrauen gerade versengt werden.
Mit welch einer wahnsinnigen Geschwindigkeit das alles verbrennt. Das ist gar keine Kettenreaktion. Alles geschieht gleichzeitig. Die Welt steht in Flammen. Die Hitze verschluckt jedes Geräusch. Es wird vom Feuer vertilgt. Alles ist Feuer. Erneut bildet sich ein schwarzer Rauchball, der in den Himmel steigt.
Dann ist alles so abrupt vorüber, wie es begonnen hat. Das Feuer erstirbt, nachdem es alles verschlungen hat, was in seinem Weg war. Der Rauchball schwebt davon, und es folgen ebenfalls schwarze, aber nicht so kompakte Schwaden. Und aus ihnen taucht ein Autowrack nach dem anderen auf, jedes vollkommen ausgebrannt.
Alles ist schwarz. Verkohlt. So sieht die Erde nach der Götterdämmerung, nach Ragnarök aus.
Und doch ist das nicht ganz richtig. Denn inmitten des Kreises der Zerstörung steht etwas. Und das ist nicht schwarz. Es ist weiß.
Ein kleines weißes Auto in all dem verkohlten Schwarz.
Da geschieht das Unglaubliche, und die Tür des Wagens öffnet sich. Ein junger Mann stolpert heraus, so weiß wie sein Auto. Er sieht sich um. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass er wirklich etwas sieht. Seine Bewegung wirkt eher wie ein tief verwurzelter, mechanischer Reflex.
Der junge Mann bleibt neben seinem Wagen stehen. Er sieht nichts. Aber er lebt.
Auf der gegenüberliegenden Fahrbahn sehen die Menschen umso mehr. Sie sehen ein kleines weißes Auto, umgeben von ausgebrannten rauchenden Wracks, das offensichtlich vollkommen unbeschädigt ist. Und es ist wie eine Offenbarung, eine Vision.
Sie sieht sich um. Mustert die anderen Autofahrer. Ihre Blicke begegnen sich. Sie sehen alle dasselbe.
Sie sehen, wie das Weiße aus all dem Schwarzen hervorsticht, hinter dem Rauchvorhang, der sich immer mehr lichtet.
Und sie denkt: Ein Elektroauto.
In diesem Augenblick weiß sie, was sie tun muss.
Der Ankauf
Tîrgu Mureş, Rumänien, 17. Februar
Die meisten Menschen überrascht es, dass Mander Petulengro Hell und Dunkel unterscheiden kann. Viele glauben, dass er schummelt und doch über ein Mindestmaß an Sehkraft verfügt. Aber das ist nicht wahr. Er wurde blind geboren und konnte noch nie sehen. Er weiß nicht einmal, was das bedeutet.
Das unterscheidet ihn von den Erblindeten, die er kennenlernt. Sie leiden darunter, empfinden ihre Blindheit als einen großen Verlust und Mangel. Und setzen ihr Leben fort als Schatten im Universum der Sehenden.
Aber er tut das nicht. Er steht damit allein. Wenn er hingegen manchmal anderen Blindgeborenen begegnet, erlebt er so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl. Dann berühren sie seine Welt für kurze Zeit. Sonst existieren sie nicht wirklich. Denn auch sie sind allein in ihrem Kosmos.
Es gab Zeiten, da hätte er es sich gewünscht, dass jemand sein Universum betreten und dort seinen Platz finden würde. Das war die Zeit der Wanderung. Seine kleine Luminitsa aus Sarajevo. Auch sie war blind wie er, und doch konnte sie ihn sehen wie kein anderer. Besser als er sich selbst. Und für eine kurze Zeit befanden sie sich im selben Universum.
Nein, diesen Stein wollte er nicht umdrehen.
Er hat sich zurückgezogen. Dieses Pflegeheim soll seine letzte Station sein. Eigentlich wartet er nur auf die nächste Dunkelheit, die Finsternis. Er ahnt, dass der Übergang gar nicht so drastisch sein wird.
Sogar seine Gitarre hat er beiseitegestellt. Als er sich im Bett aufsetzt und an einem frischen Flohstich kratzt, lässt er seine Hand auch über die Kurven des Instruments gleiten. Der Gedanke an Luminitsa aus Sarajevo wird brutal vom Widerstand des Staubs zwischen seinen Fingern verdrängt. Für eine Sekunde erfüllt ihn der Kummer, dass er seine Gitarre schon wieder verstauben lässt. Aber dann schiebt er auch diesen Gedanken weg. Er hat sich zurückgezogen. Er hat genug gespielt, genug gesungen und ist lange genug umhergewandert. Und er hat bedeutend mehr gesehen als alle Sehenden.
Er riecht an dem Staub. Verreibt ihn zwischen den Fingern. Er kennt diesen Geruch von Schmutz, altem Schmutz, aber da ist noch etwas anderes. Der Geruch von Metall. Schwermetall. Ist das hier wirklich der richtige Ort, um sich zur Ruhe zu setzen? Sollen all diese Jahre hier ein Ende finden?
Tîrgu Mureş ist nicht seine Heimatstadt. Sie liegt im falschen Teil von Transsilvanien. Seine Heimatstadt war Caşin, in der Nähe von Miercurea Ciuc im Landkreis Harghita. Aber nach dem, was dort geschah, existiert diese Stadt nicht mehr. Auf seiner Karte existiert sie nicht mehr. Es hatte ihn zu einem Dasein als Wanderer verdammt. Jetzt hat er diese Wanderung beendet. Und auch das Gitarrespielen. Und das Singen.
Er hat aufgehört zu leben.
Seit Längerem lauscht er schon ihren Stimmen. Sie waren von einem Zimmer ins nächste gegangen, der Leiter stolziert hinter ihnen her mit einem Klang in seiner Stimme, den er bisher noch nie gehört hat. Ihm wird klar, dass es hier um etwas Wichtiges geht, und in einem anderen Leben hätte er schneller reagiert. Da hätte er das Heim schon längst über den Hinterausgang verlassen – den kannte er besser als seine Westentasche –, bevor es zu spät war. Aber zu spät wofür? Was konnte ihm denn hier noch drohen? War er denn nicht schon ganz am Boden?
Viel zu spät begreift er, dass Ruhen nicht bedeutet, dass man am Boden ist. Es gibt einen Boden, wo ein Ausruhen nicht mehr möglich ist.
Es ist Mitte Februar, Viertel nach zwei Uhr am Nachmittag. Er spürt das Licht. Er weiß genau, wie hell es ist. Die Tür ist geschlossen, das hört er, das spürt er am Licht, sie haben offensichtlich die Türen zu allen Räumen geschlossen. Er spürt, dass sich etwas anbahnt.
Aber er spürt keine Furcht. Wovor sollte er auch Angst haben? Hat er nicht schon alles erlebt?
Aber als die Tür zu seinem Zimmer aufgestoßen wird, spürt Mander Petulengro zum ersten Mal seit vielen Jahren – nein, keine Angst, das wäre zu viel gesagt, aber ein Unbehagen, das Gefühl, dass ein vertrauter, statischer Zustand ungewollt eine Eigendynamik entwickelt.
Denn er weiß, dass es eigentlich heller wird, wenn die Tür aufgeht. Draußen im Flur ist es heller, der Raum der acht »Gäste« ist der dunkelste des ganzen Pflegeheims. Aber dieses Mal wird es nicht heller. Obwohl er hört, wie die Tür aufgestoßen wird, wird es dunkler. Noch dunkler.
Zuerst glaubt er, dass sein vielfach belegtes Gespür für Licht – über das er ja eigentlich gar nicht verfügen dürfte – außer Kraft gesetzt wurde. Doch dann begreift er, dass etwas anderes im Gange ist.
Etwas ganz anderes.
An den Schritten erkennt er, dass es neben dem Heimleiter drei sind. Verglichen mit dessen nur ungefähr siebzig Kilo leichten Schritten, sind diese drei Personen wesentlich schwerer. Zwei von ihnen sind sogar richtig schwergewichtig.
Aber die Stimme des Dritten hört er als Erstes: »Der Hydrozephalus ist großartig, davon abgesehen sind wir überhaupt nicht zufrieden.«
Eine Bassstimme, gewohnt, Befehle zu erteilen, trotzdem neutral, geschäftsmäßig, der drohende Unterton lässt sich kaum heraushören. Bleistiftspitzen auf Papier. Mander Petulengro versucht sich daran zu erinnern, was »Hydrozephalus« bedeutet, während seine Nase wahrnimmt, dass der Heimleiter anfängt zu schwitzen.
»Aber die Chorea Huntington ist doch auch ausgezeichnet«, versucht es der Heimleiter mit einem Flehen in der Stimme. »Und der Junge ist noch so klein. Den könnte man hervorragend mit einer üppigen Mutterfigur kombinieren.«
»Es ist wohl kaum Ihre Aufgabe, uns unsere Arbeit zu erklären, oder?«
»So war das doch gar nicht ...«
»Ich habe selten so eine abstoßende Achondroplasie gesehen«, unterbricht ihn die Bassstimme. »Glauben Sie im Ernst, dass er auch nur einen einzigen Cent einspielen wird?«
Mander Petulengro hört den Heimleiter tief Luft holen und versucht, die Puzzlestücke zusammenzufügen. Was ist das hier? Was geht hier vor? Und was hat es mit ihm zu tun? Vielleicht ja gar nichts. Er hofft es. Er möchte sich am liebsten wegdrehen, sich auf das Bett zwischen die hungrigen Flöhe legen. Aber das tut er nicht. Er bleibt reglos sitzen. Konzentriert sich. Hydrozephalus, Chorea Huntington, Achondroplasie – das waren alles medizinische Ausdrücke. Wofür? Für Krankheiten?
Und was war damit gemeint: »Glauben Sie im Ernst, dass er auch nur einen einzigen Cent einspielen wird?«
Er hört die schweren Schritte durch den Raum der acht »Gäste« schreiten. Wenn er ehrlich ist, weiß er nicht, ob auch alle acht anwesend sind. Seine Wachsamkeit ist schon so lange erloschen.
Er hört, wie der Heimleiter sich räuspert und sagt: »Dafür haben wir uns das Beste bis zum Schluss aufgehoben.«
Mander bewegt sich keinen Millimeter. Er hat seine alte Wachsamkeit doch nicht verloren, sie hat nur brachgelegen, seit sie ihm auf seinen langen Wanderungen immer wieder das Leben gerettet hat. Sie und der Gesang. Und die Gitarre.
Nach langer Zeit hat er zum ersten Mal wieder das Bedürfnis, die Saiten seiner Gitarre anzuschlagen.
Erneutes Kratzen der Bleistiftspitze, dann nähern sich die Schritte. Sie kommen direkt auf Mander zu. Und plötzlich fallen alle Puzzlestücke an ihren Platz. Und ein Gesamtbild erscheint. Ein Bild, das niemand außer ihm sehen kann.
Er sieht es auf seine Weise.
»Der da?«, fragt die Bassstimme skeptisch.
»Blind geboren«, sagt der Heimleiter eifrig. »Sehen Sie sich diese Augen an. Wer kann vollkommen weißen Augen widerstehen?«
»Aber er hat eine schwierige Geschichte, richtig?«
»Er hat sich zurückgezogen«, sagt der Heimleiter. »Er hat die ethnischen Säuberungsaktionen in Harghita im August 1992 überlebt, ist nach Süden geflohen und war fünfzehn Jahre untergetaucht.«
»Ich habe Sie nicht um seinen Lebenslauf gebeten«, sagt die Bassstimme. »Ich will nur wissen, ob er uns Schwierigkeiten machen wird.«
»Er ist die Ruhe selbst«, antwortet der Heimleiter.
Einen Moment lang herrscht Schweigen. Mander Petulengro meint, ein bestätigendes Nicken als leichte Druckveränderung in der dunklen Luft wahrzunehmen.
»Ciprian klärt mit Ihnen die finanziellen Details«, sagt die Bassstimme, und einer der beiden Schwergewichtigen setzt sich in Bewegung. Die mittlerweile wesentlich sichereren Schritte des Heimleiters folgen ihm. Die beiden verlassen den Raum.
Erneutes Kratzen des Bleistiftes auf dem Papier, dann nähern sich andere Schritte. Ein monströs lautes Schnaufen, der Kerl ist vor ihm in die Hocke gegangen, dann sagt er mit verräterischer Milde in der Stimme: »Du wirst uns doch keine Probleme machen, oder?«
»Ich heiße Mander Petulengro«, antwortet Mander.
»Ich will nicht wissen, wie du heißt.«
»Sie haben mich jetzt also gekauft?«
»Das ist die letzte Frage, die du stellst, kapiert? Wir haben einen vielversprechenden Wasserkopf, einen verkrüppelten zappelnden Sechsjährigen und einen richtig hässlichen Zwerg gekauft. Und jetzt noch eine unsichere Karte, eine Blindschleiche mit gruseligen verdrehten Augen. Los, komm.«
Während sich die schweren Schritte des dritten Mannes nähern, begreift Mander, dass sein Leben mitnichten hier in diesem Bett voller Flöhe enden wird. Sondern dass sich jetzt wieder alles ändern wird. Ihm kommt eine Idee, und er streckt seine linke Hand aus. Er spürt die Kurven des Instrumentes und sieht plötzlich Luminitsa aus Sarajevo ganz deutlich vor sich.
Er sieht sie auf seine ihm ganz eigene Weise.
»Ihr bekommt sogar noch einen Bonus dazu«, sagt er, als sich eine schwere Hand auf seine Schulter legt. »Ich bin Musiker.«
Es herrscht einen Augenblick lang Schweigen. Die Hand lässt seine Schulter los.
Schließlich sagt die Bassstimme: »Musiker kriegen wir woandersher.«
»Aber ich bin ein blinder Musiker«, entgegnet Mander und hört, wie laut sein Herz schlägt.
Erneutes Schweigen. Die Sorte von Schweigen, die – so hatte er herausgefunden – bedeutet, dass Blicke gewechselt werden.
»Na gut«, sagt die Bassstimme dann, und ihr Besitzer erhebt sich, sein Schnaufen lässt nach. »Ich gebe dir eine Minute. Zeig uns, was du draufhast!«
Mander Petulengro greift nach seiner Gitarre. Er pustet die Staubschicht weg. Der Gestank nach Schwermetallen sticht ihm in die Nase, während er das Instrument auf sein Knie hebt. Sanft streicht er über die Kurven des Korpus, und dieses Mal verdrängt er das Bild von Luminitsa aus Sarajevo nicht.
Sein ganz eigenes Bild.
Als er den ersten Akkord anschlägt, ist sein eigener Herzschlag ruhig und gleichmäßig. Und es ist so hell wie an einem normalen Nachmittag im Februar.
Die Kontaktaufnahme
Den Haag – Amsterdam, 28. Juni
Das grelle Sonnenlicht, das durch die Fenster des Hauptquartiers der Opcop-Gruppe in Den Haag fiel, schien jedes einzelne Staubkorn in Bewegung zu versetzen. Und verursachte merkwürdig fremde Schatten.
Überhaupt war es ein unerwartet einsames Gefühl, durch die Räume der Opcop-Gruppe zu laufen. Es waren dieselben, und doch auch nicht mehr. Dabei war alles wie bisher: die offene Bürolandschaft, die Besprechungsecke, die sie das »Whiteboard« nannten, der Konferenzraum mit dem sakralen Spitznamen »Kathedrale« und Paul Hjelms Chefbüro, mit Blick auf das Großraumbüro und über den Raamweg auf die Innenstadt. Als er in dem leer geräumten Zimmer aus dem Fenster über die Stadt sah, meinte er, die asymmetrischen Konturen des neuen Hauptquartiers von Europol ausmachen zu können, das sich auf der anderen Seite des kleinen Stadtparks Scheveningse Bosjes befand.
Der Umzug war praktisch überstanden, nicht zuletzt, weil sich Teile der Gruppe die ganze Zeit in Amsterdam aufhielten, wegen eines sehr personalintensiven Auftrags. Die Räume standen leer. In der Bürolandschaft, wo in den vergangenen Jahren so viele Gedanken gewälzt worden waren, befand sich kein einziger Computer mehr, kein Stuhl, nicht einmal ein Schreibtisch. Das Whiteboard zeichnete sich jetzt in erster Linie durch seine Abwesenheit aus, die elektronische Whiteboard-Tafel war längst umgehängt worden. Die Kathedrale sah aus, als hätte sie schwere Kriegsschäden zu beklagen. An den Wänden gähnten siebenundzwanzig rechteckige Löcher, in denen einst die Bildschirme der siebenundzwanzig EU-Mitgliedsstaaten angebracht waren, mit deren Repräsentanten die Gruppe in Kontakt stand. Und das Chefbüro war so leer, wie Paul Hjelm sich fühlte.
Allerdings fühlte sich das gut an.
Eine Ära war vorbei. Eine neue würde beginnen. Und sie begann auf die denkbar beste Weise.
Er ging auf den Ausgang zu. Als er sich noch einmal umdrehte, wurde ihm bewusst, dass er diesen Raum vermutlich zum letzten Mal sehen würde. Er verharrte für einen Augenblick und sog die Erinnerung an die wahrscheinlich wichtigsten Jahre seines beruflichen Lebens in sich auf.
Und die einsamsten seines Privatlebens.
Allerdings war das nun auch vorbei. Während er Richtung Amsterdam nach Norden fuhr, steigerte sich seine Vorfreude zu einem fast pubertären Gefühl. Ein Glücksempfinden erfüllte seinen Körper während der fünfzig Kilometer auf der Autobahn, und als er die Ausfahrt mit dem eigenartigen rhythmischen Namen Haarlemmermeer nahm, begann sein Herz in einem anderen Takt zu schlagen. Rhythmischer.
In Haarlemmermeer befindet sich der größte Flughafen Europas, und in Schiphol, direkt am Ankunftsgate, wurde ihm bewusst, dass sein Leben noch einmal neu begann. Die zweite Hälfte seiner Lebensphase läutete sich in dem Augenblick ein, als er sie erblickte. Klein, dunkelhaarig, bescheiden, und trotzdem hatte sie eine Ausstrahlung, die ihn überwältigte, als sie ihn erblickte und ihn anlächelte.
Für beide war es ein Gefühl, als würden sie nach Hause kommen, Paul Hjelm und Kerstin Holm.
Sie hatten nie Schwierigkeiten, miteinander zu sprechen, eher damit aufzuhören. Aber dieses Mal fiel es ihnen schwer, die richtigen Worte zu finden. Jede Aussage hörte sich irgendwie platt an. Deshalb schwiegen sie, bis er ihr Gepäck im Kofferraum verstaut hatte und sie im Auto saßen. Dann erst küssten sie sich. Es war ein langer Kuss.
Dann räusperte sie sich und sagte: »Jorge lässt grüßen und dankt.«
»Wofür denn?« Paul Hjelm lachte auf und startete den Motor.
»Dafür, dass er wieder ein bisschen Chef sein darf.«
Hjelm lachte noch lauter. »Du dagegen bist jetzt alles andere als eine Chefin.«
»Damit komme ich für ein paar Wochen klar«, entgegnete Kerstin Holm und lächelte.
Dann schwiegen sie. Es fühlte sich gut an.
Auf Höhe des Rembrandtparks sagte Kerstin: »Das Ambassade Hotel, oder ...?«
»Herengracht.« Paul nickte. »Eine kleine Suite mit Blick auf den Kanal.«
»Wie feudal!« Kerstin lächelte. »Aber ...?«
»Aber was?«
»Es klang, als hättest du noch ein ›Aber‹ auf der Zunge.«
»Hast du schon einmal darüber nachgedacht, Detektivin zu werden?«
»Also nicht zuerst in die Herengracht, sondern in die Lauriergracht?«
»Hättest du was dagegen? Es ist nur ein paar Hundert Meter vom Hotel entfernt. Bloß kurz vorbeischauen. Dann kannst du das live erleben. Außerdem lernst du unsere Neuen kennen.«
»Wovon der eine verdammt hart arbeitet, wie ich gehört habe.«
»Adrian, ja. Wir sind gerade ungewöhnlich stark auf seine Fähigkeiten angewiesen. Um keine externen Dolmetscher einsetzen zu müssen.«
Kerstin Holm nickte. Sie hatte nichts dagegen. Wie sollte sie das auch? Sie hatte sich nur auf etwas anderes gefreut. Und zwar so schnell wie möglich. Am liebsten in einer extravaganten Badewanne.
In Amsterdam Auto zu fahren war immer ein Wagnis. Es herrschte ein ständiges Verkehrschaos in einem Dschungel aus Einbahnstraßen; wie aus dem Nichts auftauchende Straßenbahnen, Fahrradfahrer, die sämtliche Verkehrsregeln außer Kraft setzten – und dazu die schmalen Straßen entlang der Kanäle, diese vielen Grachten, die kaum voneinander zu unterscheiden waren.
Die Lauriergracht war eine der kürzesten. Und schmalsten. Man konnte ohne Weiteres in seiner Wohnung auf der einen Kanalseite sitzen und in die gegenüberliegende sehen. Zudem befand sich in unmittelbarer Nähe eine Brücke. Bei Bedarf wäre man also innerhalb von Sekunden auf der anderen Kanalseite, um sich dort dem anderen Team anzuschließen, das in einer Wohnung des Hauses gegenüber Position bezogen hatte. Und zwar in der Wohnung, die direkt unter der observierten lag.
Das registrierte Kerstin Holm instinktiv, ehe sie das Gebäude durch einen Seiteneingang betraten und den sträflich falsch geparkten Wagen seinem Schicksal überließen.
Im hochsommerheißen Treppenhaus roch es feucht und leicht nach Schimmel, sie folgte ihrem Lebensgefährten die schmale Treppe aus dem 17. Jahrhundert hinauf bis zu einer Wohnungstür im ersten Stock, auf deren Namensschild »Bezuidenhout« stand. Die alte Frau Bezuidenhout war seit einigen Wochen in einer bedeutend luxuriöseren Wohnung in der Jan Luijkenstraat untergebracht.
Die dreiundachtzigjährige Reederwitwe hätte ihre alte Wohnung nicht wiedererkannt. Sie war übersät mit den unterschiedlichsten Varianten von Überwachungstechnik und Abhörgeräten, die Kerstin Holm gar nicht erst versuchte zu identifizieren. Ihre analytische Energie wurde davon in Anspruch genommen, den kahlköpfigen Mann zu identifizieren, der ausgestreckt auf dem Feldbett lag, das vollkommen unpassend mitten im Wohnzimmer stand. Er trug einen schnurlosen Kopfhörer und riss die Augen auf, als hätte man ihn bei etwas Verbotenem erwischt. Dann hievte er sich von der schwankenden Pritsche, während Kerstin Holm ihre Aufmerksamkeit zum Fenster richtete. Dort nahm eine sehr große dunkelhäutige Frau ihren Kopf von einem Gerät, das aussah wie ein Teleskop, und sah die Besucher erstaunt an. Dann richtete sie sich auf, lächelte breit und sagte: »Der Chef. Und Kommissarin Holm, nehme ich an?«
»Wir haben uns bisher ja nur digital gesehen«, antwortete Kerstin Holm und streckte ihr die Hand hin. »Corine Bouhaddi, richtig?«
»In ganzer Größe«, sagte Bouhaddi und schüttelte Holms Hand mit einem Händedrück, den man wortwörtlich als eisernen Griff bezeichnen musste.
Sie setzte sich an einen Schreibtisch, auf dem ein halbes Dutzend Monitore und Tastaturen standen. Dem Kahlköpfigen war es mittlerweile gelungen, sich von dem widerspenstigen Feldbett zu erheben, und er kam auf sie zu.
»Adrian Marinescu«, stellte er sich vor, schüttelte Holms Hand und wandte sich dann Paul Hjelm zu. »Chef, verzeihe, wenn es aussah, als hätte ich geschlafen. Das habe ich nicht.«
»Alles in Ordnung«, sagte Hjelm. »Du hast doch auch hart gearbeitet. Im Moment also keine Aktivität?«
Marinescu schüttelte den Kopf und rückte seinen Kopfhörer zurecht, der ihm auf seinem offenbar spiegelglatten Schädel ein bisschen verrutscht war. Dann antwortete er: »Seit gut einer Stunde nichts mehr.«
»Aber das könnte sich jetzt gleich ändern«, erklärte Bouhaddi und betätigte ein paar Tasten. »Deshalb stand ich auch gerade am Teleskop. Jemand, der definitiv wie ein Fahrradkurier aussieht, ist auf dem Weg ins Gebäude.«
Marinescu seufzte und sagte dann: »Ich bin bereit.«
Bouhaddis Finger flogen über die Tastatur, und auf einem der Monitore war zu sehen, wie der Fahrradkurier eine Treppe hinaufging, in seiner großen schwarzen Umhängetasche wühlte und dann an einer Tür klingelte, an der ein winziges Schild mit der Aufschrift »U. M. A. N. Imports« angebracht war. Auf dem benachbarten Monitor erhoben sich zwei feiste Männer aus einem Sofa und knöpften ihre viel zu dicken Jacketts zu. Ein Dritter glitt zwischen ihnen hindurch und drückte sich neben der Eingangstür an die Wand. Einer der Männer sah durch den Türspion, versteckte dann die Pistole hinter seinem Rücken und öffnete mit der Linken die Tür. Er nahm einen wattierten Umschlag im C5-Format in Empfang und quittierte, ebenfalls linkshändig, den Empfang mit einer elektronischen Unterschrift. Der Fahrradkurier sprang mit der für Kuriere typischen Geschwindigkeit die Treppe hinunter, und der Mann an der Tür reichte dem Kleineren den Umschlag, der damit aus dem Bild verschwand. Sofort betätigte Bouhaddi einige Tasten, und aus der Vogelperspektive war zu sehen, wie der Mann sich an einen Schreibtisch mit mehreren Computern setzte. Dann legte er den Umschlag in einen Apparat. Ein Lichtstreifen wanderte darüber, zweimal, und der Mann studierte aufmerksam die Monitore. Erst dann riss er den Umschlag auf und sagte etwas mit tiefer Bassstimme in einer Sprache, die Kerstin Holm an ein grobes Italienisch erinnerte.
Die Übertragung seiner Stimme war relativ schwach, dafür aber war Adrian Marinescus unmittelbar folgende Simultanübersetzung in einem sorgfältig modulierten Ostblockenglisch umso lauter: »Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob die das hinbekommen haben. Ich habe die Skandinavier so satt. Verdammte Geizhälse. Und in Griechenland hat noch nicht einmal mehr die feine Gesellschaft Kohle.«
Danach waren Grunzlaute im zweistimmigen Kanon zu hören, wahrscheinlich Gelächter. Der Mann faltete das Papier aus dem wattierten Umschlag auf und las es. Er nickte, schwieg aber.
»Die agieren sehr wenig auf digitalem Weg oder via Handys«, sagte Bouhaddi. »Wir sind der Ansicht, dass sie so das Abhörrisiko verringern wollen.«
»Aber sie haben keinen Verdacht geschöpft, oder?«, fragte Holm.
»Dafür gibt es keine Anzeichen«, erwiderte Hjelm. »Das scheint eher eine allgemeine Vorsichtsmaßnahme zu sein.«
»Könnte man nicht den Fahrradkurier abfangen?«
»Die Lieferungen gehen auf die unterschiedlichsten und absonderlichsten Weisen vonstatten«, sagte Bouhaddi, »außerdem gibt es hier in Amsterdam eine absurd große Anzahl an Fahrradkurierfirmen. Unser waghalsigster Zug war bisher, dass einer unserer Leute auf der anderen Seite den Kurierfahrer angehalten hat und so den Inhalt des Umschlags fotografieren konnte. Das warst du, Marek, oder?«
Auf einem dritten Bildschirm tauchte Marek Kowalewski auf. Er saß an einem bedeutend kleineren Schreibtisch in einem wesentlich kleineren Raum als dem eleganten Wohnzimmer der Witwe Bezuidenhout. Er schob sein breites, rotes Gesicht in die Kamera und sagte erstaunt: »Mann, seid ihr viele.«
»Ein Ehrengast«, erläuterte Hjelm.
Ein weiteres Gesicht schob sich von der Seite in die Kamera, eine Südländerin, die Kerstin Holm aber nicht kannte. Allerdings vermutete sie, dass es sich um Donatella Bruno handeln musste, die ehemalige Chefin der nationalen Opcop-Einheit in Rom. Sie hatte sich dazu überreden lassen, sich von der meteorologischen Hitze Roms in die professionelle Hitze von Den Haag versetzen zu lassen.
Es folgte eine kurze Begrüßung, bevor Marek erzählte: »Ja, das war ich. Ich habe den Fahrradkurier erwischt, ehe er die Eingangstreppe betreten hat. Also habe ich ihn um die Ecke gezogen, den Umschlag geöffnet und seinen Inhalt fotografiert. Ihr habt Kopien auf euren Rechnern. Danach musste ich den Umschlag wieder sehr sorgfältig verschließen.«
»Wir wissen, dass die Umschläge vor dem Öffnen immer erst geröntgt werden«, sagte Bouhaddi. »Wir wissen allerdings noch nicht, wonach die dabei suchen.«
»Meine größte Befürchtung war«, fuhr Kowalewski fort, »dass der Kurierfahrer das große Zittern bekommt, wenn einer der Fleischschränke die Tür öffnet. Aber es ist alles gut gegangen. Die haben keinen Verdacht geschöpft. Aber das ist keine zukunftsträchtige Vorgehensweise. Viel zu riskant.«
»Hier ist das Dokument«, sagte Bouhaddi und öffnete auf einem vierten Monitor eine Aufnahme. »Es handelt sich um einen Code, wie ihr seht. Unsere Experten sitzen schon seit einer Woche daran, ohne ihn knacken zu können. Er besteht aus zwei Teilen, dies hier scheint ein Fließtext zu sein, und das sieht eher aus wie eine Liste.«
»Und was glaubt ihr, worum es sich dabei handelt?«, fragte Holm und betrachtete die handschriftlichen Buchstabencodes.
»Vermutlich handelt es sich um Lageberichte der verschiedenen Niederlassungen in ganz Europa«, erklärte Hjelm. »Ereignisse, Probleme, Einnahmen und natürlich Neuzugänge – die expandieren ja in einer erschreckenden Geschwindigkeit. Vielleicht geht es auch um ein operatives Geschäft.«
»Ich begreife nach wie vor nicht, wie man so viel Geld mit Bettlern verdienen kann«, sagte Kerstin Holm aufrichtig erschüttert.
»Doch, das kann man tatsächlich«, bestätigte Donatella Bruno. »In den katholischen Ländern sind wir mildtätiger, und anders als zum Beispiel in Skandinavien erledigen wir unsere Geschäfte am liebsten noch mit Bargeld.«
»Dann liegt es also doch nicht daran, dass wir Skandinavier so ›verdammte Geizhälse‹ sind?«, warf Hjelm mit stilistisch einwandfreier Selbstironie ein.
»Das liegt eher an eurer tadellosen lutherischen Arbeitsmoral«, entgegnete Kowalewski mit einer wesentlich neutraleren Form der Ironie.
»Auf der anderen Seite«, fuhr Donatella Bruno fort, »haben wir wahrscheinlich zum ersten Mal belastbare Indizien für eine Verbindung der Bettelmafia zu einem großen Menschenhändlerring. Und vielleicht sogar zum organisierten Verbrechen.«
»Allerdings wissen wir bisher noch nichts Genaues«, warf Hjelm ein, »und darum sitzen wir hier auch.«
»Wenn ich der Chef wäre«, sagte Corine Bouhaddi mit einem lieblichen Lächeln, »wäre ich ein bisschen vorsichtig mit dem Wörtchen ›wir‹.«
Kerstin Holm musste zu ihrer eigenen Überraschung laut auflachen. Sie versuchte ihren Fauxpas schnell mit einer Frage vergessen zu machen. »Und diese Männer kommen aus Rumänien?«
»Ja, Bukarester Dialekt.« Adrian Marinescu nickte. »Und die Bettler sind auch fast ausnahmslos Rumänen. Vermutlich Roma. Musiker und mehr oder weniger behinderte Roma. Die gibt es zurzeit in jeder europäischen Großstadt. Wir sprechen da von Zehntausenden versklavten Menschen.«
»Roma aus Rumänien«, sagte Holm.
»Ich weiß, was du denkst«, entgegnete Marinescu etwas aufgebracht, »aber wir dürfen nicht vergessen, dass innerhalb Europas in Rumänien mit Abstand die meisten Angehörigen dieser Ethnie leben. Allerdings hängt das davon ab, ob wir die Türkei zu Europa zählen oder nicht. Laut Präsident Băsescu sind es rund eineinhalb Millionen Menschen. Es ist nicht so, dass wir besonders stark rassistisch wären.«
»Wir lassen diese Frage vorerst ruhen«, sagte Hjelm vermittelnd. »Wir müssen los.«
»Hat die Konferenz schon angefangen?«, fragte Bouhaddi.
»Nein«, antwortete Hjelm. »Aber heute Abend findet zum Auftakt ein Bankett hier in Amsterdam statt.«
»Wir übernachten im Hotel«, sagte Holm. »Wahrscheinlich hat euer Chef seine Junggesellenbude seit Monaten nicht aufgeräumt.«
»Konferenz?«, wiederholte Marinescu, der sich wieder beruhigt hatte. »Verzeiht, ich bin hier zwei Wochen vollkommen isoliert gewesen ...«
Paul Hjelm erläuterte: »Vor der offiziellen Einweihung des neuen Hauptquartiers von Europol findet eine dreitägige Konferenz in besagtem Hauptquartier statt, die European Police Chiefs Convention. Sie endet mit der Einweihung am 1. Juli, und dann darf auch die Opcop-Gruppe dazustoßen, also diejenigen von euch, die nicht hier sitzen werden.«
Sie verabschiedeten sich. Als sie auf die Straße traten, sahen sie den Strafzettel hinter dem Scheibenwischer stecken. Paul Hjelm warf ihn ins Handschuhfach, in dem Kerstin Holm eine ganze Reihe ähnlicher Papiere ausmachte.
»Amsterdam«, sagte Hjelm nur und gab Gas.
Die Herengracht befand sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Es war nur eine sehr kurze Fahrt, und zu Kerstin Holms großen Überraschung fanden sie sogar einen Parkplatz in der Nähe. Ihnen wurde ihr Zimmer zugewiesen, tatsächlich eine kleine, sehr geschmackvoll eingerichtete Suite mit mehreren Fenstern und Blick auf die Herengracht. Sie umarmten einander leidenschaftlich, ohne vorher die schweren Gardinen zuzuziehen. Während die Kleidungsstücke zu Boden fielen, fragte Kerstin Holm: »Was hältst du von einem Bad?«
»Sehr gerne«, antwortete Paul Hjelm.
Dänisches Tagebuch 1
Chicago, 9. Mai
Energiedichte.
Reichweite.
Ladezeiten.
Umwelteinfluss.
Seit zehn Jahren dreht sich mein Leben beständig um diese Begriffe. Um nichts anderes. Damit diese einzigartige Effektivität erzielt werden kann, die plötzlich alles freisetzt und alle Bedingungen von Grund auf verändert.
Bisher ist das unmöglich gewesen. Bisher hat es nur Theorien darüber gegeben. Aber jetzt sehen wir Licht am Horizont, und zwar aus mehreren Blickwinkeln gleichzeitig, das hat mir diese Konferenz gezeigt. Aber ich habe noch etwas anderes erkannt, daher schreibe ich auch diese Zeilen – obwohl ich sonst nie schreibe. Ich hatte ein merkwürdiges, beunruhigendes Erlebnis. Ich werde später darauf zurückkommen, »liebes Tagebuch«.
Konferenzen dieser Art sind, ehrlich gesagt, total nutzlos. Man hält seine Zunge im Zaum, spricht nur so viel, wie man muss, hört seiner Konkurrenz zu, die sich ebenfalls bedeckt hält, man versucht, die Bedeutung hinter den Worten auszumachen und den unvermeidlichen Augenblick nicht zu verpassen, in dem der andere sich verplappert. Spitzenforschung, eingehüllt in nichtssagende Floskeln bei grotesker Wachsamkeit.
In gewisser Hinsicht ist die Konferenz in Chicago genau so abgelaufen. Die verschiedensten Forschungsgruppen haben wie Habichte über ihre Worte gewacht. Aber die Stimmung war anders als sonst, der Geist der Konferenz. Es herrschte nahezu Erfindergeist wie in alten Zeiten. Wie in einem alten Dampfkochtopf. Der Druck steigt, die Temperatur ebenfalls, die Kochzeit halbiert sich, und wenn alles fertig ist, wird das kleine Ventil geöffnet, und aus ihm entweicht zischend Dampf, der heißer ist als gewöhnlicher.
Es scheint, als würden alle auf dieses Zischen warten.
Als könnte es jeder Beliebige von uns erzeugen.
Wir sind wie immer Außenseiter. Hier sind Forscher von den großen amerikanischen Universitäten und zum Teil auch von kleineren Instituten aus aller Welt. Aber die Gesandten der kleineren Universitäten kommen, um zu lernen, und die der großen arbeiten ganz bestimmt nicht frei und selbstständig. Die haben ihre etablierten Geschäftspartner in der Auto- und Ölindustrie. Und die allermeisten Anwesenden sind natürlich Forscher, die für Unternehmen mit rein kommerziellen Interessen arbeiten. Virpi und ich haben gestern beim Abendessen festgestellt, dass wir unter den größeren Akteuren wahrscheinlich die einzigen unabhängigen sind.
Aber so sieht die Welt von heute nun einmal aus.
Und niemand rechnet mit uns. Das ist ganz angenehm, vor allem im Hinblick auf Jovans Nachricht von heute Morgen. Ich wäre am liebsten ins erstbeste Flugzeug gestiegen und nach Hause geflogen.
Das ist nur ein weiterer Grund, warum ich dies hier schreibe. Aber der Hauptgrund ist ein anderer. Ich bin gezwungen, noch darauf zurückzukommen.
Dennoch ist es spannend, von den Fortschritten der anderen zu erfahren. Tesla Motors scheint nach wie vor führend in der Fahrzeugentwicklung zu sein, IBM setzt weiterhin heldenhaft auf die Lithium-Luft-Akkumulatoren, und Envia Systems scheint kurz vor einem Durchbruch bei den guten alten Lithium-Ionen-Akkumulatoren zu stehen. Und doch hat die Forschergruppe vom MIT die meiste Aufmerksamkeit für ihre »semi-solid flow cell« erhalten. Während des Vortrags der Vertreter vom Massachusetts Institute of Technology, dem MIT, habe ich mich bei dem Gedanken ertappt: Da habt ihr aber erst die Hälfte des Weges hinter euch.
Wie die Gruppe vom MIT haben auch wir die beiden grundlegenden Funktionen der Batterie voneinander getrennt: das Speichern der Energie, bis sie benötigt wird, und das Freisetzen der Energie, wenn sie eingesetzt werden soll. Und auch unser größtes Hindernis dabei war natürlich die Lagerung. Es fehlte die durchschlagende Idee. Aber nun wird man hoffentlich in naher Zukunft ein Elektroauto nicht mehr langwierig aufladen müssen – was die allermeisten Forscher weiterhin hartnäckig verfolgen –, sondern die entladene Batterieflüssigkeit an jeder beliebigen Tankstelle gegen geladene austauschen können. Die entladene Flüssigkeit wird unterdessen wieder aufgeladen, chemisch, ohne Stromverbrauch, nur mit Restprodukten. Ganz umweltfreundlich. Dann kann sie wieder getankt werden.
Jovans Nachricht heute Morgen war zwar nicht gerade die durchschlagende Idee, aber wir kommen voran. Bald wird das Lagerungsproblem aus der Welt sein.
Ich bin nicht stolz darauf, muss aber zugeben, dass ich dem Vortrag der Leute vom MIT mit so etwas wie Schadenfreude zugehört habe.
Als hätte es dieser Journalist mir angesehen – direkt nach dem Vortrag kam der auf mich zugeschossen. Es war eher eine Attacke. Ich habe ihn sofort nach seiner Akkreditierung gefragt. Er hielt mir etwas unter die Nase, aber das ging so schnell, dass ich keinen Buchstaben lesen konnte. Und dann kamen seine Fragen, Schlag auf Schlag. Wie weit eigentlich das gesamteuropäische Projekt gediehen sei? Wie nah wir am Ziel seien? Ob wir der Ansicht seien, dass die mit Benzin betriebenen Autos bald ausgedient hätten? Und wann das denn so weit sei?
Und dann hat er tatsächlich folgende Frage gestellt: Warum der Professor so ironisch gelächelt habe, während die Vertreter des hochkarätigen MIT ihren Vortrag gehalten hätten? Und er fügte noch hinzu: »Worum ist es in dem Telefonat gegangen, das der Herr Professor beim Frühstück geführt hat?«
Ich empfinde mich als einen ungewöhnlich rationalen Menschen. Dennoch ist es mir unmöglich, die Kräfte zu erklären, die mich dazu gebracht haben, nach seiner Akkreditierung zu greifen, die ihm um den Hals hing. Ich wollte unbedingt sehen, wie er hieß, wer diese Person war. Seine Reaktion war, gelinde gesagt, ungehobelt. Hatte ich zwar mit großer Kraft, aber unüberlegt gehandelt, so reagierte er mit noch größerer Kraft und äußerst überlegt. Die Kraft, mit der er mir seine Plastikkarte aus der Hand riss, passte nicht zu einem normalen Wissenschaftsjournalisten, das kann ich versichern.
Ich hatte keine Gelegenheit, seinen Namen zu lesen. Aber wenn ich mir jetzt im Hotelzimmer den Schnitt in meiner Handfläche ansehe, sagt der mehr als jeder Name. Das Blut, das mir über den Handrücken heruntertropfte, hat mich dazu gebracht, dieses Tagebuch zu schreiben. Unter einem bestimmten Gesichtspunkt war das nicht mehr als ein unbedeutendes Ereignis während einer medial aufgeladenen Energiekonferenz. Vor einem anderen Hintergrund betrachtet, scheint es mir, dass es nicht länger ausschließlich um Energiedichte, Reichweite, Ladezeiten und Umwelteinfluss geht. Hier geht es um die Zukunft, und das setzt ganz andere Kräfte in Bewegung.
Es ist durchaus möglich, dass ich übertreibe. Es ist sogar äußerst wahrscheinlich, dass es sich bei diesem Mann nur um einen Wissenschaftsjournalisten handelte, der dachte, er hätte einen riesigen Fisch am Haken, und der deshalb übereifrig war. Aber ich weiß es eben nicht. Meine Gefühle sind gemischt. Einerseits freue ich mich darauf, unsere Arbeit zu Hause fortzusetzen; wir sind kurz vor dem Ziel.
Andererseits habe ich tatsächlich ein bisschen – Angst.
Das Bankett
Amsterdam, 28. Juni
Die Sonnenflecken tanzten unentwegt über die Decke des Hotelzimmers. Kerstin Holm benötigte etwas mehr Zeit, um sich herzurichten. Paul Hjelm, der im Smoking auf dem Bett lag, konnte ungestört eineinhalb Fußballspiele im Fernsehen verfolgen. Drei Halbzeiten der holländischen Fußball-Liga. Obwohl die wahrscheinlich jetzt auch Sommerpause hatten, was bedeutete, dass Wiederholungen gesendet wurden. Das wiederum war jedoch egal, da Hjelm sich sowieso nicht mit den Vereinen auskannte.
»Wie lange muss ich noch warten, bis dieses Handballspiel beendet ist?«, erklang eine Stimme in der Wohnzimmertür.
Paul Hjelm sah auf, betrachtete die elegant gekleidete Kerstin Holm und musste an die vielen kleinen Ungerechtigkeiten des Lebens denken.
Die kleinen waren ein Teil des Lebens, die großen sollten das nicht sein dürfen.
Er nahm sie in den Arm und küsste sie. Dann ließ er seinen Blick an dem hellroten Abendkleid hinuntergleiten und sagte: »Es hat sich gelohnt, darauf drei Halbzeiten zu warten.«
Sie lachte und rückte seine Fliege zurecht. Dann wagten sie sich hinaus in die noch immer heiße und bedrückend volle Stadt.
In einem Taxi mit defekter Klimaanlage sitzend, fragte Paul Hjelm den nach Rauch riechenden Fahrer: »Wie weit ist es bis zum Muiderslot?«
»Ungefähr fünfzehn Kilometer«, antwortete der Fahrer mit heiserer Stimme.
»Ich finde das sehr sexy, wenn du holländisch sprichst«, sagte Kerstin.
Hjelm lächelte und meinte: »Allerdings hätte die richtige Frage lauten müssen: Was ist Muiderslot?«
»Willst du damit ernsthaft sagen, dass du dich nicht auf heute Abend vorbereitet hast? Muiderslot ist ein mittelalterliches Wasserschloss auf einer kleinen Insel, an der Südspitze des künstlichen Binnensees, des IJmeeres. Großes I, großes J. Früher lag das Schloss am Meer, jetzt an einem See.«
»Ein Schloss aus dem Mittelalter?«
»13. Jahrhundert.«
»Apropos Vergangenheit«, sagte Hjelm. »Habe ich dir erzählt, dass Gunnar sich gemeldet hat?«
»Welcher Gunnar?«
»So schnell hast du deine alten Kollegen vergessen?
»Mist, meinst du etwa Gunnar Nyberg?«, rief Kerstin Holm. »Ich habe seit einem halben Jahr nichts mehr von ihm gehört. Was wollte er denn?«
»Ob du es glaubst oder nicht, aber er hat seinen Roman so gut wie fertig.«
»Und deshalb hat er dich angerufen?«
»Höre ich da einen Hauch von Ironie in Ihrer Stimme, Madame?«
»Nun, es ist doch schon eine Weile her, dass du dich mit Romanen beschäftigt hast, oder?«
»Ich lese zurzeit tatsächlich mehr als je zuvor. Allerdings vorwiegend Polizeiberichte und Aktennotizen. Gunnar hat mich aber nicht aus literarischen Beweggründen angerufen, leider, sondern aus finanziellen. Er fragte mich, ob ich über gute einschlägige Kontakte verfüge, um EU-Fördergelder zu beantragen. Ich habe schon mit ein paar Leuten gesprochen.«
»Und wie geht es meinem Gunnar? Genießt er das Leben als Schriftsteller?«
»Ludmilla und er haben vor Kurzem geheiratet.«
»Ich glaube es ja nicht. So etwas muss man doch seiner ehemaligen Partnerin erzählen.«
»Es geht ihnen offenbar gut auf Chios, aber ich hatte den Eindruck, dass ihn doch finanzielle Sorgen plagen. Und eine gewisse Unruhe.«
»Na ja, er hat ja auch rasant von hundert auf null heruntergefahren. Die Folgen von so einer Vollbremsung zeigen sich immer erst nach einer Weile.«
Das Taxi hatte sich aus dem Zentrum Amsterdams herausgeschlängelt und die Autobahn in Richtung Osten erreicht. Hjelm konnte nicht aufhören, über die Polder, die künstlichen Seen und Landschaften der Holländer, zu staunen. Hier hatte man die Natur selbst in die Hand genommen, einfach eine Meeresbucht, die Zuiderzee, eingedeicht und sie dadurch in einen großen Binnensee verwandelt, das IJsselmeer, das sein Süßwasser aus dem Fluss IJssel bezieht. Zwei Drittel der Fläche wurden trockengelegt und so Neuland gewonnen. Im Zuge dessen entstanden kleinere Seen, zu denen auch das IJmeer gehörte, auf das sie jetzt zufuhren.
Kurz darauf hatten sie den kleinen, relativ anonymen Ort Muiden erreicht, den sie durchqueren mussten, um zur Schlossinsel zu kommen. Die grauen Zinnen und Türme des Muiderslot erhoben sich mächtig vor dem blauen Wasser. Als sie sich näherten, stellten sie fest, dass die Befestigungsmauern zusätzlich von einem typischen Wallgraben umgeben waren. Für einen kurzen Moment fühlten sie sich ins Mittelalter zurückversetzt, doch dann waren plötzlich Segelboote und Autos zu sehen. Daneben flatterten altertümliche Standarten im Wind, die mit dem europäischen Sternenkreis statt mit feudalherrschaftlichen Insignien versehen waren, was unerwartet selbstironisch wirkte. Die Standarten wurden von mittelalterlich anmutenden Gauklern getragen, die jeden eintreffenden Wagen zum Schein attackierten. Die meisten Gäste kamen jedoch nicht mit dem Taxi, sondern in Limousinen, um die eine Bande sich selbst geißelnder Mönche auf dem Schlossparkplatz herumtanzte. Die Chauffeure versuchten, sie zu verscheuchen, während sie sich auf eine lange und zähe Wartezeit gefasst machten.
Hjelm und Holm stiegen aus und wurden von einer weiteren mittelalterlichen Gruppe bestürmt. Diese bestand aus Musikern mit historischen Instrumenten wie Fideln, Holzquerflöten, Dudelsäcken, Schalmeien, Einhandflöten und Naturtrompeten. Hjelm verblüffte vor allem die durchgehend dunkle Hautfarbe der Musiker. Als würden sie alle einem Volksstamm angehören.
Das Paar näherte sich dem Schlosstor, das von Dienern in Livreen bewacht wurde, deren Blicken aber nichts Dienendes anhaftete. Hjelm war sogar der Meinung, eines der Gesichter aus den Fluren des Europol-Hauptquartiers wiederzuerkennen. Vermutlich ein Polizist, der das nicht operative Dasein satthatte. Er wandte sich demonstrativ ab, als Hjelm ihm zunickte. Offensichtlich handelte es sich doch um einen ungenehmigten Nebenverdienst.
»Willkommen«, sagte einer der Livrierten mit einer wenig willkommen heißenden Stimme und hakte die beiden auf der Gästeliste ab. »Sie finden Ihre Tischplatzierung auf einer Tafel, die im Innenhof aufgehängt wurde.«
Im Innenhof des Schlosses wimmelte es nur so von festlich gekleideten Menschen und einer überproportional hohen Anzahl an Kellnerinnen, von denen eine sie sofort mit zwei Gläsern Champagner versorgte. Die etwas schrille mittelalterliche Musik schien aus allen Ecken gleichzeitig zu ertönen, sodass Hjelm den Verdacht hatte, dass mehrere Musikantengruppen unterwegs waren. Die Herrschaften Hjelm und Holm balancierten ihre Champagnergläser durch die Menge, ohne dass ihnen ein einziges Gesicht bekannt vorkam. Endlich hatten sie sich bis zu der Tafel mit der Tischplatzierung vorgearbeitet und stellten fest, dass sie einander schräg gegenüber sitzen würden an einem Tisch, der sich im Wapenzaal befand und über mehrere Treppen zu erreichen war. Als Hjelm eine Berührung auf der Schulter spürte, wandte er sich um und blickte in das jugendliche Gesicht des Direktors von Europol. Sie begrüßten einander freundlich. Auch Kerstin Holm war ihm ein paarmal begegnet, und er hatte auf sie immer einen sehr reflektierten Eindruck gemacht.
»Ich befürchte, dass Ihr Tischnachbar, Fräulein Holm, ein wenig spröde ist«, schrie er, um den Lärm der Naturtrompeten und Querflöten zu übertönen. »Maltas Polizeichef, Hubert Carabott, Achtung: Frühvergreisung. Aber ich frage mich, ob Sie hingegen, Paul, Ihre Tischdame nicht sogar sehr schätzen werden.«
»Und das sagen Sie einfach so in meiner Anwesenheit?«, schrie Kerstin und lächelte.
»Natürlich nur platonisch!«, unterstrich der Direktor. »Sie ist eine unserer Ehrengäste. Marianne Barrière, EU-Kommissarin aus Frankreich.«
»Sieh mal einer an«, rief Hjelm wenig beeindruckt.
»Ich weiß, Sie freuen sich am meisten auf den Moment, wenn Sie diesen Abend überstanden haben«, schrie ihm der Direktor ins Ohr und legte ihm die Hand auf den Oberarm.
»Sprechen Sie aus eigener Erfahrung?«, entgegnete Hjelm und spürte, dass seine Stimme ihn verließ.
»Ich bin der Direktor einer großen EU-Behörde«, rief der Direktor mit neutraler Stimme. »Da hat man solche Gedanken einfach nicht.«
»Aber trotzdem ...«, hob Hjelm an, doch da hatte sich der Direktor schon weitertreiben lassen.
Paul und Kerstin versuchten zusammenzubleiben, aber schon fünf Minuten später hatten sie einander verloren. Paul fand sich in ein Gespräch mit der dänischen Polizeichefin verstrickt, aber kaum hatten sie ein Thema gefunden, wurde sie außer Sichtweite gedrängt, und er stand bei dem griechischen Innenminister, der so einiges über die EU zum Besten gab, worauf Paul gut hätte verzichten können. Obwohl die Übersetzung griechischer Schimpfwörter einen großen Unterhaltungswert hatte. Da ertönte eine Glocke, und die Gäste strömten zu den Eingängen ins Schloss.
Große, breite Türen, Steintreppen, die auf undefinierbare Weise nach Mittelalter rochen, Frauen in langen engen Abendkleidern und auf High Heels, die sich die Stufen hochquälten, die in einer Zeit gebaut wurden, als diese Art von Garderobe noch nicht das Licht der Welt erblickt hatte. Ein Klangteppich aus vielen verschiedenen Sprachen erfüllte die Gänge. Es folgte die Jagd durch die Säle nach dem richtigen Raum, dem richtigen Tisch, dem richtigen Stuhl.
Der Wapenzaal war aller Wahrscheinlichkeit nach der alte Waffensaal, wo die Ritter vor langer Zeit ihre Hellebarden und Armbrüste ablegten. Es war der mit Abstand größte Raum, in den Paul Hjelm auf seiner Suche geraten war. Am Ende half ihm eine der Kellnerinnen an seinen Platz. Auf der anderen Seite des Tisches stand Kerstin Holm. Ihr Anblick war für ihn wie eine Offenbarung, wie eine Oase in der Wüste. Ihren Mund umspielte ein leicht ironisches Lächeln. Ein älterer Herr führte sie an ihren Platz, aller Wahrscheinlichkeit nach Maltas Polizeichef Hubert Carabott. Der Platz zu Hjelms Rechten war noch nicht besetzt, aber das Namensschild neben einem der zahlreichen, noch leeren Weingläser kündigte Marianne Barrière an. Daher wandte Hjelm seine Aufmerksamkeit zunächst seiner Tischnachbarin zur Linken zu, die ebenfalls ihren Tischkavalier noch vermisste. Sie begrüßten sich. Die Frau war eine Oberstaatsanwältin aus Bratislava, Slowakei, allerdings gelang es ihm nicht, ihren Namen zu verstehen. Nicht einmal in Schriftform. Während sie über dies und das plauderten, warf er einen Seitenblick zu Kerstin. Ihr Blick wiederum sprach Bände, hätte aber nicht gar so vorwurfsvoll sein müssen. Das Beängstigende war, dass er die Staatsanwältin daraufhin mit Kerstins Augen ansah und erst da erkannte, wie gut aussehend sie war. Allerdings hatte sich mittlerweile ihr Tischnachbar eingefunden, der wie ein ergrauter, aber kastrierter Hollywoodstar aussah. Während Paul Hjelm darüber grübelte, wie er ausgerechnet auf diesen Vergleich gekommen war, drehte er sich um und erblickte endlich auch seine Tischdame. Sie war eine beeindruckende, sehr französisch aussehende Frau Anfang fünfzig.
Sie lächelte ihn an und sagte mit einem nur schwachen französischen Akzent: »Ich habe mich gerade gefragt, wann Sie sich wohl für Ihre Tischdame interessieren werden.«
»Verzeihen Sie bitte«, entgegnete Paul Hjelm und streckte ihr die Hand entgegen. »Paul Hjelm.«
»Marianne Barrière. Normalerweise wird von dem Herrn erwartet, dass er seine Tischdame ausfindig macht, sie zu Tisch führt und ihr den Stuhl heranzieht. Er plaudert mit ihr und führt sie nach dem Essen zum Tanz.«
»Ich bin mir nicht so sicher, ob wir viel zum Tanzen kommen«, sagte Hjelm und rückte ihr den Stuhl zurecht. »Wie viele mittelalterliche Tänze beherrscht Madame denn?«
»Genau genommen ist es ›Mademoiselle‹«, erwiderte Marianne Barrière. Sie setzte sich nicht auf den dargebotenen Stuhl, sondern begrüßte stattdessen die anderen Gäste um sie herum, was Hjelm natürlich auch längst hätte machen sollen. Schließlich konnte er nicht mehr die Unschuld vom Lande mimen, diese Zeiten waren vorbei. Er war ein Teil des Ganzen, ob er wollte oder nicht. Er sah, wie Kerstin Holm und Marianne Barrière sich die Hand gaben und ein paar Worte wechselten, die von einem Lachen und einem Blick zu ihm begleitet wurden. Er lächelte nur.
Endlich, wie auf ein unsichtbares Zeichen hin, nahmen alle Platz, und das Essen begann. Irgendwann würde auch Hjelm diese geheimen Zeichen verstehen, das redete er sich zuversichtlich ein. Es müsste doch möglich sein, dieses Wissen vor seinem Lebensende zu erwerben.
»Ich weiß im Übrigen so einiges über Sie und Kerstin Holm«, sagte Marianne Barrière. »Allem Anschein nach auch wesentlich mehr, als Sie über mich wissen.«
»Ich weiß lediglich, dass Sie EU-Kommissarin sind«, gab Hjelm zu. »Für Frankreich, nehme ich an. Aber wie kann es sein, dass Sie überhaupt etwas von unserer unsteten Existenz wissen?«
»Weil ich tatsächlich an diese Idee glaube, dass wir alle zusammenhalten und versuchen sollten, den Frieden in Europa zu bewahren. Daher bin ich der Ansicht, dass es zu meinen Aufgaben als Mitglied der EU-Kommission gehört, einen Überblick über die Aktivitäten in der EU zu haben, vor allem über die Bereiche, die wir strategisch sensibel nennen ...«
»So können wir das gerne nennen, solange wir leise sprechen. Ehrlich gesagt, weiß ich aber gar nicht, was eine EU-Kommissarin macht.«
»Nun, die Europäische Kommission vertritt bekanntlich die Interessen der Europäischen Union insgesamt. Ihre Aufgabe ist es, dem Europäischen Parlament und dem Rat der EU neue Rechtsvorschriften vorzuschlagen. Außerdem stellt die Kommission sicher, dass EU-Recht in den Mitgliedsstaaten umgesetzt wird. Jedes Mitgliedsland stellt einen der Kommissare, insgesamt sind wir also achtundzwanzig Abgesandte, einschließlich des Präsidenten und des Vizepräsidenten, und jeder hat einen bestimmten Aufgabenbereich.«
»Das entspricht ungefähr meinen Kenntnissen«, sagte Hjelm und stach die Gabel in die Vorspeise, die er hinterher nicht mehr würde benennen können. »Ich betreibe ja auch so eine Art EU-Kommission im Mikroformat. Aber was machen Sie genau?«
Marianne Barrière ließ ein perlendes Lachen hören und antwortete: »Ich bin die EU-Kommissarin für Umwelt. Was man auch von der etwas antiquierten Struktur der Kommissionen halten mag oder von dem beliebten Vorwurf, dass sich die meisten Kommissare nur bereichern wollen und die parteipolitische Zusammensetzung Schlagseite hat – eines steht fest: Wir sind nach wie vor der größte und wichtigste Machtfaktor in Europa, wenn es um europäische Rechtsprechung geht. Die EU-Kommission hat das alleinige Recht, gesamteuropäische Gesetzesvorschläge vorzulegen. Gesetze, die sich über die Rechtsprechung aller achtundzwanzig Staaten hinwegsetzen können. Die mächtigsten Gesetze der Welt.«
Paul Hjelm hob sein Weinglas und prostete ihr zu. »Das klingt, als hätten Sie gerade einen sehr spannenden Gesetzesvorschlag auf dem Tisch liegen.«
»Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Detektiv zu werden?«, erwiderte Marianne Barrière lächelnd und hob ebenfalls ihr Glas.
»Dann stimmt es also?«, fragte Hjelm und genoss den Weißwein, der wahrscheinlich ein Chablis war. Allerdings waren seine Geschmacksknospen jetzt schon überstrapaziert.
Marianne Barrière leerte ihr Glas, beugte sich zu ihm, sah ihn mit ihren grünen Augen scharf an und flüsterte verschwörerisch: »Das ist wie bei der Opcop-Gruppe: Es ist noch viel zu früh, um darüber zu sprechen.«
Hjelm lachte und lehnte sich zurück. Nach einer weiteren Vorspeise und einem neuen Glas Weißwein überkam ihn ein wohliges Gefühl, das er gar nicht richtig benennen konnte. Aber es hatte tatsächlich mit Politik zu tun. Er begegnete in seinem Beruf vielen Politikern und hütete sich in der Regel vor politischen Gesprächen. Ihn beschlich dabei immer das unbehagliche Gefühl, er stünde einem lediglich an Finanzen interessierten Beamten gegenüber, der einen langen einstudierten Monolog hielt. Aber Marianne Barrière war anders. Ihr sah man die Leidenschaft für Politik an, die Begeisterung für die Aussicht, das Leben vieler Menschen so gut wie nur möglich zu gestalten. Natürlich war es denkbar, dass er übertrieb – ihre Unterhaltung war schließlich viel zu kurz gewesen, um das wirklich beurteilen zu können –, aber er erlaubte sich gedanklich eine kleine Reise, auf der er vieles hinter sich ließ: die nationalen und persönlichen Machtspiele, die mehr oder weniger sichtbare Korruption, den Lobbyismus, die Intrigen, Steuerhinterziehungen und Budgetkämpfe. Und er spürte, wie er sich dem Kern dessen näherte, was Politik eigentlich sein sollte: die Gestaltung einer gerechten und tragfähigen Gesellschaft. Mehr war es nicht.
Er lachte in sich hinein und sah hinüber zu Kerstin Holm. Ihre Blicke trafen sich. Irgendwie hatte er den Eindruck, dass es ihr ähnlich erging. Er sah das in ihren überraschend konzentrierten Gesichtszügen. Sie prosteten sich zu, und ihr Gesichtsausdruck entspannte sich. Mit einem leichten Nicken deutete sie nach rechts, und Hjelm konnte sich ein Lachen nicht verkneifen, als sein Blick auf Maltas Polizeichef fiel, der mit geschlossenen Augen und mit einem gefährlich schwankenden Weinglas in der Hand neben Kerstin Holm auf seinem Stuhl hing. Während Hjelm sich nun seiner Nachbarin, der slowakischen Oberstaatsanwältin, zuwandte, sah er aus dem Augenwinkel, dass Kerstin sich über den Tisch beugte und Marianne Barrière ansprach. Sie wechselten ein paar Worte, die er nicht verstehen konnte. Und das war auch gut so.
Dann wurde das Hauptgericht serviert, und das Festmahl nahm unter zunehmendem Gemurmel und Geraune seinen Gang. Aus dem Schlosshof drang in Abständen der ein oder andere schrille mittelalterliche Ton zu ihnen hoch, während die weiß gekalkten Wände des Muiderslot immer feuchter wurden, je länger der Abend andauerte. Durch den Atem der Anwesenden.
Kerstin Holm hatte zum Schluss ihren Tischherrn aufgegeben und sich wie ihr Lebensgefährte in eine neue Unterhaltung gestürzt. Als der letzte Fingerbreit Rotwein sich mit dem beeindruckenden Hauptgericht vereinte – unzweifelhaft wurde auch hier das Mittelalterthema beibehalten, es gab ein undefinierbares, aber makellos zartes Stück Fleisch, das über dem offenen Feuer gegrillt worden war –, beugte sich Kerstin Holm vor und sagte mit einer Handbewegung in den Wapenzaal: »Wir hatten letztes Jahr einen großen Fall, und da wurde mir eine Sache klar. Die Zivilisation kämpft unentwegt gegen das sogenannte Mittelalter. In unserer Gesellschaft existieren Parallelgesellschaften, die glasklar den Wertekonzepten der dunklen Jahre, dem finstersten Mittelalter verschrieben sind. In diese Welten sind weder die Renaissance noch die Aufklärung vorgedrungen.«
»Das ist sehr wahr«, erwiderte Marianne Barrière und nahm einen kräftigen Schluck. »Gleichzeitig hat diese Welt aber auch etwas extrem Verführerisches. Etwas Basales. Ursprüngliches. Elementares. Die Frage ist nur, wie kommen wir zurück zu den Grundfesten der modernen Zivilisation, ohne uns unterwegs im Barbarischen zu verstricken? Sowohl die Welt der Gangster als auch die der Gangs und Fanatiker haben das gemeinsam. Alles ist wichtig. Man verteidigt die absolute Wahrheit. Es geht immer um Leben und Tod. Es existieren weder Ironie noch Sarkasmus oder Humor. Da stehen ganz fundamentale Werte auf dem Spiel. Aber die Methoden sind so grotesk. Sie haben vollkommen recht, diese Welt ist weit von der Aufklärung entfernt. Und wenn es Humor gibt, ist er gewalttätig. Mobbinghumor. Mittelalter.«
Nun mischte sich Paul Hjelm in das Gespräch: »Verhält es sich nicht sogar folgendermaßen: Der Superindividualismus im Neoliberalismus hat ein akutes Bedürfnis nach Gemeinschaft erzeugt, gerade weil dessen Sieg sich darauf gründet, dass alle Volksbewegungen – sein Hauptfeind – ausgerottet werden müssen, am besten von innen zersetzt. Es ist gelungen, alle Gemeinschaften der Sozialdemokratie zu vernichten, die Einsamkeit der Habgier hat gesiegt, und dadurch war der Weg frei für die falschen Gemeinschaften, wie sie der Rassismus, der Fanatismus und die Mafia anbieten.«
»Ganz genau«, sagte Barrière, »ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Auch die Neoliberalen haben begonnen, Gemeinschaften zu bilden. Und man ist sogar zu der Erkenntnis gekommen, dass es ein Bedürfnis nach stimmberechtigten Gemeinschaften gibt, das über Wohltätigkeitsvereine und Zusammenschlüsse Gleichgesinnter in der Oberklasse hinausreicht. Aber wir reden hier nicht von einer Gesellschaft – die hat man in tausend Stücke zersprengt, und das lässt sich nicht so schnell heilen –, es geht vielmehr um kleinere, einfach zugängliche Gemeinschaften. Der Logik von Hooligans folgend. Wir gegen die. Die da draußen, wir hier drinnen. Der Flirt der europäischen Rechten mit den Rechtsextremisten folgt einer strengen, historischen Logik.«
»Ah«, rief Kerstin Holm laut aus. »Ich wusste doch, dass ich Ihren Namen kenne. Aus der Opposition gegen Sarkozy.«
»Ja, da habe ich mich leider zu einer reflexartigen Reaktion hinreißen lassen. Das tut man nicht ungestraft.«