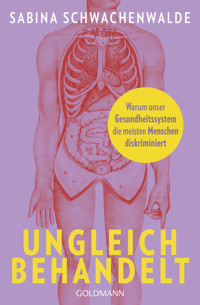
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Gesundheit ist politisch!
Die gesellschaftliche Diskriminierung und Ungleichbehandlung von Frauen, People of Color, Menschen mit Behinderungen, queeren Personen und armen Menschen setzt sich in unserem Gesundheitssystem fort. Es kommt zu Fehldiagnosen oder Vernachlässigung, was sogar tödlich enden kann, ganz zu schweigen vom zwischenmenschlichen Umgang und Übergriffigkeiten. Ärzt*in und Feminist*in Sabina Schwachenwalde setzt sich gegen Sexismus, Rassismus, Queerfeindlichkeit, Klassismus und Ableismus ein und nimmt die Medizin kritisch in den Blick: Warum gelten manche Körper als weniger schützenswert gegenüber anderen? Warum wird manchen Patient*innen mehr, manchen weniger geglaubt? Wer entscheidet, was »normal« und was »krank« ist? Woher stammt das Bild der (weißen) Halbgötter in Weiß? Und ganz konkret: Warum lernt man im Medizinstudium, wie Hautkrankheiten auf heller, nicht aber auf dunkler Haut aussehen, warum sind die meisten ärztlichen Praxen nicht im Rollstuhl erreichbar, warum wissen Ärzt*innen so wenig über queere Gesundheit, und welche Folgen hat Diskriminierung auf unseren Körper und Psyche? Sabina Schwachenwalde liefert in ihrem Debüt die Erklärung, wie strukturelle Benachteiligungen in unserem Gesundheitssystem verankert sind, und verortet diese kritisch als Teil unserer patriarchalen Gesellschaft und pathologisierenden Geschichte.
Eine feministische Auseinandersetzung mit unserem Gesundheitssystem, um die allgegenwärtige Ungleichbehandlung endlich auszuräumen – und ein Plädoyer für eine gerechtere Gesundheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
SABINA SCHWACHENWALDE
UNGLEICH BEHANDELT
Warum unser Gesundheitssystemdie meisten Menschen diskriminiert
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe April 2024
Copyright © 2024: Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Antje Steinhäuser
Umschlag: Uno Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © FinePic®, München
Satz: Mediengestaltung Vornehm GmbH, München
EB ∙ CF
ISBN 978-3-641-29618-6V002
www.goldmann-verlag.de
Inhalt
Vorbemerkung zu Sprache, Begriffen und Konzepten
Einleitung
1Hierarchie und Heilkunde
Die Urenkel*innen der Hexen
2Kolonialismus und Krankheit
Decolonize Medicine
3Daten und Diagnosen
Representation Matters
4Umwelt und Unwohlsein
Gesundheit ist politisch
5Sexismus und Symptome
Me(d) Too
6Rassismus und Risikofaktoren
Black Health Matters
Ein Gespräch mit N’joula Baryoh
7Geld und Gesundheit
Capitalism kills
8Ableismus und Anamnese
Nicht ohne Uns über Uns
9Teufelskreise und Therapien
We are Here, We are Queer
10Veränderung und Visionen
Gute Besserung
Empfehlungen zum Vertiefen und Dranbleiben
Anlaufstellen für Patient*innen
Danke
Zitate im Buch
Vorbemerkung zu Sprache, Begriffenund Konzepten
Bevor es losgeht, kurz ein paar Erklärungen zu Begriffen und (Sprach-)Konzepten, die ich im Buch verwende – wer direkt mit dem Lesen beginnen möchte, kann natürlich auch einfach bei Bedarf zu diesem kleinen Glossar zurückblättern. Ich habe mich in diesem Buch um eine inklusive und sensible Sprache bemüht. Das bedeutet, Menschen so zu nennen, wie sie genannt werden möchten, und Menschen nicht unerwähnt zu lassen, die zu oft unsichtbar gemacht werden. Es werden euch folgende Formulierungen begegnen:
Ableismus; ableistisch:
kommt vom englischen Wort
to be able
, was so viel heißt wie fähig sein, und beschreibt die Diskriminierung aufgrund von Behinderung und/oder chronischer Krankheit.
1
Behinderung; behindert:
Ich spreche von
Menschen mit Behinderung
oder
behinderten Menschen
als neutrale (Selbst-) Bezeichnung und erkenne die soziale Dimension des Behindert-Werdens durch gesellschaftliches Stigma und Teilhabebarrieren an, die eine Beeinträchtigung zu einer Behinderung machen.
2
Genauso wird die Bezeichnung
Menschen mit Lernschwierigkeiten
von Betroffenen als Bezeichnung gefordert.
3
Der Begriff
Krüppel
(oder englisch:
crip
) wird als emanzipatorische Selbstbezeichnung verwendet, die nichtbehinderte Menschen nicht als Fremdbezeichnung benutzen sollten. Ich orientiere mich an den Empfehlungen des Projektes
Leidmedien
.
4
Binarität; (nicht-)binär:
Der Begriff bezieht sich hier auf das gesellschaftliche Geschlechtersystem, in dem davon ausgegangen wird, dass es nur zwei gegensätzliche Geschlechter gibt: Frau und Mann. Viele Menschen, zum Beispiel inter* oder nicht-binäre Personen, passen nicht in dieses System und erfahren dadurch gesellschaftliche Ausschlüsse.
5
Cis:
Wer sich mit dem Geschlecht identifiziert, das bei der Geburt anhand von Genitalien zugewiesen wurde, wird als
cis
bezeichnet. Das Adjektiv
cis
ist das Gegenstück zu
trans*
, wer sich also zum Beispiel als Frau identifiziert und auch bei der Geburt in die Kategorie
weiblich
eingeteilt wurde, ist eine cis Frau.
Dekolonialisierung; dekolonial bzw. Postkolonialismus; postkolonial:
Die Begriffe stehen für Ansätze, die dem Kolonialismus kritisch gegenüberstehen und seinen fortdauernden Einfluss überwinden möchten.
6
Dabei geht es auch um die Sichtbarmachung von und den Kampf gegen koloniale Strukturen, die bis zum heutigen Tag andauern.
Disability:
Das englische Wort für Behinderung ist
Disability
, im Buch begegnet es uns, wenn es um Aktivist*innen aus der (englischsprachigen) Behindertenrechtsbewegung geht.
Diskriminierung:
Damit sind sowohl Herabwürdigung und Belästigung auf individueller als auch Benachteiligung auf struktureller Ebene gemeint.
Feminismus; feministisch:
Verschiedene Formen von Diskriminierung können nur schwer getrennt voneinander betrachtet werden, sondern sie sind sogar eng miteinander verflochten. Anders formuliert: Sie überkreuzen (engl.:
to intersect
) und verstärken sich gegenseitig, wie es die US- amerikanische Juristin Kimberlé Crenshaw formuliert hat. Sie gilt als Begründerin des sogenannten
intersektionalen Feminismus
, auf dessen Grundidee ich mich in diesem Buch beziehe.
7
,
8
Diese Form des Feminismus steht dafür ein, dass verschiedene gesellschaftlich unterdrückte Gruppen nicht gegeneinander um mehr Rechte kämpfen, sondern gemeinsam und solidarisch füreinander einstehen.
Klassismus; klassistisch:
beschreibt die Diskriminierung aufgrund von sozialer Herkunft und Einkommen.
Marginalisierung; marginalisiert:
Oft spreche ich von
marginalisierten Menschen
, was vom lateinischen Wort
margo
für Rand kommt. Es geht dabei um alle, die in der Gesellschaft, und eben auch in der Medizin, nicht im Mittelpunkt stehen, sondern an die Seite gedrängt werden.
Misogynie; misogyn:
Das Wort steht im engeren Sinne für Frauenhass und bezeichnet im weiteren Sinne die Abwertung von allen weiblichen und femininen (wahrgenommenen) Menschen.
9
Patriarchat; patriarchal:
bezeichnet eine Gesellschaftsordnung, in der in allen Bereichen überwiegend Männer die Macht haben.
Queersein/Queerness; queer:
Wenn ich die Selbstbezeichnung
queere Menschen
benutze, dann meine ich damit Menschen, die vielfältige Geschlechtsidentitäten, Beziehungskonzepte und sexuelle Orientierungen haben, die jenseits der gesellschaftlich gesetzten Norm liegen.
10
Viele verbinden den Begriff auch mit einer politischen Haltung, die eben diese
Heteronormativität
, also den gesellschaftlichen Standard von romantischen Beziehungen ausschließlich zwischen Frauen und Männern, hinterfragt.
Trans* Menschen
identifizieren sich, anders als
cis Menschen
, nicht mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt von außen zugewiesen wurde.
Intergeschlechtliche
oder
inter* Menschen
entsprechen nicht der medizinischen festgelegten Norm von männlichen oder weiblichen Körpern, sondern einem breiten Spektrum dazwischen.
Nicht-binäre Menschen
finden sich selbst nicht wieder im
binären Geschlechtersystem
, also in der Annahme, es gäbe nur Frauen und Männer. Manchmal wird auch eine Abwandlung der Abkürzung
LSBTIQ*
verwendet, die für
Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans*-, intergeschlechtliche und queere Menschen
steht.
Rassismus; rassifiziert:
Menschen, die negativ von Rassismus betroffen sind
, bezeichne ich nach dem Vorbild zum Beispiel von §eyda Kurt als
rassifiziert
,
11
um das soziale Konstrukt, das zur Diskriminierung führt, sichtbar zu machen. Denn es gibt keine menschlichen »Rassen«, Rassismus aber sehr wohl. Außerdem verwende ich die Schreibweise Schwarz/
weiß
,
12
wie es die
Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland
vorschlägt,
13
um deutlich zu machen, dass es hier nicht um Hautfarben, sondern um gesellschaftliche Positionen geht. In manchen Zitaten wird auch die Abkürzung
Bi_PoC
verwendet, die für die englische Selbstbezeichnung
Black, indigenous, _ und People of Color
steht.
14
Bei anderen Formulierungen orientiere ich mich an den Empfehlungen der
Neuen deutschen Medienmacher*innen
.
15
Repräsentativ:
ist ein (ungenauer) Begriff aus der Statistik. Er bedeutet, von der Stichprobe, die in einer Studie untersucht wurde, kann auf eine größere Menge geschlossen werden. Eine (vermutlich) repräsentative Datenmenge liegt zum Beispiel vor, wenn für eine Befragung eine Gruppe an Menschen in Deutschland ausgewählt werden, die in ihrer Zusammenstellung der Gesamtgesellschaft entspricht.
Statistisch signifikant:
Eine Formulierung aus dem Bereich der Statistik, die manchmal bei der Erwähnung von Studienergebnissen auftaucht, ist
signifikant
. Das bedeutet, dass die Unterschiede, die in einer Studie festgestellt wurden – zum Beispiel zwischen verschiedenen Patient*innengruppen – nicht zufällig sind. Unter Forschenden wurde sich darauf geeinigt, erst ab einer Irrtumswahrscheinlichkeit von unter 5 Prozent (also einem sogenannten p-Wert von 0,05) von signifikanten Ergebnissen zu sprechen, manche Studien weichen aber auch etwas hiervon ab.
16
Das Konstrukt eines binären Geschlechtersystems möchte ich sprachlich aufbrechen durch die Verwendung von geschlechtersensibler Sprache, die allen Geschlechtern einen Platz einräumt. Dabei orientiere ich mich an den Empfehlungen des Projektes Genderleicht des Deutschen Journalistinnenbunds.17 Menschen sollen, wenn es um sie geht, explizit mitgenannt werden, denn mitgemeint ist nicht mitgedacht, wie Studien belegen.18-21 Hierzu benutze ich das Gendersternchen in Formulierungen wie »Patient*innen«, wobei der Stern eine Lücke im Wort erzeugt, um so Platz für andere Geschlechter jenseits von Frau und Mann zu machen. Mir ist mit der Zeit klar geworden: Auch ich selbst fühle mich nicht recht wohl damit, wenn ich von anderen als Frau bezeichnet werde, weshalb ich für mich selbst die Schreibweise mit Genderstern, also zum Beispiel Ärzt*in, Autor*in oder Aktivisten bevorzuge. Wenn jemand über mich spricht und das Pronomen sie verwendet, finde ich das okay, am liebsten benutze ich aber gar kein Pronomen oder meinen Namen. Wenn ich Expert*innen und Betroffene zitiere, verwende ich jeweils die Pronomen, die sie selbst für sich benutzen, weshalb ihr an manchen Stellen zum Beispiel Formulierungen wie sie*, er* oder sier lesen werdet. Außerdem werden euch in Zitaten auch andere Formen der geschlechtersensiblen Sprache begegnen, zum Beispiel mit Unterstrich (»Patient_innen«) oder Doppelpunkt (»Patient:innen«).
Wenn möglich, möchte ich Menschengruppen und Sachverhalte konkret und korrekt benennen. Wenn es also zum Beispiel um das Thema Geburt geht, wäre es falsch, pauschal von Frauen zu sprechen, da zum Beispiel auch trans* Männer und nicht-binäre Menschen gebären können. Hier könnte eine Formulierung heißen: Menschen, die schwanger werden können oder Menschen mit Uterus. Ebenso ist es ungenau, von Menschen mit Migrationshintergrund zu sprechen,22 wenn es eigentlich um das Benennen von Rassismus geht, denn es gibt Menschen, die seit vielen Generationen in Deutschland leben und trotzdem rassifiziert werden, und solche, die als weiße Einwanderer nicht der gleichen Diskriminierung ausgesetzt sind.
Und noch ein Wort zu den Endnoten: Das Quellenverzeichnis zu diesem Buch ist online einzusehen unter www.penguin.de/schwachenwalde-ungleich
Einleitung
Eine meiner frühen Kindheitserinnerungen ist eine Situation in Leuchtstoffröhrenlicht, das auf weiße Fliesen fällt, ein mechanisches Surren im Hintergrund, und der Geruch von Blut liegt in der Luft. Ich sitze an einem Tisch und male Bilder mit Buntstiften, später darf ich in die Kühlkammer schauen, ein eiskalter Raum voll roter Flüssigkeit in Plastikbeuteln. Meine Mutter arbeitete als medizinisch-technische Assistentin im Labor des Blutspendediensts und nahm mich manchmal dorthin mit, wenn sie am Wochenende oder nachts arbeiten musste. Manchmal begleitete ich auch meine Tante zu ihrer Arbeit, sie war Pflegerin in der Sterbebegleitung. Die Menschen, die sich in ihren letzten Lebenswochen befanden, freuten sich immer, wenn ich zu ihnen ins Zimmer kam, um die Pflanzen zu gießen, und ich fand nichts Ungewöhnliches daran, mich mit ihnen zu unterhalten. Vielleicht habe ich es meiner Familie und diesen frühen Kontakten mit dem Gesundheitssystem zu verdanken, dass ich am Ende beruflich selbst dort gelandet bin.
Während meiner Ausbildung im Rettungsdienst und später im Medizinstudium merkte ich aber mit der Zeit, dass in diesem System einiges schiefläuft. Besonders deutlich wurde mir das bewusst, seit ich nicht nur Ärzt*in, sondern selbst auch Patient*in bin. Es ist oft die Rede davon, dass wir in Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme der Welt hätten. Da frage ich mich: das beste System für wen genau? Und kann medizinischer Fortschritt das einzige Kriterium für eine Medizin sein, die wir als »modern« bezeichnen, obwohl sie so konservativ und rückschrittlich sein kann? Kann ein System, das die meisten Menschen diskriminiert, wirklich als gut bezeichnet werden? Die Medizin ist nämlich nur auf einen sehr spezifischen Standard von Mensch ausgerichtet, wer aber nicht in die definierten Gesellschafts-, Geschlechter-, Begehrens- oder Körpernormen passt, wird nicht nur vernachlässigt, sondern sogar gefährdet.
Darum müssen wir über Diskriminierung sprechen: Es geht um unsere Gesundheit, und manchmal geht es um Leben und Tod. Gesellschaftliche Benachteiligung bedeutet gesundheitliche Benachteiligung, marginalisierte Menschen leben kränker und sterben früher. Weil sie dem Dauerstress der Diskriminierung ausgesetzt sind, weil ihnen ihre Beschwerden nicht geglaubt werden, weil sie gewaltvoll in Normen gezwängt werden, weil uns die Daten und das Wissen über sie fehlen, weil sie ungleich behandelt werden. Bestimmte Patient*innen haben es besonders schwer im Patriarchat, das fiel mir mehr und mehr auf, im Hörsaal und im Behandlungszimmer, anhand von Sprüchen und Vorschriften, durch Erlebnisse und Erzählungen. Warum sprechen wir nicht häufiger und nachdrücklicher darüber, dass manche Körper weniger beachtet, weniger umsorgt, weniger geschützt werden, während für andere alles denkbar Mögliche getan wird? Dass manches Sterben hingenommen wird, während um anderes Überleben gekämpft wird? Und warum ist das so? Das wollte ich herausfinden.
Die Recherchereise führte mich von mittelalterlicher Misogynie und den Posterboys der Medizingeschichte über koloniale Kontinuität und Gendermedizin bis hin zu Aktivismus und Arbeitskämpfen. Besonders viel lernen konnte ich von den vielen engagierten Menschen, die sich tagtäglich für eine gerechtere Gesundheit einsetzen, sei es kämpferisch auf der Straße, aufklärend bei Podiumsdiskussionen, einfühlsam im Patient*innenkontakt oder kreativ im Netz. Denn ich bin nur eine Person von vielen, die versuchen, auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Für die Inspiration, den Status quo zu hinterfragen, für das nötige Empowerment, die Verhältnisse nicht länger hinzunehmen, und nicht zuletzt für das ungeahnte Wissen, das die Schwarmintelligenz zutage förderte, war die unverzichtbare Grundlage unser Verein Feministische Medizin, den ich 2020 zusammen mit anderen kritischen Menschen aus dem Gesundheitssystem gegründet habe. Der Verein und vor allem die tollen Menschen, die ihn ausmachen, haben mir den nötigen Mut gegeben, meine feministischen Überzeugungen nicht länger aus dem Medizinkontext herauszuhalten, zu lange biss ich mir auf die Zunge und nickte freundlich – damit ist jetzt Schluss. Denn krank machende Verhältnisse zu bekämpfen, ist die beste Gesundheitsprävention, und Feminismus ist die beste Medizin in einem diskriminierenden System.
Um das zu belegen und zu veranschaulichen, habe ich in diesem Buch wissenschaftliche Erkenntnisse und feministische Konzepte versammelt, viele traurige »Fun Facts« und Expert*innenstimmen. Ich möchte nicht nur Zahlen nennen (was manchen vielleicht zu trocken wäre), sondern auch Geschichten erzählen (was andere vielleicht zu unsachlich finden). Beide Wissensformen haben ihre Berechtigung und ergänzen sich gegenseitig. Schließlich sind es oft Geschichten, die von immer mehr Menschen erzählt werden, Erfahrungen, die von immer mehr Menschen geteilt werden, die zur Erhebung von Daten und Untersuchungen von Zusammenhängen führen. Wo ich eigene Erfahrungen habe, erzähle ich von ihnen, wo nicht, möchte ich Betroffene zu Wort kommen lassen oder erzähle aus beobachtender Perspektive. Dabei ist der Grat zwischen solidarischer Thematisierung und Aneignung sicherlich manchmal sehr schmal. Denn manche Formen der Diskriminierung erlebe ich selbst, andere betreffen mich nicht.
Ich schreibe aus der Perspektive einer queeren, von außen meist weiblich gelesenen Person mit chronischer Erkrankung, die aus einem nicht-akademischen ostdeutschen Familienhintergrund kommt. Gleichzeitig bin ich privilegiert unter anderem als junge, weiße Person, die einen Universitätsabschluss machen durfte und einen deutschen Pass hat. Sicherlich werde ich beim Schreiben nicht alles richtig machen und möchte im Buch auch reflektieren, an welchen Stellen ich Teil des Problems, weil Teil des Systems bin. Ich beanspruche nicht, stellvertretend für andere Betroffene zu sprechen, und erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn ich von Medizin und Gesundheitssystem spreche, beziehe ich mich vor allem auf Daten und Diskurse aus dem deutschsprachigen Raum, wo nötig, greife ich auf Studien aus anderen Ländern zurück. Dass es dabei hauptsächlich um die sogenannte »westliche Schulmedizin« geht, liegt schlicht daran, dass ich in diesem System fachlich ausgebildet (und sozialisiert) wurde und meine Einblicke dementsprechend aus diesem Bereich stammen. Das soll aber nicht heißen, dass dieses System das einzig nennenswerte oder richtige wäre, um mit Krankheit umzugehen – im Gegenteil. Bei all seinen Errungenschaften für unsere Gesundheit soll es ja um einen kritischen Blick auf die negativen Seiten ebendieses Systems gehen. Verschiedene Systeme zu vergleichen, hätte wohl leider den Rahmen gesprengt, und natürlich gibt es noch viele weitere Zusammenhänge und Formen der Diskriminierung, wie etwa Alters- oder Gewichtsdiskriminierung, auf die ich nicht genauer eingehe.
Eine kurze Triggerwarnung möchte ich aussprechen, an vielen Stellen geht es um schwierige Themen wie Menschenfeindlichkeit, Gewalt, Selbstmord und Tod. Passt beim Lesen gut auf euch auf und sprecht mit jemandem darüber, wenn alte oder aktuelle Traumata hochkommen. Auch ich brauchte beim Schreiben ab und zu ein wenig Abstand von einer deprimierenden Datenlage. Insgesamt hat mir aber die Arbeit am Buch viel Freude bereitet und vor allem einen Sinn gegeben, um während meiner langen und bis heute andauernden Post- Covid-Erkrankung nicht den Mut zu verlieren. Gleichzeitig hat genau diese Erkrankung inklusive Brain Fog und anfänglichen Kopfschmerzen das Schreiben manchmal sehr herausfordernd gestaltet. Umso froher bin ich, nach all der langen Zeit nun diesen Text mit euch, liebe Lesende, teilen zu können. Ich hoffe sehr, dass dieses Buch Diskussionen anstößt, Debatten anregt, dass wir ins Reden und dann vor allem ins Handeln kommen.
1. Hierarchie und Heilkunde
Die Urenkel*innen der Hexen
»Die feministische Agenda ermutigt Frauen dazu, ihreEhemänner zu verlassen, ihre Kinder zu töten, Hexerei zupraktizieren, den Kapitalismus zu zerstören und lesbisch zu werden.«1
Pat Robertson
Auf einer ärztlichen Fortbildung für Geburtshilfe unterhielt ich mich beim Small Talk in der Pause mit einer Kollegin. Ich erzählte ihr, das viele Namedropping von ausschließlich cis männlichen Professoren und deren Erfindungen und Entdeckungen ärgere mich an der Fortbildung. Vor allem, wenn es um Uterus, Eierstöcke und Co. geht, kommt es mir immer so befremdlich vor, wie in Power-Point-Präsentationen Bilder von bärtigen Männern, von Menschen ohne Uterus, auftauchen, die bis heute als die ursprünglichen Experten für Geburt zelebriert werden. Es erinnert mich an das Bild der ehemaligen Chefärzte der Klinik für Geburtshilfe auf dem Flur vor dem Kreißsaal in der Charité: ein Mosaik aus ebenso aussehenden Männern, die ersten noch als Schwarz-Weiß-Bilder, später in Farbe. Meine Kollegin blickte mich nach meinem Kommentar ungläubig an und erwiderte, dass die Geburtshilfe ja nun einmal ein klassisch männlicher Beruf sei, unter anderem, weil Frauen körperlich nicht stark genug dafür sind. Mir sind fast die Catering-Häppchen aus dem Mund gefallen, derart schockiert muss ich sie angeschaut haben. Aber vielleicht sollte es mich gar nicht so sehr überraschen, diese internalisierte Misogynie aus dem Mund einer jungen Ärztin zu hören. Schließlich gibt sie nur wieder, was ihr und mir beigebracht wurde: Medizin ist männlich.
Macht und Medizinelite
Die Machtverteilung in der Medizin folgt immer noch klassistischen und elitären Prinzipien. Wer heute das Sagen über unsere Gesundheit hat, ist meist weiß, cis-männlich, heterosexuell, nicht-behindert und finanziell privilegiert. In Gesundheitsberufen machen Frauen zwar 75 Prozent der Beschäftigten aus, Entscheidungsträgerinnen sind aber nur ein Bruchteil von ihnen.2 Sie arbeiten besonders häufig in den schlechter bezahlten und weniger anerkannten Jobs wie der Pflege, während die besser bezahlten ärztlichen Stellen eher männlich besetzt sind, vor allem je weiter oben in der Hierarchie wir nachschauen.2 An den 35 deutschen Universitätskliniken sind die Führungspositionen der Lehrstühle, Klinikdirektionen und Abteilungsleitungen durchschnittlich nur zu 13 Prozent von Frauen besetzt, in Würzburg, Magdeburg und Homburg beträgt der Frauenanteil in Spitzenpositionen sogar sagenhafte 0 Prozent. Das fand eine Studie des Deutschen Ärztinnenbundes 2019 heraus. »Aktuell wird durch die Besetzung von 87 Prozent der Führungspositionen durch Männer die klinische universitäre Medizin von Männern geprägt. In diesen Führungspositionen werden therapeutische Konzepte, medizinische Meinungsbildungen, Strategien in der studentischen Lehre, Personalpolitik, Außendarstellung usw. gestaltet«3 heißt es in der Studie. In kaum einer Disziplin ist die Diskrepanz zwischen dem Frauenanteil unter Studierenden gegenüber dem in Führungspositionen so stark wie in der Medizin.4 Dazu erklärt Mattis Manke, Bundeskoordinator für medizinische Ausbildung in der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland (bvmd), in einem Interview: »Studentinnen werden auch in Forschung und Lehre durch männliche Gatekeeper unbewusst benachteiligt: Schlüsselpositionen in Wissenschaftsredaktionen sind hauptsächlich von Männern besetzt, die wiederum Männer fördern.«5
Ich erinnere mich noch gut an meinen allerersten medizinischen Fachkongress, den ich 2018 besucht habe. Als Student*in durfte ich erste eigene Forschungsdaten, die ich für meine Doktorarbeit gesammelt hatte, bei einem kurzen Vortrag vorstellen. Auf der Tagung trifft sich regelmäßig die Szene der Gynäkologie und Geburtshilfe, um sich fachlich auszutauschen und zu vernetzen. Meine Aufregung war groß, einige Namen aus dem Programm waren mir aus dem Studium und Fachartikeln bekannt, ich stellte mir vor, wie sich wichtige Menschen aus der Fachwelt vielleicht für meine Forschungsdaten interessieren könnten. Im Laufe des Kongresses wurde mir klar, dass alles etwas anders war, als ich es mir so idealistisch vorgestellt hatte. Damals kannte ich das Wort noch nicht, aber ich machte beim Anblick der Podiumsdiskussionen das erste Mal Bekanntschaft mit »Manels« – also Panels, die ausschließlich mit Männern besetzt sind. Ich weiß nicht, warum ich so überrascht war, schließlich sah es in den Hörsälen an der Uni ähnlieh aus – fast immer sind es ältere weiße Männer, die Fachwissen vermitteln. Aber hier, wo sie nebeneinander aufgereiht saßen, fiel mir diese Einseitigkeit plötzlich sehr auf. Dass seit Jahren diese Art von Kongressen immer wieder genau so aussehen, wird gern mit dem Argument gerechtfertigt, es gebe eben nicht genug kompetente Expertinnen, die eingeladen werden könnten. Mandy Mangler, eine der wenigen Chefärztinnen in Deutschland, hatte irgendwann genug von dieser immer gleichen Ausrede für die Unterrepräsentation von Frauen in der medizinischen Fachwelt. Darum organisierte sie 2021 kurzerhand selbst einen Kongress zu gynäkologischen Krebserkrankungen – mit ausschließlich weiblichen Referentinnen. Mit der 100-prozentigen Frauenquote wollte sie ein Zeichen setzen und zeigen: »Es gibt so viele hochqualifizierte Frauen.«6
Wäre der erste Kongress, an dem ich teilnahm, auch so organisiert gewesen, wären mehr Menschen wie Mangler involviert gewesen, wäre ich wahrscheinlich nicht mit einem so unguten Gefühl nach Hause gegangen. Insbesondere ein Seminar für Studierende und Berufsanfänger*innen hinterließ bei mir einen faden Beigeschmack. Der Referent sprach sehr ausführlich über die »Feminisierung der Medizin«, aus seiner Sicht ein großes Problem. Eine weitere der vielen impliziten Stimmen, dass Frauen in der Medizin nichts zu suchen haben. Ich hatte das Gefühl, mir wurde, schon bevor ich überhaupt in den Beruf eingetreten bin, signalisiert: Ich bin unerwünscht, ich gehöre dort nicht hin. Und warum? Weil ich als Mensch mit Uterus später »zum Problem« werden könnte, zumindest aus Arbeitgeber*innensicht. Dieses Gefühl verstärkte sich später bei der Jobsuche. Vor fast ausschließlich männlichen Chefärzten saß ich in den Vorstellungsgesprächen; neben übergriffigen Kommentaren zu meinem Lächeln oder Outfit und unangemessenen Fragen zu meinem Privatleben und Beziehungsstatus kam auch immer wieder der Hinweis: ich sei leider ein Risiko, weil ich ausfallen würde, wenn ich schwanger werde. Ich habe gelernt, in solchen Situationen freundlich zu lächeln und das innere »WTF?!« zu ignorieren. Später aber, je mehr ich darüber nachdachte, desto wütender wurde ich. All die harte Arbeit, all das jahrelange Lernen, Wiederholen, Üben, Untersuchen, Pipettieren, Wiederholen, Aufzeichnen, Mitschreiben, Wiederholen, Präparieren, Nachfragen, Wiederholen, Vorbereiten, Nachbereiten, Wiederholen ... all die Leistungen meines Gehirns sind am Ende doch nie ganz so viel wert, weil ich einen Uterus habe. Zumindest war das die Botschaft, die mir meine potenziellen Vorgesetzten vermittelten. Die Studierendeninitiative Kritische Medizin München schreibt dazu: »Die Ursache für den Mangel an Ärztinnen im Krankenhaus liegt (…) nicht in ihrem fehlenden Interesse an dem Beruf. Stattdessen begegnen sie tagtäglich einem hierarchischen und patriarchalen Berufsalltag. (…) Die Forderung nach einer Work-Life- Balance und die Absage an eine 90-Stunden-Woche sind weder neu, revolutionär noch frauenspezifisch.«4 Nebenbei bemerkt, sind unsere Arbeitsbedingungen für menschliche Körper egal welchen Geschlechts unzumutbar, so geht zum Beispiel die Einführung von 24-Stunden-Schichten auf einen Arzt zurück, der nur deshalb so lang am Stück arbeiten und wach bleiben konnte, weil er kokainabhängig war.7
Aber nicht nur in der Wahrnehmung der Männer in Machtpositionen gehört neben ihnen niemand in den ärztlichen Beruf. Diese Denkweise ist mir auch bei Patient*innen und außerhalb des Gesundheitssystems begegnet. Da sind die vielen Male, die ein Praktikant oder Student bei der Visite für den Arzt gehalten wird, während die danebenstehende Oberärztin gar nicht beachtet wird. Oder die zahlreichen Gespräche, bei denen ich mich bei Patient*innen als Ärzt*in vorstellte und am Ende der Untersuchung doch wieder von ihnen gefragt wurde, wann denn nun eigentlich der Arzt kommt. Weil sie mich als weiblich wahrnehmen, wirke ich automatisch weniger kompetent. »Ich habe hier schon eine Woche lang keinen Arzt gesehen«, sagte ein älterer Patient einmal zu einer Stationsärztin; als diese ihm sagte, sie selbst sei die Ärztin, lachten er und seine Angehörige nur.8 Oder da ist die Geschichte von meinem Nachbarn, der nachts gern laut Techno hört. Als ich genervt bei ihm klingelte, um ihn zu bitten, die Musik leiser zu machen, denn ich müsste früh aufstehen, um im Krankenhaus zu arbeiten, entgegnete er nur, er wusste nicht, dass ich Krankenschwester bin. Es scheint noch nicht in unserem gesellschaftlichen Bild angekommen zu sein, dass inzwischen knapp die Hälfte des derzeit arbeitenden ärztlichen Personals nicht männlich ist, Tendenz steigend.9
Die Auslöschung der »anderen«
Männer scheinen also heutzutage noch die Hoheit über Gesundheit zu haben, einflussreiche Positionen sind weiterhin meist von ihnen besetzt, wie in so vielen Berufen. Im Patriarchat ist das vielleicht nicht überraschend. Die Besonderheit bei der Medizin ist, dass das vorherrschende Machtgefälle kein bloßes Nebenprodukt gesellschaftlicher Strukturen ist. Schauen wir uns an, wie der ärztliche Beruf historisch entstanden ist, wie die Medizin professionalisiert wurde, dann wird klar: Medizin war immer eng verknüpft mit Hierarchie und Machtpolitik, sie hat eine aktive Rolle in der Etablierung und Aufrechterhaltung von Unterdrückungssystemen gespielt. Die Entstehung der sogenannten »westlichen« Medizin, wie wir sie heute kennen, fällt in die Zeit der europäischen Hexenverfolgungen und des Kolonialismus, was alles andere als ein Zufall ist.
Die Autorin und Aktivistin Barbara Ehrenreich und die Journalistin Deirdre English erzählen in ihrem Buch Hexen, Hebammen und Krankenschwestern: The Witches Are Back10 vom Zusammenhang zwischen Hexen und Heilen. Wir kennen die Geschichte aus Sicht der Hexen nicht, merken sie an, sondern nur aus den Berichten ihrer Verfolger und Folterer, denn sie sind es, die zur Wissenselite gehörten, sie und ihre Version der Geschichte sind es, die überlebt haben. Und selbst die heutige Sicht ist je nach Perspektive anders gefärbt: Historikerinnen weisen darauf hin, wie unsäglich und scherzhaft ihre männlichen Kollegen teils an das Thema herangehen – als ginge es nicht um einen gewaltvollen Massenmord an marginalisierten Menschen.10 Was wir jedenfalls aus dieser Zeit wissen, ist Folgendes:
Vom 14. bis ins 18. Jahrhundert, also noch bis in die Anfänge der Aufklärung hinein, wurden in Europa Menschen verfolgt, festgenommen, erniedrigt, gefoltert, verurteilt und hingerichtet, die als Hexen oder Hexer bezeichnet wurden. Die Definitionsmacht, wer in diese Kategorie fiel, sowie die Finanzierung und Organisation lagen in den Händen einer engen Kooperation aus Kirche und Herrschaftsklasse.10 Als Grundlage für Verdächtigungen und Verurteilungen galt das Buch Malleus Maleficarum, auch der Hexenhammer genannt, in dem 1484 von den Inquisitoren Heinrich Kramer und Jakob Sprenger detailliert benannt wurde, wer als Hexe*r galt und wie der Prozess und die Exekution abzulaufen hatten. Die Verdächtigten wurden festgenommen, dann meist nackt ausgezogen und am ganzen Körper rasiert, teils vergewaltigt, worauf verschiedene Foltermethoden folgten, die letztendlich Geständnisse herbeiführten, wenn die Folter nicht schon zum Tod geführt hatte.10 Die Beschuldigten wurden anschließend öffentlich lebendig verbrannt oder erhängt. Insgesamt wird von 50 000 bis 100 000 Opfern ausgegangen, nicht eingerechnet die, die bei der Folter starben, sich selbst das Leben nahmen oder gelyncht wurden.
In Relation zu den damaligen Bevölkerungszahlen sind die Todeszahlen enorm, teils wurden ganze Familien ausgelöscht. Circa 80 – 85 Prozent der so ermordeten Menschen waren cis Frauen, insbesondere solche, die sich nicht der ihnen zugedachten sozialen Rolle fügten. Besonders Frauen, die nicht nur allein dachten, sondern auch selbstständig lebten und handelten, fielen den Hexenverfolgungen zum Opfer. »Einem Nachbar Widerworte zu geben, laut zu sprechen, einen starken Charakter oder eine freizügige Sexualität zu haben oder irgendwie ein Störenfried zu sein, reichte schon, um sich in Gefahr zu bringen.«11 Das schreibt die Autorin und Chefredakteurin der französischen Zeitung Le Monde diplomatique, Mona Chollet, in ihrem Buch Hexen – die unbesiegte Macht der Frauen. Als eine Art mittelalterliches Slutshaming bezogen sich Beschuldigungen häufig auf körperliche Selbstbestimmung und Sexualität, die jenseits von ehelicher Pflichterfüllung und dem Zweck der Fortpflanzung gelebt wurde.12 Sexuelle Lust musste christlichen Vorstellungen zufolge zwangsläufig von einem Bündnis (und Sex) mit dem Teufel herrühren.10 Wer sich dem System nicht fügte, wurde gewaltsam aussortiert. Die Massenermordung von als eigenwillig empfundenen Frauen war ein politisches Mittel, mit dem die Machthabenden ihre Stellung im patriarchalen System sicherten.12
Beim Lesen der grausamen Praktiken und der rechtfertigenden Logik dahinter fühle ich mich ein wenig an die aktuellen Daten zu Femiziden erinnert, auf die Aktivist*innen immer wieder versuchen aufmerksam zu machen. Von »Beziehungstaten« und, wie auch bei rassistischen Morden, »Einzelfällen« ist die Rede, wenn ein Mann seine (Ex-)Partnerin auf gewaltsame Weise tötet, weil diese sich von ihm trennt, sich seinem Besitz entzieht. Der Deutsche Juristinnenbund sieht eine eindeutige Systematik in dieser Art und Weise, auf die rund jeden dritten Tag in Deutschland eine Frau ums Leben kommt.13 Die Anerkennung von Femiziden und ihre Aufnahme in Kriminalstatistiken wird seit Jahren von Feminist*innen gefordert, bisher ohne Erfolg. Das Aussortieren, das Auslöschen, das brutale Ermorden insbesondere von weiblich verorteten Personen, die entgegen der Logik der Unterwürfigkeit gegenüber (Ehe-) Männern handeln, ist heute privatisierter, als es zur Zeit der Hexenverfolgungen war.
Selbstbestimmung unerwünscht
So weit, so sexistisch. Aber was hat das alles mit Medizin zu tun? Ein wichtiger weiterer Grund, damals als Hexe*r verdächtigt zu werden, war die Fähigkeit, zu heilen. Die Linderung von Krankheiten war nach damaliger Logik Hexerei, denn Erkrankungen galten als Strafe Gottes für Sünden, und nur wer mit dem Teufel verbündet ist, könnte sich darüber hinwegsetzen.10 Laienheiler*innen und weise Alte waren vor allem in der armen Bevölkerung für die Versorgung von Wunden, Fieber und Infektionen zuständig, von manchen schon damals entdeckten Heilpflanzen wie dem Fingerhut wird noch heute Gebrauch gemacht.10,12 Vor allem die Versorgung von Schwangeren und Gebärenden übernahmen erfahrene Frauen aus den Gemeinschaften, sie betreuten Geburten und Fehlgeburten, und wenn gewünscht, teilten sie ihr Wissen über Abtreibungen und Verhütungsmethoden.11 Sie ermöglichten die reproduktive Selbstbestimmung der Arbeiter*innen und waren damit Kirche und Staat ein besonderer Dorn im Auge. »Niemand schadet dem katholischen Glauben mehr als die Hebammen«14, heißt es im Hexenhammer, und den verfolgten Hebammen wurde vorgeworfen, Babys dem Teufel zu opfern. Der Kampf gegen Abtreibungen und jene, die sie ermöglichen, ist so alt wie die Praktiken der reproduktiven Selbstbestimmung selbst. Menschen, die schwanger werden können, haben schon immer Abtreibungen gehabt und werden sie immer haben, nur der gesellschaftliche Umgang und die Rahmenbedingungen ändern sich von Zeit zu Zeit. Die Abtreibungsgegner*innen von heute haben noch immer den Staat im Rücken, veraltete Paragrafen auf ihrer Seite, und die systematische Einschüchterung ist weiterhin von Fanatismus und Feindseligkeit geprägt, wenn auch die Mittel und Methoden weit weniger brutal sind als zu Zeiten der Hexenverfolgung. Menschen Entscheidungen über ihren Körper, ihre Sexualität und Reproduktion zuzutrauen und zuzugestehen, ist bis heute nicht selbstverständlich.
»Dafür, dass wir in Deutschland heute im Gegensatz zum Mittelalter Zugang zu Informationen und alle Möglichkeiten haben, um Abbrüche sicher und unkompliziert durchzuführen, ist es ziemlich schlimm, was wir derzeit rund um Schwangerschaftsabbrüche erleben«15, findet Sibel Schick. Die Autorin, Journalistin und Podcasterin hat selbst miterlebt, wie der bis heute erschwerte Zugang zu selbstbestimmten Abtreibungen mitunter sogar lebensgefährlich für Menschen mit Uterus werden kann. »Ich wurde ungewollt schwanger und bin fast daran gestorben«16, schreibt sie über ihre Erfahrung mit dem deutschen Gesundheitssystem. Sie berichtete in den sozialen Medien, wie ihre ungewollte Schwangerschaft eine beidseitige Lungenembolie bei ihr auslöste – ein lebensbedrohlicher Zustand. Sie musste aber die schmerzliche Erfahrung machen, dass der Gesundheit des Embryos gegenüber ihrer eigenen Gesundheit von den behandelnden Ärzt*innen Vorrang gegeben wurde. »Meine Stimme wurde nicht gehört, ich hatte das Gefühl, dass eine Lebensgefahr in Kauf genommen wurde«16, schreibt Schick. »Natürlich wusste ich aufgrund meiner Arbeit als feministische Autorin, dass die gesamte Situation rund um Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland total entmündigend ist. Das aber auf dieser persönlichen Ebene zu erleben, war schockierend. Normalerweise fällt es mir nicht schwer, wütend zu werden, doch in diesem Moment fühlte ich mich ohnmächtig. Ich dachte ›Passiert das gerade wirklich?‹ – ›Bin ich hier in einem dystopischen Sci-Fi?‹ – ›Wo bin ich gelandet?‹«,15 erzählt sie später in einem Interview. Dort berichtet sie von ihrem Eindruck, dass ihre behandelnden Ärzt*innen auch deshalb so zurückhaltend in der angemessenen medizinischen Behandlung waren, weil sie rechtliche Konsequenzen fürchteten. »Ich finde es bezeichnend, dass selbst hochqualifizierte, supermodern erscheinende, junge Mediziner*innen total verunsichert wirken, wenn es um Schwangerschaftsabbrüche geht.«15
Damit spricht sie ein wichtiges Problem an, das vielen nicht bewusst ist: Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland illegal. Die aktuelle Regelung im Strafgesetzbuch stammt aus der Zeit des Deutschen Reichs aus dem Jahr 1871. Während Abtreibungen in der DDR weitestgehend legalisiert waren,17 besteht im wiedervereinten Deutschland bis heute eine gesetzlich geregelte Zugangsbeschränkung zu Abtreibungen. Sind bestimmte Bedingungen erfüllt, bleiben sie zwar straffrei, aber die Durchführung ist für Betroffene und ihre Ärzt*innen durch die rechtliche Situation stark erschwert. Das ging bis vor Kurzem so weit, dass Ärzt*innen, die Abtreibungen durchführten, neben der Belästigung von Abtreibungsgegner*innen auch dem Risiko ausgesetzt waren, angezeigt zu werden, wenn sie sachliche Informationen zum Thema auf ihrer Website zur Verfügung stellten. So erging es der Gießener Ärztin Kristina Hänel, die 2018 wegen »Werbung« für den Abbruch einer Schwangerschaft nach Strafgesetzbuch angezeigt und verurteilt wurde. Das ließ die Allgemeinmedizinerin aber nicht auf sich sitzen. Sie wehrte sich medienwirksam gegen die absurde Rechtslage, hielt Vorträge und Reden, schrieb ein Buch, wurde überregional bekannt und erfuhr große Solidarität. Sie sitzt heute im Beirat der Doctors for Choice Germany, die sich ehrenamtlich für einen selbstbestimmten Umgang mit Sexualität, Fortpflanzung und Familienplanung einsetzen. Der Verein ist ein Schwester-Verein der Medical Students for Choice, die Seminare für Studierende organisieren. Denn nicht nur wird Ärzt*innen wie Hänel die Durchführung von Abbrüchen schwer gemacht; die Problematik beginnt schon früher, nämlich in der medizinischen Ausbildung. Da wird so getan, als würden Schwangerschaftsabbrüche schlicht nicht existieren. Die medizinischen Aspekte werden kaum unterrichtet, was dazu führt, dass ärztliches Personal nicht auf Schwangerschaftsabbrüche vorbereitet oder befähigt wird, zumindest nicht innerhalb des offiziellen Lehrplans.
Ich erinnere mich noch, wie ich zusammen mit einer Freundin und einer Papaya in der Tasche abends einen Seminarraum auf dem Unigelände betrat, der gefüllt war mit Ärztinnen und Studierenden, die ihre Freizeit damit verbrachten, diese große Informationslücke der medizinischen Ausbildung zu füllen. In diesem Papaya-Workshop wurde mithilfe dieser Frucht die konkrete Handhabung einer der möglichen Vorgehensweisen bei einem Schwangerschaftsabbruch geübt und mit vielen Mythen, die selbst unter Mediziner*innen verbreitet sind, aufgeräumt. Vor Ort war auch Alicia Baier, die Gründerin dieser Gruppe nach internationalem Vorbild. »If you can’t trust me with a choice, how can you trust me with a child?«18, wird auf ihrer Website mit einem Zitat der Autorin Gayle Forman die Pro-Choice-Einstellung der Gruppierung treffend zusammengefasst. Wenn ihr mir keine Entscheidung zutraut, wie könnt ihr mir ein Kind zutrauen? Baier ist inzwischen Ärztin, Mitbegründerin der Doctors for Choice Germany und wie Hänel eine wichtige Stimme im Kampf um Selbstbestimmung.
Im Jahr 2022 bekam ich am 24. Juni eine Nachricht von einer Freundin und Vereinsmitstreiterin: »219a ist weg!«, gefolgt von zwei Sektgläser-Emojis. Damit meinte sie, dass nach jahrzehntelangem Kampf endlich der aus dem Jahr 1933 stammende Paragraf zur »Werbung« für Abtreibung, nach dem Kristina Hänel und so viele andere angeklagt wurden, vom Deutschen Bundestag abgeschafft wurde. Ein unglaublicher historischer Tag für alle, die sich über die Jahre unermüdlich für Selbstbestimmung und gegen geltendes Recht eingesetzt hatten. Wir waren in Feierstimmung, denn endlich würden Ärzt*innen nicht mehr dafür kriminalisiert werden, dass sie ungewollt Schwangeren medizinische Informationen zukommen ließen. Leider hielt die Freude nicht lang an, denn noch am gleichen Tag wurde am anderen Ende der Welt, in den USA, das Abtreibungsrecht drastisch eingeschränkt, indem ein Grundsatzurteil vom Obersten Gerichtshof gekippt wurde. Was für ein surrealer Zustand. »Die letzten Tage haben gezeigt, wie fragil feministische Errungenschaften sind. Und wie wichtig es ist, dranzubleiben, zu informieren, zu diskutieren, zu protestieren, laut und solidarisch zu sein – über Grenzen hinweg«,19 schrieb eine Freundin für unseren Verein in den sozialen Medien. Und auch hierzulande geht der Kampf um Selbstbestimmung weiter, denn: »... unter Paragraf 218 StGB sind Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland weiterhin nicht legal. Von den Krankenkassen werden sie nicht bezahlt. Es gibt weiterhin viel zu wenig Ärzt*innen, die Abbrüche durchführen – und es werden immer weniger.«19 Feminist*innen kämpfen weiter und fordern unermüdlich: »Mein Körper, meine Entscheidung!« Das bedeutet: Es geht um körperliche Selbstbestimmung, um das Recht, gut und umfassend informiert zu sein und daraus eine eigene Entscheidung abzuleiten, es geht um das Recht, die Wahl zu haben. Das Recht, Kinder bekommen zu können, genauso wie um das Recht, keine Kinder haben zu wollen. Das Recht, die eigene Sexualität zu leben, ohne stigmatisiert zu werden. Das Recht, den eigenen Körper in dieser Welt Raum einnehmen zu lassen und ihn zu umsorgen, ihn jenseits von Normen präsentieren zu wollen oder ihn bedecken zu wollen. Das wird nicht nur durch veraltete Gesetze erschwert, sondern auch durch veraltete Weltanschauungen und Rollenzuschreibungen.
Noch heute haben auch religiöse Vorstellungen einen gewissen Einfluss darauf, reproduktive Selbstbestimmung einzuschränken. In Kliniken mit christlichem Träger werden beispielsweise keine Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Als angestellte*r Ärzt*in muss ich ungewollt Schwangere abweisen und ihnen meine medizinische Hilfe verwehren. Eine Kollegin berichtet mir aus ähnlichen Situationen in der Psychiatrie, wo auch sie oft vor einem Dilemma der Unvereinbarkeit der christlichen Vorstellungen des Klinik-Trägers mit ihrem medizinisch notwendigen Handeln steht. Zum Beispiel wenn eine Patientin in einem manischen oder psychotischen Zustand ungeschützten Sex hatte und sie von ärztlicher Seite die (äußerst zeitsensible) »Pille danach« nicht erhalten darf, um eine ungeplante, ungewollte Schwangerschaft zu verhindern.
(In)kompetente Konkurrenz
Natürlich war der Einfluss der Kirche zur Zeit der Verfolgung von Hebammen als Hexen weitaus größer als heute, es ging um viel Macht und noch mehr um deren Erhalt. Das Monopol des Eingreifens in den Körper und die Gesundheit sollte in der Hand dieser mächtigen Institution bleiben. Denn allzu unterschiedlich waren die Naturheilmittel, die Laienheiler*innen verwendeten, nicht von denen, die in den Klostergärten nach dem Vorbild von Nonnen wie Hildegard von Bingen hergestellt wurden. Aber während die einen außerhalb der Klostermauern als Hexen verfolgt wurden, waren die anderen religiös legitimiert in ihrem Tun. »Die einen sammelten draußen in der Natur, was die anderen in den Kräutergärten ihrer Klöster anbauten«,20 schreibt der Arzt Dietrich Grönemeyer dazu. Er stellt die gleiche Überlegung an, die sich auch bei Barbara Ehrenreich und Deirdre English findet: »Fürchtete der Klerus zum ausgehenden Mittelalter schlichtweg um seine Vormachtstellung im Gesundheitswesen, bei der ›Behandlung‹ der Menschen? Ging er deshalb so erbarmungslos gegen diejenigen vor, die ihm frei praktizierend ins medizinische Handwerk pfuschten? Betrachten wir die düstere Geschichte der Hexenverfolgung einmal aus dem Blickwinkel patriarchalischer Dominanz und betriebswirtschaftlichen Eigennutzes – könnte es nicht sein, dass es auch hier um Macht, Konkurrenzkampf und Eitelkeiten ging?«20
Wer behandeln und heilen darf, war und ist politisch. Denn es ging und geht um nichts Geringeres als die Gesundheit, um Definitionsmacht, um biologistische Rechtfertigungen für Diskriminierung, um die Entscheidungshoheit darüber, »wer leben und wer sterben darf, wer fruchtbar und wer unfruchtbar, wer ›verrückt‹ und wer normal ist«,10 wie Ehrenreich und English schreiben. Während Frauen systematisch verfolgt und ermordet wurden, wenn sie Menschen bei gesundheitlichen Fragen berieten und behandelten, wurde ebendieses Gebiet ab dem 13. Jahrhundert von gut gestellten Männern erschlossen und institutionalisiert. Zwar hatte es schon Universitäten gegeben, die gelehrte Frauen wie Trota von Salerno hervorbrachten. Sie hatte im 12. Jahrhundert ein Standardwerk der Gynäkologie herausgegeben, welches später einem Mann zugeschrieben wurde.11 Ab dem 14. Jahrhundert aber, im Zuge der Hexenverfolgungen und im Laufe der Geschichte, wurden lange Zeit alle, die keine Männer waren, aus der institutionalisierten Heilkunde verb(r)annt.12 »Die westliche Medizin ist ein System der Macht – eines, das über seine lange Geschichte hinweg immer männliches Wissen und Expertise bevorzugt hat.«12 So beschreibt es die Kulturwissenschaftlerin und Autorin Elinor Cleghorn in ihrem medizinhistorischen Buch Die kranke Frau: Wie Sexismus, Mythen und Fehldiagnosen die Medizin bis heute beeinflussen. Und Mona Chollet schreibt: »Die Medizin scheint tatsächlich eine bedeutende Bühne für die Austragung dieses Krieges der modernen Wissenschaft gegen die Frauen gewesen zu sein. Die Medizin, wie wir sie kennen, beruht auf körperlicher Auslöschung.«11
Der ärztliche Beruf entstand, während das Talent und Wissen der Frauen, die sich nicht der ihnen vorgeschriebenen Rolle fügten, ausradiert wurden. »Vor allem die moderne Medizin baute auf (…) dem direkten Bezug zu Hexenverfolgungen auf, die den damaligen offiziellen Ärzten erlaubten, die Konkurrenz der Heilerinnen auszuschalten – die im Allgemeinen kompetenter waren als sie«,11 so Chollet. Damit bezieht sie sich auf die Anfänge der sogenannten »westlichen« Medizin, die alles andere als wissenschaftlich waren. Die damals entwickelten Therapien und verbreiteten Praktiken beruhten auf religiösen Überzeugungen,12 sie waren aber meist nicht sonderlich gut für die Gesundheit der Menschen, oder schadeten sogar. So etwa die Therapie für Epilepsie, die noch in den 1860er-Jahren praktiziert wurde: Weil ein führender Gynäkologe davon ausging, Masturbation entziehe dem Gehirn Energie und führe zu Krampfanfällen, führte er die chirurgische Entfernung der Klitoris als Therapieform (und zugleich als Erziehungsmaßnahme gegen sexuelle Selbstbefriedigung) ein.12 Eines der grausameren Beispiele für misogynes medizinisches »Wissen«, das sich als schlichtweg falsch herausstellte. Über die meisten damaligen Therapien können wir heute nur noch den Kopf schütteln. Der Datenjournalist Tin Fischer schreibt über die Anfänge der »modernen« Medizin: »In vielen Fällen entpuppten sich die Pillen und Säfte später, mit robusteren Tests, als wirkungslos.«21 Das Unwissen der ersten Generationen von Ärzten wurde vor allem in der Geburtshilfe sichtbar. »In unheilverkündender Ironie hatten sich die Ärzte und Chirurgen der Hebammen entledigt und beschuldigten sie insbesondere der Unreinheit«,11 schreibt Mona Chollet. Dabei waren es die Mediziner selbst, die mit ungewaschenen Händen aus dem Leichensaal kamen, um die Gebärenden zu untersuchen. Darum starben im 17. und 18. Jahrhundert bis zu einem Viertel der Frauen bei der Geburt durch eine Wochenbett-Sepsis, ausgelöst durch Bakterien, die von den ärztlichen Händen in die Geburtswunden eindrangen.11 »Männliche Ärzte waren sowohl gefährlicher als auch weniger effektiv gegenüber weiblichen Laienheilerinnen«,22 resümieren Barbara Ehrenreich und Deirdre English. Und Fischer schreibt in Bezug auf die neu entstandene »Wissenschaft«: »Die kurierende Medizin dürfte bis zur Einführung standardisierter statistischer Testverfahren in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kaum etwas zum Anstieg der Lebenserwartung beigetragen haben.«21
In der Vergangenheit hat die aufkommende »moderne« Medizin äußerst unwissenschaftlich dafür gesorgt, Annahmen zu zementieren, deren Nachhall bis heute durch rechte Internetforen und Chatgruppen geistert und die leider teils auch in der Wissenschaft noch auftauchen. Die Annahme zum Bespiel, cis Frauen seien inhärent defizitär, körperlich und intellektuell unterlegen gegenüber cis Männern. »In der Medizin sind noch heute alle Aspekte der zur Zeit der Hexenverfolgung entstandenen Wissenschaften auffallend konzentriert erkennbar: ein aggressiver Eroberergeist und Frauenhass; der Glaube an die Allmacht der Wissenschaft und derjenigen, die sie ausüben«,11 so Mona Chollet. Noch heute wird der mittelalterliche Konflikt zwischen Ärzt*innen und Hebammen ausgetragen,23 und noch heute scheint so mancher Arzt der Geburtshilfe die empfundene Konkurrenz durch Hebammen kleinhalten zu wollen.
Bei meinem besagten ersten gynäkologischen Kongress mit all den männlichen Experten, die über Frauengesundheit sprachen, gab es auch einen Vortrag zum Thema Akademisierung des Hebammenberufs. Der Referent Christian Albring, Präsident des Berufsverbands der Frauenärzte, sprach sich stark gegen ein Studium der Hebammenwissenschaften aus, von einer Arbeit auf Augenhöhe könne keine Rede sein, so Albring. Nur Ärzte könnten eine gute Versorgung für Schwangere gewährleisten, hieß es weiter, die Hebammen sollten sich nicht einmischen und die ihnen zugeteilten Kompetenzen nicht überschreiten.24 Ich war überrascht, wie ungeschönt unkollegial die Botschaft des Vortrags war, und gleichzeitig erschrocken von der Selbstverständlichkeit, mit der manche Ärzt*innen sich bis heute über alle anderen stellen. In der Zwischenzeit sind es die werdenden Eltern, die unter dem Machtkampf zwischen den beiden Berufsgruppen leiden, wie die Bundeselterninitiative Mother Hood in einer Stellungnahme betont.25 Ende 2019 fand eine Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages zum geplanten Hebammenreformgesetz statt, das laut Gesundheitsministerium den Hebammenberuf moderner und attraktiver machen soll. Neben verschiedenen Hebammenverbänden war auch Christian Albring als Sachverständiger eingeladen. Dass die Abgeordneten keine Fragen an diejenigen hatten, um die es gar nicht ging, und ihm zur Abwechslung keine Bühne gegeben wurde, schien ihn entrüstet zu haben. »(Es) wurde zwei Stunden lang fast ausschließlich den Vertreterinnen der Hebammenverbände Raum für ihre Statements gegeben, etwas anderes hat die Abgeordneten überhaupt nicht interessiert«,26 beschwert er sich in einer Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Das Gesetz wurde kurze Zeit später trotz Protest der gynäkologischen Berufsverbände verabschiedet, seit 2020 ist das Studium für Hebammen der neue Standard.
Pathologisierung und Paternalismus
Bis Frauen nach ihrer weitreichenden Vernichtung und Verdrängung durch die Hexenverfolgungen schließlich offiziellen Zugang zu Universitäten und damit zu institutionalisiertem Wissen hatten, vergingen mehrere Jahrhunderte. Hermine Heusler-Edenhuizen war eine dieser Frauen. 1899 durfte sie in Deutschland einen Hörsaal in Berlin betreten und wurde später die erste offiziell anerkannte Frauenärztin. Vom schwierigen Weg dorthin berichtet sie in ihren Lebenserinnerungen im Kampf um den ärztlichen Beruf der Frau. Als ihr mit Anfang zwanzig in einer Buchhandlung der feministische Aufsatz Was wir wollen von Helene Lange aus der damaligen Frauenbewegung in die Hände fiel, wurde etwas in ihr angestoßen. »Mir war nie der Gedanke gekommen, daß diese herrschende Anschauung der Superiorität des Mannes falsch sein könnte«,27 schreibt sie. An diesem Tag beschließt sie, Ärztin zu werden, um sich und ihrem Umfeld zu beweisen, dass Frauen es können. Der Besuch der nötigen privaten Gymnasialkurse war möglich, weil sie als Arzttochter sozial und finanziell sehr privilegiert war. Heusler-Edenhuizen war sich schmerzlich bewusst, dass ein persönliches Scheitern als Beweis für die Unfähigkeit ihres ganzen Geschlechts ausgelegt werden könnte. »Zur Zeit, in der dies alles spielte, hielt man die Frau ernsthaft für geistig minderwertig. Nach der Theorie eines Professors Bischof sei ihr Gehirn zu klein und im Gewicht zu leicht, wobei ein Männerhirn als Norm hingestellt wurde.«27 Immer wieder wurden solche biologistischen Vorurteile besonders von Medizinern verbreitet und »die Gefahr des Frauenstudiums« für die Gesellschaft betont. Der Neurologe Paul Möbius schrieb sogar ein ganzes Buch, Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes, in dem es heißt: »Gelehrte Frauen sind Ergebnisse der Entartung.«28
Frauen sollten in ihrer gesellschaftlichen Rolle, die darin bestand, Kinder zu gebären und aufzuziehen, gehalten werden, und nicht zu eigenem Denken und Bildung ermutigt werden. Als Instrument hierzu diente die männlich geprägte Medizin, die absurde Theorien aufstellte und Krankheiten erfand. Mutmaßungen und Mythen über den weiblichen Körper wurden als medizinische Wahrheiten gehandelt, um die Kontrolle über reproduktionsfähige Körper auszuüben.12 Ärzte stellten im 19. Jahrhundert die oben erwähnte Theorie der »Energieerhaltung« auf, nach der alle Organe des menschlichen Körpers um zirkulierende Energie kämpfen müssen. »Ärzte (...) zogen daraus sehr schnell die Konsequenz, dass höhere Bildung für Frauen physisch schädlich sein könnte. Eine zu starke Entwicklung des Denkvermögens, so rieten sie, würde den Uterus schrumpfen lassen.«29 Die Paternalisierung und Pathologisierung von weiblich verorteten Menschen wurde so von Ärzten auf ein pseudowissenschaftliches Fundament gestellt. Als Frauen begannen, ihre Position an europäischen Universitäten einzufordern, wurden die pseudomedizinischen Theorien, die sie davon abhalten sollten, noch abenteuerlicher und vehementer. Es gab die Theorie, Lesen und Lernen könnte die Eierstöcke reizen und die Frau krank machen, dazu unfruchtbar und »hysterisch«, nach der griechischen Bezeichnung »hystéra« für den Uterus.12 Aber schon immer gab es kluge Köpfe, die sich die Pathologien des Patriarchats nicht andichten lassen wollten. Mary Putnam Jacobi, eine der ersten Ärztinnen der USA, setzte sich ihr Leben lang gegen solche medizinbasierte Misogynie ein. 1876 widerlegte sie – im Gegensatz zu ihren männlichen Konkurrenten mithilfe wissenschaftlicher Methoden – die These, dass die Menstruation Frauen schwächt und daher unfähig zu studieren macht.12 Viele der Annahmen über die Körper von Menschen mit Uterus, die sich leider bis heute halten, beruhen auf diesen frühen Mythen der »Hysterie« und Anfälligkeit. Das zeigte sich, als im Jahr 2021 vermehrt menstruierende Menschen über eine veränderte Periode nach einer Covid-Impfung in den sozialen Medien berichteten. So schrieb etwa der trans* Mann Linus Giese von der schmerzlichen Rückkehr seiner Periode nach drei Jahren Testosterontherapie, die die Blutungen eigentlich unterdrückt.30 Während sich online auch von anderen die Berichte über ein plötzliches »Blutbad« oder sogar das Wiederauftreten von Blutungen nach den Wechseljahren häuften, wurden diese Berichte von der Fachwelt lang nicht ernst genommen.31 Ein führender Gynäkologe sagte sogar, es würde nur zu verstärkten Periodenblutungen kommen, weil Frauen vor der Impfung so aufgeregt seien.32 Die Jahrhunderte der »fachlich fundierten« Frauenverachtung und medizinischer Missbilligung von Menschen mit Uterus lassen grüßen. Der Mann, der hinter diesem Unsinn steckt, ist uns schon einmal in diesem Kapitel begegnet: Es handelt sich auch hier um den Präsidenten des Berufsverbands der Frauenärzte, Christian Albring. Inzwischen haben verschiedene Studien Zyklusveränderungen als Nebenwirkung von Covid-Impfungen bestätigt.-36
Menschen nicht ernst zu nehmen, vor allem alle nichtcis-männlichen Menschen, ist seit jeher integraler Bestandteil der Medizin. Als Ärzt*innen wird uns beigebracht, dass wir die Deutungshoheit über die Körper anderer haben. Das geschieht inzwischen weniger explizit als zu Zeiten der Entstehung »moderner« Medizin, ist aber heute nicht weniger gefährlich oder gruselig. Wie die Erziehungswissenschaftlerin Houda Hallal erklärt, gibt es eine Art versteckten Lehrplan, der Medizinstudierenden beibringt, sich in das hierarchische System einzufügen und um jeden Preis Autorität gegenüber Patient*innen auszustrahlen.37 Oft gilt in der Medizin: Fehlerkultur – Fehlanzeige. Als Ärzt*innen lernen wir nicht, zu sagen, »Wir wissen (noch) nicht, was ihnen fehlt. Alle Tests, die (bisher) existieren, blieben ergebnislos.« Stattdessen sagen wir – auch um die Scham über unser eigenes Unwissen zu vertuschen: »Wir können nichts finden, was Ihnen fehlt, Sie müssen sich das Ganze wohl eingebildet haben.« Wie schmerzhaft und schlimm dieses »Medical Gaslighting«, also das Absprechen und Verharmlosen von Symptomen, sein kann, erfahre ich eindrücklich, seit ich durch meine Infektion mit dem Coronavirus selbst Patient*in wurde. Wir seien doch alle mal erschöpft, wurde mir von einer medizinischen Fachangestellten gesagt, als ich von meiner Fatigue, der extremen Erschöpfung nach kleinsten Anstrengungen, berichtete. Ich solle mich eben einfach entspannen, meinte ein Vertretungsarzt, dem ich von Kurzatmigkeit in der Akutphase meiner Infektion erzählte, schließlich schien kein Test auf einen Sauerstoffmangel hinzuweisen. Dass ich vor körperlicher Schwäche anfangs die Wohnung nicht mehr verlassen konnte, wurde auf eine angebliche Depression geschoben, und ich wurde bei meinem ersten Reha-Aufenthalt in eine psychologische Abteilung geschickt. Ich müsste mich nur etwas anstrengen, und Sport würde mir guttun, hieß es von verschiedenen Ärzt*innen und Physiotherapeut*innen. Dabei hatte ich längst die Erfahrung gemacht, dass körperliche Anstrengung meine Symptome extrem verschlechterte, dass ich also unter Post Exertional Malaise litt, nur leider kannte mein Behandlungsteam dieses für das Fatigue- Syndrom typische Phänomen nicht. Immer wieder wurde von medizinischem Personal suggeriert, ich solle mich doch nicht so anstellen, ich solle nicht simulieren. Es geht eben nicht um die Patient*innen, es geht ums patriarchale Prinzip. Oft war ich von der Erkrankung zu erschöpft, um mich zu wehren, denn selbst ohne Medical Gaslighting ist die Auseinandersetzung mit dem Gesundheitssystem kräftezehrend, jedes Formular, jeder Fragebogen, jedes Telefonat eine Strapaze. Und allzu selbstbestimmt aufzutreten, war riskant, denn mir wurde schmerzlich bewusst, wie ausgeliefert ich dem medizinischen System als Patient*in bin. Wer es in der Hand hat, wie meine Zukunft aussieht – gesundheitlich, finanziell, beruflich -, das ist die Sachbearbeiterin der Berufsgenossenschaft, das ist der Gutachter des Medizinischen Dienstes, das ist die Sekretärin der Ambulanz Terminvergabe, das sind vor allem aber die Ärzt*innen, in deren Hände ich mich begebe. Ihr Urteil, ihre Diagnose, ihr Verständnis kann den Unterschied bedeuten, ob ich mich mit meinem Körper versöhnen kann, ob ich Anrecht auf Ausgleichszahlungen und vor allem Zugang zu adäquater medizinischer Versorgung habe. Menschen, die ich vorher nicht kannte, wissen nun detailliert alles, was ich gezwungen war, ihnen offenzulegen, sie kennen meine Krankengeschichte besser als meine (Wahl-)Familie. Inzwischen weiß ich aus Selbsthilfegruppen und Studien, dass ich mit diesen Erfahrungen und Empfindungen nicht allein bin.38





























